HANDREICHUNG FÜR LEHRKRÄFTE
|
|
|
- Ulrich Bieber
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HANDREICHUNG FÜR LEHRKRÄFTE
2 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 1/9 Bis Ende 2004 mussten alle EG-Mitgliedstaaten gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) den Zustand ihrer Gewässer erfassen und bis Ende März 2005 an die Europäische Kommission melden. Diese Bestandsaufnahme musste unter anderem für alle oberirdischen Gewässer, das heißt auch für Flüsse durchgeführt werden. Aufgrund dieser Bestandsaufnahme wurden Überwachungsprogramme erstellt. Mit Hilfe der Überwachungsergebnisse werden alle Flüsse in bestimmte Gewässerzustandsklassen eingeordnet. Wenn die Flüsse noch keinen guten Zustand haben, wie von der WRRL gefordert, muss über Maßnahmen entschieden werden, um den Gewässerzustand zu verbessern. Dazu gehört nicht nur die chemische Qualität der Flüsse, also deren Schadstoffbelastung, sondern vor allem auch die in den Flüssen lebenden Tiere und Pflanzen, deren Lebensraum wieder so natürlich wie möglich werden soll. Die WRRL betrachtet Fließgewässer unter neuen Gesichtspunkten. Nicht mehr die Grenzen von Bundesländern oder Staaten, sondern Flusseinzugsgebiete spielen die wesentliche Rolle. Das bedeutet eine ganzheitliche Betrachtung der natürlichen Gewässersysteme und ihrer Nutzung von der Quelle bis zur Mündung. Über den Wasserkreislauf sind Flüsse mit dem Grundwasser verbunden. Flüsse lassen bei Hochwasser den Grundwasserspiegel ansteigen, bei Niedrigwasser werden sie aber auch durch Grundwasser gespeist. Grundwasser ist unser wichtigstes Trinkwasserreservoir, so dass sein Schutz ebenfalls zu den Zielen der WRRL gehört. HINWEIS Das Infoblatt 1 stellt Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern die wesentlichen Inhalte und Zielsetzungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie vor. Die EG-Richtlinie verfolgt das Ziel, den Begriff der Nachhaltigkeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft zu konkretisieren. Mit der EG-WRRL wird angestrebt, bis zum Jahr 2015 eine gute Gewässerqualität zu erreichen. Unter diesem Begriff ist im Sinne der Nachhaltigkeit nicht mehr nur die chemische und biologische Qualität des Wassers zu verstehen, sondern auch der Zustand des gesamten Gewässers mit Sohle, Ufer und angrenzenden Auen und allen Nebengewässern des gesamten Einzugsgebietes. Der Gewässerschutz als gesetzlicher Auftrag umfasst im Wesentlichen die Verbesserung der Wasserqualität durch eine Verbesserung der Abwasserbeseitigung auf kommunaler und privater Ebene und die Verringerung des Stoffeintrages aus der Flächenbewirtschaftung (Landwirtschaft, aber auch Kleingärten u. a.). Dazu soll eine Revitalisierung der Fließgewässer sowie des Gewässerumfeldes erfolgen. Naturnahe Unterhaltungs- und Rückbaumaßnahmen, die eine natürliche Entwicklung fördern, sowie die Anlage von Uferschonstreifen entlang der Bach- und Flussläufe sind hierfür begleitende Maßnahmen. So wird es möglich, Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten und wiederherzustellen. Gewässerschutz ist jedoch nicht nur eine staatliche Aufgabe. Jeder Bürger kann sich daran beteiligen. Hierzu können z. B. Patenschaften über einzelne Gewässer oder Gewässerabschnitte übernommen werden. In einigen Bundesländern existieren auch so genannte Gewässernachbarschaften, wo sich engagierte Bürger und fachkundige Personen gemeinsam um die Gewässerpflege kümmern. Anhand der Auseinandersetzung mit den Zielen der EG-WRRL können somit Inhalte einer Bildung für Nachhaltigkeit an dem konkreten Beispiel Gewässerschutz für die Schülerinnen und Schüler erfahrbar gemacht werden
3 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 2/9 ZIEL Mit dem Set 1 Lebendige Flüsse des Unterrichtsmoduls Wasser wird aufgezeigt, wie wichtig die Beziehung des Menschen zu den Flüssen, an denen er siedelt, ist. Es werden die wechselseitigen Einflüsse und deren ökologische Konflikte dargestellt und bearbeitet. Hierzu gehören die Themen Abwasser/Wassergefährdung sowie Hochwasser und der Zusammenhang mit dem unzureichenden morphologischen Zustand (Ausbau, Verbau, Versiegelung) von Flussgebieten. Die Schülerinnen und Schüler können am Ende der Unterrichtseinheit eine Renaturierung durchspielen, die den Anforderungen aus den drei Bereichen Nutzung, Wasserqualität und morphologische Qualität entspricht. Die Schülerinnen und Schüler lernen in Bezug auf scientific literacy ihr naturwissenschaftlich erworbenes Wissen zum Themenkreis Wasser anzuwenden, erkennen die naturwissenschaftliche Problemstellung (Gefährdung von Flüssen, Gefährdung durch Flüsse) und können aus diesem erarbeiteten Wissen Schlussfolgerungen ziehen, um daraus auch Entscheidungen für ihr eigenes alltägliches Handeln zu treffen. LEHRPLANANBINDUNG Wasser als Lebensgrundlage Einblick in Auswirkungen von Eingriffen in den Naturhaushalt: Wasserhaushalt, Grundwasser, Grundwasserabsenkung, Neulandgewinnung, Versteppung, Vernässung, Versalzung Wasser, ein ungewöhnlicher Stoff, Bedeutung für Leben und Umwelt Wasser im Haushalt: Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser Wasser und Abwasser (Trinkwassergewinnung und Abwasserreinigung) Umweltschutz in der Gemeinde: u. a. Umgang mit dem Wasserverbrauch, Wassergewinnung Wasser für die Industriegesellschaft: Wasserverbrauch und -belastung durch Industrie und Haushalt, Flächenversiegelung und Grundwasserabsenkung Flüsse als Lebensraum von Tieren und Pflanzen, Artenvielfalt, Nahrungskette und Nahrungsnetz Menschen verändern ihre Umwelt: Probleme: Bodenerosion, Abholzung, Hochwassergefähr - dung Wasserwirtschaft: Wasserressourcen, -aufbereitung/gewässerbelastung und Reinhaltung des Wassers Verschiedene Methoden der Wasseraufbereitung (z. B. Kläranlage, Pflanzenkläranlage) Hochwasser eine Gefährdung für den Menschen Renaturierung von Flüssen eine Lösung für das Problem Hochwasser? METHODEN Handlungs- und problemorientierter fachübergreifender Unterricht, selbsttätiges Lernen in arbeitsteiliger und arbeitsgleicher Gruppenarbeit Alters-/Klassenstufe: 8. bis 10. Schuljahr Fächer: Geografie, Biologie, Chemie, Mathematik, Sozialkunde, Politik 45 45
4 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 3/9 INHALTE UND INHALTLICHE LERNZIELE Die Schülerinnen und Schüler erkunden zunächst, wie wichtig die Bedeutung von Flüssen für den Menschen ist. Sie lernen, dass Flussläufe Siedlungs- und Wirtschaftsräume sind. Flüsse liefern Trink- und Nutzwasser, Nahrung, sind Transportweg und vieles mehr. Es werden die wechselseitigen Einflüsse zwischen Mensch und Fluss und deren ökologische Konflikte aufgezeigt und bearbeitet. Hierzu gehören v. a. das Thema Hochwasser, das in den letzten Jahren besondere Aktualität bekommen hat, und der Zusammenhang mit dem unzureichenden morphologischen Zustand (Ausbau, Verbau, Versiegelung) von Flussgebieten. Die Schülerinnen und Schüler lernen Lösungsmöglichkeiten für diese Problematik kennen und erfahren den Stellenwert von Renaturierungsmaßnahmen, die den Anforderungen aus den drei Bereichen Nutzung, Wasserqualität und morphologische Qualität entspricht. Lernziele in Bezug auf die Gestaltungskompetenz/Schlüsselkompetenzen der OECD Die Schülerinnen und Schüler lernen ihr naturwissenschaftlich erworbenes Wissen zum Themenkreis Flüsse anzuwenden, erkennen die naturwissenschaftliche Problemstellung (Gefährdung von Flüssen, Gefährdung durch Flüsse) und können aus diesem erarbeiteten Wissen Schlussfolgerungen ziehen, um daraus auch Entscheidungen für ihr eigenes alltägliches Handeln zu treffen. Folgende Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz werden angesprochen: Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können: Fachübergreifende Aneignung der Thematik, Problem und Lösung. Die Schülerinnen und Schüler verbinden naturwissenschaftliches Arbeiten mit einer Problemstellung, problemorientierte Verknüpfung von innovativem technischem Wissen und Planungsstrategie Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (Gruppenarbeit) Sich motivieren können, aktiv zu werden (Transferphase) Andere motivieren können, aktiv zu werden (Transferphase) Selbstständig planen und handeln können (Gruppenarbeit) VERLAUFSVORSCHLAG Erste Arbeitsphase Flüsse als Lebensadern Arbeitsblatt 1: Als Einstieg in die Thematik führt man mit den Schülerinnen und Schülern zunächst ein gemeinsames Brainstorming zur Bedeutung und zum Nutzen von Flüssen durch. Die Schülerinnen und Schüler sammeln Aspekte der Bedeutung von Flüssen für den Menschen. Liegt die Stadt/Gemeinde, in der die Schülerinnen und Schüler leben, an einem Fluss, ist es auch möglich, hier eine kurze Ortsbegehung und eventuell eine Passantenbefragung nach dem Nutzen unseres Flusses durchzuführen. Auch verschiedene Ämter könnten hierzu angesprochen werden. Die Ergebnisse werden in Gruppenarbeit gesammelt, einander in der Klasse vorgestellt, dokumentiert (z. B. durch Sammelordner, Poster, Wandzeitung) und später miteinander verglichen. Zweite Arbeitsphase mit Vertiefung Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung Arbeitsblatt 2 (Gruppenarbeit): Es werden Arbeitsgruppen aus 2 bis 3 Schülern gebildet und die Arbeitsaufträge von Arbeitsblatt 2 bearbeitet. Eventuell bietet sich hier eine arbeitsteilige Gruppenarbeit an, so dass die Schülerinnen und Schüler sich jeweils mit unterschiedlichen Begriffen auseinandersetzen. Zur Informationssuche 46 46
5 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 4/9 müssen Schulbücher und Informationsblätter zur Thematik für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Die weiteren Arbeitsaufträge des Arbeitsblatts werden erst nach Vorstellung der Ergebnisse aus Arbeitsauftrag 1 bearbeitet. Danach werden die weiteren Ergebnisse besprochen und ausgewertet und eventuell in der Wandzeitung (oder in einem Sammelhefter, den die Schülerinnen und Schüler zu diesem Thema anlegen) dokumentiert. Dritte Arbeitsphase Problematik der Hochwassergefahr Arbeitsblatt 3 (Gruppenarbeit): Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen eingeteilt und bearbeiten gemeinsam die Arbeitsaufträge des dritten Arbeitsblattes. Dabei ist es wichtig, sie darauf hinzuweisen, wo und wie sie Informationen finden können. Gegebenenfalls kann man in einer Vorbesprechung die Schülerinnen und Schüler selbst kurz Recherchemöglichkeiten sammeln lassen (z. B. zuständige Behörden wie Umweltamt bzw. Untere Naturschutzbehörde oder Wasserwirtschaftsamt ansprechen, NGOs aufsuchen, Internetsuche, Bibliothek etc.). Arbeitsauftrag 3 lässt sich evt. aufteilen, so dass jede Gruppe eine spezielle Möglichkeit des Hochwasserschutzes recherchiert und vorstellt. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden dokumentiert und gemeinsam ausgewertet. Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler sollten auch darauf hingewiesen werden, dass es in Deutschland planerische Instrumente wie die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, die Erstellung von Hochwassergefährdungskarten etc. gibt, die bei den Behörden vor Ort eingesehen werden können. Weitere Informationen zum Thema Was können Landschaftsplanung, Naturschutz und Landschaftspflege zum vorbeugenden Hochwasserschutz beitragen? : wwwww.lfu.bayern.de/natur > Wasser > Fachinformationen > Hochwasser Vierte Arbeitsphase Fließgewässerausbau und Renaturierung Arbeitsblatt 4, Infoblatt 1: Im vierten Arbeitsblatt setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Problem des technischen Ausbaus von Fließgewässern (Verrohrung, Kanalisierung, Befestigungen etc.) und dessen Folgen auseinander. Nach der Frage: Was bringt uns der Fluss?, sollte gefragt werden: Wie haben wir den Fluss verändert? Die menschlichen Nutzungen erforderten zahlreiche Eingriffe in das Flusssystem, was z. B. zur Veränderung des natürlichen Abflussregimes und zu fehlender Durchgängigkeit führte. Dadurch wurde die Funktion als Lebensader für den Naturhaushalt erheblich eingeschränkt. Die bei einem natürlichen Flussregime bestehende Artenvielfalt geht verloren. Um den Schülerinnen und Schülern das Problem deutlich vor Augen zu führen, bietet sich an dieser Stelle eine Ortsbegehung an einem größeren Bach oder an einem Fluss an. Das Infoblatt 2 bietet einen Überblick über die wesentlichen Merkmale eines guten ökologischen Gewässerzustands. Wichtig ist hierbei, dass die Schüler ein Begehungsprotokoll anlegen, in dem sie alles notieren, was ihnen in Bezug auf mögliche Eingriffe des Menschen im und am Fluss auffällt. Anschließend sollen sie in dem Protokoll ihre Beobachtungen bewerten und Vorschläge machen, ob und wie man gegebenenfalls die Situation vor Ort verbessern kann. Die Ergebnisse werden gemeinsam ausgewertet. Nach Möglichkeit sollten sie ihre Ergebnisse einem Gemeindevertreter, Bürgermeister, zuständigen Amt oder einer ortsansässigen NGO vorstellen. Vielleicht lässt sich hier sogar ein gemeinsames Projekt zur Renaturierung initiieren. Arbeitsblatt 5, Durchgängigkeit von Fließgewässern: Im letzten Arbeitsblatt lernen die Schülerinnen und Schüler, dass insbesondere bei Fließgewässern eine ganzheitliche Betrachtung vonnöten ist. Die meisten der in Europa heimischen Flussfischarten sind Wanderer. Vor allem die Arten, die Laichwanderungen durchführen, sind von der Durchgängigkeit ihres Flusses und dessen Vernetzung mit allen erforderlichen Teillebensräumen abhängig. Daher braucht es für die Erhaltung der Fischfauna nebst sauberem Wasser auch reich strukturierte, vielfältige und für Fische durchwanderbare Gewässerbiotope. Der Rückgang der Fischbestände in 47 47
6 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 5/9 den Flüssen und Bächen ist auch auf die stellenweise intensive Verbauung der Fließgewässer zurückzuführen. Stauwehre, Wasserkraftwerke und Schleusen haben die freie Fischwanderung unterbrochen. Da diese Hindernisse von wandernden Fischen nicht überwunden werden können, muss die Blockade der Wanderwege über gut funktionierende Umgehungen, so genannte Fischaufstiegsanlagen ( Fischtreppen ) gemildert werden. Anhand dieser Problematik lässt sich trefflich über das Thema Ökonomie vs. Ökologie diskutieren. Was ist zum Beispiel wichtiger, die Nutzung der Wasserkraft als eine der Erneuerbaren Energien oder der Schutz der Fische in den Flüssen? Wie das Beispiel der Fischaufstiegsanlagen zeigt, muss es nicht notwendigerweise zu einem Konflikt kommen. Das System der verschiedenen Fischwanderhilfen erlaubt es, Ökonomie und Ökologie zu vereinbaren, wenn auch zu einem gewissen Preis. Der Aus- bzw. Umbau von Wasserkraftanlagen beispielsweise ist sehr teuer. Will man aber die Fischbestände erhalten bzw. wieder ansiedeln, gibt es hierzu keine Alternativen. Bei einer Ortsbegehung an einem heimatlichen Fließgewässer können die Schülerinnen und Schüler erkunden, ob und welche Barrieren für wandernde Fischarten bestehen. Mögliche Fragestellungen sind: Bis wohin besteht Durchgängigkeit? Wo gibt es geeignete Laichplätze bzw. wie können sie wieder entstehen und wie können sie erreicht werden? Sind an Schleusen und Wasserkraftwerken funktionstüchtige Fischaufstiegsanlagen vorhanden? Wo muss nachgebessert werden? Erkundigungen können beim örtlichen Wasserwirtschaftsamt eingeholt werden. Auch Sportanglervereine sind häufig gut vertraut mit der Problematik und können mit Rat behilflich sein. Anmerkung/weiterer Transfer: Eventuell lässt sich das angesammelte Material der Unterrichtseinheit zu einer kleinen Ausstellung zusammenfügen und kann dann in der Schule/beim Schulfest, in anderen Klassen oder am Elternabend vorgestellt werden. Schließlich sind die Schülerinnen und Schüler nun Fachleute beim Thema Lebendige Flüsse! Weitere Bildungsmaterialien zum Thema Wasser finden Sie im Bildungsservice des Bundesumweltministeriums im Modul Umwelt und Gesundheit. Gewässeruntersuchungen: Im Literaturanhang finden Sie Hinweise zu Gewässeruntersuchungen. Ausführliche Informationen zur Bestimmung der Gewässergüte und weiterer relevanter Untersuchungen an Gewässern finden Sie auch im Bildungsservice des Bundesumweltministeriums ( beim Modul UMWELT und GESUNDHEIT SCHUTZ VON BADEGEWÄSSERN. MATERIALIEN Rahmenhandlung (Comicgeschichte) Arbeitsblätter 1 bis 5 Informationen für Lehrkräfte Infoblatt, Seite 1: Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie Infoblatt, Seiten 2 und 3: Was ist ein lebendiger Fluss? 48 48
7 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 6/9 LÖSUNGEN UND HINWEISE ZU DEN AUFGABEN AUF DEN ARBEITSBLÄTTERN Arbeitsblatt 1: zu Aufgabe 2: Freizeit/Naherholung, Transport/Verkehr, Trinkwasser/Brauchwasser, Abwasser, Landwirtschaft, Wohnwert zu Aufgabe 3: Fließgewässer als Lebensraum für Fische, andere Wassertiere und -pflanzen, Lebensraum Ufer, Ökosystem Flussaue Arbeitsblatt 2: zu Aufgabe 2: Trinkwasserbrunnen Wasseraufbereitung Zuleitung zu Industrie/Gewerbe und Haushalten Abwasserleitung zu und -aufbereitung in den Kläranlagen Einleitung des gereinigten Abwassers in den Fluss zu Aufgabe 3: Trinkwasser ist nach der Trinkwasserverordnung so beschaffen, dass bei lebenslangem Genuss die menschliche Gesundheit nicht beeinträchtigt wird (lebenslang ein Konsum von 2 bis 3 Litern pro Tag). Als Grauwasser bezeichnet man den Teil des Wassers, der zum Baden, Duschen und Waschen genutzt wird. Durch den Gebrauch wird Trinkwasser zu Grauwasser. Rohwasser ist das unbehandelte Wasser, das einer Anlage zur Trinkwasseraufbereitung zugeführt wird. zu Aufgabe 4: Energieaufwand, Chemikalieneinsatz (Chlor, Ozon, Fluor), Unterhaltungskosten, technischer Aufwand! Hinweis: Auf den Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen sollte an dieser Stelle auch verwiesen werden. Da dieses Thema bereits in den Lehrplänen und einschlägigen Schulbüchern angesprochen wird, ist es hier nicht gesondert aufgeführt. Weitere Informationen hierzu finden sich auch in den BMU-Bildungsmaterialien Bewertung von Badegewässern ( Arbeitsblatt 3: zu Aufgabe 1: Der Überschwemmungsbereich umschließt in der rechten Karte den Bereich, der auf der linken Karte mit Nebenarmen, Alt- und Totarmen gekennzeichnet ist. Hier sollte man nicht unbedingt bauen, da mit jährlichen Hochwassern zu rechnen ist. Hintergrund: Die Darstellung zeigt, dass die Mäander, Tot- und Altarme von einst verschwunden und diese Gebiete heute besiedelt sind. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Hochwassergefahr in dem Bereich auftritt, der auf der Karte von 1825 noch als Flussbereich gekennzeichnet ist. zu Aufgabe 2: Wasserwirtschaftsamt, Untere Naturschutzbehörde, Umweltamt zu Aufgabe 3: Zur Frage, was man gegen Hochwasser tun kann, sollte den Schülerinnen und Schülern deutlich werden, dass der Deichbau als Hochwasserschutzmaßnahme nicht die einzige Lösung ist. Vielmehr sind ökologische Maßnahmen wie natürliche Rückhaltung (Retentionsflächen) und Renaturierung zu nennen sowie die Minimierung des Schadenspotenzials im Überschwemmungsgebiet
8 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 7/9 Die wesentlichen Gründe für die Hochwasserproblematik 1. Die Menschen siedeln zu nah am Fluss, genau dort, wo der Fluss natürlicherweise bei Hochwasser über die Ufer tritt. 2. Besonders problematisch ist der Gewässerausbau, das heißt, die Begradigung von Bächen und Flüssen, die Befestigung der Ufer und das Ausbaggern der Flusssohle. Dadurch erhöht sich die Fließgeschwindigkeit und die Hochwasserwelle fließt schneller flussabwärts. So steigt die Hochwassergefährdung für die Unterlieger (Flussabwärts gelegene Siedlung). Es erfolgt eine Problemverlagerung. 3. Durch die intensive Besiedelung wird viel zu viel Boden im Einzugsgebiet mit Asphalt und Beton versiegelt, der Boden wird undurchlässig, das Regenwasser kann nicht mehr versickern, der Oberflächenabfluss erhöht sich. 4. Große Flächen entlang der Bäche und Flüsse werden intensiv als Ackerland genutzt. Das verfestigt den Boden und behindert die Versickerung des Wassers. Arbeitsblatt 4: zu Aufgabe 1a: linkes Bild; 1b: rechtes Bild zu Aufgabe 2: weitere Argumente: z. B. Siedlungsraum, Nachhaltigkeit, Flächenverbrauch, Nutzungseinschränkungen, Trinkwasser, Tier- und Pflanzenwelt Weitere Informationen: Vorsicht Hochwasser Zum Download unter: > Suche: Vorsicht Hochwasser Jeder cm zählt DVD und Begleitmaterial zum Thema Hochwasser vom Umweltamt Krefeld (sehr empfehlenswert!) Zum Download unter: Arbeitsblatt 5: zu Aufgabe 1: beim 1. Wasserkraftwerk und beim Wehr zu Aufgabe 2: Eine Möglichkeit wäre der Bau eines Umgehungsgerinnes, wie bei der Schleuse. Dazu noch verschiedene Formen von Fischaufstiegsanlagen, die bei den angegebenen Internetlinks dargestellt werden. Informationen zu Flussfischen in Mitteleuropa: > Tiere > Fische > Süßwasserfische Fischartenatlas (15 Euro), erhältlich bei: Bayerische Landesanstalt für Fischerei Weilheimer Str. 8a Starnberg Tel: 08151/ Exzellente Broschüre zum Thema Durchgängigkeit: Informationen des BMU zur Gewässerstruktur unter
9 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 8/9 Links Allgemeines Wasserwirtschaft in Deutschland (2 Bände) Broschüre Gewässerschutz Gute Trümpfe für die Wasserwirtschaft Broschüre Unser Wasser: Lebensmittel Rohstoff Kulturgut alles über Das Wasserlexikon Gewässerschutz allgemein Hochwasser UBA-Broschüre Hochwasser > Suche: Hochwasser Gewässerschutz und Flüsse > Unsere Flüsse > Lebendige Flüsse Wasser und Schule > Themen > Wasser Die EG-Wasserrahmenrichtlinie und ihre Umsetzung Wasser im Haushalt Tipps Die meisten Bundesländer haben über ihr Umweltministerium oder die nachgeordneten Fachbehörden ansprechende Informationsseiten. Ein Schnellzugriff auf alle Umweltministerien bietet: Weitere Recherchemöglichkeiten von Unterrichtsmaterialien zum Thema Wasser finden Sie in der Mediendatenbank H2O-Wissen. Diese ist über die UBA-Startseite aufzurufen. Die Homepage der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz. Hier kann man kostengünstig viele Infobroschüren bestellen, u. a. auch den sehr empfehlenswerten Band 64 von Martina Graw aus der Schriftenreihe des VDG (vgl. Literatur). Infomaterialien Literatur Ein Bach ist mehr als Wasser! 51 51
10 Ein Fluss ist mehr als Wasser Seite 9/9 Hessisches Ministerium für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Download oder zu bestellen unter: > Umwelt > Wasser > Flüsse und Seen > Unterrichtsmaterialien Schülergerechte Darstellung Jeder Tropfen zählt Hessisches Ministerium für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Broschüre DIN A 5, 32 Seiten Informationen zum Trinkwasser sparen. Mit Tests zum Wasserverbrauch und Methoden zur Bedarfsermittlung CD-ROM Bach-Land-Fluss zu bestellen unter: Mit Begleitheft Ökologische Bewertung von Fließgewässern Vereinigung Deutscher Gewässerschutz Schriftenreihe des VDG e.v., Band 64 Schön gestaltete und informative Broschüre Gewässergüteatlas der Bundesrepublik Deutschland Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Kulturbuch-Verlag, Berlin sowie Broschüren des Umweltbundesamtes zum Thema Wasser, zum Download oder zur Bestellung unter:
11 Lebensstil und Wasser Seite 1/9 Eine ausreichende Wasserversorgung zählt zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen. Jeder Mensch verbraucht täglich direkt (Trinkwasser) und indirekt (Nahrungsmittel, Industrieerzeugnisse) mehrere tausend Liter Süßwasser. Für Trinkwasser wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein täglicher Mindestbedarf von 100 Litern pro Kopf angenommen. Während die direkt verbrauchte Trinkwassermenge damit relativ gering ist, geht in die Nahrungsmittelproduktion erheblich mehr ein: Die Bewässerung von einem Hektar Land in Trockengebieten kann Kubikmeter (= 10 Millionen Liter) pro Jahr betragen. Die Landwirtschaft ist weltweit gesehen der größte Wassernutzer. In Ländern mit einem hohen Anteil an Bewässerungslandwirtschaft kann der Anteil der landwirtschaftlichen Wasserentnahme bei über 80 Prozent liegen. Derzeit lebt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in Ländern, die von mittlerem bis hohem bzw. eindeutig hohem Wasserstress betroffen sind. Im Jahr 2025 werden, laut Angaben des Internationalen Wassermanagement Instituts, zirka 40 Länder, in denen dann fast 2 Milliarden Menschen leben werden, von schwerer Wasserknappheit betroffen sein. Nur selten wird jedoch darüber nachgedacht, was die Menschen in den Industrieländern mit ihrem modernen Lebensstil indirekt an Wasser konsumieren. Dies übersteigt den direkten Verbrauch bei Weitem. Mit Kaffee, Orangensaft und vielen anderen landwirtschaftlichen Produkten wird so genanntes virtuelles Wasser importiert. Virtuelles Wasser ist ein relativ neuer Begriff und bezeichnet jenes Wasser, das zur Erzeugung eines Produkts aufgewendet wird. ZIEL Mit den Bildungsmaterialien zum Thema Lebensstil und Wasser sollen die Schülerinnen und Schüler Wissen zu den Themen Das Wasser der Erde (Arbeitsblatt 1), Wie viel Wasser braucht der Mensch? (Arbeitsblatt 2), Genug Wasser für Alle? (Arbeitsblatt 3), Am Angang war das Dorf... (Arbeitsblatt 4) eigenständig aufbauen, indem sie, ganz im Sinne der OECD-Kompetenzkategorie, interaktiv Medien und Mittel anwenden. Sie nutzen hierzu die Informationen aus den Arbeitsblättern und den Infoblättern, interpretieren thematische Karten und recherchieren im Internet weitere ergänzende Informationen zum Thema. In einem nächsten Schritt reflektieren sie ihren eigenen Lebensstil, indem sie zu dem weithin wenig bekannten Sachverhalt hingeführt werden, dass wir im reichen Norden durch virtuellen Wasserimport die Wasservorräte im armen Süden beeinflussen (Arbeitsblatt 5). Die Schülerinnen und Schüler sollen ihren eigenen Lebensstil anhand ausgewählter Produkte (Bananen, Kaffee, Orangensaft) dahingehend überprüfen, inwieweit sie ihren eigenen Anteil dazu beitragen, virtuelles Wasser aus dem Süden zu verbrauchen (Arbeitsblatt 6 und 7). Damit lernen sie in Bezug auf Scientific literacy ihr naturwissenschaftlich erworbenes Wissen zum Themenkreis Lebensstil und Wasser anzuwenden, erkennen die naturwissenschaftliche Problemstellung (Problemlagen, mögliche Lösungen) und können aus diesem erarbeiteten Wissen Schlussfolgerungen ziehen, um daraus auch Entscheidungen für ihr eigenes alltägliches Handeln zu treffen (OECD-Kompetenzbereich Eigenständiges Handeln )
12 Lebensstil und Wasser Seite 2/9 LEHRPLANANBINDUNG Wasser ein knapper Rohstoff: Verschwendung von Wasser in Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalten, Ursachen von Wasserknappheit, Abholzung und Erosion, Bodenversiegelung, Überweidung, Grundwasserausbeute Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (Luft, Wasser, Boden, Rohstoffe) Wasser als Lebensgrundlage und Lebensraum Wasser, ein ungewöhnlicher Stoff, Bedeutung für Leben und Umwelt Nationaler Wasserverbrauch und globale Wasserkrise Transnationale Probleme der Wasserversorgung und Gewässerbelastung METHODEN Handlungsorientierter fachübergreifender Unterricht, selbsttätiges Erarbeiten von Wissen durch Lernen an Stationen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit; Erarbeitung eines Referates, Präsentation; Gruppendiskussion; Szenariotechnik Alters-/Klassenstufe: 9. bis 10. Schuljahr Fächer: Biologie, Erdkunde, Mathematik, Physik, Sozialkunde, Ökologie, Politik und Wirtschaft, Gesellschaftslehre INHALTE Eine Rahmenhandlung mit den vier Protagonisten führt in das Thema ein. Die Schülerinnen und Schüler lernen zunächst etwas über die Verteilung des Wassers auf der Erde und wie gering der Anteil des für den Menschen zugänglichen Süßwassers ist (Arbeitsblatt 1). Sie informieren sich über Trinkwasser und erkunden anhand des sehr unterschiedlichen Wasserverbrauchs weltweit das Thema Lebensstil und Wasser (Arbeitsblatt 2). Der Zugang zu dieser wertvollen Ressource ist aus unterschiedlichen Gründen sehr ungleich verteilt, für die Zukunft ist zu erwarten, dass der Wassermangel weltweit noch zunehmen wird (Arbeitsblatt 3). Die Problematik der mangelnden sanitären Grundversorgung in vielen Ländern und ihre katastrophalen Folgen für die Gesundheit der Menschen werden im Arbeitsblatt 4 angesprochen. Ein wichtiger Aspekt der globalen Wassersituation ist der so genannte virtuelle Wasserimport in den Norden durch landwirtschaftliche Produkte des Südens, insbesondere auch aus Ländern, die bereits mit Wassermangel zu kämpfen haben. Arbeitsblatt 5 macht die Schülerinnen und Schüler mit diesem Thema bekannt. Sie erkunden, welche landwirtschaftlichen Produkte aus Ländern des Südens in Deutschland angeboten werden (Arbeitsblatt 6). Sie untersuchen mittels eines Ernährungsprotokolls am Beispiel ihres eigenen Lebensstils, wie viel virtuelles Wasser damit aus Ländern des Südens importiert wird. Häufig sind dies Länder, die Probleme mit der sicheren Wasserversorgung ihrer Bevölkerung haben (Arbeitsblatt 7). Abschließend erkunden die Schülerinnen und Schüler mögliche Alternativen zu den angesprochenen Problemlagen: Sie reflektieren ihr Kauf- und Konsumverhalten und suchen gegebenenfalls Möglichkeiten, es zu verändern. Zudem erörtern sie die Problematik in einer Wertediskussion. Hinweis Im Text wird häufiger der Terminus Wasserverbrauch verwendet. Streng genommen müsste es eigentlich Wasserbedarf bzw. Wassernutzung heißen. Da aber in den Schulbüchern und in der einschlägigen Literatur (v. a. im Internet) der Terminus Wasserverbrauch durchgehend verwendet 54 54
13 Lebensstil und Wasser Seite 3/9 wird und der Begriff den Schülerinnen und Schülern geläufiger sein dürfte, haben wir uns aus Gründen der besseren Verständlichkeit für den Terminus Wasserverbrauch entschieden. Es wird vorgeschlagen, die unterschiedliche Begriffsverwendung im Unterricht zu thematisieren, zum Beispiel als ein Einstieg in das Thema. Diskutieren Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern über die Verwendung der drei Begriffe, beispielsweise unter der Fragestellung, ob Wasser überhaupt verbraucht werden kann. Die beiden Infoblätter geben Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Themen Globale Wassersituation und Virtuelles Wasser. INHALTLICHE LERNZIELE Die Schülerinnen und Schüler sollen die Problematik in Bezug auf den hohen Wasserverbrauch durch unseren Lebensstil kennen und verstehen lernen und Ideen entwickeln, wie sie dieser Problematik begegnen können. Dabei sollen sie mit wichtigen Aspekten wie den unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten der einzelnen Länder zu Wasser und dem virtuellen Wasserimport vertraut gemacht werden. Eine kritische Reflexion ihres Lebensstils in Bezug auf Konsumverhalten soll zur Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen führen. Am Ende steht das Erstellen eines Ratgebers zum Thema Lebensstil und Wasser mit Hinweisen/Informationen zur globalen Wasserkrise und Tipps und Empfehlungen für das eigene Konsumverhalten (siehe auch Abschnitt Transferphase). Lernziele in Bezug auf die Gestaltungskompetenz/Schlüsselkompetenzen der OECD: Folgende Bereiche der OECD-Schlüsselkompetenzen bzw. Teilkompetenzen Gestaltungskompetenz werden angesprochen: Interaktive Anwendung von Medien und Tools: Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen: Die Schülerinnen und Schüler informieren sich eigenständig mit Hilfe unterschiedlicher Materialien und Medien zu dem Themenkreis Lebensstil und Wasser. Die Schülerinnen und Schüler stellen aufgrund von Perspektivübernahmen unterschiedliche Sichtweisen und Wissensformen über globale (nicht) nachhaltige Entwicklungen dar (virtuelles Wasser, Lebensstil). Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten fachübergreifend in einem Projekt, sie verbinden naturwissenschaftliches Arbeiten mit einer Problemstellung, verknüpfen innovatives technisches Wissen und Planungsstrategien. Vorausschauend denken und handeln können: Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Anzeichen der globalen Wasserkrise und erkennen die Konsequenzen. Gelerntes übertragen und anwenden: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Handlungsmöglichkeiten und Ideen, um die Situation zu verbessern. Interagieren in heterogenen Gruppen: Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (Gruppenarbeit) In Gruppenarbeit differente Standpunkte zur Nachhaltigkeit benennen und analysieren sowie in diesem Zusammenhang Kontroversen demokratisch austragen können (Diskussion) Andere motivieren können, aktiv zu werden (Ratgeber Wasser und Lebensstil erstellen und anderen vorstellen) 55 55
14 Lebensstil und Wasser Seite 4/9 Eigenständiges Handeln: Eigene Leitbilder und die anderer reflektieren (Arbeitsblätter 6 und 7; eigener Wasserverbrauch/eigenes Konsumverhalten) Erfahrungen mit selbstständiger Planung und selbstständigem Handeln nachweisen (Durchführung eines Projektes zur Nachhaltigkeit) Empathie und Solidarität für Benachteiligte, Arme, Schwache und Unterdrückte zeigen können (Situation/Problematik wasserarmer Länder erkennen, Verständnis entwickeln) ANREGUNGEN ZUM UNTERRICHTSVERLAUF Einstieg/Rahmenhandlung: Eine Comicstory zum Thema Lebensstil und Wasser mit den bekannten Figuren Viona, Manuel, Felix und Aysche. Transferphase: Die Schülerinnen und Schüler sammeln und diskutieren in Gruppen- oder in Partnerarbeit ihre Ergebnisse. Folgender Arbeitsauftrag wird hierfür gegeben: Überlegt gemeinsam, welche Möglichkeiten ihr habt, um den eigenen virtuellen Wasserkonsum zu vermindern. Sammelt eure Ideen. Welche findet ihr gut, welche weniger gut? Was spricht für, was spricht gegen die Umsetzung? Überlegt, wie ihr eure Ideen der Klasse vorstellen könnt. (vgl. Arbeitsblatt 7). Die Arbeitsergebnisse aus diesem Auftrag werden in der Klasse diskutiert. Hinweis Es wird angeregt, die Schülerinnen und Schüler einen Ratgeber mit Tipps zum alternativen Lebensstil/Konsumverhalten erstellen zu lassen, der über die Klasse hinaus Verbreitung finden kann. Durch die Erstellung des Ratgebers reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit und fokussieren erneut das Gelernte. Dazu sollten einige Punkte beachtet werden: Es geht nicht darum, dass den Lesern des Ratgebers ein allgemeiner Konsumverzicht gepredigt wird, sondern eher darum, auf die Konsequenzen des eigenen Handelns aufmerksam zu machen. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich daher bemühen, im Ratgeber kreative Lösungen anzubieten. In diesem Zusammenhang bietet es sich auch gut an, mit den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe der Szenariotechnik die Entwicklungen für die Zukunft aufzuzeigen. Hinweise zum Einsatz dieser Methode finden Sie im Lehrmaterial Klimawandel im Bildungsservice des Bundesumweltministeriums ( MATERIALIEN Arbeitsblätter 1 bis 7 Infoblätter 1 und 2 Handreichung für Lehrkräfte Stationenpass 56 56
15 Lebensstil und Wasser Seite 5/9 HINWEISE UND LÖSUNGEN ZU DEN ARBEITSBLÄTTERN Arbeitsblatt 1: zu Aufgabe 1: Als Süßwasser wird Wasser mit einem sehr geringen Salzgehalt bezeichnet (geringer als 1 g Salz/kg Wasser). zu Aufgabe 2: Der Anteil beträgt 0,3 Prozent. zu Aufgabe 3: Vorkommen von Süßwasser in fester Form als Eis in Gletschern und in Polkappen, dazu Eis und Schnee dauerhaft in Hochlagen der Gebirge bzw. periodisch im Flachland (Winter). Süßwasser in flüssiger Form in Oberflächengewässern wie Bäche, Flüsse und Seen und Wasser im Untergrund (Grundwasser). Auch in Wolken und im Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel). zu Aufgabe 4: Die erreichbaren Grundwasservorkommen weltweit für mehr als 70 Prozent verantwortlich und das Süßwasser in Oberflächengewässern; selten das Wasser im Niederschlag sowie Eis und Schnee. Arbeitsblatt 2: zu Aufgabe 1: Die beste Übersicht zu den Länderdaten findet sich im CIA Factbook (in Englisch, siehe Linkliste). zu Aufgabe 2: Das Referat wird als Wochenhausaufgabe aufgeben. Arbeitsblatt 3: Wasserknappheit und Wassermangel Nach der Definition besteht Wassermangel, wenn ein Land weniger als Kubikmeter sich erneuerndes Süßwasser pro Kopf und pro Jahr zur Verfügung hat. Dies ist beispielsweise in Vorderasien (Kuwait, Gazastreifen und Vereinigte Arabische Emirate) und in Nordafrika (Libyen und Algerien) der Fall. Saudi-Arabien hatte zum Beispiel im Jahr 2002 nur 118 Kubikmeter Wasser pro Kopf zur Verfügung. Es zählt damit zu den zehn wasserärmsten Ländern der Erde. Trotzdem haben 95 Prozent der Einwohner Saudi-Arabiens Zugang zu Trinkwasser. Denn das Land ist reich genug, um den Wassermangel durch Grundwasserbohrungen, Meerwasserentsalzung und Abwasseraufbereitung auszugleichen. Äthiopien im Vergleich gehörte mit Kubikmetern Wasser pro Kopf im Jahr 2002 zwar noch zu den Ländern mit ausreichender Wasserversorgung. Hier fehlt es jedoch an der nötigen Infrastruktur, um das vorhandene Wasser zu erschließen und zu verteilen. zu Aufgabe 1: Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler im Internet die naturräumliche und wirtschaftliche Situation der Regionen mit Wassermangel recherchieren. Information finden sich beim CIA Factbook: Quelle: MOLDEN, David (Hrsg.) (2007): Water for Food, Water for Life. Earthscan, London and International Water Management Colombo, S.63 Hinweis Der Klimawandel wird sich nach den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen wie folgt auswirken: Eine weitere Zunahme der globalen jährlichen Niederschläge, vor allem in höheren und mittleren geografischen Breiten und den meisten äquatorialen Regionen bei einer Abnahme in den Subtropen. Zunahme der Intensität der Niederschläge, der Niederschlag wird häufiger in Form von relativ kurzen heftigen Regengüssen fallen. Der Temperaturanstieg bedeutet auch, dass ein größerer Teil der Niederschläge in höheren geografischen Breiten im Winter statt als Schnee als Regen fallen wird. Weitere Informationen finden Sie in den Materialien zum Klimawandel im Bildungsservice des Bundesumweltministeriums
16 Lebensstil und Wasser Seite 6/9 Krieg um Wasser? Aus dem lokalen Problem Wassermangel ist mittlerweile ein globaler Konfliktfaktor geworden. Meldungen wie Im Nahen Osten tickt die Wasserbombe oder In Zukunft vermehrte Kriege um die Ressource Wasser befürchtet, finden sich vermehrt in den Medien. Im Internet finden sich hierzu eine Fülle von Information zu diesem Themenkreis. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer Suchmaschine recherchieren, Stichwort: Krieg ums Wasser. Sie finden Hinweise zum Thema, z. B. bei sueddeutsche.de, heute.de, spiegel.de/schulspiegel usw. Arbeitsblatt 4: zu Aufgabe 1: Grundelemente einer sanitären Grundversorgung sind Hygieneförderung, häusliche Sanitäreinrichtungen, Abwasserbehandlung zu Aufgabe 2: a) stimmt b) stimmt nicht c) stimmt nicht d) stimmt Solare Wasserdesinfektion Schweizer Wissenschaftler haben für den Einsatz in Entwicklungsländern eine Methode entwickelt, Trinkwasser zu entkeimen SODIS, die solare Trinkwasserdesinfektion. Die Methode verbessert die mikrobiologischen Qualität von Trinkwasser. Mit Hilfe der UV-A Strahlung des Sonnenlichts und erhöhter Wassertemperatur werden Durchfall erzeugende Krankheitserreger abgetötet. Mehr Informationen zu diesem interessanten Thema unter: Das Infoblatt 1 gibt Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern einen guten Überblick über das Thema Globale Wassersituation. Weitere Informationen finden sich in der Broschüre Wasser ist Leben der Deutschen Welthungerhilfe und auf der Weltkarte WeltWasser, die unter der -Adresse info@welthungerhilfe.de zu bestellen sind sowie beim IHP/HWRP-Sekretariat der Vereinten Nationen (Infoservice/Fakten zum Thema Wasser) Arbeitsblatt 5: Weitere ausführliche Informationen zum Thema virtuelles Wasser finden Sie auf dem Infoblatt 2. Arbeitsblatt 6: zu Aufgabe 1: Orangensaft aus Brasilien und den USA, Reis aus den USA, Vietnam, Thailand, Zitronen u. a. aus dem Nahen Osten, Tee aus Indien und Sri Lanka, Soja (Tierfutter) aus Brasilien und Argentinien, Bananen aus Kolumbien, Ekuador und Costa Rica, Südfrüchte aus afrikanischen Ländern und Brasilien, Kaffee aus Kolumbien, Nicaragua u. a. (Auswahl) zu Aufgabe 2: Nahezu jeder Supermarkt in Deutschland hält eine Fülle von Produkten aus Ländern der Tropen und Subtropen meist ganzjährig bereit. Dazu kommen im Winter noch saisonale Produkte wie Obst, Kartoffeln, Zwiebeln, die z. B. aus Ägypten (einem Land mit Wasserengpässen) nach Deutschland exportiert werden. Arbeitsblatt 7: zu Aufgabe 1: Eine Beispielrechnung für einen Monat, alle Werte sind Näherungen! 150 g Reis (450 Liter), 2 kg Bananen (2.000 Liter), 200 g Kaffee (4.000 Liter) oder 200 g schwarzer Tee 58 58
17 Lebensstil und Wasser Seite 7/9 (2.000 Liter), 4 l Orangensaft (3.400 Liter), g Fleisch = g Sojaschrot (2.250 Liter), 100 g Zitronen (100 Liter), 150 g Mais (200 Liter), 500 g Schokolade (4.050 Liter), 1 kg Südfrüchte (1.000 Liter) ergibt je nach Lebensstil und Konsumverhalten zirka bis Liter virtuelles Wasser pro Monat und in einem Jahr zirka bis Liter. Hinweis Fachleute legen ca l Wasser für die Produktion von 1 kg Fleisch zugrunde. Deutschland importiert praktisch kein Fleisch aus Ländern des Südens. In dieser Beispielrechnung werden aber nur Produkte aus Ländern des Südens (Entwicklungsländer) betrachtet. Allerdings müssen die Sojaimporte, die ein Bestandteil des Tierfutters sind, mit in die Rechnung eingehen. Nach mündlicher Auskunft des Deutschen Tierfutterverbandes sind im Tierfutter durchschnittlich mindestens 25 Prozent Soja enthalten, das überwiegend aus Argentinien, Brasilien und zum Teil aus den USA importiert wird. Für die Produktion von 1 kg Fleisch werden zirka 3 kg Tierfutter eingesetzt. Dies ist ein Durchschnittswert für alle Nutztiere von Geflügel (1:2) über die Schweinemast (1:3,5) bis zur Rindermast (1:4). zu Aufgabe 2: Für die Produktion von 1 kg Baumwolltextilien braucht es bis zu Liter Wasser (siehe Arbeitsblatt 5). Ein T-Shirt guter Qualität aus 100 Prozent Baumwolle wiegt ca. 250 Gramm. Hat man nur 10 davon im Schrank, sind das bereits Liter virtuelles Wasser! Darin ist noch nicht das Wasser enthalten, das für die Produktion, Färbung etc. des T-Shirts verbraucht wird. Die größten Produzenten von Baumwolle sind: China, USA, Indien, Pakistan, Brasilien und die Türkei. zu Aufgabe 3: Eine kleine Auswahl: Ein bewusster Konsum kann schon viel helfen. Weniger Kleidung kaufen, aber dafür mit höherer Qualität und Langlebigkeit, saisonale und regionale Lebensmittel bevorzugen, Fairtrade-Produkte bevorzugen usw. Die Schülerinnen und Schüler sollten in der Klasse auße eine Diskussion zum Thema Bewusster Konsum durchführen. zu Aufgabe 4: Möglichkeiten, um den eigenen virtuellen Wasserkonsum zu vermindern, u. a.: bewußtes Einkaufen, wie beispielsweise saisonale und regionale Produkte zu bevorzugen. Auch die Broschüre Nachhaltiger Konsum Wie sich unser Konsumverhalten auf den Rest der Welt auswirkt vom Zukunftsrat Hamburg hält einige interessante Informationen bereit: Hinweis Virtuelles Wasser befindet sich nicht nur in landwirtschaftlichen Produkten! Für die Herstellung eines PKW werden Liter virtuelles Wasser benötigt, für die Produktion eines Computers Liter. Informationen zum Thema, u. a. bei: Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler über die Vor- und Nachteile des virtuellen Wasserhandels diskutieren. Sollten Länder mit sehr begrenzten Wasserressourcen auf den Anbau von mengenmäßig bedeutsamen Grundnahrungsmitteln, wie z. B. Getreide, verzichten und diese lieber importieren, um ihre Ressourcen zu schonen? Aber wie sollen arme Länder das bezahlen? Ein Thema, das in der Fachwelt zurzeit sehr kontrovers diskutiert wird. Nutzen Sie für die Diskussion auch das Infoblatt 2: Virtuelles Wasser. Hinweis Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Wasser können in der H2O-Mediendatenbank des Umweltbundesamtes im Internet recherchiert werden:
18 Lebensstil und Wasser Seite 8/9 LINKLISTE ZUR RECHERCHE Arbeitsblatt 1: Das Wasser der Erde Aufgabe 1: > Lexikon Arbeitsblatt 2: Wie viel Wasser braucht der Mensch? Aufgabe 1: > Select a Country Aufgabe 2: Ein Wassertropfen auf Reisen: > Gut zu wissen Daten zu Entwicklung des Wasserbedarfs/Bevölkerungsanstieg/Täglicher Verbrauch finden sich unter: (Quelle: UNEP) (Quelle: UN) > Ausstellung Wasser ist Zukunft Woher kommt das Trinkwasser? Gut aufbereitete Informationen rund um das Thema Wasser (von der BUNDjugend) finden sich unter > Basics > Wasser Blaues Gold Krieg ums Trinkwasser: Bericht des Fernsehmagazins Monitor über die Probleme bei der geplanten Privatisierung der Wasserversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern Wasser und Entwicklungsländer Arbeitsblatt 3: Genug Wasser für alle? Aufgabe 3: > Modul Klimawandel > Patient Weltklima > Wasser-Krise > Klimawandel und Wasser Klimawandel und Wasser und /2695.pdf Informationen zu den Themen Wassermangel, Zugang zum Wasser, Wasserverbrauch u. a. > Wasser-Wissen > Themen > Umwelt & Landwirtschaft > Wasser ist kostbar 60 60
19 Lebensstil und Wasser Seite 9/9 Arbeitsblatt 4: Am Anfang war das Dorf... Informationen zur Problematik Sanitäre Grundversorgung und Armut: > Armut weltweit > Zahlen/Fakten > Suche: sanitäre Grundversorgung (eine private Homepage mit einer anschaulichen Beschreibung eines Hilfsprojektes des Kinderhilfswerks PLAN in Peru). informiert in englischer Sprache über die Situation weltweit und gibt Projektbeispiele zum Thema Sanitäre Grundversorgung. Arbeitsblätter 5 und 6: Virtuelles Wasser Arbeitsblatt 7: Virtuelles Wasser was verbrauche ich? Informationen über Produkte, produzierende Länder und Importmengen: Statistisches Bundesamt, Info-Service Außenhandelsstatistik oder über info-aussenhandel@destatis.de Hintergrundinformationen zum Thema Welthandel und virtuelles Wasser:
20 KOMPETENT FÜR DIE ZUKUNFT GESTALTUNGSKOMPETENZEN ERWERBEN Themenkomplex Wasser Seite 1/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Ziel modernen Lernens ist es, die Gesellschaft und das eigene Leben reflektiert, gut begründet, selbstbestimmt mit anderen gemeinsam gestalten zu können. Die Schule muss damit mehr leisten, als den Schülerinnen und Schülern beizubringen, in der Schule auf Anforderungen und im künftigen Leben auf Veränderungen bloß zu reagieren. Der Unterricht muss dazu dienen, Kompetenzen nicht nur für die Bewältigung der Zukunft, sondern auch für die selbsttätige Gestaltung der Zukunft zu erwerben. Fundamental ist daher der Erwerb von Kompetenzen, die sich nicht allein für die Bewältigung und selbstbestimmte Strukturierung des Alltags, sondern für die Gestaltung des Lebens in der Welt von morgen eignen. Es verwundert daher nicht, dass die Themen Erneuerbare Energien, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit, Wasser, die Nutzung von natürlichen Räumen, Abfälle und Wertstoffe sich als Unterrichtsgegenstände in modernen Lehr- und Rahmenplänen finden. Es sind wichtige Themen des heutigen Alltags und für die Gestaltung einer global lebenswerten Zukunft von zentraler Bedeutung. Reicht es aber aus, die genannten Themen nur auf die Stundentafel zu setzen? Welcher Anspruch wird an das Resultat des Lernens gestellt? Um dieses genauer zu klären, ist es sinnvoll, sich mit den Kompetenzen für die Gestaltung dieser Zukunft zu befassen. Nach einer Definition von F. E. Weinert bezeichnen Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (der willentlichen Steuerung von Handlungsabsichten und Handlungen unterliegenden; die Verf.) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Kompetenzen sind damit in erster Linie Handlungsbefähigungen, nicht ein abstraktes Schulwissen. Die Fähigkeit, Probleme lösen zu können wird dabei in engem Zusammenhang mit Normen, Wertvorstellungen, der Handlungsbereitschaft und selbstverständlich dem verfügbaren Wissen gesehen. Als Handlungsbefähigungen sind Kompetenzen an spezifische Gegenstände, Inhalte, Wissens- und Fähigkeitsbereiche gebunden. Kompetenzorientierte Bildungskonzepte sind am Output orientiert, während konventionelle Lehrpläne und didaktische Ansätze am Input orientiert sind: Letztere stellen die Frage, mit welchen Gegenständen sich die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sollen. Der Output-Ansatz hingegen fragt, über welche Problemlösungsstrategien, Handlungskonzepte und -fähigkeiten sie verfügen sollten. Erst von dort her bestimmt sich der Lerngegenstand. Er kann in gewissen Maßen abhängig gemacht werden von den Vorkenntnissen, Motivationen, lokalen wie individuellen Alltagsbezügen von Schülerinnen und Schülern und damit das Sachinteresse der Lernenden ebenso steigern wie einen Kompetenzerwerb, der nicht in der Anhäufung von trägem Wissen (Weinert) mündet. Über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, sozialen und kulturellen Orientierungen sollen Kinder und Jugendliche zur Bewältigung und Gestaltung ihrer Zukunft verfügen? Welches Wissen sollen sie gemeinsam teilen? Diese Fragen leiten die Suche nach Unterrichtsinhalten, wenn von den Kompetenzen her gedacht wird. Der unter dieser Prämisse denkbare Katalog ist außerordentlich groß. Dennoch lassen sich einige wenige übergreifende Bildungsziele ausmachen, die bei Auswahl von Lerngegenständen helfen. In einer für die OECD verfassten Studie werden die Menschenrechte, das Ziel, eine gelebte Demokratie praktizieren zu können und den Kriterien für eine nachhaltige soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung folgen zu können, genannt. Das Verfolgen der Menschenrechte, im Rahmen demokratischer Strukturen und im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu handeln, bezeichnet drei übergreifende Bildungsziele, die für die Bestimmung von Kompetenzen Leitlinien bilden. Diese Aussagen sind von einigem Gewicht. Denn schließlich zeichnet die OECD auch verantwortlich für die PISA-Studien; und 2006 werden die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den Naturwissenschaften erhoben
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache
 Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
Grünes Wahlprogramm in leichter Sprache Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Baden-Württemberg ist heute besser als früher. Baden-Württemberg ist modern. Und lebendig. Tragen wir Grünen die Verantwortung?
DOWNLOAD. Wasser auf der Erde und im Körper. Wasser als Lebensgrundlage. Dr. Astrid Wasmann-Frahm. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Dr. Astrid Wasmann-Frahm Wasser auf der Erde und im Körper Wasser als Lebensgrundlage auszug aus dem Originaltitel: Liebe Kollegin, lieber Kollege, Wasser ist Leben, sagt man und bringt so die
DOWNLOAD Dr. Astrid Wasmann-Frahm Wasser auf der Erde und im Körper Wasser als Lebensgrundlage auszug aus dem Originaltitel: Liebe Kollegin, lieber Kollege, Wasser ist Leben, sagt man und bringt so die
Wasser und Abwasser. 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers
 Wasser und Abwasser 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers Wer Durst hat, muss trinken. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und ohne Zufuhr von Süßwasser stirbt ein Mensch nach wenigen Tagen. Nicht
Wasser und Abwasser 1.Kapitel: Die Bedeutung des Wassers Wer Durst hat, muss trinken. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und ohne Zufuhr von Süßwasser stirbt ein Mensch nach wenigen Tagen. Nicht
Plakatarbeit von Paul d Avoine und Phil Happ
 Vorstellung der Projekte Plakatarbeit von Paul d Avoine und Phil Happ Virtuelles Wasser: Auf dem Plakat virtuelles Wasser haben wir den Schülern klar gemacht was virtuelles Wasser ist und welche Arten
Vorstellung der Projekte Plakatarbeit von Paul d Avoine und Phil Happ Virtuelles Wasser: Auf dem Plakat virtuelles Wasser haben wir den Schülern klar gemacht was virtuelles Wasser ist und welche Arten
Qualität und Verlässlichkeit Das verstehen die Deutschen unter Geschäftsmoral!
 Beitrag: 1:43 Minuten Anmoderationsvorschlag: Unseriöse Internetanbieter, falsch deklarierte Lebensmittel oder die jüngsten ADAC-Skandale. Solche Fälle mit einer doch eher fragwürdigen Geschäftsmoral gibt
Beitrag: 1:43 Minuten Anmoderationsvorschlag: Unseriöse Internetanbieter, falsch deklarierte Lebensmittel oder die jüngsten ADAC-Skandale. Solche Fälle mit einer doch eher fragwürdigen Geschäftsmoral gibt
Wasserkraft früher und heute!
 Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
Wasserkraft früher und heute! Wasserkraft leistet heute einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung in Österreich und auf der ganzen Welt. Aber war das schon immer so? Quelle: Elvina Schäfer, FOTOLIA In
I. Übersicht: Sachunterricht Bereich: Mensch und Gemeinschaft Lernaufgabe: Wünsche und Bedürfnisse reflektieren
 I. Übersicht: Sachunterricht Bereich: Mensch und Gemeinschaft Lernaufgabe: Wünsche und Bedürfnisse reflektieren Unterrichtsvorhaben: bestimmen unser Leben Methoden: Stuhlkreis Rollenspiel Sozialform: Gruppenarbeit
I. Übersicht: Sachunterricht Bereich: Mensch und Gemeinschaft Lernaufgabe: Wünsche und Bedürfnisse reflektieren Unterrichtsvorhaben: bestimmen unser Leben Methoden: Stuhlkreis Rollenspiel Sozialform: Gruppenarbeit
Weltwassertag. Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise. Den größten Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise kann leisten ein sparsamer Umgang mit
 Weltwassertag Datenbasis: 1.010 Befragte Erhebungszeitraum: 14. bis 16. März 2012 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: Wissenschaftsjahr 2012 Zukunftsprojekt Erde/BMBF Den größten
Weltwassertag Datenbasis: 1.010 Befragte Erhebungszeitraum: 14. bis 16. März 2012 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: Wissenschaftsjahr 2012 Zukunftsprojekt Erde/BMBF Den größten
Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck
 Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck Um Ähnlichkeiten und Unterschiede im CO2-Verbrauch zwischen unseren Ländern zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage zum CO2- Fußabdruck durchgeführt.
Auswertung des Fragebogens zum CO2-Fußabdruck Um Ähnlichkeiten und Unterschiede im CO2-Verbrauch zwischen unseren Ländern zu untersuchen, haben wir eine Online-Umfrage zum CO2- Fußabdruck durchgeführt.
DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
 DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG von Urs Schaffer Copyright by Urs Schaffer Schaffer Consulting GmbH Basel www.schaffer-consulting.ch Info@schaffer-consulting.ch Haben Sie gewusst dass... >
DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG von Urs Schaffer Copyright by Urs Schaffer Schaffer Consulting GmbH Basel www.schaffer-consulting.ch Info@schaffer-consulting.ch Haben Sie gewusst dass... >
Wald und Wasser. Wald und Wasser in Österreich. Lernziele: Materialien: Die SchülerInnen erfahren Österreichspezi sches zu den Themen Wald und Wasser.
 Wald und Wasser in Österreich Lernziele: Die SchülerInnen erfahren Österreichspezi sches zu den Themen Wald und Wasser. Materialien: Arbeitsblatt 1 (4 Seiten): Arbeitsblatt 2 (1 Seite): Overheadfolie 1
Wald und Wasser in Österreich Lernziele: Die SchülerInnen erfahren Österreichspezi sches zu den Themen Wald und Wasser. Materialien: Arbeitsblatt 1 (4 Seiten): Arbeitsblatt 2 (1 Seite): Overheadfolie 1
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen
 Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen Ein Leben ohne Strom ist undenkbar, denn im Alltag können wir kaum auf Strom verzichten. In dieser Unterrichtseinheit für eine Vertretungsstunde
Geht dir ein Licht auf? Grundkenntnisse zum Thema Strom und Stromsparen Ein Leben ohne Strom ist undenkbar, denn im Alltag können wir kaum auf Strom verzichten. In dieser Unterrichtseinheit für eine Vertretungsstunde
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Computer, Laptop, Handy - Was machen wir damit? Jahrgangsstufen 1/2 Stand: 13.12.2015 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht 5 Unterrichtseinheiten Liste mit verschiedenen Medien
Computer, Laptop, Handy - Was machen wir damit? Jahrgangsstufen 1/2 Stand: 13.12.2015 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Heimat- und Sachunterricht 5 Unterrichtseinheiten Liste mit verschiedenen Medien
Bildungsstandards konkret formulierte Lernergebnisse Kompetenzen innen bis zum Ende der 4. Schulstufe in Deutsch und Mathematik
 Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Auswertung der Feedbackergebnisse im Unterricht (Beispiel)
 Ein sauber strukturiertes Rückmeldegespräch mit den Schülern ist für den Erfolg und die weitere Beziehung zwischen Lehrer und Schüler äußerst wichtig und unbedingt erforderlich. Wenn dies nicht geschieht,
Ein sauber strukturiertes Rückmeldegespräch mit den Schülern ist für den Erfolg und die weitere Beziehung zwischen Lehrer und Schüler äußerst wichtig und unbedingt erforderlich. Wenn dies nicht geschieht,
Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
 #upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
#upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Papierverbrauch im Jahr 2000
 Hier findest du Forschertipps. Du kannst sie allein oder in der kleinen Gruppe mit anderen Kindern bearbeiten! Gestaltet ein leeres Blatt, schreibt Berichte oder entwerft ein Plakat. Sprecht euch in der
Hier findest du Forschertipps. Du kannst sie allein oder in der kleinen Gruppe mit anderen Kindern bearbeiten! Gestaltet ein leeres Blatt, schreibt Berichte oder entwerft ein Plakat. Sprecht euch in der
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation
 Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Lernerfolge sichern - Ein wichtiger Beitrag zu mehr Motivation Einführung Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche eigentlich in ihre Ausbildung? Wir haben zu dieser Frage einmal die Meinungen von Auszubildenden
Vorwissen der SuS erfassen. Positive/Negative Aspekte von Online-Spielen feststellen. Urteilsfähigkeit der SuS trainieren.
 Unterrichtsverlauf Zeit/ Unterrichtsinhalt U-Phase (Lehrer- und Schüleraktivitäten) Kompetenzerwerb/Ziele Arbeitsform und Methoden Medien und weitere Materialien Stundenthema: Online-Spiele und ihre Nachteile
Unterrichtsverlauf Zeit/ Unterrichtsinhalt U-Phase (Lehrer- und Schüleraktivitäten) Kompetenzerwerb/Ziele Arbeitsform und Methoden Medien und weitere Materialien Stundenthema: Online-Spiele und ihre Nachteile
Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen
 Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen Die EU und die einzelnen Mitglieds-Staaten bezahlen viel für die Unterstützung von ärmeren Ländern. Sie bezahlen mehr als die Hälfte des Geldes, das alle
Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen Die EU und die einzelnen Mitglieds-Staaten bezahlen viel für die Unterstützung von ärmeren Ländern. Sie bezahlen mehr als die Hälfte des Geldes, das alle
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Örtliche Angebots- und Teilhabeplanung im Landkreis Weilheim-Schongau
 Örtliche Angebots- und Teilhabeplanung im Landkreis Weilheim-Schongau Zusammenfassung der Ergebnisse in Leichter Sprache Timo Wissel Albrecht Rohrmann Timo Wissel / Albrecht Rohrmann: Örtliche Angebots-
Örtliche Angebots- und Teilhabeplanung im Landkreis Weilheim-Schongau Zusammenfassung der Ergebnisse in Leichter Sprache Timo Wissel Albrecht Rohrmann Timo Wissel / Albrecht Rohrmann: Örtliche Angebots-
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache
 Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
Für Ihre Zukunft! Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE im Bundes-Land Brandenburg vom Jahr 2014 bis für das Jahr 2020 in Leichter Sprache 1 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung: EFRE
Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern
 Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen bereits die meisten Kinder. Wo und wann aber wächst welches Obst und Gemüse? Woher kommen die Früchte, die
Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen bereits die meisten Kinder. Wo und wann aber wächst welches Obst und Gemüse? Woher kommen die Früchte, die
Zeit lässt sich nicht wie Geld für schlechte Zeiten zur Seite legen. Die Zeit vergeht egal, ob genutzt oder ungenutzt.
 Zeitmanagement Allgemeine Einleitung Wie oft haben Sie schon gehört Ich habe leider keine Zeit? Und wie oft haben Sie diesen Satz schon selbst gesagt? Wahrscheinlich nahezu jeden Tag. Dabei stimmt der
Zeitmanagement Allgemeine Einleitung Wie oft haben Sie schon gehört Ich habe leider keine Zeit? Und wie oft haben Sie diesen Satz schon selbst gesagt? Wahrscheinlich nahezu jeden Tag. Dabei stimmt der
Mach's grün! macht Schule
 Mach's grün! macht Schule Lehrmaterial für den Grundschulunterricht Thema: Papierorientierter Umweltschutz Überblick Unterrichtsfach Sachkunde Module 1. Rätsel 2. Papierschöpfen Kompetenzziele Umweltbewusstsein
Mach's grün! macht Schule Lehrmaterial für den Grundschulunterricht Thema: Papierorientierter Umweltschutz Überblick Unterrichtsfach Sachkunde Module 1. Rätsel 2. Papierschöpfen Kompetenzziele Umweltbewusstsein
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft
 Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft S. Mayer 1 Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft Sigrid Mayer Bene AG AT-Wien 2 Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft S. Mayer 11. Internationales Branchenforum
Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft S. Mayer 1 Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft Sigrid Mayer Bene AG AT-Wien 2 Neue Arbeitswelten Bürokultur der Zukunft S. Mayer 11. Internationales Branchenforum
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
I.O. BUSINESS. Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate
 I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Telefonieren ermöglicht die direkte Kommunikation
I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Effektive Vorbereitung aktiver Telefonate Telefonieren ermöglicht die direkte Kommunikation
Im Prüfungsteil Mündlicher Ausdruck sollen Sie zeigen, wie gut Sie Deutsch sprechen.
 Im Prüfungsteil Mündlicher Ausdruck sollen Sie zeigen, wie gut Sie Deutsch sprechen. Dieser Teil besteht aus insgesamt sieben Aufgaben, in denen Ihnen unterschiedliche Situationen aus dem Universitätsleben
Im Prüfungsteil Mündlicher Ausdruck sollen Sie zeigen, wie gut Sie Deutsch sprechen. Dieser Teil besteht aus insgesamt sieben Aufgaben, in denen Ihnen unterschiedliche Situationen aus dem Universitätsleben
Video-Thema Manuskript & Glossar
 DAS KIND ALS KONSUMENT Es gibt Forschungsinstitute, die die Wirkung von Werbung auf Kinder und Jugendliche untersuchen. Diese Zielgruppe kann 2009 insgesamt etwa 20 Milliarden Euro ausgeben. Marktforscherin
DAS KIND ALS KONSUMENT Es gibt Forschungsinstitute, die die Wirkung von Werbung auf Kinder und Jugendliche untersuchen. Diese Zielgruppe kann 2009 insgesamt etwa 20 Milliarden Euro ausgeben. Marktforscherin
Volkswirtschaftslehre
 Volkswirtschaftslehre Was ist Volkswirtschaftslehre? Bedürfnisse, Güter und Produktionsfaktoren Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit dem Problem der Knappheit. Knappheit und Tausch spielen in der
Volkswirtschaftslehre Was ist Volkswirtschaftslehre? Bedürfnisse, Güter und Produktionsfaktoren Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit dem Problem der Knappheit. Knappheit und Tausch spielen in der
Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft
 -1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
-1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
Hinweise für Lehrkräfte
 Ziele Die Lernstationen zu den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft sollen Ihre Schülerinnen und Schüler auf einen Besuch der Ausstellung Umdenken von der Natur lernen vom Goethe-Institut vorbereiten.
Ziele Die Lernstationen zu den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft sollen Ihre Schülerinnen und Schüler auf einen Besuch der Ausstellung Umdenken von der Natur lernen vom Goethe-Institut vorbereiten.
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
 Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Sozialberichterstattung NRW. Kurzanalyse 02/2010 09.07.2010 12.07.2010 Das Vermögen der privaten Haushalte in Nordrhein-Westfalen ein Überblick auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008
Didaktisierungsvorschläge zum Kalender. Jugend in Deutschland 2013. UNTERRICHTSENTWURF Juli. Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT
 Seite 1 von 8 Didaktisierungsvorschläge zum Kalender Jugend in Deutschland 2013 UNTERRICHTSENTWURF Juli Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT - Unterrichtsvorschläge und Arbeitsblätter - Abkürzungen
Seite 1 von 8 Didaktisierungsvorschläge zum Kalender Jugend in Deutschland 2013 UNTERRICHTSENTWURF Juli Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT - Unterrichtsvorschläge und Arbeitsblätter - Abkürzungen
2.1 Präsentieren wozu eigentlich?
 2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht
 Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das
von: Oktay Arslan Kathrin Steiner Tamara Hänggi Marco Schweizer GIB-Liestal Mühlemattstrasse 34 4410 Liestal ATG
 von: Oktay Arslan Kathrin Steiner Tamara Hänggi Marco Schweizer GIB-Liestal Mühlemattstrasse 34 4410 Liestal ATG 20.03.2009 1 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung S. 3 2. Aufgabestellung S. 3 3. Lösungsansätze
von: Oktay Arslan Kathrin Steiner Tamara Hänggi Marco Schweizer GIB-Liestal Mühlemattstrasse 34 4410 Liestal ATG 20.03.2009 1 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung S. 3 2. Aufgabestellung S. 3 3. Lösungsansätze
Änderungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ab 1. Januar 2015.
 Änderungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ab 1. Januar 2015. In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sind zum 1. Januar 2015 einige Änderungen in Kraft getreten. Neu ist
Änderungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ab 1. Januar 2015. In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sind zum 1. Januar 2015 einige Änderungen in Kraft getreten. Neu ist
offene Netzwerke. In diesem Sinn wird auch interkulturelle Kompetenz eher als Prozess denn als Lernziel verstanden.
 correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
AGROPLUS Buchhaltung. Daten-Server und Sicherheitskopie. Version vom 21.10.2013b
 AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
AGROPLUS Buchhaltung Daten-Server und Sicherheitskopie Version vom 21.10.2013b 3a) Der Daten-Server Modus und der Tresor Der Daten-Server ist eine Betriebsart welche dem Nutzer eine grosse Flexibilität
SEK II. Auf den Punkt gebracht!
 SEK II Profil- und Kurswahl Einbringungspflicht Abitur-Bestimmungen Gesamtqualifikation Auf den Punkt gebracht! 1 Inhaltsverzeichnis Sinn und Zweck dieses Dokuments...3 Profil- und Kurswahl für den 11.
SEK II Profil- und Kurswahl Einbringungspflicht Abitur-Bestimmungen Gesamtqualifikation Auf den Punkt gebracht! 1 Inhaltsverzeichnis Sinn und Zweck dieses Dokuments...3 Profil- und Kurswahl für den 11.
Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken?
 UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
UErörterung zu dem Thema Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es unabhängig zu denken? 2000 by christoph hoffmann Seite I Gliederung 1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 2.
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1. Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse:
 Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Weiterbildungen 2014/15
 Weiterbildungen 2014/15 Kurs 1 Das Konzept Lebensqualität In den letzten Jahren hat sich die Lebensqualität im Behinderten-, Alten-, Sozial- und Gesundheitswesen als übergreifendes Konzept etabliert. Aber
Weiterbildungen 2014/15 Kurs 1 Das Konzept Lebensqualität In den letzten Jahren hat sich die Lebensqualität im Behinderten-, Alten-, Sozial- und Gesundheitswesen als übergreifendes Konzept etabliert. Aber
Integrierte Dienstleistungen regionaler Netzwerke für Lebenslanges Lernen zur Vertiefung des Programms. Lernende Regionen Förderung von Netzwerken
 Integrierte Dienstleistungen regionaler Netzwerke für Lebenslanges Lernen zur Vertiefung des Programms Lernende Regionen Förderung von Netzwerken Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
Integrierte Dienstleistungen regionaler Netzwerke für Lebenslanges Lernen zur Vertiefung des Programms Lernende Regionen Förderung von Netzwerken Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
Krippenspiel für das Jahr 2058
 Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Spielen & Gestalten Krippenspiel für das Jahr 2058 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Impressum Weihnachtsspielangebot 2009 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Die Aufführungsrechte
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Spielen & Gestalten Krippenspiel für das Jahr 2058 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Impressum Weihnachtsspielangebot 2009 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Die Aufführungsrechte
Tipps und Tricks für eine «grünere Zukunft»
 s für eine «grünere Zukunft» Projekt-Team: - Schuster Patrick - Truttmann Fabio - Demirbas Alev - Wüthrich Martina Metallbaukonstrukteure, Ernst Schweizer AG Zusammenfassung: In unserem Projekt geht es
s für eine «grünere Zukunft» Projekt-Team: - Schuster Patrick - Truttmann Fabio - Demirbas Alev - Wüthrich Martina Metallbaukonstrukteure, Ernst Schweizer AG Zusammenfassung: In unserem Projekt geht es
Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009
 MikeC.Kock Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009 Zwei Märkte stehen seit Wochen im Mittelpunkt aller Marktteilnehmer? Gold und Crude
MikeC.Kock Rohstoffanalyse - COT Daten - Gold, Fleischmärkte, Orangensaft, Crude Oil, US Zinsen, S&P500 - KW 07/2009 Zwei Märkte stehen seit Wochen im Mittelpunkt aller Marktteilnehmer? Gold und Crude
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Reizdarmsyndrom lindern
 MARIA HOLL Reizdarmsyndrom lindern Mit der Maria-Holl-Methode (MHM) Der ganzheitliche Ansatz 18 Wie Sie mit diesem Buch Ihr Ziel erreichen Schritt 1: Formulieren Sie Ihr Ziel Als Erstes notieren Sie Ihr
MARIA HOLL Reizdarmsyndrom lindern Mit der Maria-Holl-Methode (MHM) Der ganzheitliche Ansatz 18 Wie Sie mit diesem Buch Ihr Ziel erreichen Schritt 1: Formulieren Sie Ihr Ziel Als Erstes notieren Sie Ihr
Produktionsplanung und steuerung (SS 2011)
 Produktionsplanung und steuerung (SS 2011) Teil 1 Sie arbeiten seit 6 Monaten als Wirtschaftsingenieur in einem mittelständischen Unternehmen in Mittelhessen. Das Unternehmen Möbel-Meier liefert die Büroaustattung
Produktionsplanung und steuerung (SS 2011) Teil 1 Sie arbeiten seit 6 Monaten als Wirtschaftsingenieur in einem mittelständischen Unternehmen in Mittelhessen. Das Unternehmen Möbel-Meier liefert die Büroaustattung
Eltern- Newsletter KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE ARCHE NOAH. März 2013. 2013 Ausgabe 2. T H E M E N I N D I E S E R AUSGABE: Zähne putzen
 2013 Ausgabe 2 sches Eltern- Newsletter März 2013 KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE ARCHE NOAH DER ORTSGEMEINDE KETTIG T H E M E N I N D I E S E R AUSGABE: Zähne putzen in der Kita Brandschutzwoche Organisatori-
2013 Ausgabe 2 sches Eltern- Newsletter März 2013 KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE ARCHE NOAH DER ORTSGEMEINDE KETTIG T H E M E N I N D I E S E R AUSGABE: Zähne putzen in der Kita Brandschutzwoche Organisatori-
Nicht kopieren. Der neue Report von: Stefan Ploberger. 1. Ausgabe 2003
 Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.
Schnellstart - Checkliste
 Schnellstart - Checkliste http://www.ollis-tipps.de/schnellstart-in-7-schritten/ Copyright Olaf Ebers / http://www.ollis-tipps.de/ - Alle Rechte vorbehalten - weltweit Seite 1 von 6 Einleitung Mein Name
Schnellstart - Checkliste http://www.ollis-tipps.de/schnellstart-in-7-schritten/ Copyright Olaf Ebers / http://www.ollis-tipps.de/ - Alle Rechte vorbehalten - weltweit Seite 1 von 6 Einleitung Mein Name
Leitartikel Weltnachrichten 2 / 2016
 Leitartikel Weltnachrichten 2 / 2016 Armut smart bekämpfen Smart heißt intelligent, schlau oder geschickt. Manchmal ist damit auch gemeint, dass man moderne Technik wie Handys oder Internet einsetzt. Zum
Leitartikel Weltnachrichten 2 / 2016 Armut smart bekämpfen Smart heißt intelligent, schlau oder geschickt. Manchmal ist damit auch gemeint, dass man moderne Technik wie Handys oder Internet einsetzt. Zum
Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend
 Landeshauptstadt München Hep Monatzeder Bürgermeister Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend Biodiversität 02.05.2012, 18:30 Uhr, Altes Rathaus Sehr geehrte Damen und Herren,
Landeshauptstadt München Hep Monatzeder Bürgermeister Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend Biodiversität 02.05.2012, 18:30 Uhr, Altes Rathaus Sehr geehrte Damen und Herren,
Psychosoziale Gesundheit. Schulentwicklung. Suchtprävention. Bewegung. Ernährung
 wgkk.at Schulentwicklung Bewegung Psychosoziale Gesundheit Suchtprävention Ernährung Qualitätsgesicherte Angebote in der schulischen Gesundheitsförderung für alle Wiener Schulen Impressum Herausgeber und
wgkk.at Schulentwicklung Bewegung Psychosoziale Gesundheit Suchtprävention Ernährung Qualitätsgesicherte Angebote in der schulischen Gesundheitsförderung für alle Wiener Schulen Impressum Herausgeber und
Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert?
 Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
I N S T I T U T F Ü R D E M O S K O P I E A L L E N S B A C H
 I N S T I T U T F Ü R D E M O S K O P I E A L L E N S B A C H Erwartungen der Bevölkerung an die Familienpolitik Die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört unverändert zu den familienpolitischen
I N S T I T U T F Ü R D E M O S K O P I E A L L E N S B A C H Erwartungen der Bevölkerung an die Familienpolitik Die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört unverändert zu den familienpolitischen
Umsetzung kompetenz- und handlungsorientierter Curricula. Prof. Dr. Dieter Euler
 Umsetzung kompetenz- und handlungsorientierter Curricula Prof. Dr. Dieter Euler Was bedeutet Kompetenz? 1. «Fähigkeit ein bestimmtes Verhalten entsprechend eines vorgegebenen Standards auszuführen» 2.
Umsetzung kompetenz- und handlungsorientierter Curricula Prof. Dr. Dieter Euler Was bedeutet Kompetenz? 1. «Fähigkeit ein bestimmtes Verhalten entsprechend eines vorgegebenen Standards auszuführen» 2.
Kinder: Grafiken und Karten zu den Lebensverhältnissen weltweit. Wo die meisten Kinder leben Anzahl der unter 15-Jährigen in absoluten Zahlen, 2010
 Schillerstr. 59 10 627 Berlin E-Mail: info@berlin-institut.org Tel.: 030-22 32 48 45 Fax: 030-22 32 48 46 www.berlin-institut.org Kinder: Grafiken und Karten zu den Lebensverhältnissen weltweit Wo die
Schillerstr. 59 10 627 Berlin E-Mail: info@berlin-institut.org Tel.: 030-22 32 48 45 Fax: 030-22 32 48 46 www.berlin-institut.org Kinder: Grafiken und Karten zu den Lebensverhältnissen weltweit Wo die
Selbsttest Prozessmanagement
 Selbsttest Prozessmanagement Zur Feststellung des aktuellen Status des Prozessmanagements in Ihrem Unternehmen steht Ihnen dieser kurze Test mit zehn Fragen zur Verfügung. Der Test dient Ihrer persönlichen
Selbsttest Prozessmanagement Zur Feststellung des aktuellen Status des Prozessmanagements in Ihrem Unternehmen steht Ihnen dieser kurze Test mit zehn Fragen zur Verfügung. Der Test dient Ihrer persönlichen
Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen
 Kongress Kinder.Stiften.Zukunft Workshop Willst Du mit mir gehen? Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen Dr. Christof Eichert Unsere Ziele: Ein gemeinsames Verständnis für die
Kongress Kinder.Stiften.Zukunft Workshop Willst Du mit mir gehen? Die richtigen Partner finden, Ressourcen finden und zusammenführen Dr. Christof Eichert Unsere Ziele: Ein gemeinsames Verständnis für die
Kundenzufriedenheit in der Wasserwirtschaft
 ERGEBNISDOKUMENTATION Kundenzufriedenheit in der Wasserwirtschaft Kundenbefragung 2014 Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda Erarbeitet als Informations- und Positionspapier für die Verbandsmitglieder
ERGEBNISDOKUMENTATION Kundenzufriedenheit in der Wasserwirtschaft Kundenbefragung 2014 Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda Erarbeitet als Informations- und Positionspapier für die Verbandsmitglieder
1. TEIL (3 5 Fragen) Freizeit, Unterhaltung 2,5 Min.
 EINFÜHRUNG 0,5 Min. THEMEN: Freizeit, Unterhaltung (T1), Einkaufen (T2), Ausbildung, Beruf (T3), Multikulturelle Gesellschaft (T4) Hallo/Guten Tag. (Nehmen Sie bitte Platz. Können Sie mir bitte die Nummer
EINFÜHRUNG 0,5 Min. THEMEN: Freizeit, Unterhaltung (T1), Einkaufen (T2), Ausbildung, Beruf (T3), Multikulturelle Gesellschaft (T4) Hallo/Guten Tag. (Nehmen Sie bitte Platz. Können Sie mir bitte die Nummer
mehrmals mehrmals mehrmals alle seltener nie mindestens **) in der im Monat im Jahr 1 bis 2 alle 1 bis 2 Woche Jahre Jahre % % % % % % %
 Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,
Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund.
 Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Das ist eine Erklärung in Leichter Sprache. In einer
Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Das ist eine Erklärung in Leichter Sprache. In einer
Namibiakids e.v./ Schule, Rehoboth, Namibia
 Namibiakids e.v./ Schule, FK 13 Rehabilitationswissenschaften - Master Sonderpädagogik 17.01.2015 27.03.2015 Schule in Rehoboth Über den Verein Namibiakids e.v. wurde uns ein Praktikum in einer Schule
Namibiakids e.v./ Schule, FK 13 Rehabilitationswissenschaften - Master Sonderpädagogik 17.01.2015 27.03.2015 Schule in Rehoboth Über den Verein Namibiakids e.v. wurde uns ein Praktikum in einer Schule
Erst Lesen dann Kaufen
 Erst Lesen dann Kaufen ebook Das Geheimnis des Geld verdienens Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist - so geht s den meisten Leuten. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden - oder würden Sie lieber
Erst Lesen dann Kaufen ebook Das Geheimnis des Geld verdienens Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist - so geht s den meisten Leuten. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden - oder würden Sie lieber
Wachstum 2. Michael Dröttboom 1 LernWerkstatt-Selm.de
 1. Herr Meier bekommt nach 3 Jahren Geldanlage 25.000. Er hatte 22.500 angelegt. Wie hoch war der Zinssatz? 2. Herr Meiers Vorfahren haben bei der Gründung Roms (753. V. Chr.) 1 Sesterze auf die Bank gebracht
1. Herr Meier bekommt nach 3 Jahren Geldanlage 25.000. Er hatte 22.500 angelegt. Wie hoch war der Zinssatz? 2. Herr Meiers Vorfahren haben bei der Gründung Roms (753. V. Chr.) 1 Sesterze auf die Bank gebracht
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
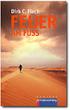 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Vom kompetenzorientierten Unterricht zur kompetenzorientierten Matura
 Vom kompetenzorientierten Unterricht zur kompetenzorientierten Matura Mag. DDr. Martin Apolin GRG 17 und Fakultät f. Physik/Didaktik Eines muss man zunächst ganz klar festhalten: Man kann nicht erwarten,
Vom kompetenzorientierten Unterricht zur kompetenzorientierten Matura Mag. DDr. Martin Apolin GRG 17 und Fakultät f. Physik/Didaktik Eines muss man zunächst ganz klar festhalten: Man kann nicht erwarten,
Der Klassenrat entscheidet
 Folie zum Einstieg: Die Klasse 8c (Goethe-Gymnasium Gymnasium in Köln) plant eine Klassenfahrt: A Sportcamp an der deutschen Nordseeküste B Ferienanlage in Süditalien Hintergrundinfos zur Klasse 8c: -
Folie zum Einstieg: Die Klasse 8c (Goethe-Gymnasium Gymnasium in Köln) plant eine Klassenfahrt: A Sportcamp an der deutschen Nordseeküste B Ferienanlage in Süditalien Hintergrundinfos zur Klasse 8c: -
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter!
 Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes
 Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes Der öffentliche Einkaufskorb soll nach dem Willen der Bundesregierung
Der nachhaltigere Anbieter sollte den Auftrag kriegen Interview mit Klaus-Peter Tiedtke, Direktor des Beschaffungsamtes des Bundes Der öffentliche Einkaufskorb soll nach dem Willen der Bundesregierung
Ulmer Universitäts-Trainingscamp. 1. bis 24. September 2015
 Ulmer Universitäts-Trainingscamp 1. bis 24. September 2015 Grußwort des Präsidenten der Universität Ulm Sehr geehrte Teilnehmer des Trainingscamps, liebe Erstsemester, ich bedanke mich ganz herzlich bei
Ulmer Universitäts-Trainingscamp 1. bis 24. September 2015 Grußwort des Präsidenten der Universität Ulm Sehr geehrte Teilnehmer des Trainingscamps, liebe Erstsemester, ich bedanke mich ganz herzlich bei
Tipp III: Leiten Sie eine immer direkt anwendbare Formel her zur Berechnung der sogenannten "bedingten Wahrscheinlichkeit".
 Mathematik- Unterrichts- Einheiten- Datei e. V. Klasse 9 12 04/2015 Diabetes-Test Infos: www.mued.de Blutspenden werden auf Diabetes untersucht, das mit 8 % in der Bevölkerung verbreitet ist. Dabei werden
Mathematik- Unterrichts- Einheiten- Datei e. V. Klasse 9 12 04/2015 Diabetes-Test Infos: www.mued.de Blutspenden werden auf Diabetes untersucht, das mit 8 % in der Bevölkerung verbreitet ist. Dabei werden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Titel:
ver.di Positionen zu aktuellen Problemen in der Wasserwirtschaft
 Betriebsversammlung der Gelsenwasser AG 23. April 2013 ver.di Positionen zu aktuellen Problemen in der Wasserwirtschaft Bundesfachgruppenleiter Wasserwirtschaft Das Menschenrecht auf Wasser und die europäische
Betriebsversammlung der Gelsenwasser AG 23. April 2013 ver.di Positionen zu aktuellen Problemen in der Wasserwirtschaft Bundesfachgruppenleiter Wasserwirtschaft Das Menschenrecht auf Wasser und die europäische
Nachhaltigkeits- Check von Geldanlagen
 Nachhaltigkeits- Check von Geldanlagen Lehrerinfo: Methodisch-didaktische Anmerkungen Die Klasse muss einen EDV-Raum mit hinreichend Arbeitsplätzen, Internetzugang und möglichst Intranet zur Verfügung
Nachhaltigkeits- Check von Geldanlagen Lehrerinfo: Methodisch-didaktische Anmerkungen Die Klasse muss einen EDV-Raum mit hinreichend Arbeitsplätzen, Internetzugang und möglichst Intranet zur Verfügung
Anleitung über den Umgang mit Schildern
 Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder
Auf den Schlussspurt kommt es an!
 72h-Wahlkampf Auf den Schlussspurt kommt es an! Wir können und MÜSSEN bis zum letzten Tag um WählerInnen werben! In den letzten Tagen kommt es gerade darauf an, Erst- und JungwählerInnen und vor allem
72h-Wahlkampf Auf den Schlussspurt kommt es an! Wir können und MÜSSEN bis zum letzten Tag um WählerInnen werben! In den letzten Tagen kommt es gerade darauf an, Erst- und JungwählerInnen und vor allem
DNotI. Fax - Abfrage. GrEStG 1 Abs. 3 Anteilsvereinigung bei Treuhandverhältnissen. I. Sachverhalt:
 DNotI Deutsches Notarinstitut Fax - Abfrage Gutachten des Deutschen Notarinstitut Dokumentnummer: 1368# letzte Aktualisierung: 14. Juni 2004 GrEStG 1 Abs. 3 Anteilsvereinigung bei Treuhandverhältnissen
DNotI Deutsches Notarinstitut Fax - Abfrage Gutachten des Deutschen Notarinstitut Dokumentnummer: 1368# letzte Aktualisierung: 14. Juni 2004 GrEStG 1 Abs. 3 Anteilsvereinigung bei Treuhandverhältnissen
Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter!
 Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Umweltbewusstseinsstudie 2014 Fact Sheet
 Umweltbewusstseinsstudie 2014 Fact Sheet Seit 1996 führt das Umweltbundesamt alle zwei Jahre eine Umfrage zum Umweltbewusstsein in Deutschland durch. Für die vorliegende Studie wurden die Daten erstmals
Umweltbewusstseinsstudie 2014 Fact Sheet Seit 1996 führt das Umweltbundesamt alle zwei Jahre eine Umfrage zum Umweltbewusstsein in Deutschland durch. Für die vorliegende Studie wurden die Daten erstmals
Grundschule des Odenwaldkreises. Rothenberg. Fortbildungskonzept
 Grundschule des Odenwaldkreises Rothenberg Fortbildungskonzept Rothenberg, im Oktober 2008 INHALTSVERZEICHNIS 1. PRÄAMBEL... 3 2. FORTBILDUNGSPLANUNG DER SCHULE... 3 3. FORTBILDUNGSPLANUNG DER KOLLEGEN...
Grundschule des Odenwaldkreises Rothenberg Fortbildungskonzept Rothenberg, im Oktober 2008 INHALTSVERZEICHNIS 1. PRÄAMBEL... 3 2. FORTBILDUNGSPLANUNG DER SCHULE... 3 3. FORTBILDUNGSPLANUNG DER KOLLEGEN...
Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit
 1 von5 Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit Autor: Dr. Gerd Sonntag Beratender Ingenieur disocon (Unternehmensberatung Diekelmann & Sonntag) Das Thema Prozessmanagement wurde in einem kompakten
1 von5 Prozessmanagement Modeerscheinung oder Notwendigkeit Autor: Dr. Gerd Sonntag Beratender Ingenieur disocon (Unternehmensberatung Diekelmann & Sonntag) Das Thema Prozessmanagement wurde in einem kompakten
ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele
 ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010
 Dipl. Naturheilpraktikerin AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010 Sind Sie interessiert an der STEINHEILKUNDE und möchten mehr dazu erfahren? Nachfolgend finden Sie die unterschiedlichen Angebote für Ausbildungen in
Dipl. Naturheilpraktikerin AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010 Sind Sie interessiert an der STEINHEILKUNDE und möchten mehr dazu erfahren? Nachfolgend finden Sie die unterschiedlichen Angebote für Ausbildungen in
Azubi Plus. projekt zukunft. Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit...
 Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit... Das unglaubliche Zusatz-Training zur Ausbildung: Sie werden Ihre Azubis nicht wieder erkennen! PERSONALENTWICKLUNG Personalentwicklung
Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit... Das unglaubliche Zusatz-Training zur Ausbildung: Sie werden Ihre Azubis nicht wieder erkennen! PERSONALENTWICKLUNG Personalentwicklung
Mehr Geld verdienen! Lesen Sie... Peter von Karst. Ihre Leseprobe. der schlüssel zum leben. So gehen Sie konkret vor!
 Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen
Kulturelle Evolution 12
 3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
3.3 Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution Kulturelle Evolution 12 Seit die Menschen Erfindungen machen wie z.b. das Rad oder den Pflug, haben sie sich im Körperbau kaum mehr verändert. Dafür war einfach
Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen Ihre Selbstachtung zu wahren!
 Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
Handout 19 Interpersonelle Grundfertigkeiten Einführung Wozu brauchen Sie zwischenmenschliche Skills? Um Ihre Ziele durchzusetzen! Um Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen! Um in Begegnungen mit anderen
weltverträglich kommunizieren
 Ausstellung zum Thema Green IT Die Ausstellung informiert über Green IT bezogen auf Computer, Fernseher und Handy. Dabei geht es um die Herstellung, Nutzung und Entsorgung und wie man diese ressourcenschonend,
Ausstellung zum Thema Green IT Die Ausstellung informiert über Green IT bezogen auf Computer, Fernseher und Handy. Dabei geht es um die Herstellung, Nutzung und Entsorgung und wie man diese ressourcenschonend,
