Glasindustrie bei Painten ( )
|
|
|
- Kristian Tiedeman
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Georg Paulus 2010 Glasindustrie bei Painten ( ) Erschienen in: Die Oberpfalz, Jahrgang 98, Heft 4, S , Kallmünz 2010; ISSN Abdruck mit freundlicher Erlaubnis von Georg Paulus. Herzlichen Dank! Manche Regionen Bayerns sind bekannt und berühmt für ihre weit in die Vergangenheit zurück reichende Glasindustrie. Zu den weniger bekannten und erst in jüngeren Jahren näher erforschten Glashüttenlandschaften gehört die Gegend um den Markt Painten, westlich von Regensburg, die vom frühen 17. Jahrhundert an für etwa dreihundert Jahre Standort für eine Reihe von Glashütten war. Fünf solche Glasmanufakturen bei Painten sind bekannt und inzwischen gründlicher erforscht worden. Dies hat den Verfasser veranlasst, die folgende Übersicht über diese Produktionsstätten und den gegenwärtigen Stand ihrer Erforschung zusammenzustellen. Ausschlaggebend für all diese Glashüttengründungen war der Waldreichtum auf den Jurahöhen zwischen den Flüssen Altmühl und Schwarze Laber. Die Glasproduktion erforderte große Mengen an Holz als Energiequelle für die Schmelzöfen und zur Gewinnung der benötigten Pottasche. Auch der Rohstoff Kalkstein war hier vorhanden und musste nicht von weit hergebracht werden, wie es zum Beispiel für die Glashütten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald vonnöten war. Quarzsand bezog man aus dem zwanzig Kilometer entfernten Hausen, südöstlich von Kelheim [1]. Aus der gleichen Gegend - zwischen Großmuß und Unterschambach - kam auch der Ton für den Bau der Glashäfen [2]. Das Vorhandensein dieser Rohstoffe und Betriebsmittel machten den Raum Painten zu einem geeigneten Glashüttenstandort. In den ausgedehnten Wäldern nördlich der Donau bei Kelheim stießen seit alters verschiedene Herrschaftsgebiete aneinander, deren Inhaber an der Nutzbarmachung des Holzreichtums interessiert waren. Die Errichtung von Glashütten erfüllte diesen Zweck und manifestierte gleichzeitig den jeweiligen Herrschaftsanspruch in diesen Grenzbereichen. Dreihundert Jahre lang durchschnitt die Landesgrenze zwischen dem Fürstentum Pfalz-Neuburg und dem Herzogtum Bayern dieses Waldgebiet. Die Waldungen waren aufgeteilt unter verschiedenen Grundherren. Dazu zählten das Fürstentum Pfalz-Neuburg, das Reichsstift Niedermünster in Regensburg, die Stadt Kelheim, sowie die angrenzenden Hofmarken. Letztere waren Maierhofen, Prunn und Randeck im Westen, sowie im Osten Eichhofen, Loch und Schönhofen. Mit Ausnahme der ältesten Glashütte im Untersuchungsgebiet standen alle diese Betriebe unmittelbar an dieser Grenze zwischen dem Fürstentum Pfalz-Neuburg und Kurbayern. Glashütten im Raum Painten, nach Gründungsjahren geordnet: Standort Zeitraum Territorium Painten /3 Pfalz-Neuburg Rothenbügl Pfalz-Neuburg Irlbrunn Kurbayern Viergstetten 1778-ca Pfalz-Neuburg Walddorf Niederbayern Painten ( /3) Die älteste bekannte Glasproduktionsstätte dieser Region befand sich im damals pfalz-neuburgischen Markt Painten selbst. Über ihre Entstehung sind in jüngster Zeit neue Quellen und Zusammenhänge bekannt geworden. Die Gründung dieser Glasmanufaktur fand unter dem seit 1614 regierenden Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm statt und dürfte wahrscheinlich im Jahre 1630 erfolgt sein. Für dieses Jahr finden wir auch die erste urkundliche Erwähnung eines Glaswerks in Painten [3]. Es war dies die zweite Glashüttengründung im Fürstentum Pfalz-Neuburg überhaupt. De Vater von Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraf Philipp Ludwig ( ), hatte in Konstein, nördlich von Neuburg, die erste Glasmanufaktur des Fürstentums gegründet [4]. Deren Geschichte ist aber trotz ihrer Langlebigkeit leider immer noch nicht eingehend erforscht worden [5] schloss Pfalzgraf Philipp Ludwig einen Vertrag über die Errichtung dieser Glashütte in Konstein mit dem Glasmacher Melchior Greiner [6], dessen Nachfahren den Betrieb bis 1795 besaßen [7]. Die Greiner zählen zu den ältesten und am weitest verbreiteten Glasmacherfamilien Deutschlands. Als Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm die Glashütte in Painten errichtete, galten die Glaswaren aus Venedig in ganz Europa als unerreicht. Sie zeichneten sich aus durch Klarheit der Masse, Leichtigkeit und durch Eleganz der Form [8]. Die von den zahlreichen Glashütten Mitteleuropas damals hergestellten Glasprodukte hatten nicht diese Qualitäten des aus Venedig importierten und deshalb teureren Glases. Um ihr Monopol zu wahren, hatte die Republik Venedig für Glasmacher, die ihr Fachwissen ins Ausland verbrachten, drakonische Strafen verhängt. Sie wurden als Landesverräter verfolgt, und ihnen drohte die Todesstrafe [9]. Dennoch gab es immer wieder solche flüchtigen Venezianer, die in der Aussicht auf großen geschäftlichen Erfolg dieses Risiko auf sich nahmen. Stand PK Seite 229 von 398 Seiten
2 [1] Flurl, Mathias: Beschreibung der Gebirge von Baiern und der oberen Pfalz, München 1792, S. 572, Nachdruck Heidelberg 1972 [2] ebenda, S. 571 [3] Bayerisches Hauptstaatsarchiv (künftig BayHStA), Pfalz-Neuburg Akten, NA 1911, Nr /1 [4] vgl. Tausendpfund, Alfred: Die Manufaktur im Fürstentum Neuburg, Nürnberg 1975 [5] vgl. Siebenhüter, Sandra; Schäfferling, Stefan: 400 Jahre Glasmacherkunst im Urdonautal, Wellheim 2009 [6] Schauer, Leonhard: Die Glasindustrie in Solnhofen, Solnhofen 1987 [7] Siebenhüter, Sandra; Schäfferling, Stefan: 400 Jahre Glasmacherkunst im Urdonautal, Wellheim 2009, S. 22 [8] Schmidt, Robert: Das Glas, Berlin 1912, S. 110 [9] Pinchart, Alexandre: Les Fabriques de Verres de Venise d Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe Siècle, in: Bulletin des Commissions Royales d Art et d Archéologie, 22, Brüssel 1883, S , S. 398 Abb /175 Glashüttenstandorte bei Painten: Painten, Viergstetten, Walddorf, Rothenbügl, Irlbrunn, Referenzorte Hemau, Regensburg, Kelheim Einer dieser venezianischen Glasmacher war Philippo de Gridolphi, der sich in die Spanischen Niederlande abgesetzt hatte. Er war seit 1598 Betreiber der kurz vor 1550 gegründeten Antwerpener Hütte, der ersten transalpinen Venezianerhütte von Bedeutung [10]. Unter ihm hatte das Antwerpener Glas einen Ruf bis weit über die Landesgrenzen hinaus erlangt [11]. Gridolphi war nach einem am 14. März 1600 von der Infantin Isabella erhaltenen Privileg der einzige, der in den Niederlanden Cristal à la façon de Venise [12] machen durfte [13]. Seit 1607 besaß er gemeinsam mit seinem Kompagnon Jean Bruyninck auch das Monopol auf die Einfuhr venezianischer Glaswaren [14] ü- bernahm de Gridolphis Schwiegersohn, der Venezianer Ferrante Morone [15], die Leitung der Glashütte [16]. Nach dem Verlust des Monopols für die spanischen Niederlande verkaufte Morone 1629 seine Antwerpener Glashütte [17]. Kein Geringerer als dieser Ferrante Morone [18] war es, den Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg mit der Einrichtung einer Glashütte in Painten beauftragte. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, der älteste Sohn von Pfalzgraf Philipp Ludwig und der Anna von Kleve- Jülich-Berg, war mit den niederrheinischen Herzogtümern Jülich und Berg begütert und residierte vornehmlich in Düsseldorf. Er hatte gewiss Kenntnis von der im benachbarten Flandern florierenden Glasproduktion und von den dortigen Entwicklungen erfahren. Er ließ den nun verfügbar gewordenen Glasmeister Ferrante Morone, wahrscheinlich zusammen mit anderen italienischen Glasmachern, anwerben, um unter dessen Federführung in seinem Fürstentum Pfalz-Neuburg eine Glasproduktion aufzubauen, die qualitativ jener in Antwerpen in nichts nachstehen sollte. Als Standort hatte er Painten ausersehen, wo mit dem herrschaftlichen Paintner Forst die Energieversorgung für die Glasschmelze gesichert war. Seite 230 von 398 Seiten PK Stand
3 Der bislang erste und einzige Beleg für die Anwesenheit des Ferrante Morone in Painten ist ein am 15. August 1630 datiertes Schreiben des im Übrigen ebenfalls aus Flandern stammenden neuburgischen Vizekanzlers Simon von Labricque [19] an Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, in dem es um einen Geldbetrag von 300 Gulden geht, der zue dem Glaßwerck zu Paindten dem Ferante Moron zu überbringen und laut Labricque zu Erhaltung des Glaßwercks, so kheine moram leidet, vonnöten war [20]. Der Aufbau der Glashütte erfolgte im Hof des Forstmeisteramts in Painten unter der Aufsicht des Paintner Forstmeisters Wolf Ernst von Günzkofen [21]. Die Glasproduktion in Painten muss im Sommer des Jahres 1630 bereits in Betrieb gewesen sein. Dies ist aus einem Dokument der Hofkammer München zu schließen, die auf das junge Unternehmen im benachbarten Fürstentum Pfalz-Neuburg aufmerksam geworden war. Hier erfahren wir auch, welche Bedeutung Kurbayern der neuen Glashütte in Painten beimaß, hatte die Hofkammer in München doch einen Industriespion in der Person des Bräugegenschreibers des kurfürstlichen Weissen Brauhauses zu Kelheim, Andreas Urfahrer [22], beauftragt, Erkundigungen über Art, Produktionsumfang und Preisgestaltung der in Painten gefertigten Glaswaren einzuholen [23]: Dem Preugegenschreiber Zu Kelhaim Vns ist vnderth[änigst] referiert worden was du wegen der Glashütten Zu Peunten berichtlich hieher geschrieben, dieweilen aber solchem Bericht etliche vndzwar nachuolgende Vmbstendt manglen, Als befelchen wür dir hiemit, das du dich widerumb nach besagtem Peunten verfingest, vnd dich erkhundigest, wieuil 1000 Trinckhgleser das Jar alda gemacht werden, wie theyer ain Trinckhgläßl in form aines Kelchls oder sonst verkhaufft wirdet, was ordinari für Leith verhanden, so solche glesern vnd in was anzahl von ainer zur andern Zeit erhandlen, vnd Vertragen wohin der maiste Verschleis [Verkauf] geet, was sonst für Vnderschietliche gattung gleser diß ortts gemacht, gattung von allerlei dengleichen gleser diß ortts gemacht, ob sie auch durchsichtige scheiben machen wie sie nemblich den gressern, mittern vnd cleinern gattungen nach verkhaufft werden, du sollst auch ain ganze trag von allerlai gattung gleser darunder auch scheiben, auch merere wids / wils [?] Trinckhgleser erhandlen, vnd neben ainer Specification hieher senden. 16. Xbr. [Decembris] ao. 630 [1630] Schenhueber Dem ehrgeizigen Unternehmen von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm war aber nur eine kurze Dauer beschieden. Der Dreißigjährige Krieg, der erstmals 1632 auf das pfalzneuburgische Territorium übergriff, bereitete dieser Glasproduktion in Painten ein frühes Ende. Ab Juni litt das Pflegamt Hemau, zu dem auch der Markt Painten gehörte, mehrfach unter Besetzungen, Einquartierungen und Truppendurchzügen [24]. Nach ersten großen Zerstörungen in Painten im Jahr 1632 [25] trafen die schwedischen Truppen unter Bernhard von Sachsen- Weimar im Frühjahr 1633 auf pfalz-neuburgischem Gebiet ein. Am 23. April 1633 besetzten sie die Residenzstadt Neuburg. Im Mai drangen sie in das Pfleggericht Hemau vor. Im November fielen Kelheim und Regensburg [26]. Jener Bernhard von Sachsen-Weimar sollte die ambitionierte Paintner Glasproduktion auf zweierlei Weise beenden, einmal durch die Zerstörung der Glashütte selbst, zum andern dadurch, dass er die venezianischen Glasspezialisten, die Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm aus Flandern in sein Fürstentum Pfalz- Neuburg geholt hatte - gütlich oder zwangsweise - zur Übersiedlung nach Tambach [27] im Thüringer Wald, in sein neu geschaffenes Herzogtum Franken, veranlasste [28]. Herzog Bernhard beabsichtigte, die Kunstfertigkeit der italienischen Glasmeister für sich zu nutzen und ließ in Tambach eine Glashütte errichten, die im März 1634 ihren Betrieb aufnahm [29]. Unter den fünf in Tambach namentlich genannten Venezianern erscheint zwar der Name Morone nicht, was darauf hindeuten könnte, dass dieser möglicherweise umgekommen war oder sich abgesetzt hatte. Allerdings weist die Herkunft der Übrigen aus dem Fürstentum Neuburg, in Verbindung mit dem dort belegten Ferrante Morone, auf Painten hin. Konstein, der andere Hüttenstandort im Herzogtum Pfalz-Neuburg käme zwar theoretisch auch als Herkunftsort der venezianischen Glasmacher in Frage, allerdings stand diese Glashütte unter der Leitung eines Greiner, wohingegen für Painten die Leitung des Venezianers Morone belegt ist und deshalb angenommen werden darf, dass die aus dem Neuburgischen nach Thüringen mitgenommenen Glasmacher von hier kamen. Aber auch im thüringischen Tambach war die Glasproduktion à la façon de Venise nur von kurzer Dauer. Die dortige Glashütte erlosch bereits im Mai 1639 [30], was mit den Kriegsgeschehnissen selbst in Zusammenhang stehen kann und mit den kriegsbedingten Schwierigkeiten, Soda und andere von den Venezianern für ihr anspruchsvolles Glasgemenge benötigte Rohstoffe zu besorgen [31]. Die Bedeutung des venezianischen Glashüttenprojekts von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm in Painten wird auch dadurch augenfällig, dass für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges in ganz Deutschland bisher nur zwei weitere Glasmanufakturen bekannt geworden sind, in denen Italiener Glas auf venezianische Art ( à la façon de Venise ) herstellten. Die eine stand in Köln, die andere im thüringischen Tambach [32]. Wobei in Letzterer Italiener arbeiteten, die, wie wir gesehen haben, aus dem Fürstentum Pfalz-Neuburg und somit wahrscheinlich aus Painten gekommen waren. An die ehemalige Glanzzeit der Glasherstellung in Painten, der der Dreißigjährige Krieg ein baldiges Ende bereitet hatte, erinnerte noch im Jahre 1715 der damalige Paintner Forstmeister Johann Leonhard von Meichsner in einem Schreiben nach Neuburg: Die alte vorige Glaßhütten ist vor dem der orthen gewesten Schweden- Stand PK Seite 231 von 398 Seiten
4 krieg alhir in Painten, vnd zwahr in Euer Churfürstlichen Durchlaucht Vorsthauß im Hoff gestandten. [33] [10] Schmidt, Robert: Das Glas, Berlin 1912, S. 112 [11] Hudig, Ferrand W.: Das Glas, Wien 1923, S. 16 [12] Glas auf venezianische Art [13] Pinchart, Alexandre: Les Fabriques de Verres de Venise d Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe Siècle, in: Bulletin des Commissions Royales d Art et d Archéologie, 22, Brüssel 1883, S , S. 394 [14] ebenda, S. 394 [15] Entscheidende Hinweise auf Literatur zu Ferrante Morone und dessen Wirken verdanke ich Herrn Werner Loibl, Gauting. [16] Schmidt, Robert: Das Glas, Berlin 1912, S. 112; sowie Hudig, Ferrand W.: Das Glas, Wien 1923, S. 16 [17] Schuermans, H.: Verres A la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas, in: Bulletin des Commissions Royales d Art et d Archéologie, 22, Brüssel 1883, S. 9-50, S , sowie: Hudig, Ferrand W.: Das Glas, Wien 1923, S [18] Andere Schreibweisen: Moron, Morron, Morono, Moroni; Er selbst zeichnete als Ferrante Morono (Pinchart, Alexandre: Les Fabriques de Verres de Venise d Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe Siècle, in: Bulletin des Commissions Royales d Art et d Archéologie, 22, Brüssel 1883, S , S. 395), bzw. als Ferrante Morone (Schuermans, H.: Verres A la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas, in: Bulletin des Commissions Royales d Art et d Archéologie, 22, Brüssel 1883, S. 9-50, S. 46) [19] Simon de Labrique, geboren in Lüttich; Professor für Zivilrecht an der Universität Ingolstadt. Danach Vizekanzler in Diensten von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg; (Nach Bosl, Karl: Bosls Bayerische Biographie, Regensburg 1983) [20] BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, NA 1911, Nr /1 [21] Staatsarchiv Amberg (künftig: StAAm), Pflegamt Hemau, R 1, fol. 84 sowie StAAm, Reg.K.d.Forst 557 [22] Gabler, Matthias: Das Personal des Weissen Brauhauses Kelheim, [23] BayHStA, Kurbayern Hofkammer 249, fol [24] Müller, Johann Nepomuck: Chronik der Stadt Hemau, Regensburg 1861, S. 172, Nachdruck 1972 [25] vgl. Paulus, Georg: Painten und der Dreißigjährige Krieg, in: Markt Painten (Hg.): Painten in Geschichte und Gegenwart, Painten 2005, S [26] Engerisser, Peter: Von Kronach nach Nördlingen, Weißenstadt 2004, S. 153 [27] heute: Tambach-Dietharz, Thüringen [28] Kühnert, Herbert: Urkundenbuch zur Thüringischen Glashüttengeschichte, Wiesbaden 1973, S. 86 und S. 295; (freundl. Hinweis von Herrn Werner Loibl, Gauting); sowie Stieda, Wilhelm: Die Glashütte zu Tambach, in: Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, Jahrgang 1916, Gotha 1916, S. 4 [29] ebenda, S. 4 [30] ebenda, S. 6 [31] vgl. ebenda, S. 6-7 [32] Drahotová, Olga: Europäisches Glas, Hanau 1984, S. 62 [33] StAAm, Reg. K.d.F. 557 Rothenbügl ( ) Erst 1665, gut dreißig Jahre nach dem kriegsbedingten Scheitern der ehrgeizigen Unternehmung von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, wurde die Glasherstellung in Painten wieder aufgenommen. Als Standort für die neue Paintner Glashütte wurde ein eine halbe Wegstunde entfernter Platz im Paintner Forst ausersehen, der auf einer Karte von 1616 unter dem Flurnamen Rodebühel zu finden ist [34]. Hier gründete der aus Konstein kommende Glasmeister Michael Degenmayer die neue Paintner Glashütte und das Dorf, das später Rothenbügl genannt werden sollte. Der Dreißigjährige Krieg lag nun 17 Jahre zurück, und die Verhältnisse im Pflegamt Hemau begannen allmählich, sich von dessen Auswirkungen zu erholen. Erst 1662 war das Amt Hemau aus einer 13 Jahre währenden Verpfändung an Kurbayern gelöst worden. Die Gründung von Rothenbügl war die dritte Glashüttengründung im Fürstentum Pfalz-Neuburg. Sie fällt in die Regierungszeit von Pfalzgraf Philipp Wilhelm ( ), der 1653 die Regierung angetreten hatte. Somit hatten drei Generationen von Pfalzgrafen jeweils eine Glashütte im Fürstentum gegründet: 1578 Konstein, 1630 Painten und nun 1665 Rothenbügl. Hier in Rothenbügl, inmitten des Paintner Forsts, sollte die langlebigste Glasmanufaktur im Paintner Raum entstehen. Sie existierte bis ins Jahr Michael Degenmayer verpflichtete vor allem Glasmacher aus Böhmen und dem Bayerischen Wald, wovon die Paintner Kirchenbücher aus jener Zeit zeugen. Bereits 1691 wurde die Familie Degenmayer mit einem Erbrechtsbrief für die Glashütte ausgestattet, die sich somit bis zu ihrem Ende im Privatbesitz befand, davon bis 1794 im Besitz der Familie Degenmayer. Die Glashütte Rothenbügl entwickelte sich bald zu einer technologischen Schnittstelle zwischen den Glashütten im bayerischen Wald und in Böhmen, wo Dutzende namhafter Glasmanufakturen bestanden, einerseits, und anderen Glashütten, vor allem im Allgäu, in Schwaben und in Franken, andererseits. Manchen Glasmachern, die sich beruflich verbessern wollten, diente Rothenbügl als Karrieresprungbrett. Von hier aus zogen sie in den Steigerwald und einzelne Familien bis nach Portugal und Spanien, wo sie in den königlichen Glasmanufakturen Karriere machten. Ihre Hochzeit hatte die Glas- Seite 232 von 398 Seiten PK Stand
5 hütte Rothenbügl im 17. und 18. Jahrhundert. Ab dem beginnenden 19. Jahrhundert, einer Zeit der allgemeinen Krise für die mitteleuropäische Glasindustrie, verlor sie an Bedeutung und geriet des Öfteren in wirtschaftliche Schwierigkeiten, was auch in einem häufigeren Besitzerwechsel seinen Ausdruck fand. Im Jahre 1878 stellte sie ihren Betrieb ein. Das Dorf Rothenbügl wird bis in die heutige Zeit im Volksmund Gloshüttn genannt. Seine Geschichte und die seiner Glashütte werden in der 2005 erschienenen Ortschronik von Painten ausführlich behandelt [35]. [34] BayHStA, PLS 3613 [35] vgl. Paulus, Georg: Die Geschichte von Rothenbügl, Gegenwart, Painten 2005, S ; sowie Hafner, Erich: Die Geschichte der Glashütte von Rothenbügl, in: ebenda, S Irlbrunn ( ) 1713 wurde auf einer nur drei Kilometer von Rothenbügl entfernten Waldlichtung, Irlbrunn genannt, eine weitere Glashütte eingerichtet. Ihre Gründung war vom damaligen Pächter der Glashütte Rothenbügl, Jakob Kiesling (gestorben 1723), betrieben worden. Trotz der geographischen Nähe befand sich Irlbrunn bereits außerhalb des Fürstentums Pfalz-Neuburg auf kurbayerischem Territorium und somit, von Rothenbügl aus gesehen, im Ausland. Die Landesgrenze trennte den Paintner Forst vom Frauenforst, der zum Reichsstift Niedermünster in Regensburg grundbar war und der Jurisdiktion des kurbayerischen Pfleggerichts Kelheim unterstand. Die Glashütte Irlbrunn entstand 1713 während des Spanischen Erbfolgekrieges [ ]. Für ihre Leitung hatte Jakob Kiesling zunächst den Glasmacher Johann Georg Fux bestimmt, der aus dem Steigerwald kam, wohin Kiesling enge Verbindungen zur Glashütte Schleichach unterhielt, deren Pächter er selbst später werden sollte. Nach dem frühen Tod von Jakob Kiesling im Jahre 1723 waren die Geschicke der Glashütte Irlbrunn bestimmt von Streitigkeiten mit der nun zum Konkurrenzbetrieb gewordenen Glashütte im nahen Rothenbügl und daraus sich ergebenden Konflikten mit den Behörden. Letztendlich führten diese Schwierigkeiten zur Einstellung der Glasproduktion in Irlbrunn bereits im Jahre 1741, also nur 28 Jahre nach ihrer Gründung [36]. Folge hatte [37]. Die Forstverwaltung hatte große Mühe, das angefallene Holz abzusetzen und fand schließlich in Anton Schmid, einem Glasmacher aus Rothenbügl, einen unternehmerischen Geist, der die Gelegenheit ergriff und sich im Gegenzug zum Kauf des Windbruchholzes eine Konzession zur Errichtung einer Glashütte erteilen ließ. Dies wurde zur Geburtsstunde von Viergstetten. Anton Schmid kam ursprünglich aus Rosenberg, einem Glashüttenstandort im Virngrund bei Ellwangen [38] hatte er die Witwe des Glasmachers Johann Carl Winter in Rothenbügl geheiratet und war damit zum Schwiegersohn des damaligen Glashüttenpächters Kaspar Mayer geworden. Letzterer dürfte ihm die nötige Unterstützung beim Holzankauf und dem Aufbau der Glashütte Viergstetten zukommen haben lassen. Schmid betrieb diese Glashütte auf der Grundlange einer zeitlich befristeten Konzession, die mehrmals verlängert wurde. Um 1809 war aber das Aus für seinen Betrieb gekommen. Die Konzession wurde nicht weiter verlängert. Das Ende der Glashütte Viergstetten fällt in eine Zeit, in der die Glasproduktion in Bayern und Böhmen eine große Krise erfuhr. Ursachen dafür waren die anhaltenden napoleonischen Kriege, besonders aber die seit 1806 verhängte Kontinentalsperre. Sie hatte den Wegfall bedeutender Exportmärkte und somit einen Preisverfall für Glaswaren zur Folge. Der gleichzeitig steigende Holzpreis führte zudem zu erhöhten Produktionskosten. Viele Glashütten im bayerisch-böhmischen Raum überstanden diese Bedingungen nicht und mussten noch vor der Aufhebung der Kontinentalsperre (1814) ihren Betrieb einstellen. Auch die Glasproduktion in Viergstetten, das in Painten noch heute Neuhüttn genannt wird, ging während dieser Krise zu Ende [39]. [37] vgl. Paulus, Georg: Zur Geschichte von Viergstetten, Gegenwart, Painten 2005, S [38] vgl. Schneider, Josef: Geschichte der Glasfabrik in Rosenberg, in: Ackermann, Hugo (Hg.): Rosenberg. Geschichte und Kultur einer Gemeinde im Virngrund, Rosenberg 1995, S [39] Näheres zur Geschichte der Glashütte Viergstetten in: Paulus, Georg: Zur Geschichte von Viergstetten, in: Markt Painten (Hg.), Painten in Geschichte und Gegenwart, Painten 2005, S [36] ausführlich zur Geschichte der Glashütte Irlbrunn, demnächst: Paulus, Georg: Die Geschichte der Glashütte Irlbrunn, in Vorbereitung Viergstetten ( ca. 1809) Im Jahre 1778 entstand am östlichen Ende des Paintner Forsts das Glashüttendorf Viergstetten. Wie Rothenbügl und die ehemalige Glashütte Painten befand es sich auf pfalz-neuburgischem Territorium. Seine Entstehung verdankt es einem Sturm vom 17. Juli 1776, der großen Schaden im Paintner Forst angerichtet und einen Windwurf in der Größenordnung von Klafter zur Stand PK Seite 233 von 398 Seiten
6 Walddorf ( ) Auch die Glasproduktion in Walddorf [40] wurde von Rothenbügl aus gegründet. Johann Nepomuk Brand, der damalige Betreiber der Glashütte Rothenbügl, und dessen Sohn Joseph ließen sie 1869 einrichten. Der neue Betrieb in Walddorf lag zwar nur einen Kilometer von Rothenbügl entfernt, befand sich aber bereits im Bezirksamt Kelheim und damit im benachbarten Niederbayern, einem Regierungsbezirk des Königreichs Bayern, unter dem das Waldgebiet um Painten nun politisch vereint worden war. Die Glashütte in Walddorf beschränkte sich im Wesentlichen auf die Herstellung einfacher Hohlglasprodukte wie Flaschen und Trinkgläser. Sie wurde bis 1932 betrieben und war somit das letzte Unternehmen seiner Art im Raum Painten. Mit ihm endete die 300 Jahre währende Glasproduktion bei Painten [41]. [40] heute: Ihrlerstein [41] Zur Geschichte der Glashütte Walddorf vgl. Hafner, Erich: Geschichte von Ihrlerstein, Kelheim 1998, S Weitere Glashüttenprojekte im Raum Painten Neben den beschriebenen fünf Glashütten, die zum Teil gleichzeitig, zum Teil abwechselnd von 1630 bis 1932 Glas produzierten, gab es im Laufe der Jahrhunderte mehrere Anläufe zur Gründung weiterer Glasmanufakturen in der Umgebung von Painten, die allerdings nicht zum Erfolg führten. Paintner Forst (1685) Im Jahre zwanzig Jahre nach Aufnahme der Glasproduktion in Rothenbügl - beantragte der damalige Paintner Forstmeister Johann Ignaz von Meichsner, eine zweite Glashütte im Paintner Forst errichten zu dürfen [42]. Von Meichsner beabsichtigte, diesen Betrieb zusammen mit dem erfahrenen Christal- und Glashüttenmeister Hanns Christoph Fidler [Fiedler] aufzubauen. Fidler hatte zuletzt die 1677 im Auftrag von Kurfürst Ferdinand Maria auf dem Lehel vor den Toren Münchens errichtete Glashütte geleitet und galt als Kapazität auf seinem Gebiet [43]. Von Meichsners Projekt zielte anscheinend darauf ab, zur bestehenden Rothenbügler Glashütte einen Konkurrenzbetrieb aufzubauen, der diese eines Tages ablösen hätte können. Damit wollte er zum Einen den für ihn scheinbar unkontrollierbar gewordenen Holzeinschlag durch die Rothenbügler Glashütte unterbinden, zum Anderen hätte er natürlich selbst einen wirtschaftlichen Vorteil gehabt, wenn die Glashütte unter seiner Verantwortung betrieben worden wäre. Warum das Projekt nicht realisiert wurde, wissen wir nicht. Möglicherweise hatte Michael Degenmayer die besseren Fürsprecher in der Residenzstadt Neuburg. Jedenfalls kam diese Glashüttengründung durch von Meichsner und Fidler nicht zustande. Johann Christoph Fidler finden wir 1691 als Hüttenmeister auf einer von Graf Wolf Heinrich Nothaft neu errichteten Glashütte bei Eisenstein [44; Bayer. Eisenstein]. [42] StAAm, Pflegamt Hemau, 2 [43] vgl. Richter, Ernst: Eine Glashütte vor den Toren Münchens, in: Der Zwiebelturm, München 1970, S ; sowie Loibl, Werner: Neues vom Gründer von Fabrikschleichach, in: Rauhenebracher Jahrbuch 2004, S [44] Häupler, Hans-Joachim: Die Geschichte der ältesten Glashütten in Eisenstein, in: Minulosti zapadočeskeho kraja, 28, 1992, S. 202 Keilsdorf (1748) 1748 entstand unter den Ingolstädter Jesuiten, den damaligen Besitzern der Hofmark Prunn (Altmühltal), in einem zu dieser Herrschaft gehörenden Auf der Hart bezeichneten Waldstück bei Keilsdorf eine Glashütte. Diese lag wie Irlbrunn auf kurbayerischem Gebiet, und zwar im Pfleggericht Riedenburg, fünf Kilometer südwestlich von Painten. Die Glashütte bei Keilsdorf soll aber bereits unmittelbar nach Fertigstellung abgebrannt sein und dürfte somit keine besondere Bedeutung erlangt haben. Da noch dazu Brandstiftung als Ursache angenommen wurde, haben ihre Erbauer vielleicht auch nicht den Unternehmergeist gehabt, sie neu aufzubauen [45]. Die Geschichte dieser Glashütte bzw. ihrer Entstehung ist leider noch nicht näher untersucht worden. [45] Halbritter, Max: Alte Häuser in Riedenburg, Riedenburg 1992, S. 41 Maierhofen ( ) Ein weiteres Glashüttenprojekt datiert aus der Zeit kurz nach der Gründung von Viergstetten. Ihr Initiator war wieder der damalige Paintner Forstmeister, Anton Wilhelm von Fabris hatte von Fabris das Schloss Maierhofen und die dazugehörige kleine Hofmark erworben, die sich zwar auf pfalz-neuburgischem Gebiet befand, als Hofmark allerdings der kurbayerischen Jurisdiktion des benachbarten Pfleggerichts Riedenburg unterstand. Ein Umstand, der in der Geschichte Maierhofens zu allerlei Komplikationen geführt hatte [46]. Von Fabris war bestrebt, den bescheidenen Ertrag seiner Hofmark durch vielfältige Projekte aufzuwerten. Dazu gehörte die Ansiedlung weiterer Untertanen ebenso wie die am beantragte Erlaubnis zur Gründung einer Glashütte. Von Fabris war mit Sabina, einer Tochter des 1772 verstorbenen Hüttenmeisters von Rothenbügl, Veit Preisler, verheiratet und dürfte allein dadurch Beziehungen zu Fachleuten aus dem Glasgewerbe gehabt haben. Zur Hofmark Maierhofen gehörten etwa 100 Hektar Wald, der aber zur Unterhaltung einer Glashütte bei weitem nicht ausgereicht hätte. Von Fabris gab an, das für die Glasproduktion benötigte Holz aus den Waldungen des benachbarten Pfleggerichts Riedenburg kaufen zu wollen. Möglicherweise wollte er aber auch seine Funktion als Forstmeister nutzen und Holz aus dem von ihm verwalteten Paintner Forst beziehen, der aber bereits die Glashütten in Rothenbügl und Viergstetten, sowie die Hammerwerke an Altmühl und Schwarzer Laber versorgte. Seite 234 von 398 Seiten PK Stand
7 Die Ablehnung des Glashüttenprojekts durch den Hofkammerpräsidenten Graf von Törring wurde schließlich auch damit begründet, dass sich in der Nähe bereits zwei Glashütten, nämlich zu Painten [Rothenbügl] und auf denen Viergstetten, befänden, aber auch damit, dass die Kelheimischen Waldungen durch jene zu Mayrhofen mittels Holzdiebereyen abgeöedet und zulezt das Churfürstl. weisse Brauhaus selbst in Holzmangl versezt wurde. [47] Hiermit wurde wohl darauf angespielt, dass die Maierhofener, wie auch andere Bewohner des Pflegamtes Hemau, althergebrachte Nutzungsrechte in dem nördlich von Kelheim gelegenen sogenannten Gmeinwald hatten und diese über das zulässige Maß hinaus genutzt und wohl auch vielfach dazu missbraucht wurden, in den angrenzenden Wäldern Holz zu besorgen. Von Fabris wiederholt gestellter Antrag wurde mehrmals abgelehnt, zunächst am 17. Januar, dann abermals am 14. Februar 1786 und zuletzt in auffallend ungehaltenem Tonfall am ein für allemal [48]. [46] vgl. Paulus, Georg: Zur Geschichte von Maierhofen, Gegenwart, Painten 2005, S [47] BayHStA, MInn 16165; freundl. Hinweis von Herrn Werner Loibl, Gauting [48] ebenda Mit der Glasproduktion in Verbindung stehende Gewerbe Aber nicht nur die Glashüttendörfer Rothenbügl, Irlbrunn, Viergstetten und Walddorf waren von der Glasproduktion bestimmt. Von ihr lebten auch Gewerbetreibende in umliegenden Orten. Dazu gehörten Zulieferer wie Aschenbrenner und Pottaschensieder, Aschen- wie auch Glashändler und glasveredelnde Betriebe. So sind etwa im Markt Painten für das Jahr 1810 mehrere mit der Glasproduktion in Zusammenhang stehenden Gewerbe belegt, nämlich ein Glasschleifer, ein Glasschneider, drei personale Pottaschenbrenner-Konzessionen sowie eine personale Pottaschensiederei-Konzession [49]; Der Physikatsbericht für das Landgericht Hemau von 1860 nennt neben der damals einzigen Glashütte in Rothenbügl folgende mit der Glasherstellung zusammenhängenden Gewerbe: ein Aschenhändler, fünf Glashändler, drei Glasschleifereien und eine Spiegelglasschleiferei [50]. Letztere zählte zu den Glasschleifen, die im nahen Labertal ab dem ausgehenden 18. und vor allem im 19. bis frühen 20. Jahrhundert bestanden und nicht unerwähnt bleiben sollen, wenn auch nicht belegt ist, dass diese Glas von den oben beschriebenen Hüttenstandorten verarbeiteten [51]. Mit der Schließung der letzten Glashütte in Walddorf im Jahre 1932 endete die dreihundert Jahre währende Zeit, in der die Glasproduktion und damit verbundene Berufe und Gewerbe das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in der Gegend von Painten mitgeprägt hatten. [49] StAAm, H.u.R. Kataster Hemau 20 [50] Paulus, Georg: Der Physikatsbericht für das Landgericht Hemau aus dem Jahre 1860, in: VHVO 146, 2006, S [51] vgl. Schwaiger, Dieter: Glasindustrie im Tal der Schwarzen Laber, in: Die Oberpfalz, Jahrgang 82, Kallmünz 1994, S Literaturübersicht zu den Glashütten bei Painten: Hafner, Erich: Die Geschichte der Glashütte von Rothenbügl, in: Markt Painten (Hg.), Painten in Geschichte und Gegenwart, Painten 2005, S Hafner, Erich: Geschichte von Ihrlerstein, Kelheim 1998 Paulus, Georg: Die Geschichte der Glashütte Irlbrunn, in Vorbereitung Paulus, Georg: Die Geschichte von Rothenbügl, Gegenwart, Painten 2005, S Paulus, Georg: Zur Geschichte von Viergstetten, Gegenwart, Painten 2005, S Schwaiger, Dieter: Aus der Geschichte der Glashütte Viergstetten, in: Die Oberpfalz, Nr. 82, Kallmünz 1994, S Anmerkung SG: Tausendpfund, Alfred: Die Manufaktur in Pfalz- Neuburg, Diss (auch Konstein und Rothenbügl) Stieda, Wilhelm: Die Glashütte zu Tambach, in: Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, Jahrgang 1916, Gotha 1916, S. 4 WEB: Klafter Holz (1 Fuß = 0,292 m) 1 Bayerischer Klafter = 6 x 6 x 3 Fuß = 2,9 cbm 1 Normalklafter = 6 x 6 x 3 ½ Fuß ~ 3,0 cbm 1 Bayer. Hüttenklafter = 6 x 6 x 2 Fuß ~ 1,9 cbm 1 Ster = 1 x 1 x 1 m = 1 cbm Stapelholz, geschichtete Holzmasse mit Luftzwischenräumen siehe Winkler, Zwischen Arber und Osser, Grafenau 1981, S. 223 Wikipedia DE: Das Klafter ist definiert als das Maß zwischen den ausgestreckten Armen eines erwachsenen Mannes, traditionell 6 Fuß, also etwa 1,80 m. In Österreich betrug seine Länge zum Beispiel 1,8965 m; in Preußen 1,88 m; in Bayern betrug ein Klafter hingegen lediglich etwa 1,75 m. Vom Längenmaß leitete sich dann das alte Raummaß für Scheitholz ab. Ein Klafter Holz entsprach einem Holzstapel mit einer Länge und Höhe von je einem Klafter, die Tiefe dieses Stapels entsprach der Länge der Stand PK Seite 235 von 398 Seiten
8 Holzscheite. Diese betrug meist 3 Fuß, also 0,5 Klafter. [ ] Dies entsprach, je nach Gegend, 3-4 rm Holz (Raummeter, entspricht etwa 2-3 Festmetern). SG, Zum Abdruck: Der Artikel über die Glashütten um Painten zeigt erstmals, dass es westlich vom Bayerischen Wald - nicht weit entfernt und durch wandernde Glasmacher sicher verbunden - vor und nach dem Dreißigjährigen Krieg wichtige Glasmanufakturen gegeben hat. Eine Dissertation Die Manufaktur in Pfalz-Neuburg von Alfred Tausendpfund, hat darauf bereits 1975 hingewiesen. Offenbar ist sie aber kurz darauf in Vergessenheit geraten: auf zwei wichtigen Karten werden westlich von Regensburg und Amberg weder von Häupler 1982 noch von Sellner 1995 Glashütten angegeben. Siehe dazu unten Auszüge und Karten aus PK , überarbeitet Juli Abb /176 Glashüttenstandorte bei Painten: 1 Painten, 2 Rothenbügl, 3 Irlbrunn, 4 Viergstetten, 5 Walddorf erwähnt: 6 Maierhofen, Referenzorte 7 Hemau 8 Regensburg, 9 Kelheim, Ausschnitt aus GOOGLE MAPS Siehe dazu auch: PK Baader, Die erste Venetianische Krystallglasfabrik in Bayern, Landshut PK Dreier, Venezianische Gläser und Façon de Venise (Auszug) PK Paulus, Bayerische Glasmacher auf der Iberischen Halbinsel Die um 1740 ausgewanderten Glasmacherfamilien Eder und Hahn PK SG, Zum Abdruck: Georg Paulus, Bayerische Glasmacher auf der Iberischen Halbinsel - Die um 1740 ausgewanderten Glasmacherfamilien Eder und Hahn PK Ritter, Eine Glashütte vor den Toren Münchens (Hans Christoph Fidler ( )) PK Spiegl, Die süddeutschen und sächsischen Goldrubingläser Die kurfürstliche Glashütte in München und Hans Christoph Fidler ( ) PK SG, PK , SG, Glas-Herstellung im Bayerischen Wald und im Umfeld (Auszug) (Zeittafel, überarbeitet November 2001, überarbeitet Juli 2010) PK Winkler, Die erste Glashütte am Eisenstein: Graf Nothaft übernimmt 1690 nach einem ungleichen Kampf gegen den Hüttenmeister Wolf Hainz die Stangenruckhütte PK Winkler, Waldwirtschaft in der Vergangenheit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert Seite 236 von 398 Seiten PK Stand
Die, Witteisbacher in Lebensbildern
 Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Bayerns Könige privat
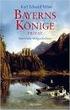 Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
In chronologisch absteigender Reihenfolge. Stand: 16. Dezember 2016
 Veröffentlichungen von Georg Paulus, Hohenwart In chronologisch absteigender Reihenfolge Stand: 16. Dezember 2016 2016 Die pfalz-neuburgische Landesaufnahme unter Pfalzgraf Philipp Ludwig, (Regensburger
Veröffentlichungen von Georg Paulus, Hohenwart In chronologisch absteigender Reihenfolge Stand: 16. Dezember 2016 2016 Die pfalz-neuburgische Landesaufnahme unter Pfalzgraf Philipp Ludwig, (Regensburger
Karl IV. zugleich König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist eine Leitfigur und ein Brückenbauer.
 Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung
Nikolaus Orlop. Alle Herrsc Bayerns. Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller
 Nikolaus Orlop Alle Herrsc Bayerns Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 11 Vorwort zur zweiten Auflage 13 Überblick über die bayerische
Nikolaus Orlop Alle Herrsc Bayerns Herzöge, Kurfürsten, Könige - von Garibald I. bis Ludwig III. LangenMüller Inhalt Vorwort zur ersten Auflage 11 Vorwort zur zweiten Auflage 13 Überblick über die bayerische
Baiereck, seine Entstehung und dessen Namensherleitung. Sehr geehrter herr Bürgermeister Norbert Zitzmann, liebe Leser der Chronik der Stadt Lauscha,
 zur Lauschaer Chronik 20.03.17 von Roland Kob Zweites Kapitel : Teil 2 Das Nassachtal als Zwischenstation Baiereck, seine Entstehung und dessen Namensherleitung Sehr geehrter herr Bürgermeister Norbert
zur Lauschaer Chronik 20.03.17 von Roland Kob Zweites Kapitel : Teil 2 Das Nassachtal als Zwischenstation Baiereck, seine Entstehung und dessen Namensherleitung Sehr geehrter herr Bürgermeister Norbert
Wir feiern heute ein ganz außergewöhnliches Jubiläum. Nur sehr wenige Kirchengebäude
 Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum?
 Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
So wählte Eppelheim in der Weimarer Republik: Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen von 1919 bis 1933
 So wählte Eppelheim in der Weimarer Republik: Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen von 1919 bis 1933 Gemeinderatswahlen am 15. Juni 1919: Zahl der Stimmzettel: davon ungültig: gültige Stimmzettel: SPD
So wählte Eppelheim in der Weimarer Republik: Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen von 1919 bis 1933 Gemeinderatswahlen am 15. Juni 1919: Zahl der Stimmzettel: davon ungültig: gültige Stimmzettel: SPD
Das Zieglerschloss von Josef Popp (aus Mittelbayerischer Zeitung vom )
 Das Zieglerschloss von Josef Popp (aus Mittelbayerischer Zeitung vom 03.09.2005) Neben dem Oberen Schloss, dem Hammerschloss als früheren Adelssitze gibt es auch das Zieglerschloss, das jüngste unter den
Das Zieglerschloss von Josef Popp (aus Mittelbayerischer Zeitung vom 03.09.2005) Neben dem Oberen Schloss, dem Hammerschloss als früheren Adelssitze gibt es auch das Zieglerschloss, das jüngste unter den
Die Landschaftskommissare (LKo) des Fürstentums Pfalz-Neuburg
 Die Landschaftskommissare (LKo) des Fürstentums Pfalz-Neuburg 1559 1) Heinrich Joachim von Otting zu Tagmersheim (gest. 29.09.1571) (LM (1559)1565-66) 2) Simprecht Lenk zu Gansheim (gest. 1565) 3) Hans
Die Landschaftskommissare (LKo) des Fürstentums Pfalz-Neuburg 1559 1) Heinrich Joachim von Otting zu Tagmersheim (gest. 29.09.1571) (LM (1559)1565-66) 2) Simprecht Lenk zu Gansheim (gest. 1565) 3) Hans
Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert
 Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert Dietlinde Lutsch, Renate Weber, Georg Weber ( ) Schiller Verlag, Hermannstadt/Sibiu, ca. 400 Seiten Der Bildband
Vorankündigung: Leben in Siebenbürgen Bildergeschichten aus Zendersch im 20. Jahrhundert Dietlinde Lutsch, Renate Weber, Georg Weber ( ) Schiller Verlag, Hermannstadt/Sibiu, ca. 400 Seiten Der Bildband
Das Ende des Dreißigjährigen Krieges
 Ernst Höfer Das Ende des Dreißigjährigen Krieges Strategie und Kriegsbild 1997 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN INHALT EINFÜHRUNG Kriegsziele 1 Kriegsziele des Kaisers - Der politische Hintergrund - Kriegsziele
Ernst Höfer Das Ende des Dreißigjährigen Krieges Strategie und Kriegsbild 1997 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN INHALT EINFÜHRUNG Kriegsziele 1 Kriegsziele des Kaisers - Der politische Hintergrund - Kriegsziele
Adressbuch Rousset, Annuaire de la Verrerie et de la Céramique 1902 (Auszug)
 Abb. 2005-1-10/001 Adressbuch Rousset 1902, Einband, Titelblatt Adressbuch Rousset, Annuaire de la Verrerie et de la Céramique 1902 (Auszug) Zur Verfügung gestellt von Herrn Dieter Neumann. Herzlichen
Abb. 2005-1-10/001 Adressbuch Rousset 1902, Einband, Titelblatt Adressbuch Rousset, Annuaire de la Verrerie et de la Céramique 1902 (Auszug) Zur Verfügung gestellt von Herrn Dieter Neumann. Herzlichen
Anna Elisabeth Iller, ( ), Tochter des Elias Iller, Bauer in Oppau.
 Erste Generation der Familie Scharf in Oppau Matthäus (Matthes) Scharf, + 03.05.1746 (54 J. alt), erst Häusler, später Bauer in Oppau 1. Er stammt von Gottesberg im Kreis Waldenburg. oo 18.11.1722 in Oppau
Erste Generation der Familie Scharf in Oppau Matthäus (Matthes) Scharf, + 03.05.1746 (54 J. alt), erst Häusler, später Bauer in Oppau 1. Er stammt von Gottesberg im Kreis Waldenburg. oo 18.11.1722 in Oppau
Hans Philip Fuchs von Bimbach (c ), Mäzen von Simon Marius. Wolfgang R. Dick Potsdam und Frankfurt am Main
 Hans Philip Fuchs von Bimbach (c.1567-1626), Mäzen von Simon Marius Wolfgang R. Dick Potsdam und Frankfurt am Main Fuchs von Bimbach und Simon Marius Inhalt und Anliegen 1. Biographisches zu Fuchs von
Hans Philip Fuchs von Bimbach (c.1567-1626), Mäzen von Simon Marius Wolfgang R. Dick Potsdam und Frankfurt am Main Fuchs von Bimbach und Simon Marius Inhalt und Anliegen 1. Biographisches zu Fuchs von
Regensburger Fernhandel im Mittelalter
 Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut
 Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
Gefallene und Vermisste aus Großholbach
 Gefallene und Vermisste aus Großholbach Gedenken und Mahnung 1914 1918 1939 1945 Gefallene und Vermisste aus Großholbach 1914 1918 Gefallene und Vermisste aus Großholbach 1939 1945 Totenehrung Wir denken
Gefallene und Vermisste aus Großholbach Gedenken und Mahnung 1914 1918 1939 1945 Gefallene und Vermisste aus Großholbach 1914 1918 Gefallene und Vermisste aus Großholbach 1939 1945 Totenehrung Wir denken
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von. Böhmen. Heiliger und Herrscher in der
 Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von Böhmen. Heiliger und Herrscher in der Österreichischen Nationalbibliothek am Mittwoch, dem 25. November 2009 Sehr geehrte
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Wenzel von Böhmen. Heiliger und Herrscher in der Österreichischen Nationalbibliothek am Mittwoch, dem 25. November 2009 Sehr geehrte
Wo unser Ur-Ahn Georg herkam, war bislang unbekannt, denn er tauchte erstmals 1712 in den Lobensteiner Kirchenbüchern auf, als er dort
 Von: Albert Frühauf Betreff: Ergänzungen zur 5. Glocke in der St. Jakobikirche in 96328 Küps Datum: 23. Juli 2016 um 12:48:37 MESZ An: In Zusammenhang mit meiner Familienforschung
Von: Albert Frühauf Betreff: Ergänzungen zur 5. Glocke in der St. Jakobikirche in 96328 Küps Datum: 23. Juli 2016 um 12:48:37 MESZ An: In Zusammenhang mit meiner Familienforschung
Franz Josef von Stein
 Geisteswissenschaft Josef Haslinger Franz Josef von Stein Bischof von Würzburg (1879-1897) und Erzbischof von München und Freising (1897-1909) Studienarbeit UNIVERSITÄT REGENSBURG, KATHOLISCH-THEOLOGISCHE
Geisteswissenschaft Josef Haslinger Franz Josef von Stein Bischof von Würzburg (1879-1897) und Erzbischof von München und Freising (1897-1909) Studienarbeit UNIVERSITÄT REGENSBURG, KATHOLISCH-THEOLOGISCHE
Bayerische Glasmacher auf der Iberischen Halbinsel
 BBLF 73 (2010) Bayerische Glasmacher 5 Bayerische Glasmacher auf der Iberischen Halbinsel Die um 1740 ausgewanderten Glasmacherfamilien Eder und Hahn Von Georg Paulus Glasmacher sind bekannt für ihre Mobilität.
BBLF 73 (2010) Bayerische Glasmacher 5 Bayerische Glasmacher auf der Iberischen Halbinsel Die um 1740 ausgewanderten Glasmacherfamilien Eder und Hahn Von Georg Paulus Glasmacher sind bekannt für ihre Mobilität.
Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler)
 Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Archivale im August 2013 Kriegsjahr 1917 (Aus dem Nachlass von Jakob Ziegler) 1. Brief von Hanna Fries aus Ludwigshafen vom 7.2.1917 an Jakob Ziegler, Weyher (Quellennachweis: Landesarchiv Speyer, Bestand
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Georg Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Georg Kunsthistoriker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik veranstalten erstmals eine gemeinsame Landesausstellung zu Kaiser Karl IV.
 Sperrfrist: 19. Oktober 2016, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der
Sperrfrist: 19. Oktober 2016, 14.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der
Niccolò Machiavellis - Il Principe - und der Begriff der Macht
 Politik Beate Sewald Niccolò Machiavellis - Il Principe - und der Begriff der Macht Studienarbeit 1 Niccolò Machiavellis - Il Principe - und der Begriff der Macht Beate Sewald Inhaltsverzeichnis Einleitung...1
Politik Beate Sewald Niccolò Machiavellis - Il Principe - und der Begriff der Macht Studienarbeit 1 Niccolò Machiavellis - Il Principe - und der Begriff der Macht Beate Sewald Inhaltsverzeichnis Einleitung...1
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur. Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg
 Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Brackwedes "Glasmacherhäuser"
 Brackwedes "Glasmacherhäuser" Fast vergessen (8): An der Hauptstraße gab es eine Glashütte - und für ihre 50 bis 60 Mitarbeiter sowie deren Familien neu gebauten Wohnraum für Glasmacher Neue Westfälische
Brackwedes "Glasmacherhäuser" Fast vergessen (8): An der Hauptstraße gab es eine Glashütte - und für ihre 50 bis 60 Mitarbeiter sowie deren Familien neu gebauten Wohnraum für Glasmacher Neue Westfälische
Die Zeit vor der Entstehung der Wallfahrt
 Inhaltsübersicht 11 Vorwort zur 10. überarbeiteten Auflage Die Zeit vor der Entstehung der Wallfahrt 13 Vorgeschichte 14 Frühgeschichte 15 Unter den bayerischen Agilulfingern - Einwanderung der Bayern
Inhaltsübersicht 11 Vorwort zur 10. überarbeiteten Auflage Die Zeit vor der Entstehung der Wallfahrt 13 Vorgeschichte 14 Frühgeschichte 15 Unter den bayerischen Agilulfingern - Einwanderung der Bayern
Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower
 Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower Mühlenbach) durchzieht die Landschaft. 1 Buggow gehörte früher
Das kleine Dörfchen Buggow liegt an der Straße von Anklam nach Wolgast und hat seinen Ursprung in der Slawenzeit. Ein kleiner Bach (Libnower Mühlenbach) durchzieht die Landschaft. 1 Buggow gehörte früher
Musenschloss und Jagdschloss Ettersburg 1. Karten zu Ettersburg
 Musenschloss und Jagdschloss Ettersburg 1. Karten zu Ettersburg (Karte nach openstreetmap.org) Dorf und Schloss Ettersburg liegen ca. 10 km nördlich von Weimar, (Karte nach openstreetmap.org) am nördlichen
Musenschloss und Jagdschloss Ettersburg 1. Karten zu Ettersburg (Karte nach openstreetmap.org) Dorf und Schloss Ettersburg liegen ca. 10 km nördlich von Weimar, (Karte nach openstreetmap.org) am nördlichen
Zeittafel Römisch-Deutsche Kaiser und Könige 768 bis 1918
 Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
Röm.Deut. Kaiser/König Lebenszeit Regierungszeit Herkunft Grabstätte Bemerkungen Karl der Große Fränkischer König Karl der Große Römischer Kaiser Ludwig I., der Fromme Römischer Kaiser Lothar I. Mittelfränkischer
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum
 man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
man sich zur Wehr setzen musste. Die Franken fanden, dass es nicht mehr zeitgemäß sei, an die Vielgötterei zu glauben, und wollten die Westfalen zum Christentum bekehren. Wenn der Westfale sich aber mal
Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16
 Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16 Georg Habermayr Im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 16 als Ortsumfahrung von Oberund Unterhausen
Zusammenfassung der archäologischen Ausgrabung und Datierung des Körpergräberfeldes Unterhausen an der B 16 Georg Habermayr Im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 16 als Ortsumfahrung von Oberund Unterhausen
Auswanderung Böhmischer Brüder nach Niederschlesien
 Auswanderung Böhmischer Brüder nach Niederschlesien Politische Situation Nach dem Sieg der Katholischen Liga in der Schlacht am Weißen Berg unweit von Prag im Jahr 1620 übernahm Ferdinand II. (1620-1637)
Auswanderung Böhmischer Brüder nach Niederschlesien Politische Situation Nach dem Sieg der Katholischen Liga in der Schlacht am Weißen Berg unweit von Prag im Jahr 1620 übernahm Ferdinand II. (1620-1637)
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen II. Herkunft und Ansehen der Karolinger
 Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar ( )
 Geschichte Maria Moeßner Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (1739-1807) Reflexionen zum Mythos einer Regentin Examensarbeit Universität Leipzig Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
Geschichte Maria Moeßner Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (1739-1807) Reflexionen zum Mythos einer Regentin Examensarbeit Universität Leipzig Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte
 Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte Ferdinand Schöningh, Postfach 25 40, 33055 Paderborn Alte Folge: Die Bände IV und VII der,,quellen und Forschungen" liegen als Reprints als Bände I
Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte Ferdinand Schöningh, Postfach 25 40, 33055 Paderborn Alte Folge: Die Bände IV und VII der,,quellen und Forschungen" liegen als Reprints als Bände I
Tannenberg Duchtlinger Strasse 13, Singen
 Tannenberg Duchtlinger Strasse 13, 78224 Singen Damals Kaufvertrag Grundstück 5 9 4 6 10 8 7 1. 2. 3. 4. 5. Winter Johann Winter Philippine Winter Karl-David fremd fremd 6. 7. 8. 9. 10. Winter Anton Reinhardt
Tannenberg Duchtlinger Strasse 13, 78224 Singen Damals Kaufvertrag Grundstück 5 9 4 6 10 8 7 1. 2. 3. 4. 5. Winter Johann Winter Philippine Winter Karl-David fremd fremd 6. 7. 8. 9. 10. Winter Anton Reinhardt
VORANSICHT. Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg
 Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Frühe Neuzeit Beitrag 7 Der Dreißigjährige Krieg 1 von 32 Ein Fenstersturz mit Folgen: der Dreißigjährige Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Dreißig Jahre Krieg was aber steckt dahinter? In der vorliegenden
Übersicht über die Herrscher in der Mark Brandenburg
 Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Übersicht über die Herrscher in der Mark 1157-1918 1. Herrschaft der Askanier (1157-1320) Die Askanier waren ein in Teilen des heutigen Sachsen-Anhalt ansässiges altes deutsches Adelsgeschlecht, dessen
Schloss Maiwaldau/Maciejowa
 Mai 2004 Maiwaldau Schloss Maiwaldau/Maciejowa Eines der schönsten Barock-Schlösser des Hirschberger Tales wurde 1686 von Graf Johann Ferdinand von Karwath zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut. Das
Mai 2004 Maiwaldau Schloss Maiwaldau/Maciejowa Eines der schönsten Barock-Schlösser des Hirschberger Tales wurde 1686 von Graf Johann Ferdinand von Karwath zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut. Das
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich
 Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Herrscher im ostfränkischen bzw. im deutschen Reich Name Lebenszeit König Kaiser Karl der Große Sohn des Königs Pippin d. J. Ludwig I. der Fromme Jüngster Sohn Karls d. Großen Lothar I. Ältester Sohn Ludwigs
Wer war Hugo Wehrle?
 Werner Zillig Wer war Hugo Wehrle? Die Vorgeschichte zu dieser Frage ist einfach: LMU München, Wintersemester 2009 / 10. In meinem Hauptseminar Zur Theorie der Gesamtwortschatz-Gliederung sollte eine Studentin
Werner Zillig Wer war Hugo Wehrle? Die Vorgeschichte zu dieser Frage ist einfach: LMU München, Wintersemester 2009 / 10. In meinem Hauptseminar Zur Theorie der Gesamtwortschatz-Gliederung sollte eine Studentin
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Geleitwort... 7 Vorwort... 9 1. Einleitung... 11 2. Johann Wilhelm II., Kürfürst von der Pfalz, Herzog von Jülich-Berg, Pfalzgraf von Neuburg 15 3. Der Fürst und die
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Geleitwort... 7 Vorwort... 9 1. Einleitung... 11 2. Johann Wilhelm II., Kürfürst von der Pfalz, Herzog von Jülich-Berg, Pfalzgraf von Neuburg 15 3. Der Fürst und die
Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert
 Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert P Beim Hammerwerk N M L A K J B Christoph-Carl-Platz I O H C D E F G Die erste urkundliche Erwähnung Hammers als Mühl zu Laufenholz ist von 1372 überliefert. 1492 wird
Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert P Beim Hammerwerk N M L A K J B Christoph-Carl-Platz I O H C D E F G Die erste urkundliche Erwähnung Hammers als Mühl zu Laufenholz ist von 1372 überliefert. 1492 wird
BLICKWINKEL BLICK AUF DAS RATHAUS PFAFFENHOFEN IM WANDEL DER ZEIT
 BLICK AUF DAS RATHAUS Obwohl erst aus dem Jahr 20 stammend, zeigt die Aufnahme des Rathauses die vielfältigen Veränderungen am Gebäude wie im direkten Umfeld. Nach der umfassenden Renovierung des Rathauses
BLICK AUF DAS RATHAUS Obwohl erst aus dem Jahr 20 stammend, zeigt die Aufnahme des Rathauses die vielfältigen Veränderungen am Gebäude wie im direkten Umfeld. Nach der umfassenden Renovierung des Rathauses
Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück.
 Aus der Geschichte der Ermreuser Feuerwehr Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück. In einer Materialbeschaffungsliste der Ermreuser Gemeinde sind 2 Feuerhaken für vier Gulden
Aus der Geschichte der Ermreuser Feuerwehr Die Anfänge der Ermreuser Wehr gehen schon 140 Jahre und mehr zurück. In einer Materialbeschaffungsliste der Ermreuser Gemeinde sind 2 Feuerhaken für vier Gulden
Bayerische Honigkönigin weiht Bienenhaus ein
 PRESSEINFORMATION Einweihung Bienenhaus Bayerische Honigkönigin weiht Bienenhaus ein Königlicher Besuch bei Schlagmann Poroton am Firmensitz in Zeilarn. Mit ihrer Teilnahme an der Einweihung des Bienenhauses
PRESSEINFORMATION Einweihung Bienenhaus Bayerische Honigkönigin weiht Bienenhaus ein Königlicher Besuch bei Schlagmann Poroton am Firmensitz in Zeilarn. Mit ihrer Teilnahme an der Einweihung des Bienenhauses
Name Heimatclub DGV-Stv DGV-Spv Netto. Rang 1 - GR Augsburg 1 A 219
 Mannschaftswertung Zählspiel - Netto Rang 1 - GR Augsburg 1 A 219 Golfliga Cup Runde 1(Einzel) - Gewertet : (2 von 4) 146 Brenner, Roland GolfRange Augsburg 6,1 6 73 Herbert-Wagner, Reinhold GolfRange
Mannschaftswertung Zählspiel - Netto Rang 1 - GR Augsburg 1 A 219 Golfliga Cup Runde 1(Einzel) - Gewertet : (2 von 4) 146 Brenner, Roland GolfRange Augsburg 6,1 6 73 Herbert-Wagner, Reinhold GolfRange
DAS GEHEIMNIS DES KOFFERS.
 DAS GEHEIMNIS DES KOFFERS. VOM SCHICKSAL EINES BÖHMISCHEN ADELIGEN IM FUGGERSCHEN BLUMENTHAL.»Fugger im Archiv. Die Fundstücke-Geschichten.«ist eine jährliche Veranstaltung im Rahmen des Fugger Forum.
DAS GEHEIMNIS DES KOFFERS. VOM SCHICKSAL EINES BÖHMISCHEN ADELIGEN IM FUGGERSCHEN BLUMENTHAL.»Fugger im Archiv. Die Fundstücke-Geschichten.«ist eine jährliche Veranstaltung im Rahmen des Fugger Forum.
Geschichte Brehna. Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v Brehna. Veröffentlichung auf Homepage:
 Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v. Brehna Veröffentlichung auf Homepage: www.sandersdorf-brehna.de Gestaltung und Satz neu überarbeitet: Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna, 2012. Inhaltsverzeichnis 3
Heimat- und Geschichtsverein Brehna e.v. Brehna Veröffentlichung auf Homepage: www.sandersdorf-brehna.de Gestaltung und Satz neu überarbeitet: Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna, 2012. Inhaltsverzeichnis 3
Begriff der Klassik. classicus = röm. Bürger höherer Steuerklasse. scriptor classicus = Schriftsteller 1. Ranges
 Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Klassik (1786-1805) Inhaltsverzeichnis Begriff der Klassik Zeitraum Geschichtlicher Hintergrund Idealvorstellungen Menschenbild Dichtung Bedeutende Vertreter Musik Baukunst Malerei Stadt Weimar Quellen
Der Kosovo-Konflikt. Ein europäischer Konflikt zwischen Serben und Albanern. Vortrag von Dr. Christoph Fichtner.
 Der Kosovo-Konflikt Ein europäischer Konflikt zwischen Serben und Albanern Vortrag von Dr. Christoph Fichtner www.drfichtners-studienblaetter.de Übersicht 1.) Geographisch-politische Angaben 2.) Historische
Der Kosovo-Konflikt Ein europäischer Konflikt zwischen Serben und Albanern Vortrag von Dr. Christoph Fichtner www.drfichtners-studienblaetter.de Übersicht 1.) Geographisch-politische Angaben 2.) Historische
Geschichtlicher Abriss 1815 bis 1871
 Geschichtlicher Abriss 1815 bis 1871 1815 1815 1832 1833 1841 1844 1848 1862 1864 1866 1867 1870 1871 Der Wiener Kongress (1815) Nach Napoleon musste Europa neu geordnet und befriedet werden. Dazu kamen
Geschichtlicher Abriss 1815 bis 1871 1815 1815 1832 1833 1841 1844 1848 1862 1864 1866 1867 1870 1871 Der Wiener Kongress (1815) Nach Napoleon musste Europa neu geordnet und befriedet werden. Dazu kamen
MAURER in BÜRGEL. Maurergesellen in Bürgel alphabetisch geordnet
 MAURER in BÜRGEL Neben der Innungsdatei der Bürgeler Maurerinnug ist auf dieser Seite noch einmal eine Zusammenstellung aller in Bürgel ansässig gewesenen Maurermeister und Maurergesellen zu finden. Die
MAURER in BÜRGEL Neben der Innungsdatei der Bürgeler Maurerinnug ist auf dieser Seite noch einmal eine Zusammenstellung aller in Bürgel ansässig gewesenen Maurermeister und Maurergesellen zu finden. Die
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden von Frank Buchali und Marco Keller Schloss von Westen
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Mannheim Schloss Mannheim- eine der größten Barockschlossanlagen der Welt von Frank Buchali und Marco
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Mannheim Schloss Mannheim- eine der größten Barockschlossanlagen der Welt von Frank Buchali und Marco
Kargowa und Schulzendorf eine gemeinsame Geschichte? Spurensuche
 Zur Anzeige wird der QuickTime Kargowa und Schulzendorf eine gemeinsame Geschichte? Spurensuche Vortrag Deutsch-polnisches historisches Forum in Kargowa am 15.06.2012 Dr. Heidi Burmeister Bei unseren Forschungen
Zur Anzeige wird der QuickTime Kargowa und Schulzendorf eine gemeinsame Geschichte? Spurensuche Vortrag Deutsch-polnisches historisches Forum in Kargowa am 15.06.2012 Dr. Heidi Burmeister Bei unseren Forschungen
Die preußische Rangerhöhung
 Geschichte Julia Neubert Die preußische Rangerhöhung Preußens Aufstieg zum Königreich um 1700 Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Der Tod des großen Kurfürsten und sein Erbe... 4 2.1
Geschichte Julia Neubert Die preußische Rangerhöhung Preußens Aufstieg zum Königreich um 1700 Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 2 2 Der Tod des großen Kurfürsten und sein Erbe... 4 2.1
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach
 Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
Siegelabgußsammlung im Stadtarchiv Rheinbach Überarbeitet: Juli 2000 Ergänzt: Juli 2000 a) Ritter von Rheinbach, Stadt- und Schöffensiegel im Bereich der heutigen Stadt Rheinbach 1 Lambert I. (1256-1276,
Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed
 Germanistik Susanne Fass Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed Examensarbeit Universität Mannheim Wissenschaftliche Arbeit im Fach Deutsch:
Germanistik Susanne Fass Vergleich künstlerischer, religiöser und gesellschaftlicher Motive in Goethes Prometheus und Ganymed Examensarbeit Universität Mannheim Wissenschaftliche Arbeit im Fach Deutsch:
Inhaltsverzeichnis Ulanen allgemein 1. Garde-Ulanen-Regiment 2. Garde-Ulanen-Regiment 3. Garde-Ulanen-Regiment
 Inhaltsverzeichnis Ulanen allgemein Tafeln 1 2: Alfred Arent. Geschichte der preußischen Ulanen von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegenwart; Köln 1893 1. Garde-Ulanen-Regiment Tafel 3: Tafel 4: Altwig
Inhaltsverzeichnis Ulanen allgemein Tafeln 1 2: Alfred Arent. Geschichte der preußischen Ulanen von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegenwart; Köln 1893 1. Garde-Ulanen-Regiment Tafel 3: Tafel 4: Altwig
Leben früh seine Prägung. Als Gerhard Fritz Kurt Schröder am 7. April 1944, einem Karfreitag, im Lippeschen geboren wird, steht das Deutsche Reich
 Der Aussteiger 1944 1966»Ich wollte raus da.«als er das im Rückblick auf seine jungen Jahre sagt, geht Gerhard Schröder auf die fünfzig zu. 1 Inzwischen hat er mehr erreicht, als man zu träumen wagt, wenn
Der Aussteiger 1944 1966»Ich wollte raus da.«als er das im Rückblick auf seine jungen Jahre sagt, geht Gerhard Schröder auf die fünfzig zu. 1 Inzwischen hat er mehr erreicht, als man zu träumen wagt, wenn
Inhalt. 99 Das nördliche Pfersee. Das südliche Pfersee. Spurensuche. Pfersee von oben. Wertach Vital
 Beatrice Schubert Angelika Prem Stefan Koch Inhalt 11 Spurensuche 19 Pfersee von oben 27 Entlang der Augsburger Straße von der Luitpoldbrücke bis Herz Jesu 26 und weiter bis zu Stadtgrenze 50 67 Das südliche
Beatrice Schubert Angelika Prem Stefan Koch Inhalt 11 Spurensuche 19 Pfersee von oben 27 Entlang der Augsburger Straße von der Luitpoldbrücke bis Herz Jesu 26 und weiter bis zu Stadtgrenze 50 67 Das südliche
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert
 Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
Die Bedeutung der napoleonischen Befreiungskriege für das lange 19. Jahrhundert Im Laufe seiner Eroberungskriege, verbreitete Napoleon, bewusst oder unbewusst, den, von der französischen Revolution erfundenen,
Grün markiert: Ausschüttung möglich mit Betrag / Vergleich 2013 und 2012
 Diese Übersicht wurde uns vom Bürgerforum Landsberg am Lech e.v. zur Verfügung gestellt: Verantwortlich: Dr. Rainer Gottwald, St.-Ulrich-Str. 11, 86899 Landsberg am Lech, Tel. 08191/922219; Mail: info@stratcon.de
Diese Übersicht wurde uns vom Bürgerforum Landsberg am Lech e.v. zur Verfügung gestellt: Verantwortlich: Dr. Rainer Gottwald, St.-Ulrich-Str. 11, 86899 Landsberg am Lech, Tel. 08191/922219; Mail: info@stratcon.de
Siegerliste der 62.Bayerischen Meisterschaften im Fingerhakeln
 Siegerliste der 62.Bayerischen Meisterschaften im Fingerhakeln 6. September 2015 Laufach Gau Spessart Jugend 1. Schuster Philipp Auerberg 6 Punkte 2. Socher Maximilian Auerberg 5 Punkte 3. Sigl Thomas
Siegerliste der 62.Bayerischen Meisterschaften im Fingerhakeln 6. September 2015 Laufach Gau Spessart Jugend 1. Schuster Philipp Auerberg 6 Punkte 2. Socher Maximilian Auerberg 5 Punkte 3. Sigl Thomas
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg
 Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Inhaltsverzeichnis Kürassiere allgemein Regiment der Gardes du Corps Garde-Kürassier-Regiment
 Inhaltsverzeichnis Kürassiere allgemein Tafeln 1-8 Die Kürassier- und Schweren Reiter-Regimenter der alten Armee. Feldgrau, 6. Jahrgang 1958, Sonderheft 10 Regiment der Gardes du Corps Tafel 9: Friedrich
Inhaltsverzeichnis Kürassiere allgemein Tafeln 1-8 Die Kürassier- und Schweren Reiter-Regimenter der alten Armee. Feldgrau, 6. Jahrgang 1958, Sonderheft 10 Regiment der Gardes du Corps Tafel 9: Friedrich
Die orientalische Waffensammlung des Prinzen Carl von Preussen Geschichte der Sammlung sowie Erstellung eines Bestandskataloges der Osmanica
 Die orientalische Waffensammlung des Prinzen Carl von Preussen Geschichte der Sammlung sowie Erstellung eines Bestandskataloges der Osmanica Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie
Die orientalische Waffensammlung des Prinzen Carl von Preussen Geschichte der Sammlung sowie Erstellung eines Bestandskataloges der Osmanica Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie
GESCHICHTE DER STADT WÜRZBURG. Band II. Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an das Königreich Bayern 1814 HERAUSGEGEBEN VON ULRICH WAGNER THEISS
 GESCHICHTE DER STADT WÜRZBURG Band II Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an das Königreich Bayern 1814 HERAUSGEGEBEN VON ULRICH WAGNER THEISS Inhalt Die Autoren Seite 18 Aspekte der vorindustriellen
GESCHICHTE DER STADT WÜRZBURG Band II Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an das Königreich Bayern 1814 HERAUSGEGEBEN VON ULRICH WAGNER THEISS Inhalt Die Autoren Seite 18 Aspekte der vorindustriellen
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Ich möchte ein neues Kleid für meine Geburtstagsparty kaufen. Ich kann bis 25 Euro ausgeben. Kommst du mit? In einer Stunde vor dem Einkaufszentrum?
 Musterarbeiten Test 1 - Teil 1 (S. 29) Hallo Markus! Hast du Lust auf ein bisschen Fußball? Ich bin gerade mit Simon auf dem Fußballplatz gegenüber der Schule. Wir wollen bis 6 Uhr hier bleiben. Also,
Musterarbeiten Test 1 - Teil 1 (S. 29) Hallo Markus! Hast du Lust auf ein bisschen Fußball? Ich bin gerade mit Simon auf dem Fußballplatz gegenüber der Schule. Wir wollen bis 6 Uhr hier bleiben. Also,
Sperrfrist: 21. Juni 2017, Uhr Es gilt das gesprochene Wort.
 Sperrfrist: 21. Juni 2017, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 70-jährigen Jubiläum
Sperrfrist: 21. Juni 2017, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 70-jährigen Jubiläum
Zeittafel von Helmstadt. Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt
 Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt 6000-4000 vor Christus (Jungsteinzeit) Bereits in diesem Zeitraum leben Menschen
Vorabdruck aus der Chronik von Helmstadt (erscheint Dez. 2004) mit freundlicher Genehmigung von Bertold Baunach, Helmstadt 6000-4000 vor Christus (Jungsteinzeit) Bereits in diesem Zeitraum leben Menschen
Vorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen in historischer und theoretischer Perspektive. PD Dr. Markus Bernhardt SS 2007
 Vorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen in historischer und theoretischer Perspektive PD Dr. Markus Bernhardt SS 2007 6. Vorlesung Geschichte des Geschichtsunterrichts 2: Kaiserreich, Weimarer
Vorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen in historischer und theoretischer Perspektive PD Dr. Markus Bernhardt SS 2007 6. Vorlesung Geschichte des Geschichtsunterrichts 2: Kaiserreich, Weimarer
Karl Wieghardt Theoretische Strömungslehre
 Karl Wieghardt Theoretische Strömungslehre erschienen als Band 2 in der Reihe Göttinger Klassiker der Strömungsmechanik im Universitätsverlag Göttingen 2005 Karl Wieghardt Theoretische Strömungslehre Universitätsverlag
Karl Wieghardt Theoretische Strömungslehre erschienen als Band 2 in der Reihe Göttinger Klassiker der Strömungsmechanik im Universitätsverlag Göttingen 2005 Karl Wieghardt Theoretische Strömungslehre Universitätsverlag
a) Unterstreiche in grün durch welche Mittel die Vergrößerung des Herrschaftsgebietes erreicht wurde.
 M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
M1: Der Aufstieg Brandenburg-Preußens zum Königtum Seit 1415 herrschten die Hohenzollern als Kurfürsten in Brandenburg. Friedrich III. wurde unter dem Namen Friedrich I. von Preußen zum König. Durch geschickte
Unterfränkische Geschichte
 Unterfränkische Geschichte Herausgegeben von Peter Kolb und Ernst-Günter Krenig Band 4/1 Vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Eingliederung in das Königreich Bayern Im Auftrag des Bezirks Unterfranken
Unterfränkische Geschichte Herausgegeben von Peter Kolb und Ernst-Günter Krenig Band 4/1 Vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Eingliederung in das Königreich Bayern Im Auftrag des Bezirks Unterfranken
Kurze Geschichte des Dekanates Fürth
 Kurze Geschichte des Dekanates Fürth Durch die Übernehme der Reformation wurde die Bevölkerung Fürths evangelischlutherisch; zudem wanderten im 16. und 17. Jahrhundert reformierte Bevölkerungsgruppen in
Kurze Geschichte des Dekanates Fürth Durch die Übernehme der Reformation wurde die Bevölkerung Fürths evangelischlutherisch; zudem wanderten im 16. und 17. Jahrhundert reformierte Bevölkerungsgruppen in
Dipl. Ing. Sabine Fritsch April 2006
 Die Wiener Hofburg Kaiser Franz Josef I. Kaiserin Elisabeth Die Wiener Hofburg Unser Lehrausgang führt uns zur Wiener Hofburg in der Inneren Stadt. Nach dem Verlassen der U Bahn stehen wir auf dem Stephansplatz.
Die Wiener Hofburg Kaiser Franz Josef I. Kaiserin Elisabeth Die Wiener Hofburg Unser Lehrausgang führt uns zur Wiener Hofburg in der Inneren Stadt. Nach dem Verlassen der U Bahn stehen wir auf dem Stephansplatz.
Neuer Film über die Produktion von Pressglas in Portieux um 2010 im Glas- und Heimatmuseum Warndt und neue Produkte im Museumsshop
 Abb. 2011-1/219 Cristallerie Portieux 2010, Eingang, Bilder Valentin, Film des Informations- und Medienzentrums (IMZ) Regionalverband Saarbrücken Burkhardt Valentin Februar 2011 Neuer Film über die Produktion
Abb. 2011-1/219 Cristallerie Portieux 2010, Eingang, Bilder Valentin, Film des Informations- und Medienzentrums (IMZ) Regionalverband Saarbrücken Burkhardt Valentin Februar 2011 Neuer Film über die Produktion
Bewährtes für Sie aus guten Händen. Zuverlässig vor Ort: Unser CREATON Verkaufsteam rund um den Standort Dorfen berät und informiert Sie gerne.
 Bewährtes für Sie aus guten Händen. Zuverlässig vor Ort: Unser CREATON Verkaufsteam rund um den Standort Dorfen berät und informiert Sie gerne. 2I3 Wir sind für Sie da. Vorwort Seit der Bekanntmachung
Bewährtes für Sie aus guten Händen. Zuverlässig vor Ort: Unser CREATON Verkaufsteam rund um den Standort Dorfen berät und informiert Sie gerne. 2I3 Wir sind für Sie da. Vorwort Seit der Bekanntmachung
Im Wolfratshauser Märchenwald wird ein Märchen wahr Altes Burgmodell wiederentdeckt
 Im Wolfratshauser Märchenwald wird ein Märchen wahr Altes Burgmodell wiederentdeckt Das erste (bekannte) Burgmodell Wolfratshausens Initiatoren dieses ersten bekannten Modells waren Hans Winibald und Alois
Im Wolfratshauser Märchenwald wird ein Märchen wahr Altes Burgmodell wiederentdeckt Das erste (bekannte) Burgmodell Wolfratshausens Initiatoren dieses ersten bekannten Modells waren Hans Winibald und Alois
Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz
 Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Karl Erhard Schuhmacher Königliche Hoheiten aus England zu Gast in der Pfalz Lebensbilder aus dem Hochmittelalter verlag regionalkultur Inhaltsverzeichnis Einleitung... 6 Mathilde von England: Kaiserin
Theorie der Neuankömmlinge widerlegt Die älteste Fichte der Damit wären die schwedischen Fichten die ältesten Bäume der Welt. Welt
 Ältester Baum der Welt entdeckt Fichte in den schwedischen Bergen erreicht Alter von 9.550 Jahren Den ältesten Baum der Welt haben Wissenschaftler jetzt im schwedischen Dalarna entdeckt. Die 9.550 Jahre
Ältester Baum der Welt entdeckt Fichte in den schwedischen Bergen erreicht Alter von 9.550 Jahren Den ältesten Baum der Welt haben Wissenschaftler jetzt im schwedischen Dalarna entdeckt. Die 9.550 Jahre
Belgien. Karten für die Setzleiste folieren und auseinander schneiden. Mischen und die Karten gruppieren lassen.
 Landes ist Brüssel. Hier ist auch der Verwaltungssitz der EU. Flandern ist es sehr flach. Im Brabant liegt ein mittelhohes Gebirge, die Ardennen. Die Landschaft ist von vielen Schiffskanälen durchzogen.
Landes ist Brüssel. Hier ist auch der Verwaltungssitz der EU. Flandern ist es sehr flach. Im Brabant liegt ein mittelhohes Gebirge, die Ardennen. Die Landschaft ist von vielen Schiffskanälen durchzogen.
Der Holzschnitt der Künstlergemeinschaft "Brücke"
 Medien Hannah Gerten Der Holzschnitt der Künstlergemeinschaft "Brücke" Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Die Anfänge der Brücke Dresden... 2 2.1 Die Gründung der Brücke -Künstlergemeinschaft...
Medien Hannah Gerten Der Holzschnitt der Künstlergemeinschaft "Brücke" Studienarbeit Inhalt 1 Einleitung... 1 2 Die Anfänge der Brücke Dresden... 2 2.1 Die Gründung der Brücke -Künstlergemeinschaft...
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die 16 Bundesländer. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de DOWNLOAD Jens Eggert Downloadauszug aus dem Originaltitel: Name: Datum: 21
Jahre. Internationale Spedition
 1919 1969 50 Jahre Internationale Spedition 50 Jahre Internationale Spedition 1919 1969 Hamburg, im Oktober 1969 So fing es damals an - 1919 Der Gründer der Firma Herr Paul Weidlich m 1. Nachkriegsjahr
1919 1969 50 Jahre Internationale Spedition 50 Jahre Internationale Spedition 1919 1969 Hamburg, im Oktober 1969 So fing es damals an - 1919 Der Gründer der Firma Herr Paul Weidlich m 1. Nachkriegsjahr
Schmelzöfen, Schliffe und Design Die Leichlinger Glashütte Rheinkristall ( )
 Schmelzöfen, Schliffe und Design Die Leichlinger Glashütte Rheinkristall (1948 1964) Anfänge 1948 ist es der Sand, der den Ausschlag für die Neuansiedlung eines heute nur noch wenig beachteten Industriezweigs
Schmelzöfen, Schliffe und Design Die Leichlinger Glashütte Rheinkristall (1948 1964) Anfänge 1948 ist es der Sand, der den Ausschlag für die Neuansiedlung eines heute nur noch wenig beachteten Industriezweigs
Adolf Hitler. Der große Diktator
 Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
Adolf Hitler Der große Diktator Biografie Die frühen Jahre Herkunft, Kindheit und erster Weltkrieg Aufstieg Polit. Anfänge, Aufstieg und Kanzlerschaft Der Diktator Politische Ziele und Untergang Hitlers
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali
 Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
Burgen und Schlösser in Nordrhein-Westfalen Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Königswinter-Ittenbach Löwenburg- Ruine hoch über dem Siebengebirge von Frank Buchali Südlich von
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere
 Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Die Glocken von St. Michael Perlach
 Die Glocken von St. Michael Perlach St. Michael Perlach nach der Renovierung im Sommer 1979 Der Kirchturm von St. Michael Perlach beherbergt folgende fünf Glocken: Nr. Name Bild und Inschrift Durchmesser
Die Glocken von St. Michael Perlach St. Michael Perlach nach der Renovierung im Sommer 1979 Der Kirchturm von St. Michael Perlach beherbergt folgende fünf Glocken: Nr. Name Bild und Inschrift Durchmesser
Vereinigung Europäischer Journalisten e.v.
 Vereinigung Europäischer Journalisten e.v. 60 Jahre Römische Verträge Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, unter zeichneten die Regierungschefs aus Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden
Vereinigung Europäischer Journalisten e.v. 60 Jahre Römische Verträge Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, unter zeichneten die Regierungschefs aus Italien, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden
Vormerkstelle des Freistaates Bayern
 Vormerkstelle des Freistaates Bayern Übersichten der Vorbehaltstellen aus den Einstellungsjahren 2009 bis 2016 für den Einstieg als Beamter/in in der dritten Qualifikationsebene im Bereich des nichttechnischen
Vormerkstelle des Freistaates Bayern Übersichten der Vorbehaltstellen aus den Einstellungsjahren 2009 bis 2016 für den Einstieg als Beamter/in in der dritten Qualifikationsebene im Bereich des nichttechnischen
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg
 Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Das große Landeswappen von Baden-Württemberg Baden-Württemberg ist als deutsches Bundesland erst im Jahr 1952 entstanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet von Baden-Württemberg
Zur Restaurierung des Epitaphs für Katharina Rybisch in der Kirche St. Elisabeth in Breslau / Wrocław (2006)
 Das Epitaph für Katharina Rybisch, das dank einer freundlichen Zuwendung des Hessischen Sozialministeriums noch im Jahr 2006 restauriert werden kann, ist das wohl letzte Denkmal und Zeichen auf die in
Das Epitaph für Katharina Rybisch, das dank einer freundlichen Zuwendung des Hessischen Sozialministeriums noch im Jahr 2006 restauriert werden kann, ist das wohl letzte Denkmal und Zeichen auf die in
