Kanton und Gemeinden fördern eine umweltschonende, diversifizierte, dezentrale und sichere Energieversorgung mit folgenden Prioritäten:
|
|
|
- Jacob Giese
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Allgemeines Das oberste Ziel der politik ist die Förderung einer volkswirtschaftlich optimalen, nachhaltigen und sicheren versorgung. Die ist dabei unter Schonung der Umwelt zu gewinnen und zu nutzen. Im Vordergrund stehen Massnahmen zur Erhöhung der effizienz sowie die Förderung von CO 2 -neutralen, erneuerbaren und umweltverträglichen n. Für den Zeitraum 2050 bis 2080 wird die Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft angestrebt. Kanton und Gemeinden fördern eine umweltschonende, diversifizierte, dezentrale und sichere versorgung mit folgenden Prioritäten: Planungsgrundsatz A Planungsgrundsatz B 1. Erhöhung der effizienz von Gebäuden und Anlagen. 2. Ausschöpfung der Potenziale bei der Nutzung erneuerbarer n, wobei den einheimischen Potenzialen besondere Beachtung zu schenken ist. 3. Reduktion der CO 2 -Emissionen und Minderung der Abhängigkeit von fossilen Brenn- und Treibstoffen. 4. Ausbau der Elektrizität aus erneuerbaren n mit dem Ziel, den Anteil der Elektrizität aus Kernenergie langfristig zu ersetzen. 5. Mittelfristig Stabilisierung und langfristig Reduktion der Elektrizitätsnachfrage. Im Nachgang zur Reaktorkatastrophe von Fukushima haben Bundesrat und Parlament 2011 den Grundsatzentscheid für einen schrittweisen Ersatz der Kernenergie gefällt. Dieser Entscheid und weitere Entwicklungen haben den Bund zur Ausarbeitung der strategie 2050 bewogen. Der Regierungsrat befürwortet die Grundsatzentscheide zur strategie Die Thurgauer politik basiert auf dem nutzungsgesetz (EnG; RB 731.1) samt Verordnung (RRV nutzung; RB ). Am 7. März 2014 hat der Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrates das «Konzept für einen Thurgauer Strommix ohne Kernenergie» zur Kenntnis genommen. Es enthält verschiedene Massnahmen und geht von folgenden Zielen aus: Die Stabilisierung beziehungsweise die Senkung der Stromnachfrage hat oberste Priorität. Bis 2020 soll der Stromverbrauch um 45 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr gegenüber 2010 gesenkt werden. Das KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 1 / 15
2 sind rund 2,5 Prozent des heutigen Stromverbrauchs. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Unabhängigkeit möglichst hoch zu halten, wird der produktion auf Kantonsgebiet grössere Bedeutung beigemessen. Bis 2020 sollen zusätzlich 70 GWh pro Jahr erneuerbarer Strom produziert werden. Im Vergleich zum heutigen Stromverbrauch sind dies knapp über 4 Prozent. Im Jahr 2020 sollen im Kanton 80 GWh Elektrizität pro Jahr mit wärmegeführten Wärmekraftkoppelungsanlagen produziert werden. Zur Erhöhung der effizienz von Gebäuden und Anlagen sollen bei Gestaltungsplänen künftig höhere Anforderungen an die effiziente nutzung gestellt werden, indem beispielsweise in Sonderbauvorschriften der «MINERGIE»- oder «MINERGIE-P»-Baustandard vorgeschrieben wird. Diese Baustandards beinhalten ein beträchtliches Potenzial zur Steigerung der effizienz. Baureglemente sind von Hindernissen zur effizienten nutzung zu befreien. Planungsauftrag A Die Gemeinden im Urbanen Raum und im Kompakten Siedlungsraum mit mehr als 2000 Einwohnern erstellen bis 2022 einen umfassenden kommunalen richtplan. Darin sind die Möglichkeiten der verstärkten Nutzung erneuerbarer träger zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung und der quartierweisen Wärmeversorgung aufzuzeigen. Der kommunale richtplan umfasst insbesondere: die Gebiete, die mittel- und langfristig für eine wirtschaftliche Erschliessung mit leitungsgebundenen trägern geeignet sind, die Gebiete, die für eine mögliche Fernwärmeversorgung geeignet sind, die Standorte für grössere anlagen sowie die Verteilinfrastruktur für leitungsgebundene träger, mögliche Standorte für grosse Wärmepumpenanlagen zur Nutzung der Wasserwärme aus Bodensee und Rhein (Auftrag gilt nur für Anliegergemeinden), Massnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs fossiler träger und elektrischer sowie zur Förderung erneuerbarer n, einen Terminplan zur Erreichung des Labels «stadt». Federführung: Gemeinden (Urbaner Raum/Kompakter Siedlungsraum) Beteiligte: Termin: 2022 Seite 2 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
3 Mit dem Instrument des kommunalen richtplans können Gemeinden, die auf einer vertieften Analyse basierenden geeigneten Massnahmen für eine nachhaltige versorgung festlegen. Das Label «stadt» ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale politik vorleben und umsetzen. städte fördern erneuerbare n, umweltverträgliche Mobilität und setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Zahlreiche Thurgauer Gemeinden führen bereits das Label «stadt», einige davon verfügen zudem über ein eigenes förderprogramm. Diese Gemeinden können durch den konsequenten Vollzug des gesetzes, durch planerische Massnahmen zugunsten einheimischer träger und eigene finanzielle Förderprogramme wichtige Impulse setzen. KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 3 / 15
4 netze Elektrizitätsnetz Planungsgrundsatz C Planungsgrundsatz D Zwischenergebnis A Ausgangslage Eine wirtschaftliche, effiziente, sichere und umweltverträgliche Versorgung des Kantons mit elektrischer ist zu gewährleisten. Die bestehenden Netze sind zu optimieren, ihre Effizienz ist zu erhöhen. Bei Neu- und Umbauten von Hoch- und Höchstspannungsleitungen ist die Erdverlegung gegenüber der Freileitung vorzuziehen. Leitungen mit 110 Kilovolt (kv) und weniger sind ausnahmslos im Erdreich zu verlegen. Folgende Vorhaben sind geplant: Unterwerk in Romanshorn (EKT/SN ) Unterwerk in Ifwil mit 110 kv-netzanschluss Ersatz der Hochspannungsfreileitung zwischen den Unterwerken Hasli (EKT) und Schlattingen (Axpo) durch Verlegen eines 110 kv Kabels Die Ausgangslage bilden die auf der Richtplankarte eingezeichneten Leitungen (Netzebene 3) und Unterwerke (Netzebene 4). Einen grossen Teil der elektrischen muss der Kanton heute importieren. Durch die Förderung erneuerbarer n (z.b. Strom aus Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie) soll der Import reduziert werden. Mit der Zunahme der Elektrizitätserzeugung aus kleinen, dezentralen Anlagen und deren Einbindung in die Netzinfrastruktur sowie der intelligenten Steuerung von Stromangebot und -nachfrage erhält die regionale und überregionale Verteilung der elektrischen eine besondere Bedeutung. Eine effiziente Netzstruktur beeinflusst die Kosten der Elektrizität beim Endkonsumenten direkt. Die Erdverlegung von Hochspannungsleitungen bietet aus Gründen des Umwelt- und Landschaftsschutzes und aus energiepolitischen Erwägungen Vorteile. Letztere beziehen sich insbesondere auf die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren und die geringere Anfälligkeit gegenüber Naturgefahren und damit insgesamt auf eine höhere Versorgungssicherheit. Sollen Freileitungen erstellt oder bei Umbauten beibehalten werden, muss die Freileitung gemäss dem «Bewertungsschema für Übertra- Seite 4 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
5 gungsleitungen» des Bundesamts für (BFE, 2013) besser bewertet sein als eine Erdverlegung. Erdgasnetz Die Versorgung mit Erd- und Biogas soll in bereits erschlossenen Gebieten mit hoher Wärmedichte erfolgen. Werden biogene Abfälle in der Nähe des Erdgasnetzes vergärt, soll das Biogas prioritär ins Gasnetz eingespeist werden. Die Gasversorgungssicherheit ist mit folgenden Massnahmen und Prioritäten zu verbessern: 1. Einspeisung von in der Region erzeugtem Biogas 2. Bau von Speicheranlagen 3. Bau zusätzlicher Ring- und Stichleitungen Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sind folgende Leitungen geplant: Leitung von Bischofszell Richtung Bodensee mit Weiterführung nach Deutschland Leitung von Amlikon nach Konstanz Die Ausgangslage bilden die auf der Übersichtskarte «netze» eingetragenen Gasleitungen und Gasversorgungen/Abnahme stationen sowie die mit Erdgas versorgten Gebiete. Erdgas deckt rund einen Fünftel der nachfrage im Kanton Thurgau. Die meisten Gemeinden sind heute mit Erdgas erschlossen. Die Gasversorgung erfolgt namentlich durch die Erdgas Ostschweiz AG (EGO) und entlang dem Untersee durch die Stadtwerke Konstanz. Die EGO hat in den letzten Jahren das überregionale Transportnetz durch Hochdruckleitungen ergänzt. Für die Versorgung von Gemeinden und Quartieren spielen Ringleitungen eine wichtige Rolle. Dabei geht die Versorgungsleitung ringförmig vom Einspeisepunkt weg. Da die meisten Kunden in diesem Fall über zwei Leitungswege erreichbar sind, ist die Versorgungssicherheit gegenüber einer Stichleitung höher. Planungsgrundsatz E Planungsgrundsatz F Vororientierung A Ausgangslage Ab einem Wärmebedarf von 400 Megawattstunden (MWh) pro Hektare kann von hoher Wärmedichte gesprochen werden. Dies sind Gebiete mit hohem Altbaubestand sowie dichter und hoher Bebauung (z.b. Altstadtgebiete) oder Gebiete mit Altersheimen, Spitälern usw. KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 5 / 15
6 Wärmeverbundnetze Planungsgrundsatz G Planungsgrundsatz H Es sind zentrale Wärmeversorgungsanlagen anzustreben, insbesondere solche mit Nutzung erneuerbarer quellen oder von Abwärme. Mit nutzungsplanerischen Massnahmen sind die Voraussetzungen zu schaffen, damit anfallende Abwärme aus industriellen oder anderen Prozessen soweit sinnvoll genutzt werden kann. In Gebieten, die im kommunalen Richtplan für eine mögliche Fernwärmeversorgung vorgesehen sind, kann der Anschluss von Neubauten und bestehenden Bauten an das Wärmeverbundnetz vorgeschrieben werden. Im Kanton existieren bereits einige grössere Wärmeverbundnetze. Im Wärmeverbund Frauenfeld wird Niedertemperaturwärme aus der Abwasserreinigungsanlage verteilt, mit der dezentrale Wärmepumpen Heizwärme für Gebäude erzeugen. In einem späteren Ausbauschritt kann die Abwärme aus Kühlanlagen mittels Wärmenetz genutzt werden. Alle anderen Wärmeverbünde stellen Hochtemperaturwärme zur Verfügung, die direkt zum Heizen verwendet wird. Bei allen Wärmeverbünden sollen möglichst viele Gebäude im jeweiligen Versorgungsgebiet angeschlossen werden (Netzverdichtung), damit sie effizient betrieben werden und Wärme kostengünstig anbieten können. Die Übersichtskarte «netze» zeigt die mit erneuerbaren n betriebenen Wärmeverbünde mit mehr als 1 Kilometer Leitungslänge. Daneben existieren auch kleinere Verbundsysteme für einige wenige Gebäude, sogenannte Nahwärmenetze. Sie machen in dicht überbauten Siedlungsgebieten die Nutzung von Abwärme aus nah gelegenen Kläranlagen, Industriebetrieben, grösseren Holzschnitzelfeuerungen, Biogasanlagen oder Wärmekraftkoppelungsanlagen möglich. Ein Gestaltungsplan oder die Ausscheidung einer überlagernden Fernwärmezone ist nebst der Verpflichtung der regelmässigen abgabe durch den Produzenten und genügend Abnehmern Voraussetzung dafür, dass allenfalls eine Anschlusspflicht festgelegt werden kann. Seite 6 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
7 Erneuerbare träger Allgemeines Die Nutzung von und die Versorgung mit erneuerbarer aus Wasser, Sonne, Wind, Biomasse und Umweltwärme sowie die Abwärmenutzung sind verstärkt auszubauen. Der Anteil der Elektrizität aus erneuerbaren und möglichst einheimischen quellen ist zu erhöhen. Langfristig könnte der Wärmebedarf im Kanton Thurgau vollumfänglich aus lokal produzierten erneuerbaren n gedeckt werden. Im Gegensatz dazu kann der Elektrizitätsbedarf im Kanton Thurgau auch unter Ausnützung der Effizienzpotenziale voraussichtlich nicht durch lokal verfügbare erneuerbare n gedeckt werden. Investitionen und Beteiligungen an Projekten in der übrigen Schweiz und im Ausland sind deshalb nötig, sinnvoll und auch wirtschaftlich interessant. Eine Erhöhung von direkten Beteiligungen an Produktionsanlagen ist anzustreben. Planungsgrundsatz I Planungsgrundsatz J Wasserkraft Die bestehenden Anlagen zur Wasserkraftnutzung sind möglichst zu erneuern und auszubauen. Ein massvoller Neubau von Anlagen ist möglich, sofern die ökologischen, gewässerschutzrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen eingehalten werden. Das Potenzial der Wasserkraft im Kanton Thurgau ist aufgrund fehlender grosser Gefälle beschränkt. Umso wichtiger ist es, die bestehenden Anlagen zu optimieren. Die Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren n» zeigt auf, wo im Kanton Thurgau die Wasserkraft genutzt wird. Planungsgrundsatz K Biomasse Die Verbrennung von holz aus dem Wald und von Holzabfällen in modernen Anlagen (z.b. Holzschnitzelfeuerungen) ist zu fördern und die Kombination mit der Erzeugung von Elektrizität (Holzheizkraftwerke) anzustreben. Planungsgrundsatz L KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 7 / 15
8 Planungsgrundsatz M Planungsgrundsatz N Planungsgrundsatz O Die Vergärung mit Nutzung der ist der reinen Kompostierung zwingend vorzuziehen. Hofdünger soll, soweit angemessen, energietechnisch genutzt werden. Auf die Produktion von Biomasse zur produktion (ausser Abfallprodukten) ist zu verzichten, wenn die Anbauflächen auch zur Nahrungsmittelproduktion eingesetzt werden können. Bereits im Jahr 2011 wurde im Kanton Thurgau das Potenzial von holz erhoben und im Bericht «Nutzung holz: Aktueller Stand» festgehalten. Bei der energetischen Nutzung der Biomasse (feucht und trocken) besteht ein Potenzial von rund 75 GWh (Elektrizität und Wärme). Die Erhebung wird 2016 aktualisiert. Im Februar 2014 hat der Regierungsrat das «Konzept Biomasse Thurgau» verabschiedet. Dieses befasst sich mit der Erhebung und Erschliessung des energetischen Potenzials der biogenen Abfälle (Speisereste, Küchenabfälle, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, Grüngut, Abfälle aus Landschaftspflege u.a.) und von Hofdünger (Gülle, Mist). Bei der Nutzung der Biomasse gilt das Kaskadenprinzip «Teller-Trog-Tank». Pflanzen dienen in erster Linie der menschlichen Nahrung, in zweiter Linie der Futtermittelproduktion und erst in letzter Priorität der Erzeugung von Brenn- und Treibstoffen. Bei der Kompostierung und Vergärung sollen Stoffkreisläufe geschlossen und entsprechende Anlagen so erstellt werden, dass kurze Transportwege entstehen (vgl. Planungsgrundsatz 4.4 N). Da die Aufbereitung von Biogas für die Einspeisung ins Erdgasnetz aufwendig ist, steht die Stromproduktion aus Biogas mit anschliessender Nutzung der Abwärme im Vordergrund (sogenannte Wärmekraftkoppelung), sofern sich die Anlagen nicht in unmittelbarer Nähe zum Erdgasnetz befinden. Dabei ist der Brennstoff optimal zu nutzen, das heisst die Abwärme ist fachgerecht und weitgehend zu nutzen. Sonnenenergie Planungsgrundsatz P Anlagen zur Gewinnung von Wärme und Elektrizität aus Sonnenenergie sind zu fördern und primär auf oder an Gebäuden zu realisieren. Das technisch-ökologische Potenzial der Photovoltaik ist sehr gross. Mit den zu erwartenden technischen Fortschritten und Kostensenkungen wird sich auch das wirtschaftliche Potenzial deutlich erhöhen. Die angestrebten Produktionsziele bis zu 360 GWh im Jahr 2050 entsprechen ei- Seite 8 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
9 ner durchschnittlichen Produktionsfläche von rund 8 bis10 Quadratmetern pro Einwohner (Dach- und/oder Fassadenfläche). Die thermische Solarnutzung ist überall dort sinnvoll, wo auch im Sommerhalbjahr grosse Wärmemengen benötigt werden. Dies betrifft vor allem Wohngebäude, Hotels, Hallenbäder sowie Industrieanlagen (Reinigungs- und Trockenprozesse von 80 bis 100 C). Der Kanton hat die Richtlinie «Solaranlagen richtig gut» zur sorgfältigen Integration von Solaranlagen erarbeitet. Windenergie Das Potenzial der lokal vorhandenen Windkraft ist vor allem mittels Grosswindanlagen zu erschliessen. Die Nutzung der Windkraft mittels Grosswindanlagen hat dabei in den acht Windpotenzialgebieten zu erfolgen, die auf der Übersichtskarte «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren n» ausgeschieden sind. Der Kanton Thurgau verfügt über ein Potenzial zur Nutzung der Wind energie. Für die Erschliessung dieses Potenzials kommen im Wesentlichen zwei Anlagetypen in Frage: Klein- und Grosswindanlagen. Eine Kleinwindanlage verfügt über eine Gesamthöhe von maximal 30 Meter und über Rotordurchmesser zwischen 10 und 20 Meter. Ihre Leistung beträgt maximal wenige 100 Kilowatt (kw). Bei den derzeit marktgängigen Anlagen liegt die Leistung in der Regel zwischen 5 und 10 kw. Demgegenüber verfügt eine Grosswindanlage typischerweise über eine Nabenhöhe von 100 bis 140 Meter, über einen Rotordurchmesser von 50 bis 100 Meter und über eine Leistung von mehr als 1 Megawatt (MW). Planungsgrundsatz Q Die kantonale Studie zu Kleinwindanlagen aus dem Jahr 2002 ergab ein Potenzial von 1,2 GWh pro Jahr. Aufgrund dieses geringen Potenzials und der oft fehlenden Wirtschaftlichkeit stehen Kleinwindanlagen im Kanton Thurgau nicht im Fokus. Das Potenzial für Grosswindanlagen im Kanton Thurgau ist 2014 mittels einer breit angelegten Studie erhoben worden. 10 bis 15 Prozent des heutigen Stromverbrauchs des Kantons Thurgau könnten mit Windstrom gedeckt werden. Im September 2014 hat der Regierungsrat diese «Windpotenzialstudie Kanton Thurgau» zur Veröffentlichung freigegeben. Das Ergebnis der Studie sind die acht auf der Übersichtskarte KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 9 / 15
10 «Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren n» ausgeschiedenen Windpotenzialgebiete Salen-Reutenen, Thundorf, Eschlikon/Littenheid, Braunau/Wuppenau, Ottenberg, Rodebärg, Cholfirst sowie Bichelsee/ Fischingen. Einerseits erlauben die Windverhältnisse in diesen Gebieten einen wirtschaftlichen Betrieb von Grosswindanlagen, andererseits verfügen diese Gebiete über Flächen, die nur geringen Nutzungskonflikten ausgesetzt sind. Die Planung und Realisierung von Grosswindanlagen erfordert neben dem ordentlichen Baubewilligungsverfahren die Durchführung des Nutzungsplanverfahrens (Rahmennutzungsplan und gegebenenfalls Sondernutzungsplan). Bei einem konkreten Bauvorhaben innerhalb eines Windpotenzialgebiets ist auf jeden Fall der Nachweis der Standorteignung zu erbringen. Massgebend sind dafür die verschiedenen in der «Windpotenzialstudie Kanton Thurgau» ausgeschiedenen Ausschluss- und Abwägungskriterien. So dürfen an Orten, die mit einem Ausschlusskriterium belegt sind, keine Windenergieanlagen erstellt werden. Demgegenüber sind an Standorten, die unter ein Abwägungskriterium fallen, Windenergieanlagen möglich, sofern die in diesen Gebieten erforderlichen weiteren spezifischen Abklärungen oder Interessenabwägungen zu einem positiven Ergebnis führen. Als Beispiel für ein Abwägungskriterium, das in jedem Fall eine sehr sorgfältige Interessenabwägung erfordert, können die BLN-Gebiete genannt werden. Drei der acht ausgeschiedenen Windpotenzialgebiete befinden sich ganz oder zumindest teilweise innerhalb eines BLN-Gebiets. Geothermie Planungsgrundsatz R Planungsgrundsatz S Die Nutzung von Umweltwärme aus dem Erdreich (untiefe Geothermie) ist zu verstärken, insbesondere in den dicht besiedelten Gebieten. Der Kanton koordiniert und unterstützt die Nutzung der tiefen Geothermie zur Strom- und Wärmeproduktion. Anlagen sind insbesondere an Standorten zu erstellen, an denen eine grosse Wärmenachfrage besteht. Neben der Stromerzeugung ist auch die Wärmeversorgung industrieller Grossverbraucher, von Wärmenetzen usw. durch die tiefe Geothermie zu ermöglichen. Seite 10 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
11 Der Kanton erarbeitet Grundlagen für die Festsetzung von Gebieten, die sich für die Nutzung der tiefen Geothermie besonders eignen. Planungsauftrag B Federführung: Kanton (AfU) Beteiligte: Kanton (Abt., ARE) Termin: 2019 Die Geothermie kann einen wichtigen Beitrag zur CO 2 -armen Wärmegewinnung und Stromerzeugung leisten. Zur Förderung der untiefen und tiefen Geothermie wurde ein kantonales Geothermie-Nutzungskonzept erstellt mit dessen Umsetzung optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung der Geothermie auf dem Kantonsgebiet geschaffen werden sollen (RRB Nr. 555 vom 26. Juni 2012). Die untiefe Geothermie wird vor allem zur Wärmegewinnung und Kühlung im Gebäudebereich eingesetzt. Zur untiefen Geothermie gehören unter anderem Grundwassernutzungen und Wärmenutzungen mittels Erdwärmesonden, Erdwärmekörben, Erdregistern oder pfählen. Dabei wird die Wärme aus Boden und Wasser mittels Wärmepumpen auf das notwendige Temperaturniveau gehoben. Im Gegensatz zu Wärmepumpen, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzen, verursachen Anlagen zur Nutzung der untiefen Geothermie keine Geräuschemissionen und haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad. Sie eignen sich deshalb insbesondere für dicht besiedelte, urbane Gebiete. Hinsichtlich der Wärmenutzung der untiefen Geothermie verfügt der Kanton über eine Erdwärmenutzungskarte ( > Karten > Umwelt > Erdwärme), die die Gebiete zeigt, in denen Erdwärmesonden zulässig sind. Die Karte wird laufend neu beurteilt, um weitere Gebiete mit nicht nutzbarem Grundwasservorkommen freigeben zu können. Ab zirka 500 Meter Tiefe kann mit der tiefen Geothermie Wärme und ab einer Temperatur von 100 C auch Strom bereitgestellt werden. Für diese Temperaturen sind allerdings Bohrtiefen von 3000 bis 4000 Metern notwendig. Das Potenzial zur Stromerzeugung mittels der tiefen Geothermie liegt gemäss aktuellen Schätzungen bei zirka 360 GWh pro Jahr. Ob und in welchem Zeitraum dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, ist wegen technischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten unklar. Der Kanton verfolgt die Vision, dass bis zum Jahr 2022 mindestens ein Geothermie-Kraftwerk zur Stromversorgung beiträgt. KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 11 / 15
12 Aufgrund des notwendigen Ersatzes der wegfallenden Kernenergie steht bei der Nutzung der tiefen Geothermie die Stromproduktion im Vordergrund. Trotzdem soll im Sinne einer nachhaltigen nutzung bei Tiefengeothermie-Kraftwerken auch die anfallende Wärme genutzt werden. Es sind deshalb Standorte zu wählen, an denen eine grosse Wärmenachfrage besteht (z.b. industrielle Grossverteiler, Wärmenetze). Im Idealfall befinden sich konstante Wärmebezüger (z.b. in Industriegebieten) in unmittelbarer Nähe von tiefengeothermischen Stromerzeugungsanlagen. Bei der Erstellung von Pilot- und Demonstrationsanlagen zur Stromproduktion kann vom Planungsgrundsatz der zeitgleichen direkten Wärmenutzung abgewichen werden. Ein möglicher Standort für eine Pilot- und Demonstrationsanlage liegt in der Gemeinde Wagenhausen (Etzwilen). Durch die Nutzung der tiefen Geothermie wird dort von der Geo- Suisse AG eine Anlage zur petrothermalen Stromproduktion geplant. Seite 12 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
13 KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 13 / 15
14 Seite 14 / 15 Ziffer 4. / KRP TG, Entwurf Mai 2016
15 KRP TG, Entwurf Mai 2016 / 4. Ziffer Seite 15 / 15
Ver- und Entsorgung 4.2 Energie
 4.2 Energie Allgemeines Energie ist möglichst nachhaltig unter Schonung von Landschaft und Umwelt zu gewinnen und zu nutzen. Im Vordergrund stehen Massnahmen zur Eindämmung von Energieverlusten sowie die
4.2 Energie Allgemeines Energie ist möglichst nachhaltig unter Schonung von Landschaft und Umwelt zu gewinnen und zu nutzen. Im Vordergrund stehen Massnahmen zur Eindämmung von Energieverlusten sowie die
Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050
 Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
Raumplanungsgruppe Nordostschweiz des VLP-ASAN Frauenfeld, 18. September 2012 Raumplanerische Konsequenzen der neuen Energiestrategie 2050 Reto Dettli Managing Partner Inhalt Die neue Energiestrategie:
FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 2011
 Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Baudirektion FAKTENBLATT ERNEUERBARE ENERGIEN IM KANTON ZUG Beilage zur Medienmitteilung vom 26. Januar 211 Das vorliegende Faktenblatt fasst die Ergebnisse der Studie "Erneuerbare Energien im Kanton Zug:
Biomassekonzept Thurgau
 Amt für Umwelt Inhalte Politischer Auftrag Vorgehen Konzepterarbeitung Aktuelle Nutzung und zusätzliches Potenzial bis 2025 Leit-, Planungsgrundsätze und Umsetzungsprinzipien Biogas- und Kompostgespräch
Amt für Umwelt Inhalte Politischer Auftrag Vorgehen Konzepterarbeitung Aktuelle Nutzung und zusätzliches Potenzial bis 2025 Leit-, Planungsgrundsätze und Umsetzungsprinzipien Biogas- und Kompostgespräch
Fernwärme, die naheliegende Alternative!
 Uzwil, 16. September 2010 Fernwärme, die naheliegende Alternative! Was können Gemeinden tun? Reto Dettli, Partner econcept AG, Zürich Inhalt Welche Voraussetzungen braucht es für ein Wärmenetz? Was kann
Uzwil, 16. September 2010 Fernwärme, die naheliegende Alternative! Was können Gemeinden tun? Reto Dettli, Partner econcept AG, Zürich Inhalt Welche Voraussetzungen braucht es für ein Wärmenetz? Was kann
Energiestrategie Kanton Schaffhausen: Wie weiter nach dem Nein zur Baugesetzrevision?
 Energiestrategie : Wie weiter nach dem Nein zur Baugesetzrevision? Thomas Volken Verein Landenergie Schaffhausen, 16. März 2015 Seite 1 Einschätzungen zum Abstimmungsergebnis Makroökonomisches Umfeld Verunsicherung
Energiestrategie : Wie weiter nach dem Nein zur Baugesetzrevision? Thomas Volken Verein Landenergie Schaffhausen, 16. März 2015 Seite 1 Einschätzungen zum Abstimmungsergebnis Makroökonomisches Umfeld Verunsicherung
Bioenergie im Gebäudebereich Biogas, Eckpfeiler im Klimaschutz?
 Bioenergie im Gebäudebereich Biogas, Eckpfeiler im Klimaschutz? 5. Bioenergie-Forum Daniela Decurtins Trends der Energieversorgung Mehr dezentrale Produktion Stromproduktion wird zunehmend erneuerbar,
Bioenergie im Gebäudebereich Biogas, Eckpfeiler im Klimaschutz? 5. Bioenergie-Forum Daniela Decurtins Trends der Energieversorgung Mehr dezentrale Produktion Stromproduktion wird zunehmend erneuerbar,
DIV / Abteilung Energie. Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf
 DIV / Abteilung Energie Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf Programm Minuten Auftrag, Konzept, Ziele, Schwerpunkte Kaspar Schläpfer 15 und volkswirtschaftliche Effekte
DIV / Abteilung Energie Der Kanton Thurgau steigt in die Champions League der Energiepolitik auf Programm Minuten Auftrag, Konzept, Ziele, Schwerpunkte Kaspar Schläpfer 15 und volkswirtschaftliche Effekte
Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret!
 Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret! Agenda: Grosswetterlag Kanton Luzern: Ausgangslage Kanton Luzern: Perspektiven Politische Beurteilung 2 www.renggli-haus.ch 1 Stand heute 2016 Klimaerwärmung
Energiewende für die Politik? Kanton Luzern konkret! Agenda: Grosswetterlag Kanton Luzern: Ausgangslage Kanton Luzern: Perspektiven Politische Beurteilung 2 www.renggli-haus.ch 1 Stand heute 2016 Klimaerwärmung
Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten
 Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten Informationsveranstaltung vom 6.12.2011 Überblick Ausgangslage Zweck einer kommunalen Energieplanung Stand der Arbeiten / Potenziale
Energieplanung Teufen Zweck einer Energieplanung und Stand der Arbeiten Informationsveranstaltung vom 6.12.2011 Überblick Ausgangslage Zweck einer kommunalen Energieplanung Stand der Arbeiten / Potenziale
Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld. Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Die MuKEn 2014: Gemeinden in einem Spannungsfeld Veranstaltung Gebäude-Labels vom 22. Oktober 2015 Hansruedi Kunz, Abteilungsleiter Energie
Gesetzliche Grundlagen des Kantons Thurgau im Energiebereich
 DIV / Abteilung Energie Gesetzliche Grundlagen des Kantons Thurgau im Energiebereich Bernard Dubochet Kanton Thurgau, Abteilung Energie Themen Strategie des Kantons Rückblick / Entwicklung Blick vorwärts
DIV / Abteilung Energie Gesetzliche Grundlagen des Kantons Thurgau im Energiebereich Bernard Dubochet Kanton Thurgau, Abteilung Energie Themen Strategie des Kantons Rückblick / Entwicklung Blick vorwärts
1. SIG in Kürze. 2. Energiewende : die grossen Veränderungen. 3. SIG : Strategie eines Multi-Energie-Verteilers. 4. Schlussfolgerungen
 Energiewende : Herausforderungen für ein Stadtwerk wie SIG 16. November 2012 André Hurter Generaldirektor Übersicht 1. SIG in Kürze 2. Energiewende : die grossen Veränderungen 3. SIG : Strategie eines
Energiewende : Herausforderungen für ein Stadtwerk wie SIG 16. November 2012 André Hurter Generaldirektor Übersicht 1. SIG in Kürze 2. Energiewende : die grossen Veränderungen 3. SIG : Strategie eines
Biomassenstrategie des Kantons Bern
 Biomassenstrategie des Kantons Bern WSED Wels, 25.2.2009 Ulrich Nyffenegger Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern, CH Projektleiter Energie Der Kanton Bern in Zahlen - 1 Mio. Einwohner -
Biomassenstrategie des Kantons Bern WSED Wels, 25.2.2009 Ulrich Nyffenegger Amt für Umweltkoordination und Energie, Kanton Bern, CH Projektleiter Energie Der Kanton Bern in Zahlen - 1 Mio. Einwohner -
Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz
 Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz Medienkonferenz 25.10.2012 Traktanden 1. Ausgangslage Bund 2. Ziele des Bundes, Energiestrategie 2050 4. Ziele des s für die kantonale Energiestrategie
Energiestrategie des Bundes Umsetzung im Kanton Schwyz Medienkonferenz 25.10.2012 Traktanden 1. Ausgangslage Bund 2. Ziele des Bundes, Energiestrategie 2050 4. Ziele des s für die kantonale Energiestrategie
Erneuerbare Energien im Kanton St.Gallen
 Erneuerbare Energien im Generalversammlung Waldwirtschaftsverband St.Gallen & Lichtenstein Alfons Schmid, Oktober 2012 Projektleiter Erneuerbare Energie Baudepartement Vier Fragen zum Start 1.Warum erneuerbare
Erneuerbare Energien im Generalversammlung Waldwirtschaftsverband St.Gallen & Lichtenstein Alfons Schmid, Oktober 2012 Projektleiter Erneuerbare Energie Baudepartement Vier Fragen zum Start 1.Warum erneuerbare
Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential
 Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential Hanspeter Eicher Studienleiter CAS Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz FHNW VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Seite 2 Inhalt GIS
Ungenutzte Ab- und Umweltwärme, ein vergessenes Energiepotential Hanspeter Eicher Studienleiter CAS Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz FHNW VR Präsident Dr. Eicher + Pauli AG Seite 2 Inhalt GIS
Der Regierungsrat legt die Einzelheiten und bei kleineren Eingriffen die Anforderungen für die neu zu erstellenden Bauteile in der Verordnung fest.
 7. Gesetz über die Energienutzung vom 0. März 004 (Stand. Januar 0). Allgemeine Bestimmungen Zweck Dieses Gesetz bezweckt:. Förderung einer sparsamen und rationellen Energienutzung;. Förderung der Nutzung
7. Gesetz über die Energienutzung vom 0. März 004 (Stand. Januar 0). Allgemeine Bestimmungen Zweck Dieses Gesetz bezweckt:. Förderung einer sparsamen und rationellen Energienutzung;. Förderung der Nutzung
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003
 Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
Anteile der Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland 2003 Gesamte Brutto-Stromerzeugung 597 TWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren 46,3 TWh Kernenergie 27,6 % Braunkohle 26,6 % Steinkohle 24,5 %
2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
 Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
Energie-Apéro Luzern Beat Marty, Leiter Abt. Energie, Luft und Strahlen 11. März 2013 2000-Watt-Gesellschaft Der Weg zur nachhaltigen Energieversorgung (Ressourcen, Umwelt, Wirtschaftlichkeit, Verteilgerechtigkeit)
Dezentrale Energieversorgung - Möglichkeiten und Chancen
 Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak Dezentrale Energieversorgung - Möglichkeiten und Chancen Ergebnisse aus dem Thüringer Bestands- und Potenzialatlas für Erneuerbare Energien Übersicht 1. Energiebedarf und
Prof. Dr.-Ing. Viktor Wesselak Dezentrale Energieversorgung - Möglichkeiten und Chancen Ergebnisse aus dem Thüringer Bestands- und Potenzialatlas für Erneuerbare Energien Übersicht 1. Energiebedarf und
DIV / Energie Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm
 Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm Bernard Dubochet Abteilung Energie Kanton Thurgau Förderung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung Sicherstellung einer volkswirtschaftlich
Energiepolitische Ziele, Energierecht und Förderprogramm Bernard Dubochet Abteilung Energie Kanton Thurgau Förderung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung Sicherstellung einer volkswirtschaftlich
Nahwärmekonzept 4.0. Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe. 28/06/17 ratioplan GmbH 1
 Nahwärmekonzept 4.0 Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe 28/06/17 ratioplan GmbH 1 Inhalt ratioplan GmbH Nutzung von Abwärme zur Nahwärmeversorgung Potenzial von Niedertemperaturabwärme
Nahwärmekonzept 4.0 Bisher ungenutzte Niedertemperatur- Abwärme aus Industrie und Gewerbe 28/06/17 ratioplan GmbH 1 Inhalt ratioplan GmbH Nutzung von Abwärme zur Nahwärmeversorgung Potenzial von Niedertemperaturabwärme
Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis,
 Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis, 14.10.2016 Holzenergie, Zukunftsträger oder Auslaufmodell? Ulrich Nyffenegger Vorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern Energiestrategie
Holzenergie-Tagung 2016 BEO HOLZ, Wimmis, 14.10.2016 Holzenergie, Zukunftsträger oder Auslaufmodell? Ulrich Nyffenegger Vorsteher Amt für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern Energiestrategie
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung. 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014
 Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
Gesamtüberarbeitung Regionaler Richtplan 5. Werkstattbericht - Ver- und Entsorgung 14. Delegiertenversammlung vom 25. Juni 2014 Ver- und Entsorgung - Inhalte Übergeordnete Themeneinbindung Kapitel 5.2
Erdgas/Biogas Die Energie.
 Erdgas/Biogas Die Energie. 1 Erdgas: effizient. Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und Treibstoff genutzt
Erdgas/Biogas Die Energie. 1 Erdgas: effizient. Erdgas ist ein natürlich vorkommender brennbarer, farb- und geruchloser Energieträger und kann ohne Umwandlung direkt als Brennstoff und Treibstoff genutzt
Saubere Städte und. und Biogas. Christophe Darbellay, NR Parteipräsident CVP Schweiz
 Saubere Städte und Gemeinden dank Erdgas und Biogas Christophe Darbellay, NR Parteipräsident CVP Schweiz Zahlen und Fakten Der Anteil von Erdgas am gesamten Energieverbrauch der Schweiz beträgt rund 12%
Saubere Städte und Gemeinden dank Erdgas und Biogas Christophe Darbellay, NR Parteipräsident CVP Schweiz Zahlen und Fakten Der Anteil von Erdgas am gesamten Energieverbrauch der Schweiz beträgt rund 12%
Unser Weg zu einer 100% unabhängigen und sauberen Stromversorgung der Stadt Pfaffenhofen.
 SAUBERE ENERGIE FÜR PFAFFENHOFEN Unser Weg zu einer 100% unabhängigen und sauberen Stromversorgung der Stadt Pfaffenhofen. KUNDENCENTER Unser Beitrag zum Klimaschutz in Pfaffenhofen: 100% saubere Energieversorgung!
SAUBERE ENERGIE FÜR PFAFFENHOFEN Unser Weg zu einer 100% unabhängigen und sauberen Stromversorgung der Stadt Pfaffenhofen. KUNDENCENTER Unser Beitrag zum Klimaschutz in Pfaffenhofen: 100% saubere Energieversorgung!
Erneuerbare Energien 2016
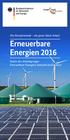 Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2016 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien bleiben wichtigste Stromquelle Im Jahr 2016 ist
Die Energiewende ein gutes Stück Arbeit Erneuerbare Energien 2016 Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) Erneuerbare Energien bleiben wichtigste Stromquelle Im Jahr 2016 ist
Frank Rutschmann, 2016 ENERGIESTRATEGIE 2050 DANK BIOMASSE
 Frank Rutschmann, 2016 ENERGIESTRATEGIE 2050 DANK BIOMASSE 4. BIOENERGIE-FORUM DR. FRANK RUTSCHMANN LEITER ERNEUERBARE ENERGIEN 22.06.2016 INHALT Stand der Energiestrategie 2050 Bedeutung der Biomasse
Frank Rutschmann, 2016 ENERGIESTRATEGIE 2050 DANK BIOMASSE 4. BIOENERGIE-FORUM DR. FRANK RUTSCHMANN LEITER ERNEUERBARE ENERGIEN 22.06.2016 INHALT Stand der Energiestrategie 2050 Bedeutung der Biomasse
Stromerzeugung aus Biomasse Nachhaltige Nutzung von Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung. FVS-Workshop Systemanalyse im FVS
 FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
FVS-Workshop Systemanalyse im FVS 10.11.2008, Stuttgart Dr. Antje Vogel-Sperl Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg -1- Mittels erneuerbarer Energiequellen kann Nutzenergie
Energiemix und Selbstversorgung. Stadtwerke als dezentraler Versorger
 Unternehmensgruppe Stadtwerke Meiningen Städtische Abwasserentsorgung Meiningen Eigenbetrieb der Stadt Meiningen SWM Erneuerbare Energien GmbH konzernfrei regional mittelständisch Energiemix und Selbstversorgung
Unternehmensgruppe Stadtwerke Meiningen Städtische Abwasserentsorgung Meiningen Eigenbetrieb der Stadt Meiningen SWM Erneuerbare Energien GmbH konzernfrei regional mittelständisch Energiemix und Selbstversorgung
Ökologische und sichere Wärme für Hamburg
 Konzept Ökologische und sichere Wärme für Hamburg CO 2 minus 50% Sicher Partnerschaftlich Bezahlbar Juni 2016 Übersicht 1 Fernwärmesituation in Hamburg 2 Herausforderungen partnerschaftlich lösen CO 2
Konzept Ökologische und sichere Wärme für Hamburg CO 2 minus 50% Sicher Partnerschaftlich Bezahlbar Juni 2016 Übersicht 1 Fernwärmesituation in Hamburg 2 Herausforderungen partnerschaftlich lösen CO 2
Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende. 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter
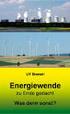 Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter Kantonales Energiekonzept 5 Schwerpunkte Gebäude: Effizienz und erneuerbare
Ihr Rundum-Partner auf dem Weg zur Energiewende 29. April 2014, Hauptversammlung Hausverein Ostschweiz Philipp Egger, Geschäftsleiter Kantonales Energiekonzept 5 Schwerpunkte Gebäude: Effizienz und erneuerbare
Auftragspotenzial durch Projekte für erneuerbare Energieen
 Auftragspotenzial durch Projekte für erneuerbare Energieen Dr. Hanspeter Eicher Dr. Eicher+Pauli AG Liestal Was sind Projekte erneuerbarer Energien? Entwicklung erneuerbarer Energien am Beispiel Deutschland
Auftragspotenzial durch Projekte für erneuerbare Energieen Dr. Hanspeter Eicher Dr. Eicher+Pauli AG Liestal Was sind Projekte erneuerbarer Energien? Entwicklung erneuerbarer Energien am Beispiel Deutschland
Umsetzung der Energiewende in Bayern
 Umsetzung der Energiewende in Bayern Administrative und technische Hilfestellungen des Freistaats für Wirtschaft, Kommunen und Bürger Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit
Umsetzung der Energiewende in Bayern Administrative und technische Hilfestellungen des Freistaats für Wirtschaft, Kommunen und Bürger Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit
Regenerative Energien Chancen für Nordbaden
 Öffentliche Fraktionssitzung 14. Oktober 2011, Baden-Baden Regenerative Energien Chancen für Nordbaden Dipl.-Wirt.-Ing. Maike Schmidt Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Öffentliche Fraktionssitzung 14. Oktober 2011, Baden-Baden Regenerative Energien Chancen für Nordbaden Dipl.-Wirt.-Ing. Maike Schmidt Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Erneuerbare Energien und Effizienz. BFE Energie-Frühstück vom in Baden COO
 Energiestrategie 2050 Knackpunkte Erneuerbare Energien und Effizienz BFE Energie-Frühstück vom 29.8.14 in Baden COO.2207.110.3.735927 Erneuerbare Energien im Kontext der aktuellen Entwicklungen Die Förderung
Energiestrategie 2050 Knackpunkte Erneuerbare Energien und Effizienz BFE Energie-Frühstück vom 29.8.14 in Baden COO.2207.110.3.735927 Erneuerbare Energien im Kontext der aktuellen Entwicklungen Die Förderung
P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien. Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017
 P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017 Schlüsseltechnologien der Sektorkopplung: Was können sie heute und was können sie in der
P2H im Wärmesektor Kopplung von Effizienz und erneuerbaren Energien Dr. Kai Schiefelbein 8. November 2017 NET 2017 Schlüsseltechnologien der Sektorkopplung: Was können sie heute und was können sie in der
Beitrag und Herausforderungen der Windenergie in der Schweiz. Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Windenergie
 Beitrag und Herausforderungen der Windenergie in der Schweiz Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Windenergie In Europa 2000-2016 zugebaute Kraftwerke nach Technologie (in GW) Windenergie 142.6
Beitrag und Herausforderungen der Windenergie in der Schweiz Schweizerische Vereinigung zur Förderung der Windenergie In Europa 2000-2016 zugebaute Kraftwerke nach Technologie (in GW) Windenergie 142.6
Ausgangslage und Chancen
 Energieproduktion, Energieeffizienz und Klimaschutz in der Schweizer Landwirtschaft: Ausgangslage und Chancen AgroCleanTech-Event, Suisse Tier Forum 18. Nov. 2011 Hans-Christian Angele Warum besteht Handlungsbedarf?
Energieproduktion, Energieeffizienz und Klimaschutz in der Schweizer Landwirtschaft: Ausgangslage und Chancen AgroCleanTech-Event, Suisse Tier Forum 18. Nov. 2011 Hans-Christian Angele Warum besteht Handlungsbedarf?
Erneuerbare Energien unverzichtbar für
 Erneuerbare Energien unverzichtbar für regionale Energiekonzepte Lehrte-Ahlten 19. August 2011 Dr. Detlef Koenemann Fukushima Flutwelle Am 11.03.2011 überflutet ein Tsunami das Gelände des Kernkraftwerk
Erneuerbare Energien unverzichtbar für regionale Energiekonzepte Lehrte-Ahlten 19. August 2011 Dr. Detlef Koenemann Fukushima Flutwelle Am 11.03.2011 überflutet ein Tsunami das Gelände des Kernkraftwerk
Windenergiepotenzial im Kanton Thurgau
 Windenergiepotenzial im Kanton Thurgau Generalversammlung VTE, 14. März 2016 Thomas Volken Abteilung Energie DIV / Energie 2 Freiamt, Windrad auf dem Schillingerberg 719 m ü. M. Programm Welche Bedeutung
Windenergiepotenzial im Kanton Thurgau Generalversammlung VTE, 14. März 2016 Thomas Volken Abteilung Energie DIV / Energie 2 Freiamt, Windrad auf dem Schillingerberg 719 m ü. M. Programm Welche Bedeutung
Stand Umsetzung Energiekonzept
 Baudepartement Stand Umsetzung Energiekonzept - Zielerreichung: Stand Ende 2014 - neue Angebote / Produkte der Energiefachstelle - Energieförderung: Ausblick Marcel Sturzenegger Leiter Energie Grundlagen
Baudepartement Stand Umsetzung Energiekonzept - Zielerreichung: Stand Ende 2014 - neue Angebote / Produkte der Energiefachstelle - Energieförderung: Ausblick Marcel Sturzenegger Leiter Energie Grundlagen
Energiestrategie 2050 Fortschritt der Aktivitäten
 Energiestrategie 2050 Fortschritt der Aktivitäten 25 Jahre Energiestadt, 25. April 2013, Zürich Nicole Zimmermann, Leiterin der Sektion Gebäude F: COO.2207.110.3.35280 D: COO.2207.110.3.38591 Die Herausforderungen
Energiestrategie 2050 Fortschritt der Aktivitäten 25 Jahre Energiestadt, 25. April 2013, Zürich Nicole Zimmermann, Leiterin der Sektion Gebäude F: COO.2207.110.3.35280 D: COO.2207.110.3.38591 Die Herausforderungen
Chancen und Facts Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Den SuS wird anhand verschiedener Facts das Potenzial von Biomasse erklärt. Dabei sollen sowohl die positiven Punkte, aber auch die Grenzen von Biomasse aufgezeigt
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Den SuS wird anhand verschiedener Facts das Potenzial von Biomasse erklärt. Dabei sollen sowohl die positiven Punkte, aber auch die Grenzen von Biomasse aufgezeigt
Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland
 Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland Die EGG plant, auch in Zukunft die Fernwärmeversorgung in Gera auf der Basis von dem zukünftig erwarteten Fernwärmebedarf
Beitrag der Energieversorgung Gera GmbH zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland Die EGG plant, auch in Zukunft die Fernwärmeversorgung in Gera auf der Basis von dem zukünftig erwarteten Fernwärmebedarf
DIE ROLLE VON PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE IN KOMBINATION MIT WÄRMEPUMPEN IN DER ENERGIESTRATEGIE DER SCHWEIZ
 shutterstock 101979313 DIE ROLLE VON PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE IN KOMBINATION MIT WÄRMEPUMPEN IN DER ENERGIESTRATEGIE DER SCHWEIZ ZHAW-ENERGIE- UND UMWELTFORUM SEKTION ERNEUERBARE ENERGIEN RITA KOBLER
shutterstock 101979313 DIE ROLLE VON PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE IN KOMBINATION MIT WÄRMEPUMPEN IN DER ENERGIESTRATEGIE DER SCHWEIZ ZHAW-ENERGIE- UND UMWELTFORUM SEKTION ERNEUERBARE ENERGIEN RITA KOBLER
Energie und Raumentwicklung. Herausforderungen in der Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Raumentwicklung ARE Energie und Raumentwicklung Herausforderungen in der Schweiz DACH+, Konstanz 24.01.2013
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Raumentwicklung ARE Energie und Raumentwicklung Herausforderungen in der Schweiz DACH+, Konstanz 24.01.2013
Energiestrategie 2050 Lehrerinformation
 02 / nergie & Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die SuS lesen einen Informationstext zur nergiestrategie. Sie suchen geeignete Titel für die Textabschnitte und formulieren Fragen, die mithilfe des Textes
02 / nergie & Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die SuS lesen einen Informationstext zur nergiestrategie. Sie suchen geeignete Titel für die Textabschnitte und formulieren Fragen, die mithilfe des Textes
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Klimaschutzkonzept Remscheid Arbeitsgruppe Kraft-Wärme-Kopplung und Innovative Technologien 18.03.2013 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Inhalt
Energieförderung im Kanton St.Gallen. Gebäudemodernisierung mit Konzept
 Energieförderung im Kanton St.Gallen Gebäudemodernisierung mit Konzept Stand Januar 2017 Der detaillierte Beratungsbericht die Grundlage für energetische Gebäudemodernisierungen Eine Gebäudemodernisierung
Energieförderung im Kanton St.Gallen Gebäudemodernisierung mit Konzept Stand Januar 2017 Der detaillierte Beratungsbericht die Grundlage für energetische Gebäudemodernisierungen Eine Gebäudemodernisierung
Öffentliche Informationsveranstaltung SP Wünnewil-Flamatt Nationale Energiepolitik Mit welchen Massnahmen zum Ziel?
 Öffentliche Informationsveranstaltung SP Wünnewil-Flamatt 26.01.2011? Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE und Programmleiter EnergieSchweiz 80 Prozent fossile Energie decken unseren Verbrauch. Wir leben
Öffentliche Informationsveranstaltung SP Wünnewil-Flamatt 26.01.2011? Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE und Programmleiter EnergieSchweiz 80 Prozent fossile Energie decken unseren Verbrauch. Wir leben
Kommunale Energieplanung
 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Energiepolitik in der Gemeinde _ Handlungsspielraum nutzen! Olten, 27. Oktober 2009 Bruno Hoesli Energie- und Raumplaner Inhalt 2 Die kommunale Energieplanung
Die Zukunft der Schweizer Energieversorgung. Bedeutung der Wasserkraftnutzung für die Versorgungssicherheit
 Die Zukunft der Schweizer Energieversorgung Bedeutung der Wasserkraftnutzung für die Versorgungssicherheit Tagung Einfluss der Klimaänderung auf die Wasserkraftnutzung Christian Holzner Visp, 8. September
Die Zukunft der Schweizer Energieversorgung Bedeutung der Wasserkraftnutzung für die Versorgungssicherheit Tagung Einfluss der Klimaänderung auf die Wasserkraftnutzung Christian Holzner Visp, 8. September
Béatrice Devènes FÖRDERUNG HOLZENERGIE
 Béatrice Devènes FÖRDERUNG HOLZENERGIE SVG 2016 AEE/EE DANIEL BINGGELI 14.09.2016 INHALT Stand der Energiestrategie 2050 Bestehende Fördermassnahmen Förderung der Holzenergie Zukünftige Rahmenbedingungen
Béatrice Devènes FÖRDERUNG HOLZENERGIE SVG 2016 AEE/EE DANIEL BINGGELI 14.09.2016 INHALT Stand der Energiestrategie 2050 Bestehende Fördermassnahmen Förderung der Holzenergie Zukünftige Rahmenbedingungen
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren. Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014)
 Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
Minimierung des Strombedarfs - wenig brauchen und selber produzieren Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) Inhaltsübersicht Stromverbrauch und Einflussmöglichkeiten Anforderungen
Klein, aber energetisch. Daten und Fakten 2011
 Klein, aber energetisch Daten und Fakten 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Energieverbrauch 5 2 Stromverbrauch 7 3 "Eigene" Stromproduktion 9 4 "Eigene" Wärmeproduktion 11 5 Kantonales Energiekonzept 2008-2015
Klein, aber energetisch Daten und Fakten 2011 Inhaltsverzeichnis 1 Energieverbrauch 5 2 Stromverbrauch 7 3 "Eigene" Stromproduktion 9 4 "Eigene" Wärmeproduktion 11 5 Kantonales Energiekonzept 2008-2015
SmartGrids Systemtechnologien Cleantech, visionäre Entwicklungen
 SmartGrids Systemtechnologien Cleantech, visionäre Entwicklungen 14. Sept 2011 Innovationstagung HSR Dr. Rainer Bacher Managing Director BACHER ENERGIE AG 5400 Baden Rainer.Bacher@BacherEnergie.ch Übersicht
SmartGrids Systemtechnologien Cleantech, visionäre Entwicklungen 14. Sept 2011 Innovationstagung HSR Dr. Rainer Bacher Managing Director BACHER ENERGIE AG 5400 Baden Rainer.Bacher@BacherEnergie.ch Übersicht
Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb.
 versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb. Das System 2SOL: Ein einfaches Prinzip mit grosser Wirkung
versorgt Gebäude emissionsfrei mit Strom, Wärme und Kälte Das zuverlässige, wirtschaftliche Gesamtsystem für den CO 2 -freien Gebäudebetrieb. Das System 2SOL: Ein einfaches Prinzip mit grosser Wirkung
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung
 Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wir versorgen Sie mit Wärme
 Wir versorgen Sie mit Wärme sauber erneuerbar massgeschneidert Kennen Sie das zukunftsweisende Projekt Circulago? Circulago Wärme und Kälte aus dem Zugersee Circulago ist ein zukunftsweisendes Projekt
Wir versorgen Sie mit Wärme sauber erneuerbar massgeschneidert Kennen Sie das zukunftsweisende Projekt Circulago? Circulago Wärme und Kälte aus dem Zugersee Circulago ist ein zukunftsweisendes Projekt
Amt für Umwelt Biomassekonzept Thurgau
 Amt für Umwelt Biomassekonzept Thurgau 17. November 2016, BAFU Forum Biogene Abfälle, Ittigen Martin Eugster, Abteilungsleiter Abfall und Boden Themen Historie und Ziele Massnahmen und Stand der Umsetzung
Amt für Umwelt Biomassekonzept Thurgau 17. November 2016, BAFU Forum Biogene Abfälle, Ittigen Martin Eugster, Abteilungsleiter Abfall und Boden Themen Historie und Ziele Massnahmen und Stand der Umsetzung
ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE
 ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE Ausarbeitung der lokalen Energiebilanzierung im Rahmen des Klimapakts Hesperange, den 20. Februar 2017 Kontext & Klimaziele: Herausforderungen: Klimapaktziele 2020 CO
ADMINISTRATION COMMUNALE HESPERANGE Ausarbeitung der lokalen Energiebilanzierung im Rahmen des Klimapakts Hesperange, den 20. Februar 2017 Kontext & Klimaziele: Herausforderungen: Klimapaktziele 2020 CO
Integriertes Klimaschutzkonzept Landkreis München
 Eckdaten im Jahr 21 Im Jahr 21 zählte der 323.15 Einwohner und 272.92 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 23 wird die Einwohnerzahl um ca. 12 Prozent auf 366.5 steigen. weit wurden 21 ca. 13.43 GWh Endenergie benötigt.
Eckdaten im Jahr 21 Im Jahr 21 zählte der 323.15 Einwohner und 272.92 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 23 wird die Einwohnerzahl um ca. 12 Prozent auf 366.5 steigen. weit wurden 21 ca. 13.43 GWh Endenergie benötigt.
Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten.
 Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten. Mitten im Leben. Klimaschutz gestalten für die Menschen in Düsseldorf. Der Weg hin zur Energieerzeugung auf Basis regenerativer
Die grüne Brücke 2050 Gemeinsam den Weg in die neue Energiewelt gestalten. Mitten im Leben. Klimaschutz gestalten für die Menschen in Düsseldorf. Der Weg hin zur Energieerzeugung auf Basis regenerativer
Energiewende in Niederösterreich
 1 Energiewende in Niederösterreich Dr. Herbert Greisberger Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 1 Was ist enu? Die Energie- und Umweltagentur NÖ ist DIE gemeinsame Anlaufstelle für alle Energie-
1 Energiewende in Niederösterreich Dr. Herbert Greisberger Energie- und Umweltagentur Niederösterreich 1 Was ist enu? Die Energie- und Umweltagentur NÖ ist DIE gemeinsame Anlaufstelle für alle Energie-
n Ein gemeinsames Umsetzungsprogramm für Maßnahmen in Gemeinden, Haushalten und Betrieben
 REGIONALES ENERGIEKONZEPT Bucklige Welt Wechselland Von der Konzeptphase in die gemeinsame Umsetzung! Ein Projekt im Auftrag der LEADER Region Bucklige Welt-WechsellandWechselland DI Andreas Karner KWI
REGIONALES ENERGIEKONZEPT Bucklige Welt Wechselland Von der Konzeptphase in die gemeinsame Umsetzung! Ein Projekt im Auftrag der LEADER Region Bucklige Welt-WechsellandWechselland DI Andreas Karner KWI
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien - Ein Marktvergleich zwischen Deutschland und Rumänien
 Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien - Ein Marktvergleich zwischen Deutschland und Rumänien Dienstag, 20. Mai 2014, Bucharest, Rumänien www.renewables-made-in-germany.com Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien - Ein Marktvergleich zwischen Deutschland und Rumänien Dienstag, 20. Mai 2014, Bucharest, Rumänien www.renewables-made-in-germany.com Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren
EKZ Windparkprojekt in Thundorf
 EKZ Windparkprojekt in Thundorf Information Gemeinde Amlikon-Bissegg, 28. April, 2016 Jean-Marc Degen, Projektleiter Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich»Die EKZ versorgen rund eine Million Menschen
EKZ Windparkprojekt in Thundorf Information Gemeinde Amlikon-Bissegg, 28. April, 2016 Jean-Marc Degen, Projektleiter Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich»Die EKZ versorgen rund eine Million Menschen
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006
 Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland Stand: Februar 2006 2005 hat sich die Nutzung erneuerbarer Energien erneut positiv weiterentwickelt. Nach Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare
Umbau des Energiesystems in Basel
 Umbau des Energiesystems in Basel Ausbau Angebot erneuerbare Energie und Anpassung gesetzliche Rahmenbedingungen novatlantis Bauforum Basel, 21. Juni 2017 Aeneas Wanner Gute Ausgangslage: Energiepolitik
Umbau des Energiesystems in Basel Ausbau Angebot erneuerbare Energie und Anpassung gesetzliche Rahmenbedingungen novatlantis Bauforum Basel, 21. Juni 2017 Aeneas Wanner Gute Ausgangslage: Energiepolitik
«EnergieSchweiz nützlich, effizient und fit für die Etappe »
 Energieforum, Donnerstag, 6. Oktober, 2005 «EnergieSchweiz nützlich, effizient und fit für die Etappe 2006-2010» Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE, Programmleiter EnergieSchweiz EnergieSchweiz : Die Schweizer
Energieforum, Donnerstag, 6. Oktober, 2005 «EnergieSchweiz nützlich, effizient und fit für die Etappe 2006-2010» Michael Kaufmann, Vizedirektor BFE, Programmleiter EnergieSchweiz EnergieSchweiz : Die Schweizer
100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr oder reale Vision. Energieland Rheinland-Pfalz
 Energieland Rheinland-Pfalz 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2030 Utopie oder reale Vision www.100-prozent-erneuerbar.de 27. März 2012 1 Rheinland-Pfalz heute: abhängig von
Energieland Rheinland-Pfalz 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2030 Utopie oder reale Vision www.100-prozent-erneuerbar.de 27. März 2012 1 Rheinland-Pfalz heute: abhängig von
Die Rolle der KWK bis 2030 und Konsequenzen für die KWK-Förderung Plattform Strommarkt Marco Wünsch Berlin 15. November 2016
 Die Rolle der KWK bis 2030 und Konsequenzen für die KWK-Förderung Plattform Strommarkt Marco Wünsch Berlin 15. November 2016 Paris ernst nehmen Vor welcher Aufgabe stehen wir? Energiebedingte CO 2 -Emissionen
Die Rolle der KWK bis 2030 und Konsequenzen für die KWK-Förderung Plattform Strommarkt Marco Wünsch Berlin 15. November 2016 Paris ernst nehmen Vor welcher Aufgabe stehen wir? Energiebedingte CO 2 -Emissionen
Wir. leben Energie. Energie für den Aargau. AEW Energie AG und Geothermie. Mitgliederversammlung 2012 Verein Geothermische Kraftwerke Aargau (VGKA)
 Wir Energie für den Aargau leben Energie AEW Energie AG und Geothermie Mitgliederversammlung 2012 Verein Geothermische Kraftwerke Aargau (VGKA) Peter Bühler Vorsitzender der Geschäftsleitung Übersicht
Wir Energie für den Aargau leben Energie AEW Energie AG und Geothermie Mitgliederversammlung 2012 Verein Geothermische Kraftwerke Aargau (VGKA) Peter Bühler Vorsitzender der Geschäftsleitung Übersicht
Energiegespräch im Wenkenhof Prozesse und Abläufe optimieren
 Energiegespräch im Wenkenhof Prozesse und Abläufe optimieren Dr. Thomas Bürki, Thomas Bürki GmbH, Benglen Worum geht es im Energiebereich? 2 Probleme CO 2 Elektrizität CO 2 ist ± erledigt Elektrizität
Energiegespräch im Wenkenhof Prozesse und Abläufe optimieren Dr. Thomas Bürki, Thomas Bürki GmbH, Benglen Worum geht es im Energiebereich? 2 Probleme CO 2 Elektrizität CO 2 ist ± erledigt Elektrizität
Grundlagenpapier ENERGIE
 Grundlagenpapier ENERGIE 2016-2050 Leistungsziel Energie beschreibend Knonauer Amt - vorbildliche Energie-Region messbar Bis 2050 deckt das Knonauer Amt 80% seines Energiebedarfs durch in der Region produzierte,
Grundlagenpapier ENERGIE 2016-2050 Leistungsziel Energie beschreibend Knonauer Amt - vorbildliche Energie-Region messbar Bis 2050 deckt das Knonauer Amt 80% seines Energiebedarfs durch in der Region produzierte,
Tipps und Kosten. Energetische Quartiersentwicklung Südöstliches Eißendorf / Bremer Straße Die Praxis der energetischen Sanierung: Möglichkeiten,
 Energetische Quartiersentwicklung Südöstliches Eißendorf / Bremer Straße Die Praxis der energetischen Sanierung: Möglichkeiten, Tücken, Tipps und Kosten d3-architekten Thomas Dittert Dipl.-Ing. Architekt
Energetische Quartiersentwicklung Südöstliches Eißendorf / Bremer Straße Die Praxis der energetischen Sanierung: Möglichkeiten, Tücken, Tipps und Kosten d3-architekten Thomas Dittert Dipl.-Ing. Architekt
PRESSEMELDUNG vom Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region
 PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
PRESSEMELDUNG vom 30.4.2014 Biosphärenreservat Bliesgau auf dem Weg zur Null-Emissions- Region Die Ziellatte hängt hoch beim "Masterplans 100% Klimaschutz" im Biosphärenreservat Bliesgau. Bis 2050 soll
Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft. Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie
 Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie Gliederung der Präsentation 1. 2. 3. Ziele Fordern Fördern Bund Kantone Kanton BL Kanton BL
Das Gebäudeprogramm des Kantons Basel-Landschaft Dr. Alberto Isenburg Leiter Amt für Umweltschutz und Energie Gliederung der Präsentation 1. 2. 3. Ziele Fordern Fördern Bund Kantone Kanton BL Kanton BL
Kommunale Energiepolitik Rahmenbedingungen, Strategie Zukunft, Stand der Umsetzung
 Kommunale Energiepolitik Rahmenbedingungen, Strategie Zukunft, Stand der Umsetzung Adrian Wüthrich, Grossrat/Gemeinderat, Huttwil Die Folien wurden vom Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) zur
Kommunale Energiepolitik Rahmenbedingungen, Strategie Zukunft, Stand der Umsetzung Adrian Wüthrich, Grossrat/Gemeinderat, Huttwil Die Folien wurden vom Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) zur
Die Zukunft der Energieversorgung
 Die Zukunft der Energieversorgung Smart Home Day Die Zukunft der Energieversorgung Historischer Rückblick Energieversorgung in Darmstadt Erster Lehrstuhl für Elektrotechnik der Welt an der TH Darmstadt
Die Zukunft der Energieversorgung Smart Home Day Die Zukunft der Energieversorgung Historischer Rückblick Energieversorgung in Darmstadt Erster Lehrstuhl für Elektrotechnik der Welt an der TH Darmstadt
DIV / Abteilung Energie Förderprogramm Energie Kanton Thurgau - Eine Erfolgsgeschichte
 DIV / Abteilung Energie Förderprogramm Energie Kanton Thurgau - Eine Erfolgsgeschichte Andrea Paoli, Leiter Energie Energieverbrauch auf der Basis des neuen Massnahmenpakets des Bundes Senkung des Verbrauchs
DIV / Abteilung Energie Förderprogramm Energie Kanton Thurgau - Eine Erfolgsgeschichte Andrea Paoli, Leiter Energie Energieverbrauch auf der Basis des neuen Massnahmenpakets des Bundes Senkung des Verbrauchs
Gemeinde Oberpframmern
 Gemeinde Oberpframmern Allgemeine Daten Einwohner 2.223 Fläche [ha] 1.847 Flächenanteil am Landkreis 3,4% Einwohnerdichte [Einw./ha] 1,2 Quelle: Energienutzungsplan Ebersberg, 214 Bezugsjahr: 212 Gesamtenergieverbrauch
Gemeinde Oberpframmern Allgemeine Daten Einwohner 2.223 Fläche [ha] 1.847 Flächenanteil am Landkreis 3,4% Einwohnerdichte [Einw./ha] 1,2 Quelle: Energienutzungsplan Ebersberg, 214 Bezugsjahr: 212 Gesamtenergieverbrauch
Energiestrategie 2050 halbbatzig oder immer noch zu waghalsig?
 Energiestrategie 2050 halbbatzig oder immer noch zu waghalsig? Stefan Müller-Altermatt Nationalrat / Präsident UREK Sommer-Workshop Konferenz der Gebäudetechnik Verbände, 30.6.2016 Inhalt Wo stehen wir?
Energiestrategie 2050 halbbatzig oder immer noch zu waghalsig? Stefan Müller-Altermatt Nationalrat / Präsident UREK Sommer-Workshop Konferenz der Gebäudetechnik Verbände, 30.6.2016 Inhalt Wo stehen wir?
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen Technische Universität München
 Technische Universität München Aschheim Kirchheim Feldkirchen Strom-Versorgung Gas-Versorgung -Geothermie -Zentrale Biogasanlage -Dezentrale Biogasanlage -Holzheizkraftwerk -Holz-/Getreideheizwerk -Wärmepumpen
Technische Universität München Aschheim Kirchheim Feldkirchen Strom-Versorgung Gas-Versorgung -Geothermie -Zentrale Biogasanlage -Dezentrale Biogasanlage -Holzheizkraftwerk -Holz-/Getreideheizwerk -Wärmepumpen
Regionale Perspektiven und Energiewende. Die Wärmewende als Handlungsfeld räumlicher Planung. auf regionaler und kommunaler Ebene
 20. Thüringer Regionalplanertag Regionale Perspektiven und Energiewende 01.10.2015 Bad Blankenburg Die Wärmewende als Handlungsfeld räumlicher Planung auf regionaler und kommunaler Ebene M.Sc. Susanne
20. Thüringer Regionalplanertag Regionale Perspektiven und Energiewende 01.10.2015 Bad Blankenburg Die Wärmewende als Handlungsfeld räumlicher Planung auf regionaler und kommunaler Ebene M.Sc. Susanne
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien
 Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien Holz dominiert kwhth/ Jahr und Einwohner 2000 1800 1600 155 82 1400 74 1200 1000 86 100 Holz Solarthermie Wärmepumpen Biogas Holz hat einen sehr hohen Anteil Solarthermieund
Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien Holz dominiert kwhth/ Jahr und Einwohner 2000 1800 1600 155 82 1400 74 1200 1000 86 100 Holz Solarthermie Wärmepumpen Biogas Holz hat einen sehr hohen Anteil Solarthermieund
Energiewende in Lörrach
 Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Biomasse im Energiemix der Stadt Lörrach Marion Dammann Bürgermeisterin der Stadt Lörrach Energiewende in Lörrach European Energy Award: Kommunale Handlungsfelder Stadtplanung Kommunale Gebäude und Anlagen
Energiekonzept des Kantons St. Gallen
 Energiekonzept des Kantons St. Gallen 2000 W Energieeffizienz im Gebäudebereich steigern Erneuerbare Energiequellen vermehrt nutzen 1 Energiepolitik im Kanton St.Gallen weil die Ressource Energie eine
Energiekonzept des Kantons St. Gallen 2000 W Energieeffizienz im Gebäudebereich steigern Erneuerbare Energiequellen vermehrt nutzen 1 Energiepolitik im Kanton St.Gallen weil die Ressource Energie eine
GEBÄUDE ZENTRALES ELEMENT KÜNFTIGER ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK
 shutterstock 101979313 GEBÄUDE ZENTRALES ELEMENT KÜNFTIGER ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK BAUEN & MODERNISIEREN DR. WALTER STEINMANN DIREKTOR BUNDESAMT FÜR ENERGIE BFE 08.09.2016 ENERGIEVERBRAUCH SCHWEIZ 2014
shutterstock 101979313 GEBÄUDE ZENTRALES ELEMENT KÜNFTIGER ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK BAUEN & MODERNISIEREN DR. WALTER STEINMANN DIREKTOR BUNDESAMT FÜR ENERGIE BFE 08.09.2016 ENERGIEVERBRAUCH SCHWEIZ 2014
Road Map Erneuerbare Energien Schweiz
 Road Map Erneuerbare Energien Schweiz Eine Analyse zur Erschliessung der Potenziale bis 2050 Prof. Andreas Zuberbühler Präsident Wissenschaftlicher Beirat Inhalt Einführung Quellen für einheimische, erneuerbare
Road Map Erneuerbare Energien Schweiz Eine Analyse zur Erschliessung der Potenziale bis 2050 Prof. Andreas Zuberbühler Präsident Wissenschaftlicher Beirat Inhalt Einführung Quellen für einheimische, erneuerbare
Energiestadt Küsnacht
 Energiestadt Küsnacht Liebe Küsnachterinnen und Küsnachter Vor drei Jahren hat die Gemeindeversammlung einem fünfjährigen Förderprogramm zugestimmt. Es setzt jährlich 300 000 Franken für erneuerbare Energie
Energiestadt Küsnacht Liebe Küsnachterinnen und Küsnachter Vor drei Jahren hat die Gemeindeversammlung einem fünfjährigen Förderprogramm zugestimmt. Es setzt jährlich 300 000 Franken für erneuerbare Energie
Die Gemeinde als Windparkbetreiberin Ein Beispiel aus dem benachbarten Innviertel. Joachim Payr Energiewerkstatt Consulting GmbH Garching
 Die Gemeinde als Windparkbetreiberin Ein Beispiel aus dem benachbarten Innviertel Joachim Payr Energiewerkstatt Consulting GmbH Garching 28.06.2012 Wir unterstützen Ihre Gemeinde bei der Energiewende.
Die Gemeinde als Windparkbetreiberin Ein Beispiel aus dem benachbarten Innviertel Joachim Payr Energiewerkstatt Consulting GmbH Garching 28.06.2012 Wir unterstützen Ihre Gemeinde bei der Energiewende.
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach. Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof
 Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Potential Erneuerbarer Energien im Landkreis Amberg-Sulzbach Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof Der Mensch beeinflusst das Klima 2 Wie decken wir die Energie 3 Was kommt an?! 4 14 200 PJ jedes Jahr nach D! Ein
Schweizer Stromversorgung in 20 Jahren. VBW-Anlass , Universität Bern Beat Deuber, Leiter Handel, BKW FMB Energie AG
 Schweizer Stromversorgung in 20 Jahren VBW-Anlass 2010 29.09.2010, Universität Bern Beat Deuber, Leiter Handel, BKW FMB Energie AG Kein Strom-Blackout in der Schweiz Sichere Stromversorgung als Ziel auch
Schweizer Stromversorgung in 20 Jahren VBW-Anlass 2010 29.09.2010, Universität Bern Beat Deuber, Leiter Handel, BKW FMB Energie AG Kein Strom-Blackout in der Schweiz Sichere Stromversorgung als Ziel auch
Energie und Siedlungsstruktur
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Energie und Siedlungsstruktur Energetische Muster im Gebäude- und Mobilitätsbereich Trotz höherem Wärmebedarf der Bauten schneiden Städte
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Energie und Siedlungsstruktur Energetische Muster im Gebäude- und Mobilitätsbereich Trotz höherem Wärmebedarf der Bauten schneiden Städte
Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie
 Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie Nicolas Oetzel Referat KI III 1 Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Erneuerbaren Energien 21. Januar 2011 Anteil erneuerbarer
Bioenergie im deutschen Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie Nicolas Oetzel Referat KI III 1 Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Erneuerbaren Energien 21. Januar 2011 Anteil erneuerbarer
