Ungenutzte Biomassen / Einsatz innovativer Substrate in Bioenergie-Regionen
|
|
|
- Michaela Weiner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ungenutzte Biomassen / Einsatz innovativer Substrate in Bioenergie-Regionen Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0 Falko Haak Sebastian Bohnet Sissy Hartig DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH Torgauer Straße Leipzig Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@dbfz.de
2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Hintergrund, Ziele und Forschungsdesign der Arbeit... 1 Hintergrund... 1 Die Ziele und das Forschungsdesign der Arbeit... 2 Forschungsaktivitäten im Bereich alternativer Bioenergierohstoffe... 3 Erfahrungen in Bioenergie-Regionen mit ungenutzten Biomassen / innovativen Substraten Alternative Rohstoffe in Bioenergie-Regionen Was zeichnet alternative Rohstoffe aus? Charakterisierung alternativer Bioenergierohstoffe Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Blühstreifen Wildpflanzenmischungen Durchwachsene Silphie Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Mischpellets Wegebegleitgrün Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Ziel des Vergleichs und methodische Vorgehensweise Potenzialhöhe und Maßnahmenanzahl alternativer Biomassen in Bioenergie-Regionen Gegenüberstellung biomassebezogener Aktivitäten mit regionalen Potenzialen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit A 1 Potenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfs ausgewählter Biomassen und Maßnahmenanzahl im REK A 2 Die Maßnahmen der Projektdatenbank (Auszug alternative Rohstoffe) Literatur- und Referenzverzeichnis Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul I
3 Hintergrund, Ziele und Forschungsdesign der Arbeit Hintergrund, Ziele und Forschungsdesign der Arbeit 1.1 Hintergrund Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert regionale Strukturen zur Erzeugung und zum Einsatz von Bioenergie in sogenannten Bioenergie-Regionen. In diesen Modellregionen wurden in einer ersten Förderphase von 2009 bis 2012 regionale Netzwerke ausgebaut, um alle relevanten Akteure vom Landwirt über Anlagenbetreiber bis hin zu Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung einzubinden und die vorhandenen Bioenergiepotenziale vor Ort effizient zu nutzen. Seit Sommer 2012 erhalten 21 Regionen eine dreijährige Folgeförderung. In den fortgeschriebenen Regionalen Entwicklungskonzepten (REK) der Bioenergie-Regionen nehmen Projekte zum Einsatz alternativer Rohstoffe in zahlreichen Regionen einen besonderen Stellenwert einp0f1p. Einerseits sollen bislang nicht verwertete Biomassen durch effizientes Stoffstrommanagement einer energischen Verwertung zugeführt und somit Lücken im Sinne der Kreislaufwirtschaft geschlossen werden. Andererseits führt der Nutzungsdruck der Landbewirtschaftung zu einer stärkeren Diskussion der Argumente von Ökologie und Naturschutz. Die bestehenden Bewirtschaftungsweisen werden nun punktuell verändert. Eine Motivation ist dabei, Alternativen zum großflächigen Anbau von Energiepflanzen, wie z. B. Mais, zu finden und somit dem Akzeptanzverlust der Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen entgegenzuwirken. Mit dieser Schwerpunktsetzung reagieren die Regionen aber auch auf die Änderungen des EEG von 2012, durch die für Biogasanlagen eine Deckelung des Maiseinsatzes auf maximal 60 Masse-% vorgeschrieben ist (vgl. EEG 2012). Gleichzeitig ist aber nun eine freie Kombination aller Substrate und dessen mengenanteiliger Vergütung möglich. Als alternative Biogassubstrate werden in den REKs z.b. Getreide- und Rapsstroh, Landschaftspflegematerial oder Pferdemist angegeben. Auch im Bereich der Festbrennstoffe engagieren sich Projektinitiativen für den Einsatz innovativer Rohstoffe. Die steigende Nachfrage nach Holz führt zu Anstrengungen, bislang ungenutzte Biomassen einer Verbrennung zuzuführen bzw. neuartige Kulturen zur Brennstofferzeugung zu etablieren. In den REKs werden vor allem Kurzumtriebsplantagen, aber z.b. auch Strauchschnitt oder Stroh genanntp1f2p. Welche konkreten Projekte zur Nutzung von solchen Nischenrohstoffen bestehen (und wo diese zu finden sind), ist nicht ausreichend bekannt. Die Akteure in den Projekten können bei fehlender langjähriger Expertise auf Probleme bei der Rohstoffbereitstellung und -verarbeitung stoßen, welche gegebenenfalls bereits in anderen Bioenergie-Regionen gelöst wurden. Die Begleitforschung kann hier zum Themenfeld ungenutzte Biomassen / Einsatz innovativer Substrate dazu beitragen, entsprechende Erfahrungen zur Verfügung zu stellen und weiteren Forschungsbedarf herauszustellen. 1 Unter alternative Bioenergierohstoffe fallen bestehende, aber bislang ungenutzte Rohstoffe sowie neuartige, innovative Rohstoffe, welche bislang unbekannt waren. Die vorliegende Arbeit verwendet dies synonym mit dem Begriff ungenutzter / innovativer Rohstoffe. 2 Eine Recherche der regionalen Projekte ist auf der Webseite des Vorhabens Bioenergie-Regionen möglich: Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
4 Hintergrund, Ziele und Forschungsdesign der Arbeit 1.2 Die Ziele und das Forschungsdesign der Arbeit Die vorliegende Arbeit ist ein Bestandteil der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen (Tabelle 1). Als Unterarbeitspaket zu AP 3 sollen als Arbeitspaket 3.3 Erkenntnisse zur Themenkonjunktur ungenutzter / innovativer Bioenergierohstoffe gewonnen werden. Abbildung 1: Gliederung und Inhalte der Arbeitspakete (AP) der technisch-ökonomischen Begleitforschung Bioenergie- Regionen durch das DBFZ. Inhalte des Berichts sind die rohstoffspezifischen Erfahrungen in den Regionen und der Vergleich zwischen Rohstoffangebot und Projektvielfalt im Bereich ungenutzter / innovativer Rohstoffe. Die folgende Abbildung enthält das Forschungsdesign mit den Zielen und Methoden des Arbeitspaketes: Lösungsorientierter Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen Vergleich Maßnahmenzahl mit Biomassepotenzialen Erfahrungen verfügbar machen, Maßnahmen identifizieren Workshops Sammeln von Erfahrungen Wissenstransfer Vernetzung Datenauswertung Biomassepotenziale Regionale Projekte Regionale Zwischenberichte Literaturanalyse und Recherche von Erfahrungsberichten Ziele Methoden Abbildung 2: Ziele und Methoden im Arbeitspaket 3.3 der techn.-ökon. Begleitforschung Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
5 Hintergrund, Ziele und Forschungsdesign der Arbeit Die übergeordneten Ziele bestehen erstens darin, die Projektvielfalt mit den jeweiligen technischen Biomassepotenzialen zu vergleichen und zweitens den regionalen Wissensträgern einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Damit sollte auch untersucht werden, ob die Regionalmanagements verstärkt in den Bereichen aktiv sind, in denen das größte technische Biomassepotenzial zu erwarten ist. Die Datenauswertung bedient sich den verfügbaren Berichten und Projektergebnissen. Die Gegenüberstellung und Bewertung von Maßnahmen zur Nutzung innovativer Rohstoffe mit dem jeweils ausgewiesenen technischen Biomassepotenzial führt die Begleitforschung unter Berücksichtigung der Ergebnisse regionaler Biomassepotenziale (AP 3.1) sowie der Ausführungen der regionalen Zwischenberichte und Projektbeschreibungen durch. Daneben wurden zwei Workshops durchgeführt, in denen bestehende Erfahrungen der Regionen identifiziert und den anderen Akteuren verfügbar gemacht werden. Gelegenheiten zur Vernetzung, zum Wissenstransfer und zum Sammeln von Erfahrungen erhielten die Regionalmanager somit sowohl beim 11. Workshop mit dem Thema Reststoffe und Landschaftspflegematerial (März 2013 in Hardehausen - Warburg) als auch beim 13. Workshop Bioenergie-Regionen Probleme und Lösungsansätze bei der Etablierung alternativer Bioenergierohstoffe (September 2013 in Nienburg, Weser). Basis der Arbeit ist schließlich die Literaturanalyse und Recherche bestehender Erfahrungen zu alternativen Bioenergierohstoffen in den Bioenergie-Regionen. Sowohl die gesammelten Erfahrungen als auch die Ergebnisse der Gegenüberstellung von theoretischem Potenzial und dem regionalen Projekten sind Bestandteil des vorliegenden Berichts. Ausführungen zu den Inhalten und Ergebnissen des Workshops wurden zusätzlich als Tagungsreader veröffentlicht (siehe hierzu Haak und Bohnet 2013). Darin ist neben den Herausforderungen und Lösungsansätzen schon eine erste Übersicht vorhandener Wissensträger zu den thematisierten Biomassen in den Regionen enthalten. Mit gezielten Literaturhinweisen und praxisnahen Handlungsempfehlungen wird damit der Zugang zu Wissen sowie die Vernetzung innerhalb der Bioenergie-Regionen stark erleichtert. Der vorliegende Bericht vertieft und ergänzt diese Punkte. 1.3 Forschungsaktivitäten im Bereich alternativer Bioenergierohstoffe Die nachfolgende Zusammenstellung von Forschungsaktivitäten verdeutlicht grob die Vielseitigkeit alternativer Bioenergierohstoffe und kann als Basis für weitere, vertiefte Recherchen dienen. Zahlreiche Veröffentlichungen enthalten Informationen zu potenziellen Bioenergiepflanzen. Das Energiepflanzensymposium der FNR (FNR 2013) greift aktuelle Forschungsergebnisse der Branche auf. Hierbei sind sowohl bereits zur Energieerzeugung genutzte Pflanzen als auch potenzielle Energiepflanzen thematisiert. Darüber hinaus gibt es vielfältige Bemühungen, Reststoffe und Koppelprodukte energetisch zu nutzen. Im Bereich Bioabfall untersucht IAA (2011) die Potenziale des biogenen Anteils im Abfall zur Energieerzeugung. Einen aktuellen Überblick zur Vergärung von biogenen Abfällen in Deutschland enthält Wiemer u. a. (2014). Hier wird deutlich, dass (derzeit) nur ein Bruchteil der in Deutschland anfallenden Bioabfälle in einer energetisch optimierten Kaskade eingesetzt wird. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
6 Mais Die Monovergärung von Pferdemist ist trotz des hohen Strohgehalts technisch realisierbar und bei entsprechender Ausgestaltung ein stabiler Prozess. In Bayern und Baden-Württemberg sind Biogasanlagen mit Pferdemist in Betrieb. Das DBFZ führte Substratuntersuchungen im Labormaßstab durch (Fischer u. a. 2013). Für reines Stroh gibt es die Nutzungswege Verbrennung, Ethanolproduktion und Fermentation als Cosubstrat in Biogasanlagen. Diese drei Verwertungsmöglichkeiten werden unter anderem vom DBFZ intensiv beforscht (Brosowski 2012; Gröngröft und Meisel 2013; Igelspacher 2006; Müller 2011; Weller u. a. 2010). Mischpellets sind bislang noch nicht standardisiert und erlangen damit nahezu keine relevanten Anteile im Pelletmarkt. Hierzu forschen das DBFZ sowie weitere Forschungsinstitute an Zertifizierungen und Nutzungskonzepten (z.b. Guder 2013; Pollex und Zeng 2012; Zeng u. a. 2012) Zum Thema Kurzumtriebsplantagen (KUP) finden sich bereits umfangreiche Handlungsanleitungen (z.b. Bärwolff u. a. 2012; LfULG 2009; Unselt u. a. 2010), Bücher (z.b. Bemmmann und Manning 2013) und Forschungsprojekte (recherchierbar in der 17TFNR-Projektdatenbank17TP2F3P: FastWOOD; agrofornet; ELKE; AGENT; KUPAD; KUP am Fließgewässer). Dennoch ist der KUP-Anbau als bislang wenig verbreitet anzusehen und wird daher im vorliegenden Bericht bei der Auswertung der regionalen Aktivitäten mit betrachtet. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL e.v.) sammelt Informationen zu Energieprojekten mit Materialien aus der Landschaftspflege. Der schwierig vorhersehbare Rohstoffanfall sowie dessen Aufbereitung sind die bedeutendsten Forschungsthemen. Hefter u. a. (2009) analysieren schwerpunktmäßig das Aufkommen von Landschaftspflegematerial (kurz: LPM). Darüber hinaus betrachten Naturschutzstiftung David (2012); Sauter u. a. (2013) sowie TLL (2011) Aspekte wie Verfahrensketten, technische Rohstoffverwertbarkeit und naturschutzfachliche Effizienz bei der Nutzung von LPM. Kuhn u. a. (2013) sowie Vollrath u. a. (2012) wenden sich der energetischen Nutzung von Wildpflanzen zu. Zum Anbau der Durchwachsenen Silphie forscht schwerpunktmäßig die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL 2013) sowie das Thünen-Institut (Johann Heinrich von Thünen-Institut 2014). Zusammenfassend zeigt sich eine große Vielfalt an Forschungsaktivitäten bezüglich nachwachsender Rohstoffe. Zwar bestätigen die Ergebnisse des Forschungsprojekts EVAP3F4P in seiner Rolle als ertragreichste und ökonomischste Kultur (Eckner und Vetter 2013). Dennoch sind regionsspezifisch eine Reihe von sinnvollen und praxisrelevanten Ergänzungen in der Fruchtfolgegestaltung möglich. ECKNER & VETTER (2013) weisen diesbezüglich darauf hin, dass standortspezifisch neue Kulturen ebenso überzeugen, wie die Erweiterung der Fruchtfolgen mit Zwischen- oder Zweitfrüchten als auch der Anbau von Ganzpflanzengetreiden oder Ackerfutter. 3 Online im Web: 4 Verbundvorhaben: Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
7 Erfahrungen in Bioenergie-Regionen mit ungenutzten Biomassen / innovativen Substraten Erfahrungen in Bioenergie-Regionen mit ungenutzten Biomassen / innovativen Substraten Abbildung 3: Erfahrungen mit alternativen Rohstoffen in Bioenergie-Regionen. Aufgeführt ist eine Auswahl von Biomassen, zu denen bereits bedeutende Wissensträger in den Regionen vorhanden sind. Siehe ergänzend Anhang A 2 Eigene Darstellung DBFZ Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
8 2 Alternative Rohstoffe in Bioenergie-Regionen Alternative Rohstoffe in Bioenergie-Regionen Was zeichnet alternative Rohstoffe aus? Typische Bioenergierohstoffe sind bereits breit etabliert und werden seit langer Zeit als Biomasse zur Energieerzeugung eingesetzt. Dazu gehören für den Einsatz in Biogasanlagen die Wirtschaftsdünger aus der Geflügel-, Rinder- und Schweinehaltung sowie nachwachsende Rohstoffe wie Mais, Ganzpflanzensubstrate (z.b. aus Roggen) und Gras. Als Festbrennstoffe kommen in Heiz(kraft)werken und Holzvergasern typischerweise Holzhackschnitzel aus Waldrestholz oder Holzpellets aus Nebenprodukten der Holzverarbeitung sowie Altholz zum Einsatz. Neben den typischen Bioenergierohstoffen findet auch der Anbau neuartiger, d.h. noch wenig in der Praxis erprobter Energiepflanzen, z.b. mehrjährige Energiekräuter und gräser statt (FNR 2012). Dazu zählen auch mehrjährige Energiepflanzen-Exoten mit noch relativ wenig Erfahrung hinsichtlich Ertragsverhalten, Nährstoffbedarf, Pflanzenschutzmaßnahmen und Anbauverfahren (Eder 2012: S. 76f). Darüber hinaus geraten auch biogene Abfälle und Nebenprodukte, die bisher vor allem stofflich verwertet bzw. entsorgt wurden, verstärkt in den Fokus als Rohstoff zur Energieerzeugung. Seit 2011/12 entstanden 25 neue Bioabfallvergärungsanlagen. Obwohl gleichzeitig 9 Anlagen still gelegt wurden, stieg somit der Gesamtbestand an Bioabfallvergärungsanlagen in Deutschland um etwa ein Viertel auf nunmehr 113 Anlagen (Wiemer u. a. 2014). In solchen Anlagen können anteilig auch bislang nicht genutzter alternativer Rohstoffe eingebracht werden. Solche alternativen Bioenergierohstoffe sind gekennzeichnet durch einen niedrigen Bekanntheitsgrad als Energieträger, besondere logistische Herausforderungen bei der Bereitstellung oder hohe technische Anforderungen an die Verwertung (siehe Tabelle 1). Diese drei Eigenschaften führen zu einer bisher nur geringen energetischen Nutzung, weswegen hierbei gleichzeitig nur wenige Erfahrungen vorliegen. Bei nachwachsenden Rohstoffen sind außerdem die zurückliegenden Anstrengungen zur Sortenzüchtung sowohl die bislang begründete Anbaufläche in Deutschland ein Hinweis auf den Neuheitsgrad des Bioenergierohstoffs. Tabelle 1: Kennzeichnende Eigenschaften alternativer Bioenergie. Eigene Darstellung Kennzeichen alternativer Bioenergierohstoffe Bekanntheitsgrad als Energieträger Komplexität der Bereitstellung Technische Anforderungen an die Verwertung NAWARO: Züchtungshistorie auf Energieausbeute NAWARO: Derzeitige Anbaufläche Niedrig Hoch Hoch Kurz Gering Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
9 2 Alternative Rohstoffe in Bioenergie-Regionen Charakterisierung alternativer Bioenergierohstoffe Grundsätzlich können bei den alternativen Bioenergierohstoffen hinsichtlich der Nutzungsmotive zwei Gruppen unterschieden werden. In der ersten Gruppe lassen sich solche Rohstoffe zusammenfassen, die aus vorwiegend ökologischen Gründen (Naturschutz, Landschaftsbild etc.) als Bioenergierohstoff thematisiert werden. Charakteristisch ist hierbei, dass diese als Alternative für bisher genutzte Materialien oder Substrate gewonnen bzw. angebaut werden. Es findet demnach überwiegend eine Änderung der bestehenden Flächenbewirtschaftung statt, um die alternativen Rohstoffe zu produzieren. Als eingängiges Beispiel können Wildpflanzenmischungen angeführt werden, die für die Biogaserzeugung als Alternative zu Maispflanzen eingesetzt werden und damit einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz sowie zur Auflockerung des Landschaftsbildes leisten. In der zweiten Gruppe befinden sich alternative Bioenergierohstoffe, welche bislang schon in Stoffströmen der Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung oder Landschaftspflege vorkommen, jedoch (noch) nicht energetisch genutzt werden. Hier ist die Motivation zur Etablierung dieser Rohstoffe das Erschließen ungenutzter Ressourcen. Die energetische Nutzung erweitert im besten Fall die Nutzungskaskade und wertet damit einen ohnehin anfallenden Rohstoff bzw. Reststoff auf. Als Beispiel sei hier die Aufbereitung von landwirtschaftlichen Reststoffen zu Mischpellets und deren energetische Verwertung genannt. Die folgende Tabelle 2 enthält ausgewählte Bioenergierohstoffe, die zur Energieerzeugung bislang einen nur geringen Beitrag liefern. Es wird unterschieden nach den Gruppen Rohstoffgruppe A) Ökologisch motivierter Anbau Rohstoffgruppe B) Erschließen ungenutzter Ressourcen Tabelle 2: Ausgewählte alternative Bioenergierohstoffe und ihre Einordnung zu den Rohstoffgruppen. * Dauerkultur meint in diesem Zusammenhang den mehrjährigen Energiepflanzenanbau ohne Umbruch (x) keine eindeutige Zuordnung Quelle: (FNR 2012) (FNR 2007: S. 64ff) Rohstofftyp Rohstoff Gruppe A) Ökologisch motivierter Anbau Gruppe B) Erschließen ungenutzter Ressourcen Kultur 1-jährig Zucker- / Futterhirsen (Sorghum bicolor) X Kultur 1-jährig Sudangrashybride (S. bicolor x S. sudanense) X Kultur 1-jährig Sonnenblumen als Energiepflanze (x) Dauerkultur* Topinambur X Dauerkultur* Wildpflanzenmischungen X Dauerkultur* Durchwachsene Silphie X Dauerkultur* Switchgras (Rutenhirse) X Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
10 2 Alternative Rohstoffe in Bioenergie-Regionen Rohstofftyp Rohstoff Gruppe A) Ökologisch motivierter Anbau Gruppe B) Erschließen ungenutzter Ressourcen Dauerkultur* Szarvasigras (Riesenweizengras) X Mischkultur z.b. Mais-Bohnen-Gemenge X Zwischenfrüchte / Untersaaten Wie Leguminosen, Phacelia, Ölrettich, Gräsermischungen (x) (x) Landschaftspflegematerial Halmgutartiges Material aus Schutzgebieten und Biotopen als Biogassubstrat X Landschaftspflegematerial Holziges Material aus Schutzgebieten, Biotopen; als Festbrennstoff X Abfall Kommunaler / Privater Grünschnitt, Grünabfall X Abfall Abfälle der Nahrungsmittelproduktion X Exkremente Pferdemist X Exkremente Klärschlamm X Nebenprodukt Stroh als Biogassubstrat X Brennstoff Holziges Wegebegleitgrün X Brennstoff Stroh als Festbrennstoff X Brennstoff Holz aus Kurzumtriebsplantagen X Brennstoff Miscanthus (Chinaschilf) X Brennstoff Mischpellets / Mischbriketts; Grüngutpellets X Sekundärbrennstoff Karbonisierte Biomasse (aus Pyrolyse oder Hydrothermaler Carbonisierung (HTC)) X Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
11 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Im Zuge der regionalen Zwischenberichterstattung zur Fördermaßnahme gaben die Regionalmanager im Jahr 2013 an, welche alternativen Biomassen in ihren Regionen bereits genutzt werden und für welche eine Nutzung geplant ist. Der Rohstoff wird thematisiert, sobald er entweder bereits genutzt oder dessen Nutzung geplant ist. Eine Übersicht der hierbei genannten Rohstoffe aus Gruppe A enthält die folgende Abbildung: Alternative Rohstoffe zur Förderung der Ökologie in Bioenergie-Regionen im Jahr 2013 KUP Hackschnitzel Wildpflanzenmischungen Durchwachsene Silphie Blühstreifen Sorghumhirsen Rohstoff wird thematisiert Nutzung des Rohstoffs geplant Rohstoff wird bereits genutzt Szarvasi-Gras, Topinambur Anzahl der Regionen Abbildung 4: Alternative Rohstoffe der Gruppe A (Ökologisch motivierter Anbau) in Bioenergie-Regionen. Angaben des Regionalmanagements. thematisiert : Rohstoff bereits genutzt oder dessen Nutzung geplant Datengrundlage: Regionale Zwischenberichte der Bioenergie-Regionen im Jahr Für einige der genannten Rohstoffe zeichnet sich durch die Anzahl an Nennungen ein verstärktes Interesse ab, sodass hierbei mit einem erhöhten Bedarf an Wissensaustausch gerechnet werden kann. Die folgenden Kapitel führen daher den Forschungsstand und Erfahrungen aus den Bioenergie-Regionen für ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie zusammen. Die hier aufgeführten Erfahrungen sind überwiegend Ergebnisse des 13. Workshops Bioenergie-Regionen.P4F5 5 Erfahrungsbericht online verfügbar unter Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
12 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) 3.1 Blühstreifen Begriff und Grundlagen Blühflächen sind Ackerflächen, die mit blütenreichem Saatgut eingesät werden und daraufhin bis auf Ausnahmen fünf Jahre lang nicht bewirtschaftet werden. (Wagner 2013) Für die Anlage solcher Flächen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt eine ausgewählte Fläche für fünf Jahre bestehen oder die Blühfläche wird jährlich an einer anderen Stelle neu eingerichtet. Eine energetische Nutzung des Aufwuchses ist nicht vorgesehen. Stattdessen nennt WAGNER (2013) folgende agrarökologische Ziele: Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität) Schaffung neuer Lebens- und Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen Nahrung für Bienen über die gesamte Vegetationsperiode Förderung des Biotopverbunds Artenreiche Vegetation aus Kulturpflanzen und Wildpflanzen heimischer Herkunft Ganzjähriger Bodenschutz Schutz von Oberflächen- und Grundwasser Nützlinge aus den Blühstreifen können Schädlinge in der Ackerfläche bekämpfen Erhöhung des Erholungswerts der Kulturlandschaft Die Saatgutmischungen sind dementsprechend überwiegend auf einjährige Pflanzen ausgerichtet, die einen nicht zu dichten Bestand bilden. Der wirtschaftliche Aufwand für die Landwirte wird in einigen Bundesländern durch entsprechende Maßnahmen im jeweiligen Agrarumweltprogramm gefördert. Die Möglichkeit, einzelne Schläge bzw. Streifen für nur ein Jahr als Blühfläche anzulegen ist besonders interessant für Landwirte, die sich noch nicht für eine mehrjährige Kultur entscheiden wollen. Die Erfahrungen mit blütenreichen Pflanzenmischungen dienen auch bei der Etablierung von Wildpflanzen für die Biogasnutzung (siehe Kapitel 2.2). Jan Freese / pixelio.de Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
13 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Erfahrungen aus den Regionen Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Planung (konzeptionell, Einbindung ins System) Die Landwirte haben keinen Anreiz, Blühstreifen anzulegen Landwirte haben Vorbehalte, sich auf mehrere Jahre festzulegen Prozedere der Förderung, und Integration in Anbaustruktur unbekannt Im Wendland ging die Initiative von den Energiewirten aus, weil sie ein besonderes ökologisches Selbstverständnis haben. Vertreter des Naturschutzes formulierten Hinweise zum Anbau und empfahlen Saatgutmischungen. Blühstreifen können analog zu normalen Kulturen jedes Jahr auf anderen Flächen angelegt werden. Damit passen sie gut ins Anbausystem. Die Moderation einer Bioenergie-Region ( Vielfalt ins Feld ) hat dazu geführt, dass sich das Wissen stark verbreitet hat. Viele Landwirte haben eigene kleine Versuchsflächen angelegt, um das Verfahren kennenzulernen. Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung Zusammensetzung der Saatgutmischung Anlage von Blühstreifen auf Flächen mit großer Öffentlichkeitswirkung Langfristige Auswirkung auf Ackerbegleitvegetation unbekannt Speziell entwickeltes Saatgut wird von mehreren Firmen angeboten. In der Region Wendland-Elbetal gibt es eine eigene Entwicklung einer Saatgutmischung. Für den Erfolg der Maßnahme in der Region Wendland war die Zusammensetzung der Saatgutmischung aber nicht so wichtig wie ursprünglich gedacht. Die Flächenauswahl sollte sich vordringlich am ökologischen Nutzen orientieren. Durch gezielte Beratung in der Region Wendland-Elbetal werden Blühstreifen inzwischen sowohl in sensiblen Räumen (z.b. Übergang zu Naturschutzgebiet) als auch auf Flächen an Ortsrändern, Wegen und Straßen angelegt. In der Bioenergie-Region Wendland sind begleitende Untersuchungen zu unerwünschten Effekten durch Ackerunkräuter in Vorbereitung. Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Der großflächige Anbau von Energiepflanzen führt zu Widerstand in der Bevölkerung gegen Bioenergieprojekte Die Anlage von Blühstreifen wird von der Bevölkerung nicht wahrgenommen Runder Tisch aller Beteiligten brachte Versachlichung in die Diskussion um Maismonokulturen. Blühstreifen führen zu einem Ausgleich der Intensivnutzung und relativieren die Negativ-Debatte. Inzwischen werden Naturschutzthemen in die Öffentlichkeitsarbeit und den Biogas- Stammtischen integriert. Anstatt sich zu lange mit theoretischen Überlegungen auseinander zu setzen, wurden im Wendland Vorbildprojekte entwickelt und durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Durch Moderation und eine öffentlich wahrnehmbare Kampagne steigt die öffentliche Wahrnehmung und damit die Motivation der Landwirte mitzumachen. Die Vorbildwirkung der ersten Blühstreifen induziert Nachahmer. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
14 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Administration (Fördermittel, Genehmigungen) Es ist unklar, ob die Blühstreifen als Greeningflächen angerechnet werden können Die Förderung der Anlage der Blühstreifen wird gewünscht Blühstreifen können als Feldrand- bzw. Pufferstreifen mit dem Gewichtungsfaktor 1,5 angerechnet als ökologische Vorrangfläche (övf) werden. Für einen Hektar Blühfläche wird dementsprechend der Soll von 1,5 ha övf erfüllt. Blühstreifen sind außerdem kombinierbar mit den Agrarumweltmaßnahmen der Länder. Die Länder können bei Inanspruchnahme von Leistungen des Vertragsnaturschutzes jedoch finanzielle Kürzungen festlegen, um Doppelförderung zu vermeiden. Die Förderung von Blühstreifen/Blühflächen ist in den Agrarumweltprogrammen der Bundesländer festgelegt. z.b. in Baden-Württemberg: Maßnahme N-E3 im MEKAP5F6P III (Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz 2011) Bayern: Maßnahmen 3.5 (920 / ha) & 3.6 (mindestens 110 / ha) im KULAP (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) 2011) Niedersachsen: Maßnahmen A5 & A6: / ha im NAU/BAU (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 2011) Handlungsempfehlungen für Kommunikation und Umsetzung Handlungsempfehlungen für Landwirte zur Anlage von Blühstreifen findet man online auf der 17TWebseite der Bioenergieregion Wendland-Elbetal17TP6F7P. Darüber hinaus hat die 17TBayerische Landesanstalt für Landwirtschaft17TP7F8P Informationen zusammengestellt und ein Merkblatt zur Anlage von Blühstreifen und -flächen herausgegeben. 6 MEKA III, KULAP, NAU/BAU sind die Agrarumweltprogramme der genannten Bundesländer. 7 Online unter: 8 Online unter: Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
15 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) 3.2 Wildpflanzenmischungen Begriff und Grundlagen Die Wildpflanzenmischungen zur Biogasgewinnung bestehen aus Wildpflanzen- und Kulturarten, die über mehrere Jahre nutzbare, 1,5 bis 3,5 m hohe, blütenreiche Pflanzenbestände bilden. (FNR 2012: S. 41) Durch die Kombination von bis zu 25 Arten ergeben sich dichte Mischbestände mit einem wechselnden Erscheinungsbild innerhalb der ersten drei Nutzungsjahre. Das Ziel des Anbausystems ist ein hohes Biomassepotenzial bei gleichzeitigen Vorteilen für Biodiversität, Umweltschutz und das Landschaftsbild. Kuhn u. a. (2013: S. 6) nennen unter anderem folgende ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber einjährigen Anbausystemen, die mit hoher Intensität betrieben werden: Ökonomische Vorteile: Deutlich Einsparung von Maschinen-, Lohn- und Treibstoffkosten Erhebliche Einsparung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln Deutliche Verminderung des Wildschadensrisikos Mehr Risikostreuung bei der Biomasseproduktion Bessere Verteilung der Arbeitsspitzen durch ein erweitertes Erntefenster Alternativen für schwache Standorte Ökologische Vorteile: Produktionsintegrierte Förderung der Vielfalt in den Agrarlandschaften Vorteile bei voraussichtlicher Klimaveränderung mit trockeneren und wärmeren Sommern Lebensraum für viele Offenlandarten über das ganze Jahr Verhindern von Bodenerosion durch Wasser und Wind Erhöhung der Boden- und Pflanzengesundheit Abwechslungsreicheres Landschaftsbild Ausschließliche Verwendung von heimischen Pflanzenarten, somit keine Florenverfälschung Hervorragende Pollen- und Nektarquelle für Wild- und Honigbienen hohe Akzeptanz in der Bevölkerung Bodensee-Stiftung Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
16 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Erfahrungen aus den Regionen Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Planung (konzeptionell, Einbindung in System) Die Einführung neuer Pflanzen braucht Überzeugungsarbeit bei den regionalen Landwirten Langfristige Kontaktpflege zu regionalen Landwirten, Mund-zu-Mund-Propaganda und Pressearbeit sind wichtige Bausteine zur erfolgreichen Verbreitung / Etablierung von Wildpflanzenmischungen. Eine Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt schafft nötiges Wissen, um ggf. bestehenden Vorbehalten der Landwirte besser begegnen zu können. Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung Wirtschaftlichkeit noch nicht flächendeckend belegt Saatgut ist teuer Einstellen der Sämaschine ist schwierig Unerwünschte Arten dominieren Wirtschaftliches Ergebnis bei Anbau von Wildpflanzen über einen Zeitraum von fünf Jahren entspricht in etwa dem Ergebnis von Mais (FNR 2012: S. 42) Sammelbestellung von Saatgut ermöglicht günstigere Einkaufspreise. Eine gemeinsame Aussaat erspart Zeit und Kosten, Knowhow kann geteilt werden. Wichtig ist eine flache, gleichmäßige Saat. Damit Unkrautdruck (z. B. Ampfer, Gräser) die gewünschte Artenzusammensetzung nicht beeinflusst, ist die Vorbereitung der Fläche sehr wichtig. Z.B. zweimaliges Eggen gegen einjährige Ackerunkräuter. Falls im ersten Jahr keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden können, ist es sinnvoller, anstatt umzubrechen, zu mähen und die Entwicklung der mehrjährigen Arten abzuwarten. Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Verstärkter Maisanbau stößt in Teilen der Bevölkerung auf wenig Akzeptanz Landwirte können Vorhaben selten alleine öffentlichkeitswirksam darstellen Wildpflanzenmischungen bieten die Möglichkeit, das Image der Bioenergie zu steigern. Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsamt und der unteren Naturschutzbehörde erhöht die Erfolgsaussichten und Glaubwürdigkeit. In der Folge kann der Wert von Wildpflanzen für Naturschutz und Landschaftsbild kommuniziert werden. In der Region Bodensee führt die Bodensee-Stiftung Infokampagnen durch. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit und die Vereinigung verschiedener Interessensgruppen macht das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Administratives (Fördermittel, Genehmigungen) Flächen nicht als Greeningflächen anerkannt Trotz ihrer ökologischen Vorteile gegenüber vielen weiteren Ackerkulturen sind Flächen mit Wildpflanzen Nutzpflanzen in Hauptfruchtstellung und somit nicht als Greeningfläche anrechenbar. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
17 ergeben 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Handlungsempfehlungen für Kommunikation und Umsetzung Am dem Beispiel der erfolgreichen Etablierung von Wildpflanzen auf Ackerflächen in der Bioenergie-Region Bodensee wird deutlich, dass es wichtig ist, Experten einzubinden und sich bei der Öffentlichkeitsarbeit und Infoveranstaltungen auf den Erfahrungsaustausch zu konzentrieren. Ein erster Entwurf mit Praxisempfehlungen für den Anbau von Wildpflanzen zur Biomasseproduktion kann auf der te 17Thttp:// heruntergeladen werden (Kuhn u. a. 2013). Wissenschaftliche Untersuchungen zu Erträgen und Biogasausbeuten verschiedener Wildpflanzenmischungen führt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau im Projekt Energie aus Wildpflanzen durch (siehe hierzu Vollrath u. a. 2012). Bodensee-Stiftung 3.3 Durchwachsene Silphie Begriff und Grundlagen Die Durchwachsene Silphie ist eine ausdauernde und gleichzeitig ertragreiche Pflanze, die derzeit eine steigende Bedeutung für die Bioenergieerzeugung erfährt. Die Anbaufläche wuchs beginnend mit 25 ha im Jahr 2009 auf 300 ha im Jahr 2012 an (TLL 2013). Landwirte testen den Anbau und die energetische Verwertung der Durchwachsenen Silphie vor allem auf Rest- und Splitterflächen. Der Ertrag beläuft sich auf ca dt Trockenmasse pro Hektar ab dem zweiten Anbaujahr. Mit Methanausbeuten von ca. 285 Nl/kg otsp8f9p sich theoretische Methanerträge je Flächeneinheit, die etwa 10 bis 15 % unter dem Niveau von Silomais liegen (EBD.). Die auffälligen gelben Blütenstände des Korbblütlers bereichern das Landschaftsbild und bieten durch die lange Blütezeit von Mitte Juli bis Mitte September Insekten eine wichtige Nahrungsgrundlage. Weitere ökologische Vorteile vor allem gegenüber einjährigen Kulturen ergeben sich durch die permanente Bodenbedeckung, was Erosion durch Wind und Wasser minimiert. Der Stickstoffbedarf liegt etwa 30 % unter dem von Mais. Pflanzenschutzmittel sind ab dem zweiten Bestandsjahr weitgehend unnötig (EBD.). 9 Nl/kg ots: Normliter pro Kilogramm organischer Trockensubstanz Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
18 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Erfahrungen aus den Regionen Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Planung (konzeptionell, Einbindung in System) Landwirte stehen neuen Sorten argwöhnisch gegenüber. Insbesondere bei großen Agrargenossenschaften besteht Routine bzgl. Fruchtfolge Durch die große Menge an produzierter Biomasse besteht seitens der Landwirte prinzipiell großes Interesse an der Silphie als Energiepflanze. Die Pflanze erreicht außerdem aufgrund der attraktiven Blüte positive Resonanz in der Bevölkerung. Die Ansprache und Motivation/Überzeugung der Landwirte erfolgte in der Bioenergie- Region Jena-Saale erfolgreich über das Bioenergie-Regionen-Netzwerk. Argumentation: Die Erträge der Durchwachsenen Silphie sind mit denen des Mais zu vergleichen. Die Bewirtschaftung mit vorhandenen Maschinen möglich. Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung Viele verschiedene Sorten machen Marktlage unübersichtlich Aussaat/Pflanzung von Durchwachsener Silphie erfordert zunächst größere Anfangsinvestitionen Engpässe bei der Bereitstellung von Pflanzgut Fehlende praktische Erfahrung unter den Akteuren Gefahr des Verlusts des Bestandes im 1. Jahr Keine planbaren Erträge In der Bioenergie-Region Jena-Saale wurden zunächst besonders Splitter- und Restflächen bepflanzt, um Erfahrungen mit Pflanzmaterial zu gewinnen. Schwierigkeiten mit der Saatgutablage erfordert Pflanzung zur Etablierung einer einheitlichen Bestandsdichte. Die Pflanzung ist sehr zeit- und personalintensiv: Kosten & Aufwand für Pflanzung liegen bei ca /ha; Herbizide sind für diese Kultur noch nicht zugelassen, so dass Unkräuter per Hand entfernt werden müssen. In den Folgejahren nach der Pflanzung sind die Kosten jedoch gering. Wegen der steigenden deutschlandweiten Nachfrage nach Silphie zum Auspflanzen kommt es bereits zu Engpässen seitens der Anzucht. Die Alternative ist die Saat auf dem Acker. Drillversuche zum Ausbringen der Silphien- Saat verlaufen sehr vielversprechend und könnten die Kosten für die Ausbringung deutlich senken. In Thüringen arbeiten die Landwirte mit einer Partnerfirma zusammen. Diese verfügt über das nötige Know-how bei der Pflanzen Samen- und Pflanzenzucht. Fachliche Unterstützung kommt außerdem von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), die eigene Versuche durchführt. Maschinen für die Pflanzung können von Gartenbauunternehmen ausgeliehen werden, was Investitionen erspart. Wichtig ist, die Akteure zum Experimentieren zu ermutigen. Erkannte Ursache: Pflanzen wurden zu spät gepflanzt und waren bereits zu groß. Unzureichende Pflegemaßnahmen im ersten Jahr gefährden den Bestand. In der Region Jena-Saale kam es auch zu flächigen Ausfällen durch Austrocknung. Region Jena-Saale: die ermittelten Ausbeuten im Jahr 2012 lagen zwischen 133 dt/ha und 314 dt/ha Frischmasse Ausfälle, teilweise mit bislang unbekannten Ursachen, müssen weiter erforscht werden Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
19 3 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A) Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Nachwachsende Rohstoffe müssen ein besseres Image bekommen Die Durchwachsene Silphie ist attraktiv für Bienen. Eine Kooperation mit Imkern ist daher möglich. Allerdings ist die Pflanze durch den späten Blühzeitpunkt für die Honigproduktion weniger interessant (hierzu liegen bereits Erfahrungen in der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber vor). Administration (Fördermittel, Genehmigungen) Möglichkeiten der öffentlichen Förderung sind unbekannt In der Region Jena-Saale konnte das Pflanzmaterial sowie (anteilig) die Pflanzmaschine über eine LEADER-Förderung finanziert werden Handlungsempfehlungen für Kommunikation und Umsetzung Durch die Versuche von landwirtschaftlichen Einrichtungen sowie engagierten Landwirten liegen in mehreren Regionen Deutschlands bereits Erfahrungen mit dem Anbau der Durchwachsenen Silphie vor. Die TLL hat hierzu eine Leitlinie zur effizienten und umweltverträglichen Erzeugung von Durchwachsener Silphie herausgegeben (siehe TLL, 2013). Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass über das Netzwerkmanagement positive Impulse durch Öffentlichkeitsarbeit und der gezielten Ansprache und Vernetzung von Akteuren gesetzt werden können. Durch kleinflächige Versuche können regional Erfahrungen gewonnen werden. Bestehende Anpflanzungen dienen in der Folge als Vorbilder für Nachahmer. Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
20 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Auch für bislang nicht genutzte Rohstoffe, welche aber in einer Nutzungskaskade energetisch verwertbar wären, machten die Regionalmanager im regionalen Zwischenbericht 2013 Angaben zur bisherigen und geplanten Nutzung. Dies betrifft Reststoffe und Abfälle bzw. Nebenprodukte. Ein Rohstoff gilt dann als thematisiert, sobald er entweder bereits genutzt oder dessen Nutzung geplant ist. Eine Übersicht der hierbei genannten Rohstoffe aus Gruppe B enthält die folgende Abbildung: Landschaftspflegematerial (Fermentation) Landschaftspflegematerial (Verbrennung) Alternative Rohstoffe zur Erschließung ungenutzter Ressourcen in Bioenergie-Regionen 2013 Private Bioabfälle Pferdemist Mischpellets / -briketts Stroh (Verbrennung) Pflanzenkohle Klärschlamm Stroh (Fermentation) separierte Schweinegülle Rapsstroh Pellets aus WRH Holziges Grüngut Holz unter Hochspannungsleitungen Feuchtgrünland / Moor Biomasse aus Solarparks Rohstoff wird thematisiert Nutzung des Rohstoffs geplant Rohstoff wird bereits genutzt Anzahl der Regionen Abbildung 5: Alternative Rohstoffe der Gruppe B (Erschließen ungenutzter Ressourcen) in Bioenergie-Regionen. Angaben des Regionalmanagements. thematisiert : Rohstoff bereits genutzt oder dessen Nutzung geplant Datengrundlage: Regionale Zwischenberichte der Bioenergie-Regionen im Jahr Für einige der genannten Rohstoffe zeichnet sich durch die Anzahl an Nennungen ein verstärktes Interesse ab, sodass hierbei mit einem erhöhten Bedarf an Wissensaustausch gerechnet werden kann. Die folgenden Kapitel führen daher den Forschungsstand und Erfahrungen aus den Bioenergie-Regionen für ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen bestehender Stoffströme zusammen. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
21 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Die hier aufgeführten Erfahrungen sind überwiegend Ergebnisse des 13. Workshops Bioenergie- Regionen.P9F10P Die Erweiterung der Nutzungskaskade von Bio- und Speiseabfällen um eine energetische Nutzung wurden hierbei nicht diskutiert. Eine Gegenüberstellung von Potenzial und Maßnahmenzahl in den Bioenergie-Regionen enthält Kapitel Erfahrungen in Bioenergie-Regionen mit Landschaftspflegematerial waren Thema des 11. Workshops Bioenergie-Regionen und sind in einer gesonderten Veröffentlichung zusammengefasst. Einen Einblick in die Vielschichtigkeit der Projekte gibt hierzu die Gegenüberstellung von Potenzial und Maßnahmen in Kapitel Mischpellets Begriff und Grundlagen Mischpellets sind Biobrennstoffe, deren Herstellungsprozess wie bei Holzpellets abläuft, das Rohmaterial hingegen aus verschiedenen Biomassen bestehen kann. Dazu zählen zum Beispiel Mischpellets aus Stroh- oder Miscanthus (halmgutartige Biomasse) mit Biomasse von Früchten (nicht-holzartige Biomasse) oder mit holzartiger Biomasse (vgl. DIN EN ). Jan Gutzeit (DBFZ) Für den Einsatz von Mischpellets in Feuerungsanlagen bis 100 kwrnwlr sind die Anforderungen der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) maßgeblich, in der sowohl die Emissionsgrenzwerte für den Anlagenbetrieb als auch die brennstofftechnischen Anforderungen an die einzusetzenden Pellets definiert sind (Witt 2012). Demnach dürfen Feuerungsanlagen, die nicht nach 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu genehmigen sind, nur mit solchen Brennstoffen betrieben werden, für deren Einsatz sie nach Angaben des Herstellers geeignet sind ( 4 Abs BImSchV). Die Hersteller von Feuerungsanlagen für z.b. Stroh, Getreide oder Pellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen müssen außerdem durch ein Typisierungsverfahren belegen, dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Bislang ist in Deutschland noch kein Biomassekessel für etwaige Mischbrennstoffe typisiert. Sollen Mischpellets in Anlagen ab 100 kwrnwlr eingesetzt werden, ist jede Einzelanlage individuell behördlich zu prüften und zu genehmigen. Dies ist von einer etwaigen Typisierung unabhängig. Zwar gelten für die Prüfung keine genehmigungsrechtlichen Vorgaben, aber eine Sicherung der Brennstoffqualität ist erforderlich. Somit kann es sinnvoll sein, dass sich die Brennstoffqualität an bestehenden Produktnormen (EN bzw. -6) orientiert. Grundsätzlich sind Feuerungsanlagen stets auf bestimmte Brennstoffe ausgelegt. Der Einsatz von Mischpellets müsste demzufolge vom Kesselhersteller vorgesehen sein. Vorgaben des Hersteller zu Brennstoffeigenschaften oder Anlagenbetrieb müssten also in jedem Fall beachtet werden, damit vorgegebene Emissionsgrenzwerte eingehalten werden können (Bosch und Zeng 2012). 10 Erfahrungsbericht online verfügbar unter Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
22 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Erfahrungen aus den Regionen Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Planung (konzeptionell, Einbindung in System) Mögliche Einsatzstoffe sind in der Region eventuell nicht erschlossen In Frage kommen Reststoffe und halmgutartige Biomasse (Weizen-, Gerste-, Mais-, Hirsestroh, Miscanthus, Schalen, Gräser, Pressrückstände usw.). Prinzipiell ist solches Material z.b. aus der Getreideverarbeitung genügend vorhanden. Z.B. kann ein Maschinenring als Ansprechpartner für den regionalen Reststoffanfall dienen. Ggf. helfen Suchanzeigen in Landwirtschaftszeitung, um mögliche Einsatzstoffe zu identifizieren. Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung Erhöhter technischer Aufwand bei der Pelletproduktion Hoher Feinanteil nach Pressvorgang Erhöhter technischer Aufwand bei Pelletverbrennung Notwendig ist eine Durchmischung von Holz mit den sonstigen Rohstoffen (z.b. entmischt sich Stroh leicht). Die gesamte Mischung sollte mit einer Hammermühle aufgearbeitet werden, um unterschiedliche Ausgangsstoffe in einheitliche Form zu bringen (Guder 2013) Eine Dosieranlage für Additive ist unentbehrlich für Mischpellets, um Emissionsgrenzwerte einhalten zu können. Nötig ist auch eine Spezialmatrize für den Pressvorgang (gegebenenfalls vom Hersteller individuell anfertigen lassen). Grund: Feuchte des Ausgangsmaterials ist zu hoch oder zu gering. Diese kann über Konditionierung (Wasserdampf, Verarbeitungstemperatur) eingestellt werden. Herangehensweise der BTU-Cottbus (Guder 2013): - Verschlackung durch das Additiv Kaolin steigt Ascheerweichungstemperatur (Additive nur mit halmgutartiger Biomasse mischen); alternativ sind Schubrostkessel möglich, die unempfindlich gegenüber Verschlackung sind - Schwefel und Chlor kondensieren zu Säure Additiv Calciumcarbonat bindet Chlor; ggf. kann Brennkammer mit Edelstahl ausgekleidet werden - Hoher Ascheanteil führt zu größeren Feinstaubemissionen zusätzliche Filtertechnik installieren - Hoher Ascheanteil verschmutzt Brennkammer zweistündlicher Druckluftimpuls auf Brenner befreit von Störstoffen, Kesselreinigungsintervall: 4-6 Wochen - Kessel, die mit den genannten technischen Maßnahmen ausgestattet sind, sind sehr variabel bzgl. der Bandbreite der verwendbaren Pelletbrennstoffe Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Pelletierfabriken nehmen sich dem Thema Mischpellets nicht an Gründe: der Normierungs-/Zertifizierungsaufwand ist sehr hoch; der Kesselhersteller muss Gewährleistung für den Brennstoff erteilen, sonst entfällt die Garantie. Mögliche Lösung: Ein unabhängiges Institut unterstützt bei der Zertifizierung und untersucht die Unbedenklichkeit des Brennstoffes für den Kesselbetrieb. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
23 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Administration (Fördermittel, Genehmigungen) Bisher keine standardisierten Biomischpellets in Deutschland etabliert und geprüft Jeder Mischpellet muss genormt werden, was eine Herausforderung für jene Produzenten darstellt, die nicht nur für den Eigenbedarf pelletieren (siehe Norm EN & ggf in denen Anforderungen an Heizwert, Abrieb, Schüttdichte usw. definiert sind.). Die Zulassung (Zertifikat) der Pellets bindet den Produzent an bestimmte Einsatzstoffe. Hier muss geprüft werden, inwiefern Flexibilität bzgl. der Einsatzstoffe möglich ist. Technologie (Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung) Möglichkeiten der Mischungen weitgehend unbekannt Erhöhter technischer Aufwand bei der Pelletproduktion Hoher Feinanteil nach Pressvorgang Erhöhter technischer Aufwand bei Pelletverbrennung An der BTU-Cottbus entschied man sich für das Pelletdesign: 90 % Holz mit 10 % Zumischung aus Schilf, Segge, Gräser und anderen Einsatzstoffen. Die Brennstoffeigenschaften bleiben bei Zumischung recht ähnlich. Mindestens sollte ein Holzanteil von 60 % verbleiben. Je nach Angebot kann der beigemischte Rohstoff variieren, sofern die Brennstoffeigenschaften unverändert bleiben (Guder 2013). Mischung von reinen Holzpellets und Nichtholzpellets sind nicht empfehlenswert, da die Entmischung im Lager stattfindet. Durchmischung von Holz und sonst. Rohstoffen (z.b. Stroh entmischt sich leicht) Gesamte Mischung mit Hammermühle aufarbeiten, um unterschiedliche Ausgangsstoffe in einheitliche Form zu bringen (Guder 2013) Dosieranlage für Additive ist unentbehrlich für Mischpellets, nötig ist auch eine Spezialmatrize (gegebenenfalls vom Hersteller individuell anfertigen lassen). Grund: Feuchte des Ausgangsmaterials ist zu hoch oder zu gering. Dieser kann über Konditionierung eingestellt werden. Lösungsansätze der TU-Cottbus (Guder 2013): - Verschlackung durch das Additiv Kaolin steigt Ascheerweichungstemperatur (Additive nur mit halmgutartiger Biomasse mischen); alternativ sind Schubrostkessel möglich, die unempfindlich ggü. Verschlackung sind - Schwefel und Chlor kondensiert zu Säure Additiv Calciumcarbonat bindet Chlor; ggf. kann Brennkammer mit Edelstahl ausgekleidet werden - Hoher Ascheanteil führt zu größeren Feinstaubemissionen zus. Filtertechnik installieren - Hoher Ascheanteil verschmutzt Brennkammer zweistündliche Druckluftimpuls auf Brenner befreit von Störstoffen, Kesselreinigungsintervall: 4-6 Wochen - Kessel, die mit diesen techn. Maßnahmen ausgestattet sind, sind nicht Brennstoffgebunden und damit sehr variabel bzgl. des Pelletbrennstoffs Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Pelletierfabriken nehmen sich dem Thema Mischpellets nicht an Gründe: der Normierungs- / Zertifizierungsaufwand ist sehr hoch; Kesselhersteller muss Gewährleistung für Brennstoff erteilen, sonst entfällt Garantie Mögl. Lösung: Ein unabhängiges Institut unterstützt bei Zertifizierung und untersucht Unbedenklichkeit des Brennstoffes für Kesselbetrieb Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
24 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Administratives (Fördermittel, Genehmigungen) Keine standardisierten Biomischpellets in Deutschland -> keine definierten Mischungen Jeder Mischpellet muss genormt werden, was eine Herausforderung für Produzenten darstellt, der nicht nur für Eigenbedarf pelletiert. (Norm En & ggf Heizwert, Abrieb, Schüttdichte usw.) Die Zulassung (Zertifikat) des Pellets binden den Produzent an bestimmte Einsatzstoffe. Hier muss geprüft werden, inwiefern Flexibilität bzgl. der Einsatzstoffe möglich ist Handlungsempfehlungen für Kommunikation und Umsetzung Sollen Mischpellets den Markt der Holzpellets ergänzen, ist eine enge Kooperation zwischen Brennstoffproduzenten und Kesselherstellern notwendig. Der Kesselhersteller muss letztlich die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte bei Verwendung der Mischpellets in seinem Kessel bestätigen. Für die dafür nötigen Prüfungen kann eine Zusammenarbeit mit einem Institut mit Zertifizierungserfahrung nützlich sein. Das Netzwerkmanagement von Bioenergie-Regionen kann durch zielgerichtete Aktivitäten maßgeblich dazu beitragen, dass Kooperationen und eine Zusammenarbeit zwischen den regionalen Akteuren zustande kommen. Im Rahmen des europäischen Projekts mixbiopells wurde ein Handbuch für Initiatoren zur Unterstützung der Vorbereitung und Planung von Projekten im Bereich alternativer und gemischter Biomassepellets herausgebracht (siehe hierzu z.b. POLLEX & ZENG, 2012). Dieses enthält Informationen bzw. Empfehlungen zu den Themenfeldern Rohmaterialien, Rechtliche Verhältnisse, Technologien und Wirtschaftlichkeit. Auf der Webseite 17Thttp:// lassen sich das Handbuch und weitere Broschüren (z.b. zur Kostenanalyse) herunterladen. Andreas Pilz (DBFZ) Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
25 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) 4.2 Wegebegleitgrün Begriff und Grundlagen Bei den Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen, Schienen- und Wasserwegen fallen halmgut- und krautartiger Grünschnitt sowie holziger Gehölz- und Baumschnitt an, welche als energetisch nutzbare Rohstoffe dienen können. Halmgutartige und krautartige Biomasse fällt hierbei mehrfach während der Vegetationsphase an, während der Baumschnitt überwiegend in den Wintermonaten durchgeführt wird. Die aufkommenden Mengen variieren dabei stark je nach Breite der Wegränder, der Bestockung sowie der Witterung im Jahresverlauf. Die Verantwortung über die Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum liegt bei Bundesund Landesstraßen sowie Autobahnen beim Land, bei Kreisstraßen beim Landkreis und bei Gemeindestraßen bei der Gemeinde. Die Zuständigkeiten zur Unterhaltung der Pflegeflächen geben die einzelnen Ebenen weiter an Autobahn- & Straßenmeistereien. An Schienenwegen und Wasserstraßen sind wiederum andere Einrichtungen (z.b. Flussmeistereien) zuständig. In Bezug auf Straßen richtet sich die Unterhaltung nach folgenden Zielen (nach FGSV 2004: S. 3): Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere durch Freihalten der Sichtfelder Ingenieurbiologische Sicherung des Straßenkörpers durch Schutz gegen Erosion Schutz der Anlieger vor Emissionen und optischen Beeinträchtigungen Erhaltung landschaftspflegerischer Funktionen durch Erhaltung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere Bestandsicherung der Grünflächen unser-klima-cochem-zell e.v. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
26 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Erfahrungen aus den Regionen Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Planung (konzeptionell, Einbindung in System) Es sind keine Partnerschaften vorhanden, die eine Verwertung von Wegebegleitgrün ermöglichen könnte In der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber wurden mit der Informationskampagne alle notwendigen Akteure für das Vorhaben gewonnen: Straßenmeistereien, Flussmeistereien, Deutsche Bahn, Standortverwaltung militärischer Anlagen, Maschinenringe, Abfallwirtschaftsbetriebe, Forstverwaltungen, Vertreter von Gemeinden und erste Marktteilnehmer (z.b. Stadtwerke). Das Netzwerk Landschaftspflegematerial spielte hier die zentrale Rolle. In der Region Cochem-Zell werden durch die Zusammenarbeit mit dem Forstamt Cochem die Kosten für die Zwischenlagerung, das Hacken der Gehölze und der Transport, mit den von der Straßenmeisterei angelieferten Stammholzmassen verrechnet. Für die Straßenmeisterei fallen so keine Kosten an. Diese Partnerschaft nützt allen Beteiligten. Abbildung 6: Schema der partnerschaftlichen Bezüge bei der Verwertung von Material von Straßenbegleitgehölzen in der Region Cochem-Zell. Eigene Darstellung Das holzige Material wird typischerweise durch die Bevölkerung sowie Lohnunternehmen abgelagert bzw. kompostiert und wird somit nicht energetisch genutzt Fehlender regionaler Markt Besonders wichtig ist eine Informationskampagne bzw. Öffentlichkeitsarbeit, wobei sowohl der Bevölkerung als auch den beteiligten Ämtern und Dienstleistern der Mehrwert im Bereich der Ökonomie und Ökologie aufgezeigt wird. Das Logistik-System sollte so geplant werden, dass die Risiken für involvierte Firmen genau abgeschätzt werden können. Hierfür eignen sich auch Machbarkeitsstudien als planerische Grundlage. Durch gezielte Kooperationen wurden in der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber Verträge zwischen Marktteilnehmern geschlossen, in denen Kosten festgelegt sind: Die Stadtwerke zahlen in diesem Fall an das Entsorgungsunternehmen, welche wiederum für den Rohstoff die Straßenmeisterei bezahlt. Diese Strukturen können Basis für weitere Marktakteure sein und eine weitere Nachfrage induzieren. Die Brennstoffqualität (mit Parametern wie Wassergehalt, Asche, Heizwert, Schwefel, Körnung und Mischungsverhältnisse, etc.) ist vertraglich festgelegt. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
27 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Herausforderungen / Probleme Lösungsansätze, Erfahrungen Anbau, Ernte, Aufbereitung, Verwertung Bergung des Wegebegleitgrüns ist aufwändig. Es wird daher am Entstehungsort nur gemulcht Keine Erfahrung zur Bergung des Materials Keine Erfahrungen zur Gesamtlogistik (Rentabilität der Transportkosten/Sammelsystem/Auslast ung der Maschinen) Grünabfälle von kommunalen Einrichtungen wurden bisher nicht erfasst Einsatz des Holzes nicht für standartisierte gewöhnliche Kessel vorgesehen Für die Bergung von Wegebegleitholz sind keine zusätzlichen Investitionen nötig. Die Technik ist vorhanden: mitgeführter Anhänger/Container und ggf. Hacker. Zusätzlich anzuschaffende Technik betrifft die nachfolgenden Schritte: Separieren Aufbereiten Trocknen. An Straßen hat man sich zur Bergung des Straßenbegleitschnittgutes in der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber für die Einrichtung von wandernden Baustellen entschieden. Die Sicherung der Arbeitsstelle an Straßen erfolgt somit fahrend. Für eine Bergung an Gewässern muss die Befahrbarkeit von Wiesen und Wäldern durch den Eigentümer gestattet werden. In der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber wurden dezentrale als Zwischenlager fungierende - Sammelplätze eingerichtet, wo die Fraktionen direkt bei der Ablage separiert werden (stationäre Verarbeitung). Von dort wird das Material regelmäßig abgeholt und weiterverarbeitet. Die Absicherung der erforderlichen Menge zum Betrieb der Aufbereitungstechnologien erfolgt durch den Verbund von Sammelplätzen in der gesamten Region. Durch die Einführung der Trennung von kommunalen Grünabfällen von anderen Abfällen ist in der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber nun auch eine integrierte energetische Weiterverwertung gemeinsam mit Wegebegleitgrün möglich. Möglich ist z.b. die Verwendung eines Gemisches aus Waldrestholz und Landschaftspflege- bzw. Wegebegleitholz im Verhältnis 1:1. Hierfür liegt im Beispiel der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber die Zusage seitens des Anlagenherstellers des Naturwärmekraftwerks (6 MWRthR) vor, dass diese Rohstoffmischung ohne Bedenken im Kessel eingesetzt werden kann (siehe auch Kapitel 4.1). Überzeugung und Vorurteile (Öffentlichkeitsarbeit, Projektpartner) Probleme bei der Überzeugung der Akteure Erfolgreich verlief die Akteursansprache und Vermittlung aus dem Netzwerk der Bioenergie-Region Cochem-Zell heraus. Durch eine intelligente Nutzung der Maschinen eines Landwirts (Großhacker, Ladehänger) und bestehende Lagerkapazitäten des Forstamtes konnten Neuinvestionen vermieden und die beteiligten Akteure überzeugt werden. In der Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber ist die Einbindung der Schienenwege der Deutschen Bahn bislang nicht gelungen. Die Errichtung eines Naturwärmekraftwerks an einem Kasernenstandort erweist sich ebenso als langwieriger Überzeugungsprozess. Administration (Fördermittel, Genehmigungen) Investitionskosten stellen große Hürde für öffentliche Träger dar Die Investitionskosten können oftmals durch Förderprogramme zumindest teilweise gedeckt werden. In Cochem-Zell wurde die Hackschnitzelheizung am Standort der Straßenmeisterei durch ein Förderprogramm des Bundes für energetische Sanierung gefördert. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
28 4 Ausgewählte Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B) Handlungsempfehlungen für Kommunikation und Umsetzung Arbeitsorganisatorische Hinweise zur Durchführung von Pflegemaßnahmen an Straßen geben die Landesbetriebe Straßenbau (z.b. LBV-SH 2009). Als Grundlage dient das Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst zur Grünpflege (FGSV 2004). Soll das anfallende Mähgut bzw. der Holzschnitt für die energetische Nutzung gewonnen werden, ist es empfehlenswert, Akteure gezielt zusammenzuführen. Dies ist notwendig, um Logistik-Systeme zu planen sowie die Mindestmengen zur kostendeckenden Auslastung der Verarbeitungstechnologie zu gewährleisten. Besonders den derzeitigen Baulastenträgern sollten Vorteile für den täglichen Arbeitsprozess aufgezeigt und dabei der ökonomische und ökologische Mehrwert herausgearbeitet werden. Für die Etablierung von Wegebegleitgrün als alternativer Bioenergierohstoff ist es entscheidend, die Risiken für die Akteure abschätzbar zu machen und eine Qualitätssicherung der Produkte anzustreben. Wichtig ist darüber hinaus, die Bevölkerung in dem Prozess zu informieren und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. Somit kann man etwaige Bedenken vorzubeugen, dass die bei der Biomasseentnahme Naturschutzanliegen vernachlässigt werden. Paul Trainer (DBFZ) Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
29 Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen nur diejenigen Typen alternativer Rohstoffe ein, für die einerseits sowohl Daten zum technischen Biomassepotenzial vorliegen, und denen andererseits Maßnahmen in den regionalen Entwicklungskonzepten eindeutig zuzuordnen waren (siehe Tabelle 3). Als Datengrundlage für den Vergleich dienen somit zum einen die Ergebnisse der Begleitforschung zu technischen BiomassepotenzialenP10F11P. Zum anderen stammen die Daten aus den Regionalen Entwicklungskonzepten. Deren Maßnahmen sind in der Projektdatenbank zum Vorhaben Bioenergie-Regionen (online)p1f12p gelistet. 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial 5.1 Ziel des Vergleichs und methodische Vorgehensweise Die vorangegangenen Kapitel beziehen sich auf ausgewählte Erfahrungen mit alternativen Biomassen in den Bioenergie-Regionen. In Ergänzung zu den bisherigen Ausführungen zum Forschungsstand und zu konkreten Handlungsempfehlungen schließt nun eine Gegenüberstellung von Maßnahmen zur Etablierung alternativer Biomassen mit den für diese Biomassen ausgewiesenen technischen Biomassepotenzialen an. Auch hierfür steht die Gebietskulisse der Bioenergie-Regionen im Fokus. Der Vergleich soll zeigen, wie die technischen Biomassepotenziale bislang ungenutzter Reststoffe in den Regionen verteilt sind und wie umfangreich zu diesen Biomassen Maßnahmen in den regionalen Entwicklungskonzepten (REK) vorgesehen sind. Tabelle 3 zeigt die Zusammensetzung thematisierter Biomassen, sowie deren Datenverfügbarkeit in den jeweiligen Datenquellen. Zur Einordnung der Ergebnisse sind ebenfalls die technischen Biomassepotenziale und Maßnahmen im Bereich forstwirtschaftliche Biomasse dargestellt. Weitere Typen alternativer Rohstoffe, die in diesem Kapitel nicht gesondert dargestellt sind, kann man Tabelle 2 in Kapitel 1 entnehmen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Projektdatenbank zum Vorhaben Bioenergie-Regionen nur die Schwerpunktthemen enthält, mit denen sich die Regionen im Rahmen des regionalen Entwicklungskonzepts für die Förderung qualifiziert haben. Dabei bleiben unter Umständen weitere Maßnahmen unbetrachtet, die außerhalb des Tätigkeitsfeldes der Regionalmanager in Bioenergie-Regionen stattfinden. Die Ergebnisse lassen demzufolge Schlussfolgerungen hinsichtlich der Thematisierung bislang ungenutzter Reststoffe insbesondere durch das Regionalmanagement zu. Dabei erfolgt eine rein quantitative Gegenüberstellung, welche den qualitativen Aspekt der konkreten Maßnahmen nicht berücksichtigt. Ergänzend ist für ein detaillierteres Bild zur Nutzung und Etablierungsabsichten alternativer Biomassen in den einzelnen Regionen die Übersicht im Anhang A 2 heranzuziehen. 11 Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technische Biomassepotenziale 12 Stand Datenbank vom Projekte der Bioenergie-Regionen online unter Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
30 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Im folgenden Kapitel 4.2 sind zunächst die zur Verfügung stehenden Daten dargestellt, um in Kapitel 4.3 den eigentlichen Vergleich anzuschließen. Tabelle 3: Die Datenverfügbarkeit für einen quantitativen Vergleich zwischen technischen Biomassepotenzialen und den jeweiligen Maßnahmenanzahlen ausgewählter Bioenergierohstoffe in Bioenergie-Regionen. Bioenergierohstoffe Berücksichtigt bei Ermittlung der BiomassepotenzialeP11 Berücksichtigt in Projektdatenbank zum VorhabenP12 Stroh Bioabfall / Speiseabfälle Landschaftspflegematerial u. Wegebegleitgrün Straßenbegleitgrün Naturschutzflächen o Heide/ Moor o Extensives Grünland Grünabfälle aus: Gärten Kommunalen Liegenschaften Obstbau/ Weinbau Kurzumtriebsplantagen (KUP) Forstwirtschaftliche Biomasse 5.2 Potenzialhöhe und Maßnahmenanzahl alternativer Biomassen in Bioenergie-Regionen Für technische Biomassepotenziale in Bioenergie-Regionen liegen sowohl Mengenangaben (in Tonnen) als auch der Energieinhalt des potenziellen Rohstoffaufkommens vor. Zur besseren Veranschaulichung sind diese Rohstoffmengen bereits in Anzahl der mit Strom/Wärme versorgbaren Haushalte umgerechnet. Dieser Umrechnung liegen einheitliche Annahmen eines technologieabhängigen Wirkungsgrades sowie des Strom-/Wärmebedarfs eines Haushalts zu Grunde.P12F13P Diese pauschalen Annahmen führen zwar zu Unschärfen, erlauben jedoch eine anschauliche Diskussion der Daten in diesem theoretischen Kontext. 13 Weitere Hintergründe und die Vorgehensweise zur Potenzialermittlung finden sich in (BROSOWSKI & ADLER, 2014). Online unter Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
31 Anzahl Haushalte 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Die ermittelte Anzahl der potenziell versorgbaren Haushalte dient demzufolge in der vorliegenden Arbeit dazu, die Potenzialdaten veranschaulichend darzustellen. Abbildung 7 gibt hierzu einen Überblick für die einzelnen Regionen. Hinterlegt ist ebenso die Gesamtzahl an Haushalten der Regionen Gesamtzahl Haushalte Potenzielle Deckung des Strombedarfs durch: Forstwirtsch. Biomassepotenzial Biomassepotenzial Stroh Biomassepotenzial Grünabfall Biomassepotenzial Landschaftspflegematerial Biomassepotenzial Bioabfall / Speiseabfälle Abbildung 7: Potenzielle Deckung des Bedarfs regionaler Haushalte mit Strom aus Reststoffen und forstwirtschaftlicher Biomasse. Datengrundlage: Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie- Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Annahmen: Strombedarf pro Haushalt: 2500 kwh/jahr, elektrischer Wirkungsgrad: 37 % Geht man modellhaft davon aus, dass die technischen Potenziale der untersuchten alternativen Rohstoffe umfassend genutzt würden (also ohne forstwirtschaftliche Biomasse), so überschreitet das potenzielle Stromangebot den Strombedarf der Privathaushalte in nur einer Region (Rügen). Dies geht nahezu vollständig auf die Nutzung von Stroh zurück. Die übrigen Potenziale alternativer Rohstoffe bieten nur einen marginalen Anteil zur Deckung des regionalen Strombedarfs. Im Vergleich dazu könnte allein die Nutzung des berechneten Potenzials forstwirtschaftlicher Biomasse unter den getroffenen Annahmen in 12 Regionen den kompletten Haushaltsstrombedarf decken. Dies unterstreicht, dass die technischen Potenziale alternativer Biomassen (hier am Beispiel Bioabfall/Speiseabfall, Landschaftspflegematerial (LPM) und Grünabfall) grundsätzlich nur einen sehr geringen Anteil am Gesamtenergiebedarf einer Region decken könnten. Auffällig sind auch die regionalen Unterschiede innerhalb der einzelnen Rohstoffkategorien. Diese sind maßgeblich auf Ausgangsbedingungen der Regionen, wie Regionsgröße, Struktur und Landbewirtschaftung zurückzuführen. Die folgende Tabelle 4 zeigt für die 21 Bioenergie-Regionen, wie viele Haushalte im Durchschnitt durch eine energetische Nutzung der fünf untersuchten Rohstoffe mit Strom versorgt werden könnten. Die genannten Ausgangsbedingungen schlagen sich entsprechend in der Stan- Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
32 Maßnahmen im REK (Doppelnennung möglich) 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial dardabweichung der Potenziale nieder. Die einzelnen Werte für alle Regionen sind Anhang A 1 zu entnehmen. Tabelle 4: Anzahl der potenziell mit Strom versorgbaren Haushalte aus ausgewählten Biomassen in den 21 Bioenergie- Regionen. Datengrundlage: Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie- Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt: 2500 kwh, elektrischer Wirkungsgrad Bioenergieanlage: 37 % Bioabfall / Speiseabfälle Anzahl der potenziell mit Strom versorgbaren Haushalte (HH) Landschaftspflegematerial, Wegebegleitgrün Halmgut Holz Halmgut Holz Grünabfall Stroh Forstwirtschaftliche Biomasse Durchschnitt Minimum Maximum Standardabweichung Die Maßnahmen zu alternativen Biomassen innerhalb der Bioenergie-Regionen sind in der folgenden Abbildung 8 enthalten. Hierbei sind für jede Region die Maßnahmen aus den regionalen Entwicklungskonzepten berücksichtigt, die sich den betrachteten Rohstoffkategorien zuordnen lassen(siehe auch Anhang A 2). Einige Maßnahmen sprechen dabei mehrere Biomassen an und sind somit doppelt aufgenommen Forstwirtschaftliche Biomasse Stroh Grünabfall Landschaftspflegematerial Bioabfall/Speiseabfälle Abbildung 8: Maßnahmen zu alternativen Biomassen in den Bioenergie-Regionen. Maßnahmen zu forstwirtschaftlicher Biomasse sind als Vergleichswert mit aufgeführt. * - Keine Zuordnung der REK-Maßnahmen zu den betrachteten Rohstoffen möglich Datengrundlage: Regionale Entwicklungskonzepte (REK) der Bioenergie-Regionen zur Förderphase (Projektdatenbank Bioenergie-Regionen, online) Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
33 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial In den Regionen Mecklenburgische Seenplatte, Südoldenburg und Wendland-Elbetal geht aus den Maßnahmen im REK nicht hervor, ob sie die Rohstoffproduktion der betrachteten Biomassen thematisieren. Manche Regionen thematisieren das gesamte betrachtete Biomassenspektrum, während andere nur einzelne Biomassen berücksichtigen, um gezielt alternative Roh- und Reststoffe zu etablieren. Wie eingangs erläutert, ist aus der Abbildung nicht ersichtlich, welchen qualitativen Umfang diese Maßnahmen ausmachen und inwiefern gegebenenfalls weitere Initiativen zur Etablierung dieser Rohstoffe bestehen, die im REK nicht aufgeführt sind. Stattdessen zeigen sie den Handlungsschwerpunkt der Regionalmanagements auf. 5.3 Gegenüberstellung biomassebezogener Aktivitäten mit regionalen Potenzialen Die nachfolgenden Abschnitte stellen für jeden untersuchten Rohstoff einerseits die potenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfs und andererseits die regional erfassten Maßnahmen gegenüber. Dabei ist zunächst angegeben, wie viele der gemeldeten Haushalte einer Region anteilig durch den jeweiligen Rohstoff potenziell mit Strom versorgt werden könnten. Dem steht schließlich rohstoffspezifisch die Maßnahmenzahl der einzelnen Bioenergie-Regionen gegenüber. Für eine qualitative Einschätzung der Maßnahmen zur Nutzung und zu Etablierungsabsichten alternativer Biomassen ist ergänzend die Übersicht im Anhang A 2 heranzuziehen Technische Potenziale und Maßnahmen zu Bioabfall/ Speiseabfall Die technischen Potenziale einer Stromversorgung aus den gesammelten Bio- und Speiseabfällen sind in Abbildung 9 dargestellt. Berücksichtigt sind in dieser Kategorie Bioabfälle privater Haushalte (Braune Tonne) sowie gewerbliche Speiseabfälle. Die Bioabfallfraktion im Restmüll geht in diese Berechnung nicht mit ein. In allen Bioenergie-Regionen könnten nur deutlich unter 5 % der regionalen Haushalte mit Strom aus Bioabfall/Speiseabfall versorgt werden. Im Mittel entspricht das Potenzial einem Stromverbrauch von etwa Haushalten (siehe auch Tabelle 4). Die regionalen Aktivitäten zur energetischen Nutzung von Bio- und Speiseabfällen durch Maßnahmen im REK beschränken sich auf vier Regionen. Sowohl die Region Oberland, Bayreuth, Jena-Saale und Achental wollen mit jeweils einer Maßnahme im REK diesen Reststoff energetisch nutzen. Hinzu kommt die Region Oberberg RheinErft, wo Bioabfälle vergoren werden, das Regionalmanagement hierzu jedoch keine Angabe gemacht hat. Generell ist bei dieser Kategorie kein Zusammenhang zwischen Potenzialhöhe und dem Vorhandensein einer Maßnahme festzustellen. Es zeigt sich ebenfalls, dass die Bioenergie-Regionen, die das vergleichsweise größte Potenzial aufweisen, keine Maßnahmen ge- DBFZ Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
34 Anteilige Deckung Maßnahmenzahl 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial plant haben, beziehungsweise durchführen. Im Gegensatz dazu ist mit einer Maßnahme im Achental sogar eine Region aktiv, die mit ihrem Potenzial nur einen sehr geringen Teil des Haushaltsstrombedarfs decken könnte. 5% 4 3 Bioabfall / Speiseabfall 0% Pot. Deckung HH- Strombedarf [%] Maßnahmenzahl Abbildung 9: Gegenüberstellung der Potenziale und Maßnahmen in den Bioenergie-Regionen für den Rohstoff Bioabfall / Speiseabfall. Balken grün: Rohstoff bereits genutzt (2013), Balken dunkelgrau: Nutzung geplant (2013). * - Keine rohstoffspezifische Zuordnung der REK-Maßnahmen möglich. Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online); Regionale Zwischenberichte (2013); Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt (HH): 2500 kwh, elektr. Wirkungsgrad: 37 % Trotz der niedrigen Maßnahmenzahl in den REK werden private Bioabfälle als Rohstoff für Bioenergie bereits in 13 von den 21 Bioenergie-Regionen thematisiert (siehe hierzu auch Abbildung 5 in Kapitel 3). Laut der regionalen Zwischenberichte werden in vier Regionen private Bioabfälle bereits genutzt (Grüne Balken in Abbildung 9). In weiteren neun Regionen ist die Nutzung dieser Rohstoffe geplant (Dunkelgrauer Balken). Mit Ludwigsfelde, Cochem-Zell und Natürlich Rügen wollen auch Regionen Bioabfälle energetisch nutzen, obwohl nur ein sehr niedriges Potenzial ausgewiesen ist (jeweils unter 500 Haushalte). Ob das regionale Entwicklungskonzept Maßnahmen zur energetischen Nutzung von Bio- und Speiseabfällen beinhaltet, hängt somit nicht von der berechneten Potenzialhöhe ab. Die energetische Nutzung von Bioabfällen ist sehr aufwändig zu etablieren. Hier gilt es, Anlagen mit hohen Anforderungen bzw. Auflagen zu konzipieren und mit planbaren Mindestmengen zu versorgen. Ein umfangreicher gesetzlicher Rahmen sowie die u.u. langfristige vertragliche Bindung von Dritten könnten hier dazu führen, dass das Regionalmanagement zu diesem Rohstoff verhältnismäßig wenige eigene Maßnahmen vorsieht. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
35 Anteilige Deckung Maßnahmenzahl 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Technische Potenziale und Maßnahmen zu Landschaftspflegematerial (LPM) und Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial definiert sich nicht über seine Materialeigenschaften, sondern anhand der Bewirtschaftungsweise. LPM umfasst somit alle Materialien, die bei Maßnahmen anfallen, die vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes dienen und nicht gezielt angebaut wurden. (Anlage III / BiomasseV 2012). In dieser Kategorie konnten die technischen Biomassepotenziale von Heide- und Moorflächen berücksichtigt werden. Biomassepotenziale sonstiger naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen liegen der technischökonomischen Begleitforschung für Bioenergie-Regionen nicht vor. Zusätzlich wird hier Straßenbegleitgrün (jeweils Holz und Halmgut) mit berücksichtigt (siehe Tabelle 3 in Kapitel 4.1). Für die nachfolgende Betrachtung sind die Potenziale für holz- und halmgutartiges Material addiert betrachtet. Damit lässt sich ein Vergleich mit den Angaben aus weiteren Datenquellen (Projektdatenbank, Zwischenberichte) anstellen, die ihrerseits nicht nochmals nach Materialtyp untergliedern. Das energetische Potenzial ist bei beiden Fraktionen annähernd gleich groß (siehe hierzu Tabelle 4). Abbildung 10 zeigt, wie viel Prozent der regionalen Haushalte mit Strom aus Landschaftspflegematerial und Wegebegleitgrün versorgt werden könnten. Geht man davon aus, dass das ermittelte technische Potenzial komplett für Bioenergie genutzt würde, könnte dies bis zu 4 % des regionalen Bedarfs decken (Region Achental mit ca. 700 Haushalten). Die durchschnittliche Anzahl der potenziell mit Strom versorgbaren Haushalte liegt bei etwa Haushalten pro Regionen (siehe auch Tabelle 4). Bei über der Hälfte der Regionen liegt der Anteil wegen der höheren Bevölkerungszahl jedoch unter 1 %. Somit ist die potenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfes aus Landschaftspflegematerial insgesamt sehr gering. 5,0% 0,0% Landschaftspflegematerial Pot. Deckung HH- Strombedarf [%] Maßnahmenzahl Abbildung 10: Gegenüberstellung der Potenziale und Maßnahmen in den Bioenergie-Regionen für den Rohstoff Landschaftspflegematerial und Wegebegleitgrün. Balken grün: Rohstoff bereits genutzt (2013), Balken dunkelgrau: Nutzung geplant (2013) * - Keine rohstoffspezifische Zuordnung der REK-Maßnahmen möglich. Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online); Regionale Zwischenberichte (2013); Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt (HH): 2500 kwh, elektr. Wirkungsgrad: 37 % Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
36 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Die Bioenergie-Regionen haben in ihren regionalen Entwicklungskonzepten vergleichsweise zahlreiche Maßnahmen zur Nutzung des Landschaftspflegematerials und Wegebegleitgrüns vorgesehen. Fast jede Region hat hier mindestens eine Maßnahme zur Gewinnung von Bioenergie aus diesen Quellen gelistet. Die Auswertung der regionalen Zwischenberichte von 2013 ergibt, dass der Rohstoff Landschaftspflegematerial in 18 von 21 Regionen thematisiert wird. Bereits in 7 Regionen kommt der Rohstoff Landschaftspflegematerial schon zum Einsatz (Grüne Balken in Abbildung 10). Darunter sind auch Höxter, Straubing-Bogen und Oberberg RheinErft, die damit jedoch nur einen marginalen Anteil ihres Haushaltsstrombedarfs decken können. Nur für die Regionen Achental, Südoldenburg und die naturkraft- Region wurde im Zwischenbericht 2013 LPM nicht regional thematisiert. Trotz des relativ niedrigen Potenzials erfährt dieser Rohstoff somit eine vergleichsweise sehr große Aufmerksamkeit. Vergleicht man die potenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfs aus LPM und Wegebegleitgrün mit der Maßnahmenzahl, so ergeben sich keine eindeutigen Zusammenhänge. Allein die Altmark hat gleichzeitig eine relativ hohe potenzielle Deckung und zwei Maßnahmen im REK. Weitere Regionen mit zwei bis vier Maßnahmen weisen lediglich eine potenzielle Deckung unter 1 % auf. Eine Verbindung zwischen Potenzialhöhe und Maßnahmenzahl lässt sich letztendlich nicht feststellen. Auffällig ist, dass fast alle Regionen Landschaftspflegematerial energetisch nutzen bzw. nutzen möchten und auch Maßnahmen hierzu formuliert haben. Ob damit ein bestimmter Energiebedarf gedeckt werden könnte, spielt anscheinend für die Regionalmanager keine entscheidende Rolle. In Kapitel 3.2 werden bei diesem Reststoff überwiegend organisatorische Hemmnisse gesehen. Da die Regionalmanagements insbesondere Stärken bei der Vernetzung und Organisation besitzen, könnte hier ein Grund für verstärktes Engagement liegen. Des Weiteren bestehen um die Nutzung von Landschaftspflegematerial vergleichsweise geringe Nutzungskonkurrenzen und die technischen Voraussetzungen für die Gewinnung und Verwertung sind insbesondere Uwe Steinbrich / pixelio.de bei Holz aus der Landschaftspflege oftmals in den Regionen bereits vorhanden Technische Potenziale und Maßnahmen zu Grünabfall Ein weiterer alternativer Rohstoff stellt Grünschnitt / Grünabfall dar. Bei der Berechnung technischer Biomassepotenziale flossen sowohl Grünabfälle privater Haushalte und kommunaler Liegenschaften aus der Abfallsammlung als auch Grünabfälle aus Obst- und Weinbau ein (siehe auch Tabelle 3 in Kapitel 4.1). Hier ist erneut für die weitere Betrachtung das halmgutartige und holzartige Material zusammengefasst. Wie Abbildung 11 zeigt, fällt in den einzelnen Bioenergie-Regionen die potenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfs mit Energie aus Grünabfall sehr unterschiedlich aus. Im Gegensatz zu Bioabfällen Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
37 Potenzielle Deckung HH-Strombedarf Maßnahmenzahl 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial und Landschaftspflegematerial, ließe sich bei einer theoretischen vollständigen Nutzung in einigen Regionen mehr als 5 % des Haushaltsstrombedarfs decken. Bei der Hälfte der Regionen beträgt die potenzielle Deckung jedoch weniger als 2 %. Im Durchschnitt könnten pro Region mit diesem Reststoff ca der regionalen Haushalte mit Strom versorgt werden (siehe hierzu Tabelle 4). Spitzenreiter sind hier die Regionen Bodensee (8 % mit ca HH) und Hohenlohe-Odenwald-Tauber mit 6,5 % und HH. 10,0% 5,0% 0,0% Grünabfall Pot. Deckung HH- Strombedarf [%] Maßnahmenzahl Abbildung 11: Gegenüberstellung der Potenziale und Maßnahmen in den Bioenergie-Regionen für den Rohstoff Grünabfall. * - Keine rohstoffspezifische Zuordnung der REK-Maßnahmen möglich. Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online); Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt (HH): 2500 kwh, elektrischer Wirkungsgrad: 37 %. Insgesamt sind sieben Regionen mit Maßnahmen im REK zur energetischen Nutzung von Grünabfall aktiv. In den regionalen Zwischenberichten von 2013 wurde diese Rohstoffkategorie nicht gesondert ausgewiesen, sodass hier kein Abgleich mit den Angaben der Regionalmanager während der Förderlaufzeit erfolgt. Von den Regionen, die um 5 % ihrer Haushalte mit Strom aus Grünabfall decken könnten, hat nur Cochem-Zell Maßnahmen im REK vorgesehen. Die übrigen ein bis zwei Maßnahmen pro Region verteilen sich auf Regionen mit einem wesentlich niedrigerem potenziellen Anteil. Die Tatsache, dass mit Grünabfall durchaus ein nennenswerter Anteil des regionalen Energiebedarfs gedeckt werden könnte, spielt anscheinend keine Rolle bei der Formulierung der Maßnahmen. So haben die Regionen Bodensee und Ho- DBFZ Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
38 Anteilige Deckung Maßnahmenzahl 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial henlohe-odenwald-tauber sowie Straubing-Bogen keine Maßnahmen im REK, die sich explizit diesem Rohstoff zuwenden. Demgegenüber haben Ludwigsfelde, Märkisch-Oderland und Jena-Saale sogar zwei Maßnahmen im REK, könnten mit dem technischen Potenzial jedoch nur einen verschwindend geringen Anteil des Haushaltsstrombedarfs decken Technische Potenziale und Maßnahmen zu Stroh Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass durch die Energiebereitstellung aus Stroh im Gegensatz zu den bisher betrachteten Rohstoffen - in vielen Regionen ein maßgeblicher Anteil des Haushaltsstrombedarfs gedeckt werden könnte. Nur in sechs Regionen liegt dieses Potenzial bei unter 25 % (siehe Abbildung 12). Für die Regionen Achental, Oberland, Wendland-Elbetal, Oberberg-RheinErft und Ludwigsfelde liegen keine ausreichenden Daten zum Strohpotenzial vor. 100% 4 75% 50% 25% 0% Stroh Pot. Deckung HH- Strombedarf [%] Maßnahmenzahl Abbildung 12: Gegenüberstellung der Potenziale und Maßnahmen in den Bioenergie-Regionen für den Rohstoff Stroh. Balken grün: Rohstoff bereits genutzt (2013), Balken dunkelgrau: Nutzung geplant (2013) * - Keine rohstoffspezifische Zuordnung der REK-Maßnahmen möglich. ** - Keine Daten zum Strohpotenzial verfügbar Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online); Regionale Zwischenberichte (2013); Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt (HH): 2500 kwh, elektr. Wirkungsgrad: 37 % Laut den regionalen Zwischenberichten von 2013 thematisieren sieben Regionen die Verbrennung und eine Region die Fermentation von Stroh (siehe hierzu auch Abbildung 5 in Kapitel 3). Bislang wird Stroh erst in zwei Regionen tatsächlich energetisch genutzt (siehe grüne Balken in Abbildung 12). Mit dunkelgrauen Balken ist in Abbildung 12 dargestellt, in welchen Regionen zukünftig Stroh thermochemisch genutzt werden soll. Darüber hinaus plant die Region Ludwigsfelde auch den Einsatz von Stroh in Biogasanlagen. Die regionalen Entwicklungskonzepte enthalten bei sechs Bioenergie-Regionen konkrete Maßnahmen zur energetisch Nutzung von Stroh. Die beiden Regionen mit der höchsten potenziellen Deckung des Haushaltstrombedarfs (Rügen, Höxter) führen je eine Maßnahme im REK. Diese und zwei weitere Regi- Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
39 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial onen könnten über 75 % ihres Haushaltsstrombedarfs potenziell über Stroh decken. Von weiteren sechs Regionen, die mindestens 25 % decken könnten, weisen nur zwei Regionen Maßnahmen hierzu auf. Bei den übrigen Regionen fehlt dieses Thema trotz des vergleichsweise hohen Potenzials in den REK. Ein Grund könnte in der Tatsache liegen, dass es bereits einen funktionierenden Markt für das berechnete Potenzial an Stroh gibt. Die hier aufgezeigten Potenziale berücksichtigen zwar die Nutzung als Einstreu in Ställen und den Rückhalt zur Bodenverbesserung als bestehende Nutzung, nicht aber die tatsächliche Nutzung im Geschäftsfeld der Landwirte. Paul Trainer (DBFZ) Kurzumtriebsplantagen (KUP) Der Anbau von Kurzumtriebsplantagen zur Produktion von Energieholz wird laut Angaben der Regionalmanager in den Zwischenberichten von 2013 in nahezu jeder Region thematisiert (nicht in: Bayreuth, Rügen, Südoldenburg, Weserbergland). In immerhin zehn Regionen werden KUP-Hackschnitzel bereits produziert bzw. genutzt und sollen in weiteren zehn Regionen etabliert werden (siehe hierzu Abbildung 4 in Kapitel 2). Seitens der Potenzialberechnung lässt sich keine konkrete Zahl potenziell mit Strom versorgbarer Haushalte durch KUP-Hackschnitzel ausweisen. Dies liegt daran, dass KUP als landwirtschaftliche Kultur prinzipiell auf jedem Ackerschlag angebaut werden könnte und somit die Flächenbilanz der Landwirtschaft das Potenzial bestimmt. Eine Analyse wäre hier nur unter Verwendung der Szenariotechnik möglich. Aufgrund der festgestellten Themenkonjunktur von KUP soll dennoch kurz auf das Thema KUP eingegangen werden. In der Projektdatenbank sind 10 Maßnahmen aus 8 Regionen gelistet, die sich konkret um die Etablierung von KUP bemühen (siehe Tabelle 5). Insgesamt liegt das Engagement somit höher als bei Stroh, Bioabfall und Grünabfall. Martin Dotzauer (DBFZ) Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
40 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Tabelle 5: Maßnahmen zum Thema Kurzumtriebsplantagen in Bioenergie-Regionen. Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online), Stand: August 2014 Bioenergie-Region Nordfriesland Nord Jena-Saale-Holzland Höxter Höxter Mecklenburgische Seenplatte Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Achental Cochem-Zell naturkraft-region Maßnahme Fachveranstaltung für Anlagenbetreiber und Landwirte zum Thema KUP Unterstützung und Förderung des Anbaus von Kurzumtriebsplantagen KUP auf Deponiekörper Weiterentwicklung bestehender KUP-Standorte auf 10 Jahre Umtriebsdauer Machbarkeitsstudie zum Anbau von Kurzumtriebsplantagen Etablierung neuer KUP-Flächen Energieholzproduktion auf Leitungstrassen Erweiterung des Anbaus von Kurzumtriebsplantagen Kurzumtriebsplantage in Masburg Feldtag zur Nutzung von Kurzumtriebsholz Die aufgelisteten Maßnahmen beziehen die jeweiligen Vorkenntnisse bzw. bisherige Projekte in den Regionen ein. So betreffen einige Maßnahmen zunächst den Aufbau von Wissen und den Versuch, erste Kurzumtriebsplantagen zu verwirklichen. Einige Regionen können sich hingegen schon der Ausdehnung bestehender KUP-Flächen zuwenden. Damit versuchen die Regionen aus vorwiegend ökologischen Gründen diesen alternativen Bioenergierohstoff (weiter) zu etablieren Forstwirtschaftliche Biomasse Forstwirtschaftliche Biomasse stellt keine alternative Biomasse im bislang beschriebenen Sinne dar. Sie soll dennoch nachfolgend berücksichtigt werden, um die Ergebnisse zu den betrachteten alternativen Biomassen im Kontext einzuordnen. Wie bereits Tabelle 4 in Kapitel 4.2 erahnen lässt, ist das Potenzial zur Deckung des Strombedarfs mit forstwirtschaftlicher Biomasse in allen Regionen am höchsten. Aus dieser Tabelle geht hervor, dass im Durchschnitt pro Region etwa Haushalte mit Strom versorgt werden könnten, sofern man von einer vollständigen Nutzung des Potenzials ausgeht. Für 12 Regionen ließen sich aus forstwirtschaftlicher Biomasse 100 % der Haushalte allein auf Basis dieses Potenzials mit Strom versorgen (siehe Abbildung 13). In einigen dieser Regionen übersteigt dies den Haushaltsstrombedarf sogar um das Doppelte: Wendland-Elbetal, Altmark, Oberland, Achental und Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
41 Potenzielle Deckung HH-Strombedarf Maßnahmenzahl 5 Alternative Rohstoffe: Regionale Maßnahmen im Vergleich zum Biomassepotenzial Cochem-Zell. Selbst die niedrigste potenzielle Deckung von 25 % fällt im Vergleich zu den bislang betrachteten Biomassen beachtlich aus.p 13F14 Von den 21 Bioenergie-Regionen führen 13 Regionen Maßnahmen zur energetischen Nutzung von forstwirtschaftlicher Biomasse durch. Hier reicht die Spanne von ein bis maximal sechs, bewegt sich aber im Mittel um ein bis drei Maßnahmen je Region. Besonders sticht die Region Märkisch-Oderland hervor, die ihre ca Haushalte komplett versorgen könnte. Das regionale Entwicklungskonzept ist mit sechs Maßnahmen in dieser Region hauptsächlich auf Holz ausgerichtet. 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Forstwirtsch. Biomasse Pot. Deckung HH- Strombedarf [%] Maßnahmenzahl Abbildung 13: Gegenüberstellung der Potenziale und Maßnahmen in den Bioenergie-Regionen für den Rohstoff Forstwirtschaftliche Biomasse. * - Keine rohstoffspezifische Zuordnung der REK-Maßnahmen möglich. Datengrundlage: Projektdatenbank Bioenergie-Regionen (online); Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Technisches Brennstoffpotenzial. Stromverbrauch pro Haushalt: 2500 kwh, elektrischer Wirkungsgrad: 37 %. Insgesamt lassen die Regionalmanagements der forstwirtschaftlichen Biomasse eine hohe Aufmerksamkeit zukommen. Dennoch enthalten die REK in einigen Regionen hierzu keine Maßnahmen, obwohl die Potenziale eine umfangreiche Deckung des Energiebedarfs erlauben würden. Hier könnte die Ursache darin liegen, dass in den Regionen bereits umfangreiche Initiativen zur Nutzung von Waldrestholz bestehen, sodass manche Regionalmanagements hierzu keine neuen Projekte in ihren REK planten. 14 Die bei der Berechnung dieser Potenziale bereits berücksichtigten Restriktionen, wie der stofflich genutzte forstwirtschaftliche Einschlag und der Totholzverbleib, können im Detail Brosowski und Adler (2014) entnommen werden. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
42 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Insgesamt sind die Bioenergie-Regionen im Bereich ungenutzter / innovativer Bioenergierohstoffe stark engagiert. Zahlreiche Rohstoffe sind bereits in energetische Nutzungen integriert. Eine (verstärkte) Nutzung wurde darüber hinaus für zahlreiche Rohstoffe in der Fördermaßnahme von geplant. Hierbei sollen sowohl Rohstoffe mit ökologischen Vorteilen etabliert, als auch ungenutzte Ressourcen erschlossen werden (siehe hierzu Abbildung 4 in Kapitel 2 und Abbildung 5 in Kapitel 3). Damit verbunden ist ein wachsender Erfahrungsschatz innerhalb der regionalen Initiativen. Der vorliegende Bericht fasst hierzu wesentliche Punkte zusammen und bietet Möglichkeiten zum gezielten Wissensaustausch und zur Zusammenarbeit. Probleme und Lösungsansätze bei der Etablierung alternativer Bioenergie-Rohstoffe Die beiden Kapitel 2 und 3 widmen sich Herausforderungen, die in Bioenergie-Regionen bei der energetischen Nutzung von innovativen / alternativen biogenen Rohstoffen auftraten. Die entsprechenden Erfahrungen und Lösungsansätze lassen sich in vier Bereiche untergliedern: die konzeptionelle Planung; die praktische Umsetzung vom Anbau bis zur energetischen Verwertung die Öffentlichkeitsarbeit sowie Administratives zu Fördermitteln, Genehmigungen und weiteren rechtlichen Belangen. Hierbei kristallisieren sich sowohl einige Probleme als auch Lösungsansätze heraus, die auf mehrere oder alle alternative Bioenergierohstoffe zutreffen: Probleme bei der Etablierung alternativer Bioenergie-Rohstoffe Fehlende Erfahrungen oder fehlende Technologien führen auf der Umsetzungsebene zu geringem Anreiz bis hin zu Vorbehalten gegenüber neuen Kulturen und Methoden Änderungen von Routinen bzw. Gewohnheiten bei der Rohstoffbereitstellung sind nicht einfach herbei zu führen und benötigen Zeit Wirtschaftlichkeit ist nicht durchweg belegt, Erträge und Umsätze sind schwer planbar bis unbekannt Öffentlichkeitsarbeit ist nicht durch Landwirt bzw. engagierten Akteur leistbar Fehlende (regionale) Strukturen wie Partnerschaften, Netzwerke, Angebot & Nachfrage Rechtliche Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten, geltende Vorschriften sind unbekannt, Große Investitionen z.b. für Zertifizierungsprozess oder Aufbereitungstechnik, erfordern Fremdkapital, was u.u. eine Hürde darstellt Lösungsansätze für eine Etablierung alternativer Bioenergie-Rohstoffe Information & Dialog: Interessengruppen einbeziehen, transparent kommunizieren und ggf. einen runden Tisch einberufen schafft öffentliche Akzeptanz und streut Erfahrungen Vorbildwirkung geht von positiven Versuchen oder Pilotvorhaben aus und ermutigt dazu, diese nachzuahmen Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
43 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Beratungsleistungen können durch Wissensträger, Regionalmanagement und organisiertem KnowHow-Transfer zielgerichtet vermittelt werden Öffentlichkeitsarbeit kann von Regionalmanagement, Genossenschaft, Verein oder Verband übernommen werden Neben den hier aufgezählten Punkten sind Akteure häufig zusätzlich mit individuellen Herausforderungen konfrontiert, deren Lösung besonderes Engagement erfordern kann. Allerdings zeichnen sich bei einigen Rohstoffen Fortschritte bei ihrer Etablierung ab, indem sich praktikable Ansätze immer weiter verbreiten und ein Durchbruch aus der Nische zu erwarten ist. Dazu zählen: Durchwachsene Silphie da Bauern kontinuierlich weitere Flächen anlegen, die Erträge nah an Mais heranreichen und parallel dazu intensive Forschungstätigkeiten stattfinden Wegebegleitgrün & Grünabfall weil das Sammeln mit weiteren Stoffströmen kombiniert werden kann und vergleichsweise geringen (finanziellen) Aufwand verursacht. Kurzumtriebsplantagen da Techniken inzwischen erprobt sind und Züchtungen fortschreiten, sodass sich profitable Konzepte ausbreiten. Problematisch erscheinen weiterhin Mischbrennstoffe, da hier den Akteuren durch die rechtlichen Rahmenbedingungen ein großer Aufwand abverlangt wird. Auch die Anlagentechnik und deren Zulassung gestalten sich im Vergleich zu Normbrennstoffen wesentlich aufwendiger. Insbesondere die Vorgaben der Immissionsschutzverordnungen sowie die Schwierigkeit, Gemische aus Nischenrohstoffen mit heterogenen Eigenschaften zu standardisieren, erschwert die Nutzung gemischter Festbrennstoffe. Perspektivisch sind alternative Ansätze denkbar, um beliebige Biomassen zu karbonisieren und auf diese Weise homogene Sekundärbrennstoffe zu gewinnen. Potenzialhöhe und Maßnahmenanzahl ausgewählter Biomassen in den Bioenergie-Regionen Das Kapitel 4 analysiert die regionale Themenvielfalt bezüglich alternativer Rohstoffe vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ausgangssituationen in den Bioenergie-Regionen. Die für diese Analyse ausgewählten Rohstoffe sind sämtlich energetisch ungenutzte Biomassen aus bestehenden Stoffströmen (Gruppe B): Bioabfall /Speiseabfälle, Landschaftspflegematerial und Wegebegleitgrün, Grünabfall und Stroh (siehe auch Kapitel 1.2). Für diese vier Reststoffe kann das technische Biomassepotenzial der entsprechenden Maßnahmenanzahl zu diesem Reststoff gegenübergestellt werden. Die Maßnahmenanzahl entspricht der Anzahl an Projekten, die die regionalen Entwicklungskonzepte (REK) zu diesen Biomassen enthalten. Für die Bewertung der Höhe des Potenzials dienen die mit Strom aus dem jeweiligen Reststoff zu versorgenden Haushalte in der entsprechenden Region. Es zeigte sich, dass die technischen Potenziale alternativer Biomassen grundsätzlich nur einen marginalen Anteil des Strombedarfs der Haushalte in den Regionen decken könnten. Von den betrachteten Rohstoffen birgt nur Stroh das Potenzial, eine größere Bedeutung zur Stromversorgung zu erlangen (siehe folgende Tabelle 6). Zum Vergleich: die Nutzung der forstwirtschaftlichen Biomasse könnte unter Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
44 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit den getroffenen Annahmen im Durchschnitt den gesamten Haushaltsstrombedarf decken. Innerhalb der Regionen gibt es jedoch bei allen betrachteten Biomassen große Unterschiede bezüglich der Höhe der potenziellen Abdeckung. Bei dieser Darstellung ist jedoch der in Kapitel 4.1 erläuterte theoretische Kontext zu berücksichtigen. So erfolgten Annahmen einer Modellanlage zur Stromerzeugung sowie eines einheitlichen Haushaltsstrombedarfs, um die Potenzialdaten veranschaulichen zu können. Tabelle 6: Zusammenfassende Gegenüberstellung der Potenziale und der Maßnahmenanzahl für ausgewählte alternative Biomassen in allen 21 Bioenergie-Regionen Datengrundlagen: Projektdatenbank zum Vorhaben Bioenergie-Regionen (online), Stand: Februar 2014; Technisch-ökonomische Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0: Arbeitspaket 3.1 Rohstoff Durchschnittliche potenzielle Deckung des HH- Strombedarfs [%] Anzahl Regionen, die Maßnahmen zum Rohstoff umsetzen Gesamtzahl Maßnahmen in den REK (alle Regionen) Bioabfall /Speiseabfälle 1 % 4 4 Landschaftspflegematerial und Wegebegleitgrün 1 % Grünabfall 3 % 7 11 Stroh 44 % 6 8 Forstwirtschaftliche Biomasse 135 % Die Gegenüberstellungen zeigen, dass die Höhe des Rohstoffpotenzials keinen Einfluss auf die regionale Themenvielfalt alternativer Rohstoffe hat. Wenngleich für Stroh abgesehen von forstlicher Biomasse - das höchste durchschnittliche Potenzial besteht, haben nur sechs Regionen hierzu Maßnahmen im REK aufgeführt. Im Gegensatz dazu beinhalten fast alle 21 REK Maßnahmen zur energetischen Nutzung von Landschaftspflegematerial und Wegebegleitgrün, obwohl die Potenziale wesentlich niedriger ausfallen. Es ist jedoch zu bedenken, dass ein regional sehr geringer potenzieller Versorgunggrad aus einem Reststoff dennoch Maßnahmen zur energetischen Nutzung erlaubt, sofern der Reststoffanfall eine lokale Relevanz entfaltet beziehungsweise mit weiteren Biomassen regional gebündelt werden kann. Die Darstellungen von Abbildung 9 bis Abbildung 12 in Kapitel 4 zeigen, wie die technischen Biomassepotenziale der betrachteten Reststoffe in den Regionen verteilt sind und wo hierzu Maßnahmen in den regionalen Entwicklungskonzepten vorgesehen sind. Zu beachten ist, dass dies jedoch keinen Rückschluss auf den Umfang und die Auswirkung der Maßnahmen erlaubt. Die Befragung der Regionen aus dem Jahr 2013 macht darüber hinaus deutlich, dass neben den Maßnahmen im REK oftmals zusätzliches regionales Engagement zu den betrachteten Biomassen besteht. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
45 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Ungenutzte bzw. innovative Rohstoffen zur Erzeugung von Bioenergie mit hoher Relevanz Welche Hintergründe zur Thematisierung ungenutzter / innovativer Bioenergieträger in den Regionen führen, kann mit der durchgeführten Analyse nicht geklärt werden. Gründe wären mittels vertiefter Analysen beispielsweise bei lokal anfallenden Rohstoffmengen oder beim regional individuellen Handlungsdruck und den Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Es muss somit davon ausgegangen werden, dass Rohstoffmengen auch dezentral konzentriert anfallend und sich Einzelprojekte mit lokaler Bedeutung umsetzen lassen. Die Befragung der Regionalmanager nach bereits genutzten bzw. zukünftig zu erschließenden alternativen Rohstoffen, gibt einen guten Überblick darüber, welchen Rohstoffen in Bioenergie-Regionen die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mindestens 10 Regionen thematisieren folgende Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie (Gruppe A): Hackschnitzel von Kurzumtriebsplantagen Wildpflanzenmischungen Durchwachsene Silphie Mindestens 10 Regionen thematisieren folgende Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen (Gruppe B): Private Bioabfälle Landschaftspflegematerial Pferdemist Mischpellets / -briketts Fazit und Einschätzung der Ergebnisse im Kontext des Förderprogramms Ziel der Arbeit war es, rund um ungenutzte / innovative Bioenergierohstoffe einen Erfahrungsaustausch der regionalen Akteure zu organisieren und die praktischen Maßnahmen in den Regionen vor dem Hintergrund technischer Biomassepotenziale einzuordnen. Sowohl die Workshops als auch die Zusammenstellung alternativer Bioenergierohstoffe inklusive einer Übersicht vorhandener Wissensträger stellen nun eine Basis für den Wissensaustausch und die Vernetzung in diesem Bereich dar. Die Bioenergie-Regionen sind Modellregionen in Deutschland, sodass sich Erkenntnisse grundsätzlich auch auf andere Regionen übertragen lassen. Durch die gezielte Analyse von Rohstoffangebot und Maßnahmenvielfalt sowie die Analyse bereits vorliegender regionaler Erfahrungen, ergibt sich ein umfassendes Bild zur Themenkonjunktur ungenutzter / innovativer Bioenergierohstoffe in den Bioenergie-Regionen. Ohne eine Verortung der auf unterschiedliche Regionen verteilten Erfahrungen und Wissensträger war es bislang für Interessierte schwierig, gezielt Kontakt zu Best Practice-Beispielen aufzunehmen. Die Erkenntnisse bieten die Möglichkeit zum Wissenstransfer zwischen den Bioenergie-Regionen aber auch zu weiteren interessierten Akteuren. Dadurch sollte es möglich sein, die Etablierung alternativer Rohstoffe zu beschleunigen oder zumindest seitens eines Regionalmanagements zu unterstützen. Die Auseinandersetzung mit den Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
46 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit technischen Biomassepotenzialen erlaubt es den Regionen auch, diese zukünftig als Rahmenbedingungen zusätzlich zu den regional individuellen Hintergründen anzuführen. In der Gruppe A) Rohstoffe mit Schwerpunkt Naturschutz / Ökologie spielt KUP sowie die durchwachsene Silphie und Wildpflanzenmischungen die größte Rolle (siehe Kapitel 2). Weitere nachwachsende Rohstoffe wie Miscanthus oder Hirse werden höchstens vereinzelt thematisiert. Unter den untersuchten Biomassen der Gruppe B) Rohstoffe mit Schwerpunkt Erschließen von bestehenden Stoffströmen gibt es in den REK die meisten Maßnahmen zu den Reststoffen Landschaftspflegematerial, Wegebegleitgrün und Grünabfall (siehe Kapitel 4.3). Diese Typen sind außerdem in ihrer Weiterverarbeitung sehr ähnlich und können gegebenenfalls in einem Stoffstrom gebündelt werden. Die Verarbeitung von Reststoffen zu Biokohle und andere Möglichkeiten der erweiterten Kaskadennutzung haben sich jedoch noch nicht weiter etabliert (siehe Kapitel 3). Hier gilt es die erkannten Probleme abzubauen und Lösungsansätze sowie innovative Ansätze weiterzuentwickeln. Im Rahmen des Fördervorhabens haben zahlreiche Bioenergie-Regionen Potenzialuntersuchungen durchgeführt. Durch die Begleitforschung des DBFZ konnten Potenziale für alle Regionen und zahlreiche Bioenergierohstoffe miteinander verglichen werden. Damit war es erstmals möglich, die Themensetzung der Regionen mit den Potenzialhöhen in Verbindung zu bringen. Ein Zusammenhang zwischen Höhe des Potenzials und der Anzahl der Maßnahmen kann dabei jedoch nicht festgestellt werden. Etwaige Vermutungen, dass die Bioenergie-Regionen in den Bereichen stärker engagiert sind, wo sie theoretisch das größte Biomasseangebot haben, können damit nicht bestätigt werden. Besonders bei der Diskussion der regionalen Aktivitäten bezüglich ungenutzter / innovativer Biomassen ist zu beachten, dass in den Regionen eventuell weitere Maßnahmen in diesem Themenfeld stattfinden. Dies trifft auf solche Maßnahmen zu, die entweder nicht vom Regionalmanagement ausgehen, daher also auch nicht in der Projektdatenbank zur Fördermaßnahme gelistet sind, oder dem Management nicht bekannt sind. Hierzu gehören auch Stoffströme der Waldwirtschaft oder Stroh, für welche gegebenenfalls etablierte Märkte bestehen. Die vorliegenden Ergebnisse erheben somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Handlungsbedarf in den Regionen und weitergehender Forschungsbedarf Es ist festzustellen, dass sich die Regionen eine individuelle Kombination an Kompetenzen im Bereich ungenutzter / innovativer Bioenergierohstoffe aufgebaut haben. Auf Grundlage der vorliegenden Arbeit ist es empfehlenswert, den Wissenstransfer weiter voran zu treiben und seitens der Wissensträger Dienstleistungen in diesem Bereich anzubieten. Dabei ist zu einigen Energieträgern bereits spezifisches Wissen vorhanden, welches auch in entsprechenden Ausbildungs- oder Hochschulbereichen integriert werden kann. Eine transparente und überzeugende Öffentlichkeitsarbeit sollte erfolgreiche Verfahren und Pilotversuche begleiten, sodass vielversrechende Ansätze bekannt werden und zum Nachahmen anregen. Hierfür erscheint eine koordinierende Stelle auf regionaler Ebene angemessen. Die positiven Erfahrungen mit den Leistungen der koordinierenden Regionalmanagements als Anlaufstelle für tatwillige Akteure und für den individuellen Dialog führen bereits vielfach zur Verstetigung dieser Strategie. Zahlreiche Maßnahmen zur Etablierung alternativer Bioenergierohstoffe finden mit kleinflächigen Versuchen bzw. mit geringfügigen Änderungen bestehender Stoffströme statt. Selbst solche Maßnahmen Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
47 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit sollten fachlich begleitet werden, um negative Erfahrungen zu vermeiden. Insbesondere kleine Experimente ohne professionelle Begleitung bergen die Gefahr, nur geringe Erträge zu liefern oder als Misserfolg zu enden. Vereinzelte Beispiele sind hier bei KUP (verfehlte Beikrautregulierung) und Wildpflanzenmischungen (Umbruch nach dem ersten Jahr) bekannt. Daher sollten die in der Fördermaßnahme gesammelten Erfahrungen dazu dienen, Probleme zu umgehen und erfahrene Akteure in Projekte von Beginn an einzubinden. Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der innovativen Substrate zum einen auf der technologischen Seite und zum anderen bei Entscheidungsgrundlagen zur regionalen Einbindung in die Landnutzungssysteme. Ersteres umfasst technische, wirtschaftliche und ökologische Grundlagen, die dabei helfen, innovativen Verfahren und Methoden technische und wirtschaftliche Sicherheit zu verschaffen. Unter den betrachteten Biomassen betrifft das zum Beispiel die weitere Züchtung von Energiepflanzen (z.b. Wildpflanzen; Zweifruchtanbau) oder eine Optimierung der Aufbereitungsmethoden von Reststoffen (z.b. Homogenisierung von Mischbrennstoffen). Zum zweiten sind weiterhin Forschungstätigkeiten gefragt, um das Engagement regionaler Strukturen mit wissenschaftlichen Untersuchungen, Machbarkeitsstudien und Handlungsempfehlungen zu flankieren. Hierzu gehören zum Beispiel Potenzial- und Logistikanalysen für dezentral anfallende Biomassen unterschiedlichster Akteure und Bereitstellungsketten. In der vorliegenden Arbeit wurde nur ein Teil der großen Bandbreite ungenutzter / innovativer Biomassen aus Tabelle 2 betrachtet. Zukünftige Forschungstätigkeiten zur Themenkonjunktur und zum Erfahrungsstand innovativer Bioenergierohstoffe sollten ein breiteres Spektrum abdecken. Insbesondere eine fortgesetzte Betrachtung von Maßnahmen zur Etablierung alternativer Bioenergierohstoffe könnte Best-Practice-Projekte identifizieren und Informationen zielgruppenspezifisch und dienstleistungsorientiert zur Verfügung stellen. In weiterführenden Untersuchungen könnte außerdem ermittelt werden, welche Einflüsse dazu führen, dass Maßnahmen Eingang in regionale Handlungskonzepte finden. Anstelle der Höhe des Biomassepotenzials scheint dies stattdessen stärker von Akteursinteressen und anderen Faktoren in den Regionen abhängig zu sein. Des Weiteren bieten sich für zukünftige Förderprogramme Untersuchungen zum Fortschritt der Maßnahmen im Verlauf der Projektlaufzeit an, um bei Bedarf angepasste wissenschaftliche Unterstützung anbieten zu können. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
48 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit A 1 42BPotenzielle Deckung des Haushaltsstrombedarfs ausgewählter Biomassen und Maßnahmenanzahl im REK Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
49 Stroh Bioabfall/ Speisereste Grünabfälle Die folgende Tabelle enthält nur solche Maßnahmen aus den regionalen REK, die gemäß ihrer Maßnahmenbeschreibung (mindestens) einem thematisierten Rohstoff zugeordnet werden konnten. Unter Umständen wurden Inhalte und Maßnahmen seit Förderbeginn durch die Regionen angepasst. Der aktuelle Stand der Projekte kann online recherchiert werden unter 17Thttp:// Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial Forstwirtschaftliche Biomasse 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit A 2 Die Maßnahmen der Projektdatenbank (Auszug alternative Rohstoffe) Region Projektbezeichnung Thematisierter Rohstoff Achental Achental Altmark Altmark Altmark Umrüstung bestehender BGAs auf alternative Energiepflanzen und Substrate Potential- und Machbarkeitsuntersuchung HTC Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse RuminoTec-Anlage zur Wärmeversorgung kreiseigener Gebäude Erweiterung des bestehenden GIS(GeoInformationsSystem)- Werkzeuges um Landschaftspflegeund Naturschutzflächen Rohstoffbörse für Waldbesitzer Altmark Bayreuth Bayreuth Bodensee Bodensee Bodensee Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen Errichtung Bioabfallvergärungsanlage Energetische Verwertung von Heckenpflegematerial und krautigem Landschaftspflegematerial Stoffstrommanagement bei Straßenbegleitgrün Handlungsanweisung zur Nutzung und Umgestaltung von Waldrändern Handlungsempfehlungen Landschaftspflegematerial Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
50 Stroh Bioabfall/ Speisereste Grünabfälle Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial Forstwirtschaftliche Biomasse 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Region Projektbezeichnung Thematisierter Rohstoff Bodensee Nutzung von nichtverholzten Landschaftspflegematerial Bodensee Bioenergienutzung von Campingplatz-Grünschnitt Bodensee Ausbau Wärmenetz Lochmühle Cochem-Zell Errichtung einer Strohverbrennungsanlage Cochem-Zell Cochem-Zell Cochem-Zell Rohstoffakquise Wegebegleitgrün & LPM aus Biotoppflege Erzeugung nachwachsender Rohstoffe als Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen Privatwaldmanagement und Steillagenmobilisierung Hohenlohe-Odenwald- Tauber Hohenlohe-Odenwald- Tauber Initialberatungen in Kommunen (Initialberatung Land- und Forstwirtschaft) Potenzialanalyse Waldrestholz & Erstellung eines strategischen Handlungsleitfadens für die forstliche Maßnahmenplanung im Staats-, Kommunal- und Privatwald Hohenlohe-Odenwald- Tauber Hohenlohe-Odenwald- Tauber Nutzung bisher nicht genutzter Grünschnittmengen Mobilisierung von Holz aus dem Kleinprivatwald Höxter Förderung der thermischen Nutzung von Stroh Höxter Höxter Wissenstransfer "energetische Restholznutzung" Biomasseheizkraftwerk für die Abfallentsorgungsanlage Beverungen- Wehrden Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
51 Stroh Bioabfall/ Speisereste Grünabfälle Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial Forstwirtschaftliche Biomasse 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Region Projektbezeichnung Thematisierter Rohstoff Höxter Höxter Jena-Saale Jena-Saale Energetische Nutzung von Grünabfällen holziger Art Strukturanalyse Holzwitschaft: Optimieren der Wertschöpfungspotenziale der Marktkette "Forst-Holz" Erprobung neuer Aufschlussverfahren zur maximalen Biogasausbeute Strohheizkraftwerk Jena-Saale Jena-Saale Jena-Saale Jena-Saale Jena-Saale Ludwigsfelde Ludwigsfelde Erweiterung Kompostwerk um Trockenfermentation Nutzung von Reststoffen und Landschaftspflegematerial Rohstoffmobilisierung aus Landschaftspflegematerial/Bioabfall Stoffstrommanagement in der Wertschöpfungskette Holz Kreislaufwirtschaft der Forstwirtschaft mit Aschenutzung Energiepflanzenanbau auf ehemaligen Rieselfeldern Managementsystem energetische Heckennutzung Ludwigsfelde Biogasanlage ENRO Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Wertschöpfung durch Energieholz aus der Heckenpflege Fortführung Qualitätssiegel "Märkischer Holzweg" Förderung von Biofestbrennstoffhöfen und Energieholzproduzenten/- vermarktern Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
52 Stroh Bioabfall/ Speisereste Grünabfälle Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial Forstwirtschaftliche Biomasse 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Region Projektbezeichnung Thematisierter Rohstoff Märkisch-Oderland Wertschöpfungsketten Kaminholz Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Märkisch-Oderland Machbarkeitsstudie zu Kommunalen Holzheizungen Machbarkeitsstudie zu Holzheiz- Contracting Initial- und Nutzerberatungen zum Heizen mit Holz Mittelhessen Konzept Heckenmanagement Mittelhessen Mittelhessen naturkraft-region naturkraft-region naturkraft-region naturkraft-region naturkraft-region Nordfriesland Nord Nordfriesland Nord Strukturen zu Sammlung und Verwertung von Biomasse aus der Landschaftspflege entwickeln Realisierung einer IffB-Technikums- Anlage zur Verwertung von Gras aus Landschaftspflege Ausstellung Kompaktierung von Biomasse Machbarkeitsstudie zur Verwertung von landwirtschaftlichen Bioreststoffen durch Kompaktierung im Schwalm-Eder Kreis Alternative Anbaukonzepte für Energiepflanzen Machbarkeitsstudie Brennstofflogistik Handlungsleitfaden Nachhaltige energetische Nutzung von Holz aus historischen Waldnutzungsformen Düngeversuche zur Ertragssteigerung von Grünland für die Biogasproduktion (Biogas-Expert) Hackschnitzelheizwerk Högel mit Hackschnitzelversorgung aus regionaler Produktion Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
53 Stroh Bioabfall/ Speisereste Grünabfälle Wegebegleitgrün Landschaftspflegematerial Forstwirtschaftliche Biomasse 6 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit Region Projektbezeichnung Thematisierter Rohstoff Oberberg"RheinErft" Oberberg"RheinErft" Oberberg"RheinErft" Oberberg"RheinErft" Oberland Oberland Oberland Oberland Rügen Straubing-Bogen Straubing-Bogen Weserbergland Weserbergland Weserbergland GIS Projekt zur Verwertung Landschaftspflegematerial Ausbau der WSK Holzmobilisierung aus dem Privatwaldbesitz Flächendatenbank regionale Holzmobilisierung Fachschulungen zur Holzmobilisierung durchführen Verstromung biogener Reststoffe (Bioabfall) Energienutzungspläne / Stoffstrommanagement Machbarkeitsstudie Pellet- Produktionsanlage Potenzialstudie Holzenergie im Privat- und Kommunalwald Biomassepotenzialanalyse für den gesamten Landkreis Vorpommern- Rügen Mobilisierung Privatwald und Kaskadennutzung Informationsmappe für Waldbesitzer Erschließung endogener Biomasse- Reserven Aufbau eines regionalen Stoffstrommanagements Steigerung einer nachhaltigen Holzwerbung Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
54 Literatur- und Referenzverzeichnis Literatur- und Referenzverzeichnis Bärwolff, M.; Hansen, H.; Hofmann, M.; Setzer, F. (2012): Energieholz aus der Landwirtschaft. Gülzow- Prüzen. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) (Hrsg.) (2011): Das Kulturlandschafts programm (KULAP). München. Bemmmann, A.; Manning, D.B. (2013): Energieholzplantagen in der Landwirtschaft: Eine Anleitung zur Bewirtschaftung von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb für den Praktiker. Auflage: 1. Agrimedia. Clenze. ISBN Bosch, J.; Zeng, T. (2012): Qualitative Anforderungen an alternative Biomassepellets im Rahmen des deutschen Genehmigungsrechtes. Vortrag gehalten: Leipziger Fachgespräche Feste Biomasse. Am in Leipzig. Brosowski, A. (2012): Regionale Biomassepotenziale und Standortbewertung am Beispiel von Stroh in Sachsen - GIS-basierte Ermittlung von Bereitstellungskosten. In: GeoForum MV GIS schafft Energie: Beiträge der Geoinformationswirtschaft zur Energiewende. GITO. Berlin. ISBN Brosowski, A.; Adler, P. (2014): Ergebnisvorstellung technische Biomassepotenziale. Vortrag gehalten: 14. Workshop Bioenergie-Regionen. Am in Straubing. Eckner, J.; Vetter, A. (2013): Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die Produktion von Energiepflanzen (EVA). In: Symposium Energiepflanzen ISBN Eder, B. (2012): Biogas-Praxis: Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. 5. Vollständ. überarb. ökobuch. ISBN EEG (2012): Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) vom Zuletzt geändert durch Art. 5 G v I FGSV (Hrsg.) (2004): Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen. Leistungsbereich 2: Grünpflege. Version 1.1. FGSV Verlag. Köln. Fischer, E.; Powrosnik, A.-M.; Beil, C. (2013): Prozessstabilität und Biogasausbeute bei der Vergärung von Pferdemist im Labormaßstab. In: Landtechnik. Bd (Nr. 68 (4)). S ISSN FNR (2007): Leitfaden Bioenergie. Planung, Betrieb und Wirtschaftlichkeit von Bioenergieanlagen. Gülzow. FNR (Hrsg.) (2012): Energiepflanzen für Biogasanlagen - Sachsen. 1. Aufl. Selbstverlag. Gülzow. FNR (2013): 4. Symposium Energiepflanzen. 22./23. Oktober 2013, Berlin. Gülzow-Prüzen. ISBN Gröngröft, A.; Meisel, K. (2013): Ökologische und wirtschaftliche Analyse von Anlagenkonzepten zur Produktion von Ethanol aus Weizen und Stroh. Vortrag gehalten: Am in Berlin. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
55 Literatur- und Referenzverzeichnis Guder, R. (2013): Energetische Nutzung von Biomischpellets. Vortrag gehalten: 13. Workshop Bioenergie-Regionen. Am in Nienburg. Haak, F.; Bohnet, S. (2013): Probleme und Lösungsansätze bei der Etablierung alternativer Bioenergie- Rohstoffe - Tagungsreader zum 13. Workshop Bioenergie-Regionen am 17. & 18. September in Nienburg (Weser). Tagungsreader. Leipzig. Hefter, I.; Mann, S.; Naumann, H.; Runge, K.; Thomas, A.; Böhmer, J.; Köhler, R.; Oßwald, D.; Wern, B.; Jäger, U. (2009): Etablierung eines beispielhaften regionalen Energiekreislaufes mit Biomasse aus der Landschaftspflege im Naturpark Unteres Saaletal unter besonderer Berücksichtigung einer GIS-gestützten Abschätzung des langfristig zur Verfügung stehenden Biomassepotenzials. Abschlussbericht. Hochschule Anhalt. Bernburg, Birkenfeld. IAA (2011): Nutzung der Potenziale des biogenen Anteils im Abfall zur Energieerzeugung. Nr. UBA-FB Igelspacher, R. (2006): Methode zur integrierten Bewertung von Prozessketten am Beispiel der Ethanolerzeugung aus Biomasse. E und M, Energie-und-Management-Verl.-Ges. Herrsching. Johann Heinrich von Thünen-Institut (2014): Agrarökologische Bewertung der Durchwachsenen Silphie als eine Biomassepflanze der Zukunft. Abgerufen am von Kuhn, W.; Zeller, J.; Bretschneider-Herrmann, N.; Drenckhahn, K. (2013): Energie aus Wildpflanzen Politik, Beratung, Praxis - Praxisempfehlungen. LfULG (2009): Anbauempfehlungen Schnellwachsende Baumarten im Kurzumtrieb. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Dresden. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (Hrsg.) (2011): Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das Niedersächsiche und Bremer Agrarumweltprogramm. Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz (Hrsg.) (2011): Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz zur Förderung der Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft und von Erzeugungspraktiken, die der Marktentlastung dienen (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich - MEKA III). Müller, L. (2011): Aufbereitung und Fermentation von Mais- und Getreidestroh für die Biogaserzeugung (Poster). In: Göttingen. Naturschutzstiftung David (2012): Energieholz und Biodiversität Die Nutzung von Energieholz als Ansatz zur Erhaltung und Entwicklung national bedeutsamer Lebensräume. Zwischenbericht Nr. 2. Naturschutzstiftung David. Erfurt. o. A. (2012): Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234) Zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 10 G v I 212. Pollex, A.; Zeng, T. (2012): mixbiopells Handbuch für Initiatoren. Leipzig. Sauter, P.; Billig, E.; Döhling, F.; Pilz, A.; Brosowski, A.; Kirsten, C.; Bosch, J.; Büchner, D.; Majer, S.; Weller, N.; Witt, J.; Seidenberger, T.; Schicketanz, S.; Peters, W.; Lochmann, Y.; Prochnow, A. (2013): Grünlandenergie Havelland - Entwicklung von übertragbaren Konzepten zur Nutzung von halm- Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
56 Literatur- und Referenzverzeichnis gutartigen Landschaftspflegematerialien am Beispiel der Region Havelland (Verbundvorhaben). DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum ggmbh. LBV-SH, (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig Holstein) (2009): Leitfaden für die fachgerechte Unterhaltungspflege von Gehölzflächen an Straßen. TLL (2011): Optimierung der nachhaltigen Biomassebereitstellung von repräsentativen Dauergrünlandtypen für die thermische Verwertung (GNUT Verbrennung). Endbericht. Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Jena. TLL (Hrsg.) (2013): Leitlinie zur effizienten und umweltverträglichen Erzeugung von Durchwachsener Silphie. Jena. Unselt, R.; Möndel, A.; Textor, B.; Seidl, F.; Steinfatt, K.; Kaiser, S.; Thiel, M.; Karopka, M.; Nahm, M. (2010): Anlage und Bewirtschaftung von Kurzumtriebsflächen in Baden-Württemberg - Eine praxisorientierte Handreichung. Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg. Rheinstetten-Forchheim. Vollrath, B.; Werner, A.; Degenbeck, M.; Illies, I.; Zeller, J.; Marzini, K. (2012): Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion. Veitshöchtsheim. Wagner, C. (2013): Blühflächen Lebensraum auf Zeit. Abgerufen am von Weller, N.; Zeng, T.; Lenz, V. (2010): Combustion behavior of straw pellets and its potential optimisation by fuel improvement. In: Proceedings of the 18th European Biomass Conference and Exhibition. S Lyon. doi: /18thEUBCE2010-OC5.3. ISBN Wiemer, K.; Kern, M.D.; Raussen, T. (2014): Biogas-Atlas 2014/15: Anlagenhandbuch der Vergärung biogener Abfälle in Deutschland und Europa. Witzenhausen-Institut f. Abfall, Umwelt u. Energie. Witzenhausen. ISBN Witt, J. (2012): Holzpelletbereitstellung für Kleinfeuerungsanlagen - Analyse und Bewertung von Einflussmöglichkeiten auf die Brennstofffestigkeit. Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH. Leipzig. ISBN ISSN Zeng, T.; Pollex, A.; Lenz, V.; Alakangas, E.; Rönnbäck, M.; Sager, A. (2012): Certification of mixed biomass pellets a proposal from the MixBioPells project. Vortrag gehalten: Pellcert Workshop. Am in Brussels, Belgium. Bericht zum Arbeitspaket 3.3 der technisch-ökonomischen Begleitforschung zur Fördermaßnahme Bioenergie-Regionen 2.0, 09. Jul
57 Impressum Ansprechpartner: DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH Torgauer Straße Leipzig Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: 17Twww.dbfz.de17T M.Sc. Falko Haak Tel.: +49 (0) Dipl.-Geogr. Sebastian Bohnet Tel.: +49 (0) Erstelldatum: Leipzig, Projektnummer DBFZ: Projektnummer FNR Gesamtseitenzahl + Anlagen 54 Aufsichtsrat: Bernt Farcke, BMEL, Vorsitzender Berthold Goeke, BMUB Anita Domschke, SMUL Dr. Dorothee Mühl, BMWi Dr. Christoph Rövekamp, BMBF Birgitta Worringen, BMVI Geschäftsführung: Sitz und Gerichtsstand: Leipzig Prof. Dr. mont. Michael Nelles (wiss.) Amtsgericht Leipzig HRB Daniel Mayer (admin.) Steuernummer: 232/124/01072 USt.-IdNr.: DE Deutsche Kreditbank AG IBAN: DE SWIFT BIC: BYLADEM1001
Viernheim: Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner.
 Thema: Wildpflanzen zu Biogas Viernheim: 16.4.15 Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner. Eine Möglichkeit, sich
Thema: Wildpflanzen zu Biogas Viernheim: 16.4.15 Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner. Eine Möglichkeit, sich
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Farbe ins Feld und Alternative Energiepflanzen
 Farbe ins Feld und Alternative Energiepflanzen Projektleitung Alternative Energiepflanzen und FIF Dipl. Wirtschaftsing. Marion Wiesheu Fachreferentin Mitgliederservice Fachverband Biogas e.v. Referent
Farbe ins Feld und Alternative Energiepflanzen Projektleitung Alternative Energiepflanzen und FIF Dipl. Wirtschaftsing. Marion Wiesheu Fachreferentin Mitgliederservice Fachverband Biogas e.v. Referent
Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen
 Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen Energiepflanzen ein Überblick: Energiepflanzen in Niedersachsen Mais Getreide Ganzpflanzennutzung Grünland / Ackergras Rüben
Substratalternativen für die Biogaserzeugung Frerich Wilken, LWK Niedersachsen Energiepflanzen ein Überblick: Energiepflanzen in Niedersachsen Mais Getreide Ganzpflanzennutzung Grünland / Ackergras Rüben
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm
 Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
Energie vom Acker. Miscanthus Giganteus
 Energie vom Acker Durch die ständig ansteigenden Preise für fossile Brennstoffe (Erdgas, Erdöl) steigen auch die Preise für die Energieproduktion. Es ist zu erwarten, daß diese Preise noch weiter steigen
Energie vom Acker Durch die ständig ansteigenden Preise für fossile Brennstoffe (Erdgas, Erdöl) steigen auch die Preise für die Energieproduktion. Es ist zu erwarten, daß diese Preise noch weiter steigen
Einzelbetriebliche Betrachtung zum Anbau alternativer Energiepflanzen. Lindach 1, Nebelschütz
 Einzelbetriebliche Betrachtung zum Anbau alternativer Energiepflanzen Ökonomische Kriterien EEG 2012 Erneuerbare- Energien- Gesetz, Novelle 2012 Erhöhung der Artenvielfalt beim Energiepflanzenanbau Züchtung
Einzelbetriebliche Betrachtung zum Anbau alternativer Energiepflanzen Ökonomische Kriterien EEG 2012 Erneuerbare- Energien- Gesetz, Novelle 2012 Erhöhung der Artenvielfalt beim Energiepflanzenanbau Züchtung
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Dienstsitz in Bonn mit Außenstellen in Hamburg Weimar und München www.ble.de Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist eine Anstalt des
Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe
 Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe Claudia Viße, MLUR 1 Verluste in der Lebensmittelkette Gemäß UNEP gehen weltweit 56% der möglichen Energieeinheiten (kcal) entlang
Möglichkeiten und Grenzen bei Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe Claudia Viße, MLUR 1 Verluste in der Lebensmittelkette Gemäß UNEP gehen weltweit 56% der möglichen Energieeinheiten (kcal) entlang
POTENZIALE BIOGENER REST- UND ABFALLSTOFFE für eine nachhaltige Energie- und Rohstoffbereitstellung
 fnr.de POTENZIALE BIOGENER REST- UND ABFALLSTOFFE für eine nachhaltige Energie- und Rohstoffbereitstellung HANDOUT EINLEITUNG In diesem Papier wird angenommen, dass biogene Rest- und Abfallstoffe überwiegend
fnr.de POTENZIALE BIOGENER REST- UND ABFALLSTOFFE für eine nachhaltige Energie- und Rohstoffbereitstellung HANDOUT EINLEITUNG In diesem Papier wird angenommen, dass biogene Rest- und Abfallstoffe überwiegend
Greening in der Landwirtschaft
 Greening in der Landwirtschaft Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen und Wirkungen für Vegetation und Tierwelt Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Vortrag
Greening in der Landwirtschaft Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen und Wirkungen für Vegetation und Tierwelt Dr. Rainer Oppermann Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab), Mannheim Vortrag
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung
 Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Biomasseanbau in Brandenburg - Wandel der Landnutzung Dr. Günther Hälsig Zielstellungen zum Biomasseanbau Ziele der EU bis 2020 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieverbrauch 20 Prozent Reduzierung
Nachhaltige Erzeugung von Biogassubstraten. Alternativen zum Mais: Nachhaltige Biogassubstrate als Beitrag zur Biodiversität
 Nachhaltige Erzeugung von Biogassubstraten Alternativen zum Mais: Nachhaltige Biogassubstrate als Beitrag zur Biodiversität 4. Kommunalbörse Biomassennutzung in Kommunen Blieskastel, 20.09.2012 Dr. Peter
Nachhaltige Erzeugung von Biogassubstraten Alternativen zum Mais: Nachhaltige Biogassubstrate als Beitrag zur Biodiversität 4. Kommunalbörse Biomassennutzung in Kommunen Blieskastel, 20.09.2012 Dr. Peter
Energie aus Biomasse. vielfältig nachhaltig
 Energie aus Biomasse vielfältig nachhaltig Was haben weggeworfene Bananenschalen, Ernterückstände und Hofdünger gemeinsam? Sie alle sind Biomasse. In ihnen steckt wertvolle Energie, die als Wärme, Strom
Energie aus Biomasse vielfältig nachhaltig Was haben weggeworfene Bananenschalen, Ernterückstände und Hofdünger gemeinsam? Sie alle sind Biomasse. In ihnen steckt wertvolle Energie, die als Wärme, Strom
Stroh, Miscanthus und Co. Wärmeenergieträger vom Acker. Zentrum für nachwachsende Rohstoffen NRW
 Stroh, Miscanthus und Co. Wärmeenergieträger vom Acker Zentrum für nachwachsende Rohstoffen NRW 1 energetische Nutzung stoffliche Nutzung 2 3 4 Vereinbarung von Kyoto: 5 Quelle: FastEnergy GmbH 6 Quelle:
Stroh, Miscanthus und Co. Wärmeenergieträger vom Acker Zentrum für nachwachsende Rohstoffen NRW 1 energetische Nutzung stoffliche Nutzung 2 3 4 Vereinbarung von Kyoto: 5 Quelle: FastEnergy GmbH 6 Quelle:
Biomasse und Biogas in NRW
 Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Biomasse und Biogas in NRW Herbsttagung der Landwirtschaftskammer NRW Veredelung und Futterbau im Wettbewerb zu Biogas Martin Hannen Referat Pflanzenproduktion, Gartenbau Gliederung 1. Stand der Biomasse-
Mehrjährige Energiepflanzen im Vergleich
 22. Jahrestagung des Fachverband Biogas e.v. Workshop 5: Alternative Energiepflanzen Leipzig, 31.01.2013 Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt,
22. Jahrestagung des Fachverband Biogas e.v. Workshop 5: Alternative Energiepflanzen Leipzig, 31.01.2013 Dr. agr. Lothar Boese Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (LLFG) Sachsen-Anhalt,
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen,
 1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
Miscanthus-Anbautelegramm
 Miscanthus-Anbautelegramm Allgemein Miscanthus x giganteus stammt ursprünglich aus Asien und ist ein Hybrid aus Miscanthus sachariflorus und Miscanthus sinensis (siehe Fotos). Es bildet daher auch keine
Miscanthus-Anbautelegramm Allgemein Miscanthus x giganteus stammt ursprünglich aus Asien und ist ein Hybrid aus Miscanthus sachariflorus und Miscanthus sinensis (siehe Fotos). Es bildet daher auch keine
Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario
 Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario 1 Bedeutung der Bioenergie bei 100 % Erneuerbare Energien - Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt => Dezember 2015 100 % Erneuerbare
Bioenergie im 100 % Erneuerbare Energie Szenario 1 Bedeutung der Bioenergie bei 100 % Erneuerbare Energien - Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt => Dezember 2015 100 % Erneuerbare
Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg
 Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Auftraggeber: Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe Tagung Biologische
Ermittlung des Potenzials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Auftraggeber: Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe Tagung Biologische
Landwirtschaft und Biodiversität
 Landwirtschaft und Biodiversität Axel Kruschat BUND Brandenburg Artenvielfalt in Brandenburg 0: ausgestorben 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet R: potenziell gefährdet G: Gefährdung
Landwirtschaft und Biodiversität Axel Kruschat BUND Brandenburg Artenvielfalt in Brandenburg 0: ausgestorben 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet R: potenziell gefährdet G: Gefährdung
Biogaserzeugung in industriellem Maßstab
 Biogaserzeugung in industriellem Maßstab NAWARO BioEnergie Park Güstrow Der NAWARO BioEnergie Park Güstrow ist in seiner Art einzigartig: Hier wird in industriellem Maßstab Biogas erzeugt und auf Erdgasqualität
Biogaserzeugung in industriellem Maßstab NAWARO BioEnergie Park Güstrow Der NAWARO BioEnergie Park Güstrow ist in seiner Art einzigartig: Hier wird in industriellem Maßstab Biogas erzeugt und auf Erdgasqualität
Landwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe - Energiegewinnung
 Landwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe - Energiegewinnung Wegen der begrenzten Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die vermutlich wegen des Rückganges der Bevölkerung in der EU weiter abnehmen wird, sowie
Landwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe - Energiegewinnung Wegen der begrenzten Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die vermutlich wegen des Rückganges der Bevölkerung in der EU weiter abnehmen wird, sowie
Stellen Blühflächen auch für die Landwirtschaft eine Alternative dar? Werner Kuhn,
 Stellen Blühflächen auch für die Landwirtschaft eine Alternative dar? Werner Kuhn, Partner im Netzwerk Lebensraum Feldflur der Bayerische Jagdverband e.v., die Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften
Stellen Blühflächen auch für die Landwirtschaft eine Alternative dar? Werner Kuhn, Partner im Netzwerk Lebensraum Feldflur der Bayerische Jagdverband e.v., die Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften
Energiewende. Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz. Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur
 Energiewende Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur www. Lebensraum-Feldflur.de Gliederung Einleitung Energiewende in Deutschland
Energiewende Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz Kristin Drenckhahn Deutsche Wildtier Stiftung Netzwerk Lebensraum Feldflur www. Lebensraum-Feldflur.de Gliederung Einleitung Energiewende in Deutschland
Energetische Biomassenutzung in Deutschland
 Energetische Biomassenutzung in Deutschland Dr.-Ing. Janet Witt Fachgespräch Feste Biomasse im Rahmen der ENERTEC, Leipzig, 31.01.2013 Einleitung Bioenergie: Das Multitalent V i e l f ä l t i g e R o h
Energetische Biomassenutzung in Deutschland Dr.-Ing. Janet Witt Fachgespräch Feste Biomasse im Rahmen der ENERTEC, Leipzig, 31.01.2013 Einleitung Bioenergie: Das Multitalent V i e l f ä l t i g e R o h
Energiepflanzen Gibt es einen Weg aus den Maisund Rapsmonokulturen?
 7. Master Class Course Confernece Renewable Energies Energiepflanzen Gibt es einen Weg aus den Maisund Rapsmonokulturen? Herbert Geißendörfer Triesdorf - Campus Hochschule Fachober-/ Berufsoberschule Energiezentrum
7. Master Class Course Confernece Renewable Energies Energiepflanzen Gibt es einen Weg aus den Maisund Rapsmonokulturen? Herbert Geißendörfer Triesdorf - Campus Hochschule Fachober-/ Berufsoberschule Energiezentrum
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern
 Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen
 Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen Weiterentwicklung von Technologien zur effizienten Nutzung von Pferdemist als biogener Reststoff und Dr. Hans Oechsner Landesanstalt für Agrartechnik
Möglichkeiten der Vergärung von Pferdemist in Biogasanalagen Weiterentwicklung von Technologien zur effizienten Nutzung von Pferdemist als biogener Reststoff und Dr. Hans Oechsner Landesanstalt für Agrartechnik
Biogas und Naturschutz
 Biogas und Naturschutz Workshop Energie und Klimaschutz in Gütersloh 12.11.2010 Dr. Wolfgang Peters Büro Herne Kirchhofstr. 2c 44623 Herne Büro Hannover Lister Damm 1 30163 Hannover Büro Berlin Streitstraße
Biogas und Naturschutz Workshop Energie und Klimaschutz in Gütersloh 12.11.2010 Dr. Wolfgang Peters Büro Herne Kirchhofstr. 2c 44623 Herne Büro Hannover Lister Damm 1 30163 Hannover Büro Berlin Streitstraße
Bundesverband BioEnergie. Stellungnahme des Bundesverband BioEnergie e.v. (BBE)
 Stellungnahme des Bundesverband BioEnergie e.v. (BBE) zur Ausgestaltung der Option Niederwald mit Kurzumtrieb für Ökologische Vorrangflächen im Entwurf der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung (DirektZahlDurchfV)
Stellungnahme des Bundesverband BioEnergie e.v. (BBE) zur Ausgestaltung der Option Niederwald mit Kurzumtrieb für Ökologische Vorrangflächen im Entwurf der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung (DirektZahlDurchfV)
Roggen - die Energiepflanze für magere Böden
 Roggen - die Energiepflanze für magere Böden Martin Schulze Ausbau 8 15306 Dolgelin Tel.: 03346 / 845455 Fax: 03346 / 854958 Betriebs- und Standortbeschreibung: In Ostbrandenburg, genauer: 80 km östlich
Roggen - die Energiepflanze für magere Böden Martin Schulze Ausbau 8 15306 Dolgelin Tel.: 03346 / 845455 Fax: 03346 / 854958 Betriebs- und Standortbeschreibung: In Ostbrandenburg, genauer: 80 km östlich
Thema. Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015*
 Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch ausstehende BundesVO 1 Ziele der GAP-Reform (EU) Ernährungssicherheit EU muss Beitrag
Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch ausstehende BundesVO 1 Ziele der GAP-Reform (EU) Ernährungssicherheit EU muss Beitrag
Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) - Termine und Anforderungen (Stand Juli 2015)
 Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) - Termine und Anforderungen (Stand Juli 2015) Nach Abstimmung mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat der DBV die verschiedenen Termine und Anforderungen an Ökologische
Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) - Termine und Anforderungen (Stand Juli 2015) Nach Abstimmung mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat der DBV die verschiedenen Termine und Anforderungen an Ökologische
BMU Förderprogramm Energetische Biomassenutzung. Osteuropa-Workshop im BMU, Berlin Wissenschaftlich begleitet vom: Gefördert von:
 BMU Förderprogramm Energetische Biomassenutzung Osteuropa-Workshop im BMU, Berlin 12.04.2010 Aufbau von Kompetenznetzwerken mit den russischen Regionen Nizhny Novgorod, Kirov und Kaluga zur Nutzung von
BMU Förderprogramm Energetische Biomassenutzung Osteuropa-Workshop im BMU, Berlin 12.04.2010 Aufbau von Kompetenznetzwerken mit den russischen Regionen Nizhny Novgorod, Kirov und Kaluga zur Nutzung von
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Schleswig-Holstein
 Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht
 Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Leipzig FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau Vortrag am 12.03.2007 in der Reihe Naturschutz
Biomasse: Chancen und Risiken aus Naturschutzsicht Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Außenstelle Leipzig FGL in Erneuerbare Energien, Berg- und Bodenabbau Vortrag am 12.03.2007 in der Reihe Naturschutz
Energiepflanzenanbau in Niedersachsen aus regionaler Sicht: Wechselwirkungen mit anderen Raumnutzungen
 Energiepflanzenanbau in Niedersachsen aus regionaler Sicht: Wechselwirkungen mit anderen Raumnutzungen Workshop Basisdaten zur Flächenausdehnung des Energiepflanzenanbaus für die Biogaserzeugung Berlin,
Energiepflanzenanbau in Niedersachsen aus regionaler Sicht: Wechselwirkungen mit anderen Raumnutzungen Workshop Basisdaten zur Flächenausdehnung des Energiepflanzenanbaus für die Biogaserzeugung Berlin,
Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen
 Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen Dipl. Ing. agr Gerd Ostermann Agrarreferent NABU Rheinland- Pfalz Ausgangssituation Etwa
Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen Dipl. Ing. agr Gerd Ostermann Agrarreferent NABU Rheinland- Pfalz Ausgangssituation Etwa
Wildpflanzen zur Biogasgewinnung
 Landespflege Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Wildpflanzen zur Biogasgewinnung eine ökonomische Alternative zur Silomais Dr. Birgit Vollrath und Antje Werner www.lwg.bayern.de Nachdruck
Landespflege Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Wildpflanzen zur Biogasgewinnung eine ökonomische Alternative zur Silomais Dr. Birgit Vollrath und Antje Werner www.lwg.bayern.de Nachdruck
Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik
 Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik Timo Kaphengst Ecologic Institut Berlin 1 Inhalt Kurzer Überblick über die Gemeinsame Agrarpolitik
Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik Timo Kaphengst Ecologic Institut Berlin 1 Inhalt Kurzer Überblick über die Gemeinsame Agrarpolitik
Förderung mehrjähriger Wildpflanzenmischungen als Energiepflanzen
 Förderung mehrjähriger Wildpflanzenmischungen als Energiepflanzen Vorschläge des Netzwerkes Lebensraum Feldflur für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen DAS NETZWERK LEBENSRAUM FELDFLUR Im Netzwerk Lebensraum
Förderung mehrjähriger Wildpflanzenmischungen als Energiepflanzen Vorschläge des Netzwerkes Lebensraum Feldflur für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen DAS NETZWERK LEBENSRAUM FELDFLUR Im Netzwerk Lebensraum
Biogaseinspeisung wie Land- und Energiewirtschaft gemeinsam profitieren können
 Biogaseinspeisung wie Land- und Energiewirtschaft gemeinsam profitieren können Kooperationsmodelle Angebote eines Energieversorgers an die Landwirtschaft (45 min.) Peter Majer Innovationsmanagement & Ökologie,
Biogaseinspeisung wie Land- und Energiewirtschaft gemeinsam profitieren können Kooperationsmodelle Angebote eines Energieversorgers an die Landwirtschaft (45 min.) Peter Majer Innovationsmanagement & Ökologie,
Wie viel Mais muss sein?
 88. Kongress deutschsprachiger Imker 13.09.14 in Schwäbisch Gmünd Wie viel Mais muss sein? Regionalreferent Fachverband Biogas e.v. Agenda Aktuelle Branchenzahlen Biogas Warum Energie aus Biogas? Welche
88. Kongress deutschsprachiger Imker 13.09.14 in Schwäbisch Gmünd Wie viel Mais muss sein? Regionalreferent Fachverband Biogas e.v. Agenda Aktuelle Branchenzahlen Biogas Warum Energie aus Biogas? Welche
Fruchtfolgen und Pflanzenschutz Chancen und Risiken für Feld, Betrieb und Region
 Fruchtfolgen und Pflanzenschutz Chancen und Risiken für Feld, Betrieb und Region Horst Henning Steinmann Universität Göttingen, Zentrum für Biodiversität und Nachhaltige Landnutzung Fruchtfolgen (mit Energiepflanzen)
Fruchtfolgen und Pflanzenschutz Chancen und Risiken für Feld, Betrieb und Region Horst Henning Steinmann Universität Göttingen, Zentrum für Biodiversität und Nachhaltige Landnutzung Fruchtfolgen (mit Energiepflanzen)
Ermittlung des Potentials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg
 Gliederung Ermittlung des Potentials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Einführung in das Projekt Methodik der Ermittlung des
Gliederung Ermittlung des Potentials an nutzbarer Biomasse und kommunalen Abfällen zur energetischen Verwertung für die Einheitsgemeinde Havelberg Einführung in das Projekt Methodik der Ermittlung des
Ergebnisse aus zwei Fruchtfolgerotationen im Eva-Projekt gefördert mit Mitteln des BMELV und betreut von der FNR
 Ergebnisse aus zwei Fruchtfolgerotationen im Eva-Projekt gefördert mit Mitteln des BMELV und betreut von der FNR Es gilt das gesprochene Wort. EVA I FF 1 EVA II FF 1 Entwicklung und Optimierung von standortangepassten
Ergebnisse aus zwei Fruchtfolgerotationen im Eva-Projekt gefördert mit Mitteln des BMELV und betreut von der FNR Es gilt das gesprochene Wort. EVA I FF 1 EVA II FF 1 Entwicklung und Optimierung von standortangepassten
Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft (BiS)
 Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft (BiS) Projektleiter: Prof. Dr. Hans Ruppert Gefördert für 5 Jahre von: http://www.bmwi.de/bmwi/navigation/energie/statistik-und-prognosen/energiedaten/gesamtausgabe.html
Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft (BiS) Projektleiter: Prof. Dr. Hans Ruppert Gefördert für 5 Jahre von: http://www.bmwi.de/bmwi/navigation/energie/statistik-und-prognosen/energiedaten/gesamtausgabe.html
Nachweisführung EEG EVK I & II in Heizkraftwerken. Begutachtung durch den Umweltgutachter
 Nachweisführung EEG 2012 - EVK I & II in Heizkraftwerken Begutachtung durch den Umweltgutachter Inhalt Vorstellung der Firma OmniCert Umweltgutachter GmbH Rechtliche Einordnung von Biomasse zur energetischen
Nachweisführung EEG 2012 - EVK I & II in Heizkraftwerken Begutachtung durch den Umweltgutachter Inhalt Vorstellung der Firma OmniCert Umweltgutachter GmbH Rechtliche Einordnung von Biomasse zur energetischen
Diversität im Biomasseanbau Herausforderungen und Chancen für Naturschutz und Landwirtschaft
 Prof. Dr. agr. Harald Laser Fachbereich Agrarwirtschaft in Soest Höxter, am 2. Dezember 2011 Diversität im Biomasseanbau Herausforderungen und Chancen für Naturschutz und Landwirtschaft 1. Einleitung 2.
Prof. Dr. agr. Harald Laser Fachbereich Agrarwirtschaft in Soest Höxter, am 2. Dezember 2011 Diversität im Biomasseanbau Herausforderungen und Chancen für Naturschutz und Landwirtschaft 1. Einleitung 2.
Biomasse der Zukunft Bioenergie der Zukunft?
 Biomasse der Zukunft Bioenergie der Zukunft? Elisabeth Wopienka Biomasse der Zukunft Innovative und wirtschaftliche Bereitstellung fester Biomasse Energiebereitstellung aus Biomasse in Österreich 1970
Biomasse der Zukunft Bioenergie der Zukunft? Elisabeth Wopienka Biomasse der Zukunft Innovative und wirtschaftliche Bereitstellung fester Biomasse Energiebereitstellung aus Biomasse in Österreich 1970
Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen.
 Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen. Deutsche Energie-Agentur (dena) Bereich Energiesysteme und Energiedienstleistungen
Projektskizze: Pilotprojekt Demand-Side-Management Bayern. Potenziale erkennen Märkte schaffen Energiewende gestalten Klima schützen. Deutsche Energie-Agentur (dena) Bereich Energiesysteme und Energiedienstleistungen
Rechnet sich die Bereitstellung von agrarischen Biobrennstoffen?
 Rechnet sich die Bereitstellung von agrarischen Biobrennstoffen? Christa Kristöfel Elisabeth Wopienka Fachtagung Energie, Graz 3.2.212 Hintergrund-Fallstudien Tabelle 1: Untersuchte Fallbeispiele im Rahmen
Rechnet sich die Bereitstellung von agrarischen Biobrennstoffen? Christa Kristöfel Elisabeth Wopienka Fachtagung Energie, Graz 3.2.212 Hintergrund-Fallstudien Tabelle 1: Untersuchte Fallbeispiele im Rahmen
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen
 Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen F&E-Projekt gefördert vom BfN und BMU Dr. Markus Schorling, Dr. Susanne Stirn, Prof. Dr. Volker Beusmann Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und
Potenziale der Gentechnik bei Energiepflanzen F&E-Projekt gefördert vom BfN und BMU Dr. Markus Schorling, Dr. Susanne Stirn, Prof. Dr. Volker Beusmann Forschungsschwerpunkt Biotechnik, Gesellschaft und
Workshop. Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
 Veranstaltung des Verbundprojektes RePro Ressourcen vom Land mit Unterstützung des Wissenschaftlichen Begleitvorhabens (Modul B) Workshop Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
Veranstaltung des Verbundprojektes RePro Ressourcen vom Land mit Unterstützung des Wissenschaftlichen Begleitvorhabens (Modul B) Workshop Bewässerung von Kurzumtriebsplantagen mit (gereinigtem) Abwasser
Kristin Lüttich - IBZ St. Marienthal -
 Kristin Lüttich - IBZ St. Marienthal - Landmanagementsysteme, Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität Entwicklung von Steuerungsinstrumenten am Beispiel des Anbaues Nachwachsender Rohstoffe (LÖBESTEIN)
Kristin Lüttich - IBZ St. Marienthal - Landmanagementsysteme, Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität Entwicklung von Steuerungsinstrumenten am Beispiel des Anbaues Nachwachsender Rohstoffe (LÖBESTEIN)
Chancen und Risiken der Integration der Biogastechnologie in Russland Erfahrungsbericht
 Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Chancen und Risiken der Integration der Biogastechnologie in Russland Erfahrungsbericht Jan Postel Berlin 12. November 2008 Deutsches
Deutsches BiomasseForschungsZentrum German Biomass Research Centre Chancen und Risiken der Integration der Biogastechnologie in Russland Erfahrungsbericht Jan Postel Berlin 12. November 2008 Deutsches
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/ Wahlperiode des Abgeordneten Johann-Georg Jaeger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/3283 6. Wahlperiode 14.10.2014 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten Johann-Georg Jaeger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Maisanbau in Mecklenburg-Vorpommern und ANTWORT
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/3283 6. Wahlperiode 14.10.2014 KLEINE ANFRAGE des Abgeordneten Johann-Georg Jaeger, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Maisanbau in Mecklenburg-Vorpommern und ANTWORT
Das Projekt. Ein Biodiversitätsprojekt zur Förderung der Wildbienen (Hautflügler) im LKR Passau
 Franz Elender Der Bauhof und die Biologische Vielfalt bienenfreundliche Straßenränder im Landkreis Passau Das Projekt + Ein Biodiversitätsprojekt zur Förderung der Wildbienen (Hautflügler) im LKR Passau
Franz Elender Der Bauhof und die Biologische Vielfalt bienenfreundliche Straßenränder im Landkreis Passau Das Projekt + Ein Biodiversitätsprojekt zur Förderung der Wildbienen (Hautflügler) im LKR Passau
Thema. Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015*
 Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand 27.10.2014 *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch Agrarzahlungen- Verpflichtungenverordnung 1 Arbeitsgebiet Roth Agrarhandel
Thema Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) Greening 2015* Stand 27.10.2014 *vorbehaltlich weiterer Änderungen und Detailregulierungen durch Agrarzahlungen- Verpflichtungenverordnung 1 Arbeitsgebiet Roth Agrarhandel
Forum 4: Halmgüter in der Verbrennung - Status quo und Entwicklungen
 BMU Förderprogramm Optimierung energetische Biomassenutzung Konferenz Energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial, Berlin 01./02.03.2011 Vorstellung der Foreninhalte und Diskussionsergebnisse Forum
BMU Förderprogramm Optimierung energetische Biomassenutzung Konferenz Energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial, Berlin 01./02.03.2011 Vorstellung der Foreninhalte und Diskussionsergebnisse Forum
Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog: GAP ab 2014 Mehr Biodiversität im Ackerbau? BfN, Naturschutzakademie Vilm,
 Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog: GAP ab 2014 Mehr Biodiversität im Ackerbau? BfN, Naturschutzakademie Vilm, 02.-05.05.2012 Problem- und Zielstellung Aktuelle Situation der Biologischen Vielfalt
Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog: GAP ab 2014 Mehr Biodiversität im Ackerbau? BfN, Naturschutzakademie Vilm, 02.-05.05.2012 Problem- und Zielstellung Aktuelle Situation der Biologischen Vielfalt
Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse. Uwe Gährs Senior Manager
 Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse Uwe Gährs Senior Manager Agenda I Abgrenzung feste Biomasse II Nutzungsmöglichkeiten III Praxisbeispiele IV
Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen und Wärmenetzen auf Basis fester Biomasse Uwe Gährs Senior Manager Agenda I Abgrenzung feste Biomasse II Nutzungsmöglichkeiten III Praxisbeispiele IV
Energie und Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Reststoffen Hydrothermale Carbonisierung ein geeignetes Verfahren? Berlin 5.
 Energie und Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Reststoffen Hydrothermale Carbonisierung ein geeignetes Verfahren? Berlin 5. März 2009 Bedeutung der HTC für den Klimaschutz Dr. Claus Bormuth Bundesministerium
Energie und Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Reststoffen Hydrothermale Carbonisierung ein geeignetes Verfahren? Berlin 5. März 2009 Bedeutung der HTC für den Klimaschutz Dr. Claus Bormuth Bundesministerium
Pläne des BMELV zur Förderung der. On-farm-Erhaltung
 Pläne des BMELV zur Förderung der Mustertext Mustertext On-farm-Erhaltung Dr. Thomas Meier Referat 522: Biologische Vielfalt und Biopatente Mustertext 2 Internationale Zusammenarbeit 3 Internationaler
Pläne des BMELV zur Förderung der Mustertext Mustertext On-farm-Erhaltung Dr. Thomas Meier Referat 522: Biologische Vielfalt und Biopatente Mustertext 2 Internationale Zusammenarbeit 3 Internationaler
Jürgen Reulein. Symposium Mit Energie zur nachhaltigen Regionalentwicklung: Initiativen anregen Wertschöpfung organisieren Effizienz steigern
 Effiziente Nutzung von Biomasse Energieerträge verschiedener Anbau- und Konversionsverfahren Das Scheffer-Verfahren : Konzept für optimierte Energieausbeute vom Acker ökologische Betrachtungen Jürgen Reulein
Effiziente Nutzung von Biomasse Energieerträge verschiedener Anbau- und Konversionsverfahren Das Scheffer-Verfahren : Konzept für optimierte Energieausbeute vom Acker ökologische Betrachtungen Jürgen Reulein
NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln. Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011
 NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011 BioErdgas Vorteile Alleskönner Biogas Höchste Flächeneffizienz aus der Agrarfläche Ideal für Regelenergie,
NAWARO BioEnergie AG Biogas keine Konkurrenz zu Lebensmitteln Nature.tec 2011 Berlin, 24. Januar 2011 BioErdgas Vorteile Alleskönner Biogas Höchste Flächeneffizienz aus der Agrarfläche Ideal für Regelenergie,
Hilmar Gerdes (Autor) Energiegewinnung aus Biomasse im Küstenbereich Eine ökonomische und multikriterielle Bewertung verschiedener Prozessketten
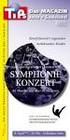 Hilmar Gerdes (Autor) Energiegewinnung aus Biomasse im Küstenbereich Eine ökonomische und multikriterielle Bewertung verschiedener Prozessketten https://cuvillier.de/de/shop/publications/6503 Copyright:
Hilmar Gerdes (Autor) Energiegewinnung aus Biomasse im Küstenbereich Eine ökonomische und multikriterielle Bewertung verschiedener Prozessketten https://cuvillier.de/de/shop/publications/6503 Copyright:
Potenziale der energetischen Nutzung von Biomasse in der Steiermark
 13. Symposium innovation, 12.-14.2.2014, Graz/Austria Potenziale der energetischen Nutzung von Biomasse in der Steiermark Julia Grill, Andreas Hammer, Harald Raupenstrauch Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik,
13. Symposium innovation, 12.-14.2.2014, Graz/Austria Potenziale der energetischen Nutzung von Biomasse in der Steiermark Julia Grill, Andreas Hammer, Harald Raupenstrauch Lehrstuhl für Thermoprozesstechnik,
Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
 DLG-Grünlandtagung, 21.Juni 2007 Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft Dr. habil. Günter Breitbarth Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
DLG-Grünlandtagung, 21.Juni 2007 Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft Dr. habil. Günter Breitbarth Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Rahmenbedingungen für die Grünlandwirtschaft
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen - Anhalt
 Neue Kulturen für die Bioenergie Demonstrationsanbau und erste Ergebnisse von Verbrennungsversuchen J. Rumpler und I. Reichardt Gliederung 1. Zielstellung 2. Demonstrationsanbau Neuer Energiepflanzen in
Neue Kulturen für die Bioenergie Demonstrationsanbau und erste Ergebnisse von Verbrennungsversuchen J. Rumpler und I. Reichardt Gliederung 1. Zielstellung 2. Demonstrationsanbau Neuer Energiepflanzen in
Blühende Energiepflanzen
 Blühende Energiepflanzen Mehr als nur schön Warum Blühstreifen?? Häufige Problematiken von Monokulturen Umweltschutz Pflanzenschutz Schädlingsdruck Erosion Bodenmüdigkeit/Humusabtrag Nitratauswaschung/Düngebelastung
Blühende Energiepflanzen Mehr als nur schön Warum Blühstreifen?? Häufige Problematiken von Monokulturen Umweltschutz Pflanzenschutz Schädlingsdruck Erosion Bodenmüdigkeit/Humusabtrag Nitratauswaschung/Düngebelastung
Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern
 Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern Wolfram Güthler Referat 64 Landschaftspflege und Naturschutzförderung Schneverdingen, den 28.09.2010 Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche Landwirtschaftliche
Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern Wolfram Güthler Referat 64 Landschaftspflege und Naturschutzförderung Schneverdingen, den 28.09.2010 Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche Landwirtschaftliche
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs. Fachtagung Energie Graz
 Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Zahlt sich Biogas-Produktion in Zukunft aus? Werner Fuchs Fachtagung Energie 25.01.2013 Graz Future strategy and 2020 and related projects C-II-2 Biogas im Umbruch Europa wächst österreichischer und deutscher
Biomasse rein Kohle raus. Und dabei noch richtig Asche machen!
 Farmer Automatic Biomasse rein Kohle raus. Und dabei noch richtig Asche machen! Das Farmer Automatic Verwertungssystem für Biomassen 1. Steinfurter Biogasfachtagung 01. Juni 2007 Fachhochschule Münster
Farmer Automatic Biomasse rein Kohle raus. Und dabei noch richtig Asche machen! Das Farmer Automatic Verwertungssystem für Biomassen 1. Steinfurter Biogasfachtagung 01. Juni 2007 Fachhochschule Münster
Forschungsprojekt: Biobrennstoffdesign - Mischpellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen
 Forschungsprojekt: Biobrennstoffdesign - Mischpellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen 9. Industrieforum Pellets 06. - 07. Oktober 2009 Neue Messe Stuttgart, ICS Daniel Hein Universität Siegen Institut
Forschungsprojekt: Biobrennstoffdesign - Mischpellets aus landwirtschaftlichen Reststoffen 9. Industrieforum Pellets 06. - 07. Oktober 2009 Neue Messe Stuttgart, ICS Daniel Hein Universität Siegen Institut
Die fossilen Energiequellen sind endlich. Wind, Sonne, Erdwärme, Gezeiten und Nachwachsende Rohstoffe sind die künftigen Energieressourcen.
 Globale Herausforderungen Experten warnen seit mehr als 30 Jahren Bei den Menschen und der Politik hat sich die Erkenntnis erst seit wenigen Jahren durchgesetzt: Begrenzte energetische Ressourcen Wir stehen
Globale Herausforderungen Experten warnen seit mehr als 30 Jahren Bei den Menschen und der Politik hat sich die Erkenntnis erst seit wenigen Jahren durchgesetzt: Begrenzte energetische Ressourcen Wir stehen
Wie grüner BUND-Regionalstrom die Landschaftspflege fördert
 Wie grüner BUND-Regionalstrom die Landschaftspflege fördert DVL-Tagung Biogas aber natürlich Schwäbisch Hall, 8. Juli 2014 Was macht der BUND in Ravensburg? BUND-Ortsgruppe seit 1982 Naturschutzzentrum
Wie grüner BUND-Regionalstrom die Landschaftspflege fördert DVL-Tagung Biogas aber natürlich Schwäbisch Hall, 8. Juli 2014 Was macht der BUND in Ravensburg? BUND-Ortsgruppe seit 1982 Naturschutzzentrum
Zwischenfruchtanbau als ein Beitrag zum Gewässerschutz im Energiepflanzenanbau
 Zwischenfruchtanbau als ein Beitrag zum Gewässerschutz im Energiepflanzenanbau Gunter Ebel 1/2, Jens Eckner 3, Ernst Walter 4, Daniela Zander 5, Carsten Rieckmann 6 1 Leibniz-Institut für Agrartechnik
Zwischenfruchtanbau als ein Beitrag zum Gewässerschutz im Energiepflanzenanbau Gunter Ebel 1/2, Jens Eckner 3, Ernst Walter 4, Daniela Zander 5, Carsten Rieckmann 6 1 Leibniz-Institut für Agrartechnik
EEG 2012: Eckpunkte des Referentenentwurfs
 EEG 2012: Eckpunkte des Referentenentwurfs biogaspartner das podium am 6. Juni 2011 in Berlin Rechtsanwalt Hartwig von Bredow Schnutenhaus & Kollegen Reinhardtstraße 29 B, 10117 Berlin Tel.: (030) 25 92
EEG 2012: Eckpunkte des Referentenentwurfs biogaspartner das podium am 6. Juni 2011 in Berlin Rechtsanwalt Hartwig von Bredow Schnutenhaus & Kollegen Reinhardtstraße 29 B, 10117 Berlin Tel.: (030) 25 92
Biomasse im EEG Hintergrundpapier zur Situation der Bestandsanlagen in den verschiedenen Bundesländern. Mattes Scheftelowitz Daniela Thrän
 Biomasse im EEG Hintergrundpapier zur Situation der Bestandsanlagen in den verschiedenen Bundesländern Mattes Scheftelowitz Daniela Thrän DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH In
Biomasse im EEG Hintergrundpapier zur Situation der Bestandsanlagen in den verschiedenen Bundesländern Mattes Scheftelowitz Daniela Thrän DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH In
Mehrfachantrag 2015 Ökologische Vorrang-Flächen
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mehrfachantrag 2015 Ökologische Vorrang-Flächen Greening - Grundlagen Greening erfordert: Anbaudiversifizierung Dauergrünlanderhalt
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mehrfachantrag 2015 Ökologische Vorrang-Flächen Greening - Grundlagen Greening erfordert: Anbaudiversifizierung Dauergrünlanderhalt
Biomassenutzung. Dipl.-Ing. Matthias Funk
 Biomassenutzung Dipl.-Ing. Matthias Funk Agenda Was ist Biomasse? Biomassenutzung Biomassepotenzial im LK Gießen Biomassenutzung am Beispiel Queckborn Vergleich verschiedener Heizsysteme Fazit Was ist
Biomassenutzung Dipl.-Ing. Matthias Funk Agenda Was ist Biomasse? Biomassenutzung Biomassepotenzial im LK Gießen Biomassenutzung am Beispiel Queckborn Vergleich verschiedener Heizsysteme Fazit Was ist
Bioenergie soll unsere Bodenseelandschaft nicht monotoner sondern vielfältiger gestalten. Bioenergie der Alleskönner. Bioenergie - Made in Germany
 Bioenergie der Alleskönner Bioenergie ist gespeicherte Sonnenenergie. Pflanzen wandeln durch Photosynthese die Energie der Sonne in Biomasse um. Diese können wir dann wieder nutzen: als Strom, Wärme oder
Bioenergie der Alleskönner Bioenergie ist gespeicherte Sonnenenergie. Pflanzen wandeln durch Photosynthese die Energie der Sonne in Biomasse um. Diese können wir dann wieder nutzen: als Strom, Wärme oder
Workshop Gruppe 5 Agrarproduktion
 Multifunktionalität und Zielkonflikte 4-F oder 5-F für Österreich ( Lebensmittelmarkt ) Food ( Futtermittelproduktion ) Feed ( Rohstoffe Fibre (Industrielle ( Verwertung (Fire) (Thermische ( Treibstoffe
Multifunktionalität und Zielkonflikte 4-F oder 5-F für Österreich ( Lebensmittelmarkt ) Food ( Futtermittelproduktion ) Feed ( Rohstoffe Fibre (Industrielle ( Verwertung (Fire) (Thermische ( Treibstoffe
NEBrA Nachhaltige Energieversorgung durch Biomasse aus regionalem Anbau
 NEBrA Nachhaltige Energieversorgung durch Biomasse aus regionalem Anbau 1. Warum Pellets? 2. Warum nicht ausschließlich Holzpellets? 3. Alternativen? 4. Biomischpellets Anforderungen Rohstoffe Forschung
NEBrA Nachhaltige Energieversorgung durch Biomasse aus regionalem Anbau 1. Warum Pellets? 2. Warum nicht ausschließlich Holzpellets? 3. Alternativen? 4. Biomischpellets Anforderungen Rohstoffe Forschung
Biogaspotential für Agroindustrielle Reststoffe in Kenia
 Biogaspotential für Agroindustrielle Reststoffe in Kenia Thomas Schmidt PEP-Informationsveranstaltung Energie aus Biogas und Biomasse - Marktchancen in Kenia, 22. Mai 2014 Einführung Hintergrund 2009 wurde
Biogaspotential für Agroindustrielle Reststoffe in Kenia Thomas Schmidt PEP-Informationsveranstaltung Energie aus Biogas und Biomasse - Marktchancen in Kenia, 22. Mai 2014 Einführung Hintergrund 2009 wurde
Die neuen Cross-Compliance- Anforderungen zum Erosionsschutz
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Die neuen Cross-Compliance- Anforderungen zum Erosionsschutz Hinweise zum Verfahren Dr. P. Gullich (TLL) Dr. R. Bischoff (TLUG) Jena, Juli 2010 Thüringer Ministerium
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Die neuen Cross-Compliance- Anforderungen zum Erosionsschutz Hinweise zum Verfahren Dr. P. Gullich (TLL) Dr. R. Bischoff (TLUG) Jena, Juli 2010 Thüringer Ministerium
Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014
 Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014 Greening ein neues Instrument der EU-Agrarpolitik Uta Maier (TLL) Jena, 17.06.2013 TLL Kolloquium Wirtschaftliche Lage / Aktuelle Fragen der Agrarpolitik
Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014 Greening ein neues Instrument der EU-Agrarpolitik Uta Maier (TLL) Jena, 17.06.2013 TLL Kolloquium Wirtschaftliche Lage / Aktuelle Fragen der Agrarpolitik
Rahmenbedingungen für die Bioenergie in Deutschland. Dr. Steffen Beerbaum, BMELV
 Standbild Rahmenbedingungen für die Bioenergie in Deutschland Dr. Steffen Beerbaum, BMELV Allgemeine Rahmenbedingungen Energieverbrauch 14.200 PJ Primärenergieverbrauch in Deutschland (2005) entspricht
Standbild Rahmenbedingungen für die Bioenergie in Deutschland Dr. Steffen Beerbaum, BMELV Allgemeine Rahmenbedingungen Energieverbrauch 14.200 PJ Primärenergieverbrauch in Deutschland (2005) entspricht
Biomasseverwertungszentrum Region Wolfsburg
 Handlungsmotivation: Erschließung von regional verfügbaren Biomassen unterschiedlichster Art zur energetischen und stofflichen Nutzung Nutzung von Synergien bei der Zusammenführung von Stoffströmen Substituierung
Handlungsmotivation: Erschließung von regional verfügbaren Biomassen unterschiedlichster Art zur energetischen und stofflichen Nutzung Nutzung von Synergien bei der Zusammenführung von Stoffströmen Substituierung
Energielandschaft Morbach: Energieregion
 : Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
: Energieregion 1957-1995 1957-1995 1995 Vorteile der 145 ha großen Fläche: - relativ hoher Abstand zu Orten (1.000 m) - Gelände seit 50 Jahren nicht zugänglich (kein Nutzungskonflikt) - sehr gute Erschließung
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein
 Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Leiterin des Fachgebiets Erneuerbare Energien,
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Aktuelle Herausforderungen der naturverträglichen Erzeugung Erneuerbarer Energien Kathrin Ammermann Bundesamt für Naturschutz Leiterin des Fachgebiets Erneuerbare Energien,
Biomasseanbau Anforderungen aus Sicht eines Umweltverbandes
 Biomasseanbau Anforderungen aus Sicht eines Umweltverbandes Biomasse die Chance mit Umsicht nutzen! Axel Kruschat BUND Brandenburg 9.10.2008 BUND-Prämissen: Wir brauchen umweltverträglich erzeugte Biomasse
Biomasseanbau Anforderungen aus Sicht eines Umweltverbandes Biomasse die Chance mit Umsicht nutzen! Axel Kruschat BUND Brandenburg 9.10.2008 BUND-Prämissen: Wir brauchen umweltverträglich erzeugte Biomasse
Der Landschaftspflegebonus in der Praxis Wie entscheiden Umweltgutachter?
 Der Landschaftspflegebonus in der Praxis Wie entscheiden Umweltgutachter? Konferenz Energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial Berlin, 01.03.2011 Dr. Wolfgang Peters Büro Herne Kirchhofstr. 2c
Der Landschaftspflegebonus in der Praxis Wie entscheiden Umweltgutachter? Konferenz Energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial Berlin, 01.03.2011 Dr. Wolfgang Peters Büro Herne Kirchhofstr. 2c
Was ist multifunktionale Landwirtschaft?
 Was ist multifunktionale Landwirtschaft? Landwirtschaft, die: Rohstoffe und Lebensmittel produziert Kulturlandschaft gestaltet und erhält Vielfältige natürliche Lebensräume gestaltet und erhält Ausgleichsräume
Was ist multifunktionale Landwirtschaft? Landwirtschaft, die: Rohstoffe und Lebensmittel produziert Kulturlandschaft gestaltet und erhält Vielfältige natürliche Lebensräume gestaltet und erhält Ausgleichsräume
UMSETZUNGSKONZEPT ZUR SCHAFFUNG EINES REGIONALEN NETZWERKES ZUR ENERGETISCHEN VERWERTUNG VON BIOMASSE AUS DER LANDSCHAFTSPFLEGE IM ERZGEBIRGSKREIS
 UMSETZUNGSKONZEPT ZUR SCHAFFUNG EINES REGIONALEN NETZWERKES ZUR ENERGETISCHEN VERWERTUNG VON BIOMASSE AUS DER LANDSCHAFTSPFLEGE IM ERZGEBIRGSKREIS Christof Thoss, Andy Paul LPV Zittauer Gebirge e.v. e.v.
UMSETZUNGSKONZEPT ZUR SCHAFFUNG EINES REGIONALEN NETZWERKES ZUR ENERGETISCHEN VERWERTUNG VON BIOMASSE AUS DER LANDSCHAFTSPFLEGE IM ERZGEBIRGSKREIS Christof Thoss, Andy Paul LPV Zittauer Gebirge e.v. e.v.
