Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges
|
|
|
- Irma Hummel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bericht über das Projekt Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges am Campe-Gymnasium Holzminden 2010/11 mit Schülerinnen und Schülern des Doppeljahrganges 12/13 Die Fotografien sind von Jürgen Neumann u. Bastian Blume, Projektteilnehmern gemacht. StR Hans-Joachim Sach Campe-Gymnasium Holzminden Schneckenbergstr Holzminden Tel
2 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 2 Inhaltsverzeichnis 1. Ein lokalhistorisches Schülerprojekt zum Thema Holzmindener Opfer im Ersten und Zweiten Weltkrieg Das Kurzprofil des Campe-Gymnasiums Die Entstehung des Projekts Die Ursprungszielsetzung des Friedhofprojektes Die Zusammensetzung der Projektgruppe und ihre Bedingungen Bericht über den Projektverlauf Die Einführungsphase in das Projekt Der Gruppenarbeitsprozess zu den Grundlagentexten für die Erinnerungsund Gedenktafeln Der Erstellungsprozess einer Plakatausstellung zu den Opfergruppen Die Vorbereitung der Präsentation der Erinnerungs- und Gedenktafeln, sowie der Plakatausstellung der Kursteilnehmer Bewertung der erzielten Ergebnisse des Projekts Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Bewertung des Schülerinnen und Schülereinsatzes Bewertung des Lehrereinsatzes Literaturverzeichnis Anhang... 13
3 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 3 1. Ein lokalhistorisches Schülerprojekt zum Thema Holzmindener Opfer im Ersten und Zweiten Weltkrieg Warum könnte es sinnvoll sein, einen elektronischen Stadtführer für seine Stadt zu produzieren? Und in welchem Rahmen könnte so ein nicht einfaches Unterfangen von Erfolg gekrönt werden? Beide Fragen werden nun im Rahmen der Bewerbung für den Jahrespreis der Henning von Burgsdorff-Stiftung vom Verfasser beantwortet. Zuerst konzeptuell, dann mithilfe der Durchführung des Projektes und schließlich wird noch eine Bewertung der Schülerprodukte vorgenommen Das Kurzprofil des Campe-Gymnasiums Das Campe-Gymnasium Holzminden ist das einzige öffentliche, allgemeinbildende Gymnasium im Landkreis und in der Stadt Holzminden. Es liegt in Südniedersachsen. Sein Schwerpunkt ist heute der naturwissenschaftliche Bereich, weil hier z.b. der Weltkonzern Symrise seinen Sitz hat, der Duft- und Geschmackstoffe produziert und international exportiert. Da aber der bisherige Schulleiter, Herr Keese, Historiker ist, werden auch Geschichtsprojekte wie das im Folgenden dargelegte - unterstützt. Unsere Schülerzahl betrug zum Zeitpunkt des Projektes mehr als 1000 Kinder- und Jugendliche. Wir sind seit einem Jahr Ganztagsschule, damit auch Schülerinnen und Schüler mit sozialen Problemen besser gefördert werden können. Siebzig Lehrerinnen und Lehrer sind hier im Einsatz. Weil Holzminden seit 1913 mit einer kurzen Unterbrechung Garnisonsstadt war, spielt das Thema Gewalt und Rassismus natürliche auch in der Provinz eine Rolle. Auch wenn der Anteil der muslimischen Schülerinnen und Schüler bei uns gering ist, gibt es sie. Ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus Elternhäusern mit Migrationshintergrund, z.b. aus Kasachstan oder sind noch vor dem Mauerfall aus der ehemaligen DDR hier her geflüchtet. In unserer Stadt gab es schon seit 1557 Juden und ab dem 19. Jahrhundert eine jüdische Synagoge. Das NS-Stadtregiment sorgte seit 1933 für die vollständige Beseitigung jüdischen Lebens im Kreis und Stadtgebiet. Auch am Campe-Gymnasium war die Mehrheit der Lehrer und Schülerschaft nationalsozialistisch eingestellt Die Entstehung des Projekts Auf dem Friedhof Allersheimer Straße gibt es über 500 Gräber von Opfern des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die aber vor dem Projekt für die Friedhofsbesucher nicht eindeutig als Opfer wahrnehmbar waren. Aus diesem Grunde entstand eine gemeinsame Initiative der Lutherkirche, die den Friedhof verwaltet, des Heimat- und Geschichtsvereins Holzminden e.v., damals vertreten durch Herrn Detlef Creydt, der die Geschichte der Zwangs-
4 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 4 arbeiter in Holzminden aufgearbeitet hatte, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v., vertreten durch Klaus-Volker Kempa und Gerald Dütschke, Vorsitzende des Kreisverbandes Holzminden, aber auch deren Schulreferentin Anett Schweitzer und des Campe-Gymnasiums am 22. September Die Geschichte der Holzmindener Opfer der beiden Weltkriege sollte für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wieder erkennbar werden Die Ursprungszielsetzung des Friedhofprojektes Damit dieses o.g. Hauptziel möglich würde, wollte die Initiative eine Erinnerungs- und Gedenktafel neben der Friedhofskapelle errichten, um auf die Opfer beider Weltkriege lokalhistorisch aufmerksam zu machen. Dazu sollte ein Geschichtskurs am Campe- Gymnasium den Grundlagentext liefern, der dann von einer Expertengruppe überarbeitet würde, um schließlich als eine Geschichts- und Erinnerungstafel auf die Opfer aufmerksam zu machen. Die Schulreferentin des Volksbundes, Frau Schweitzer, sollte das Projekt beratend begleiten und die Endredaktion der Tafeln leiten, aber auch dafür sorgen, dass Sponsoren die Tafeln und ihr Aufstellen finanzieren. Der Verfasser, Studienrat Hans-Joachim Sach, Geschichts- und Religionslehrer am Campe-Gymnasium sollte Schülerinnen und Schüler finden, die freiwillig ein Jahr sich mit den Opfergeschichten historisch auseinandersetzten, um allgemein und lokalhistorische Grundlagentexte für die Entstehung der Erinnerungs- und Gedenktafel zu liefern. Dazu sollten die Schülerinnen und Schüler mit dem Stadtarchivar, Herrn Dr. Seeliger, zusammenarbeiten, um Quellen- und Literaturmaterial ausfindig zu machen und die Geschichte der Opfer wiederaufleben zu lassen Die Zusammensetzung der Projektgruppe und ihrer Bedingungen Durch Werbung gelang es dem Verfasser 22 Schülerinnen und Schüler aus drei Grundkursen Geschichte für dieses Projekt zu gewinnen. Sie gehörten alle zum Doppeljahrgang, d.h. entweder zum 11. oder 12. Jahrgang des Campe-Gymnasiums. Da sich die Kursteilnehmer freiwillig meldeten, war ihre Motivation wesentlich größer als wenn sie einen normalen Geschichtskurs besuchten. Der Kurs hatte nur das Schuljahr 2010/2011 Zeit, um die o.g. Grundlagentexte zu liefern. Die Kurteilnehmer hatten jeweils wöchentlich zwei Mittwochsnachmittagsstunden zur Verfügung. Da es sich um einen normalen Grundkurs handelte mussten mündliche Noten gegeben werden und pro Halbjahr eine zweistündige Klausur geschrieben werden. Die
5 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 5 Arbeitsbereitschaft ist normalerweise im Grundkurs nicht sehr hoch, deshalb war die Freiwilligkeit in diesem Fall sehr wichtig, denn die Kursteilnehmer mussten außerhalb der Kurszeit selbstständig das Stadtarchiv, das Archiv des Landschulheims in Holzminden und vor allem den Friedhof besichtigen, um die Quellen für ihre Teilaufgabe zu finden. 2. Bericht über den Projektverlauf In den folgenden vier Schritten legt der Verfasser nun kurz den Verlauf des Projekts dar. Nach einer sechsstündigen Einführungsphase folgten zwei Gruppenarbeitsprozesse. Als zweiter Schritt wurden die Grundlagentexte produziert und danach sieben Ausstellungsplakate. Zum Schluss musste der Kurs seine Präsentationsaufgaben für die Vorstellung der neu entstandenen Geschichts- und Erinnerungstafeln für den 11. Mai 2011 vorbereiten Die Einführungsphase in das Projekt Zur ersten Orientierung wurde den Kursteilnehmern mithilfe eines Auszuges der von Paul Kretschmer 1984 geschriebenen Stadtgeschichte einen Einblick in die Kriegsereignisse des Ersten und Zweiten Weltkrieges auf lokalhistorischer Ebene 1 gewährt. Da die Kursteilnehmer auch einen internationalen Überblick bekommen mussten wurden kostengünstige, wissenschaftlich hochwertige Informationen zur politischen Bildung 2 als Lektüre ausgegeben. Die den Schülerinnen und Schülern ausgehändigte Literaturliste 3 finden Sie im Anhang. Um die Komplexität des Themas zu verstehen, aber auch den Einstieg spannend zu gestalten, entschied sich der Verfasser drei Experten in den Unterricht einzuladen. Der Friedhof Allersheimerstraße befindet sich in kirchlicher Hand. Der zuständige Pfarrer i.r. Rüdiger Schmidt hatte den Artikel Der jüdische Friedhof in Holzminden 4 geschrieben. Er brachte eine Liste aller Opfergruppen, die auf dem Friedhof lagen, mit. Außerdem zeigte er den Kursteilnehmern die verschiedenen Gräberfelder und die alte Friedhofskapelle, in der er ein Gedenkbuch für die Opfer der beiden großen Weltkriege in Holzminden ausgelegt hatte. Er berichtete darüber, wie er zu Familienangehörigen der Opfer Kontakt aufnahm und ihnen half, das Grab ihrer Verstorbenen zu finden. 1 Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden wie sie wurde, was sie ist, Holzminden 1984, S u Thamer, Hans-Ulrich: Das Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg, in: Diehl, Elke u. Faulenbach, Jürgen: Nationalsozialismus II. Führerstaat und Vernichtungskrieg, in: Informationen zur politischen Bildung 266/2000 (Neudruck 2004), S Siehe Anhang unter M 1. 4 Schmidt, Rüdiger: Der Friedhof in Holzminden, in: Zwangsarbeit für Rüstung, Landwirtschaft und Forsten im Oberwesergebiet , Bd. 3, hg. von Detlef Creydt, Holzminden 1995, S
6 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 6 Detlef Creydt gab eine allgemeine Einführung in die Zwangsarbeit im Dritten Reich und wie diese in Holzminden durchgeführt wurde. Heute sind auf dem o.g. Friedhof zwar vorwiegend Gräber von osteuropäischen Zwangsarbeitern zu finden, weil die verstorbenen westeuropäischen Zwangsarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg meistens in ihre Heimatorte überführt worden sind. In Holzminden gab es mindestens 18 Zwangsarbeiterlager, in den vor allem osteuropäische Zwangsarbeiter den Tod fanden. Über die jüdischen Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges in Holzminden referierte Klaus Kieckbusch, der das Buch Von Juden und Christen in Holzminden 5 geschrieben hatte. Weil es direkt an den Friedhof Allersheimer Straße seit dem Ende 19. Jahrhundert einen jüdischen Friedhof gab, lag die Vermutung nahe, dass es auch dort Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges geben könnte. Bisher wurden die drei o.g. Themenkomplexe in Holzminden getrennt voneinander bearbeitet. Durch die Vortragsreihe wurden die Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Zwangsarbeiter und die verfolgten Juden in Holzminden als ein Thema erkennbar: Opfer von Krieg und Gewalt. Zwei Holzmindener Besonderheiten sind, dass es Bombenangriffe mit Opfern in Holzminden gab und dass ungarische Flüchtlinge, die sich in einer zum Lazarett umgewandelten Privatschule aufhielten, in den Jahren 1945 bis 1946 umkamen. Zentrale Informationen zu den Bombenopfern liefert das Buch von Detlef Creydt über den Luftkrieg im Weserbergland 6 Für die ungarischen Lazarettopfer gibt es nur Quellen im Archiv der Privatschule Landschulheim Der Gruppenarbeitsprozess zu den Grundlagentexten für die Erinnerungsund Gedenktafeln Aus der Einführungsphase ergaben sich folgende Opfergruppen: 1. Jüdische Opfer, 2. westeuropäische und osteuropäische Zwangsarbeiter, 3. Bombenopfer, 4. Ungarische Lazarettopfer, 5. Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die Kursteilnehmer ordneten sich nach eigenen Interessen einer der fünf Opfergruppen zu, sodass Untergruppen - aus zwei bis vier Kursteilnehmern bestehend - entstanden. Jede Gruppe hatte nun den Auftrag ihr Gräberfeld auf dem Friedhof zu erforschen und nach weiteren Quellen im Stadtarchiv oder im Landschulheim zu suchen. Nachdem die Gruppe mindestens zwei bis drei Literaturtexte oder Quellen zum jeweiligen Unterthema gefunden hatte, wurde der Inhalt exzerpiert und den andern Gruppenteilnehmern vorgetra- 5 Kieckbusch, Klaus: Von Juden und Christen in Holzminden Ein Geschichts- und Gedenkbuch, Holzminden 1998.
7 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 7 gen. Im nächsten Schritt wurde jeweils ein kurzer Text zur eigenen Opfergruppe formuliert. Dabei musste die Gruppe darauf achten, dass zuerst die allgemeine politische Situation während der beiden Weltkriege dargestellt werden sollte. Danach wurde die Besonderheit der Opfer in Holzminden hervorgehoben. Mindestens ein Fallbespiel sollte kurz geschildert werden. Zum Schluss sollte eine Bewertung oder Beurteilung der Holzmindener Ereignisse erfolgen. Wer das Glück hatte, ein Zeitzeugeninterview zu bekommen, dem wurde methodisch die Vorgehensweise erklärt. Die daraus entstandenen Schülertexte für fünf Opfergruppen sind im Anhang unter M 2-6 einsehbar. Die westeuropäischen Zwangsarbeiter wurden zwar behandelt, da aber keine sichtbaren Grabsteine mehr nachweisbar sind, tauchen sie auf den beiden von den Kursteilnehmern erstellten großen Tafeln auf. Diese sind ebenfalls als Schülerprodukte im Anhang unter M 7 eingefügt, weil alle genannten Texte bei Frau Schweitzer, VdK Hannover, als erste Grundlage für die Erinnerungs- und Gedächtnistafeln dienten. Nach dem die Texte bei Frau Schweitzer eingereicht wurden, dienten sie als Arbeitsgrundlage für ein Expertenteam, dass nun entscheiden musste, was auf die Erinnerungs- und Gedächtnistafel kommen sollte. Da aber der Verfasser im Verlauf des Gruppenprozesses erkannte, dass aufgrund der verschiedenen Gräberfelder ein Friedhofspädagogischer Pfad entstehen könnte, der Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule, aber auch der beiden Gymnasien in Holzminden nützen könnte, regte er mithilfe des in M 8 abgedruckten Friedhofspädagogischen Konzeptes an, dass fünf kleine Tafeln und eine beidseitig begehbare große Tafel bei der Kapelle entstehen sollten, denn damit könnte Lokalgeschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges an einem außerschulischen Ort unterrichtet werden. Besonders Herr Kempa, Vorsitzende des Kreisverbandes Holzminden, unterstützte diese Idee. Zusammen mit ihm stellte der Verfasser die Idee eines Friedhofpädagogischen Pfades im Kulturausschuss der Stadt Holzminden vor. Der Bürgermeister, aber auch die Ausschussmitglieder waren von der Idee begeistert und sicherten ihre Unterstützung zu. Die Stadt Holzminden stiftete das Fundament für die Tafeln. In mehreren Gesprächen mit dem zuständigen Pfarrer und der nachfolgenden Pfarrerin der Luthergemeinde motivierte der Verfasser mithilfe von Herrn Pfarrer i.r. Schmidt die Kirchengemeinde den größten Teil der Finanzierung der Tafeln zu übernehmen. Sowohl der VdK als auch das Campe-Gymnasium Holzminden beteiligten sich finanziell an der Tafelproduktion. Der Betrag des Campe-Gymnasiums war nur gering, aber hatte symbolischen Charakter. 6 Creydt, Detlef: Luftkrieg im Weserbergland. Eine Chronologie der Ereignisse, Holzminden 2007.
8 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Der Erstellungsprozess einer Plakatausstellung zu den Opfergruppen Während die Expertengruppe die wissenschaftliche Endredaktion vollzog, produzierten die Schülerinnen und Schüler die Plakatausstellung mit dem Titel Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die aus sieben Plakaten im A 1 Format bestand. Dort wurden gemäß den drei Anforderungsbereichen des EPA den folgenden Opfergruppen gedacht: 1. Jüdische Opfer, 2. Osteuropäische Zwangsarbeiter, 3. Westeuropäischer Zwangsarbeiter, 4. Ungarische Lazarettopfer, 5. Bombenopfer, 6. Gefallene Soldaten des Ersten und 7. des Zweiten Weltkrieges. Da nicht alle Kursteilnehmer mit der PC-Software für die Plakaterstellung zurechtkamen und der Kurs die Corporate Identity beachten wollte, wurden zwei Layout-Spezialisten bestimmt, die ein Plakatgrunddesigne entwickelten. Dies besteht aus dem Titel der Ausstellung, einem Panoramastreifen, der aus Fotos der jeweiligen Gräberfelder besteht der Fußzeile, in der Angaben zu den Produzenten, Quellen und das Campe-Logo zu finden sind. Im Hintergrund wurde das Gräberfeld der jeweiligen Opfergruppe als grauer Hintergrund produziert. Die Fotographien schoss eine Kursteilnehmerin. Der Panoramastreifen und die Überschrift, aber auch die Fußzeile lassen sofort erkennen, dass es sich um eine einheitlich gestaltete Ausstellung handelt. Die opferspezifischen Fotos und die Unterschriften charakterisieren das spezifische Unterthema. Diese Ausstellung bildete am Präsentationstag den krönenden Abschluss. Die vollständige Plakatausstellung finden Sie in der beigefügten CD Die Vorbereitung der Präsentation der Erinnerungs- und Gedenktafeln, sowie der Plakatausstellung der Kursteilnehmer Die toten Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges mahnen die Lebenden zum größtmöglichen gewaltfreien, demokratischen und toleranten Umgang mit anderen. Dies ist nicht nur eine säkulare Aussage. Wer der toten Opfer gedenkt, der erahnt, dass Frieden auch eine geistliche Dimension hat. Deshalb legte der Verfasser besonderen Wert darauf, dass zu Beginn der Präsentationsveranstaltung eine Andacht stattfinden sollte. Der Posaunenchor unter der Leitung von des sich im Ruhestand befindlichen Religionslehrers Grote war sofort bereit die Andacht musikalisch zu begleiten. Frau Pfarrerin Bode bereitete eine engagierte Friedensandacht vor. Für die Kursteilnehmer bestand ihre letzte Aufgabe darin, die redigierten Erinnerungs- und Gedächtnistafeln in einem Friedhofsrundgang zu präsentieren. Dazu bereiteten sie in Partner- und Gruppenarbeit kleine Vorträge zum Inhalt der Geschichts- und Erinnerungstafeln
9 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 9 vor. Bei einer Probe auf dem Friedhof wurde der genaue Rundgang zusammen mit Frau Schweitzer, VdK Hannover, festgelegt. Zusammen mit Frau Schweitzer plante der Verfasser den im Anhang unter M 9 beigefügten Ablauf zur Einweihung der Erinnerungs- und Gedächtnistafeln auf dem Friedhof Allersheimer Straße. Die Einladungen wurden vom Kreisvorsitzenden des VdK, Herrn Kempa verschickt. Auch diese ist dem Anhang unter M 10 beigefügt. 3. Bewertung der erzielten Ergebnisse des Projekts Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Im Folgenden wird eine differenzierte Bewertung des Schüler- und Lehrereinsatzes vorgenommen. Als Bewertungsmaßstäbe wird das Augenmerk auf den Zeitaufwand und das Engagement gelegt, weil der erste Maßstab oft Schüler und Kollegen abschreckt und der zweite dazu dient, sich trotzdem auf die schwierige Reise zu machen. Aber zuerst wird die Sprachfähigkeit der Kursteilnehmer bewertet Bewertung des Schülerinnen und Schülereinsatzes Beim Vergleich der Schülerbeiträge mit dem von der Expertengruppe und dem VdK abgesegneten Endprodukt, das im Anhang unter M 11 eingesehen werden kann, fällt auf, dass die Opfergruppen teilweise anders benannt wurden. Statt Bombenopfer steht nun Opfer der Luftangriffe im Frühjahr 1945 oder statt Osteuropäische Zwangsarbeiter Unter nationalsozialistischer Herrschaft verstorbene Zwangsarbeiter/innen. Die Expertengruppe kritisierte die heutigen Sprachmängel der Schülerinnen und Schüler, deshalb formulierte die Expertengruppe differenzierter. Sie führten Sprachverbesserungen durch, wie man aus den beiden Überschriftbeispielen entnehmen kann. Schüler, die einen sogenannten Abdeckerkurs am Campe-Gymnasium besuchen, bringen sprachliche Schwächen mit. Dazu kommt noch, dass ihnen ein Jahr Sprachschulung fehlt, weil es sich hier teils um Kursteilnehmer handelt, die nur 11 Jahre Deutschunterricht genossen haben. Bedeutender bei der Bewertung ihrer Leistung ist aber, dass sie freiwillig einen wesentlich größeren Zeitaufwand in Kauf nahmen, weil sie die Opfergeschichten interessierten. Neben den zwei Schulstunden besuchten sie die beiden Archivare Vorort und lasen sich in Quellen und Literatur ein. Da es sich hier um Nicht-Historiker handelt und der Geschichtsunterricht teilweise gekürzt wurde, muss das freiwillige Engagement besonders hervorgehoben werden. Dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Abiturphase und nach ihrem Abitur die Präsentation erfolgte zwischen Schriftlichem und Mündlichem einen solchen Einsatz zeigten, war nicht zu erwarten.
10 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 10 Die Beschäftigung mit Opfern der beiden Weltkriege und die Aussicht, dass man mithilft, dass nachfolgende Schülergenerationen neue Möglichkeiten des außerschulischen Lernens eröffnet wird, motivierte diese Schülergruppe, mehr Zeit aufzuwenden als üblich. Was die Expertengruppe anfangs unterschätzte, war die Bedeutung des biografischen Ansatzes dieses Projektes. Die Kursteilnehmer bemühten sich, durch exemplarische Beispiele die Opfergeschichten zum Leben zu erwecken. Besonders gut ist das der Bombenopfergruppe bei ihrem Vortrag gelungen, weil sie ein Zeitzeugeninterview mit einem Opa eines Kursteilnehmers nacherzählten, das die Zuhörer persönlich berührte. Schwierig gestaltete sich die Gedenktafel für die jüdischen Opfer, weil diese durch Emigration oder Vernichtung in Konzentrationslager während der NS-Zeit starben und nicht auf dem jüdischen Friedhof bestattet sind. Hier liegen nur 17 während des Ersten Weltkrieges internierte Juden, deren Einzelschicksale unbekannt sind. Außerdem musste die Erlaubnis für die Aufstellung einer kleinen Tafel auf dem jüdischen Friedhof vom Landesverband der Juden eingeholt werden. Hier wurde das eingereichte Schülerprodukt von der Expertengruppe vollständig ablehnt, sodass eine andere Tafel entstand. Die Endprodukte der Geschichts- und Erinnerungstafeln Holzminden sind im Anhang unter M 12 einsehbar Bewertung des Lehrereinsatzes Gerade die kleine Tafel zu den jüdischen Opfern lag dem Verfasser sehr am Herzen, denn ein Lehrpfad für Schüler zu den Opfern des Zweiten Weltkrieges wäre ohne die Erinnerung an die jüdischen Opfer nicht denkbar gewesen. Herr Kieckbusch, der Experte für jüdische Geschichte in Holzminden, verwies Frau Schweitzer auf den Gedenkstein im Katzensprung, dort seien die wichtigsten Namen jüdischer Opfer des Nationalsozialismus bereits genannt, deshalb könnte man auf eine Tafel an dieser Stelle verzichten. Aber will man als Lehrer mithilfe der sieben Tafeln die Opfer beider Weltkriege lokalhistorisch in Gruppenarbeit handlungsorientiert, selbstständig erarbeiten lassen, dann dürfen die jüdischen Opfer der NS-Barbarei nicht fehlen. Der Zeitaufwand des Verfassers war in diesem Fall höher als sonst, weil er zusätzlich an Sitzungen der Initiative teilnehmen und Gespräche mit Pfarrer Cohring und seiner Nachfolgerin Bode führen musste. Eingangs musste die Vortragsreihe organisiert werden. Pfarrerin Bode und Herr Kempa besuchten den Unterricht, um sich über den Stand der Produkte zu informieren. Frau Schweitzer begleitete das Projekt und kam mehrmals in den Unterricht, um von der Weiterentwicklung zu berichten. Das Friedhofspädagogische Konzept entstand und der -Verkehr nahm zu, damit die gemeinsamen Termin abgestimmt werden konnten.
11 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 11 Trotzdem war der Zeitaufwand gerechtfertigt, weil nun in Zukunft der Unterricht zu den Themen Erster und Zweiter Weltkrieg anschaulich und motivierender gestaltet werden kann. Der lokalhistorische Zugang ermöglicht einen schnelleren und spannenderen Zugang zu den Themen. Der außerschulische Lernort ist schnell erreichbar und die Stadtidentität wird gefördert. Leider konnte der Verfasser sich mit der Idee der Überführung der beiden umstrittenen Gedenktafeln an die gefallenen Schüler und Lehrer in beiden Weltkriegen aus der Aula des Campe-Gymnasiums in die Friedhofskapelle nicht durchsetzen. Diese wäre ein geeignetes Scharnier zwischen Schule und Friedhof gewesen, weil Schüler erkennen würden, dass damals Jugendliche in ihrem Alter in den Krieg ziehen mussten und starben. Aber der Verein der ehemaligen Schülerinnen und Schüler und Pfarrerin Bode verhinderten diese Translation. Die Leserbriefe von Eltern, dass die beiden Tafeln aus der Aula entfernt werden sollten, werden nun weiter geschrieben werden. Hier ist eine Chance verpasst worden, eine Brücke zwischen Schule und Friedhof zu bauen, die pädagogisch und historisch gut begründbar ist. Aus einer wenig benutzen alten Friedhofskapelle die meisten Beerdigungen finden in der neuen größeren Kapelle statt hätte im Rahmen der Einweihung der sieben Erinnerungstafeln eine Friedenskapelle werden können. Da Holzminden seit zwar mit Unterbrechung - Garnisonsstadt ist, hätte diese Umwandlung der Kapelle einen ethischen Nutzen sowohl für die Bürger unserer Stadt als auch für Christen, deren Herr zu Recht als Friedensfürst bezeichnet wird. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.v. würdigte das Engagement sowohl der beteiligten Schülerinnen und Schüler als auch ihres Lehrers, indem er in der Fußzeile der großen Geschichts- und Erinnerungstafel, die sich vor der alten Friedhofskapelle befindet, die Kursteilnehmer und ihren Leiter explizit benennt und auf die gute Kooperation hinweist. Außerdem lobte sowohl der Bezirksvorsitzende des Volksbundes Mönckemeyer als auch dessen Kreisvorsitzende Kempa den besonderen Einsatz der Schülerinnen und Schüler, damit die Opfer von Gewalt und Rassismus nicht vergessen werden. Unter M 11 können Sie den Bericht aus dem Täglichen Anzeiger Holzminden nachlesen. Der Verfasser bedankt sich bei der Geschäftsstelle Demokratisches Handeln, dass er persönlich aufgefordert wurde sein Projekt vorzustellen.
12 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Literaturverzeichnis Monographie Creydt, Detlef: Luftkrieg im Weserbergland. Eine Chronologie der Ereignisse, Holzminden Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden wie sie wurde, was sie ist, Holzminden Zeitschrift Thamer, Hans-Ulrich: Das Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg, in: Diehl, Elke u. Faulenbach, Jürgen: Nationalsozialismus II. Führerstaat und Vernichtungskrieg, in: Informationen zur politischen Bildung 266/2000 (Neudruck 2004), S Sammelband Zwangsarbeit für Rüstung, Landwirtschaft und Forsten im Oberwesergebiet , Bd. 3, hg. von Detlef Creydt, Holzminden Richtlinien Richtlinien für die Erstellung von Geschichts- und Erinnerungstafeln im Landesverband Niedersachen, Stand 2006, Hannover 2006.
13 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Anhang M 1 Vorläufiges Literaturverzeichnis Vorläufige Literaturliste für das Projekt Holzminden im Ersten und Zweiten Weltkrieg im Kurs 112 auf normalem Niveau, Campe-Gymnasium Holzminden, StR Hans- Joachim Sach Becker, Waldemar: Das Kriegsende 1945 in der Stadt Holzminden im Spiegel amerikanischer Berichte, in: Jahrbuch für den Landkreis Holzminden, hg. von Matthias Seeliger im Auftrag des Heimat- u. Geschichtsvereins des Landkreis u. Stadt Holzminden e.v., Bd. 26, Holzminden 2008, S Brenz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches, München [allgemeine Information] Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, hg. von Hermann Weiß (Fischer Taschenbuch, 13086), überarb. Neuausg., Frankfurt a.m [allgemeine Information] Gelderblom, Bernhard u. Kieckbusch, Klaus: Literatur zur Geschichte der Juden in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden, in: Fund-Stücke. Nachrichten u. Beiträge zur Geschichte der Juden in Niedersachsen u. Bremen (2003), S. 5. ( Screen.pdf) Gelderblom, Bernhard: Die Schicksale der jüdischen Friedhöfe des Weserberglandes seit ihrer Zerstörung bis heute, in: Fund-Stücke. Nachrichten u. Beiträge zur Geschichte der Juden in Niedersachsen u. Bremen (2003), S ( Screen.pdf) Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung Niedersachsen II. Regierungsbezirke Hannover und Weser-Ems, hg. vom Studienkreis zur Erforschung u. Vermittlung der Geschichte des Widerstandes , Bd. 3, Köln 1986, S Kieckbusch, Klaus: Von Juden und Christen in Holzminden Ein Geschichtsund Gedenkbuch, Holzminden Jahns, Werner: Kriegeserlebnisse von Schülern der Oberschule für Jungen in Holzminden, niedergeschrieben Ostern 1947, in: Jahrbuch für den Landkreis Holzminden, hg. von Matthias Seeliger im Auftrag des Heimat- u. Geschichtsvereins des Landkreis u. Stadt Holzminden e.v., Bd. 26, Holzminden 2008, S Thamer, Hans-Ulrich: Das Dritte Reich im Zweiten Weltkrieg, in: Diehl, Elke u. Faulenbach, Jürgen: Nationalsozialismus II. Führerstaat und Vernichtungskrieg, in: Informationen zur politischen Bildung 266/2000 (Neudruck 2004), S [allgemeine Information] Thamer, Hans-Ulrich: Nationalsozialistische Außenpolitik: Der Weg in den Krieg, in: Diehl, Elke u. Faulenbach, Jürgen: Nationalsozialismus II. Führerstaat und Vernichtungskrieg, in: Informationen zur politischen Bildung 266/2000 (Neudruck 2004), S [allgemeine Information] Zwangsarbeit für Rüstung, Landwirtschaft und Forsten im Oberwesergebiet , Bd. 3, hg. von Detlef Creydt, Holzminden Zwangsarbeit für Industrie und Rüstung im Hils , Bd. 4, hg. von Detlef Creydt, Holzminden Die Quellen wurden von Kursteilnehmern im Stadtarchiv, im Archiv des Landschulheims und auf dem Friedhof Allersheimerstraße gefunden. Das Fettgedruckte war die Einstiegslektüre.
14 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 14 M 2 Schülertext zu den Jüdische Opfern in Holzminden Jüdische Opfer von Lara Thevis, Lucas Sander, Lukas Kampioni, Jürgen Neumann Judentum in Deutschland von 1933 bis 1945 Vom Nationalsozialismus waren nicht nur Juden betroffen, sondern auch Menschen mit jüdischer Abstammung. Ebenso wurde eine Heirat mit einem Juden von der Rassenlehre des NS-Regimes erfasst. Im Rahmen dieser Lehre erfolgte eine Ausgrenzung und Diskriminierung dieser Personen. Sie wurden mit einem Judenstern gekennzeichnet. Ihre Rechte wurden durch Gesetze eingeschränkt. Ein Beispiel hierfür sind die Nürnberger Gesetze vom 15. September Völkermord durch den Nationalsozialismus Die Situation verschärfte sich durch die Beschlüsse der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar Nun war die Vernichtung der Juden das Ziel der Nationalsozialisten. Alle Betroffenen waren ab sofort einer großen Gefahr ausgesetzt. Einige wurden von der Gestapo überwacht. Sie konnten jederzeit in ein Konzentrationslager oder Vernichtungslager abtransportiert werden. Was sie dort erwartete, wird an einer Aussage eines Soldaten deutlich: Schon bei diesen Transporten kamen viele Menschen um." 38 Daraus lässt sich auch auf die Methoden in den Lagern selbst schließen. Die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten ist also verantwortlich für den Tod von ca. 6 Mio. Menschen. Im Nachhinein spricht man vom Holocaust. Aus dem Griechischen abgeleitet bedeutet dies: vollständig verbrannt. Verfolgung von Einwohnern Holzmindens Auch das Leben einiger Holzmindener wurde durch das NS-Regime beeinflusst. Sie wurden deportiert und dann nach einiger Zeit in den Konzentrationslagern oder Vernichtungslagern für tot erklärt. Eines dieser Lager war in Auschwitz. Unterernährung, sowie körperliche und geistige Misshandlung waren hier Todesursachen. Andere konnten dem psychischen Druck der "Vernichtungslager in Auschwitz Verfolgung nicht länger Stand halten und nahmen sich das Leben. "Judenstern o/objekte/pict/xx /index.html Ernst Frank und das Ehepaar Koch Beispiele für solche Schicksale sind der Jude Ernst Frank und Julius Koch, welcher mit einer Jüdin, Emma Koch, verheiratet war. Ernst Frank war ein Pferdehändler aus Holzminden. Aufgrund einer nicht gemachten Angabe in seiner Vermögenserklärung, wurde ein Teil seines Eigentums enteignet. Dies erfolgte im Rahmen einer Sicherungsanordnung vom 24. August Ebenso verbrachte er eine Zeit lang in Untersuchungshaft. In der Zeitung fand sich ein Bericht zu seiner Verurteilung mit dem Titel Holzmindener Jude wollte mit Devisen türmen. Dies zeigt den Umgang mit jüdischen Mitmenschen in der Öffentlichkeit. Seine Versuche, Deutschland zu verlassen, scheiterten alle. Die Auswanderung von Juden wurde von Himmler, dem Reichsführer der Schutzstaffel, unterbunden. Letztendlich wurde Ernst Frank am 26. Februar 1943 nach Auschwitz deportiert und am 9. September 1950 für tot erklärt. 7 Protokoll der Wannsee-Konferenz, 20. Januar 1942 in: 8 Augenzeugenbericht eines SS-Obersturmführers über eine Besichtigung des Vernichtungslagers Belżec im August 1942, in: Wolfgang Michalka (Hg.), das Dritte Reich, Bd. 2, S
15 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 15 Julius Koch war per Definition der Nationalsozialisten auch Jude. Seine Biografie weist ebenfalls Merkmale der Judenverfolgung auf. Er hatte einen kurzen Aufenthalt im Gefängnis. Seine Arbeit als Tischler musste er gezwungenermaßen aufgeben. Die Synagoge, um die er sich kümmerte, wurde niedergebrannt. Ein entscheidendes Ereignis war das Verhör einer jüdischen Bekannten durch die Gestapo. Koch sollte gegen sie aussagen. Dazu war er aber nicht bereit. Daraufhin entschieden seine Frau und er, sich das Leben zu nehmen. Koch erschoss seine Frau auf ihren Wunsch hin. Anschließend erhängte er sich am 2. März 1939 selbst. Die Biografien dieser beiden Personen wurden beide durch das NS-Regime beeinflusst. Sie unterscheiden sich aber in der Todesursache. Das Ehepaar Koch wurde nicht direkt von den Nationalsozialisten ermordet. Einer Suizidalisierung liegen jedoch immer psychische Ursachen zu Grunde. Diese wurden durch die Verfolgung und Verfemung hervorgerufen. Demnach hat die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus nicht nur den Tod von Ernst Frank zu verantworten, sondern auch den Tod des Ehepaars Koch. Dieser Vergleich verdeutlicht das körperliche und mentale Leid der Betroffenen. Auch wenn Ernst Franks Schicksal der Deportation von vielen jüdischen Holzmindenern geteilt wurde, dürfen die Fälle der Selbsttötung auf keinen Fall unberücksichtigt bleiben und müssen hier genannt werden. Beide Beispiele sind von großer Bedeutung, um an das Leid zu erinnern, dass das NS-Stadtregime über Menschen mit jüdischen Wurzeln gebracht hatte. Eine solche Verfolgung und Vernichtung darf niemals wieder in unserer Stadt geben. Jüdische Opfer Die Leben von 120 Einwohnern Holzmindens wurden durch die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten beeinflusst. 46 konnten erfolgreich fliehen. Aber 38 starben durch die Judenverfolgung. Dies geschah im Zeitraum von 1937 bis wurden für tot erklärt. 6 nahmen sich selbst das Leben. Wir gedenken mit dieser Tafel an die uns mit Namen bekannten jüdischen Holzmindener: Robert Beverstein, Regina Carsch (geb. Rose), Rudolf Ehrlich, Sophie Frank (geb. Meyerhof), Ernst Frank, Willi Friedlaender, seine Ehefrau Ilse Friedlaender (geb. Goldstein), Alfons Goldschmidt, Grete Heineberg (geb. Meyer), David Holzapfel, seine Frau Elsbeth Holzapfel (geb. Kornberg), Bernhard Judenberg, seine Frau Thekla Judenberg (geb. Rothschild) und ihr Sohn Horst Judenberg, Julius Koch, Emma Koch (geb. Weinberg), Emil Kornberg, seine Frau Ida Kornberg (geb. Lilienstern), Wilhelmine Kugelmann (geb. Schartenberg), Dr. Alexander Müller, seine Frau Margarete Müller (geb. Scheftel), Julius Nachmann, seine Frau Helene Nachmann (geb. Haas) und ihre Tochter Lore Nachmann, Henriette Neuding (geb. Schwarzmann), Amalie Salomon (geb. Schönbach), Gerda Salomon, Gustav Samuel, Else Schartenberg- Steinitz, Kurt Stern, seine Ehefrau Margarethe Stern (geb. Rose), Lotte Stern, Martha Stern, Siegmund Strauss, seine Ehefrau Helene Strauss (geb. Emanuel), Erich Weinberg, Max Weinberg und Cäcilie Weissenstein (geb. Held). Literatur: Kieckbusch, Klaus: Von Juden und Christen in Holzminden Ein Geschichts- und Gedenkbuch, Holzminden Liste jüdischer Opfer von Klaus Kieckbusch
16 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 16 M 3 Schülertext zu den Jüdische Opfern in Holzminden Situation der polnischen und russischen Zwangsarbeiter in und um Holzminden während des Zweiten Weltkrieges Situation von Russen und Polen in Deutschland von 1938 bis 1945 Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es in Deutschland zwölf Millionen Zwangsarbeiter. Vier Millionen davon stammten aus Polen und Russland. Vorwiegend wurden die Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten entzogen, um die fehlenden Arbeitskräfte in der Heimat günstig zu ersetzen. Die Behandlung war menschenunwürdig. Durch groß angelegte Razzien in Osteuropa wurden die Zwangsarbeiter mittels Gewalt rekrutiert und nach Deutschland abtransportiert. Die Russen wurden Ostarbeiter genannt und standen in der nationalsozialistischen Rangordnung Abbildung 1: Häftlinge des KZs in Buchenwald. noch unter den Polen. Sie waren so genannte Untermenschen. Dies bedeutete meist eine schlechtere Behandlung. Zwangsarbeiter wurden in der Landwirtschaft und Rüstungsindustrie eingesetzt, allerdings auch bei Privatpersonen. Da für sie kein Arbeitsschutz galt, konnten sie auch an ungesicherten Arbeitsstellen eingesetzt werden. Die Unterbringung erfolgte meist in Zwangsarbeiterlagern, den Stammlagern. Sie bestanden aus Baracken und waren nicht selten von Stacheldrahtzäunen umgeben. Russen und Polen in Holzminden und Umgebung Auch hier in Holzminden und in seiner Umgebung gab es polnische und russische Zwangsarbeiter. Auf dem örtlichen Friedhof wurden alleine rund 50 Russen, 10 Polen und 50 Kinder in den Kriegsjahren begraben.(1) Während dieser Zeit lebten mehr als 600 Russen und Polen in Holzminden und längst nicht alle Todesfälle wurden aufgeführt. Fast in jedem der 17 bis 20 Lager gab es so genannte "Ostarbeiter". Ihre Schicksale sind so unterschiedlich wie die Menschen in ihrem Umfeld. Im Russenlager "Weiße Breite" wurden sie oft misshandelt und ihre Kinder stark unterernährt, weshalb man es auch Säuglingssterbelager nannte. Hingegen beherbergte die Familie Ullrich ein polnisches Dienstmädchen, dass sie sogar unerlaubter Weise verkleidet mit ins Kino nahmen. Auch in den umliegenden Dörfern wurden Polen und Russen beschäftigt, so zum Beispiel in Mühlenberg nahe dem Gasthaus "Sollingruh". Die auszuführenden Arbeiten waren auch abhängig vom Standort der Zwangsarbeiter, doch waren es immer schwere, belastende Aufgaben. In der Glashütte in Holzminden arbeiteten zum Beispiel acht polnische Frauen unter schweren Bedingungen am Ofen als Ausblaserinnen. Russenlager Weiße Breite Im Jahr 1942 wurden in der Charlotten- und Bebelstraße drei Holzbaracken in der Größe von 160 bzw. 120 qm erbaut. Durch seinen Ruf als Sterbelager ist es bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Das Russenlager umfasste ca. 200 russische Kriegsgefangene. Im Juni kamen zwei weitere Baracken in der Größe von 320 bzw. 125 qm dazu. In ihnen wurden 300 ukrainische Zivilgefangene untergebracht. Da die Zahl der Betriebe, die Zwangsarbeiter beschäftigten, bis zum Februar 1943 auf 23 gestiegen war, kamen noch einige Ostarbeiter dazu. Somit betrug die Höchstzahl Abbildung 2: Russische Zwangsarbeiterinnen des Gemeinschaftslagers der Stadt Holzminden der Inhaftierten ca. 400 Menschen, die unerlaubterweise in dreistöckigen Betten schliefen. Die stellvertretende Lagerleiterin missachtete die Vorschriften für die Essensvergabe an die Inhaftierten und vergab es stattdessen an Deutsche und Tiere.
17 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 17 So verzeichnete dieses Lager, bezogen auf Säuglinge und ältere Ostarbeiter, eine sehr hohe Sterblichkeitsziffer. Da es ein Freigängerlager war, mussten die Inhaftierten morgens und abends anwesend sein, während sie tagsüber arbeiteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Lager Weiße Breite durch britische Soldaten aufgelöst. Die Insassen wurden verladen und in östliche Richtung abtransportiert. Teilweise gelang eine Flucht, doch für die anderen war es vorübergehend die letzte Reise. Polnisches und russisches Zwangsarbeiterlager Domäne Allersheim und Firma Ulrich An der Straße nach Bevern gab es seit 1928 eine Unterkunft für polnische Saisonarbeiter. Diese waren ununterbrochen beschäftigt. Während des Krieges lebten dort auch polnische Zwangsarbeiter. Ca. 20 Männer und Frauen wurden hierfür in Polen festgenommen und zwangsweise nach Allersheim/Deutschland gebracht. Im August 1942 ereignete sich eine äußerst brutale Schlägerei mit Todesfolgen auf den Felder vor Allersheim: Wie üblich sollten die Polen arbeiten, doch dieses Mal weigerten sie sich, weil für sie ein wichtiger Feiertag war. Sogleich wurden Sachverständige informiert. Diese trafen einige Tage später auf den Feldern ein. Die arbeitsunwilligen Polen wurden brutal verprügelt. Es wagte keiner wegzulaufen, weil die Gefahr der Erschießung bestand. Das war eine der vielen Vergeltungsaktionen. Im Gegensatz dazu stand das Lager am Pipping. Dort am Eingang Holzmindens, war die große renommierte Holzfabrik der Familie Ulrich. Während des Krieges stellte sie Sperrholzteile für die Flugzeugindustrie und Kisten für Munitionsteile her. Dafür arbeiteten bereits Anfang 1940 ca. 10 polnische Frauen in der Fabrik, wo sie auch schliefen und aßen. Später kamen weitere 20 ukrainische Frauen aus dem Lager Liebigstraße dazu. Sie waren stark unterernährt und wurde deshalb von Frau Ulrich versorgt folgten weitere 46 Russen aus dem Gemeinschaftslager Holzminden. Positiv zu vermerken ist hierbei, dass die Familie die menschlichen Bedürfnisse ihrer Arbeiter weitgehend deckte. Friedhof Holzminden Insgesamt sind auf dem Holzmindener Friedhof 109 Russen und Polen, im Zeitraum von , bestattet worden. Acht dieser Todesopfer waren Polen und 101 Russen. Die Todesursachen waren nicht selten die menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen. 58 dieser Bestatteten waren Kinder. Diese litten besonders schwer unter den schlechten Lebensbedingungen, wie der Lebensmittelknappheit. So wurden die Kinder der Ostarbeiterinnen ihnen direkt nach der Entbindung entrissen, um die Frauen wieder bei Arbeiten einzusetzen. In speziellen Kinderlagern wurden die Säuglinge untergebracht, wo sie gezielt unterernährt wurden. Aus diesem Grund starben sie meist frühzeitig. Die Bestattungskosten wurden größtenteils von der Stadt Holzminden oder dem Arbeitgeber entrichtet. Allerdings hielt man sich nur an die Rechtsbestimmungen, die eine minimale Bestattung anordneten. Bis heute sind allerdings viele Schicksale ungeklärt und oft ist nicht mehr als der Name bekannt. Durch eine großartige Wiederaufarbeitung der Geschichte und durch einige glückliche Zufälle, konnten einige wenige Schicksale aufgeklärt werden. Es wurde also auch hier Friedensarbeit geleistet. Quellen- u. Literaturverzeichnis 1) Einwohnermelderegister im Stadtarchiv Holzminden 2) Creydt, Detlef: Das Leben und Leiden in den Lagern in und um Holzminden, in: Detlef Creydt (Hg.), Zwangsarbeit für Rüstung, Landwirtschaft und Forsten im Oberwesergebiet , Bd. 3, Holzminden 1995, S Abbildung 3: Gedenkstein für russische und polnische Zwangsarbeiter und Opfer in Holzminden. Bildquellen: Abb.1.: Abb.2,3.:Creydt/ A.Meyer: Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie im südniedersächsischen Bergland, Bd. 2.
18 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 18 M 4 Schülertext zu den Ungarischen Lazarettopfern in Holzminden Ungarische Opfer des Zweiten Weltkrieges in Holzminden von Carolin Brandt, Daniel Stukenberg und Louisa Petersen 1. Allgemeine Situation der Ungarn im Zweiten Weltkrieg Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Ungarn seit 1941 auf der Seite der Achsenmächte, also auch auf der Seite der Deutschen. Die Freundschaft, die für dieses Bündnis sorgte, beruhte auf einer langen Tradition. Heute sind Ungarn und Deutschland wieder eng verbunden, weil die deutsche Wiedervereinigung in Ungarn begann. Nachdem die Rote Armee seit Herbst 1944 nach Ungarn vorrückte und besetzte, floh die ungarische Bevölkerung in das verbündete Deutsche Reich. Aus diesem Grund kamen auch die Ärzte, Krankenschwestern und einige Soldaten eines ungarischen Lazaretts nach Holzminden. Wie die Menschen dieses Lazaretts, wurden die geflohenen Ungarn in der Regel geduldet, waren jedoch nicht willkommen. 2. Ungarisches Lazarett im Landschulheim am Solling 2.1 Die Besetzung des Landschulheims Am 6. April 1945 besetzt die Mannschaft eines ungarischen Lazaretts mit Ärzten, Pflegern und ihren Familien (insgesamt circa 500 Personen) das Unterhaus und das Mittelhaus des Landschulheims am Solling. Es war menschenleer, denn die letzten Schüler waren am Tag vorher abgerückt, und nur einige Familien waren noch im Heim. Die Ungarn kamen wahrscheinlich aus Böhmen, welches von Russen besetzt wurde. Sie beschlossen zu fliehen, weil sie auf deutscher Seite gekämpft hatten und sich lieber in Kriegsgefangenschaft begeben wollten. Die Häuserbesetzung erfolgte chaotisch und in großer Eile. Es gelang den Landschulheimern kaum, Ordnung zu schaffen. Es ist nicht anzunehmen, dass die Ungarn von irgendeiner Stelle ordnungsgemäß ins Landschulheim eingewiesen wurden. Das Landschulheim Anfang des 20. Jahrhundert 2.2 Das Zusammenleben zwischen Ungarn und Landschulheimern Das Zusammenleben mit den Ungarn war für die Landschulheimer schwierig. Sie fühlten sich übergangen und fürchteten um ihr Eigentum. Die Ungarn wurden als Fremdkörper empfunden. Sie wurden nur spärlich versorgt und mussten somit ums Überleben kämpfen. Sie sammelten Pilze und betrieben Tauschhandel in Albaxen und Stahle. Dort tauschten sie alles, was sie im Landschulheim als wertvoll erachteten, gegen Lebensmittel ein. Das Verhältnis zwischen Ungarn und Landschulheimern war weitgehend kontaktlos, da sie offenbar kaum Deutsch sprachen. Nur dort, wo Familien des Landschulheims noch in den besetzten Häusern wohnten, entstanden Kontakte. 2.3 Der Abzug der Ungarn Nach zweieinhalb Jahren erfolgte Ende Oktober 1947 der erzwungene Abzug der Ungarn. Die Gebäude wurden aber erst am 12. Oktober 1948 von der Militärregierung freigegeben. Es setzten heftige Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten ein. Am 29. Februar wurde die Hohe Halle feierlich wieder eingeweiht. Was mit den Ungarn nach dem Abzug geschehen war, ist nicht bekannt. Einige wollten nach Kanada auswandern; es kann auch sein, dass manche zurück in das russisch besetzte Ungarn mussten. Die Landschulheimer bemühten sich die ganze Zeit über um das Abrücken der Ungarn, um ihre Schule wieder vollständig führen zu können. Ein wirtschaftliches Problem war die Besetzung nicht, denn es wurde Miete gezahlt. Nach Abzug der Ungarn wurde festgestellt, dass alle Mietforderungen - bis auf einen geringen Betrag - erfüllt wurden. Vor dem tatsächlichen Abzug hieß es in diversen Schreiben immer wieder, dass der Abtransport bevorstünde, jedoch verzögerte sich dieser jedes Mal. Kleinere Gruppen zogen ab, wurden aber bald wieder durch neue ersetzt. Es war die Rede von neuen Gruppen aus dem Lager in Eschershausen. Trotz der vorhandenen Diskrepanzen zwischen Landschulheimern und Ungarn, war der Abschied teilweise emotional, da über die lange Zeit doch noch enge Kontakte entstanden waren.
19 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Ungarische Opfer in Holzminden Neben der Mannschaft des Lazaretts waren auch ungarische Soldaten in Holzminden. Es ist nicht bekannt, ob sie vorher schon auf deutscher Seite gekämpft haben oder zusammen mit dem Lazarett angekommen sind. Belegbar sind 20 Todesfälle von Ungarn, die in Holzminden gestorben sind. Sieben von ihnen sind in Sterbeurkunden als Soldaten gekennzeichnet. Da viele Dokumente aus dieser Zeit nicht mehr existieren, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl höher liegt. Auch die Todesdaten der bekannten Opfer sind unvollständig. Aber es ist auffällig, dass alle in einer Zeitspanne von eineinhalb Jahren gestorben sind, wobei 13 von ihnen innerhalb von drei Monaten ihr Leben verloren. Diese Häufung lässt sich auf die Bombenangriffe Anfang April 1945 zurückführen. Die sieben anderen bekannten Opfer sind vermutlich nicht an Kriegsverletzungen gestorben, sondern an den Folgen des Krieges. Beispielsweise ist Istvanka Kéki am Tag ihrer Geburt an Lebensschwäche gestorben. Dies lässt sich durch die mangelnde Versorgung durch Lebensmittel und den daraus resultierenden schlechten Umständen während der Schwangerschaft erklären. 4. Einzelschicksal Vermutlich waren zwei der Ärzte des ungarischen Lazaretts im Landschulheim: Dr. Josefine Jolán Margit Tóth, geborene Tusnádi, und ihr Ehemann Dr. Josef Tóth. Josefine wurde am 3. April 1920 in Abrudbánya in Ungarn geboren. Nur 25 Jahre später, am 5. November 1945, verstarb sie in Holzminden an Tuberkulose. An dieser Infektionskrankheit waren viele Menschen im Zweiten Weltkrieg erkrankt. Auch in Holzminden gab es eine Tuberkuloseepidemie. Aufgrund der mangelnden ärztlichen Versorgung konnte diese nicht einfach eindämmt werden, so dass die Erkrankten verstarben. Von Dr. Josef Tóth sind keine weiteren Daten bekannt. Er zog wahrscheinlich mit dem Rest des Lazaretts zurück nach Ungarn. Anhang Quellen: - Informationen über das ungarische Lazarett im Landschulheim am Solling: Herr Dr. Wolfgang Mitgau, Archivar und ehemaliger Lehrer des Landschulheims - Gräberlisten aus dem Stadtarchiv Holzminden: Obere Straße Holzminden - Bild vom Landschulheim: Fgeschichte%2Findex.php Anmerkungen Unterschiede zwischen Informationen von Mitgau und dem Text von Creydt: Personenanzahl des Lazaretts (500 und 300), Herkunftsort (Böhmen und Budapest)
20 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 20 M 5 Schülertext zu den Bombenopfern in Holzminden Der Bombenangriff und seine Opfer im 2. Weltkrieg in Holzminden von Julian Georgi, Merlin Brychcy, Daniel Kohrs und Jan Saß Situation während des Zweiten Weltkrieges Diese Tafel soll der Opfer der Bombenangriffe vom 31. März 1945 bis zum 8. April 1945 gedenken. Wie kam es zu diesen Angriffen? Der Luftkrieg über Europa begann im Jahr Dieser Luftkrieg wurde zuerst von den Deutschen dominiert, so bewiesen sie ihre Macht schon im Spanischen Bürgerkrieg in Gernika fand dann der verheerende Angriff auf die englische Industriestadt Coventry statt. Die Stadt wurde fast komplett zerstört und über 500 Menschen starben bei dem Angriff. Es folgte die gegenseitige Bombardierung deutscher und englischer Städte, bis die Alliierten im April 1944 die Oberhand durch fortschrittlichere Technik und eine größere Flugzeugstaffel gewannen. Angriffe auf deutsche Städte waren nun fast alltäglich. Primär wollten die Alliierten militärische und wirtschaftliche Ziele zerstören. Dadurch wurde Holzminden, auf Grund der Stiebel Eltron Werke und den dort produzierten V2-Teilen, zu einem Ziel. Auch der Bahnhof als Warenumschlagspunkt wurde deshalb mehrfach angegriffen. Einen Tag nach den letzten Bombenangriffen, am 9. April 1945, wurde Holzminden von Truppen befreit, die aus Bevern kamen. Bombenangriffe auf Holzminden Bei dem Bombenangriff am 31. März 1945 wurde, wie üblich die Untertunnelung der Eisenbahnstrecke Holzminden-Höxter und Boffzen-Höxter, die entlang des Lüchtringer Wegs führt, als Luftschutzbunker benutzt. Am Ende dieses Tunnels lag die fünfjährige Inge Wenzel auf einem Bett aus Stroh. Als eine Bombe einschlug, wurde diese durch den so erzeugten Unterdruck herausgezogen und durch die Luft geschleudert. Sie blieb von diesem Vorfall bis auf den Schock unverletzt, wurde jedoch so weit weg geschleudert, dass sie erst nach längerem Suchen gefunden wurde. Am 3. April wurde die Kreisstadt Holzminden von mehreren US-Bombern und Jägern Coventry nach Luftangriff Bundesarchiv, Bild 183-R Foto: Hoffman, o. Dat. Beim Bombenangriff am 3. April 1945 zerstörte Baracke am Holzmindener Bahnhof angegriffen. Dieser Angriff fand zwischen 16:30 und 17:00 Uhr statt. Zuerst überflogen die Bomber Holzminden in großer Höhe und verschwanden hinter dem Solling. Gegen 16:30 Uhr kehrten sie zurück und starteten die erste Angriffswelle. Ziel ihres Angriffs war der Holzmindener Bahnhof. Bei dem vorerst sonnigen Wetter konnte dieses Ziel wegen der klaren Sicht gut ausgemacht werden, an diesem Ort waren vor kurzem ein paar Truppen eingetroffen. Die Bomber hatten eine Angriffshöhe von ungefähr Metern und griffen aus nordöstlicher Richtung an. Die angekommenen deutschen Truppen suchten nach der Sichtung der Bomber die ausgewiesenen Luftschutzbunker in der Nähe auf. Die Bomber warfen Aluminiumstreifen ab, die als Düppel bekannt waren, um die Funkgeräte der 10,5 cm Eisenbahnflaks auszuschalten. Die Bomber flogen auf den Bahnhof zu und fächerten sich auseinander, um eine größere Trefferquote zu erreichen. Die Flugzeuge kippten nach unten ab und entleerten sich so ihrer Bombenlast. Die erste Welle traf das Gebiet zwischen Bahnhofstraße und Fürstenberger Straße. Bei diesem Angriff starben 158 Menschen. Mit den Angriffen vom 31. März 1945, 6. und dem 8. April 1945, beläuft sich die Zahl der Bombenopfer auf etwa 168.
21 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 21 Zeitzeugeninterview mit Wilhelm Schmidt (* ) Wilhelm Schmidt erlebte den Bombenangriff vom Dienstag, den 3. April 1945 als 12-jähriger Junge, der vormittags bei seinem Schulfreund und Nachbarn Wolfram Domeyer in der Fahrenbreite war. Er war, anders als sonst, am frühen Nachmittag gegangen. Abends gegen Uhr begann der Fliegeralarm. Daraufhin gingen sie in den Luftschutzkeller, einen Raum mit durch Sperrholz verstärkten Wänden. Draußen war ein klarer azurblauer Himmel, doch kurz nach dem Angriff zog ein Gewitter auf, weshalb die feindlichen Bomber die Orientierung verloren und ihre Bomben weit gefächert von der Fürstenberger Straße bis auf den Kiesberg abwarfen. Die Fürstenberger Straße war durch riesige Bombentrichter mit einem Handwagen nahezu unbefahrbar. Selbst vor Schmidts Haus, direkt im Lindenhof, fiel eine große Zahl von Bomben. Es herrschte große Angst unter der Bevölkerung. Wilhelm Schmidt kannte eine Verstorbene des Bombenangriffs. Es war die damals 46-jährige Nachbarin Marie Althoff, die mit vielen anderen in einem großen Haus ein Versteck suchte. Leider wurde dieses Haus komplett zerstört. Seine Schwester Ursel Schmidt war beim Bombenangriff vom 3. April mit ihrer Freundin Inge Kißling in der Stadt, als der Fliegeralarm kam. Inge Kißling wollte in das nach dem Angriff vollständig zerstörte Haus, jedoch flohen beide schließlich bis nach Hause. Am nächsten Tag flohen er, seine Schwester Ursel und seine Mutter auf den Bauernhof am Allernbusch, wo sie schliefen. Man konnte von oben sehr genau erkennen, wie die Brücke gesprengt wurde. Beim nächsten Angriff der Alliierten wurde der Bauernhof getroffen. Nun flüchteten sie in einen Keller der Glashüttenwerke, wo sie am nächsten Morgen wieder aufbrachen und in die Bleiche gingen. Im Beukampsborn fanden sie endlich Unterschlupf. Dort blieben sie bis zur Einnahme der Stadt durch amerikanische Soldaten. Liste der Bombenopfer Holzmindens Bei den Luftangriffen auf Holzminden kamen insgesamt etwa 168 Menschen ums Leben, wobei Quellen und Literatur nicht vollständig übereinstimmen. So sind im Sterbebuch des Standesamtes Holzminden, von 1945 und 1946 nur 166 Opfer verzeichnet. Detlef Creydt nennt in seinem Buch Luftkrieg im Weserbergland jedoch noch zwei weitere Opfer (Urbach, Adam, sowie Hohn, Anton). Auch ist trotz Quellen nicht immer sicher, ob die Verstorbenen den Bombardierungen zugeordnet werden können. So ist der Fall des Carl Schoppe nicht eindeutig, da er erst am 16. April 1945 verschied. Es ist möglich, dass sein Tod eine Folge der durch die Bombardierung erlittenen Verletzungen gewesen sein kann. Es kamen jedoch nicht nur Einwohner Holzmindens bei den Bombenangriffen ums Leben. Auch Zwangsarbeiter und Flüchtlinge aus größeren Städten, wie Berlin und Köln starben durch die Bombardierungen. Sie suchten auf dem Land nach Schutz. Sogar eine Auslandskorrespondentin, Margret Scotland, aus Kanada wurde Opfer der Bomben. Diese Liste der Bombenopfer wurde mit Hilfe des Sterbebuches des Standesamtes Holzminden 1945 und 1946, sowie des von Detlef Creydt verfassten Buches, Luftkrieg im Weserbergland erstellt. Die Zahlen entsprechen der Ordnungsnummer des Sterbebuches und ermöglichen eine schnellere Überprüfung einzelner Namen und Schicksale. Nr. Name Nationalität Daten 147 Kirchhoff, Ingrid; 11 J. deutsch Kirchhoff, Rolf; 4 J. deutsch Landtreter, Waltraud; 29 J. deutsch Mainshausen, Käte; 14 J. deutsch Mainshausen, Elisabeth; 12 J. deutsch Grelle, Hermine; 35 J. deutsch Kloppe, Hans-Bodo; 10 J. deutsch Althoff, Marie; geb. Hesse; 46 J. deutsch Andreewa, Alexei Federowitscha; 18 J. Ostarbeiter Arndt, Albert Heinrich; 39 J. deutsch Arndt, Magarete; geb. Wiegmann; 37 J. deutsch Arndt, Ernst Heinrich; 8 J. deutsch Arndt, Magarete; 1 J. deutsch Bartels, Elisabeth; geb. Eßmann; 27 J. deutsch Auf dem Friedhof in Holzminden begraben 10 vermutlich russischer Herkunft
22 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Bartels, Christel; 2 J. deutsch Baumhauer, Marie; 44 J. deutsch Baumhauer, Agathe; geb. Böddeker; 42 J. deutsch Bergstein, Robert Willhelm; 18 J. deutsch Bierwirth, Auguste; geb. Berner; 49 J. deutsch Bill, Helene; geb. Winhauer; 67 J. deutsch Bischoff, Paul; 41 J. deutsch Bonderent, Pawel; 53 J. Ostarbeiter Bost, Caroline; geb. Kleine; 78 J. deutsch Bremer, August; 58 J. deutsch Brüggemann, Anna; geb. Herdtmann; 81 J. deutsch Burzek, Wilhelm; 45 J. deutsch Busche, August; 46 J. deutsch Busche, Luise; geb. Göhmann; 36 J. deutsch Busche, Friedrich; 12 J. deutsch Busche, Karl; 9 J. deutsch Busche, Rosa; 7 J. deutsch Busche, Ernst-August; 6 J. deutsch Busche, Bernhard; 4 J. deutsch Busche, Erika; 2 J. deutsch Busche, Heinz; 1 J. deutsch Claußen, Anna; geb. Kumlehn; 56 J. deutsch Dederichs, Hubert; 51 J. deutsch Diekmann, Wilhelm; 14 J. deutsch Dörrier, Franziska; 36 J. deutsch Dörrier, Heinrich; 34 J. deutsch Dörrier, Martha; geb. Lehne; 33 J. deutsch Dörrier, Gerhard; 3 J. deutsch Dörrier, Ursula; 1 J. deutsch Dreyer, Lina; geb. Drücke; 55 J. deutsch Eisig, Elfriede; geb. Grimm; 35 J. deutsch Eisig, Michael; 6 J. deutsch Enaux, Else; geb. Bill; 32 J. deutsch Filipowa, Ewdokija; 53 J. Ostarbeiter 11 unbekannt Fischer, Martha; geb. Koch; 60 J. deutsch Flader, Marie; geb. Kretzer; 56 J. deutsch Frohe, Elisabeth; geb. Leinebrink; 30 J. deutsch Gehrke, Erna; geb. Seifert; 45 J. deutsch Gerberding, Loise, geb. Ridder; 82 J. eutsch Grimpe, Elisabeth; 62 J. deutsch Grimpe, Martin Ludwig; 61 J. deutsch van Grünsven, Cornelius Hend; 31 J. holländisch Grünewald, Johanne; geb. Vogelsang; 83 J. deutsch Gundelach, Hermann; 72 J. deutsch Halbfaß, Hildegard; geb. Vorberg; 30 J. deutsch Halbfaß, Hartmut; 6 J. deutsch Halbfaß, Helga; 4 J. deutsch Dr. Hechelhammer, Annelise; 34 J. deutsch Hechelhammer, Wilhelm; 4 J. deutsch Hechelhammer, Friedrich; 11 M. deutsch Heinemeyer, Jürgen; 5 J. deutsch Hellig, Christiane; 74 J. deutsch Hellig, Auguste; geb. Multhoff; 71 J. deutsch Hellig, Robert; 43 J. deutsch vermutlich russischer Herkunft 12 Auf dem Friedhof in Holzminden begraben
23 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Hinz, Erika; geb. Lange; 27 J. deutsch Hohn, Anton; 41 J. deutsch unbekannt Humberg, Leonie; 57 J. deutsch Jakowenko unbekannt unbekannt Jordan, Hermann; 50 J. deutsch Kersten, Bertha; geb. Strelow; 66 J. deutsch Kirchhoff, Auguste; geb. Reuber; 60 J. deutsch Klagholz, Rudolf; 67 J. deutsch Koch, Elisabeth; 18 J. deutsch Köhler, Ingrid; 13 J. deutsch Kohlstädt, Hermann; 65 J. deutsch Kraus, Wally; geb. Multrus; 29 J. deutsch Kraus, Karl; 7 J. deutsch Kraus, Gisela; 6 J. deutsch Krause, Rudolf; 4 J. unbekannt Kreikmann, Heinrich; 48 J. deutsch Kruspe, Max; 69 J. deutsch Kumlehn, Johanne; geb. Schormann; 34 J. deutsch Kumlehn, Ingeborg; 10 J. deutsch Lange, Luise; geb. Scholz; 53 J. deutsch Leidloff, Auguste; 85 J. deutsch Leidloff, Magarete; 74 J. deutsch Lindemann, Frieda; geb. Göhmann; 36 J. deutsch Lohrberg, Albertine; geb. Knauck; 63 J. deutsch Luther, Hans; 87 J. deutsch Mairose, Dorothee; geb. Engelbrecht; 76 J. deutsch Mairose, Hermann; 45 J. deutsch Mairose, Dieter; 1 J. deutsch Meier, Auguste; geb. Deppe; 67 J. deutsch Mittelsten-Scheid, Lisa; geb. Fischer; 30 J. deutsch Nieswandt, Richard; 46 J. deutsch Nolte, Hedwig; 59 J. deutsch Nolte, Rosemarie; 15 J. deutsch Oerke, Hertha; geb. Lüttich; 38 J. deutsch Owel, Elisabeth; geb. Götting; 59 J. deutsch Pauli, Josef; 45 J. deutsch Plöger, Charlotte; geb. Kirchhoff; 34 J. deutsch Pollmann, Josef; 39 J. deutsch Prante, Wilhelmine; geb. Czeplunch; 64 J. deutsch Prigge, Marianne; 20 J. deutsch Plüm, August; 74 J. deutsch Püschel, Gertrud; 45 J. deutsch Ravenè, Peter Louis; 54 J. deutsch Reinicke, Paul; 76 J. deutsch Reinicke, Louise; geb. Ritterbusch; 67 J. deutsch Renneberg, Marie; 22 J. deutsch Rögner, Gertrud; geb. Klagholz; 31 J. deutsch Rögner, Ingeborg; 1 J. eutsch Rößmann, Alois; 43 J. deutsch Salm, Luise; geb. Bode; 46 J. deutsch Salm, Günther; 12 J. deutsch Schilling, Ludwig; 40 J. deutsch Schmerwitz, Rudolf; 15 J. deutsch Schmidt, Louis; 75 J. deutsch Auf dem Friedhof in Holzminden begraben
24 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges Schmidt, Klaus; 22 J. deutsch Schmidt, Dieter; 13 J. deutsch Schmidt, Ingrid; 9 J. deutsch Schoppe, Carl; 67 J. deutsch Schormann, Johanne; geb. Püttcher; 63 J. deutsch Schrader, Else; geb. Borchers; 60 J. deutsch Schramm, Hildegard; geb. Miodda; 30 J. deutsch Schreckenberg, Sigrid Wilhelmine; 1 J. deutsch Schröder, Otto; 63 J. deutsch Schütte, Caroline; geb. Stapel; 59 J. deutsch Schulz, Gustav; 33 J. deutsch Schulz, Erna; geb. Kaiser; 32 J. deutsch Schulz, Reinhard; 1M. deutsch Schwahn, Helene; geb. Schormann; 36 J. deutsch Schwahn, Ursula;14 J. deutsch Schwahn, Wolfgang; 9 J. deutsch Schwahn, Hannelore; 1 J. deutsch Schwalm, Theodor; 67 J. deutsch Scotland, Magaret; 27 J. kanadisch Seibert, Brigitte; geb. Ahlswede; 22 J. deutsch Seidl, Waltraud; 41 J. deutsch Seidl, Stefan; 5 J. deutsch Seidl, Albrecht; 5 M. deutsch Simons, Julius; 52 J. deutsch Sonntag, Ilse; geb. Werner; 25 J. deutsch Stübben, Peter; 9 J. deutsch Stübben. Wilhelm; 8 J. deutsch Sturm, Lore; 19 J. deutsch Subowa, Elena; 56 J. Ostarbeiter Szczesny, Viktor; 47 J. deutsch Tack, Peter; 48 J. deutsch Tigges, Hermann; 77 J. deutsch Tobianski, Wilhelm; 13 J. deutsch Thomcyck, Else; geb. Wiegmann; 48 J. deutsch Tulanowa, Marta; 78 J. Ostarbeiter Urbach, Adam; 45 J. unbekannt unbekannt Vorberg, Adolf; 68 J. deutsch Vorberg, Karoline; geb. Schoppe; 63 J. deutsch Voß, Ilse; geb. Schrader; 30 J. deutsch Voß, Hans-Peter; 3 J. deutsch Walter, Julie; geb. Berrisch; 48 J. deutsch Wiechmann, Horst; 1 J. deutsch Willems, Jakob; 33 J. deutsch Witte, Albertine; geb. Beddies; 47 J. deutsch Krukemeyer, Alvine; 37 J. deutsch Teiwes, Helgo; 22 J. deutsch Problematik und Ziele Eines der Probleme war es, die Namen der Opfer, sowie ihre Lebensdaten und ihre Nationalität zu erfahren. Quellen- und Literaturverzeichnis Quellen: Sterbebuch des Standesamtes Holzminden 1945 Sterbebuch des Standesamtes Holzminden 1946 Zeitzeugeninterview mit Wilhelm Schmidt Literatur: Creydt, Detlef: Luftkrieg im Weserbergland. 2. erw. Aufl., Holzminden Bilder: Creydt, Detlef: Luftkrieg im Weserbergland. 2. erw. Aufl. Holzminden Auf dem Friedhof in Holzminden begraben 15 vermutlich russischer Herkunft
25 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 25 M 6 Schülertext zu den gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges Deutsche gefallene Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges von Ann-Cathrin Schütte, Patrik Stark, Melanie Kahl Erster Weltkrieg Gefallene Soldaten Im August 1914 feierten die Menschen überall in Europa den Kriegsbeginn, da sie an einen schnellen Sieg glaubten, der ihre Lebensumstände verbessern würde. Daher meldeten sich hunderttausende junger Männer freiwillig zum Kriegsdienst. Die Großmächte Europas standen sich in feindlichen Bündnissystemen gegenüber befand also der Großteil des Kontinents im Kriegszustand. Österreich kämpfte mit der Hilfe Deutschlands gegen Serbien, Russland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Die französische Front erstarrte im Stellungskrieg mit pausenlosem Schusswechsel. Vor dem Einsatz tödlicher Giftgase schreckten die Militärs nicht zurück. Besonders schlimm tobte der Kampf 1916 bei Verdun, bei dem deutsche und französische Soldaten ihr Leben verloren. Ende 1916 war der Krieg nur noch ein Kräftemessen zwischen erschöpften Gegnern. Von insgesamt 8,5 Millionen getöteten Soldaten, doppelt so viel Verwundeten und einer Millionen toter Zivilisten, verzeichneten Deutschland und Österreich-Ungarn drei Millionen Tote, fast acht Millionen Verwundete und Menschen starben in Deutschland an Nahrungsmangel. Es war ein von Material- und Blutschlachten geprägter Krieg, der bis zur Unkenntlichkeit entstellte und verkrüppelte Kriegsteilnehmer ihrem Schicksal überließ. (Deick, Christian: Deutsche Geschichte, 2008, S u. Erster Weltkrieg, in: Wikipedia, Foto 1: Portrait von Karl Reese, Mitglied der deut- Mobilmachung und Kriegsmaßnahmen Wie überall in Deutschland herrschte auch in Holzminden eine patriotische Begeisterung im Hinblick auf die Mobilmachung. Vielseitige Vorbereitungen auf den bevorstehenden Krieg mussten vorgenommen, sowie damit verbundene Probleme gelöst werden. Einsatzfähige Männer rückten in den Heeresdienst ein. Das am 13. Oktober 1913 in den neu erbauten Kasernen eingezogene Bataillon 164 wurde später durch die Abteilung 174 des Infanterie- Regiments abgelöst, welches bis zum Ende des Krieges dort blieb. Die Militärbaracken, in denen erst Landwehrsoldaten untergebracht waren, dienten nun als Militärvorbereitungsschule. Eine Kontingentierung der Lebensmittel stellte für die landwirtschaftlich geprägte Stadt kein Problem dar, denn viele Bürger halfen auf den Betrieben aus. Bezugsscheine wurden zum üblichen Zahlungsmittel. Einrichtungen, wie ein Gemeindelazarett, eine schen Truppenverpflegungsanstalt und eine Sanitätskolonne waren von Nöten. Über das Rote Kreuz gelang der Erlös musikalischer Vorstellungen und Ersten Weltkrieges Vorträge an die Lazarette. Jeder brauchte einen Arbeitsnachweis und Notstandsarbeiten wurden eingeführt. (Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden 1981, S ) Versorgungs- Kompanie während des Holzminden im Ersten Weltkrieg Mit fortschreitender Kriegsdauer fand eine allgemeine Verknappung von Lebensmitteln und anderen Gütern statt. Umliegende Dörfer lieferten Nahrung für die städtische Bevölkerung. Die alte Bauschule wurde zu einem Lazarett umfunktioniert und der Bahnhof stellte eine Versorgungsstation des Roten Kreuzes dar. Französische und russische Kriegsgefangene arbeiteten in ansässigen Betrieben, wie den Glashüttenwerken und der Landwirtschaft, da auf Grund der vielen Kriegstoten ein Arbeitskräftemangel herrschte. (Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden 1981, S. 497)
26 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 26 Gefallene Krieger Von den rund zwei Millionen deutschen gefallenen Soldaten, wurde der größte Teil im Ausland begraben. So liegen noch etwa unbestattete deutsche Soldaten bei Reims auf einem Gräberfeld. ( Das Gräberfeld, Nachrichtenblatt, Grabow, Gustav Ritter, 1. Januar 1933) Die Zahl der unbekannten Toten ist fast so groß, wie die derer, die in Einzelgräbern liegen. (Stadtarchiv, 1931) Der aus Holzminden stammende Landwirt Karl Reese, verheiratet und Vater eines fünfjährigen Sohnes, diente als Mitglied einer Versorgungskompanie in Frankreich. Während eines Angriffes bei Verdun am verstarb dieser im Alter von 40 Jahren. Seine Familie erhielt wie üblich nach dessen Tod zwei Gedenkschriften und ein Portrait des Verstorbenen (siehe Fotos 1-3). Die Begräbnisstätte ist unbekannt. Foto 2: Gedenkblatt Die Schwierigkeit der würdevollen Bestattung gefallener Soldaten bestand darin, dass durch die schlechte Finanzlage während des Krieges und danach nur geringe Geldmittel zur Verfügung standen (Die Kreisdirektion, 1920). Da eine baldige, würdige Ausgestaltung und Pflege eine unaufschiebbare Ehrenpflicht und Dankesschuld nicht allein des Reiches, sondern des ganzen beruflichen Volkes war, entschlossen sich viele Städte und Gemeinden dazu, dies aus eigenen Mitteln zu tun. Ehrung der Kriegsgefallenen In Anlehnung an die Friedhofsanlage an der Fürstenberger Straße wurde 1917 ein Ehrenfriedhof geschaffen und auch die Idee eines repräsentativen Ehrenhaines wurde 1915 in Betracht gezogen. Auf dem Friedhof an der Allersheimer Straße befinden sich 48 deutsche Kriegergräber von denen etwa 10 privat gepflegt werden sowie ein Ehrenmahl zu derer Gedenken. (Quelle: Stadtarchiv, Kreisdirektion, ) Der Rat der Stadt Holzminden äußerte sich in einem Schreiben vom zu den Kriegsgefallenen. Demnach sollen die Opfer des Krieges ohne Unterschied geehrt werden, damit man unserer Brüder, die in französischer Erde ruhen, entsprechend gedenkt. (Stadtarchiv, Der Rat der Stadt, Holzminden, ) Zweiter Weltkrieg Gefallene Soldaten In der Zeit von 1933 bis 1945 kamen etwa 18 Millionen Soldaten im Krieg zum Einsatz. Dies waren aber nicht nur Berufssoldaten, sondern alle Männer mussten sich zum Wehrdienst melden. Gegen Ende des Krieges mussten sogar Jugendliche an die Front oder in der Heimat aushelfen. Die Einberufungen, die vorher schon angelaufen waren, wurden im September 1939 verstärkt. Denn nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen wurden mehr Soldaten benötigt. Gleichzeitig kamen die ersten Todesnachrichten von der Front in der Heimat an (Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden 1981, S. 550). Foto 3: Gedenkblatt Pioniere beim Hochwasser in der Innenstadt Holzminden (Creydt S. 112) In Holzminden stationierte Soldaten Als am 25. September 1944 zum Volkssturm aufgerufen wurde, begann für die jungen Männer die Ausbildung. Auch rückte eine Gruppe Holzmindener Gymnasiasten nach Holland ab, um dort den zurückweichenden deutschen Truppen zu helfen. Da sich im Zweiten Weltkrieg das Kriegsgeschehen nicht mehr nur an der eigentlichen Front abspielte, waren im gesamten Reich Truppen stationiert Männer umfasste das
27 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 27 am 19. März 1945 in Holzminden stationierte Panzer-Pionier-Bataillon 19. Dieses war eine Ersatz- und Ausbildungseinheit. Es hatte drei Rekrutenaus-bildungskompanien, eine Stammkompanie und einen Nachrichtenzug. Weiterhin gab es eine starke Genesendenkompanie und eine Marschkompanie. Nach dem Aufruf zum Volkssturm kamen weitere 8000 Männer zur regulären Truppe. Allerdings mangelte es überall an Waffen und Ausrüstung. Es wurden sogar zurückgelassene Gewehre in den Wartesälen der Bahnhöfe gesammelt (Kretschmer, Paul: Die Weser- Solling-Stadt Holzminden 1981, S. S ). Fliegerangriff auf Holzminden Anfang April 1945 drangen die Alliierten mit ihren Panzerspitzen zügig voran. Um sie zu stoppen wurde die Holzmindener Weserbrücke - wie auch alle anderen festen Weserübergänge - zur Sprengung vorbereitet. In der Nacht zum 7. April griffen die Amerikaner über Fürstenau und Albaxen Stahle an und konnten so die Stadt unter Panzerbeschuss nehmen. Noch in derselben Nacht wurde die Weserbrücke von den Deutschen gesprengt, um die Feinde aufzuhalten. Die Amerikaner beschrieben die Holzmindener als entschlossene Widerständler. Am 7. April 1945 wurde die Holzmindener Weserbrücke von den Deutschen gesprengt, um die Alliierten aufzuhalten (Kretschmer, S ) Am Tage des 7. April 1945 wurde die Stadt von den Alliierten mit Artilleriefeuer angegriffen. Besonders im Gebiet der Teichanlagen entstanden durch Raketen und erneute Bomben größere Schäden. Da die Lage für Holzminden aussichtslos schien, sollte das Pionierbataillon den Nachschub an Munition und Verpflegung der Amerikaner zerstören. Am 9. April wurde die Stadt schließlich von den Amerikanern besetzt. Doch die Kriegsschäden hielten sich verhältnismäßig gering, da weder das Silo, noch die Stiebel Eltron Werke oder die Brotfabrik trotz Befehls nicht zerstört wurden. Der Ehrenfried auf dem Holzmindener Friedhof Insgesamt gibt es heute 76 Einzelgräber deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Ehrenfriedhof in Holzminden. Allerdings wurden am 19. Februar 1948 Soldaten vom Friedhof des Landschulheims auf den Ehrenfriedhof hier in der Allersheimerstraße umgebettet. Herkunftsorte sind u. a. Stuttgart, Rinteln oder Hameln. Im Zeitraum von 1939 bis 1945 starben diese Soldaten durch Fliegerangriffe, an Bauch-, Kiefer- oder Lungensteckschüssen oder anderen Verletzungen. Einer von ihnen ist der Gefreite Leopold Trimmel, er wurde am 12. Januar 1924 in Kohnitz (Weidhofen) geboren. Er starb am 7. April 1945, am Tage des Angriffs durch die Alliierten, durch einen Kopfschuss. Er wurde am Friedhof des Landschulheims bestattet, später jedoch auf den Ehrenfriedhof umgebettet. Sein Grab ist noch heute hier zu finden. Creydt, Detlef: Luftkrieg im Weserbergland. Eine Chronologie der Ereignisse, Holzminden Kretschmer, Paul: Die Weser-Solling-Stadt Holzminden wie sie wurde, was sie ist, Holzminden 1981.
28 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 28 M 7 Schülerentwurf für eine große beidseitig begehbare große Tafel Erste Seite der großen Tafel Die Opfer der beiden großen Weltkriege auf dem Holzmindener Friedhof Auf dem Friedhof an der Allersheimerstraße auf dem Sie sich gerade befinden - lässt sich die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges anhand der verschiedenen Gräberfelder verfolgen. Neben den gefallenen Soldaten aus den beiden Weltkriegen wurden auch osteuropäische Zwangsarbeiter bestattet. Sie mussten in Lagern in und um Holzminden arbeiten. Ebenso befanden sich westeuropäische Zwangsarbeiter auf unserem Friedhof. Diese waren hier nur kurzzeitig beerdigt worden. Nach dem Krieg wurden sie in ihre Heimatländer umgebettet. Außerdem befinden sich in einem Sammelgrab ungarische Opfer, die während des Krieges das Landschulheim besetzten und als Lazarette benutzten. Die jüdischen Mitbürger Holzmindens wurden deportiert oder haben sich selbst getötet. Deshalb sind sie nicht auf dem jüdischen Friedhof, der an unseren christlichen angrenzt, begraben. Schließlich sind die Holzmindener Bürger, die bei dem Bombenangriff am 3. April 1945 starben, in einem eigenen Gräberfeld bestattet. Es handelt sich also um fast 500 Gräber, die auf die unterschiedlichen Opfergruppen beider Weltkriege hinweisen. Allerdings ist zu beachten, dass sich der Rundgang an die Friedhofstruktur und nicht an der chronologische Abfolge orientiert. Der genaue Weg zu den einzelnen Gräberfeldern der o.g. Opfergruppen, auf denen sich detailliertere Informationen befinden, entnehmen Sie der folgenden Karte.
29 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 29 Ein Rundgang lohnt sich, denn Sie erhalten neben einer allgemeinen und lokalhistorischen Informationen zu den genannten Opfergruppen, auch konkrete Fallbeispiel, die unsere Stadt und den Landkreis betreffen. Zu den einzelnen Opfergruppen ist Folgendes bekannt: 1. Bombenopfer im Zweiten Weltkrieg Über Deutschland tobte seit 1942 ein erbitterter Luftkrieg, in dem alliierte Flugzeuge primär Städte und Großstädte angriffen. Dementsprechend wurden Städte, wie Berlin, Hamburg oder auch das Ruhrgebiet nahezu täglich bombardiert. Die Alliierten nahmen in diesen Fällen keine Rücksicht auf Zivilisten, da die Gefahr zu groß gewesen wäre. So kam es immer wieder zu Gefechten zwischen deutschen und alliierten Jagd- und Bomberverbänden. Zwischen den Jahren 1943/44 verloren die deutschen Flugzeuge die Kontrolle über den Luftraum des Deutschen Reiches, weshalb nun auch sekundäre Ziele, wie Kleinstädte mit kleineren Betrieben, angegriffen wurden. Da die deutschen Jäger- und Bomberflotten unter Benzinmangel litten, wurde bald das Kommando Elbe gegründet, welches versuchte, die alliierten Bomber durch Angriffe mit eigenen Flugzeugen zu stoppen. Man flog buchstäblich in die Bomber hinein, um einen Angriff zu vermeiden, nicht selten starben die jungen Piloten bei diesen Manövern. Am 3. April 1945 wurde die Kreisstadt Holzminden von mehreren US-Bombern und Jägern angegriffen. Dieser Angriff fand zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr statt. Zuerst überflogen die Bomber Holzminden in großer Höhe und verschwanden hinter dem Solling. Gegen 16:30 Uhr kehren sie zurück und starteten die erste Angriffswelle. Ziel des Angriffs der US-Bomber war der Holzmindener Bahnhof. Bei dem vorerst sonnigen Wetter konnte dieses Ziel, an welchem vor kurzem ein paar Truppen eingetroffen waren, wegen der klaren Sicht gut ausgemacht werden. Die Bomber hatten eine Angriffshöhe von ungefähr Metern und griffen vom Nord-Osten her an. Die angekommenen deutschen Truppen suchten nach Sichtung der Bomber die ausgewiesenen Luftschutzbunker in der Nähe auf. Die Bomber warfen Aluminiumstreifen, die besser als Düppel bekannt waren, ab, um die Funkgeräte der 10,5 cm Eisenbahnflaks auszuschalten. Die Bomber flogen auf den Bahnhof zu und fächerten sich auseinander, um eine größere Trefferquote zu erreichen. Die Flugzeuge kippten nach unten ab, um sich ihrer Bombenlast zu entleeren. Somit traf die erste Welle das Gebiet zwischen Bahnhofstraße und Fürstenberger Straße. Bei diesem Angriff starben 158 Menschen. Mit den Angriffen
30 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 30 vom 31. März 1945, dem 06. und 08. April 1945, betrug die Zahl der Bombenopfer Deutsche Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf dem Ehrenfried Auch aus Holzminden mussten viele Männer für Deutschland an der Front kämpfen. Der von Material- und Blutschlachten geprägte Erste Weltkrieg ( ) spielte sich größtenteils im Ausland als Stellungskrieg ab und erhielt seine schrecklichen Züge vor allem durch den hohen Einsatz von Giftgasen. Somit stellte er eine zu der Zeit völlig neue Kriegsform dar, die Millionen von Menschenleben kostete. Ebenso wie im Ersten Weltkrieg, wurden auch im Zweiten Weltkrieg ( ) in den Anfangsjahren der Kriege die verstorbenen Soldaten von der Front zurück in die Heimat überführt, um sie hier bestatten zu können. Später jedoch war dies nicht immer der Fall. Auch in Holzminden verstarben im Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten. In der alten Baugewerkschule wurde ein Lazarett eingerichtet und in einer Baracke im Forster Weg 65 wurden Verwundete aus Kämpfen bei Lüttich versorgt. Das Bataillon 174 des Infanterie- Regiments diente damals zum Schutz der Stadt. Im Zweiten Weltkrieg dagegen sah die Situation anders aus. So waren im März 1945 über Männer des Panzer-Pionier-Bataillons 19 in Holzminden stationiert. Als dann im April die Stadt von den Alliierten angegriffen wurde, starben beim Fliegerangriff einige deutsche Soldaten. Darüber hinaus wurde Holzminden am 6. April 1945 von den Alliierten mit Artilleriefeuer angegriffen. Dabei sollte das hier stationierte Pionierbataillon den Nachschub der Truppen zerstören, da die Stadt nicht mehr gehalten werden konnte. Am 9. April folgte schließlich die Besetzung durch die Amerikaner. Allerdings waren die Kriegsschäden relativ gering, da die Amerikaner den Silo, die Stiebel Eltron Werke und die Brotfabrik trotz Befehls nicht zerstört haben. 3. Ungarische Opfer Im Zweiten Weltkrieg kämpften Ungarn seit 1941 auf der Seite der Achsenmächte, als auf der Seite der Deutschen. Die Freundschaft, die für dieses Bündnis sorgte, beruhte auf einer langen Tradition. Auch heute sind diese beiden Staaten noch eng verbunden. Nachdem die Rote Armee seit Herbst 1944 nach Ungarn vorrückte und dieses besetzte, flohen viele Ungarn in das verbündete Deutsche Reich.
31 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 31 Aus diesem Grunde wurden das Unter- und das Mittelhaus des Landschulheims am Solling am 6. April 1945 von der Mannschaft eines ungarischen Lazaretts besetzt. Die geflohenen Ungarn waren aber nicht mehr als Ärzte aktiv. Die Mannschaft war zusammen mit ihren Familien vermutlich aus der Nähe von Böhmen vor den Russen geflohen. Sie hatten auf Pferdewagen den gesamten Weg von Ungarn bis in das Weserbergland auf sich genommen, da sie lieber in Kriegsgefangenschaft gehen wollten, als sich den Russen auszuliefern. Ihr Aufenthalt im Landschulheim war kein einfach. Sie wurden von außen nicht mit Lebensmitteln versorgt, was dazu führte, dass sie alles, was sie in den Gebäuden fanden, bei der Holzmindener Bevölkerung gegen Nahrung tauschten. Da die Ungarn kaum Deutsch sprachen, ergaben sich keine Beziehungen zu den Menschen in der Stadt. Nur mit den wenigen verbliebenen Familien im Landschulheim gab es vereinzelt freundschaftliche Kontakte. Ende Oktober 1947 kam es nach zweieinhalb Jahren zum Abzug des Lazaretts. Auf diesen Abzug der Ungarn warteten die Landschulheimer schon sehnsüchtig. Trotz der Probleme zwischen Ungarn und Landschulheimern war der Abschied sehr emotional. Ob die Ungarn es geschafft haben nach Kanada auszuwandern, wie es ihr Wunsch gewesen war, ist nicht bekannt. Es ist auch möglich, dass sie in das von Russen besetzte Ungarn zurückkehren mussten. Neben der Lazarettmannschaft waren auch ungarische Soldaten in Holzminden. Es ist nicht bekannt, ob sie vorher schon auf deutscher Seite gekämpft haben oder zusammen mit den Menschen des Lazaretts angekommen sind. Unter den insgesamt 20 belegten Todesfällen befinden sich sieben Soldaten. Da viele Dokumente aus dieser Zeit nicht mehr existieren, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl höher liegt. Auch die Todesdaten der bekannten Opfer sind unvollständig. Vermutlich sind 13 der Todesfälle auf die Bombenangriffe Anfang April zurückzuführen, da sie in dem Zeitraum kurz danach gestorben sind.
32 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 32 Zweite Seite der großen Tafel 4. Zwangsarbeiter 4.1 Osteuropäische Zwangsarbeiter Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es in Deutschland ca. 12 Millionen Zwangsarbeiter. Ein Großteil, ca. 4 Millionen, davon bestand aus Polen und Russen. Durch groß angelegte Razzien in Osteuropa wurden die Zwangsarbeiter mittels Gewalt rekrutiert und nach Deutschland abtransportiert. Diese Menschen wurden Ostarbeiter genannt und standen in der nationalsozialistischen Rangordnung noch unter den westeuropäischen Zwangsarbeitern. Sie waren so genannte Untermenschen. Zwangsarbeiter wurden in der Landwirtschaft und der Rüstungsindustrie eingesetzt, allerdings auch bei Privatpersonen. Die Unterbringung erfolgte meist in Zwangsarbeiterlagern, die aus Baracken bestanden und mit Stacheldrahtzäunen umgeben waren. Auch hier in Holzminden und in seiner Umgebung gab es polnische und russische Zwangsarbeiter. Auf dem örtlichen Friedhof wurden alleine rund 50 Russen, 10 Polen und 50 Kinder in den Kriegsjahren begraben. Während dieser Zeit lebten mehr als 600 Polen und Russen in Holzminden und längst nicht alle Todesfälle wurden aufgeführt. Fast in jedem der 17 bis 20 Lager hier gab es so genannte "Ostarbeiter". Auch in den umliegenden Dörfern wurden Polen und Russen beschäftigt, als bekannte Beispiele gelten das Russenlager Weiße Breite und das Polenlager Domäne Allersheim. Das Freigängerlager Weiße Breite wurde im Jahr 1943 in der Charlotten- und Bebelstraße in Form von drei Holzbaracken errichtet. Es umfasste ca. 200 bis 400 Kriegsgefangene. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Lager durch britische Soldaten aufgelöst. Die Domäne Allersheim gab es seit 1928 an der Straße nach Bevern. Hier wurden Polen beschäftigt, die anfangs noch saisonabhängig arbeiteten. Doch seit dem Beginn des Krieges waren es ausschließlich Zwangsarbeiter. Sein Bekanntheitsgrad wuchs durch eine äußerst brutale Schlägerei als Folge von arbeitsunwilligen Polen, die einen ihrer Feiertag einhielten. Auf dem Holzmindener Friedhof liegen 109 Russen und Polen, die im Zeitraum von bestattet worden. Acht dieser Todesopfer waren Polen und 101 Russen. Die Todesursachen waren nicht selten die unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. 58 dieser Bestatteten waren Kinder. Diese litten besonders schwer unter den schlechten Lebensbedingungen, z.b. der Lebensmittelknappheit. Die Bestattungskosten wurden teilweise notdürftig von der Stadt Holzminden oder dem Arbeitgeber entrichtet. Aus den östlich gelegenen Ländern waren hier zudem auch noch ungefähr 300 Ukrainer untergebracht. Zwölf von ihnen waren Kriegsgefangene, die in einem Waldarbeiterlager im Solling beschäftigt wurden. Sie wurden bei Verletzungen sogar in einem deutschen Lazarett behandelt. Die restlichen Ukrainer befanden sich im Zwangsarbeiterlager Weiße Breite, wo sie unter ebenso schweren und menschenunwürdigen Bedingungen wie die Russen lebten. Die Säuglingssterblichkeit war auch hier erschreckend hoch, sodass man
33 Projektbericht über Holzmindener Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges 33 sogar vermutete, sie seien zum Teil totgeschlagen oder gar ertränkt worden. Auch sie arbeiteten in den umliegenden Betrieben und wurden meist als Landarbeiter eingesetzt. Man kann heute klar zehn Todesfälle nachweisen. Andere sind schwer auszumachen, da in den Friedhofsakten die Ukrainer teilweise unter Russen aufgeführt wurden. Tschechen kamen von 1938 bis 1941 hier freiwillig als Fremdarbeiter her. Sie arbeiteten bei der Firma Ritterbusch und erhofften sich bessere Lebensbedingungen in Deutschland. Hingegen allen Hoffens verschlechterten sich diese Bedingungen im Verlauf des Krieges - wie bei allen Ostarbeitern - immer mehr. Bis heute sind viele Schicksale ungeklärt und oft ist nicht mehr als der Name bekannt. 4.2 Westeuropäische Zwangsarbeiter Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren in Holzminden die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Italiener, Franzosen und der Einwanderer der Beneluxstaaten besser als die der o.g. osteuropäischen Zwangsarbeiter. Viele von ihnen, besonders Italiener, kamen zunächst freiwillig nach Holzminden, weil sie sich hier ein besseres Leben als Fremdarbeiter erhofften. Den westeuropäischen Gastarbeitern wurden ausreichende Essensrationen, ein gutes Gehalt, Zukunftsperspektiven und passable Unterkünfte geboten. Ebenso war es ihnen gestattet soziale Kontakte zu knüpfen und abendliche Unternehmungen zu tätigen. Arbeitgeber waren häufig ansässige Firmen, wie Stiebel Eltron. Weitere Arbeitgeber finden Sie auf der folgenden Karte und in der Tabelle.
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe
 Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
Das Schicksal der Juden in Polen: Vernichtung und Hilfe Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten rund 3,3 Millionen Juden in Polen. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939
70 JAHRE KRIEGSENDE Gedenkstätten in Linz
 70 JAHRE KRIEGSENDE Gedenkstätten in Linz Unser Weg beginnt am Bernaschekplatz. Niemals vergessen. Den Opfern des Nationalsozialismus. Den Kämpfern für ein freies Österreich zur Ehre. Den Lebenden zur
70 JAHRE KRIEGSENDE Gedenkstätten in Linz Unser Weg beginnt am Bernaschekplatz. Niemals vergessen. Den Opfern des Nationalsozialismus. Den Kämpfern für ein freies Österreich zur Ehre. Den Lebenden zur
Rosengarten - Vahrendorf, Kriegsgräberstätte
 Gräber von Opfern des Nationalsozialismus im Landkreis Harburg In Niedersachsen gibt es auf vielen Friedhöfen Grabstätten von Opfern des Nationalsozialismus. Neben großen Friedhöfen und Gräberfelder sind
Gräber von Opfern des Nationalsozialismus im Landkreis Harburg In Niedersachsen gibt es auf vielen Friedhöfen Grabstätten von Opfern des Nationalsozialismus. Neben großen Friedhöfen und Gräberfelder sind
Erinnerungstafel Holzminden
 1 Die durch Bombenangriff am 3. April 1945 zerstörte Zwangsarbeiterbaracke beim Holzmindener Bahnhof. [Quelle: Sammlung Rüdiger Schmidt] Opfer der Luftangriffe im Frühjahr 1945 Etwa 167 Menschen kamen
1 Die durch Bombenangriff am 3. April 1945 zerstörte Zwangsarbeiterbaracke beim Holzmindener Bahnhof. [Quelle: Sammlung Rüdiger Schmidt] Opfer der Luftangriffe im Frühjahr 1945 Etwa 167 Menschen kamen
Kreisarchiv des Hochtaunuskreises. KZ-Häftlinge und Zwangsarbeit im Hochtaunuskreis vier Informationstafeln in Hundstadt, Merzhausen und Kransberg
 Kreisarchiv des Hochtaunuskreises KZ-Häftlinge und Zwangsarbeit im Hochtaunuskreis vier Informationstafeln in Hundstadt, Merzhausen und Kransberg Einleitung Am Ende des Zweiten Weltkrieges lief die deutsche
Kreisarchiv des Hochtaunuskreises KZ-Häftlinge und Zwangsarbeit im Hochtaunuskreis vier Informationstafeln in Hundstadt, Merzhausen und Kransberg Einleitung Am Ende des Zweiten Weltkrieges lief die deutsche
Das Fach Geschichte stellt sich vor. Ziele und Inhalte
 Das Fach Geschichte stellt sich vor Ziele und Inhalte Das Ziel des Faches Geschichte ist durch die Vorgaben der Lehrpläne und Richtlinien eindeutig festgelegt: Schülerinnen und Schüler sollen in der kritischen
Das Fach Geschichte stellt sich vor Ziele und Inhalte Das Ziel des Faches Geschichte ist durch die Vorgaben der Lehrpläne und Richtlinien eindeutig festgelegt: Schülerinnen und Schüler sollen in der kritischen
Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen
 Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen Die Handreichungen des Arbeitskreises Landeskunde/Landesgeschichte Region Mannheim erscheinen im Februar 2003. Vorab und mit Genehmigung des Stadtarchivs
Arbeitsblätter zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sandhofen Die Handreichungen des Arbeitskreises Landeskunde/Landesgeschichte Region Mannheim erscheinen im Februar 2003. Vorab und mit Genehmigung des Stadtarchivs
Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends
 VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
VI 20./21. Jahrhundert Beitrag 14 Schindlers Liste (Klasse 9) 1 von 18 Schindlers Liste eine Annäherung an den Holocaust mittels eines Filmabends Thomas Schmid, Heidelberg E uropa am Beginn der 40er-Jahre
Projektbeschreibung Februar 2011
 Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Projektbeschreibung Deutsch-polnisch-russisches Seminar für StudentInnen: Multiperspektivität der Erinnerung: deutsche, polnische und russische Perspektiven und gesellschaftliche Diskurse auf den Holocaust
Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung)
 Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Erinnerungsstätte Rathaus Attendorn Tafel: Die Verfolgung der Juden Blick vom Kirchturm auf die im Jahre 1900 errichtete Villa Stern am Ostwall. (Foto: Stadtarchiv Attendorn, Fotosammlung) In der Wasserstraße
Denn Joseph Goebbels selbst organisierte das Geschehen vom Münchner Rathaus aus und setzte die schrecklichen Ereignisse von dort aus in Szene.
 Sperrfrist: 10. November 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkveranstaltung
Sperrfrist: 10. November 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Gedenkveranstaltung
Bilder- und Quellenverzeichnis: Bernhard Keuck und Gerd Halmanns (Hrsg.): Juden in der Geschichte des Gelderlandes, Geldern 2002
 e n i e t s r e p l o St m u s s I n i Bilder- und Quellenverzeichnis: www.stolpersteine.eu Bernhard Keuck und Gerd Halmanns (Hrsg.): Juden in der Geschichte des Gelderlandes, Geldern 2002 Online-Artikel
e n i e t s r e p l o St m u s s I n i Bilder- und Quellenverzeichnis: www.stolpersteine.eu Bernhard Keuck und Gerd Halmanns (Hrsg.): Juden in der Geschichte des Gelderlandes, Geldern 2002 Online-Artikel
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt
 Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Leben von Oskar und Emilie Schindler in die Gegenwart geholt Schindler Biografin Erika Rosenberg zu Gast bei Gymnasiasten der Bereiche Gesundheit/Soziales und Wirtschaft Samstag, 13.11.2010 Theo Tangermann
Gedenkveranstaltung am Lagerfriedhof Sandbostel
 Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Gedenkveranstaltung am 29. 4. 2017 Lagerfriedhof Sandbostel - Begrüßung zunächst möchte ich mich bei der Stiftung Lager Sandbostel bedanken, dass ich heute anlässlich des72. Jahrestages der Befreiung des
Volkstrauertag 13. November 2016
 Volkstrauertag 13. November 2016 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Wir haben uns heute hier versammelt, um an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben, zu erinnern. Für die unter
Volkstrauertag 13. November 2016 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! Wir haben uns heute hier versammelt, um an die Menschen, die im Krieg und durch Gewaltherrschaft starben, zu erinnern. Für die unter
Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod
 Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Aus: Inge Auerbacher, Ich bin ein Stern, 1990, Weinheim Basel: Beltz & Gelberg
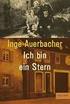 Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Inge Auerbacher wächst als Kind einer jüdischen Familie in einem schwäbischen Dorf auf. Sie ist sieben, als sie 1942 mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird. Inge Auerbacher
Erich Kleeberg. ca (Privatbesitz Ruth Gröne)
 Erich Kleeberg ca. 1939 (Privatbesitz Ruth Gröne) Erich Kleeberg * 3.5.1902 (Boffzen/Weser), Ende April 1945 (Sandbostel) Ausbildung zum Bankkaufmann; 1931 Eheschließung nach jüdischem Brauch mit einer
Erich Kleeberg ca. 1939 (Privatbesitz Ruth Gröne) Erich Kleeberg * 3.5.1902 (Boffzen/Weser), Ende April 1945 (Sandbostel) Ausbildung zum Bankkaufmann; 1931 Eheschließung nach jüdischem Brauch mit einer
MEMORANDUM ZUR VERLEGUNG DER STOLPERSTEINE
 FÖRDERVEREIN EISLEBER SYNAGOGE E.V www.synagoge-eisleben.de MEMORANDUM ZUR VERLEGUNG DER STOLPERSTEINE Für Alfred und Pauline Katzenstein vor ihrem letzten Wohnort in der Geiststraße 6 in Eisleben. Lutherstadt
FÖRDERVEREIN EISLEBER SYNAGOGE E.V www.synagoge-eisleben.de MEMORANDUM ZUR VERLEGUNG DER STOLPERSTEINE Für Alfred und Pauline Katzenstein vor ihrem letzten Wohnort in der Geiststraße 6 in Eisleben. Lutherstadt
Kriegsgräberstätten Heldengedenken oder Mahnung für den Frieden und gegen den Krieg?
 Kriegsgräberstätten Heldengedenken oder Mahnung für den Frieden und gegen den Krieg? Einstieg Diese Einheit ist primär theoretisch und textbasiert. Die Schüler erarbeiten anhand von zwei Arbeitsblättern
Kriegsgräberstätten Heldengedenken oder Mahnung für den Frieden und gegen den Krieg? Einstieg Diese Einheit ist primär theoretisch und textbasiert. Die Schüler erarbeiten anhand von zwei Arbeitsblättern
Kriegsgefangenenfriedhof Hörsten
 Kriegsgefangenenfriedhof Hörsten Sowjetisches Mahnmal mit Relief Die Trauernde. Die Marmorskulptur wurde von Mykola Muchin, einem bekannten Künstler aus Kiew, geschaffen. Foto: Peter Wanninger, 2009 Für
Kriegsgefangenenfriedhof Hörsten Sowjetisches Mahnmal mit Relief Die Trauernde. Die Marmorskulptur wurde von Mykola Muchin, einem bekannten Künstler aus Kiew, geschaffen. Foto: Peter Wanninger, 2009 Für
D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE
 D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE Didaktische Materialien D: Fragebogen zur Gruppenarbeit Herausgeber und v.i.s.d.p Heimatverein Dingden e. V. Hohe Straße 1 46499 Hamminkeln
D GESCHICHTSORT HUMBERGHAUS GESCHICHTE EINER DEUTSCHEN FAMILIE Didaktische Materialien D: Fragebogen zur Gruppenarbeit Herausgeber und v.i.s.d.p Heimatverein Dingden e. V. Hohe Straße 1 46499 Hamminkeln
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Lager Am Bauhof in Herten- Langenbochum. Hindenburgstraße
 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Lager Am Bauhof in Herten- Langenbochum Lyckstraße/ Hindenburgstraße Präsentation von Hans-Heinrich Holland, erstellt anlässlich des internationalen Gedenktages für
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Lager Am Bauhof in Herten- Langenbochum Lyckstraße/ Hindenburgstraße Präsentation von Hans-Heinrich Holland, erstellt anlässlich des internationalen Gedenktages für
BAYERISCHES SCHULMUSEUM ICHENHAUSEN
 BAYERISCHES SCHULMUSEUM ICHENHAUSEN Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums München Schlossplatz 3, 89335 Ichenhausen, Tel. 08223 6189 Schülerbogen 5 SCHULE UND ERZIEHUNG IM NATIONALSOZIALISMUS Der
BAYERISCHES SCHULMUSEUM ICHENHAUSEN Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums München Schlossplatz 3, 89335 Ichenhausen, Tel. 08223 6189 Schülerbogen 5 SCHULE UND ERZIEHUNG IM NATIONALSOZIALISMUS Der
JUDENVERFOLGUNG IN DRESDEN
 Dr. Nora Goldenbogen JUDENVERFOLGUNG IN DRESDEN 1933 1945 25. April 1943, Ostersonntag vormittag Die Todesdrohungen immer näher und würgender: Juliusburger am Mittwoch verhaftet, am Freitag tot. Meinhard
Dr. Nora Goldenbogen JUDENVERFOLGUNG IN DRESDEN 1933 1945 25. April 1943, Ostersonntag vormittag Die Todesdrohungen immer näher und würgender: Juliusburger am Mittwoch verhaftet, am Freitag tot. Meinhard
Aktionstag Geschichte der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Spaichingen
 Aktionstag Geschichte der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Spaichingen Geschichtsvereine, Archive, Museen und Gedenkstätten informierten über Ihre Arbeit von Reinhard Mahn "Zeitgeschichte: Forschen erinnern
Aktionstag Geschichte der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Spaichingen Geschichtsvereine, Archive, Museen und Gedenkstätten informierten über Ihre Arbeit von Reinhard Mahn "Zeitgeschichte: Forschen erinnern
Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit. Wesendorfs Zukunft hat eine lange und bewegte Vergangenheit
 Workshop 02.05.2016, Landgasthaus Schönecke, Wahrenholz Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit Hier: Wesendorfs Zukunft hat eine lange und bewegte Vergangenheit Lichtbildervortrag: Wilhelm Bindig
Workshop 02.05.2016, Landgasthaus Schönecke, Wahrenholz Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit Hier: Wesendorfs Zukunft hat eine lange und bewegte Vergangenheit Lichtbildervortrag: Wilhelm Bindig
Es gilt das gesprochene Wort
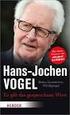 Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Es gilt das gesprochene Wort Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Siegfried Balleis anlässlich des nationalen Gedenktages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1.2005, 19.30 Uhr, Hugenottenkirche
Sehr geehrter Herr Prof. Lahnstein, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, meine sehr verehrten Damen, meine Herren,
 Sehr geehrter Herr Prof. Lahnstein, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, gestern haben wir den 340. Geburtstag unserer Handelskammer gefeiert. Ein beeindruckendes Alter
Sehr geehrter Herr Prof. Lahnstein, sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, gestern haben wir den 340. Geburtstag unserer Handelskammer gefeiert. Ein beeindruckendes Alter
MATERIAL 4. Geflüchtet und vertrieben. Aus dem Unabhängigen Staat Kroatien einem Vasallenstaat Nazi-Deutschlands vertriebene Serben
 MATERIAL 4 Während des Zweiten Weltkriegs fielen Millionen Menschen Massenhinrichtungen, Deportationen, Hunger, Zwangsarbeit und Bombardements zum Opfer oder wurden in den Konzentrationslagern ermordet.
MATERIAL 4 Während des Zweiten Weltkriegs fielen Millionen Menschen Massenhinrichtungen, Deportationen, Hunger, Zwangsarbeit und Bombardements zum Opfer oder wurden in den Konzentrationslagern ermordet.
Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag
 Bundesrat Drucksache 420/10 07.07.10 Antrag des Landes Berlin In Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Bundesrat Drucksache 420/10 07.07.10 Antrag des Landes Berlin In Entschließung des Bundesrates zur Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Angebot für Jugendliche der 9ten und 10ten Klassen aus Gymnasien. Schuljahr 2010/2011. Historisch-politische Bildung
 Die Einrichtung lernort gedenkstätte macht Angebote der historisch-politischen Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Die Einrichtung lernort gedenkstätte macht Angebote der historisch-politischen Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg?
 Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Ausstellung Que reste t il de la Grande Guerre? Was bleibt vom Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg: Ein Konflikt gekennzeichnet durch massenhafte Gewalt 1. Raum: Die Bilanz: eine zerstörte Generation
Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden)
 Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden) Zwischen dem 3. Februar und dem 6. April 1945 wurden etwa 500 Häftlinge aus dem Lager Laurahütte einem Außenlager des KZ Auschwitz III (Monowitz) in Hannover-Mühlenberg
Hannover-Mühlenberg (Hanomag/Linden) Zwischen dem 3. Februar und dem 6. April 1945 wurden etwa 500 Häftlinge aus dem Lager Laurahütte einem Außenlager des KZ Auschwitz III (Monowitz) in Hannover-Mühlenberg
Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen
 Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen Die Malerin Michaela Classen gibt mit ihren Porträts Kindern, die der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Opfer fielen, eine Lebensgeschichte.
Die Reise nach Jerusalem Bilder von Michaela Classen Die Malerin Michaela Classen gibt mit ihren Porträts Kindern, die der nationalsozialistischen Judenverfolgung zum Opfer fielen, eine Lebensgeschichte.
Schmerzhafte Erinnerung Die Ulmer Juden und der Holocaust
 Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen
 Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen Eine Spurensuche nach Frau Johanna Schwarz, geb. Michel, der evangelischen Kirche Böhringen Stand: 16.03.2011 1. Kurze Geschichte der Deportierten
Jüdisches Leben am westlichen Bodensee am Beispiel von Bohlingen Eine Spurensuche nach Frau Johanna Schwarz, geb. Michel, der evangelischen Kirche Böhringen Stand: 16.03.2011 1. Kurze Geschichte der Deportierten
Das kurze Leben von Anna Lehnkering
 Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
Das kurze Leben von Anna Lehnkering Tafel 1 Anna als Kind Anna wurde 1915 geboren. Anna besuchte für 5 Jahre eine Sonder-Schule. Lesen, Schreiben und Rechnen findet Anna schwer. Anna ist lieb und fleißig.
53894 Mechernich-Bleibuir
 Der jüdische Friedhof in 53894 Mechernich-Bleibuir 9. September 2008 9 Seiten Der vorliegende Beitrag ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und stellt eine vorläufige Vorabfassung dar.
Der jüdische Friedhof in 53894 Mechernich-Bleibuir 9. September 2008 9 Seiten Der vorliegende Beitrag ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und stellt eine vorläufige Vorabfassung dar.
Es gilt das gesprochene Wort!
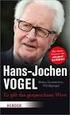 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Vorlage zur Kenntnisnahme
 Drucksache 16/3394 30.07.2010 16. Wahlperiode Vorlage zur Kenntnisnahme Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite
Drucksache 16/3394 30.07.2010 16. Wahlperiode Vorlage zur Kenntnisnahme Erklärung des 8. Mai als Tag der Befreiung zum nationalen Gedenktag Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses können über die Internetseite
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17
 Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Auf den Spuren des Nationalsozialismus
 Auf den Spuren des Nationalsozialismus Bericht über die Studienfahrt nach Polen Von Egemen Övec, Klasse 8a Ein Kaufhaus in Krakowska in Polen nach der Ankunft. Vom 14. bis zum 19. April 2011 durften mehrere
Auf den Spuren des Nationalsozialismus Bericht über die Studienfahrt nach Polen Von Egemen Övec, Klasse 8a Ein Kaufhaus in Krakowska in Polen nach der Ankunft. Vom 14. bis zum 19. April 2011 durften mehrere
1865 Am 1. August wurde Schwester Martha in Korbach geboren.
 Anna Rothschild, geb. Lebach geb. 21.6.1863 1 oder am 21.7.1866 2 in Korbach gest. wohl 1942 in Minsk Eltern: Kaufmann und Getreidehändler Levi Lebach (1826-97) und Julie, geb. Salberg, aus Eimelrod Geschwister:
Anna Rothschild, geb. Lebach geb. 21.6.1863 1 oder am 21.7.1866 2 in Korbach gest. wohl 1942 in Minsk Eltern: Kaufmann und Getreidehändler Levi Lebach (1826-97) und Julie, geb. Salberg, aus Eimelrod Geschwister:
Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden
 Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
Klaus Euhausen Waldrandsiedlung 28 16761 Hennigsdorf Tel. / Fax: 03302-801178 E-Mail: euhausen@aol.com DOKUMENTATION Denkmal für die ermordeten Oldersumer Juden Klaus Euhausen Wrangelstraße 66 10 997 Berlin
ANNE FRANK TAG JAHRE TAGEBUCH
 ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
ANNE FRANK TAG 2017 75 JAHRE TAGEBUCH Am 12. Juni ist Anne Franks Geburtstag. Vor 75 Jahren, zu ihrem 13. Geburtstag, hat sie von ihren Eltern ein Tagebuch geschenkt bekommen. Darin schrieb sie ihre Erlebnisse,
Unterwegs bei Kriegsende
 Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften am Beispiel der Konzentrationslager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Seminar für interessierte Erwachsene
Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften am Beispiel der Konzentrationslager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Seminar für interessierte Erwachsene
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Arbeit für den Frieden Versöhnung über den Gräbern
 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Arbeit für den Frieden Versöhnung über den Gräbern 1919 gründete sich eine Bürgerinitiative Kriegsgräberfürsorge, was ist das? Gegründet 1919 als Bürgerinitiative
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Arbeit für den Frieden Versöhnung über den Gräbern 1919 gründete sich eine Bürgerinitiative Kriegsgräberfürsorge, was ist das? Gegründet 1919 als Bürgerinitiative
 Ergänzungen zu den Aufzeichnungen der israelitischen Gemeinde von Bürstadt Die Aufzeichnungen und Berichte von Herrn Hans Goll sind in hervorragender Weise verfasst und niedergeschrieben worden, die Niederschrift
Ergänzungen zu den Aufzeichnungen der israelitischen Gemeinde von Bürstadt Die Aufzeichnungen und Berichte von Herrn Hans Goll sind in hervorragender Weise verfasst und niedergeschrieben worden, die Niederschrift
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung
 Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Schautafel-Inhalte der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen zur Nakba-Ausstellung Die Nakba-Ausstellung will das Schicksal und das Leid der palästinensischen Bevölkerung dokumentieren. Wer ein Ende
Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, , Uhr, Haus Kirchstraße 21
 Seite 1 von 12 1 Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, 9.11.2009, 14.30 Uhr, Haus Kirchstraße 21 Meine sehr geehrten Herren und Damen,
Seite 1 von 12 1 Rede von Frau Bürgermeisterin Maria Unger anlässlich des Beitritts der Stadt Gütersloh zum Riga-Komitee, 9.11.2009, 14.30 Uhr, Haus Kirchstraße 21 Meine sehr geehrten Herren und Damen,
Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften mitten in Deutschland
 Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften mitten in Deutschland Am Beispiel der Lager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Ein Seminar für interessierte
Unterwegs bei Kriegsende KZ-Landschaften mitten in Deutschland Am Beispiel der Lager Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora Gedenkstätte Bergen-Belsen Ein Seminar für interessierte
Ausstellung und Veranstaltungen. Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945
 Ausstellung und Veranstaltungen Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Ausstellung Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Vor 70
Ausstellung und Veranstaltungen Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Ausstellung Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Vor 70
Hendrikus van den Berg
 Hendrikus van den Berg 1936 (Privatbesitz Beatrice de Graaf) *23.2.1910 (Putten/Niederlande), 31.7.1975 (Putten) Goldschmied; Oktober 1944 nach deutscher Strafaktion gegen sein Dorf ins KZ Neuengamme deportiert;
Hendrikus van den Berg 1936 (Privatbesitz Beatrice de Graaf) *23.2.1910 (Putten/Niederlande), 31.7.1975 (Putten) Goldschmied; Oktober 1944 nach deutscher Strafaktion gegen sein Dorf ins KZ Neuengamme deportiert;
[Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Weissenbach/Triesting]
![[Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Weissenbach/Triesting] [Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Weissenbach/Triesting]](/thumbs/69/60499548.jpg) [Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Weissenbach/Triesting] LISTE DER OPFER AUS WEISSENBACH A.D. TRIESTING BZW. NEUHAUS (Quellen: www.lettertothestars.at, Heimatbuch der Marktgemeinde Weissenbach)
[Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Weissenbach/Triesting] LISTE DER OPFER AUS WEISSENBACH A.D. TRIESTING BZW. NEUHAUS (Quellen: www.lettertothestars.at, Heimatbuch der Marktgemeinde Weissenbach)
Rede zum Volkstrauertag 2015
 Rede zum Volkstrauertag 2015 1 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren Kriegsgräber sind Wegweiser in den Frieden. Diese Überzeugung, diese Hoffnung hegte der Friedensnobelpreisträger
Rede zum Volkstrauertag 2015 1 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren Kriegsgräber sind Wegweiser in den Frieden. Diese Überzeugung, diese Hoffnung hegte der Friedensnobelpreisträger
Liste der Patenschaften
 1 von 6 01.07.2013 Liste der Patenschaften Quellen: Beiträge zur Geschichte der Juden in Dieburg, Günter Keim / mit den Ergänzungen von Frau Kingreen Jüdische Bürgerinnen und Bürger Strasse Ergänzungen
1 von 6 01.07.2013 Liste der Patenschaften Quellen: Beiträge zur Geschichte der Juden in Dieburg, Günter Keim / mit den Ergänzungen von Frau Kingreen Jüdische Bürgerinnen und Bürger Strasse Ergänzungen
Ella Kozlowski, geb. Herschberg
 , geb. Herschberg 2000 (ANg, 2013-21) * 9.3.1920 (Berlin), 14.2.2013 1934 Auswanderung nach Polen; 1939 Getto Zduńska Wola; August 1942 Getto Lodz; Auschwitz-Birkenau; 29.8.1944 bis April 1945 KZ Neuengamme,
, geb. Herschberg 2000 (ANg, 2013-21) * 9.3.1920 (Berlin), 14.2.2013 1934 Auswanderung nach Polen; 1939 Getto Zduńska Wola; August 1942 Getto Lodz; Auschwitz-Birkenau; 29.8.1944 bis April 1945 KZ Neuengamme,
Widerstand und Überleben
 Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Widerstand und Überleben Die Poträts der 232 Menschen, die aus dem 20. Deportationszug in Belgien befreit wurden, am Kölner Hauptbahnhof 26./27.1. 2008 Eine Aktion der Gruppe Bahn erinnern GEDENKEN UND
Grabower Juden im 1. Weltkrieg
 Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
Grabower Juden im 1. Weltkrieg Mitten im Ersten Weltkrieg, am 11. Oktober 1916, verfügte der preußische Kriegsminister Adolf Wild von Hohenborn die statistische Erhebung des Anteils von Juden an den Soldaten
die Jugendlichen aus Belgien und Deutschland, die ihr diese Gedenkfeier heute mitgestaltet.
 Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen aus Bonn und Warschau
 Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Was war was wird? Projekt des Lyceums im Adama Mickiewicza (Warschau) und der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel Projektarbeit 2004 (Teil 2) Wo ist das Warschauer Ghetto? Eine Neuentdeckung von Jugendlichen
Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von Max Frisch haben wir befunden, dass wir uns mit der Kultur der
 Projekt: Spaziergang durch das Jüdische Viertel Leitung: Ursula Stoff Führung: Gabriela Kalinová Klasse: 5.b 13. Mai 2009 Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von
Projekt: Spaziergang durch das Jüdische Viertel Leitung: Ursula Stoff Führung: Gabriela Kalinová Klasse: 5.b 13. Mai 2009 Im Anschluss an die intensive Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Andorra von
Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem
 Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem Alex Devries Hilde Devries Jüdische Opfer: 2-4, 6-13, 15-19, 21-32, 34-42 Behinderte: 5, 14, 20, 33, 44-46
Stadtplan und Hintergrundinformationen zu den Standorten der Stolpersteine in der Gemeinde Uedem Alex Devries Hilde Devries Jüdische Opfer: 2-4, 6-13, 15-19, 21-32, 34-42 Behinderte: 5, 14, 20, 33, 44-46
Mit Stempel und Unterschrift
 Mit Stempel und Unterschrift Dokumente zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus Eine digitale Werkstatt für Quelleninterpretation Lehrmaterial 12 Dokumente Arbeitsblätter Kommentare 1 Angeworben zur Zwangsarbeit,
Mit Stempel und Unterschrift Dokumente zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus Eine digitale Werkstatt für Quelleninterpretation Lehrmaterial 12 Dokumente Arbeitsblätter Kommentare 1 Angeworben zur Zwangsarbeit,
Ausführungen von Gert Hager, Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim, anlässlich der Gedenkfeier am auf dem Hauptfriedhof
 Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Dezernat I Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Rats- und Europaangelegenheiten Pressereferent Tel: 07231-39 1425 Fax: 07231-39-2303 presse@stadt-pforzheim.de ES GILT DAS GESPROCHENE WORT Ausführungen von Gert
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried
 Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Livia Fränkel (links) und Hédi Fried 1946 (Privatbesitz Hédi Fried) Hédi Fried, geb. Szmuk * 15.6.1924 (Sighet/Rumänien) April 1944 Getto Sighet; 15.5.1944 Auschwitz; von Juli 1944 bis April 1945 mit ihrer
Zwangsarbeiter fremdländischer Herkunft im 2. Weltkrieg und ihre Gedenkstätten
 Zwangsarbeiter fremdländischer Herkunft im 2. Weltkrieg und ihre Gedenkstätten Das Denkmal für die Emder Zwangsarbei ter wurde von Herald Ihnen zusammen mit deutschen, polnischen und russischen Jugendlichen
Zwangsarbeiter fremdländischer Herkunft im 2. Weltkrieg und ihre Gedenkstätten Das Denkmal für die Emder Zwangsarbei ter wurde von Herald Ihnen zusammen mit deutschen, polnischen und russischen Jugendlichen
Unser Weg zu den Stolpersteinen
 Unser Weg zu den Stolpersteinen An einem kalten Herbsttag vor ca. 1 ½ Jahren haben wir auf einem Spaziergang durch Kreuzberg die erste Bekanntschaft mit Stolpersteinen gemacht. Sie waren vielen aus unserem
Unser Weg zu den Stolpersteinen An einem kalten Herbsttag vor ca. 1 ½ Jahren haben wir auf einem Spaziergang durch Kreuzberg die erste Bekanntschaft mit Stolpersteinen gemacht. Sie waren vielen aus unserem
Unsere Heimat in der NS-Zeit
 Unsere Heimat in der NS-Zeit Struktur Alltag in der NS-Zeit Erinnerung an die letzten Kriegsjahre Spuren. Gedanken zur Geschichte Alltag in der NS-Diktatur in Krefeld Bombenangriff am 22. Juni 1943 Alltag
Unsere Heimat in der NS-Zeit Struktur Alltag in der NS-Zeit Erinnerung an die letzten Kriegsjahre Spuren. Gedanken zur Geschichte Alltag in der NS-Diktatur in Krefeld Bombenangriff am 22. Juni 1943 Alltag
Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je?
 Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je? Zugegeben: Die Überschrift ist provokativ. Das will sie bewusst sein, denn um den Begriff Volkstrauertag auch noch heute
Volkstrauertag ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert oder notwendiger denn je? Zugegeben: Die Überschrift ist provokativ. Das will sie bewusst sein, denn um den Begriff Volkstrauertag auch noch heute
Kriegsgefangenenfriedhof Wietzendorf
 Kriegsgefangenenfriedhof Wietzendorf Foto: Peter Wanninger, 2010 Von allen Bäumen haben sie die Rinde abgeschält und gegessen. Aus dem Tagebuch des Landesschützen H.D.Meyer, der ab Januar 1942 in Wietzendorf
Kriegsgefangenenfriedhof Wietzendorf Foto: Peter Wanninger, 2010 Von allen Bäumen haben sie die Rinde abgeschält und gegessen. Aus dem Tagebuch des Landesschützen H.D.Meyer, der ab Januar 1942 in Wietzendorf
Erinnern für die Zukunft:
 Erinnern für die Zukunft: Frieden und Demokratie sind in Gefahr, wenn politisches Desinteresse, Gewaltbereitschaft und Anfälligkeit für radikales, fremdenfeindliches Gedankengut zunehmen. Wie wichtig ist
Erinnern für die Zukunft: Frieden und Demokratie sind in Gefahr, wenn politisches Desinteresse, Gewaltbereitschaft und Anfälligkeit für radikales, fremdenfeindliches Gedankengut zunehmen. Wie wichtig ist
Topographie der Erinnerung
 Topographie der Erinnerung Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus im Gebiet der Braunschweigischen Landschaft Herausgegeben im Auftrag der Braunschweigischen Landschaft e. V., Arbeitsgruppe
Topographie der Erinnerung Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus im Gebiet der Braunschweigischen Landschaft Herausgegeben im Auftrag der Braunschweigischen Landschaft e. V., Arbeitsgruppe
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
 Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Holocaust-Gedenktag - Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (27. Januar 1945) Das komplette Material finden Sie hier:
Das Zwangsarbeitslager Am Dammacker in Bremen-Huckelriede
 Das Zwangsarbeitslager Am Dammacker in Bremen-Huckelriede Historische Daten und Fakten zusammengestellt von der Geschichtsgruppe "AnwohnerInnen gegen das Vergessen" Einrichtung der Zwangsarbeiterlager
Das Zwangsarbeitslager Am Dammacker in Bremen-Huckelriede Historische Daten und Fakten zusammengestellt von der Geschichtsgruppe "AnwohnerInnen gegen das Vergessen" Einrichtung der Zwangsarbeiterlager
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 96-2 vom 23. September 2008 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Fundraising Dinner zugunsten des Denkmals für die ermordeten Juden Europas am 23. September
Im Frühjahr 1933 begannen die bauten der ersten offiziellen Konzentrationslager.
 Was ist ein Konzentrationslager? Konzentrationslager sind Inhaftierungen in denen Juden, Homosexuelle, Kriminelle, Asoziale, Zeugen Jehovas, Zigeuner ab 1939 auch unerwünschte Ausländer und Kriegsgefangene
Was ist ein Konzentrationslager? Konzentrationslager sind Inhaftierungen in denen Juden, Homosexuelle, Kriminelle, Asoziale, Zeugen Jehovas, Zigeuner ab 1939 auch unerwünschte Ausländer und Kriegsgefangene
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Luftangriff auf Wulfen am 22. März 1945
 Forder- Förder- Projekt 2015 Wittenbrinkschule Dorsten- Wulfen Moritz Brockhaus Klasse 3b Thema: Luftangriff auf Wulfen am 22. März 1945 Luftangriff auf Wulfen am 22. März 1945 VORWORT Ich berichte über
Forder- Förder- Projekt 2015 Wittenbrinkschule Dorsten- Wulfen Moritz Brockhaus Klasse 3b Thema: Luftangriff auf Wulfen am 22. März 1945 Luftangriff auf Wulfen am 22. März 1945 VORWORT Ich berichte über
Die Schiffskatastrophe vom 3. Mai 1945 in der bundesdeutschen Presseberichterstattung
 Die Schiffskatastrophe vom 3. Mai 1945 in der bundesdeutschen Presseberichterstattung Die Presseberichterstattung über die irrtümliche Bombardierung der Schiffe Cap Arcona und Thielbek durch die britische
Die Schiffskatastrophe vom 3. Mai 1945 in der bundesdeutschen Presseberichterstattung Die Presseberichterstattung über die irrtümliche Bombardierung der Schiffe Cap Arcona und Thielbek durch die britische
Quelle: Personalakte Strafgefängnis Bremen-Oslebshausen Tilgungsbescheinigung
 9. Schicksale Ort: Gerichtstrakt Quelle: Tilgungsbescheinigung Literatur: Lübeck - eine andere Geschichte. Einblicke in Widerstand und Verfolgung in Lübeck 1933-1945. Sowie: Alternativer Stadtführer zu
9. Schicksale Ort: Gerichtstrakt Quelle: Tilgungsbescheinigung Literatur: Lübeck - eine andere Geschichte. Einblicke in Widerstand und Verfolgung in Lübeck 1933-1945. Sowie: Alternativer Stadtführer zu
Auschwitzfahrt ( )
 Inhaltsverzeichnis Auschwitzfahrt (17.02.-21.02.2017) Gespräch mit Pfarrer Dr. Manfred Deselaers Führung durch das Stammlager (Auschwitz 1) Führung durch die Ausstellung eines ehemaligen Häftlings Führung
Inhaltsverzeichnis Auschwitzfahrt (17.02.-21.02.2017) Gespräch mit Pfarrer Dr. Manfred Deselaers Führung durch das Stammlager (Auschwitz 1) Führung durch die Ausstellung eines ehemaligen Häftlings Führung
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27.
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Mittwoch, 27. Januar 2009, 12:00 Uhr Schloß Oberhausen, Konrad Adenauer Allee
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen -
 Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
Wo einst die Schtetl waren... - Auf den Spuren jüdischen Lebens in Ostpolen - unter diesem Motto veranstaltete Zeichen der Hoffnung vom 13. 21. Aug. 2006 eine Studienfahrt nach Polen. Die 19 Teilnehmenden
im Nationalsozialismus
 Der Landkreis Mühldorf a. Inn im Nationalsozialismus RHOMBOS-VERLAG BERLIN 1 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich.
Der Landkreis Mühldorf a. Inn im Nationalsozialismus RHOMBOS-VERLAG BERLIN 1 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich.
Projekt zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus : (Das Projekt begleiteten Frau Brändle und Herr Sterk)
 Projekt zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus : (Das Projekt begleiteten Frau Brändle und Herr Sterk) Präsentation am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in Zwiefalten am 27.
Projekt zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus : (Das Projekt begleiteten Frau Brändle und Herr Sterk) Präsentation am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in Zwiefalten am 27.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Richard von Weizsäcker - "Zum 40. Jahrestag der Beendigung Gewaltherrschaft" (8.5.1985 im Bundestag in Bonn) Das komplette Material
Gerechte unter den Völkern
 Materialien zu dem Workshop Gerechte unter den Völkern International School for Holocaust Studies Yad Vashem 1. Vier historische Fotografien (siehe Stundenablauf ) 2. Informationen zu Yad Vashem und dem
Materialien zu dem Workshop Gerechte unter den Völkern International School for Holocaust Studies Yad Vashem 1. Vier historische Fotografien (siehe Stundenablauf ) 2. Informationen zu Yad Vashem und dem
Inhalt. 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus. So findet ihr euch im Buch zurecht... 10
 Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Schüler mit offenen Herzen und Hirnen Fünf Tage in Auschwitz und Krakau
 Schüler mit offenen Herzen und Hirnen Fünf Tage in Auschwitz und Krakau Als ich meine Erwartungen Anfang September (2011) formulierte, habe ich nicht mit einer so erfahrungsreichen und einmaligen Klassenfahrt
Schüler mit offenen Herzen und Hirnen Fünf Tage in Auschwitz und Krakau Als ich meine Erwartungen Anfang September (2011) formulierte, habe ich nicht mit einer so erfahrungsreichen und einmaligen Klassenfahrt
Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas
 Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas Wir als Profil Politik haben am 22.09.2016-23.09.2016 eine Projektfahrt nach Berlin gemacht. Im Rahmen der Kursfahrt haben wir die Gedenkstätte
Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas Wir als Profil Politik haben am 22.09.2016-23.09.2016 eine Projektfahrt nach Berlin gemacht. Im Rahmen der Kursfahrt haben wir die Gedenkstätte
Arbeitsblatt - Thema Demografie Schule
 Familie im Sand vor der Ahlbecker Seebrücke (Ostsee) Leseverstehen Sprechen Schreiben Foto: König Jens, UTG, http://www.auf-nach-mv.de 1. Wie viele Kinder werden in einem Land geboren? Die UNO ermittelt
Familie im Sand vor der Ahlbecker Seebrücke (Ostsee) Leseverstehen Sprechen Schreiben Foto: König Jens, UTG, http://www.auf-nach-mv.de 1. Wie viele Kinder werden in einem Land geboren? Die UNO ermittelt
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27.
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27. Januar 2014, 11:00 Uhr Aula Sophie - Scholl - Gymnasium, Tirpitzstraße
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27. Januar 2014, 11:00 Uhr Aula Sophie - Scholl - Gymnasium, Tirpitzstraße
Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg
 Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg präsentieren wir hier einen Text, der das Schicksal der Duisburgerin Christine Lehmann schildert. Er stammt
Im Rahmen unseres Projekts Spurensuche zur Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma in Duisburg präsentieren wir hier einen Text, der das Schicksal der Duisburgerin Christine Lehmann schildert. Er stammt
Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten.
 Zachor! Erinnere dich! Hennefer Stolpersteine Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten. Herausgegeben vom Stadtarchiv Hennef in Zusammenarbeit mit dem Ökumenekreis der Evangelischen und Katholischen
Zachor! Erinnere dich! Hennefer Stolpersteine Übersicht über die Orte, die Namen und die Lebensdaten. Herausgegeben vom Stadtarchiv Hennef in Zusammenarbeit mit dem Ökumenekreis der Evangelischen und Katholischen
