Facharbeit. Vorkommen der Gattung Sphagnum im Schorenmoos
|
|
|
- Helmut Dunkle
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen Kollegstufe Jahrgang: /2010 Leistungskurs:...Biologie Kollegiat:...Franz Hofmann Facharbeit Vorkommen der Gattung Sphagnum im Schorenmoos Abgegeben am: Bewertung: Facharbeit: Note: Punkte: Mündliche Prüfung: Note: Punkte: Gesamtergebnis: Note: Punkte: Datum und Unterschrift des Kursleiters:
2 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Sphagnopsida Torfmoose Ökologie Bedeutung Moore Wirtschaft Arbeitsweise und Bestimmung Ergebnisse Sektion Sphagnum Sektion Acutifolia Sektion Squarrosa Sektion Cuspidata Sektion Subsecunda Ausblick Quellenverzeichnis Anhang...17
3 3 1. Einleitung Um zu überprüfen, ob Renaturierungsmaßnahmen in einem Gebiet Wirkung zeigen oder ob sie nötig sind, wird immer wieder, in sinnvollem zeitlichem Abstand, die Pflanzenwelt des Gebiets kartiert und die Vorkommen der Pflanzen bestimmt. So kann man nicht nur sehr viel über ihre Lebensräume und ihre Ökologie lernen, sondern es wird auch die Möglichkeit gegeben Veränderungen in der Natur zu erkennen und, falls nötig, einzuschreiten. So geht man den Gründen für das Verschwinden oder Auftauchen einer Art oder für andere Veränderungen im Gebiet auf den Grund. Die Natur zeigt uns auf diese Weise genau, welche Auswirkungen die Aktivitäten der Menschen haben. Die gestellte Aufgabe war eben eine solche Kartierung der Gattung Sphagnum im Schorenmoos durchzuführen. Sphagnum ist nicht nur einfach ein Moos, es beeinflusst seinen Standort und sagt auch durch Präsenz bzw. Absenz einiges über die Qualität dieses Standortes aus. Ziel der Arbeit war also möglichst viele unterschiedliche Arten von denen dort zu finden, die zuvor schon einmal gefunden wurden und so eventuell auf Änderungen der Standorte schließen zu können. Das Schorenmoos, ein Gebiet im Oberallgäu, etwas nördlich der Ortschaft Käsers gelegen, gehört zur Gemeinde Dietmannsried. Der größte Teil des Gebiets besteht aus einer Hochmoorfläche. Kleinere Flächen sind eher als Zwischenmoor zu klassifizieren, jedoch weisen diese hochmoorartigen Charakter auf. Diese Erkenntnis kann aufgrund der Vegetation gefasst werden, denn neben den typischen Zwischenmoorpflanzen finden sich auch solche, die eher für das Hochmoor typisch sind, unter anderem auch die in dieser Arbeit untersuchte Gattung Sphagnum. 2. Sphagnopsida Torfmoose 2.1 Ökologie Die Beschreibung der Ökologie basiert auf NEBEL/PHILIPPI (2005, S.13-15). Die Moose der Gattung Sphagnum wachsen an feuchten Standorten, meist in Mooren oder auf Feuchtwiesen. Ihre Anwesenheit bzw. Abwesenheit ist ein Indiz für die Qualität eines Moores und sie sind
4 4 zudem ein Indikator für saure Umgebung. Sie tauschen Ionen mit dem umgebenden Wasser aus, wobei sie Kationen aus der Umgebung aufnehmen (z.b. Kalziumionen und Magnesiumionen aus dem Regenwasser) und dafür Oxonium-Ionen abgeben. Dieser Vorgang erhöht stetig die H 3 O + -Ionenkonzentration im direkten Umfeld der Pflanzen, was zu einer Senkung des ph-wertes führt und so das saure Milieu an vielen Moorstandorten zur Folge hat - Moorwasser in Hochmooren ist fast so sauer wie unverdünnter Essig (ph = 3-4). Durch den Ionenaustausch verbessern sich die Lebensbedingungen für die Sphagnum-Pflanzen, da sie durch die ph-wert-senkung andere Pflanzen, die mit ihnen um den Standort konkurrieren, im Wachstum hemmen, was Sphagnum zu einer konkurrenzstarken Art im Bereich der Moorvegetation macht. Um den Ionenaustausch zu vollziehen, muss die Pflanze nicht einmal mehr am Leben sein, selbst abgestorbene Pflanzenteile sind noch dazu befähigt. Der Austausch findet über die Polyuronsäure statt, die sich in der Cellulose-Matrix der Zellwand befindet. Der Anteil von Polyuronsäure am Trockengewicht der Pflanze liegt zwischen 10 und 30%, was die besonders hohe Austauschkapazität erklärt, die Sphagnum eine hohe ökologische Bedeutung zukommen lässt. Sphagnum kann seine Austauschkapazität an die Gegebenheiten anpassen. Steigt der ph-wert oder erhöht sich die Kationen-Konzentration am Standort, so steigert die Pflanze die Austauschkapazität. Dies ist z.b. nach einem Regenschauer der Fall, da im Regenwasser mehr Nährstoffe enthalten sind, als im Moorwasser. Durch den erhöhten Ionenaustausch binden Sphagnum-Moose auch große Mengen Nährstoffe sehr schnell, auch wenn diese Menge an Nährstoffen für das Überleben nicht benötigt wird, so dass für konkurrierende Arten auch hier lebensfeindliche Bedingungen gegeben sind. Insgesamt ist Sphagnum eine sehr genügsame Gattung, die zur Not auch mit den Nährstoffen auskommt, die ihr durch die Luft zugetragen werden. 2.2 Bedeutung Moore Die Sphagnum-Moose sind durch ihre Ökologie ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Moor-Standorten. Sie sind maßgeblich an der Entstehung der sauren Umgebung beteiligt, und durch ihre Art des Wachstums sind sie aber auch Hauptlieferant für die Entstehung von Torf. Sphagnum-Moose sind nicht, wie die meisten anderen Moose, mit Rhizoiden im Boden verankert; die unteren Pflanzenteile sterben nach und nach ab, während die oberen weiterhin wachsen. So entstehen im Lauf der Jahre tiefe Schichten von abgestorbenem Moos. Diese Pflanzenteile werden nicht vollständig zersetzt, da die saure Umgebung und das Fehlen von
5 5 Sauerstoff zur Folge hat, dass nur wenige Destruenten im Boden vorhanden sind; die übrigen Pflanzenteile vertorfen, d.h. durch das Absinken werden die Pflanzenteile immer mehr vom Sauerstoff abgeschnitten, bis schließlich Torf entsteht. Die Vertorfung ist ein sehr langsam ablaufender Prozess. Nach und nach bilden sich, je nach Klima, Vegetationsdichte und Feuchtigkeit, metertiefe Torfbänke. Es kann über tausend Jahre dauern, bis ein Meter Torf abgelagert wurde. An manchen Stellen sind diese Torfbänke bis zu acht Meter tief, und damit über achttausend Jahre alt, woraus sich auch das Alter eines Moorstandortes schließen lässt. Anhand von Proben aus diesen tiefen Schichten lassen sich dann z.b. Rückschlüsse über die frühere Vegetation und evtl. Änderungen im Vegetationsbild ziehen Wirtschaft Die Torfmoose haben heute eine geringere wirtschaftliche Bedeutung als früher, jedoch ist sie immer noch erwähnenswert. Vor allem der durch sie entstandene Torf hat auch heute noch große Bedeutung. Der Torf wird als Streumaterial für Ställe, in der chemischen Industrie z.b. als Aktivkohle, in der Medizin z.b. als Moorbad, vor allem aber im Gartenbau verwendet. Das Pigment Sphagnorubin, das in rotem Torfmoos enthalten ist, ist ein chemischer Indikator für Säuren. Früher kamen noch die Funktion als Heizmaterial hinzu, die jetzt aber verloren ging, da Torf wegen seines geringen Heizwerts von anderen Energieträgern verdrängt wurde. Die Sphagnum-Moose selbst wurden auch vielseitig verwendet. Früher waren sie aufgrund ihrer hohen Saugkraft Bestandteil von Windeln. Auch beliebt war die Verwendung als Verpackungsmaterial und als Füllstoff für Kissen. Im Ersten Weltkrieg wurden sie in sterilisierter Form als Verband genutzt, da Baumwolle knapp war. Auch zur Isolation wurden die Torfmoose genutzt, in Form von Moosschichten zwischen den Balken einer Holzhütte oder als Isolierplatte im Hausbau. Der Großteil dieser Verwendungszwecke ist heute allerdings in den Hintergrund getreten, da andere Produkte Sphagnum aus seiner Position verdrängt haben; nur bei einigen indianischen Stämmen werden manche der Funktionen von Sphagnum noch genutzt. Neu entdeckt wurden die Torfmoose für die Reinigung von Industrieabwässern oder als Absorptionsmaterial bei leichten Ölverschmutzungen. 2.3 Arbeitsweise und Bestimmung Der erste Schritt bei der Bearbeitung des Themas war die Sammlung mehrerer Moosproben im vorgegebenen Gebiet Schorenmoos, wobei hier stichprobenartig vorgegangen wurde. Aus
6 6 einem Moosteppich wurden je vier bis fünf Pflanzen entnommen, die dann in einer nummerierten Papiertüte aufbewahrt wurden. Die Wahl der Papiertüte ist insofern geschickt, dass sie saugfähig ist und daher das Moos, das bis zu 40 mal sein Eigengewicht an Wasser aufnehmen kann, besser trocknet. Durch das Trocknen werden die Proben haltbarer und lassen sich leichter aufbewahren, als wenn man sie konstant feucht halten müsste. Zu jeder Probe werden noch Notizen zu Standort, ursprünglicher Farbe, Informationen zum Wuchs, wie die Dichte des Moosrasens usw., gemacht, die später für die Bestimmung unter Umständen wichtig sein können. Diese Exkursionen ins Schorenmoos wurden mehrere male wiederholt, um von verschiedenen Standorten innerhalb des Gebiets Proben zu sammeln, da der Verdacht bestand, dass an verschiedenen Standorten verschiedene Moose wachsen und so Präsenz bzw. Absenz an unterschiedlichen Standorten untersucht werden konnten. In einem weiteren Schritt wurden Karten, die die Verbreitung von Sphagnum in Bayern zeigen, darauf überprüft, welche Arten im vorgegebenen Gebiet überhaupt vorkommen und welche in angrenzenden Kartenquadranten verbreitet sind (s. Anhang A 1 A 6), denn diese Moose könnten ihren Standort verändert haben und in das zu untersuchende Gebiet gekommen sein. So entstand schließlich eine Liste mehr oder weniger wahrscheinlicher Arten, die sich unter den gesammelten Proben befinden könnten. Der dritte und aufwändigste Schritt war die Bestimmung der Arten der Gattung Sphagnum, die zuvor gesammelt wurden. Zunächst wurde eine getrocknete Pflanze wieder angefeuchtet, um sie in möglichst ursprünglicher Gestalt betrachten zu können. Unter Binokular und Mikroskop und unter Zuhilfenahme der Notizen wurden folgende Werte ermittelt, die für die Bestimmung notwendig sind: Länge eines Astblattes im Verhältnis zu seiner Breite Form eines Astblattes, sowie dessen Spitze Form und Größe der Stammblätter Form der Chlorocyten Freiliegen der Chlorocyten oder Eingeschlossensein zwischen Hyalocyten (einseitig / beidseitig?) Farbe und Wachstum der Pflanzen Größe und Anzahl der Poren in den Zellen Anzahl der Schichten der Stamm-Hyalodermis
7 7 Abb.1 (links): verschiedene Stammblatt- Formen bei S. angustifolium, S. flexuosum, S. tenellum und ein Astblatt von S. tenellum (14) (FRAHM, 2004) Abb.2 (rechts): Astblattquerschnitte bei S. papillosum, S. imbricatum, S. magellanicum und S. centrale (v.o.n.u.) (FRAHM, 2004) Zum Untersuchen der Chlorocyten ist es erforderlich einen Astblattquerschnitt anzufertigen. Dabei wird die Pflanze zwischen zwei Holundermark-Hälften oder zwei Styroporstücke geklemmt, ein sauberer, gerader Schnitt wird gemacht und dann wird mit einer Rasierklinge über die entstandene Schnittfläche gefahren, bis eine grüne Flüssigkeit auf deren Oberfläche zu sehen ist. Diese Flüssigkeit ist Wasser, in dem viele Pflanzenteile umherschwimmen. Unter diesen Pflanzenteilen muss nun unter dem Mirkoskop ein passender und gut sichtbarer Astblattquerschnitt herausgesucht werden, der dann untersucht werden kann. Beim Untersuchen der Poren der Zellen muss man das Blatt anfärben, da die Poren mit bloßem Auge sonst kaum bis garnicht erkennen kann. Zum Färben wird oft Methylenblau verwendet, empfohlen wird aber auch Kristallviolett, da es eine angenehmere Farbe ergibt, mit der auch besonders intensiv gefärbt werden kann. Die genaue Abfolge der Untersuchungsschritte variiert mit dem verwendeten Bestimmungsschlüssel; so werden bei manchen Büchern andere Merkmale zuerst untersucht. Bei Unsicherheiten ist es daher auch oft ratsam eine Probe nach verschiedenen Schlüsseln zu untersuchen. Anhand der untersuchten Parameter ist eine eindeutige Bestimmung in den meisten Fällen nun möglich. Die bestimmten Moose wurden, sofern noch Probenmaterial vorhanden war, wieder verpackt und aufbewahrt. Im letzten Schritt wurden die entstandenen Daten über die Anwesenheit der Moose in das Programm FIN-View eingetragen, so dass die Ergebnisse dann veröffentlicht werden konnten.
8 8 2.4 Ergebnisse Im Folgenden wird, nach Sektionen unterteilt, eine Übersicht über die Sphagnum-Arten gegeben, die im Schorenmoos vorkommen können und ob sie während der Untersuchungen gefunden wurden, oder nicht. Unter jeder Sektion stehen Merkmale, die auf alle Arten innerhalb dieser Sektion zutreffen. Die Informationen zu den Moosen stammen aus NEBEL/PHILIPPI (2005) und FRAHM/FREY (2004) Sektion Sphagnum Die Arten der Sektion Sphagnum sind an den kahnförmigen, hohlen Astblättern mit stumpfer Spitze zu erkennen, die in etwa 1,5 bis 2 mal so lang wie breit sind, sowie an den Spiralfasern an Stamm- und Ast-Epidermiszellen und an ihrem relativ kräftigen Bau. Alle Moose der Sektion Sphagnum weisen diese Merkmale auf. Sphagnum centrale: Kräftige Pflanzen, die häufig in lockeren oder dichten Rasen wachsen. Sie besitzen Astbüschel mit meist vier bis fünf Ästen. Ihre Farbe reicht von bleichem Grün bis zu einem gelblichen Braun. Sie besitzen ovale Chlorocyten, die von den Hyalocyten beidseitig eingeschlossen werden. Die Zellwände der Hyalocyten haben keine Papillen. Diese Art taucht unter den Proben mehrfach auf. Eine Vergesellschaftung mit S. angustifolium, S. teres, S. warnstorfii, S. subtinens oder S. subsecundum, wie in NEBEL/PHILIPPI (2005, S.20) beschrieben konnte nicht nachgewiesen werden. Verbreitungskarte: Anhang S. A 2 Sphagnum magellanicum (auch S. medium): Kräftige, rötliche bis tiefrote Pflanzen, manchmal auch bläulich-grün, die meist in Polstern oder Bulten zu finden sind. Ihre Astbüschel weisen meist vier bis fünf Äste auf. Diese Art besitzt ebenfalls ovale Chlorocyten, die beiderseits von den Hyalocyten eingeschlossen werden. Auch bei dieser Art besitzen die Hyalocyten keine Papillen. S. magellanicum kommt sowohl oben, als auch auf den Seiten bzw. unten in Bulten vor oder bildet größere Teppiche, in denen es mit anderen Sphagnum-Moosen vergesellschaftet ist. Dieses Sphagnum-Moos tritt unter den Proben deutlich am häufigsten auf. Da S. magellanicum typischerweise an oligotrophen (= nährstoffarmen) Standorten zu finden ist,
9 lässt die große Verbreitung auf oligotrophe Gegebenheiten am Standort schließen. Verbreitungskarte: Anhang S. A 3 9 Sphagnum palustre: Häufig kräftige, bleichgrüne bis gelbliche oder bräunliche Pflanzen. Ihre Astbüschel bestehen aus drei bis sechs, manchmal sieben Ästen. S. palustre besitzt dreieckige Chlorocyten, die auf beiden Seiten freiliegen, also nicht von den Hyalocyten eingeschlossen werden. Unter den entnommenen Proben befand sich keine Pflanze der Art Sphagnum palustre, was auf die stichprobenartige Sammlung zurückzuführen ist. Bei der Untersuchung einer größeren Zahl von Proben könnte diese, wie auch andere fehlende Arten, eventuell gefunden werden. Verbreitungskarte: Anhang S. A 4 Sphagnum papillosum: Kräftige Pflanzen mit gelblicher, bräunlicher oder grünbrauner Farbe. An jedem Astbüschel befinden sich vier bis fünf Äste. Im Astblattquerschnitt sind ovale Chlorocyten zu erkennen, die beidseitig von Hyalocyten eingeschlossen sind. Das besondere Kennzeichen von Sphagnum papillosum sind die namensgebenden Papillen an den Hyalocyten. Auch von dieser Art befand sich kein Exemplar unter den Proben. Verbreitungskarte: Anhang S. A Sektion Acutifolia Die Arten der Sektion Acutifolia besitzen keine Spiralfasern, ihre Astblätter sind mehr als zweimal so lang wie breit und ihre Chlorocyten liegen an der Blattoberseite frei oder deutlich freier als an der Blattunterseite. Häufig sind die Pflanzen rötlich oder braun, einige auch grün. Sphagnum capillifolium (auch S. nemoreum, S. acutifolium oder S.capillaceum): S. capillifolium ist im Aussehen sehr variabel, die Färbung reicht von bleichem Grün bis zu tiefem Rot. Auch am Standort unterscheidet sich das Wachstum mitunter sehr stark: das Moos kann in dichten oder lockeren Polstern verschiedener Tiefe wachsen, meist sind diese Polster rötlich gescheckt. Die Astbüschel von S. capillifolium sind 3-4ästig, wobei 2 Äste abstehen, die anderen hängen herunter. S. capillifolium befand sich einmal unter den Proben. Ob die in NEBEL/PHILIPPI (2005, S.41) beschriebene Vergesellschaftung mit S. magellanicum damit nachgewiesen werden kann ist
10 aufgrund der geringen Zahl der Funde fraglich. Verbreitungskarte: Anhang S. A 1 10 Sphagnum fuscum: Diese meist kleinen Pflanzen besitzen einen braunen oder rotbraunen Farbton, der mitunter auch etwas Grün enthalten kann, wobei der Stamm immer braun ist. S. fuscum ist die einzige braune Art in der Sektion Acutifolia. Auch hier besitzt ein Astbüschel 1-2 hängende und 2 abstehende Äste. Da sich unter den Proben keine Pflanze dieser Art befand scheint sich der in NEBEL/PHILIPPI (2005, S.38) beschriebene Standort, ein sonniger Platz, zu bestätigen. Der größte Teil der Proben stammt aus Plätzen unter Bäumen und Büschen und nur wenige wurden auf freien Flächen gesammelt. Verbreitungskarte: Anhang S. A 3 Sphagnum girgensohnii: Relativ kräftige, gelblichgrüne oder grüne Pflanzen, selten mit bräunlicher Färbung. Die Astbüschel umfassen 4-5 Äste, von denen 2-3 abstehen. Ein wichtiges Merkmal dieser Art sind die Stammblätter, die nur an der Spitze ausgefranst sind. (FRAHM/FREY 2004, S. 162) Auch von diesem Moos befand sich keines unter den gesammelten Proben, was auf seine Verbreitung zurückzuführen ist, denn in Mooren wächst diese Art lediglich am Rand. Sämtliche Proben stammen jedoch aus tiefer im Moor gelegenen Stellen. Verbreitungskarte: Anhang S. A 3 Sphagnum rubellum: Mittlere bis kleine, zarte Pflanzen, meist tiefrot gefärbt. Die Astbüschel bestehen aus 3-4 Ästen, von denen zwei kräftigere abstehen. Diese Art ist meistens nur in Bulten zu finden, wo sie bevorzugt wächst, manchmal sind auch größere Polster aufzufinden. Kein Individuum dieser Art wurde unter den Proben gefunden, obwohl sie relativ häufig vorkommen sollte. Zurückzuführen ist dies vermutlich wieder auf die verwendete Methode beim Sammeln der Proben, die stichprobenartig verlief und damit nicht unbedingt alle Arten erfasst werden. Verbreitungskarte: Anhang S. A 5
11 11 Sphagnum subnitens: Die Pflanzen dieser Art können sehr klein sein, es gibt aber auch Individuen, die bis zu 20 cm groß werden können. Die Astbüschel bestehen aus 3-4 Ästen, von denen 2 abstehen. In trockenem Zustand weisen die Astblätter einen für diese Art typischen metallischen Glanz auf. Von dieser Art findet sich ebenfalls keine Pflanze unter den gesammelten Proben, sie ist auch relativ selten aufzufinden. Verbreitungskarte: Anhang S. A 5 Sphagnum warnstorfii: Aufrechte, rötliche oder violette Pflanzen. Ihre Astbüschel umfassen 4-5 Äste, von denen 2-3 abstehen. Die anderen Äste liegen meist sehr nahe am Stamm an. Es handelt sich um eine seltene Art, die nach FRAHM/FREY (2004, S.164) stark im Rückgang ist. Bei einer Probe besteht der Verdacht auf S. warnstorfii, jedoch ist kein sicherer Beleg erbracht. Bei der fraglichen Probe könnte es sich ebenso um S. russowii handeln, das im Schorenmoos bisher noch nicht nachgewiesen wurde, in angrenzenden Gebieten jedoch vorkommt; daher scheint S. warnstorfii wahrscheinlicher. Verbreitungskarte: Anhang S. A Sektion Squarrosa Die Sektion Squarrosa ist die kleinste, aus nur zwei Arten bestehende, Sektion. Diese Arten definieren sich durch die gezahnten Astblätter, die meist in eine abstehende Spitze zusammengezogen werden. Die Chlorocyten sind trapezförmig oder rechteckig und meist im Querschnitt zentriert, wobei die von S. teres auf der Blattunterseite offenliegen. Sphagnum squarrosum: Kräftige, große Pflanzen in tiefgrünem bis gelblichem, selten braunem Farbton. Die Äste liegen in Büscheln von 4-6 vor, von denen die kräftigsten 2-3 Äste abstehen. Ein in Frage kommender Standort wäre nach NEBEL/PHILIPPI (2005, S. 56) eine lichte Stelle im Moorwald. S. squarrosum kam unter dem Probenmaterial einmal vor. Die entsprechende Probe wurde tatsächlich an einer wenig bewachsenen Stelle im Moorwald gesammelt, was die Angabe bestätigt. Verbreitungskarte: Anhang S. A 5
12 12 Sphagnum teres: Kleinere, grüne bis semmelbraune Pflanzen. Ihre Astbüschel bestehen aus 4-5, manchmal bis 7 Ästen, von denen 3 abstehen. Die Astblätter liegen am Ast an und sind gestutzt und gezähnt. S. teres kam unter den Proben dreimal vor. Verbreitungskarte: Anhang S. A Sektion Cuspidata Die Arten der Sektion Cuspidata weisen keine Poren in den Hyalocyten auf. Die Astblätter sind in trockenem Zustand meist wellig, ihre Spitze ist gestutzt und gezahnt. Die Chlorocyten sind dreieckig oder trapezförmig. Sphagnum angustifolium: Gelbgrüne, grüne oder semmelbraune Pflanzen. Ihre Astbüschel umfassen 4-6 Äste, 2-3 davon abstehend. Die Chlorocyten dieser Art sind dreieckig und auf einer Seite von den Hyalocyten eingeschlossen. S. angustifolium befand sich nicht unter den Proben. Verbreitungskarte: Anhang S. A 1 Sphagnum cuspidatum: Pflanzen sehr unterschiedlich ausgeprägt, manche kräftiger, andere zart und eher klein. Frablich lassen sie sich kaum festlegen: während in NEBEL/PHILIPPI (2005, S. 64) von grünen, gelben bis bräunlichen Pflanzen die Rede ist, wird in FRAHM/FREY (2004, S. 166) behauptet, dass es nur reingrüne und keine bräunliche oder gelbe Formen gäbe. Die Astbüschel bestehen aus 3-5, manchmal 5 Ästen, von denen 2 abstehen. Die großen, dreieckigen Stammblätter mit gezähnter Spitze sind ein charakteristisches Merkmal dieser Art. Da sich unter den Proben kein S. cuspidatum befindet, ist es an dieser Stelle nicht möglich, Aussagen über die Färbung zu machen. Verbreitungskarte: Anhang S. A 2 Sphagnum fallax: Eine sehr variable Art, die in vielen Formen vorkommt, vor allem die Unterwasserformen sehen sehr unterschiedlich aus. Meist sind die Pflanzen bleich grün oder semmelbraun. Astbüschel bestehen aus 4-5 Ästen, von denen 2 abstehen. S. fallax ist häufig an gefluteten
13 13 oder sehr feuchten Standorten zu finden. S. fallax wurde dreimal unter den Proben entdeckt, was, im Vergleich zur Zahl anderer Funde, die Häufigkeit der Art unterstreicht. Der Fundort war, wie erwartet, eine feuchte Stelle innerhalb eines größeren Rasens. Verbreitungskarte: Anhang S. A 2 Sphagnum tenellum: Zierliche Pflanzen, die in gelblichen, bleichgrünen oder gelbbraunen Rasen vorkommt. Sie meidet offenes Wasser und kommt eher am Rand von Senken oder zwischen Bulten vor. Ein sehr auffälliges Merkmal von S. tenellum sind die hohlen und sehr kurzen Ast- und Stammblätter, durch welche sie sich unter anderem sehr stark von den anderen Arten der Sektion Cuspidata unterscheidet. Diese starke Unterscheidung hat einige Autoren dazu veranlasst S. tenellum in eine eigene Sektion, die Sektion Mollusca, zu stellen. Da S. tenellum kaum mit anderen Arten verwechselt werden kann, liegt ihr Fehlen unter den Proben an der Tatsache, dass zufällig beim Sammeln des Probenmaterials keine Pflanze ihrer Art aufgenommen wurde, was auf die stichprobenartige Sammlung zurückzuführen ist. Verbreitungskarte: Anhang S. A Sektion Subsecunda Die Chlorocyten der Arten innerhalb der Sektion Subsecunda sind rechteckig oder tonnenförmig, liegen beidseitig frei und die Grenzen zu den Hyalocyten sind immer glatt. Die Astblätter besitzen keine Resorptionsfurche. Die Pflanzen sind im Großteil der Fälle eher schlaff. Sphagnum contortum: Die Pflanzen kommen in gelblichen, bräunlichen, dunkelgrünen oder schwärzlich-braunen Rasen vor und sehen S. subsecundum ziemlich ähnlich. Nur die mehrschichtige Hyalodermis des Stamms ist ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zu S. subsecundum. Die Äste liegen in Büscheln von 4-6 vor, von denen 2-3 abstehen. In einer Probe finden sich Pflanzen der Art S. contortum, welche, wie in NEBEL/PHILIPPI (2005, S. 85) beschrieben, mit S. teres vergesellschaftet war. Verbreitungskarte: Anhang S. A 2
14 14 Sphagnum platyphyllum: Schlaffe, grünlich- oder gelblichbraune Pflanzen, die in lockeren, weichen Rasen vorkommt. Die Astbüschel umfassen nur 2-3 Äste, von denen 1-2 abstehen. Die Astblätter sind ähnlich denen der Sektion Sphagnum hohl. Die Stammblätter sind lang und zungenförmig und werden gegen die Basis gehend schmäler. Unter den Proben fand sich keine Pflanze der Art S. platyphyllum. Verbreitungskarte: Anhang S. A 4 Sphagnum subsecundum: Kleinere, zierliche Pflanzen mit grüner, graugrüner bis semmelbrauner Färbung. Die oft gebogenen Äste liegen in Büscheln von 4-7 vor, davon stehen 2-3 ab, während die restlichen Äste dicht am Stamm liegen. S. subsecundum fand sich nicht unter den Proben. Verbreitungskarte: Anhang S. A Ausblick Betrachtet man die Ergebnisse dieser Arbeit, so fällt schnell auf, dass nur 7 von 19 Arten der Gattung Sphagnum, die laut den Verbreitungskarten im Schorenmoos vorkommen sollen, auch tatsächlich gefunden wurden. Ein möglicher Grund ist, wie bereits mehrfach erwähnt, die Stichproben-Sammelmethode. Jedoch wurden praktisch alle Proben im Hochmoor- Kerngebiet gesammelt, was durchaus ein Grund für die Absenz einiger Arten sein kann. Der Grund hierfür liegt darin, dass in dieser Arbeit eher das Verfahren zur Bestimmung der Moose in den Vordergrund gestellt wurde und weniger auf die Verteilung der Arten im Gelände. Es wäre nun interessant auch die Verteilung und die Fundorte der Arten, im Zuge einer Folgearbeit zu dieser, genauer zu untersuchen und dabei den Hochmoorbereich mit dem Zwischenmoorbereich und den Feuchtwiesen, die zum Schorenmoos gehören, zu vergleichen, um von der Gattung Sphagnum ein noch besseres Bild zu erhalten.
15 15 3. Quellenverzeichnis Literatur: FRAHM/FREY: FRAHM, Jan-Peter und FREY, Wolfgang (2004): Moosflora. 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. ISBN NEBEL/PHILIPPI: NEBEL, Martin und PHILIPPI, Georg (2005): Die Moose Baden-Württembergs. Band 3. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. ISBN Webseiten: : Moose Deutschland: (unter Suche: Eingabe 'Sphagnum') : Laubmoose: (Absatz 'Sphagnidae (Torfmoose)) : Einführende Informationen über Torfmoos: : Morphologie von Torfmoos (Sphagnum): : Der Torf: Abbildungen: Titelblatt: Sphagnum magellanicum aus NEBEL/PHILIPPI (2005, S.25), Foto: RASBACH Abb.1: Schematische Darstellung von Blattformen, aus FRAHM/FREY (2004, S.167) Abb.2: Schematische Darstellung von Astblattquerschnitten, aus FRAHM/FREY (2004, S.160) Verbreitungskarten: (unter Suche: Eingabe 'Sphagnum')
16 16 Erklärung des Kollegiaten: Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ziegelberg, den (Unterschrift des Kollegiaten)
17 - A 1 - Gliederung des Anhangs: Verteilungskarte Sphagnum angustifolium...a 1 Verteilungskarte Sphagnum capillifolium...a 1 Verteilungskarte Sphagnum centrale...a 2 Verteilungskarte Sphagnum contortum...a 2 Verteilungskarte Sphagnum cuspidatum...a 2 Verteilungskarte Sphagnum fallax...a 2 Verteilungskarte Sphagnum fuscum...a 3 Verteilungskarte Sphagnum girgensohnii...a 3 Verteilungskarte Sphagnum inundatum...a 3 Verteilungskarte Sphagnum magellanicum...a 3 Verteilungskarte Sphagnum palustre...a 4 Verteilungskarte Sphagnum papillosum...a 4 Verteilungskarte Sphagnum platyphyllum...a 4 Verteilungskarte Sphagnum quinquefarium...a 4 Verteilungskarte Sphagnum rubellum...a 5 Verteilungskarte Sphagnum squarrosum...a 5 Verteilungskarte Sphagnum subnitens...a 5 Verteilungskarte Sphagnum subsecundum...a 5 Verteilungskarte Sphagnum tenellum...a 6 Verteilungskarte Sphagnum teres...a 6 Verteilungskarte Sphagnum warnstorfii...a 6 Grundkarte...A 6 Sphagnum angustifolium Sphagnum capillifolium
18 - A 2 - Sphagnum centrale Sphagnum contortum Sphagnum cuspidatum Sphagnum fallax
19 - A 3 - Sphagnum fuscum Sphagnum girgensohnii Sphagnum inundatum Sphagnum magellanicum
20 - A 4 - Sphagnum palustre Sphagnum papillosum Sphagnum platyphyllum Sphagnum quinquefarium
21 - A 5 - Sphagnum rubellum Sphagnum squarrosum Sphagnum subnitens Sphagnum subsecundum
22 - A 6 - Sphagnum tenellum Sphagnum teres Sphagnum warnstorfii Grundkarte
Thema 12: Bearbeitet von : Daniel Willing Kurs : LK Biologie I Jahrgang : Gliederung
 Thema 12: Torfmoose Bearbeitet von : Daniel Willing Kurs : LK Biologie I Jahrgang : 1999-2001 Gliederung 1. Allgemeines Seite 1 2. Torf Seite 1 3. Torfbildung Seite 1 4. Ernährung Seite 2 5. Wachstum Seite
Thema 12: Torfmoose Bearbeitet von : Daniel Willing Kurs : LK Biologie I Jahrgang : 1999-2001 Gliederung 1. Allgemeines Seite 1 2. Torf Seite 1 3. Torfbildung Seite 1 4. Ernährung Seite 2 5. Wachstum Seite
Die Gattung Sphagnum (Torfmoose). Eine Einführung in die Bestimmung häufigerer Arten. Bernhard Kaiser
 Die Gattung Sphagnum (Torfmoose). Eine Einführung in die Bestimmung häufigerer Arten Bernhard Kaiser Es soll hier versucht werden, den Freunden des Mikroskops die Welt der Torfmoose näherzubringen. Nach
Die Gattung Sphagnum (Torfmoose). Eine Einführung in die Bestimmung häufigerer Arten Bernhard Kaiser Es soll hier versucht werden, den Freunden des Mikroskops die Welt der Torfmoose näherzubringen. Nach
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten. Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach
 Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
KostProbe Seiten. So bestimmst du Blütenpflanzen
 Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Überblick. Ziele. Unterrichtseinheit
 MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz
 HESSEN-FORST Artensteckbrief Gedrehtes Torfmoos (Sphagnum contortum) 2008 FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz Artensteckbrief Sphagnum contortum Schultz Gedrehtes Torfmoos Erstellt
HESSEN-FORST Artensteckbrief Gedrehtes Torfmoos (Sphagnum contortum) 2008 FENA Servicestelle für Forsteinrichtung und Naturschutz Artensteckbrief Sphagnum contortum Schultz Gedrehtes Torfmoos Erstellt
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
3. Formale Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit. 3.1 Das Zitieren Direkte und indirekte Zitate
 3. Formale Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit 3.1 Das Zitieren 3.1.1 Direkte und indirekte Zitate Bei direkten Zitaten übernimmt man ganze Sätze oder Passagen aus dem zitierten Werk originalgetreu
3. Formale Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit 3.1 Das Zitieren 3.1.1 Direkte und indirekte Zitate Bei direkten Zitaten übernimmt man ganze Sätze oder Passagen aus dem zitierten Werk originalgetreu
Seite 2. Allgemeine Informationzu Basilikum. Kontakt. Vorwort. ingana Shop
 2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
Moorflora. Sonnentau. Rundblättriger. Drosera rotundifolia
 Rundblättriger Sonnentau Drosera rotundifolia Fleischfressende Pflanze; ernährt sich von kleinen Insekten, die an den tauähnlichen Tröpfchen ihrer Blätter kleben bleiben. Die Blätter und die bis zu 10
Rundblättriger Sonnentau Drosera rotundifolia Fleischfressende Pflanze; ernährt sich von kleinen Insekten, die an den tauähnlichen Tröpfchen ihrer Blätter kleben bleiben. Die Blätter und die bis zu 10
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume. Acer platanoides. Diplomarbeit von Jennifer Burghoff. Fachbereich Gestaltung. Kommunikationsdesign
 Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
S Eutrophierung >> Watt für Fortgeschrittene Naturschule Wattenmeer
 Eutrophierung des Wattenmeeres EUTROPHIERUNG ist die Anreicherung von Nährstoffen in einem Gewässer, die meist von menschlichen Aktivitäten verursacht wird. Das Wort eutroph stammt aus dem Griechischen
Eutrophierung des Wattenmeeres EUTROPHIERUNG ist die Anreicherung von Nährstoffen in einem Gewässer, die meist von menschlichen Aktivitäten verursacht wird. Das Wort eutroph stammt aus dem Griechischen
Faszination Moor. Teil III - Hochmoore: Entstehung und Lebensräume Arbeitsblätter. EUROPÄISCHE UNION Europäischer Fond für Regionale Entwicklung
 Faszination Moor Teil III - Hochmoore: Entstehung und Lebensräume Arbeitsblätter Inhalt Teil III: Arbeitsblätter Hochmoore: Entstehung und Lebensräume Ein kleines Moos macht Moore Ein Hochmoor entsteht
Faszination Moor Teil III - Hochmoore: Entstehung und Lebensräume Arbeitsblätter Inhalt Teil III: Arbeitsblätter Hochmoore: Entstehung und Lebensräume Ein kleines Moos macht Moore Ein Hochmoor entsteht
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem
 Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Unsere Umwelt ein großes Recyclingsystem 1. Der Regenwurm in seinem Lebensraum Im Biologiebuch findest du Informationen über den Regenwurm. Lies den Text durch und betrachte die Abbildung. Regenwürmer
Die Echtheit sächsischer Wildbirnenbestände Morphologische und genetische Betrachtungen
 Die Echtheit sächsischer Wildbirnenbestände Morphologische und genetische Betrachtungen Frank Lochschmidt und Dr. Stefanie Reim Grüne Liga Osterzgebirge e.v. + Staatsbetrieb Sachsenforst Zinnwald, 18.
Die Echtheit sächsischer Wildbirnenbestände Morphologische und genetische Betrachtungen Frank Lochschmidt und Dr. Stefanie Reim Grüne Liga Osterzgebirge e.v. + Staatsbetrieb Sachsenforst Zinnwald, 18.
Stundenbild. Lebensräume
 Stundenbild Lebensräume Das Moor und sein Torfmoos Was ist ein Moor? Warum ist es für jeden von uns so wichtig? Torfmoos eine seltsame Pflanze? Geht es um das Thema Moor denken viele sofort an etwas Unheimliches.
Stundenbild Lebensräume Das Moor und sein Torfmoos Was ist ein Moor? Warum ist es für jeden von uns so wichtig? Torfmoos eine seltsame Pflanze? Geht es um das Thema Moor denken viele sofort an etwas Unheimliches.
Merkblatt zum Arbeitsprojekt*
 I. Hinweise zum Arbeitsprojekt: Merkblatt zum Arbeitsprojekt* Das Arbeitsprojekt ist eine Prüfungsleistung im Prüfungsteil Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen. Mit dem Arbeitsprojekt
I. Hinweise zum Arbeitsprojekt: Merkblatt zum Arbeitsprojekt* Das Arbeitsprojekt ist eine Prüfungsleistung im Prüfungsteil Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen. Mit dem Arbeitsprojekt
Bestimmung des ph-wertes des Bodens
 Bestimmung des ph-wertes des Bodens Durch den ph-wert erhältst du eine Angabe zum Säuregehalt. Er wird im Bereich zwischen 1 (sehr sauer!!!) und 14 (sehr basisch!) angegeben. Bei einem ph-wert von 7 spricht
Bestimmung des ph-wertes des Bodens Durch den ph-wert erhältst du eine Angabe zum Säuregehalt. Er wird im Bereich zwischen 1 (sehr sauer!!!) und 14 (sehr basisch!) angegeben. Bei einem ph-wert von 7 spricht
Können Haare schimmeln?
 Können Haare schimmeln? Vorangehende Gedanken, These: Ob Haare, respektive Dreadlocks, schimmeln können, ist ungeklärt. Die bisherigen Beobachtungen sprechen dagegen; Schimmelbefall bei sauberen Dreads
Können Haare schimmeln? Vorangehende Gedanken, These: Ob Haare, respektive Dreadlocks, schimmeln können, ist ungeklärt. Die bisherigen Beobachtungen sprechen dagegen; Schimmelbefall bei sauberen Dreads
Warum heißt unsere Schule Königsknollschule?
 Schüler experimentieren 2012 Warum heißt unsere Schule Königsknollschule? Maximilian Hörmann Hector-Kinderakademie Sindelfingen Betreuer: Walter Lenk Grundschule Königsknoll Sindelfingen 1 Inhaltsverzeichnis:
Schüler experimentieren 2012 Warum heißt unsere Schule Königsknollschule? Maximilian Hörmann Hector-Kinderakademie Sindelfingen Betreuer: Walter Lenk Grundschule Königsknoll Sindelfingen 1 Inhaltsverzeichnis:
Die Stabheuschrecke. Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, Sprache: Deutsch. Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2
 Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Schulen in NRW blühen auf. Die Pflanze des Monats April: Das Hirtentäschelkraut. Das Geheimnis des Namens
 1. Warum heißt die Pflanze Hirtentäschel? Schreibe zuerst deine Vermutung auf. Das Wort Täschel wird bei uns nicht benutzt. Wir sagen kleine Tasche oder Täschchen. Tipp: Schau dir die Zeichnungen genau
1. Warum heißt die Pflanze Hirtentäschel? Schreibe zuerst deine Vermutung auf. Das Wort Täschel wird bei uns nicht benutzt. Wir sagen kleine Tasche oder Täschchen. Tipp: Schau dir die Zeichnungen genau
HERBARIUM SEK II. Hinweise zur Erstellung und Bewertung
 HERBARIUM SEK II Hinweise zur Erstellung und Bewertung Allgemeine Hinweise 1. Termin der Abgabe: legt Fachlehrer fest, 2. Anzahl der geforderten Arten: legt Fachlehrer fest, z.b.: 10 Blütenpflanzen aus
HERBARIUM SEK II Hinweise zur Erstellung und Bewertung Allgemeine Hinweise 1. Termin der Abgabe: legt Fachlehrer fest, 2. Anzahl der geforderten Arten: legt Fachlehrer fest, z.b.: 10 Blütenpflanzen aus
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
2. Datenvorverarbeitung
 Kurzreferat Das Ziel beim Clustering ist es möglichst gleich Datensätze zu finden und diese in Gruppen, sogenannte Cluster zu untergliedern. In dieser Dokumentation werden die Methoden k-means und Fuzzy
Kurzreferat Das Ziel beim Clustering ist es möglichst gleich Datensätze zu finden und diese in Gruppen, sogenannte Cluster zu untergliedern. In dieser Dokumentation werden die Methoden k-means und Fuzzy
Saugschuppen. Station: Saugschuppen mikroskopieren. Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten
 Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Garten-Melde. Anbau. Vermehrung AS_Z_026. (Atriplex hortensis)
 Die Gartenmelde ist eine historische der Name Melde ableitet. Diese rote Melde stammt aus dem Wittgensteiner Land. Die jungen, feinen Blätter der Melde kann man frisch als Salat verwenden, die älteren
Die Gartenmelde ist eine historische der Name Melde ableitet. Diese rote Melde stammt aus dem Wittgensteiner Land. Die jungen, feinen Blätter der Melde kann man frisch als Salat verwenden, die älteren
Traubenkraut / Beifußambrosie (Ambrosia artemisiifolia )
 Traubenkraut / Beifußambrosie (Ambrosia artemisiifolia ) Im Griesheimer Neubaugebiet Süd zwischen Oberndorferstraße, Odenwaldstraße und Südring breitet sich derzeit das Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia
Traubenkraut / Beifußambrosie (Ambrosia artemisiifolia ) Im Griesheimer Neubaugebiet Süd zwischen Oberndorferstraße, Odenwaldstraße und Südring breitet sich derzeit das Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia
Herzlich Willkommen. Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung. Dipl.-Ing. Manfred Schleicher
 Herzlich Willkommen Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung Dipl.-Ing. Manfred Schleicher Übersicht Allgemeines Zellenkonstante Relative Zellenkonstante Kalibrierung Kalibrierung mit Kalibrierlösung 25 C
Herzlich Willkommen Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung Dipl.-Ing. Manfred Schleicher Übersicht Allgemeines Zellenkonstante Relative Zellenkonstante Kalibrierung Kalibrierung mit Kalibrierlösung 25 C
Gib mir Deine Haare und ich sag Dir wer Du bist
 Anleitung zum Sammeln von Haarproben Gib mir Deine Haare und ich sag Dir wer Du bist Ablauf für Klassen und Gruppen 1. Mindestens 15 Haarfallen basteln 2. Haarfallen 5-7 Tage vor der Nussjagd im Nuss-Suchgebiet
Anleitung zum Sammeln von Haarproben Gib mir Deine Haare und ich sag Dir wer Du bist Ablauf für Klassen und Gruppen 1. Mindestens 15 Haarfallen basteln 2. Haarfallen 5-7 Tage vor der Nussjagd im Nuss-Suchgebiet
Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun?
 Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun? Hypothese: : Erkenntnis: Zeichnung : 1 Euglena goes Disco! Reagiert Euglena auf Licht? Mag sie
Euglena - Pflanze oder Tier? Was für ein Lebewesen findest Du hier, und was hat es mit Fotosynthese zu tun? Hypothese: : Erkenntnis: Zeichnung : 1 Euglena goes Disco! Reagiert Euglena auf Licht? Mag sie
Hinweise zum Erstellen von Abschlussarbeiten
 Hinweise zum Erstellen von Abschlussarbeiten Version: Dezember 2015 Institut für Konstruktion, Mikro- und Medizintechnik Fachgebiet Konstruktion von Maschinensystemen Prof. Dr.-Ing. Henning J. Meyer Das
Hinweise zum Erstellen von Abschlussarbeiten Version: Dezember 2015 Institut für Konstruktion, Mikro- und Medizintechnik Fachgebiet Konstruktion von Maschinensystemen Prof. Dr.-Ing. Henning J. Meyer Das
E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments
 E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments Nachweis von Stärke in Blättern: (aus Westermann; BIO 2 Rheinlandpfalz, Saarland;
E2-1-2 Beispiel Experiment Biologie 1/6 Entwicklung von kompetenzorientiertem Unterricht am Beispiel eines Experiments Nachweis von Stärke in Blättern: (aus Westermann; BIO 2 Rheinlandpfalz, Saarland;
FACHARBEIT THEMA. Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf. von Vorname Nachname
 Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf FACHARBEIT THEMA von Vorname Nachname Grund/Leistungskurs Fach bei Frau/Herrn Nachname Schuljahr 2006/07 Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis Titel der Facharbeit 1. Kapitel...
Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Alsdorf FACHARBEIT THEMA von Vorname Nachname Grund/Leistungskurs Fach bei Frau/Herrn Nachname Schuljahr 2006/07 Abgabedatum: Inhaltsverzeichnis Titel der Facharbeit 1. Kapitel...
1 Einleitung Das Holz der Eberesche Eigenschaften und Aussehen des Holzes Verwendung des Holzes...
 Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Herzlichen Glückwunsch! Das Thema der heutigen Show: Knabenkräuter
 Knabenkräuter: Infoblatt 1 Herzlichen Glückwunsch! Das Casting-Team der Millionenshow hat dich ausgewählt und lädt dich ein dein Wissen zu testen. Mit etwas Glück kannst du die Millionenfrage knacken.
Knabenkräuter: Infoblatt 1 Herzlichen Glückwunsch! Das Casting-Team der Millionenshow hat dich ausgewählt und lädt dich ein dein Wissen zu testen. Mit etwas Glück kannst du die Millionenfrage knacken.
Klexse- Experimente erprobt von Manfred Martin und Bernd Setzer
 Klexse- Experimente Im Kapitel Biologie werden einige Experimente beschrieben, durch die man manches über das Keimen von Pflanzen und ihr Wachstum den Aufbau einiger Pflanzen und anderes Wissenswerte erfahren
Klexse- Experimente Im Kapitel Biologie werden einige Experimente beschrieben, durch die man manches über das Keimen von Pflanzen und ihr Wachstum den Aufbau einiger Pflanzen und anderes Wissenswerte erfahren
Faltblatt Chemie: Teilchenmodell F
 Faltblatt Chemie: Teilchenmodell F E K B FACHWISSEN ERKENNTNISGEWINN KOMMUNIKATION BEWERTUNG 1 WO WURDE UNTERRICHTET? Erstes Jahr Chemieunterricht (Kl. 9, G9) VORAUSSETZUNGEN: ANGESTEUERTE FACHLICHE KOMPETENZEN
Faltblatt Chemie: Teilchenmodell F E K B FACHWISSEN ERKENNTNISGEWINN KOMMUNIKATION BEWERTUNG 1 WO WURDE UNTERRICHTET? Erstes Jahr Chemieunterricht (Kl. 9, G9) VORAUSSETZUNGEN: ANGESTEUERTE FACHLICHE KOMPETENZEN
Abb. 2: Mögliches Schülermodell
 Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Pflegeanleitung von Parkett Dietrich
 Seit drei Generationen steht der Name Parkett Dietrich für handwerkliche Tradition und einzigartige, anspruchsvolle Erfahrung in der Verarbeitung von Parkettböden. Genießen Sie diesen wunderbaren Werkstoff,
Seit drei Generationen steht der Name Parkett Dietrich für handwerkliche Tradition und einzigartige, anspruchsvolle Erfahrung in der Verarbeitung von Parkettböden. Genießen Sie diesen wunderbaren Werkstoff,
Softwareentwicklungspraktikum Nebenfach
 PD Dr. Ulrich Schöpp Ludwig-Maximilians-Universität München Dr. Steffen Jost Institut für Informatik Stephan Barth WS 2016/17 Softwareentwicklungspraktikum Nebenfach Blatt 3 Dieses Arbeitsblatt ist innerhalb
PD Dr. Ulrich Schöpp Ludwig-Maximilians-Universität München Dr. Steffen Jost Institut für Informatik Stephan Barth WS 2016/17 Softwareentwicklungspraktikum Nebenfach Blatt 3 Dieses Arbeitsblatt ist innerhalb
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa)
 Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Die Natur in den 4 Jahreszeiten. Julian 2012/13
 Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius
 Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
Fichtenfaulpech Picea abies pix putorius Definition Das durch Abkratzen von Stämmen von Picea abies gewonnene vom Baum selbst abgesonderte Produkt. Sammelvorschrift Picea abies kann sehr unterschiedliche
Wurzeleinwuchs in die Infrastruktur urbaner Räume
 Wurzeleinwuchs in die Infrastruktur urbaner Räume Wurzeleinwuchs ein Problem in Städten und Gemeinden Grünpflanzung in urbanen Räumen sorgt für Wohlbefinden und Erholung. Ohne Grünpflanzen und Bäume wären
Wurzeleinwuchs in die Infrastruktur urbaner Räume Wurzeleinwuchs ein Problem in Städten und Gemeinden Grünpflanzung in urbanen Räumen sorgt für Wohlbefinden und Erholung. Ohne Grünpflanzen und Bäume wären
Microsoft Word 2013 Aufzählungen und Nummerierungen
 Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen Microsoft Word 2013 Aufzählungen und Nummerierungen Aufzählungen und Nummerierungen in Word 2013 Seite 1 von 12 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung...
Hochschulrechenzentrum Justus-Liebig-Universität Gießen Microsoft Word 2013 Aufzählungen und Nummerierungen Aufzählungen und Nummerierungen in Word 2013 Seite 1 von 12 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung...
Unser Kräuterjahr neigt sich allmählich. Es ist fast vollbracht!
 Es ist fast vollbracht! 127 neue Kräuterexpertinnen und Kräuterexperten gibt es 2015 in Österreich. Sie alle haben in St. Georgen am Längsee ihre Prüfungen abgelegt und freuen sich auf die Arbeit mit den
Es ist fast vollbracht! 127 neue Kräuterexpertinnen und Kräuterexperten gibt es 2015 in Österreich. Sie alle haben in St. Georgen am Längsee ihre Prüfungen abgelegt und freuen sich auf die Arbeit mit den
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Sezieren eines Schweinefußes
 Anleitungen zu Modul 1 / NAWI-LAB Biologie am 13.10.2015 Sezieren eines Schweinefußes Materialien: Schweinefuß, Handschuhe, Küchenrolle, ( Skalpell+Klingen, Pinzette :wenn vorhanden), Fotoapparat; Ihr
Anleitungen zu Modul 1 / NAWI-LAB Biologie am 13.10.2015 Sezieren eines Schweinefußes Materialien: Schweinefuß, Handschuhe, Küchenrolle, ( Skalpell+Klingen, Pinzette :wenn vorhanden), Fotoapparat; Ihr
Prüfung Feldbotanikkurs 2009/10: Musterfragen
 Morphologie/Blütenbiologie Benennen/skizzieren von morphologischen Elementen Frage a) Beschrifte nebenstehende Abbildung b) Skizziere eine Spirre (Blütenstand) c) Nenne einen morphologischen Unterschied
Morphologie/Blütenbiologie Benennen/skizzieren von morphologischen Elementen Frage a) Beschrifte nebenstehende Abbildung b) Skizziere eine Spirre (Blütenstand) c) Nenne einen morphologischen Unterschied
Eine Frucht für die Götter
 Eine Frucht für die Götter Ratet Kinder, wer ich bin, hänge hoch im Baume drin, hab rote Bäckchen, nen Stiel hab ich auch und einen dicken, runden Bauch. Es war einmal vor langer Zeit. Da schuf Gott Himmel
Eine Frucht für die Götter Ratet Kinder, wer ich bin, hänge hoch im Baume drin, hab rote Bäckchen, nen Stiel hab ich auch und einen dicken, runden Bauch. Es war einmal vor langer Zeit. Da schuf Gott Himmel
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. Art Ab 15. Februar. März April Mai Juni Juli.
 Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
KZU Bio. KZU Bio. KZU Bio. KZU Bio
 Was wollte van Helmont mit "Weidenzweig-Versuch" herausfinden? Weshalb nahm van Helmont Regenwasser und nicht Leitungswasser? Was war das Resultat des Experimentes von van Helmont? Was konnte er aus seinem
Was wollte van Helmont mit "Weidenzweig-Versuch" herausfinden? Weshalb nahm van Helmont Regenwasser und nicht Leitungswasser? Was war das Resultat des Experimentes von van Helmont? Was konnte er aus seinem
Wellenlängen bei Strahlungsmessungen. im Gebiet der Meteorologie nm nm
 Die Solarstrahlung Die Sonne sendet uns ein breites Frequenzspektrum. Die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die am oberen Rand der Erdatmosphäre einfällt, wird als extraterrestrische Sonnenstrahlung
Die Solarstrahlung Die Sonne sendet uns ein breites Frequenzspektrum. Die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die am oberen Rand der Erdatmosphäre einfällt, wird als extraterrestrische Sonnenstrahlung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Bäume brauchen Wasser
 Bäume brauchen Wasser Im Juli 2010 war es sehr heiß und trocken. In der Stadtzeitung konnte man lesen, dass Menschen und Tiere sich gerne im kühlen Schatten von Bäumen aufhielten. Martin, der Stadtgärtner
Bäume brauchen Wasser Im Juli 2010 war es sehr heiß und trocken. In der Stadtzeitung konnte man lesen, dass Menschen und Tiere sich gerne im kühlen Schatten von Bäumen aufhielten. Martin, der Stadtgärtner
Sempervivum Hauswurz
 Sempervivum Hauswurz Sempervivum - Hauswurz Sempervivum ist eine Gattung mit etwa 40 Arten. Diese immergrünen Stauden kommen hauptsächlich in den Gebirgen Europas und Asiens vor. Die n dieser Pflanze sind
Sempervivum Hauswurz Sempervivum - Hauswurz Sempervivum ist eine Gattung mit etwa 40 Arten. Diese immergrünen Stauden kommen hauptsächlich in den Gebirgen Europas und Asiens vor. Die n dieser Pflanze sind
Prüfungsausschuss Risk and Finance. Antrag auf Zulassung zur Masterthesis und zum Kolloquium
 Antrag auf Zulassung zur Masterthesis und zum Kolloquium Bearbeitungszeitraum vom bis bitte freilassen; wird nur (Zulassungstermin) (Abgabetermin = Ausschlussfrist!) vom Studienbüro festgelegt Matrikel-Nr.
Antrag auf Zulassung zur Masterthesis und zum Kolloquium Bearbeitungszeitraum vom bis bitte freilassen; wird nur (Zulassungstermin) (Abgabetermin = Ausschlussfrist!) vom Studienbüro festgelegt Matrikel-Nr.
Bäume pflanzen in 6 Schritten
 Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
Hinweise zur Facharbeit im Seminarfach (Jg. 12)
 I Titelseite Siehe Muster S.6 II Erste Seite nach der Titelseite Siehe Muster S. 4 III Inhaltsverzeichnis Es enthält die Gliederung der Facharbeit mit Seitenzahlangabe für IV 1.-5. Die jeweiligen Überschriften
I Titelseite Siehe Muster S.6 II Erste Seite nach der Titelseite Siehe Muster S. 4 III Inhaltsverzeichnis Es enthält die Gliederung der Facharbeit mit Seitenzahlangabe für IV 1.-5. Die jeweiligen Überschriften
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4)
 Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Bestimmungsschlüssel für die Epilobiumarten in Schleswig-Holstein (RAABE in Kieler Notizen 1975/4) 1 Seitenadern des Blattes setzen an der Mittelrippe mit einem Winkel von 80-90 Grad an (Abb. 1) Epilobium
Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen. B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch
 Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch mittlere PK-Werte Nachweis durch Doppel-KN kein weiterer PU nachgewiesen PU- Unten breiter
Auflage RU/PU Rollenmerkmale Bemerkungen B 47-1 I (1) PU- (a) Unten schmaler Schnitt mit offenem Mittelzähnungsloch mittlere PK-Werte Nachweis durch Doppel-KN kein weiterer PU nachgewiesen PU- Unten breiter
Ich kann die Lage des Schwarzwaldes innerhalb von Baden-Württemberg beschreiben. (S. 126, S. 222)
 1 Sich orientieren (Orientierungskompetenz) Ich kann die Lage des Schwarzwaldes innerhalb von Baden-Württemberg beschreiben. (S. 126, S. 222) 1 Ergänze den Lückentext durch passende Lagebeschreibungen
1 Sich orientieren (Orientierungskompetenz) Ich kann die Lage des Schwarzwaldes innerhalb von Baden-Württemberg beschreiben. (S. 126, S. 222) 1 Ergänze den Lückentext durch passende Lagebeschreibungen
Versuche zur Untersuchung von Fruchtfarbstoffen
 Versuche zur Untersuchung von Fruchtfarbstoffen Durchgeführt und protokolliert von: Annika Bauland, Corinna Brockers, Anne Jonas, Isabelle Schmidt 1.Versuch: Dünnschichtchromatographie Für diesen Versuch
Versuche zur Untersuchung von Fruchtfarbstoffen Durchgeführt und protokolliert von: Annika Bauland, Corinna Brockers, Anne Jonas, Isabelle Schmidt 1.Versuch: Dünnschichtchromatographie Für diesen Versuch
Verbreitung der Torfmoose in SW-Deutschland anhand dreier Arten
 Coll. Tourbières, Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald 15 (2009-2010) : 81-102 Verbreitung der Torfmoose in SW-Deutschland anhand dreier Arten Adam HÖLZER & Amal HÖLZER Staatliches Museum
Coll. Tourbières, Ann. Sci. Rés. Bios. Trans. Vosges du Nord-Pfälzerwald 15 (2009-2010) : 81-102 Verbreitung der Torfmoose in SW-Deutschland anhand dreier Arten Adam HÖLZER & Amal HÖLZER Staatliches Museum
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana
 Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
NISM - Nationales Inventar der Schweizer Moosflora
 NISM - Nationales Inventar der Schweizer Moosflora Datenzentrum Moose Schweiz Institut für Systematische Botanik der Universität Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich e-mail nism@systbot.uzh.ch web www.nism.uzh.ch
NISM - Nationales Inventar der Schweizer Moosflora Datenzentrum Moose Schweiz Institut für Systematische Botanik der Universität Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich e-mail nism@systbot.uzh.ch web www.nism.uzh.ch
1 Was ist Leben? Kennzeichen der Lebewesen
 1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
1 In diesem Kapitel versuche ich, ein großes Geheimnis zu lüften. Ob es mir gelingt? Wir werden sehen! Leben scheint so selbstverständlich zu sein, so einfach. Du wirst die wichtigsten Kennzeichen der
MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES
 161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang Economics (M. Sc.) Bitte dieses Merkblatt vor dem Beginn der Masterarbeit durchlesen.
 Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang Economics (M. Sc.) MERKBLATT FÜR DIE ANFERTIGUNG EINER MASTERARBEIT Bitte dieses Merkblatt vor dem Beginn der Masterarbeit durchlesen. 1. Termine und Fristen
Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang Economics (M. Sc.) MERKBLATT FÜR DIE ANFERTIGUNG EINER MASTERARBEIT Bitte dieses Merkblatt vor dem Beginn der Masterarbeit durchlesen. 1. Termine und Fristen
Erste schriftliche Wettbewerbsrunde. Klasse 4
 Klasse 4 Erste schriftliche Wettbewerbsrunde Die hinter den Lösungen stehenden Prozentzahlen zeigen, wie viel Prozent der Wettbewerbsteilnehmer die gegebene Lösung angekreuzt haben. Die richtigen Lösungen
Klasse 4 Erste schriftliche Wettbewerbsrunde Die hinter den Lösungen stehenden Prozentzahlen zeigen, wie viel Prozent der Wettbewerbsteilnehmer die gegebene Lösung angekreuzt haben. Die richtigen Lösungen
Faktenblatt: Entwicklung des Alkoholkonsum der Schweiz seit den 1880er Jahren
 Datum: 28.1.213 Für ergänzende Auskünfte: Sektion Alkohol (Email: alkohol@bag.admin.ch) Faktenblatt: Entwicklung des Alkoholkonsum der Schweiz seit den 188er Jahren Basierend auf den Daten der Eidgenössischen
Datum: 28.1.213 Für ergänzende Auskünfte: Sektion Alkohol (Email: alkohol@bag.admin.ch) Faktenblatt: Entwicklung des Alkoholkonsum der Schweiz seit den 188er Jahren Basierend auf den Daten der Eidgenössischen
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz
 Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Protokoll Grundpraktikum I: T6 Thermoelement und newtonsches Abkühlungsgesetz Sebastian Pfitzner 5. Juni 03 Durchführung: Sebastian Pfitzner (553983), Anna Andrle (55077) Arbeitsplatz: Platz 3 Betreuer:
Lernzirkel Kartoffel und Kartoffelprodukte. 2. Fertigt ein Balkendiagramm an mit der Länge 10 cm und der Höhe 1 cm.
 M35: Lernzirkel Kartoffel und Kartoffelprodukte Lernzirkel Kartoffel und Kartoffelprodukte Station 1: Nährstoffgehalt einer Kartoffel 1. Schlagt in der Nährwerttabelle "Kartoffel, roh" nach. 2. Fertigt
M35: Lernzirkel Kartoffel und Kartoffelprodukte Lernzirkel Kartoffel und Kartoffelprodukte Station 1: Nährstoffgehalt einer Kartoffel 1. Schlagt in der Nährwerttabelle "Kartoffel, roh" nach. 2. Fertigt
Der gelbe Weg. Gestaltungstechnik: Malen und kleben. Zeitaufwand: 4 Doppelstunden. Jahrgang: 6-8. Material:
 Kurzbeschreibung: Entlang eines gelben Weges, der sich von einem zum nächsten Blatt fortsetzt, entwerfen die Schüler bunte Fantasiehäuser. Gestaltungstechnik: Malen und kleben Zeitaufwand: 4 Doppelstunden
Kurzbeschreibung: Entlang eines gelben Weges, der sich von einem zum nächsten Blatt fortsetzt, entwerfen die Schüler bunte Fantasiehäuser. Gestaltungstechnik: Malen und kleben Zeitaufwand: 4 Doppelstunden
Verbindliche Vorgaben zum Dokumentieren und Präsentieren
 Verbindliche Vorgaben zum Dokumentieren und Präsentieren Die GFS besteht aus drei Teilen: 1. schriftliche Ausarbeitung 2. Vortrag 3. Befragung Thema absprechen Sprich vor Beginn das Thema mit dem Fachlehrer
Verbindliche Vorgaben zum Dokumentieren und Präsentieren Die GFS besteht aus drei Teilen: 1. schriftliche Ausarbeitung 2. Vortrag 3. Befragung Thema absprechen Sprich vor Beginn das Thema mit dem Fachlehrer
Wasserleitung in Pflanzen rot und blau gefärbte Pflanzenblüten oder -blätter
 50 Experimente - Biologie / 9.-13. Schulstufe 60 Min Wasserleitung in Pflanzen rot und blau gefärbte Pflanzenblüten oder -blätter Pflanzen brauchen zum Leben ständig Wasser. Jeder Hobbygärtner und Zimmerpflanzenliebhaber
50 Experimente - Biologie / 9.-13. Schulstufe 60 Min Wasserleitung in Pflanzen rot und blau gefärbte Pflanzenblüten oder -blätter Pflanzen brauchen zum Leben ständig Wasser. Jeder Hobbygärtner und Zimmerpflanzenliebhaber
Volkmar Schara Bayernring Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521
 www.sempervivumgarten.de info@sempervivumgarten.de Volkmar Schara Bayernring 6 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Sempervivum - Grüne Typen Teil III In jeder Pflanzung ist die grüne Farbe
www.sempervivumgarten.de info@sempervivumgarten.de Volkmar Schara Bayernring 6 91567 Herrieden Fon 09825/4846 Fax 09825/923521 Sempervivum - Grüne Typen Teil III In jeder Pflanzung ist die grüne Farbe
Organisatorische Hinweise für die Anfertigung juristischer Seminararbeiten
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Europäisches Wirtschafts- und Umweltrecht Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht Prof. Dr. G. Ring Organisatorische Hinweise
TU Bergakademie Freiberg Institut für Europäisches Wirtschafts- und Umweltrecht Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht Prof. Dr. G. Ring Organisatorische Hinweise
Tagfalter in Bingen. Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
/ / / Untersuchung des Bakterienwachstums bei unterschiedlicher Zusammensetzung der Nähragar-Grundsubstanz
 22.01. / 29.01./ 05.02. / 17.02.2010 Untersuchung des Bakterienwachstums bei unterschiedlicher Zusammensetzung der Nähragar-Grundsubstanz Benedikt Oswald und Sebastian Scheinost Als Vorbereitung der durchzuführenden
22.01. / 29.01./ 05.02. / 17.02.2010 Untersuchung des Bakterienwachstums bei unterschiedlicher Zusammensetzung der Nähragar-Grundsubstanz Benedikt Oswald und Sebastian Scheinost Als Vorbereitung der durchzuführenden
Formatvorgaben für die Ausarbeitung
 Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Die heimischen Ginsterarten
 Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Saisonale Nährstoffdynamik und. Veränderung der Futterqualität. auf einem Kalkmagerrasen. Heidi Weber
 Saisonale Nährstoffdynamik und Veränderung der Futterqualität auf einem Kalkmagerrasen Diplomarbeit im Studiengang Landschaftsökologie Heidi Weber Mai 2009 I Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut
Saisonale Nährstoffdynamik und Veränderung der Futterqualität auf einem Kalkmagerrasen Diplomarbeit im Studiengang Landschaftsökologie Heidi Weber Mai 2009 I Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut
Musterprüfung Chemie Klassen: MPL 09 Datum: 14. 16. April 2010
 1 Musterprüfung Chemie Klassen: MPL 09 Datum: 14. 16. April 2010 Themen: Metallische Bindungen (Skript S. 51 53, inkl. Arbeitsblatt) Reaktionsverlauf (Skript S. 54 59, inkl. Arbeitsblatt, Merke, Fig. 7.2.1
1 Musterprüfung Chemie Klassen: MPL 09 Datum: 14. 16. April 2010 Themen: Metallische Bindungen (Skript S. 51 53, inkl. Arbeitsblatt) Reaktionsverlauf (Skript S. 54 59, inkl. Arbeitsblatt, Merke, Fig. 7.2.1
dansand fugensand D A N S A N D Produktinformationen zum patentierten Fugenmaterial für Betonpflasterflächen N a t ü r l i c h. O h n e U n k ra u t
 dansand fugensand Produktinformationen zum patentierten Fugenmaterial für Betonpflasterflächen D A N S A N D N a t ü r l i c h. O h n e U n k ra u t unkraut hemmend umweltfreundlich und natürlich Dansand
dansand fugensand Produktinformationen zum patentierten Fugenmaterial für Betonpflasterflächen D A N S A N D N a t ü r l i c h. O h n e U n k ra u t unkraut hemmend umweltfreundlich und natürlich Dansand
Berufliche Oberschule Landsberg am Lech FOSBOS. Seminarphase
 Modul Formale Gestaltung und Layout Seminarphase Kriterienkatalog für die formale Gestaltung und das Layout der Seminararbeit 1 Kriterienkatalog für die Seminararbeit Kriterium Blattformat Randeinstellungen
Modul Formale Gestaltung und Layout Seminarphase Kriterienkatalog für die formale Gestaltung und das Layout der Seminararbeit 1 Kriterienkatalog für die Seminararbeit Kriterium Blattformat Randeinstellungen
Dr. habil. Anna Salek. Vorteile Serotypisierung Legionella: Falsch negatives oder positives Ergebnis
 Dr. habil. Anna Salek Vorteile Serotypisierung Legionella: Falsch negatives oder positives Ergebnis Was ist in Ihrer Wasserleitung? Legionellen: Regelmäßige Kontrollen Regelmäßige Kontrollen sind unverzichtbar
Dr. habil. Anna Salek Vorteile Serotypisierung Legionella: Falsch negatives oder positives Ergebnis Was ist in Ihrer Wasserleitung? Legionellen: Regelmäßige Kontrollen Regelmäßige Kontrollen sind unverzichtbar
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt.
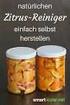 ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
Material: Rotkohlblätter, Eiklar, Essigsäurelösung (w=10%), Speiseöl, Spülmittel farblos verdünnt mit Wasser 1:1, Wasser, 9 Reagenzgläser, Messer.
 Bau der Biomembran Experiment mit Rotkohl: Indirekter Nachweis von Membranbestandteilen verändert nach Feldermann, D. (2004). Schwerpunktmaterialien Linder Biologie Band 1. Hannover, Schroedel Fragestellung:
Bau der Biomembran Experiment mit Rotkohl: Indirekter Nachweis von Membranbestandteilen verändert nach Feldermann, D. (2004). Schwerpunktmaterialien Linder Biologie Band 1. Hannover, Schroedel Fragestellung:
Leben im Boden. Dominik Noldin German-Titow-Straße 26, Aschersleben. Nils Schreiber Bachstelzenweg 7, Aschersleben
 Leben im Boden Dominik Noldin German-Titow-Straße 26, 06449 Aschersleben Nils Schreiber Bachstelzenweg 7, 06449 Aschersleben Kreativwerkstatt der Stadt Aschersleben Wilhelmstraße 21-23, 06449 Aschersleben
Leben im Boden Dominik Noldin German-Titow-Straße 26, 06449 Aschersleben Nils Schreiber Bachstelzenweg 7, 06449 Aschersleben Kreativwerkstatt der Stadt Aschersleben Wilhelmstraße 21-23, 06449 Aschersleben
Station Titel der Station Materialien Aufgaben fertiggestellt. Stationskarte, Lösungskarte. Stationskarte, Informationskarte, VORANSICHT.
 S 3 M 1 Laufzettel Laufzettel von: Nehmt den Laufzettel zu den Stationen mit. Vermerkt auf ihm, wann ihr mit den Aufgaben der jeweiligen Station fertig geworden seid. Notiert auch, ob die Lösung überprüft
S 3 M 1 Laufzettel Laufzettel von: Nehmt den Laufzettel zu den Stationen mit. Vermerkt auf ihm, wann ihr mit den Aufgaben der jeweiligen Station fertig geworden seid. Notiert auch, ob die Lösung überprüft
Modul č. 12. Odborná němčina pro 2. ročník
 Modul č. 12 Odborná němčina pro 2. ročník Thema 5: Holzkunde - Terminologie Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 5: Holzkunde Terminologie Holz Borke, Rinde
Modul č. 12 Odborná němčina pro 2. ročník Thema 5: Holzkunde - Terminologie Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 5: Holzkunde Terminologie Holz Borke, Rinde
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen
 ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
ph-wert ph-wert eine Kenngröße für saure, neutrale oder basische Lösungen ChemikerInnen verwenden den ph-wert um festzustellen, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Man verwendet eine Skala von 0-14:
Suche nach einer Unterbrechung des Drahtes mit dem Werkzeug Unterbrechungsfinder
 3.3.2.2 Suche nach einer Unterbrechung des Drahtes mit dem Werkzeug Unterbrechungsfinder Vor dem Gebrauch des Kabelbruchmelders, sind zumindest die Abschnitte des Handbuchs zur Sicherheit, Reparatur und
3.3.2.2 Suche nach einer Unterbrechung des Drahtes mit dem Werkzeug Unterbrechungsfinder Vor dem Gebrauch des Kabelbruchmelders, sind zumindest die Abschnitte des Handbuchs zur Sicherheit, Reparatur und
