Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter MITTEILUNGEN
|
|
|
- Theresa Müller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 MITTEILUNGEN DER ABTEILUNG FÜR ZOOLOGIE UND BOTANIK AM LANDESMUSEUM JOANNEUM" IN GRAZ HEFT 16 MAI 1963 Die wichtigsten Honigtauerzeuger des steirischen Ennstales Von ANNEMARIE FOSSEL (Aigen im Ennstal, Stmk.) Inhaltsverzeichnis Zum Geleit! 1 Einleitung 2 Die wichtigsten Honigtauerzeuger des steirischen Ennstales (mit zwölf Abbildungen) 3 Literaturverzeichnis 19 Register der im Text genannten Honigtauerzeuger und Wirtspflanzen derselben 21 Zum Geleit! Mit vorliegender Veröffentlichung über die wichtigsten Honigtauerzeuger des steirischen Ennsgebietes liefert die Verfasserin einen wichtigen Beitrag des Gastlandes Steiermark zu der im August 1963 in Graz stattfindenden Arbeitstagung der Internationalen Kommission zum Studium sozialer Insekten" aus ihrem engeren Arbeitsgebiet, worin sie die in langjährigen Untersuchungen gesammelten Ergebnisse zusammenfaßt. Hiebei wird die besondere Bedeutung der Blatt- (Aphiden) und Schildläuse (Cocciden) als Erzeuger des für Honigbienen, Ameisen und andere so wichtigen Honigtaues behandelt, der als die Nahrungsquelle in unseren Wäldern die Bienenhaltung erst existenzfähig macht, ebenso wie er das Leben der Ameisen bis in hohe Gebirgslagen bedingt, ohne deren Vorhandensein (Waldpolizei!) wiederum das Überhandnehmen von Schadinsekten zur Vernichtung der Wälder führen müßte. Mögen die Ausführungen der Verfasserin allen maßgeblichen Stellen und Kreisen die hervorragende Bedeutung, Wichtigkeit und Notwendigkeit des Studiums dieses umfangreichen und komplizierten Fragenkomplexes in allen seinen Teilen blitzlichtartig klarmachen, damit diesem weit über alle unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen hinausreichenden Kapitel der Zoologie eine ganz besonders verdiente Förderung zuteil werde. KARL MECENOVIC 1
2 Einleitung Im Jahre 1952 wurde mit der Beobachtung der Honigtauerzeuger im Ennstal begonnen, und seither wurden einzelne, besonders günstige Standorte, regelmäßig besucht, andere Gebiete jedoch nur gelegentlich kontrolliert, um eine Übersicht über die Bedeutung und Verbreitung dieser Insekten zu gewinnen. Dabei erstreckten sich die Beobachtungen nicht nur auf das Haupttal der Enns, sondern über den ganzen politischen Verwaltungsbezirk Liezen, einschließlich des steirischen Salzkammergutes. Meine Beobachtungen waren bisher hauptsächlich darauf gerichtet, festzustellen, welche honigtauerzeugenden Insekten im Ennstal vorkommen. Man versteht darunter eine Reihe von Aphiden (Blattläuse) und Cocciden (Schildläuse), die mit ihren Mundwerkzeugen die Saftbahnen (Siebröhren, Phloëm) von Laub- und Nadelbäumen anstechen und als Endprodukt ihrer Verdauung konzentrierte Zuckerlösungen ausscheiden, den sogenannten Honigtau. Dieser Honigtau fällt gelegentlich in großen Mengen an und sammelt sich in den Morgenstunden in Form von wasserklaren, zähflüssigen Tröpfchen wie frischer Tau auf Blättern oder Nadeln. Bei warmer, trockener Witterung dickt er zu einem klebrigen Belag ein oder bildet eine kristalline, zuckerartige Masse, die als Manna bezeichnet wird. Die Bedeutung der Honigtauerzeuger besteht darin, daß zahlreiche Insekten sich von diesen Süßstoffen ernähren, die von Aphiden und Cocciden ausgeschieden werden. Für viele Insekten stellt der Honigtau die einzige Quelle für die lebensnotwendigen Kohlehydrate der Nahrung dar. Besonders die Ameisen haben es darauf abgesehen, und ein einziges Nest kann im Laufe des Sommers bis zu 25 kg Honigtau eintragen. Neben den Ameisen sind vor allem die Honigbienen auf den Honigtau unserer Wälder angewiesen und ohne die Erträge, aus der Waldtracht wäre die Bienenhaltung in Mitteleuropa nicht mehr existenzfähig. Die oft sehr schwierigen Determinationen der Honigtauerzeuger verdanke ich Prof. Dr. F. SCHREMMER vom II. Zoologischen Institut der Universität Wien und Doz. Dr. W. KLOFT vom Institut für angewandte Entomologie der Universität Würzburg, denen ich an dieser Stelle für ihre freundliche Hilfe nochmals meinen besonderen Dank ausspreche. Auch der Steiermärkischen Landesregierung bin ich zu Dank verpflichtet, die mir zur Fortführung der wissenschaftlichen Arbeiten einen Forschungsbeitrag gewährte.
3 Die wichtigsten Honigtauerzeuger des steirischen Ennstales Die Reibung der Honigtauerzeuger erfolgt nun nach den Wirtspflanzen, weil dadurch eine bessere Übersicht über ihre wirtschaftliche Bedeutung gegeben erscheint. A. Honigtauerzeuger auf Koniferen Unter den Waldbäumen des steirischen Ennstales besitzen die Nadel- Däume die größte Verbreitung. 1. Die Fichte, Picea excelsa (Lam.) Link Die Fichte erreicht etwa 60% des Baumbestandes, und schon allein dadurch spielt der Honigtau der Fichte die wichtigste Rolle, aber sie Deherbergt auch eine besonders große Zahl verschiedener Arten von Honigtauerzeugern. a) Coccoidea, Familie Lecaniidae, Unterfamilie Lecanünae, Tri- Dus Lecanini, Genus Physokermes TARG., zwei Arten: Physokermes piceae SCHRK., die große Fichtenlecanie oder Große Fichtenquirl-Schildlaus, und Physokermes hemicryphus DALM., die kleine Fichtenlecanie oder Kleine Fichtenquirl-Schildlaus. Beide Arten entwickeln nur eine Generation im Jahr. Die Weibchen Aberwintern im zweiten Larvenstadium im Schütze der Fichtenquirlschuppen der einjährigen Triebe, die Männchen auf den Fichtennadeln in Mähe der von Weibchen besetzten Wirtel. Abb. 1 zeigt die große Art zur Seit der Honigtauproduktion im Mai. Der Honigtau wird nicht abgespritzt ind hauptsächlich von Ameisen eingetragen. Abb. 2 zeigt die kleine Fichtenlecanie mit Honigtautropfen. Sie entwickelt sich etwa um 4 Wochen später als die große Art, und ihre Honig- ;auproduktion fällt im Ennstal in den Juni. Ihr Honigtau wird vor allem /on den Honigbienen ausgenützt, die aus dieser Tracht in günstigen Jah- "en Spitzenleistungen von 30 kg pro Volk einzubringen vermögen. Zur Massenvermehrung der beiden Lecanienarten kam es in den fahren 1959 und Ihre Verbreitung erstreckt sich über das ganze»teirische Ennstal mit Ausnahme der Höhenlagen über 1200 oder 1400 m, iber es fällt auf, daß die verschiedenen Waldbestände sehr ungleichen 3esatz aufweisen. In ameisenreichen Waldstrichen ist der Besatz regelnäßiger und dichter.
4 Abb. 1: Physokermes piceae SCHRK., Große Fichtenlecanie. Unten vier weibliche Große Lecanien, oben rechts an einer Nadel eine männliche Larve und darüber an einer Nadel das leere Wachsschild einer männlichen Larve. Abb. 2: Physokermes hemicryphus DALM., Kleine Fichtenlecanie. Im Höhepunkt ihrer Honigtauproduktion. b) Aphidoidea, Unterreihe Aphidina, Familie Lachnidae, Unterfamilie Cinarinae, Tribus Cinarini, Genus Cinaropsis CB., vier Arten Genus Lachniella d. Gu., eine Art: die große schwarze Cinaropsis piceae PANZ., die rotbraune bepuderte Cinaropsis pilicornis HTG., die grüngestreifte Cinaropsis cistata BCKT., die graugrün gescheckte Cinaropsis pruinosa HTG., und endlich ' die stark bemehlte Lachniella costata ZETT., die zur Gattung Lachniella gehört. Diese Honigtauerzeuger überwintern im Eistadium und entwickeln 5 9 Generationen pro Jahr, in denen, ausgehend von der Fundatrix, der Stammutter, lauter vivipare Virgines auftreten, die in oder ab der dritten Generation teilweise oder größtenteils Flügel tragen. Männchen und ovipare, begattungsbedürftige Weibchen erscheinen zumeist erst im Herbst, oft erst im Oktober. Alle genannten Fichtenlachniden sind im ganzen steirischen Ennstal verbreitet und häufig, doch begleiten nur Cinaropsis piceae PANZ. und Cinaropsis cistata BCKT. die Fichte regelmäßig bis zur Vegetationsgrenze. Die anderen Arten bevorzugen geschütztere Lagen.
5 Wie bei allen Insekten wechseln auch bei den FichtenZaehniden Jahre mit starker Massenvermehrung mit ausgesprochenen Fehljahren, doch finden sich stets in gut mit Waldameisen besetzten Waldstrichen inselartige Refugien, die für die gesamte Fauna dieser Standorte eine große Rolle spielen und die große Bedeutung von Ameisen und Honigtauerzeugern für die Lebensgemeinschaft des Waldes vor Augen führen. Abb. 3 zeigt einen Fichtenzweig mit kandiertem Honigtau der großen schwarzen Cinaropsis piceae PANZ., der im September 1960 an einer Fichte auf der Tauplitzalm auf dem Wege zum Lawinenstein gefunden wurde. Dort gibt es zahlreiche Nester der großen roten Waldameise der Rasse Formica aquilonia JARROW., die eine ausgezeichnete Lauszüchterin ist. Die Honigtauproduktion der großen schwarzen Cinaropsis piceae PANZ, fällt gewöhnlich in den Juli und wird auch von den Honigbienen ausgenützt. Abb. 3: Fichtenzweig mit kandiertem Honigtau von Cinaropsis piceae PANZ. Tauplitzalm, Oktober Die rotbraune bepuderte Cinaropsis pilicornis HTG. besiedelt vor allem die Maitriebe der Fichte und erzeugt dort im Juni große Mengen von Honigtau (Abb. 4). Sobald die Maitriebe verholzen, erscheinen die Geschlechtstiere, und der Jahreszyklus dieser Art wird schon im Juli mit der Ablage von Wintereiern an den Nadeln beendet. Für die Cinaropsis pilicornis haben die Ameisen wenig Interesse, so daß dieser Honigtau zahlreichen Insekten und vor allem auch der Honigbiene zugute kommt. Die Waldameisen machen den Bienen beim Einsammeln des Honigtaues starke Konkurrenz, weil sie ihn direkt von den Aphiden aufnehmen oder erbetteln (Trophobiose), während die Honigbienen nur den überschüssigen Honigtau bekommen, der von den Lachniden abgespritzt wird, wenn keine Ameisen zur Stelle sind.
6 Abb. 4: Cinaropsis pilicornis HTG. auf Picea excelsa mit großen Honigtautropfen. Der Honigtau von Cinaropsis cistata BCKT. und Cinaropsis pruinosa HTG. kommt nach meinen Beobachtungen hauptsächlich den Ameisen zugute und Lachniella costata ZETT. ist zwar verbreitet, bildet aber stets nur kleine Kolonien. Sie hat von den Honigtauerzeugern der Fichte im Ennstal die geringste Bedeutung. 2. Die Tanne, Abies alba Mill. (A. pedinata) Die Tanne tritt im Ennstal nur selten in geschlossenen Beständen auf, ist aber regelmäßig in den meisten Waldungen anzutreffen und im Salzkammergut auch von forstwirtschaftlicher Bedeutung. Die Tanne beherbergt gelegentlich auch die beiden Fichtenlecanien Physokermes piceae SCHRK. und Physokermes hemicryphus DALM., aber die wichtigsten Honigtauerzeuger der Weißtanne sind Lachniden des Tribus Cinarini CB., und zwar zwei Arten: die grüngestreifte Buchneria pectinatae NÖRDL. und die schwarzbraune Todolachnus abieticola CHOL. Da die Lachniden der Koniferen keine deutschen Artnamen besitzen, ergänzt man die lateinischen Bezeichnungen in wirtschaftlich interessierten Laienkreisen durch charakterisierende Eigenschaftswörter, die in dieser Aufstellung der Vollständigkeit halber angeführt werden. Die grüngestreifte Buchneria pectinatae NÖRDL. besitzt eine ausgezeichnete Schutzfarbe und saugt einzeln hinter einer Tannennadel am ein- oder zweijährigen Holz. Die schwarzbraune Todolachnus abieticola CHOL. bildet dagegen große, dichtgedrängte Kolonien an älteren Zweigen. Die Honigtauproduktion der Tannenlachniden beginnt im Ennstal Anfang Juli oder noch später, je nachdem längere Schönwetterperioden die Entwicklung der Lachniden begünstigen.
7 Im September und Oktober 1961 kam es in einigen Standorten der Tanne, z. B. am Pyhrnpaß, in der Klachau, in der Gnanitz und in Donnersbachwald, zu einer spontanen Massenvermehrung beider Arten von Tannenlachniden, und es ergab sich die interessante Tatsache, daß diese Massenvermehrung in ganz Österreich und darüber hinaus im gesamten Verbreitungsgebiet der Weißtanne in Mitteleuropa beobachtet werden konnte. Überall wurde von starker Honigtauproduktion der Tanne im September und Oktober berichtet. Auch die bereits erwähnte Massenvermehrung der Fichtenlecanien in den Jahren 1959 und 1960 erstreckte sich über das ganze Verbreitungsgebiet der Fichte in Europa. Die Fichteniae/iniden machten im Herbst 1961 die starke Entwicklung ihrer Verwandten auf der Tanne trotz gleicher Witterungsbedingungen nicht mit. Das sind überaus interessante Feststellungen, die durch die Zusammenarbeit der interessierten Entomologen und Bienenfachleute er- > möglicht wurden, die sich in der Internationalen Kommission zum Studium sozialer Insekten" vereinen und im August 1963 in Graz ihre nächste Arbeitstagung abhalten werden. Abb. 5: Buchneria pectinatae NÖRDL. auf Abies alba mit Honigtautropfen. Abb. 5 zeigt eine grüngestreifte Buchneria pectinatae NÖRDL. hinter einer Tannennadel und darunter einen Honigtautropfen, der von diesem einen Tier stammt, so daß man sich die Menge von Honigtau vorstellen kann, die auf einer Tanne erzeugt wird, wenn jedes Zweigende nur ein oder zwei Lachniden beherbergt. Im Ennstal ist die Bedeutung der Tannentracht für die Bienenwirtschaft weniger ausschlaggebend als im nördlichen Voralpengebiet, aber
8 es können immerhin gelegentlich bis zu 5 kg Tannenhonig pro Volk geerntet werden. Die Ameisen belaufen die Tannenlachniden weniger intensiv als die Fichtenlachniden. 3. Die Lärche, Larix decidua Mill. (L. europaea) Die Lärche ist im steirischen Ennstal von der Talsohle bis an die Baumgrenze verbreitet und erreicht etwa 2O /o des gesamten Baumbestandes. Ihre Honigtauproduktion fällt daher in günstigen Jahren sehr ins Gewicht, und es gibt Ameisennester, die ihren Bedarf an Kohlehydraten ausschließlich vom Honigtau der Lärche decken. Besonders an der Wald- und Baumgrenze können die Waldameisen durch diese Nahrungsquelle noch hochgelegene Standorte besiedeln und in dieser Kampfzone der Vegetation ihre wichtige Funktion als Waldpolizei erfüllen und das Überhandnehmen von Schadinsekten hintanhalten. Als Honigtauerzeuger auf der Lärche sind im steirischen Ennstal drei Lachniden vom Tribus Cinarini CB. ZU nennen: die gefleckte, borstige Cinaria laricis WALK. (Abb. 6), die graubraune Cinara laricicola CB. und die große schlanke Laricaria kochiana CB. Abb. 6: Cinaria laricis WALK, auf Lärchenzweig, Larix decidua, mit Lärchenmanna. Die größte Verbreitung besitzt die gefleckte, borstige Cinaria laricis WALK., die bis an die Baumgrenze hinauf überall sehr häufig in großen Kolonien anzutreffen ist und stets starken Ameisenbesuch aufweist. 8
9 Cinara laricicola CB. bildet dagegen stets nur kleine Kolonien und meidet höhere Lagen über 1200 m. Sie wird von den Ameisen weniger beachtet. Die große schlanke Laricaria kochiana CB. hält sich mit Vorliebe in klimatisch günstigen Standarten im Wurzelbereich der Lärchen auf, wo ihr verschiedene Ameisenarten geräumige Wurzelkammern anlegen. Lasius fuliginosus LATR. betreut diese Lachnide jahrelang in ihrem Nestbereich, ohne daß Fehljahre zu beobachten wären. Alle drei LärchenlacTmiden sondern sehr reichlich Honigtau ab, der zu rascher Kandelung neigt (Lärchenmanna). Abb. 6 zeigt einen Lärchenzweig mit etwas kandiertem Honigtau. Sein hoher Gehalt an Melezit o s e, einem hochmolekularen Trisaccharid, wird für die schnelle Kandelung verantwortlich gemacht. Auch der von den Bienen verarbeitete Lärchenhonig kandiert schon im Stock und ist deshalb schwer zu schleudern. Im Ennstal spendet die Lärche fast alljährlich Honigtau, aber bienenwirtschaftlich erreicht die Lärchentracht im Ennstal bei weitem nicht die Bedeutung wie im oberen Murtal. Dort erstreckt sich ein bewährtes Lärchentrachtgebiet von Brück an der Mur aufwärts bis in den Salzburger Lungau. Im Ennstal sind Spitzenerträge über 5 kg pro Bienenvolk sehr selten. Die Ameisen ernten ein Vielfaches davon. 4. Die Föhre, Pinus silvestris L. 9 und Latsche, Pinus mugo Turra (P. montana) Die Föhre besitzt in den Wäldern des Ennstales nur geringe Bedeutung, aber die Latsche, die von den gleichen Arten der Honigtauerzeuger befallen wird, bildet weite, geschlossene Areale in der Hochgebirgsregion, vor allem auf Kalkunterlage. Die Determination der Föhren- und LatschenlacTimden bereitet auch heute noch große Schwierigkeiten, weil sich die Beschreibungen der verschiedenen Autoren meist nur auf wenige Merkmale oder bestimmte Entwicklungsstadien stützen. Für den Laien sind die einzelnen Arten kaum zu unterscheiden, so daß ihre Verbreitung im steirischen Ennstal noch nicht so eingehend kontrolliert werden konnte wie bei den Lachniden der anderen Koniferen. Auch die Föhrenlochniden gehören zum Tribus Cinarini CB.; vier Arten konnten bisher nachgewiesen werden: die große braune Cinara pini L., KALT, und eine Unterart: Cinara neubergi ARNH. (Abb. 7 zeigt Cinara pini L., KALT, mit Honigtau); weiters die kleine dunkle Cinaria montanicola CB., die leicht bepuderte Cinaria setosa CB. und die gefleckte Cinaria nuda MORDV. Von diesen Föhvenlachniden besitzt die große braune Cinara pini L., KALT, die größte Verbreitung und findet sich häufig auf Pinus silvestris und Pinus mugo (montana) im benadelten Bereich der Zweige in kleinen Kolonien. Starker Ameisenbesuch und reichliche Honigtauproduktion zeichnen diese Art besonders aus. Auch Bienenbeflug konnte be-
10 obachtet werden. Im Jahre 1958 kam es in ganz Österreich zur Massenvermehrung, die im Juli und August ihren Höhepunkt erreichte und 1962 folgten im Ennstal zwei ausgesprochene Fehljahre. Die kleine dunkle Cinaria montanicola CB. war 1958 und 1959 auf der Tauplitzalm auf Latschen im benadelten und unbenadelten Bereich der Latschenzweige zahlreich in kleinen Kolonien vertreten und stark von Ameisen besucht, ebenso wie auf den Föhren in der Gnanitz. Im Jahre 1960 war sie am Hauser Kaibling in den Latschenbeständen gut vertreten, 1962 war ein Fehl jähr. Die leicht bepuderte Cinaria setosa CB. fand sich im Herbst 1960 auf der Tauplitzalm im benadelten Bereich der Latschenzweige in sehr vereinzelten, kleinen Kolonien mit lebhaftem Ameisenbesuch und etwas Wespenbeflug. Wenn die anderen Latschenlachniden nicht ein Fehljahr gehabt hätten, wäre diese Art wahrscheinlich nicht aufgefallen. In den Jahren 1959 und 1960 wurde sie auch im Gullingtal gefunden, wo sie von Formica lugubris ZETT. betreut wurde. Die gefleckte Cinaria nuda MORDV. trat im Sommer und Herbst 1960 und 1961 auf der Tauplitzalm an den Latschen auf und fand sich auch an alten Föhren auf der Acherlalm bei Wörschach. Sie siedelt in zahlreichen, aber kleinen Kolonien im benadelten Bereich der Zweige und Abb. 7: Cinara pini L., KALT, auf Legföhre, Pinus mugo. Unten kandierter Honigtau. Abb. 8: Nest von Formica lugubris ZETT. unter Pinus mugo am Hauser Kaibling. 10
11 darunter und wird stark von Ameisen besucht. Bienenbeflug konnte von mir bisher nicht beobachtet werden. Abb. 8 zeigt eine Aufnahme vom Nordostabhang des Hauser Kaiblings mit einem Nest der großen roten Waldameise der Rasse Formica lugubris ZETT., die ihren Kohlehydratbedarf von den Honigtauerzeugern der Latsche deckt. Es fand sich dort regelmäßig Cinara pini L., KALT. und fallweise Cinaria montanicola CB. im Bereich dieses Ameisennestes. Im Gegensatz zu den Ameisen ziehen die Honigbienen im Ennstal wenig Nutzen aus dem Honigtau der Latschen, weil diese Trachtmöglichkeit für die Bienenvölker selten auf lohnende Weise erreichbar ist. Aus Vordernberg und vom Präbichl werden gelegentlich Waagstockzunahmen aus den Latschen gemeldet und auch in Neuberg an der Mürz hat ARNHART im Jahre 1930 Bienenbeflug beobachtet. Auch Nadelläuse kommen im Ennstal auf Föhren und Latschen vor. Sie sind wesentlich kleiner als die Rindenläuse, erzeugen aber bei Massenbesatz doch sehr beachtliche Honigtaumengen, die von Bienen und Wespen beflogen werden. Sie gehören zur Unterfamilie Cinarinae, Tribus Protolachnini und Schizolachnini, es sind zwei Arten: Protolachnus agilis KALT., eine hellgrüne bepuderte NadelZachnide, und Schizolachnus pineti F., eine stark bemehlte bräunliche Art. Beide werden von Ameisen wenig beachtet und treten nur vereinzelt in kleinen Kolonien auf, aber sie waren stets zu finden, wenn man besonders danach suchte. 5. Die Zirbe, Pinus cembra L. Im Bereich der Niederen Tauern tritt die Zirbe vereinzelt oder in kleinen Gruppen an der Baumgrenze auf. Häufig findet man unter den Zirben ein Ameisennest und kann beobachten, daß eine breite Ameisenstraße den Stamm entlang führt. Die Ameisen finden auf den Zirben den begehrten Honigtau einer Rindenlaus, es ist dies: Cinaria cembrae CHOL., eine große, gescheckte, metallisch glänzende Art, aus dem Tribus Cinarini CB., die im benadelten und unbenadelten Bereich der Zirbenzweige häufig zahlreiche und große Kolonien bildet und so reichlich Honigtau absondert, daß die wasserhellen, süßen Exkrete von den Ameisen nicht bewältigt werden können, sondern auf Nadeln und Unterwuchs abtropfen, wo sich zahlreiche Insekten (auch Schmetterlinge!) als Besucher einfinden. Auch an einer einzelstehenden Zirbe in öblarn konnte ich diese Zirbenlachnide beobachten. 6. Der Wacholder, Juniperus communis L., und Juniperus sibirica Lodd. (J. nana) Auf beiden im Ennstal heimischen Wacholderarten findet sich in manchen Jahren eine kugelrunde, borstige und bemehlte Lachnide aus dem Tribus Cinarini CB.: Cupressobium juniperi DEG. (Abb. 9). Sie wird sehr fleißig von Ameisen besucht, die den ganzen, reichlich anfallenden Honigtau für sich bell
12 Abb. 9: Große rote Waldameise besucht Cupressobium juniperi DEG. auf Zwergwacholder, Juniperus sibirica. anspruchen. Besonders im Gebiete der Tauplitzalm, wo viele Nester von Formica aquilonia JARROW. ganz zwischen Zwergwacholder eingebettet sind, spielt diese Lachnide für die Ernährung der Ameisen eine große Rolle. Die Art bildet meistens nur kleine Kolonien und erreicht im Frühsommer die größte Populationsdichte. Im Juli geht der Besatz bereits stark zurück. Die Liste der Honigtauerzeuger auf Nadelbäumen kann leider noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es wurden lediglich die wichtigsten Arten genannt, deren Honigtauproduktion in den letzten zehn Jahren wenigstens zeitweise eine Rolle spielte. Das Hauptgewicht meiner Beobachtungen erstreckte sich bisher auf die Verbreitung der Honigtauerzeuger, ihre Biologie und ihre Bedeutung für die Ernährung von Bienen und Ameisen. Viele Fragen sind in diesem Zusammenhang noch ungeklärt und bedürfen weiterer Beobachtungen, so z. B. die Anzahl der Generationen, Anzahl und Verhalten der geflügelten Virgines, Zeitpunkt des Auftretens der einzelnen Entwicklungsstadien, der Massenwechsel usw. Gar nicht berücksichtigt wurden bisher die verschiedenen anderen Nutznießer des Honigtaus und alle jene Insekten, denen die Honigtauerzeuger direkt als Nahrung dienen, wie z. B. Käfer, Raubwanzen, Schlupfwespen, Florfliegen und viele andere. Auch ihr Studium hätte großes wissenschaftliches und praktisches Interesse. 12
13 Die forstwirtschaftlich bedeutsame Frage, ob die Honigtauerzeuger der Koniferen vorwiegend nützlich oder schädlich sind, kann man entschieden zugunsten der Honigtauerzeuger beantworten. Es traten auf den Koniferen auch bei Massenbefall (z. B. über 5000 Cinaropsis piceae PANZ. an einem Fichtenast) keinerlei Stauchungen, Verfärbungen, Krümmungen oder sonst sichtbare Schädigungen an den befallenen Pflanzenteilen auf. Auch später eintretende Nekrosen konnten nicht beobachtet werden. B. Honigtauerzeuger auf Laubbäumen Die Laubbäume spielen im Waldbestand des Ennstales nur eine untergeordnete Rolle. Ihre Honigtauproduktion hat daher stets nur lokale Bedeutung, kann aber im Einzelfall sehr ausgiebig sein, obwohl sie sich meist nur auf wenige Tage oder Wochen erstreckt. Der von den Honigbienen verarbeitete Honigtau der Laubbäume wird im Gegensatz zum W a 1 d h o n i g" der Koniferen als,,b 1 a 11 h o n i g" bezeichnet, während alle aus Nektarquellen stammenden Honige unter dem Sammelbegriff Blütenhonig" zusammengefaßt werden. Manche Laubbäume spenden Blütenhonig und Blatthonig, oft sogar zur selben Zeit, so daß es schwierig ist, die Bedeutung der Honigtautracht der Laubbäume für die Bienen zu beurteilen. Ich will daher im folgenden nur auf jene Honigtauerzeuger der Laubbäume eingehen, die auf Grund meiner bisherigen Beobachtungen bei Ameisen oder bei Honigbienen größere Beachtung fanden. 1. Die Stieleiche, Quercus robur L. In Gruppen oder vereinzelt findet sich die Stieleiche als Baum oder Heister häufig in Tallagen an Waldrändern und Rainen. Sie spielt unter den Laubbäumen des Ennstales als Honigtauquelle die wichtigste Rolle. Aus der Unterfamilie der Lachninae finden sich zwei Arten von Rindenläusen aus zwei nahestehenden Gattungen: Lachnus roboris L., eine dunkelbraune Eichenrindenlaus (Abb. 10), Schizodryobius longirostris MORDV., eine schwarzglänzende Art. Beide Arten saugen in großen Kolonien an der Rinde junger Eichenzweige und sondern fallweise von Mitte Juni an reichlich Honigtau ab, der im Ennstal vor allem verschiedenen Ameisenarten zugute kommt. Schäden durch die Saugtätigkeit dieser Honigtauerzeuger konnten an den befallenen Zweigen nicht beobachtet werden. Die Eier, die oft zu vielen Hunderten offen und dicht gedrängt an den Zweigenden abgelegt werden, fallen im Winter leicht den Vögeln zum Opfer. Außer diesen Rindensaugern sind an der Stieleiche noch zwei Blattlausarten zu nennen: Tuberculoides annulatus HTG. (Aphidoidea, Callaphididae, Callaphidinae, Myzocallidina, Genus Tuberculoides v. d. G.), eine Eichenzierlaus und Thelaxes dryophila SCHRK. (Aphidoidea, Thelaxidae, Thelaxinae. Thelaxini, Genus Thelaxes WESTW.), eine Eichenmaskenlaus. 13
14 Abb. 10: Lachnus roboris L. legt Eier an Eiche ab. Beide Arten sind getrennt oder vereint auf Standorten mit Kalkunterlage fast alljährlich verbreitet und erzeugen große Mengen von Honigtau, der im Juni von Ameisen und Honigbienen und vielen anderen Insekten aufgenommen wird. Die Eichenzierlaus, Tuberculoides annulatus HTG., besiedelt die Unterseite der Eichenblätter, die Eichenmaskenlaus, Thelaxes dryophila SCHRK., die Stengel der Blätter und Früchte und besetzt nur ausnahmsweise bei Massenbefall die Früchte selbst oder die Rippen der Blätter. Schädigungen der Blätter und Früchte wurden nicht beobachtet, aber starke Rußtaubildung auf den Blättern, wenn Ameisen und Bienen die anfallenden Honigtaumengen nicht bewältigen konnten. Schließlich ist auf der Eiche noch eine Schildlaus als Honigtauerzeuger zu nennen: Eulecanium rufulum CKLL. (Lecaniidae), die Eichen-Napfschildlaus. Sie tritt auf vereinzelt stehenden Eichen in Stainach und Gwilk schon seit 1956 alljährlich in großer Zahl auf und erzeugt im Juni reichlich Honigtau, der von Ameisen und Honigbienen eingetragen wird. 2. Die Buche, Fagus silvatica L. Die Buche tritt auf der nach Süden exponierten Talseite der Enns stellenweise in größeren Beständen auf und liefert zahlreichen Ameisenarten gelegentlich Honigtau von einer Rinden- und einer Blattlausart: Schizodryobius pallipes HTG., die Buchenrindenlaus (Unterfamilie 14
15 Lachninae), gehört der selben Gattung an wie die schwarzglänzende Eichenrindenlaus und sieht ihr äußerlich sehr ähnlich. Sie saugt am älteren Holz und in Rindenrissen der Buche und wird für das Auftreten von schorfartigen Rindenrissen und krebsartigen Wunden der Buchenrinde verantwortlich gemacht, die zu Nekrose ganzer Zweigpartien führen können. Bienenbeflug wurde bei dieser Art bisher nicht beobachtet, aber verschiedene Ameisenarten stellten sich ein. Phyllaphis fagi L. (Callaphididae, Phyllaphidinae, Phyllaphidini, Phyllaphidina), die Wollige Buchenzierlaus, die in volkreichen Kolonien die Unterseite der jungen Buchenblätter besiedelt und der Länge nach eingerollte Blattkräuselungen erzeugt. Die befallenen Blätter vergilben vorzeitig und fallen ab. Der Bienenbesuch war Ende Mai und Anfang Juni 1962 sehr lebhaft, besonders in Wörschach und Niederhof en, doch sind noch keine Angaben darüber vorhanden, wieviel Buchenblatthonig von einem Bienenvolk aus dieser Tracht eingetragen werden kann. Der Beflug der Buche wurde im Frühsommer 1962 in vielen Teilen Österreichs festgestellt, war aber in den vergangenen Jahren nicht zu beobachten. Die Ameisen nahmen wenig Notiz von diesen Aphiden. 3. Der Bergahorn, Acer pseudoplatanus L. Der Bergahorn findet sich im Ennstal meist vereinzelt oder in kleinen Gruppen an Wald- und Wegrändern und steigt stellenweise bis auf 1200 m, wo oft besonders mächtige Baumriesen auf Weideflächen anzutreffen sind. Auf dem Bergahorn sind im steirischen Ennstal zwei Blattläuse als Honigtauerzeuger zu nennen: Abb. 11: Bergahorn-Blatt mit Periphyllus villosus HTG-, der europäischen Ahornborstenlaus. 15
16 Periphyllus villosus HTG. (Chaitophoridae, Chaitophorinae, Periphyllini), Abb. 11, die Europäische Ahornborstenlaus, und Drepanosiphon platanoidis SCHRK. (Callaphididae, Phyllaphidinae Drepanosiphonini), die blaßgrüne Ahornzierlaus. Periphyllus villosus HTG. besitzt die größere Verbreitung und spiel' unabhängig davon auch die größere Rolle als Honigtauerzeugerin. Ihre Frühjahrsgenerationen befallen vor allem die Blatt- und Blütenstengel de; Bergahorns, und die Honigtauproduktion erreicht zur Blütezeit des Bergahorns ihren Höhepunkt, so daß die Honigbienen auf dem Bergahorn ofi gleichzeitig Nektar und Honigtau sammeln. Auch der Ameisenbesuch is1 im Frühjahr sehr rege. Die Art ist in allen Teilen des Ennstales verbreitei und liefert fast jedes zweite oder dritte Jahr größere Mengen vor Honigtau. Drepanosiphon platanoidis SCHRK. wurde auch auf Spitzahorn, Acei platanoides L., beobachtet, z. B. in Untergrimming und Admont, aber ei kam im ganzen Beobachtungszeitraum bisher nicht zu einer Massenvermehrung. 4. Die Weißbirke, Betula verrucosa Ehrh. Die Weißbirke ist im ganzen steirischen Ennstal zerstreut an Waldrändern und in Mischwäldern vertreten und zeigt sich stellenweise als beachtliche Honigtauquelle für verschiedene Ameisenarten. In Gwilk (Gemeinde Aigen im Ennstal) und in Hinterwald (Gemeinde Kleinsölk) versorgen sich einige Nester der Waldameise, Formica lugubris ZETT., und der Wiesenameise, Formica pratensis RETZIUS, schon seit Jahren weitgehend mit dem Honigtau der Birke. Als Honigtauerzeuger sind in erster Linie zu nennen: Symydobius oblongus v. HEYD. (Callaphididae, Phyllaphidini, Symydobiina), eine schlanke Birkenrindenlaus, die im Juni und September stellenweise alljährlich sehr große Kolonien bildet, besonders in ameisenreichen Waldstrichen. Betulaphis quadrituberculata KALT., eine blaßgrüne, sehr kleine Birkenblattlaus, die auch zu den Callaphididen gehört und bald da, bald dort vorübergehend Honigtau spendet, aber in so reichem Maße, daß sich auf dem überschüssigen Honigtau Rußtaupilze ansiedeln, die die Birkenblätter schwärzen. Ameisenbesuch und Bienenbeflug wurde 1959 und 1960 in Gwilk beobachtet. Auf den Weißbirken finden sich im Ennstal noch mehrere andere Arten von Aphiden, aber ihre Honigtauerzeugung ist nur gering. 5. Verschiedene Weidenarten, Salix spec. Im steirischen Ennstal gibt es viele Weidenarten. Sie finden sich häufig an Waldrändern, Rainen, in Mooren, an Seen und Ufern meistens in Strauchform, seltener als Heister und Bäume. Sie werden von allen Laubhölzern am häufigsten von zahlreichen Aphidenarten heimgesucht und oft zeigen ihre Blätter starken Rußtaubelag, als sicheres Zeichen dafür, daß Honigtau abgeschieden wurde. Dennoch scheinen die meisten Honigtauerzeuger auf den Weiden nur geringe, lokale Bedeutung zu haben, weil der Befall sehr wechselnd und 16
17 vorübergehend ist, so daß sich nach meinen Beobachtungen keine Ameisenart auf Weiden als Honigtauquelle verläßt. Nur in den Jahren 1952, 1956 und 1961 kam es zu größerer Honigtauproduktion von: Tuberolachnus salignus GMEL., (Lachnidae, Lachninae), der Großen Weidenrindenlaus (Abb. 12). Abb..12: Tuberolachnus salignus GMEL., Große Weidenrindenlaus, auf Salix purpurea L., der Purpurweide. Ihre Kolonien erreichten im August und September dieser Jahre ganz plötzlich die Stärke von vielen hundert Exemplaren aller Altersstufen und besiedelten Korbweiden, Salix viminalis, an der Enns, Purpurweiden, Salix purpurea, und Grauweiden, Salix cinerea, an verschiedenen Uferrändern zwischen Trautenfels und dem Pürgschachenmoor. Auch Silberweiden, Salix alba, und Grauerlen, Alnus incana, wurden vortabergehend von benachbarten Weiden aus besiedelt. Es wurden ungeheure Honigtaumengen produziert. Der dünnflüssige Honigtau sickerte buchstäblich in kleinen Rinnsalen an den Weidenzweigen herab und lockte massenhaft Insekten an. Die Honigbienen fanden sich so zahlreich ein, daß es in den Weiden wie zur Schwarmzeit summte. Bienenwirtschaftlich fällt jedoch eine so späte und unverhoffte Tracht nicht mehr ins Gewicht. 6. Die Linden, Tilia platyphyllos Scop und Tilia cordata Mill. Die Linden werden im steirischen Ennstal vereinzelt als Zierbäume gepflanzt und stehen bei Gehöften und am Straßenrand, wo ihre mächtigen Baumgestalten jedermann auffallen. Ihr Honigtau stammt von: 17
18 Eucallipterus tiliae L. (Callaphididae, Callaphidinae, Eucallipterina), der europäischen Lindenzierlaus. Sie wird von Ameisen nur selten beachtet und von Bienen nur ausnahmsweise beflogen, so daß der oft reichlich anfallende Honigtau auf den Lindenblättern eindickt und zur Ansiedlung von Rußtaupilzen führt, wodurch die Assimilationstätigkeit der Blätter stark beeinträchtigt wird. Bienen und Ameisen leisten daher den Pflanzen durch Beseitigung des Honigtaus nicht zu unterschätzende Dienste. 7. Die Bergulme, Ulmus scabra Mill., und Esche, Fraxinus excelsior L. Bergulme und Esche finden sich zerstreut an Waldrändern und Wegen. Sie waren in den Jahren auf Kalkunterlage bei Trautenfels, Unterburg, Untergrimming, Niederhofen, Aich, Lessern und Vorberg sehr starkem Schildlausbefall ausgesetzt. Er stammte von: Eulecanium corni BCHE. (Coccoidea, Lecaniidae), der Gemeinen Napfschildlaus. Diese Schildlausart entwickelt, wie alle andern bisher besprochenen, nahe verwandten Schildlausarten, nur eine Generation im Jahr, aber sie spritzt, im Gegensatz zu den Physokermesarten, ihren Honigtau kräftig ab, so daß die Honigtautröpfchen ringsum Blätter, Zweige und Unterwuchs lackartig überziehen. Die Ameisen interessieren sich für diesen im Juni anfallenden Honigtau nicht sonderlich, aber dafür Bienen, Wespen und Hummeln, die Eschen und Ulmen lebhaft befliegen. Seit 1959 ist der Besatz im ganzen Beobachtungsgebiet so stark zurückgegangen, daß die Eschen und Ulmen seither praktisch als befallsfrei zu bezeichnen sind. Auf der Esche treten außerdem noch zwei Arten von Aphiden auf, die starke Blattkräuselungen hervorrufen: Prociphilus bumeliae SCHRK., die Eschenzweiglaus, und Prociphilus fraxini F., die Eschenblattnestlaus (Pemphigidae, Pemphiginae, Pachypappini). Ihr reichlich mit weißlichem Wachswollmehl eingepuderter Honigtau sammelt sich in perlartigen Kügelchen in den dichten Blattnestern, wo er von verschiedenen Insekten, auch von Ameisen und Honigbienen, Ende Mai oder anfangs Juni aufgenommen wird. Die Ameisen belaufen schon die Fundatrices, die im allerersten Frühjahr an den Eschenzweigen unterhalb der Winterknospen saugen. Im Juli verschwinden die Kolonien und es bleiben nur die charakteristischen Blattneste* mit Exuvien zurück. Damit glaube ich, die wichtigsten Honigtauerzeuger des steirischen Ennstales aufgezählt zu haben, die sich in den letzten zehn Jahren auf Laub- und Nadelbäumen durch die Abgabe von größeren Honigtaumengen bemerkbar machten. Das steirische Ennstal mit seinen großen Waldbeständen auf Kalkund Urgesteinsunterlage ist in den verschiedenen Höhenstufen sehr reich an Honigtauerzeugern, aber es wird vom oberen Murtal weit übertroffen. Von Brück a. d. Mur bis in den Salzburger Lungau finden die Honigtauerzeuger durch das kontinentale Klima im Bereich der Zentralalpen viel bessere Lebensbedingungen als im Ennstal mit seinen feuchten Sommern. 18
19 Ich hoffe die Beobachtungen fortsetzen zu können und werde mich in verstärktem Maße den Fragen der Biologie und der Massenvermehrung der Honigtauerzeuger zuwenden, aber ich bin mir bewußt, nur ein kleines Teilgebiet des gesamten Fragenkomplexes erfassen zu können. Die Bedeutung der Honigtauerzeuger im Haushalt der Natur geht über die speziellen Interessen der Forstleute und Imker weit hinaus, und es wäre sehr zu wünschen, daß dieses Kapitel der Zoologie von einer höheren Warte aus wissenschaftlich bearbeitet werden könnte. Ich bin daher dem Landesmuseum Joanneum sehr dankbar, daß es mir die Möglichkeit gab, in seinem Mitteilungsblatt über die Honigtauerzeuger des steirischen Ennstales zu berichten und dadurch die Aufmerksamkeit erneut auf diese Insektengruppe zu richten, deren Nutzen oder Schaden leider meistens nur vom Standpunkt einseitiger wirtschaftlicher Interessen betrachtet wird. Literaturverzeichnis Arnharfc L Der Honigtau der Tanne. Bienenvater 55: Der Fichtenhonig. Bienen va ter 56: Der Honigtau. Bienenvater 56: Chemische Zusammensetzung der Koniferenhonige. Bienenvater 57: österreichischer Lärchenhonigtau, Lärchenmanna und Lärchenhonig. Z. f. angew. Entom. 12 : Die Latsdhenhonigtau liefernde Lachnus neubergi n. spec. Z. f. angew. Entom. 16 : Börner C Europae centralis Aphides. Mitt. thür. bot. Ges., Beih. 3 : Weimar. & Franz H Die Blattläuse des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes, österr. zool. Z. 6 (3/5) : Fossel A Lärchenhonig. Bienenvater 77 (6) : , (7) : Die Tannentracht. Bienenvater 79 (6) : , (7/8) : Die Fichtentracht. Bienenvater 81 (7/8) : Neues vom Honigtau. Bienenvater 83 (4) Ergebnisse und Fragen der Wialdtrachtbeobachtung unter besonderer Berücksichtigung der Fichtenlecanien. Z. f. Bienenforschg. 6 (3) : Franz H Zur Kenntnis der Aphidenfauna Kärntens. Carinthia II, 69 : Geinitz B Honigtau, Bienenzucht und Forstwirtschaft. Verh. VII. Intern. Kongr. f. Entom. Berlin : Gontarski H Beitrag zur Honigtaufrage. Z. f. angew. Entom. 27 : Gorbach G Vorkommen, Gewinnung und Verwertung der Melezitose. Bienenviater 70 : 6 14, Beiträge zur Chemie des Honigs. Forschungsdienst 11 :222 und 426. Berfldn Waldhonig. Südwestdeutsch. Imker (5). Hölzl F Beobachtung des Honigens der Fichte. Bienenvater 73 : Temperatur Honigtau Waagvolk, österr. Imker 2 : Warum Fehljahre bei Fichte und Tanne? Bienenvater 77 (9) : Kloft W Einwirkungen einiger bienenwirtschiaftlich wichtiger Rindenläuse auf das Pflanzenwachstum. Z. f. Bienenforschg. 1 : Blienen, Ameisen und Wald. Der Imkerfreund 8 : München Die Nestbautätigkeit der roten Waldameise. Waldhygiene (3/4) Versuch einer Analyse der trophobiotischen Beziehungen von Ameisen zu Aphiden. Biol. Zbl. 78 (6) : Die Trophobiose zwischen Ameisen und Pflanzenläusen. Entomophaga V, I. Paris., Kunkel H. & Erhardt P Beitrag zur Lachnidenfauna Mitteleuropas (Homoptera: Aphididae). Beitr. z. Entom. 10 (1/2) : Berlin. 19
20 1961. Die wichtigsten Lachniden der Fichte. Deutsch. Bien.-Ztg. Leonhardt H Beiträge zur Kenntnis der Lachniden, der wichtigsten Tannenhonigtauerzeuger. Z. f. angew. Entom. 27 : Ruttner F Oberösterreichische Honige. Bienenvater 77 (3) : Waldtracht und Waldtrachtbeobachtung in Österreich. Bienenvater 81 (7/8) : Sc'hels J Beobachtungen an Cinara pinicola. Z. f. Bienenforschg. (4/3) Wie beobachtet man Honigtauerzeuger. Deutsch. Bien.-Ztg. Schiller J Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung der Wald'honige aus den österreichischen Waldgebieten. Bienenvater 69 : Die Herkunft des Honigtaues und die Bedingungen seiner Entstehung. Donauland-Imker 52 (1/2). Schmutterer H Beobachtungen über Honigtauerzeuger und Honigtautrac'hten im Frühsommer 1957 in Oberhessen. Z. f. Bienenforschg. (4/5). Schremmer F Beobachtungen und Untersuchungen über die Insektenfauna der Lärche. Z. f. angew. Entom. 5,45 :1 48 und Seitner M Die ZirbenblattLaus Lachnus cembrae n. spec. Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 62: Sorauer P Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Aufl. 5, 5, 4. Lief., Homoptera II. Teil: Wellenstein G Beiträge zur Systematik und Biologie der Rindenläuse (Lachnidae C. B.) Z. Morph. ökol. d. Tiere 17 (4): Wepfer Th Waldtracht Schweizerische Bienen-Ztg. Zander E Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. IV. Studien zur Herkunftsbestimmung bei Waldhonigen. München. Zoebelein G Versuche zur Feststellung des HonLgtauertrages von Fichtenbeständen mit Hilfe von Waldameisen. Z. f. angew. Entom. 36 (3) : 358 bis 362. Zwölfer W Der Wald als Honigspender. AlLg. Forstz. 4 : Die Waldbienen weide und ihre Nutzung als forstentomologisches Problem. Verh. deutsch. Ges. f. angew. Entom. a. d. 12. Mitgliedervers, p
21 REGISTER der im Text genannten Honigtauerzeuger und Wirtspflanzen derselben (Die Zahlen bezeichnen die Seiten) Honigtauerzeuger Betulaphis quadrituberculata Kalt 16 Buchneria pectinatae Nördl.. 6, 7 Cinana laricicola CB 8, 9 Cinana neubergi Arnh Cimara pini L., Kalt 9, 10, 11 CLnariia cembrae Chol Ciniaria laricis Walk 8 Cinaria montanicola CB.... 9, 10, 11 Cinaria nuda Mordv 9, 10 Cinaria setosa CB 9, 10 Cinaropsis cistata Bckt. '... 4, 6 Cinaropsis piceae Panz.... 4, 5, 13 Cinaropsis pimcornis Htg... 4, 5, 6 Cimaropsis pruinosa Htg.... 4, 6 Cupressobium juniperi Deg.. 11, 12 Drepanosiphon platanoidis Schrk 16 Eucallipterus tiliae L Eulecanium corni Bché Euilecanium rufulum Ckll...14 Abies alba Mill. (A. pectinata) 6 Acer platanoides L 16 Acer pseudo-platanus L Alnus incana (L.) Moench..17 Betula verrucosa Ehrh Fagus selvatica L 14 Fraxinus excelsior L 18 Juniperus communis L Juniperus sibirica Lodd. (J. nana) 11, 12 Darix deciduo ML11. (L. europaea) 8 Picea excelsa (Lam.) Link.. 3 Wirtspflanzen Lachraiella costata Zett.... 4, 6 Lachnus roboris L 13, 14 Laricaria kochiiana CB.... 8, 9 Periphyllus villosus Htg... 15, 16 Phyllaphis fagi L 15 Physokermes hemicryphus Dalm 3, 4, 6 Physokermes piceae Schrk... 3, 4, 6 Prociphilus bumeliae Schrk.. 18 Prociphilus fraxini F 18 Protolachnus agilis Kalt Schizodryobius longirostris Mordv 13 Schizodryobius pallipes Htg.. 14 Schizolachnus pineti F Symydobius oblongus v. Heyd. 16 Thelaxes dryophila Schrk... 13, 14 Tödolachnus abieticola Chol.. 6 Tuberculoides -annulatus Htg.. 13, 14 Tuberolachnus salignus Gmel. 17 Pinus cembra L 11 Pinus mugoturra (P. montana) 9, 10 Pinus silvestris L 9 Quercus robur L 13 Salix 'alba L 17 Salix cinerea L 17 Salix purpurea L 17 Salix vàminalis L 17 Tilia cordata Mill 17 Tilia platyphyllos Scop Ulmus scabra Mill. (U. montana) 18 Anschrift der Verfasserin: Dr. ANNEMARIE FOSSEL, Aigen im Ennstal, Steiermark. Für den Inhalt ist die Verfasserin verantwortlich. Schriftleitung: Dr. KARL MECENOVIC, Graz, Raubergasse 10. Im Selbstverlag der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum", Graz, Raubergasse 10. Druck: Leykam A. G., Graz. 21
Entstehung, Beobachtung, Prognose und Nutzung der Waldtracht
 Gewichtzunahme während der Tracht in kg 12 Baar-Hegau Schwarzwald Süd Zollernalb Schwäbischer Wald Schönbuch Bodensee-Allgäu Schwarzwald Nord Schwarzwald Mitte 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Trachtbeginn bzw.
Gewichtzunahme während der Tracht in kg 12 Baar-Hegau Schwarzwald Süd Zollernalb Schwäbischer Wald Schönbuch Bodensee-Allgäu Schwarzwald Nord Schwarzwald Mitte 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Trachtbeginn bzw.
Waldtracht. Einige Beobachtungen. von Förster Ernst Fankhauser, Eschenbach Text, Fotos ef Fotos R. Ritter E.
 Waldtracht Einige Beobachtungen von Förster Ernst Fankhauser, Eschenbach Text, Fotos ef Fotos R. Ritter 31.03.2013 E. Fankhauser 1 Ablauf Wichtige Blütenpflanzen im Wald Honigtaupflanzen, Ansprüche/ Standorte
Waldtracht Einige Beobachtungen von Förster Ernst Fankhauser, Eschenbach Text, Fotos ef Fotos R. Ritter 31.03.2013 E. Fankhauser 1 Ablauf Wichtige Blütenpflanzen im Wald Honigtaupflanzen, Ansprüche/ Standorte
Liste einheimischer Heckenpflanzen
 Liste einheimischer Heckenpflanzen Dornbüsche Weissdorn Crataegus sp. 4 5 m Heckenrose canina Gewöhnliche Berberitze Stachelbeere Ribes uvacrispa Purgier- Kreuzdorn Schwarzdorn Feld-Rose Hecken-Rose Wein-Rose
Liste einheimischer Heckenpflanzen Dornbüsche Weissdorn Crataegus sp. 4 5 m Heckenrose canina Gewöhnliche Berberitze Stachelbeere Ribes uvacrispa Purgier- Kreuzdorn Schwarzdorn Feld-Rose Hecken-Rose Wein-Rose
Anlage GOP WA Gstettner Straße. Bepflanzung Ausbach
 Anlage GOP WA Gstettner Straße Bepflanzung Ausbach M 1:1000 Ident Bezeichnung (lat.) Baumart Alter Baum höhe Kronen breite Stammumfang Vitalität Schützenswert / 1709 Quercus robur Stiel-Eiche 35 12,00
Anlage GOP WA Gstettner Straße Bepflanzung Ausbach M 1:1000 Ident Bezeichnung (lat.) Baumart Alter Baum höhe Kronen breite Stammumfang Vitalität Schützenswert / 1709 Quercus robur Stiel-Eiche 35 12,00
Portfolio. Pflanzen Spezieller Teil: Bäume. Atelier Symbiota. Alexander Schmidt Kurt-Tucholsky-Straße Leipzig.
 Portfolio Pflanzen Spezieller Teil: Bäume Atelier Symbiota Alexander Schmidt Kurt-Tucholsky-Straße 2 04279 Leipzig Tel.: 0341-9271611 E-Mail: info@atelier-symbiota.de Homepage: www.atelier-symbiota.de
Portfolio Pflanzen Spezieller Teil: Bäume Atelier Symbiota Alexander Schmidt Kurt-Tucholsky-Straße 2 04279 Leipzig Tel.: 0341-9271611 E-Mail: info@atelier-symbiota.de Homepage: www.atelier-symbiota.de
ERLE (Schwarzerle, Alnus glutinosa)
 ERLE (Schwarzerle, Alnus glutinosa) Leipzig, 9 ) -Blütenstände (unreif) ) -Fruchtstände ( Zapfen mit Samen) ) -Blütenstand (reif mit Pollen) ) -Blütenstände Die Erle ist _ein_häusig ( -Blüten und -Blüten
ERLE (Schwarzerle, Alnus glutinosa) Leipzig, 9 ) -Blütenstände (unreif) ) -Fruchtstände ( Zapfen mit Samen) ) -Blütenstand (reif mit Pollen) ) -Blütenstände Die Erle ist _ein_häusig ( -Blüten und -Blüten
Bebauungsplan Umweltbericht. Stammanzahl
 Bebauungsplan 11-60 1 Anhang III Tabelle 1: Baumliste Bebauungsplan 11-60 anzahl 1 Weymouths-Kiefer Pinus strobus 1 135 0 ja 2 Apfel Malus domestica 1 96 2 ja 3 Walnuss Juglans regia 1 80 2 ja 4 Walnuss
Bebauungsplan 11-60 1 Anhang III Tabelle 1: Baumliste Bebauungsplan 11-60 anzahl 1 Weymouths-Kiefer Pinus strobus 1 135 0 ja 2 Apfel Malus domestica 1 96 2 ja 3 Walnuss Juglans regia 1 80 2 ja 4 Walnuss
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
Die Waldameisen im Wald Biologie und Oekologie. Anne Freitag und Daniel Cherix
 Die Waldameisen im Wald Biologie und Oekologie Anne Freitag und Daniel Cherix Georges Gris Laurent Keller Pekka Pamilo Daniel Cherix Rainer Rosengren Ramona Maggini Leila Von Aesch Arnaud Maeder Christian
Die Waldameisen im Wald Biologie und Oekologie Anne Freitag und Daniel Cherix Georges Gris Laurent Keller Pekka Pamilo Daniel Cherix Rainer Rosengren Ramona Maggini Leila Von Aesch Arnaud Maeder Christian
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus)
 Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Eine Übersicht der deutschen Herkünfte
 801 01 Norddeutsches Acer pseudoplatanus L. / Bergahorn (801) 801 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland 801 03 Westdeutsches, kolline Stufe 801 04 Westdeutsches, montane Stufe 801 05 Oberrheingraben
801 01 Norddeutsches Acer pseudoplatanus L. / Bergahorn (801) 801 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland 801 03 Westdeutsches, kolline Stufe 801 04 Westdeutsches, montane Stufe 801 05 Oberrheingraben
Baumrallye durch den Botanischen Garten
 Baumrallye durch den Botanischen Garten Aufgabe: Beantworte kurz die folgenden Fragen zu den zehn Baumgattungen. Mache dafür einen Spaziergang durch den Garten. Benutze den Gartenplan, um dich zu orientieren.
Baumrallye durch den Botanischen Garten Aufgabe: Beantworte kurz die folgenden Fragen zu den zehn Baumgattungen. Mache dafür einen Spaziergang durch den Garten. Benutze den Gartenplan, um dich zu orientieren.
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Preisliste Baumschule 2015 FORST
 Preisliste Baumschule 2015 FORST Preisliste Baumschule 2015 Laubhölzer Acer platanoides Spitzahorn 1+1 30-50 98,50 790,00 1+1 50-80 122,00 980,00 1+1 o. 1+2 80-120 154,00 1.240,00 1+1 o. 1+2 120-150 192,00
Preisliste Baumschule 2015 FORST Preisliste Baumschule 2015 Laubhölzer Acer platanoides Spitzahorn 1+1 30-50 98,50 790,00 1+1 50-80 122,00 980,00 1+1 o. 1+2 80-120 154,00 1.240,00 1+1 o. 1+2 120-150 192,00
Preisliste Pflanzgarten 2017
 Preisliste Pflanzgarten 2017 FORSTREVIER RÜTI-WALD-DÜRNTEN Rütistrasse 80 8636 Wald +41 55 240 42 29 info@frwd.ch Besuchen Sie uns auf unserer neu gestalteten Website unter: www.frwd.ch Preisliste Pflanzgarten
Preisliste Pflanzgarten 2017 FORSTREVIER RÜTI-WALD-DÜRNTEN Rütistrasse 80 8636 Wald +41 55 240 42 29 info@frwd.ch Besuchen Sie uns auf unserer neu gestalteten Website unter: www.frwd.ch Preisliste Pflanzgarten
Stadt Luzern. Allmend Kriens 15
 Baumkataster Luzern Fällliste V13 - Seite 1 Allmend Kriens 15 Stadt Luzern 90119 Populus nigra 'Italica', 105 alle poni J J Populus nigra 'Italica', Italienische 90121 Populus nigra 'Italica', 108 J J
Baumkataster Luzern Fällliste V13 - Seite 1 Allmend Kriens 15 Stadt Luzern 90119 Populus nigra 'Italica', 105 alle poni J J Populus nigra 'Italica', Italienische 90121 Populus nigra 'Italica', 108 J J
Zur Ökologie und Bedeutung
 Institut für Forstbotanik und Forstzoologie Zur Ökologie und Bedeutung seltener Baumarten im Wald Prof. Andreas Roloff www.tu-dresden.de/forstbotanik Sorbus und Taxus in Thüringen, Ilmenau 23.9.2016 Ökologie
Institut für Forstbotanik und Forstzoologie Zur Ökologie und Bedeutung seltener Baumarten im Wald Prof. Andreas Roloff www.tu-dresden.de/forstbotanik Sorbus und Taxus in Thüringen, Ilmenau 23.9.2016 Ökologie
Sachkunde: Baum-Ratespiel
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 3 Methodisch-didaktische Hinweise... 3 Abstract... 4 Die Lärche... 4 Eberesche (Vogelbeerbaum)... 5 Gemeine Hasel (Haselnussbaum)... 5 Buche (Rotbuche)... 6 Platane
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 3 Methodisch-didaktische Hinweise... 3 Abstract... 4 Die Lärche... 4 Eberesche (Vogelbeerbaum)... 5 Gemeine Hasel (Haselnussbaum)... 5 Buche (Rotbuche)... 6 Platane
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
 Statistischer Bericht C II 5-4j/ S 17. März 2005 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Hamburg Standorte: Hamburg und Kiel Internet: www.statistik-nord.de
Statistischer Bericht C II 5-4j/ S 17. März 2005 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Hamburg Standorte: Hamburg und Kiel Internet: www.statistik-nord.de
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI
 DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
DIE SAMENQUELLEN FÜR FORSTLICHES VERMEHRUNGSGUT IN DER SLOWAKEI Dagmar Bednárová, NLC LVÚ Zvolen Bernkastel Kues 04. 07. 6. 2013 Aus der Historie der Zulassung 1938 erste Vorschrift über die Zulassung
B-Plan "Dorfgebiet obere Siedlung Waltersdorf"
 B-Plan "Dorfgebiet obere Siedlung Waltersdorf" k a t j a a e h n l i c h dipl.-ing. (fh) für landespflege vinetastraße 19 17459 koserow isdn 038375 / 22056 k.aehnlich@yahoo.de Baumbestandliste 1 Acer pseudplatanus
B-Plan "Dorfgebiet obere Siedlung Waltersdorf" k a t j a a e h n l i c h dipl.-ing. (fh) für landespflege vinetastraße 19 17459 koserow isdn 038375 / 22056 k.aehnlich@yahoo.de Baumbestandliste 1 Acer pseudplatanus
Newsletter. Krummzähniger Tannenborkenkäfer. 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5.
 Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil. Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil
 Land Vorarlberg Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Sulzerweg 2, 6830 Rankweil, Österreich T +43 5552 73232 landesforstgarten@vorarlberg.at
Land Vorarlberg Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Sulzerweg 2, 6830 Rankweil, Österreich T +43 5552 73232 landesforstgarten@vorarlberg.at
Lösungen zu den Arbeitsblättern HONIG LERNZIEL:
 Lösungen zu den Arbeitsblättern HONIG Die Lösungen aller auf den Arbeitsblättern gestellten Aufgaben und Fragen können Schülerinnen und Schüler finden, nachdem sie das Thema Honig im Unterricht erarbeitet
Lösungen zu den Arbeitsblättern HONIG Die Lösungen aller auf den Arbeitsblättern gestellten Aufgaben und Fragen können Schülerinnen und Schüler finden, nachdem sie das Thema Honig im Unterricht erarbeitet
SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE
 Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Die Natur in den 4 Jahreszeiten. Julian 2012/13
 Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Esche & Co. Zum Pollenflug im Zeitraum März bis Mai. Die Gemeine Esche. Newsletter Nr
 Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Station 1 Der Baum. Frucht Blüte Stamm. Wurzeln Blatt Ast
 Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Verankerung höher anbringen. 1 Kronenverankerung vorhanden
 4 Fraxinus excelsior Gemeine Esche Laubbaum 612452.972 269303.945 gemäss Koordinaten STG Basel 1 247 24 29 1950 0 5 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn, Wald-Ahorn Laubbaum 612454.354 269328.034 gemäss Koordinaten
4 Fraxinus excelsior Gemeine Esche Laubbaum 612452.972 269303.945 gemäss Koordinaten STG Basel 1 247 24 29 1950 0 5 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn, Wald-Ahorn Laubbaum 612454.354 269328.034 gemäss Koordinaten
Entwicklung des Klimawaldes und der Einfluss von Wild auf den Bestand
 Entwicklung des Klimawaldes und der Einfluss von Wild auf den Bestand Jeanine Jägerberger Juli 2016 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung....................................................... 2 2. Methode.......................................................
Entwicklung des Klimawaldes und der Einfluss von Wild auf den Bestand Jeanine Jägerberger Juli 2016 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung....................................................... 2 2. Methode.......................................................
Bedarfsliste für die Erstbepflanzung des Baumparks Rüdershausen
 E R L Ä U T E R U N G Die Bepflanzung ist im Oktober 2012 vorgesehen (Liefertermin ab 42. KW) Gepflanzt werden generell einheimische Gehölze in Anlehnung an das bisher ausgewählte Sortiment der sog. Bäume
E R L Ä U T E R U N G Die Bepflanzung ist im Oktober 2012 vorgesehen (Liefertermin ab 42. KW) Gepflanzt werden generell einheimische Gehölze in Anlehnung an das bisher ausgewählte Sortiment der sog. Bäume
Bienenweide. Hast du schon gewusst...?
 Hallo! Ich bin Fritz Frilaz und wohne hier im grünen Pausenhof! Ich freue mich, dass du mich besuchen möchtest! Verhalte dich bitte so, dass sich Tiere, Pflanzen und Kinder hier wohlfühlen können! Bienenweide
Hallo! Ich bin Fritz Frilaz und wohne hier im grünen Pausenhof! Ich freue mich, dass du mich besuchen möchtest! Verhalte dich bitte so, dass sich Tiere, Pflanzen und Kinder hier wohlfühlen können! Bienenweide
WITTERUNGSVERLAUF UND MASSENWECHSEL DER GRÜNEN TANNENHONIGLAUS CINARA PECTINATAE (NÖRDL.) (HOMOPTERA, LACHNIDAE) IN DEN JAHREN
 WITTERUNGSVERLAUF UND MASSENWECHSEL DER GRÜNEN TANNENHONIGLAUS CINARA PECTINATAE (NÖRDL.) (HOMOPTERA, LACHNIDAE) IN DEN JAHREN 1977-1981 Gerhard Liebig, Ursula Schlipf, Waltraud Düwel To cite this version:
WITTERUNGSVERLAUF UND MASSENWECHSEL DER GRÜNEN TANNENHONIGLAUS CINARA PECTINATAE (NÖRDL.) (HOMOPTERA, LACHNIDAE) IN DEN JAHREN 1977-1981 Gerhard Liebig, Ursula Schlipf, Waltraud Düwel To cite this version:
Vorlesung Waldwachstumskunde. Mikroskopische Holzanatomie Laubhölzer. nach Schweingruber FH 1990: Mikroskopische Holzanatomie. WSL Birmensdorf 226 S.
 Vorlesung Waldwachstumskunde Mikroskopische Holzanatomie Laubhölzer nach Schweingruber FH 1990: Mikroskopische Holzanatomie. WSL Birmensdorf 226 S. 05.06.02 1 Übersicht: Begriffe und Merkmale Übungen Porenverteilung
Vorlesung Waldwachstumskunde Mikroskopische Holzanatomie Laubhölzer nach Schweingruber FH 1990: Mikroskopische Holzanatomie. WSL Birmensdorf 226 S. 05.06.02 1 Übersicht: Begriffe und Merkmale Übungen Porenverteilung
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 2011
 Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Bienenkunde SS 2009 Teil 5
 Bienenkunde SS 2009 Teil 5 HONIG Dipl. Ing. Christian Boigenzahn Teil 5 Inhalt Definition Honig Honigarten Rohstoffe des Honigs Honigbereitung durch die Honigbiene Inhaltsstoffe des Honigs Honigqulitätsprüfung
Bienenkunde SS 2009 Teil 5 HONIG Dipl. Ing. Christian Boigenzahn Teil 5 Inhalt Definition Honig Honigarten Rohstoffe des Honigs Honigbereitung durch die Honigbiene Inhaltsstoffe des Honigs Honigqulitätsprüfung
EINZELNE UNTERRICHTSEINHEIT: Wespen - die verkannten Nützlinge I (staatenbildende Wespen)
 Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
STATION 1: MISCHWALD
 STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
Bäume und ihre Bewohner
 Margot und Roland Spohn Bäume und ihre Bewohner Haupt Verlag Margot Spohn, Roland Spohn Bäume und ihre Bewohner Der Naturführer zum reichen Leben an Bäumen und Sträuchern Margot Spohn hat Biologie mit
Margot und Roland Spohn Bäume und ihre Bewohner Haupt Verlag Margot Spohn, Roland Spohn Bäume und ihre Bewohner Der Naturführer zum reichen Leben an Bäumen und Sträuchern Margot Spohn hat Biologie mit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
laubbäume Quelle: Bundesforschungs- u Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)
 Laubbäume zeichnet aus, dass sie jedes Jahr im Herbst ihre Blätter abwerfen. Zunächst verfärben sich die Blätter. Diese herbstliche Farbenpracht ist das Ergebnis eines längeren Vorganges, bei dem den Blättern
Laubbäume zeichnet aus, dass sie jedes Jahr im Herbst ihre Blätter abwerfen. Zunächst verfärben sich die Blätter. Diese herbstliche Farbenpracht ist das Ergebnis eines längeren Vorganges, bei dem den Blättern
Klimagarten Projektausschreibung: Kunst und Botanik
 Klimagarten 2085 - Projektausschreibung: Kunst und Botanik Rundgang zum Klimawandel im Alten Botanischen Garten Schon heute sind einige unserer einheimischen Baumarten im Schweizer Mittelland von Klimawandel
Klimagarten 2085 - Projektausschreibung: Kunst und Botanik Rundgang zum Klimawandel im Alten Botanischen Garten Schon heute sind einige unserer einheimischen Baumarten im Schweizer Mittelland von Klimawandel
Schwarz-Kiefer Pinus nigra 129 F vital; Krone nicht nach N wg. Engstand
 380835 Spitz-Ahorn Acer platanoides 110 F vital 380836 Spitz-Ahorn Acer platanoides 73 F vital 380837 Spitz-Ahorn Acer platanoides 85/122 F vital 380838 Hain-Buche Carpinus betulus 99 F vital 380839 Rot-Fichte
380835 Spitz-Ahorn Acer platanoides 110 F vital 380836 Spitz-Ahorn Acer platanoides 73 F vital 380837 Spitz-Ahorn Acer platanoides 85/122 F vital 380838 Hain-Buche Carpinus betulus 99 F vital 380839 Rot-Fichte
Die Große Kerbameise
 Die Große Kerbameise Berlin (8. November 2010) Die Große Kerbameise ist das Insekt des Jahres 2011. Das 7 bis 8 mm große Tier tritt nie einzeln auf und ist alleine auch gar nicht überlebensfähig, denn
Die Große Kerbameise Berlin (8. November 2010) Die Große Kerbameise ist das Insekt des Jahres 2011. Das 7 bis 8 mm große Tier tritt nie einzeln auf und ist alleine auch gar nicht überlebensfähig, denn
3. Erkennen von einheimischen Bäumen
 3. Erkennen von einheimischen Bäumen! Die 17 gekennzeichneten Baumarten auf dem Spazierweg Baum des Jahres entlang des Rehbachweges Name Pflanzenfamilie Blattform Rinde Habitus Fruchtform Bes. Merkmale
3. Erkennen von einheimischen Bäumen! Die 17 gekennzeichneten Baumarten auf dem Spazierweg Baum des Jahres entlang des Rehbachweges Name Pflanzenfamilie Blattform Rinde Habitus Fruchtform Bes. Merkmale
Baumbestandserfassung
 Wir tun was für die Landschaft Büro für Landschaftsarchitektur Oberer Graben 3a 85354 Freising Telefon 08161 49 650 46 E-Mail e@fiselundkoenig.de www.fiselundkoenig.de Projektentwicklung Angerstraße, Freising
Wir tun was für die Landschaft Büro für Landschaftsarchitektur Oberer Graben 3a 85354 Freising Telefon 08161 49 650 46 E-Mail e@fiselundkoenig.de www.fiselundkoenig.de Projektentwicklung Angerstraße, Freising
Material. 3 Akteure im Simulationsspiel
 Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Kopf und ein Fühler (rot) Hinterleib (gelb) Brust und ein gegliedertes Bein (blau) Code 1 : Die Farbgebung ist richtig
 Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer
 150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Die große Frühlingswerkstatt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die große Frühlingswerkstatt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Die große Frühlingswerkstatt
Pollenflugbericht von Obergurgl für das Jahr 2013
 Pollenflugbericht von Obergurgl für das Jahr 2013 Die Werte der Pollen/m 3 und Tag aus dem Jahr 2013 wurden jeweils mit den Mittelwerten der letzten 5 Jahre (2008-2012) verglichen und in den beiliegenden
Pollenflugbericht von Obergurgl für das Jahr 2013 Die Werte der Pollen/m 3 und Tag aus dem Jahr 2013 wurden jeweils mit den Mittelwerten der letzten 5 Jahre (2008-2012) verglichen und in den beiliegenden
Der Kormoran in der Steiermark
 Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
DOWNLOAD. Geografisches Grundwissen 7. Unterwegs in der Welt. Vegetation und Vegetationszonen. Friedhelm Heitmann
 DOWNLOAD Friedhelm Heitmann Geografisches Grundwissen 7 Vegetation und Vegetationszonen Friedhelm Heitmann Downloadauszug aus dem Originaltitel: Bergedorfer Unterrichtsideen Unterwegs in der Welt Materialien
DOWNLOAD Friedhelm Heitmann Geografisches Grundwissen 7 Vegetation und Vegetationszonen Friedhelm Heitmann Downloadauszug aus dem Originaltitel: Bergedorfer Unterrichtsideen Unterwegs in der Welt Materialien
Die Stockwerke der Wiese
 Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa)
 Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Die Varroamilbe Aussehen, Vermehrung, Lebensweise, Schadwirkung. AGES, Dr. Rudolf Moosbeckhofer LWT Wien - Institut für Bienenkunde
 Die Varroamilbe Aussehen, Vermehrung, Lebensweise, Schadwirkung AGES, Dr. Rudolf Moosbeckhofer LWT Wien - Institut für Bienenkunde Varroose Parasitenerkrankung der Bienenvölker Verursacher: Milbe Varroa
Die Varroamilbe Aussehen, Vermehrung, Lebensweise, Schadwirkung AGES, Dr. Rudolf Moosbeckhofer LWT Wien - Institut für Bienenkunde Varroose Parasitenerkrankung der Bienenvölker Verursacher: Milbe Varroa
Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt
 Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt Seite 1/57 Impressum Landesverwaltungsamt Referat Forst- und Jagdhoheit Redaktionsschluss: 08.01.2014 Dienstgebäude: Dessauer
Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt Seite 1/57 Impressum Landesverwaltungsamt Referat Forst- und Jagdhoheit Redaktionsschluss: 08.01.2014 Dienstgebäude: Dessauer
Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet
 Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Bestellliste für Garten- und Heckenpflanzen
 Seite 1/7 Bestellliste für Garten- und Heckenpflanzen Garten- und Heckenpflanzen- für: Firma: Name: Strasse: PLZ: Telefon: Ort: Vorname: Datum: Anmerkungen zur : Die ist zu senden an: info@frwd.ch oder
Seite 1/7 Bestellliste für Garten- und Heckenpflanzen Garten- und Heckenpflanzen- für: Firma: Name: Strasse: PLZ: Telefon: Ort: Vorname: Datum: Anmerkungen zur : Die ist zu senden an: info@frwd.ch oder
Verordnung über forstliches Vermehrungsgut
 Verordnung über forstliches Vermehrungsgut 921.552.1 vom 29. November 1994 (Stand am 1. Juli 1995) Das Eidgenössische Departement des Innern, gestützt auf die Artikel 22 Absatz 3 und 24 der Waldverordnung
Verordnung über forstliches Vermehrungsgut 921.552.1 vom 29. November 1994 (Stand am 1. Juli 1995) Das Eidgenössische Departement des Innern, gestützt auf die Artikel 22 Absatz 3 und 24 der Waldverordnung
1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen. Ungezieferbefall
 1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen Ungezieferbefall Blattläuse Blattläuse saugen den Pflanzensaft auf und scheiden Honigtau aus. So kann schwarzer Schimmel entstehen, ein Virus übertragen werden
1. Erkennen von Schädlingsbefall an Rosen Ungezieferbefall Blattläuse Blattläuse saugen den Pflanzensaft auf und scheiden Honigtau aus. So kann schwarzer Schimmel entstehen, ein Virus übertragen werden
für die Frühjahrsaufforstung 2017 werden die Bestellungen von Waldpflanzen bis 6. März 2017
 Landesforstdirektion Zahl (Bitte im Antwortschreiben anführen) Datum Fanny-v.-Lehnert-Straße 1 06.02.2017 Postfach 527 5010 Salzburg Betreff Fax +43 662 8042 3887 Waldpflanzenabgabe Frühjahr 2017 forstdirektion@salzburg.gv.at
Landesforstdirektion Zahl (Bitte im Antwortschreiben anführen) Datum Fanny-v.-Lehnert-Straße 1 06.02.2017 Postfach 527 5010 Salzburg Betreff Fax +43 662 8042 3887 Waldpflanzenabgabe Frühjahr 2017 forstdirektion@salzburg.gv.at
Anpassung von Insekten an ihren Lebensraum. Viel Spaß beim Forschen!
 Anpassung von Insekten an ihren Lebensraum am Beispiel der Waldameisen Viel Spaß beim Forschen! Für eure Stationsgruppe benötigt ihr jeweils bitte folgende Materialien: Kurzausarbeitung eurer Referate
Anpassung von Insekten an ihren Lebensraum am Beispiel der Waldameisen Viel Spaß beim Forschen! Für eure Stationsgruppe benötigt ihr jeweils bitte folgende Materialien: Kurzausarbeitung eurer Referate
Phänologische Beobachteranleitung der Internationalen Phänologischen Gärten
 Phänologische Beobachteranleitung der Internationalen Phänologischen Gärten (überarbeitete Version der Beobachteranleitung von 1960) 1. Allgemeines Um bei den Beobachtungen in den Internationalen Phänologischen
Phänologische Beobachteranleitung der Internationalen Phänologischen Gärten (überarbeitete Version der Beobachteranleitung von 1960) 1. Allgemeines Um bei den Beobachtungen in den Internationalen Phänologischen
Das Bienenvolk Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Im Sommer leben neben der Königin Tausende Arbeiterinnen und viele Drohnen im Volk. Die SuS lernen, welche Aufgaben die jeweiligen Bienen haben und wie aus einem
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Im Sommer leben neben der Königin Tausende Arbeiterinnen und viele Drohnen im Volk. Die SuS lernen, welche Aufgaben die jeweiligen Bienen haben und wie aus einem
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Preisliste Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil. Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil
 Land Vorarlberg Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Sulzerweg 2, 6830 Rankweil, Österreich T +43 5522 73232 landesforstgarten@vorarlberg.at
Land Vorarlberg Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesforstgarten Rankweil Sulzerweg 2, 6830 Rankweil, Österreich T +43 5522 73232 landesforstgarten@vorarlberg.at
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
Merkblatt für Knickneuanlagen, bunter Knick
 Merkblatt für Knickneuanlagen, bunter Knick Neuanlage eines dreireihigen Knickes 0,75 m 0,75 m 3,50 m Pflanzabstand in der Reihe; 0,75 m zwischen den Reihen Rotbuche Fagus sylvatica Weiden Salix alba,
Merkblatt für Knickneuanlagen, bunter Knick Neuanlage eines dreireihigen Knickes 0,75 m 0,75 m 3,50 m Pflanzabstand in der Reihe; 0,75 m zwischen den Reihen Rotbuche Fagus sylvatica Weiden Salix alba,
GESUNDER NACHWUCHS FÜR IHREN WALD PREISLISTE 2016/17.
 GESUNDER NACHWUCHS FÜR IHREN WALD PREISLISTE 2016/17 www.murauer-forstpflanzen.at WEIL IHR WALD NUR DAS BESTE VERDIENT... NADELHOLZ Die Firma MURAUER hat sich nicht nur durch das in Österreich einzigartige
GESUNDER NACHWUCHS FÜR IHREN WALD PREISLISTE 2016/17 www.murauer-forstpflanzen.at WEIL IHR WALD NUR DAS BESTE VERDIENT... NADELHOLZ Die Firma MURAUER hat sich nicht nur durch das in Österreich einzigartige
ÜBER DIE AUSWIRKUNG VON UMWELTEINFLÜSSEN AUF DIE POPULATIONS - ENTWICKLUNG DER PHYSOKERMES - ARTEN
 ÜBER DIE AUSWIRKUNG VON UMWELTEINFLÜSSEN AUF DIE POPULATIONS ENTWICKLUNG DER PHYSOKERMES ARTEN Hermann Pechhacker To cite this version: Hermann Pechhacker. ÜBER DIE AUSWIRKUNG VON UMWELTEINFLÜSSEN AUF
ÜBER DIE AUSWIRKUNG VON UMWELTEINFLÜSSEN AUF DIE POPULATIONS ENTWICKLUNG DER PHYSOKERMES ARTEN Hermann Pechhacker To cite this version: Hermann Pechhacker. ÜBER DIE AUSWIRKUNG VON UMWELTEINFLÜSSEN AUF
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa)
 Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Die Schwarzerle (Alnus glutinosa) Eine wichtige Baumart im Gemeindewald Weingarten. Mit aktuell 13 Prozent bestockt sie vor allem die feuchten bis nassen Standorte unserer Waldflächen. Hier muss sie auch
Party vor dem Flugloch der Bundestags-#Bienen. Die Saison startet jetzt auch in Berlin. Freuen uns auf den Honig in diesem Jahr!
 06.01.2017 Bienen Neues von den Bundestagsbienen Juni 2017: Es wird geschleudert Die erste Schleuderung der Bundestagsblüte Mitte Juni 2017. Pro Volk gab es rund 25 Kilo. Bis Mitte/ Ende Juli blüht noch
06.01.2017 Bienen Neues von den Bundestagsbienen Juni 2017: Es wird geschleudert Die erste Schleuderung der Bundestagsblüte Mitte Juni 2017. Pro Volk gab es rund 25 Kilo. Bis Mitte/ Ende Juli blüht noch
Inhaltsverzeichnis. Lebensraum für Bienen- & Hummeln 7
 3590_Pflanzen Bienen Hummeln_12.1.indd 2 3590_Pflanzen Bienen Hummeln_12.1.indd 4 Inhaltsverzeichnis Lebensraum für Bienen- & Hummeln 7 Bienen unverzichtbar für Natur- und Ernährung 8 Lebensraum Garten
3590_Pflanzen Bienen Hummeln_12.1.indd 2 3590_Pflanzen Bienen Hummeln_12.1.indd 4 Inhaltsverzeichnis Lebensraum für Bienen- & Hummeln 7 Bienen unverzichtbar für Natur- und Ernährung 8 Lebensraum Garten
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen
 Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
Phytophthora Krankheit
 Phytophthora Krankheit Einleitung: der Name Phytophthora kommt aus dem Griechischen und bedeutet Pflanzenzerstörer die Gattung kommt weltweit vor und ist ein wichtiges Gehölzpathogen (Krankheitskeim) /aggressiver
Phytophthora Krankheit Einleitung: der Name Phytophthora kommt aus dem Griechischen und bedeutet Pflanzenzerstörer die Gattung kommt weltweit vor und ist ein wichtiges Gehölzpathogen (Krankheitskeim) /aggressiver
Bestellung: Einfach kurze mit Artikel und Menge an:
 Ernte 2017: Nach dem späten Start unserer Bienenvölker im Frühjahr, gab es reichlich Rapshonig zu ernten. Der sehr kurzen Robinienblüte folgte ein schönes Sommerblütenangebot. Besonders das Wandern in
Ernte 2017: Nach dem späten Start unserer Bienenvölker im Frühjahr, gab es reichlich Rapshonig zu ernten. Der sehr kurzen Robinienblüte folgte ein schönes Sommerblütenangebot. Besonders das Wandern in
Nützliche Insekten im Garten. Referentin: Dr. Sandra Lerche
 im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
Presse Information 4. Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz
 Presse Information 4. Dez. 2015 Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz Der Dunkelbraune Kugelspringer Berlin (4. Dezember 2015) Der Dunkelbraune Kugelspringer ist das Insekt des Jahres 2016.
Presse Information 4. Dez. 2015 Insekt des Jahres 2016 Deutschland Österreich Schweiz Der Dunkelbraune Kugelspringer Berlin (4. Dezember 2015) Der Dunkelbraune Kugelspringer ist das Insekt des Jahres 2016.
Baumarten. Wald und Klimawandel Waldbauliche Empfehlungen für. Die waldbaulichen Empfehlungen beziehen sich auf die folgenden Baumarten:
 Wald und Klimawandel Waldbauliche Empfehlungen für Baumarten Die waldbaulichen Empfehlungen beziehen sich auf die folgenden Baumarten: Nadelholz Fichte Tanne Douglasie Lärche Föhre Laubholz Buche Bergahorn
Wald und Klimawandel Waldbauliche Empfehlungen für Baumarten Die waldbaulichen Empfehlungen beziehen sich auf die folgenden Baumarten: Nadelholz Fichte Tanne Douglasie Lärche Föhre Laubholz Buche Bergahorn
MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG. Triebsterben der Schwarzkiefer
 MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG 1980 Nr. 19 Triebsterben der Schwarzkiefer Bearbeitung: H. BUTIN und R. SIEPMANN, Hann.Münden WALDSCHUTZ Herausgegeben von
MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG 1980 Nr. 19 Triebsterben der Schwarzkiefer Bearbeitung: H. BUTIN und R. SIEPMANN, Hann.Münden WALDSCHUTZ Herausgegeben von
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
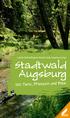 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Vital, guter Aufbau, Totholz 15% im Grobastbereich, Starkastausbrüche. 5 Hainbuche Carpinus betulus 60cm
 Bauliste Bauart Bauart (lat.) Beschreibung Auffälligkeiten / Bauzustand Astwerk Staufang Stäe Krone 1 Fichte Picea abies 60c;50c 2 7.5 11 2 869 Douglasie Pseudotsuga enziesii Vital, Randbau, einseitig
Bauliste Bauart Bauart (lat.) Beschreibung Auffälligkeiten / Bauzustand Astwerk Staufang Stäe Krone 1 Fichte Picea abies 60c;50c 2 7.5 11 2 869 Douglasie Pseudotsuga enziesii Vital, Randbau, einseitig
 GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL LANDKREIS ROTTWEIL BEBAUUNGSPLAN "ZIMMERN O.R. - OST, TEIL II" IN ZIMMERN OB ROTTWEIL ANLAGE 1 ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN (TEXTTEIL) PFLANZLISTEN siehe folgende
GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL LANDKREIS ROTTWEIL BEBAUUNGSPLAN "ZIMMERN O.R. - OST, TEIL II" IN ZIMMERN OB ROTTWEIL ANLAGE 1 ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN (TEXTTEIL) PFLANZLISTEN siehe folgende
Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II
 Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II Textinformationen Bienen gehören zu den holometabolen Insekten. Im Laufe ihrer Entwicklung machen sie also eine vollständige Verwandlung durch. Aus
Die Varroamilbe - ein Ektoparasit an der Honigbiene II Textinformationen Bienen gehören zu den holometabolen Insekten. Im Laufe ihrer Entwicklung machen sie also eine vollständige Verwandlung durch. Aus
19. BEZIRK ND Nr. Art Adresse Speierling mehrere Baumgruppen Mammutbaum Winterlinde Eibe Zweigeschlechtliche Eibe mehrere Kieferngruppen Eibe
 19. BEZIRK ND Nr. Art Adresse 7 Speierling Muckentalerweg (Sorbus domestica) 12 mehrere Baumgruppen Cobenzl 13 Mammutbaum Geweygasse 1a 14 Winterlinde Grinzinger Allee 43 16 Eibe Grinzinger Allee 45 29
19. BEZIRK ND Nr. Art Adresse 7 Speierling Muckentalerweg (Sorbus domestica) 12 mehrere Baumgruppen Cobenzl 13 Mammutbaum Geweygasse 1a 14 Winterlinde Grinzinger Allee 43 16 Eibe Grinzinger Allee 45 29
Landesforstanstalt Eberswalde. Vernetzte Umwelt und Ameisen mittendrin Ameisen im Wald
 Vernetzte Umwelt und Ameisen mittendrin Ameisen im Wald Ameisen sind Raubinsekten, fördern honigtauausscheidende Baum- und Rindenläuse, sind Nahrungsquelle, lockern den Waldboden, aktivieren die Bodenfauna,
Vernetzte Umwelt und Ameisen mittendrin Ameisen im Wald Ameisen sind Raubinsekten, fördern honigtauausscheidende Baum- und Rindenläuse, sind Nahrungsquelle, lockern den Waldboden, aktivieren die Bodenfauna,
Leseprobe Nr. 1. Thema: Ein Waldausflug
 Name Datum Klasse c http://aufgaben.schulkreis.de Leseprobe Nr. 1 Thema: Ein Waldausflug Ein Waldausflug Kurz vor den Herbstferien wandert unsere Klasse 3a in den Wald. Wir Kinder freuen uns sehr und sind
Name Datum Klasse c http://aufgaben.schulkreis.de Leseprobe Nr. 1 Thema: Ein Waldausflug Ein Waldausflug Kurz vor den Herbstferien wandert unsere Klasse 3a in den Wald. Wir Kinder freuen uns sehr und sind
Tagfalter in Bingen. Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Agrar-Landesrat Dr. Josef Stockinger und Präsident Mag. Maximilian Liedlbauer OÖ. Landesverband für Bienenzucht am 28. Juni 2007 zum Thema "Situation der Bienen
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Agrar-Landesrat Dr. Josef Stockinger und Präsident Mag. Maximilian Liedlbauer OÖ. Landesverband für Bienenzucht am 28. Juni 2007 zum Thema "Situation der Bienen
Bestimmungsschlüssel Pinus. Hier die wichtigsten für uns
 Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Hier die wichtigsten für uns 2 nadelige Kiefern Pinus sylvestris Gewöhnliche Waldkiefer Pinus nigra Schwarzkiefer Pinus mugo Latsche oder Bergkiefer 3 nadelige Kiefern Pinus ponderosa Gelb-Kiefer Pinus
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie. Krankheiten und Schädlinge an. Rosen
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie Krankheiten und Schädlinge an Rosen Autor: Regina Petzoldt Bestellungen: Telefon: 0351 2612-8080 Telefax: 0351 2612-8099 E-Mail:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie Krankheiten und Schädlinge an Rosen Autor: Regina Petzoldt Bestellungen: Telefon: 0351 2612-8080 Telefax: 0351 2612-8099 E-Mail:
Bergwelt Wetter-Klima
 Wetter- und Klimaforscher werden aktiv Arbeitsauftrag: Sch arbeiten die Aufgaben in Workshop-Gruppen selbstständig durch, unter zu Hilfename von Atlanten, Internet, Arbeitsblättern und Folien Ziel: Exploratives
Wetter- und Klimaforscher werden aktiv Arbeitsauftrag: Sch arbeiten die Aufgaben in Workshop-Gruppen selbstständig durch, unter zu Hilfename von Atlanten, Internet, Arbeitsblättern und Folien Ziel: Exploratives
Warum brauchen Honigbienen ein vielseitiges Trachtangebot?
 L A N D E S A N S TA LT F Ü R BIENENKUNDE Warum brauchen Honigbienen ein vielseitiges Trachtangebot? Wolpertshausen, 22. Juli 2015 Inhalt Entwicklung und Nährstoffbedarf der Honigbiene Mangelerscheinungen
L A N D E S A N S TA LT F Ü R BIENENKUNDE Warum brauchen Honigbienen ein vielseitiges Trachtangebot? Wolpertshausen, 22. Juli 2015 Inhalt Entwicklung und Nährstoffbedarf der Honigbiene Mangelerscheinungen
Lösung Station 1. Teile des Baumes (a)
 Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe
 Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
