Ein Zeitroman. mit Bilddokumenten
|
|
|
- Susanne Kalb
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Alle jungen Leute denken darüber nach, wie sie ihr Leben entwickeln könnten. Als ich dies getan habe, kam ich zu dem Schluß, daß das Leben nicht leicht zu sein braucht, wenn es nur inhaltsreich ist. (Lise Meitner) Ein Zeitroman mit Bilddokumenten 1
3 Impressum 75 Jahre Lise-Meitner-Gymnasium Ein Zeitroman mit Bilddokumenten Im Eigenverlag des Lise-Meitner-Gymnasiums Alle Rechte vorbehalten. Die Redaktion bemühte sich bei der Auswahl des historischen Materials Autoren- und Verwertungsrechte - soweit bekannt- zu berücksichtigen. 1. Auflage 1998 Redaktion: Gerhard Löw, Bernd Ostermann (verantwortlich), Horst Thelen Gestaltung und Satz: Alfred Prenzlow, Grafische Kunst, Leverkusen 2
4 Inhalt Grußworte - Vorwort Seite 5 Vom ersten Schultag bis zum ersten Abitur: Seite 9 Der erste Schultag Seite 10 Die erste Reifeprüfung 1933 Seite 16 Annäherungen an einen Schulleiter (Dr. Paul Börger) Seite 18 Leben und Überleben der Schule im Nationalsozialismus: Seite 21 Dr. Eva Wolff: Die Leverkusener Mädchenlyzeen Seite 23 Beispiele von Abiturthemen und -arbeiten aus den Jahren Seite 23 Dr. Astrid Gehlhoff-Claes (Abiturjahrgang 1946): Zweitausendzweihundert Lichter Seite 31 Die Nachkriegszeit : Seite 33 Von der Oberschule für Mädchen zum Mädchen-Gymnasium Seite 34 Zur Einführung der Koedukation Seite 39 Erinnerungen von Christian Bügel (Abiturjahrgang 1980) Ingeborg Schwenke-Runkel (Abiturjahrgang 1968): Zwei Tage mit Lehrern von damals Seite 41 Die neue Epoche beginnt: Seite 45 Lise Meitner - Ein Name verpflichtet Seite 46 Innere Reformen und äußere Differenzierung Seite 49 Der Endausbau Seite 53 Friederike Kretzen (Abiturjahrgang 1975): Ich bin ein Hügel, Auszüge aus ihrem Roman Seite 56 Das Lise-Meitner-Gymnasium heute - Profile Seite 59 Einführung des Schulleiters Gerhard Löw Seite 60 Profile einer reformfreudigen Schule - Einleitung Seite 63 Karola Fings (Abiturjahrgang 1982): Eine Schule mit menschlichem Antlitz schaffen Seite 68 Das Pädagogische Konzept des Lise-Meitner-Gymnasiums Seite 71 Hinweise zur Schulprogrammarbeit Seite 71 Die innere Schulreform seit 1986: Seite 74 Freie Arbeit, Jahresarbeit in Stufe 8, Reise- und Erfahrungsberichte sowie Praktikumsberichte in den Stufen 9 und 10 Berufswahlvorbereitung/Projektphase in Stufe 11,Facharbeit in Stufe 12 Computer und Telekommunikation Seite 82 Geschichte des Internet-Kurses Seite 83 Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung (IKG) für alle Seite 84 ÜBETREUung - Schüler lernen von Schülern Seite 86 3
5 Inhalt Veränderte Rahmenbedingungen: Seite 88 Die Unterstufenbücherei, Zentrale Lise-Meitner-Bibliothek, Galerie Lise, Eine-Welt-Arbeit Dr. Rainer Engels (Abiturjahrgang 1982): Seite 108 Mut und Hoffnung im Zeitalter der Globalisierung Die Reform-Inseln am Lise-Meitner-Gymnasium Seite 112 Teilnahme am Schulversuch "Schule & Co" Seite 113 Das neue Haus des Lernens nach Dr. Heinz Klippert Seite 117 Lise Mobil - Schulpartnerschaften: Seite 121 Frankreich, England, USA, Russland Gremien und Institutionen der Schulgemeinde: Die Schülervertretung (SV), Die Schülerzeitung "Liselchen", Schülerradio am LMG, Der Förderverein Seite 131 Das Fest zum 75jährigen Jubiläum Seite 139 Das Fest im Spiegel der Presse Seite 140 Der Festakt im Forum Seite 141 Geschichte der "Bühne Lise" Seite 146 Kerstin Müller (Abiturjahrgang 1983): Rede zur Feierstunde Seite 149 Bild-Collage zum Fest am 20. Juni 1998 Ein Bildgeschenk von Roland Kohlhaas (Abiturjahrgang 1983) Seite 160 Internet-Reaktionen Seite 161 Personalia Seite 163 4
6 Grußworte von Frau Ministerin Gabriele Behler anläßlich des 75-jährigen Bestehens des LISE-MEITNER-GYMNASIUMS Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich freue mich, dem Lise-Meitner-Gymnasium meine herzlichen Glückwünsche zum 75jährigen Bestehen übermitteln zu können. Diese Schule kann auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Ihre Wurzeln hat sie in den nach 1870 entwickelten Ideen der Frauenbewegung, sie gründet auf der Preußischen Reform von Nach demokratischem Neubeginn ab 1945 und der 68er Bildungsreform ist das Lise-Meitner-Gymnasium heute eine Schule, die mit Recht das Prädikat "reformfreudig" trägt. Mit der Wahl ihres Namens hat es die Schule verstanden, ihre Tradition mit neuen bildungspolitischen Ideen zu verknüpfen. Lise Meitner ist als Wissenschaftlerin gleichzeitig Vorbild für das heutige Rollenverständnis der Frau und für die Bedeutung naturwissenschaftlicher Bildung und Forschung. Es zeichnet diese Schule aus, daß sie sich auch heute den geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellt und sich in eigener Initiative auf den Weg der inneren Schulreform gemacht hat. Als Schule, die am Projekt Schule & Co. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und der Bertelsmann-Stiftung teilnimmt, hat sie sich vorgenommen, der Reform der pädagogischen Arbeit im Interesse der Kinder und Jugendlichen die höchste Priorität einzuräumen. Wenn ich an die vielfältigen Aktivitäten, Projekte und die Einübung neuer Formen des Lernens denke, so kann man bereits deutlich die Umrisse eines "Haus des Lernens" erkennen. Ich möchte den Lehrerinnen und Lehrern des Lise-Meitner-Gymnasiums für ihr außergewöhnliches Engagement danken und sie ermutigen, auf dem bisher eingeschlagenen Weg fortzufahren. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich weiterhin viel Freude und Erfolg beim Lernen. 5
7 von Dr. Walter Mende Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler der Lise-Meitner-Schule, unser heutiges gesellschaftliches und politisches Zusammenleben bietet viele Möglichkeiten, Jubiläen anzusetzen und zu feiern. Ganz sicher gehört es aber zu den besonderen Anlässen, wenn eine städtische Bildungseinrichtung auf ein 75jähriges Bestehen zurückblicken kann. Daß es die Lise-Meitner-Schule, Städtisches Gymnasium Am Stadtpark, ist, die in diesem Jahr eine Chronik von 75 Jahren vorzuweisen hat, gibt mir nicht nur Gelegenheit, Glückwünsche zu übermitteln, sondern auch auf die herausragende Position dieses Gymnasiums innerhalb der Schullandschaft Leverkusens hinzuweisen. Es fing an im Jahre 1923 mit einer Mädchenklasse der Mittelschule, dann kam später die Anerkennung als Höhere Schule für Mädchen, schließlich wurde daraus das Städtische neusprachliche und sozialwissenschaftliche Mädchengymnasium mit Gymnasium für Frauenbildung bis hin zum heutigen Gymnasium, an dem nunmehr Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet werden. Die nach der Physikerin Lise Meitner heute so benannte Schule hat über ein dreiviertel Jahrhundert wahrlich eine enorme Weiterentwicklung durchschritten. Die Palette der pädagogischen Aktionsfelder, und hier insbesondere die 1986 mit Mut und Kreativität durchgeführte innere Schulreform, haben die Lise-Meitner-Schule über die Stadtgrenze hinaus bekannt gemacht. Als beispielhaft zählen die seit 11 Jahren praktizierte Intensivierung selbständiger Arbeitsformen in der Sekundarstufe I, die den traditionellen Unterricht so ergänzt, daß Lernart, Lernform und Lernwirkungen den Schülerinnen und Schülern eine größere Chance bietet, sich selbsttätig und selbständig mit sich, ihrer Um- und Mitwelt auseinanderzusetzen. Mit ihrem großen Engagement für neue Lernformen ist das Lise-Meitner-Gymnasium geradezu prädestiniert gewesen, sich dem auf 5 Jahre angelegten Schulversuch der Bertelsmann-Stiftung "Stärkung von Schulen im kommunalen und regionalen Umfeld", unterstützt durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung, anzuschließen. Für die weiteren wichtigen Schritte innerhalb dieses Projektes in Richtung auf die Vision von Schule als ein "Haus des Lernens" wünsche ich der Lise-Meitner-Schule viel Glück und Erfolg. Zum 75jährigen Schuljubiläum gratuliere ich herzlich im Namen der Stadt Leverkusen und von mir persönlich. Dem von ehemaligen und aktiven Schülerinnen und Schülern der Lise-Meitner-Schule gemeinsam vorbereiteten festlichen Jubiläumsprogramm wünsche ich einen guten Verlauf. Mit freundlichen Grüßen Dr. Walter Mende 6
8 Vorwort 75 Jahre Lise-Meitner-Gymnasium "Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn unergründlich nennen?" Mit diesen Sätzen beginnt Thomas Mann den Zeit-Roman "Joseph und seine Brüder", in dem er auf über 1300 Seiten dem "Rätselwesen" Mensch auf die Spur zu kommen versucht. Lassen wir uns auf diese Zeit-Metaphorik ein! 75 Jahre tief ist der "Brunnen der Vergangenheit" unserer Schule; "unergründlich" ist er insofern nicht, als es den klar definierten Anfang im Jahre 1923 und danach relativ objektiv einteilbare Vergangenheitsstrecken gibt, die in dieser Festschrift dokumentiert werden. Unauslotbar ist uns Heutigen indessen die "Brunnentiefe" hinsichtlich der Schul- und Lebensgeschichten der etwa Schülerinnen und Schüler, die bislang an unserer Schule das Abitur gemacht haben. Wir lassen hier einige Ehemalige zu Wort kommen, die etwas von ihrem Leben aufgeschrieben haben und dabei auf "ihre" Schulzeit zurückblicken. Vielleicht wird daraus auch etwas Repräsentatives über die jeweilige Zeit unserer Schule ablesbar. Wir hoffen durch die Zusammenstellung aus darstellenden Texten, aus Schrift- und Bilddokumenten insgesamt den Zeit-"Roman" des Lise-Meitner-Gymnasiums aus der Vergangenheit heraus bis in die Gegenwart hinein nachvollziehbar gemacht zu haben. "Unergründlich" muss die Zukunft bleiben. Aber soviel lässt sich im Blick auf die wechselvolle 75-jährige Geschichte dieser Schule prognostizieren: Hier wird wohl nie Stillstand mit Bewegung verwechselt werden! Denn in allen Jahrzehnten ( mit Ausnahme der NS-Zeit) hat es neben der Orientierung an der kulturellen Tradition immer auch pädagogische Reformen gegeben, die - angesichts des gesellschaftlichen Wandels - zukunftsbezogenes Lernen für die Kinder und Jugendlichen sichern sollten. Mit der Einführung der Koedukation im gesamtgesellschaftlich inhaltsschweren Jahr 1968 und der kurz danach erfolgten Übernahme des Namens der Physikerin Lise-Meitner als Schulname beginnt gewissermaßen eine "neue Epoche", in der sich unser Gymnasium in zunehmendem Maße reformpädagogisch profiliert hat. Z. Z. befinden wir uns wieder in einer "sensiblen Phase": Das Lise-Meitner-Gymnasium beteiligt sich im Rahmen eines auf 5 Jahre angelegten Projekts, getragen vom Ministerium und der Bertelsmann-Stiftung, daran, die "Schule der Zukunft" schrittweise zu verwirklichen. Gleichzeitig sind wir in einem von der Bertelsmann-Stiftung ins Leben gerufenen "Netzwerk" mit insgesamt 400 innovativen Schulen (davon 40 Gymnasien) aus ganz Deutschland verbunden. Bei beiden sich ergänzenden Vorhaben geht es nicht um eine "von oben" verordnete Schulreform, sondern um die sukzessive Übernahme der Verantwortung für die Bildungs- und Erziehungsarbeit durch die Einzelschule im Rahmen klarer staatlicher Vorgaben. Dabei wird sich mehr Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulen um gute pädagogische Lösungen entwickeln; gleichzeitig müssen die Schulen bereit sein, mehr als bisher öffentlich Rechenschaft über ihre Arbeit abzulegen, so dass die Qualitäts-Standards gesichert bleiben. Kurz: Die "Schule der Zukunft" wird eine Schule mit mehr Freiheit und mit mehr Verantwortung sein! (Gerhard Löw, Schulleiter) 7
9 8
10 Vom ersten Schultag bis zum ersten Abitur 9
11 Der erste Schultag Die Anfänge der höheren Mädchenschule Wiesdorf reichen bis in das Jahr 1923 zurück. Zunächst war sie der Mittelschule angegliedert, die aber auch kein eigenes Gebäude hatte. Beide Schulen waren in der evangelischen Knabenschule untergebracht, der Raum war hier allerdings sehr beschränkt. Ostern 1923 standen wir 36 Mädchen voller Pläne und Erwartungen vor der Schule. Manchen schlug das Herz ein wenig bänglich. Wir trugen fast alle noch Schürzen, meist blau und weiß gestreift, glatt gekämmtes Haar, lange Zöpfe und bunte Schleifen. Da schellte es. Fräulein Prange führte uns samt der untersten Mittelschulklasse in ein großes Schulzimmer. Die Mittelschulklasse setzte sich in die eine Reihe der Bänke, die höhere Mädchenklasse in die andere. Fräulein Prange diktierte uns den Stundenplan. Das Wort "Französisch" flößte uns besondere Ehrfurcht ein. Trotzdem schrieben es die meisten falsch und zwar meist mit "ch" statt mit "sch". Auf dem Heimweg tauschten wir natürlich unsere Ansichten aus über die neue Schule und die neue Lehrerin, die noch erwartet wurde... Endlich kam Fräulein Färber. Sie gefiel uns von Anfang an gut. Sie trug einen blauen Rock mit weißer Bluse und hatte schönes blondes Haar. Erst seitdem sie da war, fühlen wir uns als Klasse. Unser Klassenzimmer war ein nicht gerade freundlicher Raum hinter der Turnhalle... Die Bänke nahmen fast die ganze Klassenbreite ein. Sie bestanden aus zwei Brettern. Auf dem einen saßen wir, auf dem anderen schrieben wir. Unser Vertrauen zu Frl. Färber war von Anfang an groß. Ich fragte sie gleich, ob ich ganz allein und für immer das Tafelamt haben dürfe. Das war der Gipfel unserer Wünsche. Leider erhielt ich es nicht... Am nächsten Morgen hatten wir die erste Französischstunde: Wie sollten wir uns stellen? Fräulein Färber begann: Wenn ein Franzose herein kä- Die Anfangsklasse
12 Aus einem Verwaltungsbericht der Stadt Leverkusen me, dann würde er sagen: 'Où est la classe?' Wir müßten dann antworten: 'Voici la classe!' Wir lernten mit Eifer, denn das Französische schien uns leicht. Vor der ersten französischen Arbeit hatten wir große Angst. Sie sollte so ähnlich werden wie 'La première lecon' Sie begann auch wirklich 'Bonjour Madame'. Sie gefiel gut. Die meisten hatten 'bien' bekommen. Wir waren sehr stolz."... Inzwischen war zu Ostern 1924 das neue Gebäude der Mittelschule fertig geworden. Jedermann schwärmte für ihr märchenhaftes Innere. Ganz wunderbare Gerüchte waren darüber im Umlauf. Da sollte über jeder Klassentür ein Tier abgebildet sein. Da waren bunte Korridore, ein feiner Turmaufgang, das Musikzimmer mit der Bühne, das Kartenzimmer und die Klassen selbst wurden wir an das Realgymnasium unter der Leitung von Herrn Direktor Dr. Leopold angegliedert. Wir zogen um in die Baracke hinter der evangelischen Knabenschule. Die zwei Jahre, die wir dort verlebt haben, gehören zu den schönsten unserer Schulzeit. In diesem Jahr änderte sich auch die Verteilung des Unterrichts. Fräulein Färber gab uns noch die weitaus meisten Stunden, doch hatten wir Religion, Nadelarbeit, Turnen und Singen bei Lehrern der Mittelschule... Ostern 1927 schmolz unsere Klasse stark zusammen. Die Eigenheimer und mehrere Leverkusener gingen aufs Mülheimer Lyzeum. Das war auch sicherlich besser als im 4. Stockwerk der katholischen Mädchenschule, in die wir jetzt umzogen. 84 Stufen mußten wir steigen, ehe wir in unsere Klasse kamen Der neue Stundenplan mit den vielen neuen Fächern, 11
13 Englisch, Physik und Stenographie schreckte uns zunächst. Aber es wurde doch nur halb so schlimm. Die beiden neuen Lehrerinnen waren sehr nett... Am 5. November 1928 weihten wir mit dem Schulleiter Herrn Dr. Leopold das neue Realgymnasium mit ein. Da gab es allerlei Vorbereitungen. Auf dem Elternabend sollte unser Klasse einen Reigen aufführen. Es machte gewaltige Mühe, bis wir alle Walzer und Polka tanzen und unsere Lieder richtig singen konnten. Nach dem Festtrubel hieß es um so fleißiger zu arbeiten. Die Lehrer fanden mit der Zeit überhaupt weniger an uns auszusetzen. Wir zogen mehr und mehr die Kinderschuhe aus... Ostern 1929 brachte uns den schönen Erfolg, daß wir 18 alle versetzt wurden und, was im Grunde genommen doch noch mehr war, die Anerkennung unserer Schule als Lyzeum. Jetzt erhielt unsere Schule mit Studiendirektor Dr. Börger auch einen eigenen Direktor. Mit einer gewissen Spannung blickten wir dem neuen Schuljahre entgegen. Würde es uns den weiteren Ausbau zum Oberlyzeum bringen? Wir empfinden etwas von der Verantwortung, daß unsere Klasse einmal das erste Abitur ablegen soll. Und das soll ordentlich werden..." Diese Gedanken dokumentieren die ersten sechs Jahre unseres heutigen Lise-Meitner-Gymnasiums aus der Sicht der Schülerin L. Sch. und sind als "Klassenchronik der Untersekunda" im Jahrbuch des Oberlyzeums i.e. 1929/30 enthalten. Diese und ähnliche Erlebnisse haben sich nun schon 75 Mal wiederholt, der Bericht enthält bereits exemplarisch viele Grundzüge, so in der Begeisterungsfähigkeit dieser Schülerin, ihrem Verantwortungsgefühl und im Engagement ihrer Lehrer, die das weitere Werden der Schule auf ein Haus des Lernens hin mit bestimmt und geprägt haben. Die Vielfalt der individuellen Erfahrungen und die sich ständig verändernden Lern- und Lehrbedingungen machen die nun 75jährige lebendige Geschichte des Lise-Meitner-Gymnasiums aus, wie diese Festschrift zu belegen versucht. Dr. Paul Leopold Realgymnasium 12
14 Die Einrichtung des künstlerischen und technischen Unterrichts. Nach Übersiedlung der Anstalt in das neue Schulgebäude konnte der Musikunterricht im Sinne der ministeriellen Richtlinien erteilt werden. Das Gesangliche stand nach wie vor im Vordergrunde. In den unteren Klassen wurden gelegentlich kleine Werke unserer Meister, auch unter Berücksichtigung der formalen Seite besprochen. In UIII wurde das deutsche Lied des 19. Jahrhunderts (Schubert, Schumann, Löwe), in OIII die romantische Oper unter besonderer Berücksichtigung des "Freischütz" behandelt. Die geeigneten Schülerinnen der verschiedenen Klassen mit Ausnahme der VI vereinigten sich zum Schulchor. Hier wurden meist dreistimmige Lieder aus den verschiedenen Zeitabschnitten der Musikgeschichte gesungen. Der Zeichenunterricht erfuhr eine wesentliche Förderung dadurch, daß in der neuen Schule ein den neuzeitlichen Anforderungen entsprechender Zeichensaal zur Verfügung stand. Zum ersten Male konnte mit dem im Lehrplan vorgeschriebenen Linearzeichen von Untertertia ab begonnen werden. Dazu trat noch der Kunstbetrachtungsunterricht, in welchem neben der griechischen und römischen Kunstepoche einzelne markante Künstler der Renaissance, der altdeutschen Schule etc. behandelt werden konnten. Auf der Unterstufe wurden ähnlich wie im Vorjahre ausschließlich Themen aus dem Lebenskreis des Kindes bearbeitet. Am Nadelarbeitsunterricht nahmen bis auf eine Schülerin, die augenleidend war, alle Schülerinnen teil. In der Sexta wurden Taschen und Puppenkleidung aus verschiedenfarbigem Garn gehäkelt, die Nähtasche und das Einschlagtuch für den Nadelsarbeitsunterricht genäht und bestickt. Die V strickte Gegenstände schwierigerer Form für die Puppe und z.t. Fausthandschuhe, danach wurde der Kreuzstich an Kissen geübt. In der IV beschäftigen sich die Schülerinnen mit Stopfen und Flicken, behäkelten Taschentücher und machten Versuche an verschiedenen Webeapparaten. In der UIII wurde die Nähmaschine besprochen und Vorübungen im Maschinenähen, Kissenbezüge und Schlafanzüge angefertigt. In der OIII wurde das Wäschenähen fortgesetzt und das Flicken mit Maschine geübt. Zum Schluß nähten die Schülerinnen ein Kleid für sich selbst, das mit Handmalerei verziert wurde." Werkunterricht war im Schuljahr 1928/29 nur für die Klassen IV und UIII vorgesehen. Die Schülerinnen beschäftigen sich mit leichten Holzarbeiten und mit Papparbeiten. Mappen für erdkundliche Sammlungen und für Zeichnungen, Schreibmappen und Schreibunterlagen wurden angefertigt, Karten und Tabellen aufgezogen bzw. ausgebessert. Die Schülerinnen der UIII befaßten sich mit Buchbinden. Schadhafte Bücher der Schüler-bibliothek und sämtliche Jahrgänge der laufenden Zeitschriften wurden eingebunden. Zudem wurde eine Anzahl Bilder, die der Anstalt geschenkt waren, eingerahmt." Diese Auszüge aus dem "Bericht über das Schuljahr 1928/29" sind die ersten Hinweise auf einen handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterricht, der zudem noch projektartig angelegt ist. Die "Allgemeine Lehrverfassung" weist das Lyzeum als grundständige höhere Schule für die weibliche Jugend aus. Das Lyzeum i.e. in Wiesdorf, VI - OIII, beginnt mit Französisch und nimmt von der UIII an als 2. Neuere Fremdsprache Englisch hinzu. 13
15 14
16 15
17 Die erste Reifeprüfung Sie fand am statt. 12 Schülerinnen unterzogen sich ihr. Eine Leverkusener Tageszeitung berichtete: Das Ziel ist erreicht: Unser Leverkusener Oberlyzeum konnte in diesem Jahr zum erstenmal die Prüfung der Abiturientinnen durchführen. In schweren Tagen wurde das Werk begonnen, schwer war auch der Kampf - um so freudiger und zukunftsfroher darf man nun sein, da die Aufgabe, die man sich stellte, erfüllt worden ist. Am Samstag bereitete die Anstalt ihren scheidenden Schülerinnen eine Abschiedsfeier, die schlicht und würdig-feierlich war, die von jenem Geist getragen war, der der Anstalt zu eigen ist... Grünes Blattwerk und hell leuchtendes Fahnentuch schmückte den Musiksaal, froh klang ein Lied des Schulchores auf, den Abschiednehmenden von ihren Mitschülerinnen unter der Leitung von Musikdirektor Havemith zum Gruß gesungen. Und dann konnte Studiendirektor Dr. Börger all die vielen Gäste begrüßen, die sich zu dieser Stunde eingestellt hatten, sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Dr. Claes, Beigeordnetem Dr. Bahlmann und dem Schuldezernenten Dr. Posthofen. Gruß und Dank galten weiter dem Leiter des Carl-Duisberg-Realgymnasiums, Studiendirektor Dr. Leopold, der vor der Tätigkeit des jetzigen Direktors das Lyzeum betreute, dann Rektor Klopsch, unter dessen Obhut das erste Reislein gepflanzt worden sei, und dann begrüßte der Redner mit besonderer Herzlichkeitdie Kollegen von Volksschulen. Und dabei betonte er, daß die höhere Schule nicht weiterbauen könne, würde nicht in der Volksschule der Grund gelegt. Die weiteren Ausführungen des Redners galten der Schilderung der Entwicklung unseres heutigen Oberlyzeums, aus dessen ehemalgen Schülerinnenzahl von 40 nun 210 geworden sind. Diese äußere Entwicklung sei wichtig, wichtiger aber sei die innere Entwicklung. Gerade die höheren Mädchenschulen seien es, die um ihren Bestand zu kämpfen hätten, und auch heute müsse weiter gekämpft werden, dem Gedanken der modernen Mädchenerziehung zum Siege zu verhelfen. Das sei nicht das Ziel unserer heutigen Mädchenerziehung: das Anrecht auf gut bezahlte Stellungen zu erlangen, das Ziel sei geistig, das geistige Leben solle Bereicherung durch die geistigen Kräfte der Frau erfahren. Es sei schon so, daß die Bildungshöhe eines Volkes von der Bildungshöhe seiner Frauen abhänge. Bürgermeister Dr. Claes wies besonders darauf hin, daß in Leverkusener Elternkreisen immer noch Kinder zu auswärtigen Schulen geschickt würden, statt die heimischen Lehranstalten zu berücksichtigen. Es gebe kein Bedenken, das dazu führen könne, ein Leverkusener Kind nicht in eine Leverkusener Schule zu schicken. Herzliche Worte des Glückwunsches richtete Studiendirektor Dr. Leopold an die Schwesteranstalt und ihren Leiter zu der Erreichung des Zieles. Worte des Dankes sprach Fräulein Wirth im Namen ihrer Conabiturientinnen, dankte der Lehrerschaft und den Eltern für das, was beide in den Jahren der Schulzeit an ihnen getan haben. Und dann klang die würdige und schlichte Abschiedsstunde in einem Liedvortrag des Schulchores aus. Im März 1983, anläßlich des 50. Jahrestages dieses ersten Abiturs, erhielt der damalige Schulleiter des Lise-Meitner-Gymnasiums, Herr Dahlmannn, folgenden Brief: 16
18 Ähnliches wiederholte sich dann im Vorfeld der Feiern zum 70jährigen Bestehen der Schule: In seinem Geleitwort zum Jahrbuch des Oberlyzeums i.e. 1929/30 hatte Dr. Börger geschrieben: "In diesem Jahr erreicht zum ersten Male eine Klasse des Lyzeums ihren Abschluß. Darum enthält unser Jahrbuch eine ausführlichere Chronik dieser Klasse aus der Feder einer Schülerin... Aus den Schülerinnenarbeiten mag jeder entnehmen, was unsere heranwachsende Jugend vom Streben der älteren Generation in sich aufgenommen hat und wie sie es in ihre eigene Lebensform umgeprägt hat. Der innere Zusammenhalt des ersten Abiturjahrgangs über fünf Jahrzehnte hinweg und das Interesse an dem jetzigen Lise-Meitner-Gymnasium, das sich auch in weiteren Jahrgängen ständig wieder zu erneuern scheint, bestätigen beeindruckend den eingeschlagenen Weg. 17
19 Annäherungen an einen Schulleiter Dr. Paul Börger, Schulleiter des Oberlyzeums Leverkusen von , hat mein Abiturzeugnis unterschrieben, denn er war, als ich 1959 die Reifeprüfung ablegte, Direktor des Gymnasiums in Köln-Mülheim. Dr. Paul Börger, Schulleiter des Oberlyzeums Leverkusen von , hat mein Abiturzeugnis unterschrieben, denn er war, als ich 1959 die Reifeprüfung ablegte, Direktor des Gymnasiums in Köln-Mülheim,. Als Schulleiter war er eine Herrscher-persönlichkeit; das belegt unsere Abizeitung: in ihr machten wir uns über die Folgsamkeit einiger Lehrer gegenüber dem Direktor lustig. Was mich als Schüler auch beeindruckte: er hatte die drei Bände des Religionsbuches "Am Quell des Lebens" verfaßt, das mich von Sexta bis Oberprima begleitet hat. Einige Jahre später las ich überrascht, daß Paul Börger während des Krieges gegen einen Befehl gehandelt 1 und den Kölner Dom gerettet hätte. Als Major der Reserve und Kommandeur des Pionier- Ausbildungsbataillons in Westhoven hätte er mit seinen Soldaten den durch Bomben beschädigten Nordpfeiler des Domes mit einer Plombe aus Ziegelsteinen gesichert. Mit diesem Einsatz hätte Börger gegen einen militärischen Befehl verstoßen: Das Pionierbataillon hätte keine bautechnischen Hilfsdienste - schon gar nicht bei einer Kirche - leisten dürfen, sondern es hätte ausschließlich Soldaten ausbilden dürfen. Diese Geschichte gefiel mir gut. Und wenn ich Gäste durch Köln führte, habe ich, stolz auf meinen Direktor, das Mauerstück am Nordturm gezeigt und seine Geschichte erzählt. 18
20 Über diesen Paul Börger wollte ich mehr herausfinden; unsere Festschrift war dafür ein Anlaß: Paul Börger wurde 1896 als Sohn eines Rektors in Dortmund geboren. Nach schwerer Verwundung im Ersten Weltkrieg studierte er Theologie, Geschichte, Deutsch und Philosophie in Leipzig und Münster legte er beide theologischen Examina und die Prüfungen für das Lehramt an höheren Schulen ab; 1928 erfolgte die Promotion. Im Oktober 1922 wurde er Gemeindepfarrer in Dortmund-Derne, und ab 1925 war er Anstaltspfarrer und Studienrat (zugleich Internatsleiter) am evangelisch-stiftischen Gymnasium in Gütersloh. Vom an war er Oberstudiendirektor am Oberlyzeum Leverkusen; am wechselte er als Schulleiter an das Gymnasium Köln-Deutz. Von war er Soldat, blieb aber nominell Direktor des Deutzer Gymnasiums. Aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, war er von Pfarrer an der Johanneskirche in Düsseldorf; danach wurde er wieder in den Schuldienst übernommen und leitete bis zu seiner Pensionierung (1961) das Städt. Naturw. Gymnasium in Köln-Mülheim. Dr. Paul Börger starb am in Düsseldorf. Interessant ist die Rolle, die Dr. Börger in der Zeit des Dritten Reiches gespielt hat. Historiker des Deutzer Gymnasiums, das 1983 sein 75jähriges Bestehen feierte, haben sich eingehend mit der Geschichte ihrer Schule in ihrer Festschrift beschäftigt. Einer von ihnen, Horst-Dieter Blumrath, hat mir darüber hinaus folgendes über Dr. Börger berichtet: Als Schulleiter mußte er in der NSDAP sein. Er habe auch meist die Parteiuniform getragen. Er galt öffentlich als strammer Nationalsozialist. Am Deutzer Gymnasium gab es eine Reihe von Lehrern, die an diese Schule strafversetzt worden waren, weil sie dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstanden. Die NSDAP wähnte sie vermutlich unter der Fuchtel des Parteigenossen Dr. Börger gut aufgehoben. Lehrer (auch die strafversetzten) und Schüler, die diesen Direktor aus eigenem Erleben kennengelernt hatten, berichteten aber übereinstimmend, daß an der Schule ein gewisses Maß an Freiheit geherrscht hätte, daß unbequeme, mutige Worte gegen den Nationalsozialismus in den Klassen möglich gewesen wären. Das wäre nicht zuletzt Dr. Börger zu verdanken gewesen. Auf ihn ging auch zurück, daß der Religionsunterricht an der Schule unangetastet blieb. (Dr. Börger war 1930 in den Vorstand des rheinischen Religionslehrverbandes gewählt worden. Der Druck des von ihm neu herausgegebenen Arbeitsbuches für den evangelischen Religionsunterricht wurde später von der NSDAP untersagt.) Ein gewichtiger Prüfstein für seine Einstellung zum Nationalsozialismus war sein Verhalten den jüdischen Schülern gegenüber: Dr. Börger, so berichteten ehemalige jüdische Schüler, hätte sich schützend und vermittelnd für sie eingesetzt; noch nach 1936 hätten 10 jüdische Schüler das Deutzer Gymnasium besucht. So ergibt sich das Bild eines Mannes, der während der Nazizeit zwei Seiten zeigte. Und sicher war es das NSDAP-Mitglied, der stramme Parteigenosse, der Schulleiter in der braunen Uniform, der nach dem Ende der Nazidiktatur untragbar wurde. An das Deutzer Gymnasium durfte er nicht zurück; aber 1950 hat man ihm wieder eine Schulleitung übertragen. Es ist noch eine Korrektur am Bild Börgers anzubringen, die auch für den Kollegen Blumrath etwas Rätselhaftes hat: Es hätte schon immer Gerüchte gegeben, daß die Geschichte, daß Börger mit seinen Pionieren den Domturm vor dem Einsturz bewahrt hätte, (Kölner Stadtanzeiger 1976: "Der Mann, der den Dom rettete", und 1980: "Der Major wollte dem Befehl nicht folgen") überhaupt nicht stimmte. Der Historiker fand heraus: Der Nordturm ist von Kölner Handwerksbetrieben repariert worden. Das Generalvikariat besitzt sogar noch die Rechnungen der mit der Reparatur des Nordturms zügig beauftragten Firmen. Und es gab von Seiten der Militärbehörden keine Behinderungen oder Widerstände, Baumaterial für die Sicherung der Kirche einzusetzen. Er wisse allerdings nicht, warum diejenigen in der kirchlichen Verwaltung geschwiegen hätten, die wußten, daß die Zeitungsberichte über Börgers Rettungstat nicht stimmten. Was mag ihn veranlaßt haben, diese Geschichte zu erfinden? Vielleicht ist sie dem tiefen Bedürfnis eines alten Mannes entsprungen, den Kölnern - in deren Stadt er die schönsten Jahre seines Lebens verbracht hat - denen er aber als strammer Nazidirektor galt, zu "beweisen", daß er im Grunde kein Nazi gewesen war. (H. Jürgen Döllscher) 1 Klaus Zöller, Der Major wollte dem Befehl nicht folgen, in: Sonderausgabe des Kölner Stadtanzeiger, "Der Kölner Dom, 100 Jahre vollendet", Köln
21 20
22 Leben und Überleben der Schule im Nationalsozialismus 21
23 Leben und Überleben der Schule in der Zeit des Nationalsozialismus ( ) Die Entwicklung des Lise-Meitner-Gymnasiums in der Phase des Nationalsozialismus, d. h. von 1933 bis 1945, läßt sich nur sehr eingegrenzt mit Originalbelegen dokumentieren, sie gewinnt viel mehr ihre bedrückende Wirkung aus den Werken zweier ehemaliger Schülerinnen dieser Schule. Dr. Eva Wolff geht in Auszügen aus ihrer Dissertation auf die Bedeutung dieser Zeit für die Leverkusener Schulen ein. Der für diese Festschrift geschriebene Beitrag von Dr. Astrid Gehlhoff-Claes "Zweitausendzweihunderthundert Lichter" vermittelt aus autobiographischer Sicht in einer Art Gegenperspektive Zwänge und Leiden in einer dunklen Zeit. Der Leiter der damaligen Städtischen Mädchen- Oberschule (Hauswirtschaftliche und sprachliche Form) war vom 16. November 1933 bis zum 31. Oktober 1945 Dr. Franz A. Jungbluth. Das Gedenkblatt zur Feier des 25jährigen Bestehens der "Städtischen Studienanstalt und des Städtischen Lyzeums mit Frauenoberschule in Leverkusen" vom 24. Juni 1948 stellt fest: "Das neue Schuljahr brachte der Schule einen neuen Leiter in Herrn Direktor Dr. Jungbluth., der in ererbtem, beschwingtem Rhythmus der Schule weiterarbeitete. Zeitbedingte Einflüsse, die das Frauenstudium eindämmen wollten, machten sich in unserer Schule dahingehend bemerkbar, daß man das Oberlyzeum abbauen und an seiner Stelle eine dreijährige Frauenoberschule auf dem sechsklassigen Lyzeum aufbauen wollte. Das Ergebnis vieler Verhandlungen war schließlich, das Oberlyzeum zu belassen und die Frauenoberschule daneben zu errichten. Die erste Reifeprüfung der Frauenoberschule wurde 1937 von fünf Schülerinnen bestanden." 22
24 Die Leverkusener Mädchenlyzeen Unsere ehemalige Schülerin Eva Wolff hat über das Thema Nationalsozialismus in Leverkusen promoviert Die drei Mädchenlyzeen, das Opladener Städtische Lyzeum, welches bis zur Obersekunda führte, die Katholische Höhere Töchterschule (Marianum) und das Leverkusener Städtische Oberlyzeum, welches die Hochschulreife ermöglichte, waren natürlich den gleichen nationalsozialistischen Übergriffen unterworfen wie die Jungenschulen, was sich in der Umgestaltung der Lehrpläne und Themen der Reifeprüfungen, in der Indoktrination durch Schulfeiern und nationalpolitische Lehrgänge und in dem Einfluß der Staatsjugend in Form des BDM auf die Schule äußerte. Im Vordergrund der Schulungsarbeit stand natürlich das Ziel, die Mädchen in die Hitlers Idealbild entsprechende Rolle als Hausfrau, Mutter und kompetente Lebensgefährtin 217 des Mannes einzuweisen. Die im Schuljahr 1937/38 gestellten Aufgaben für die schriftliche Reifeprüfung am Leverkusener Oberlyzeum spiegeln diese Ausrichtung wider. "Deutscher Aufsatz (zur Wahl) a) Mit unserer Marionettenspielschar auf den Dörfern (Was wir wollten und was wir erlebten) Anmerkung: Beide Oberprimanerinnen sind in der Marionettenspielschar, die hier in Leverkusen von der HJ gegründet wurde. Die Puppen wurden selbst gebaut, und es wurde schon verschiedentlich in kleineren Gemeinden vor Kindern und Erwachsenen gespielt, als Stück Kulturarbeit der HJ. 23
25 b) Erziehung zu Gemeinschaftsgeist und Opferbereitschaft im neuen Deutschland c) Marie Voigt - eine Deutsche Mutter und Gutsherrin (Eine Charakteristik aus Voigt-Diederichs: Gut Marienhoff) d) Wie ist es mir als Frau möglich, an der Durchführung des Vierjahresplanes mitzuarbeiten? In diesen Themenstellungen werden die von den Nationalsozialisten in allen Schulen eingebrachten Ziele deutlich, nämlich die Erziehung zur Gemeinschaft als Grundlage für den Aufbau des völkischen Staates und die Erziehung zur von jedem einzelnen geforderten Opferbereitschaft für die Bewegung. Darüber hinaus wird besonders mit den beiden letzten Themen auf die spezifische Rolle der Frau eingegangen. Mit der Reduzierung des Betätigungsfeldes der Frau auf den häuslichen Bereich war natürlich verbunden, dass auch die Berufsmöglichkeiten, so vor allem die eines Studiums für die Frau in beträchtlichem Maße beschnitten wurde. Die damit verbundene Reduzierung der wissenschaftlichen Ausbildung für die Frau machte sich bereits 1934 am Leverkusener Oberlyzeum bemerkbar, als infolge der veränderten Berufsmöglichkeiten sich nur noch eine Schülerin für die wissenschaftliche Oberstufe anmeldete. In Übereinstimmung mit der Schulleitung beantragte der Leverkusener Bürgermeister beim Oberpräsidenten, Abteilung für Höheres Schulwesen in Koblenz, die Umgestaltung des Städtischen Oberlyzeums in ein Lyzeum mit anschließender Frauenschule, wobei zunächst die Frage nach Angliederung einer einjährigen Frauenschule oder die einer dreistufigen Frauenoberschule offenblieb. Auf jeden Fall wollte Leverkusen an der Entwicklung teilhaben, "die kommende Generation als Frau, Mutter und Staatsbürgerin auszubilden und sie zu rüsten". Sprach sich der Leverkusener Bürgermeister unter Hinweis auf die reduzierten Haushaltskosten und aufgrund der Tatsache, dass auch Mittelschulabsolventinnen die einjährige Frauenschule besuchen konnten, eindeutig für die einjährige Form aus, argumentierte der Schulleiter ähnlich wie der Oberschulrat für die dreijährige Form, da ansonsten bereits das Lyzeum leiden würde, da viele Eltern ihre Töchter dann die Mittelschule besuchen lassen würden oder aber direkt ein Lyzeum, das die Oberschule anböte. Zunächst konnte sich allerdings der Leverkusener Bürgermeister durchsetzen. Am erklärte sich der preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung "damit einverstanden, dass die Oberklassen des Oberlyzeums in Leverkusen-Wiesdorf von Ostern des Jahres ab stufenweise abgebaut werden und dass dafür mit Wirkung von Ostern des Jahres ab eine einjährige Frauenschule an das Lyzeum angegliedert wird". Nachdem sich Ende April von den neuen Schülerinnen der Frauenklasse acht für eine Reifeprüfung ausgesprochen hatten und sich eine Elterninitiative mit Schreiben vom vehement für die Frauenoberschule eingesetzt hatte, sah sich der Bürgermeister bereits Ende April 1934 veranlaßt, seine Meinung zugunsten der dreijährigen Form zu revidieren. Bereits am stellte er beim Oberpräsidenten den Antrag auf Umwandlung der bereits eingerichteten Frauenschulklasse in die Sekunda einer Frauenoberschule, ein Antrag, der am durch den preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung genehmigt wurde. Der Protest des Opladener Bürgermeisters gegen die Umwandlung des Oberlyzeums in eine Frauenschule, in dem er auf eine im Jahre 1929 getroffene Vereinbarung hinwies, wonach der Stadt Leverkusen seiner Zeit ein Oberlyzeum nur unter der Bedingung genehmigt worden war, "dass der Stadt Opladen bei allen Plänen auf Errichtung von Frauen- und Frauenoberschulen, die im Kreisgebiet auftauchen sollten, die Priorität zugestanden" würde, wurde mit Hinweis auf die völlig veränderten Verhältnisse vom Oberpräsidenten der Rheinprovinz abgewehrt. Für die Leverkusener Mädchen war mit der Umwandlung des Oberlyzeums zur Frauenoberschule die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Allgemeinbildung drastisch eingeschränkt worden, war doch nun die Frauenoberschule in Leverkusen einzige Schulform, in der Kernfächer wie Nadelarbeit, Hauswirtschaft, Zeichnen, Musik und der pflegerisch-erzieherische Bereich im Vordergrund standen. Dass diese Schwerpunktbildung auf Kosten einer fundierten Grundbildung in den allgemeinbildenden Fächern wie Geschichte, Erdkunde oder Mathematik vor sich ging, wird deutlich aus dem Erfahrungsbericht des Studiendirektors des Oberlyzeums vom mit den vorläufigen Richtlinien für die ein- und dreijährigen Frauenschulen. Die folgenden Passagen mögen dieses verdeutlichen: "Geschichte: So äußerst wichtig die für OII und UI gestellten Aufgaben sind, so leidet - trotz der 3 Stunden in der Woche - doch die Übersicht über das gesamte geschichtliche Wissen... Vielfach war eine Eingliederung des Stoffes in den Gesamtablauf des Geschehens fast unmöglich. Erdkunde: Der Abstand von einer Woche ist für den Erdkundeunterricht bei der Vielzahl der Fächer und der Fülle der Eindrücke, die auf die Mädchen einstürmen, sehr lang, zu lang, um zu wirklich fruchtbaren Ergebnissen zu führen. Mathematik: Schon jetzt läßt sich mit einer gewissen Sicherheit übersehen, dass das gesteckte Unterrichtsziel mit 2 24
26 Wochenstunden nicht erreicht werden kann. Wird also an dieser Stundenzahl festgehalten, so müssen weitere Abstiche gegenüber dem Pensum des Oberlyzeums gemacht werden... Englisch: Mit meinen bisherigen Erfahrungen kann mit 2 Stunden Englisch in der Frauenschule nichts Ersprießliches geleistet werden." Das Reifezeugnis bildete nur für ganz bestimmte Berufe die Zugangsberechtigung (Gewerbelehrerin, technische Lehrerin, Werklehrerbildungsanstalt, künstlerisches Lehramt an Höheren Schulen, Haushaltspflegerin, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Diplomhandelslehrerstudium). Studiengänge wie Medizin, Jura oder Philosophie blieben mit dem Abschluß verschlossen. Erst im Jahr 1937 wurde in Leverkusen für die Gymnasiastinnen die Möglichkeit der wissenschaftlichen Allgemeinbildung erweitert, denn neben dem hauswirtschaftlichen Zweig der Oberstufe wurde durch Verfügung des Reichs- und preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom der sprachliche Zweig eingerichtet und damit die Wiederaufnahme des Oberlyzeums beschlossen. Die Schülerinnen konnten nun zwischen hauswirtschaftlicher und sprachlicher Form wählen. Anmerkungen: In einem Aufsatz zum Thema "Was warten wir Mädchen von der Frauenoberschule?" wird der den Mädchen vermittelte Erziehungsanspruch in sehr anschaulicher Weise deutlich: "...aber eine Hausfrau, die einzig und allein für die rein materielle Seite ihres Berufes ausgebildet wäre, wäre keine echte Hausfrau und vor allem keine deutsche Mutter....so müssen neben den rein praktischen Fächern auf dem Plan der Frauenoberschule auch die wissenschaftlichen Fächer stehen, wie Deutsch, Geschichte, Englisch und Mathematik. Sie sollen dazu dienen, die Frau zu befähigen, auch auf geistigem Gebiet mit dem Lebenskameraden Schritt halten zu können. Wenn unser Führer verlangt, dass die deutsche Frau voll und ganz im Stande sein soll, die Aufgaben, die ihre als der Wurzel der Familie gestellt sind, zu erfüllen, so heißt das nicht nur, dass sie in der Küche und ihrem Keller Bescheid weiß,..., sondern auch, dass sie die geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, ihren Kindern in jeder Beziehung eine gute Erzieherin und ihrem Mann ein verstehender Kamerad sein zu können...."(lha Koblenz, 405 A, 18, Die Fähre, Nachrichtenblatt des Städt. Oberlyzeums Leverkusen, Heft 1, Juli 1934, S. 5 f.). aus: Eva Wolff, Nationalsozialismus in Leverkusen, Leverkusen
27 Deutscher Aufsatz - DEUTSCHER Aufsatz!? Abiturthemen und -arbeiten aus den Jahren Mit unserer Marionettenspielschar auf den Dörfern ( Was wir wollten und was wir erlebten. ) Anmerkung: Beide Oberprimanerinnen sind in der Marionettenspielschar, die hier in Leverkusen von der HJ gegründet wurde. Die Puppen wurden selbst gebaut, und es wurde schon verschiedentlich in kleineren Gemeinden vor Kindern und Erwachsenen gespielt, als ein Stück der Kulturarbeit der HJ. 2. Erziehung zu Gemeinschaftsgeist und Opferbereitschaft im neuen Deutschland 3. Marie Voigt - eine deutsche Mutter und Gutsherrin 4. Wie ist es mir als Frau möglich, an der Durchführung des Vierjahresplans mitzuarbeiten Erlebnisse von unseren Klassenwanderfahrten, die mir- rückschauend - wertvoll sind. 2. "Ich will, daß dem Gesetz Gehorsam sei." ( Kleist) 3. Wer sein Volk liebt, beweist es einzig durch die Opfer, die er für dieses zu bringen bereit ist. ( Hitler ) 4. Eine Frau, die mich stark beeindruckt hat Aus Schmidtbonns Novelle "Die Letzte" ist der Grundgedanke und seine dichterische Gestaltung aufzuzeigen. 2. "Die Stärke der Staaaten beruht auf den großen Männern, die ihnen zur rechten Stunde geboren werden." ( Friedrich der Große ) 3. Hermann Onken: "Die Einkreisung Mitteleuropas". ( Gliederung, Wiedergabe und Stellungnahme von der Gegenwart aus. ) 4. "Es würde nicht viel aus der Welt werden, wenn es nicht den Hunger darin gäbe." ( Wilhelm Raabe ) Drei Bilder aus meiner Heimat 2. Gott konnte nicht überallhin, da schuf er die Mütter 3. Wir leben in einer großen Zeit, wohl dem, der dies begreift. 4. Fichte: Reden an die deutsche Nation "Nicht die Gewalt der Armeen noch die Tüchtigkeit der Waffen, sondern die Kraft des Gemüts ist es, für welche Siege er kämpft Die deutsche Frau im dritten Kriegsjahr ( sachliche Leistung - seeelische Bewährung ) 2. Das Erhabene verehren, das Schöne lieben, das Gute tun. Anna Amalia von Weimar 3. Zwei Plastiken vom Straßburger Münster 4. Japanische Soldatentugenden ( im Anschluß an die Erzählung "Die Pflicht" von W. von Scholz ) Im Jahre 1932 wurde am Leverkusener Städtischem Oberlyzeum erstmalig das Abitur abgenommen. Die hier vorliegenden Themen unterscheiden sich erstaunlich wenig von den heutigen, so dass sie auch eher von anekdotischem Interesse sind. Erwähnenswert ist allerdings, daß eine Schülerin anstelle des Deutschen Prüfungsaufsatzes eine Jahresarbeit vorlegen konnte, die sich mit der "Grundlegung der Ethik nach Kants 'Grundlegung zur Metaphysik der Sitten' und Luthers 'Sermon von den guten Werken." auseinandersetzt. Entstanden ist diese Arbeit aus einer philosophischen Arbeitsgemeinschaft am Oberlyzeum sowie dem Religionsunterricht. Bedeutend erscheint diese Arbeit und diese Arbeitsform nicht nur vor dem Hintergrund, daß heute in der Form der Facharbeit ein ähnlicher Leistungsnachweis wieder eingeführt worden ist, sondern vor allen Dingen als Hinweis auf die geistige Lebendigkeit und die Möglichkeiten, die die Schule den Schülerinnen bot. Dies gewinnt noch an Bedeutung, wenn die Abiturthemen gegen Ende der dreissiger Jahre betrachtet werden, die deutlich von Zeitthemen geprägt sind.waren in den Jahren nach der Machtübernahme der Nazis zunächst noch die "klassischen" Themen wie literarische, aber auch heimatkundlich und historisch orientierte vorherrschend, setzte sich zunehmend eine ideologisch 26
28 orientierte Themenstellung durch, wobei aber keine Aussage darüber getroffen werden kann, ob dies nun aufgrund ideologischer Überzeugung der Lehrkräfte oder aufgrund äußeren Drucks zustande kam. Die allen Abiturjahrgängen beigefügten persönlichen Beurteilungen der Schülerinnen durch die Lehrkräfte gehen nur in verhaltener Form auf die jeweiligen BDM-Aktivitäten ein, so daß wohl ein Einfluß auf die Leistungsbewertung weitgehend ausgeschlossen werden darf. Auch die Benotung und Kommentierung der jeweiligen Abiturarbeiten liefert keinen Hinweis darauf. Im Gegenteil: Die in der nationalsozialistischen Terminologie eloquentesten Arbeiten bekommen nicht die besten Zensuren. In der Themenstellung dagegen wird unmittelbar deutlich, dass der Nationalsozialismus seine Ziele in den Schulen durchzusetzen versuchte. Betont wird in den ausgewählten Abiturthemen insbesondere die Rolle der Frau als Mutter, später auch die Rolle der Frau im Krieg, der Heimatgedanke sowie die Betonung der besonderen Zeit, in der man lebt. Interessant erscheint nun hierbei nicht die Thematik, sondern vielmehr die Auswahl der Themen durch die Schülerinnen. Wählen 1938 nur zwei von fünf Schülerinnen den Ausspruch Hitlers zur Opferbereitschaft als Thema, so ist das Thema "Gott konnte nicht überall hin, da schuf er die Mütter" 1941 mit sechsmaliger Wahl bei insgesamt neun Schülerinnen schon sehr stark repräsentiert liegt das Thema "Die deutsche Frau im dritten Kriegsjahr" klar im Trend, die "Japanischen Soldatentugenden" folgen, während die scheinbar unverfänglichen Themen nur von fünf Schülerinnen gewählt wurden. Insgesamt läßt sich feststellen, daß von den 16 ausgewählten Themen der Abiturprüfungen gut die Hälfte eher dem literarischen Bereich zuzuordnen sind, wenn sich natürlich auch immer der Bezug zur jeweiligen Realität herstellen lässt. Mutter, Frau und Haushälterin in Geschichte und Heimat Gemäß der nationalsozialistischen Ideologie hatte die Frau eine klar definierte Rolle: In erster Linie sollte sie als Mutter für eine starke und zahlreiche Nachkommenschaft sorgen, die Familie zusammenhalten und den Haushalt besorgen. "Die Mutter ist immer diejenige gewesen, die ihrer Familie und ihrem Volk neues Leben schenkte. Die Mutter sieht es als Selbstverständlichkeit an, aber liegt darin nicht Aufopferung der eigenen Person für ihre Familie, für ihr Volk. Opfer bringen ist einer der großen Züge im Wesen der Mutter.... Nach dem Kriege gab es eine Zeit, in der die deutsche Mutter in den Staub gezogen wurde. Eine Frau, die viele Kinder hatte, war verpönt, heute aber im 3. Reich sind wir ganz anderer Ansicht. Die deutsche Mutter wird wieder geschätzt, denn sie stärkt das Volk. Der Führer steht auf dem Standpunkt, dass jede deutsche Mutter, die der Nation ein Kind schenkt, eine Schlacht schlägt und gewinnt." (1) Nicht so voreilig, bitte! Diese Schülerinnen hatten 1941 schon acht Jahre Nationalsozialismus hinter sich, so daß sie bei der sogenannten Machtergreifung 10 Jahre alt gewesen sein mögen. Hier einen kritischen Standpunkt zu erwarten, ist sicherlich unangemessen. Nur ein Jahr später ist ein Thema für den Deutschen Aufsatz im Abitur: Die deutsche Frau im dritten Kriegsjahr ( sachliche Leistung - seelische Bewährung ). Die Phrasenhaftigkeit der einzelnen Sentenzen ist sicherlich auffällig: "Die deutsche Frau pflegt nicht mit Mürrischkeit und Nörgeln ihr Opfer zu bringen, sondern freudig und willig." "Eine deutsche Frau sieht ihre Lebensaufgabe darin, eine Familie zu gründen, um für die Zukunft des Volkes zu sorgen." Der Rückblick auf den 1. Weltkrieg wird Ansporn zur Aufgabe der eigenen Peron im großen Ganzen: "Man sah nicht, dass es nicht um die Leistung des einzelnen, sondern um die aller geht, das erst das Werk 'aller', die gemeinsame Arbeit und das gemeinsame Schaffen Erfolge bringen kann, während das Werk des einzelnen zusammenbricht, wie uns ja der Weltkrieg bewiesen hat." Aus solcher jahrelang in der öffentlichen Propaganda gehörten 'Einsicht' kann sich nur eine Schlußfolgerung ergeben: "Eine deutsche Frau sieht ihre Lebensaufgabe darin, eine Familie zu gründen, um für die Zukunft des Volkes zu sorgen." Diese Zitate lassen sich fortsetzen, doch "die deutsche Frau im dritten Kriegsjahr" hat noch andere Aufgaben zu bestehen. Der große Anteil der auch sprachlich in völlig anderer Form gehaltenen Ausführungen zum Alltagsleben im Jahr 1942 lässt die Verunsicherung und Angst der Schülerinnen deutlich erkennen. "Es ist gewiss viel leichter, den Mut in den ersten Kriegsjahren zu haben, wenn man den Krieg noch nicht am eigenen Leib gespürt hat. Wenn noch kein Fliegeralarm die Nachtruhe unterbricht, wenn die Läden noch nicht ausgekauft sind und wenn man noch nicht vom Verlust irgend eines lieben Menschen, der gefallen ist, betroffen wurde." Die ausführlichen Schilderungen des Arbeitsalltags der Frauen dürften wohl klarer Ausdruck des Erlebens in der eigenen Familie sein. In allen Abituraufsätzen dieses Jahrgangs zum Thema ist ausführlich von den Mühen des Alltags die Rede: Nach einer vollen Schicht als Fabrikarbeiterin, als Schaffnerin und als Lazaretthelferin muß die Mutter noch in den "ausgekauften Läden" Nahrung für die Kinder besorgen und ein schmackhaftes Essen zubereiten. Diese hat die Mutter nun den ganzen Tag über nicht betreuen können: "Dann spielen die Kleinen mit den 27
29 Nachbarskindern und lernen manche schlechte Manieren." In allen Abiturarbeiten zu diesem Thema spiegelt sich deutlich die Last wieder, die die Schülerinnen erfahren haben. Hier wirken die Formulierungen fast kindlich, wenn von "den Kleinen, die die Ärmchen hochwerfen, wenn die Mutter von der anstrengenden Tagesarbeit zurückkehrt", die Rede ist. Der ideologische Kitt klebt aber auch fest im Kopf: Darf sie ihrem Manne all ihre Klagen, alles was ihr auf dem Herzen liegt, schreiben? Nein - hier muß sie stark sein, muß erkennen, daß sie damit ihren Mann nur quält und ängstigt. Sie muß ihn durch ihre Briefe anspornen, erinnern und ihn froh stimmen, so daß er in seinen Mußestunden gerne und mit Stolz an seine Familie und an seine Heimat zurückdenkt." "Denn Kriege werden nicht nur an der Front gewonnen, der Sieg hängt oft von der Haltung der Heimat ab, und daß sie bis zum letzten durchhält." Fast resignativ liest sich folgender Schlusssatz: "Daß die Leistungsforderung von Kriegsjahr zu Kriegsjahr steigt, ist wohl klar, daß der Krieg an der Front seine Opfer fordert und daß diese Lücken immer wieder durch neuen Zustrom aus der Heimat aufgefüllt werden müssen." Was bleibt einem siebzehnjährigen Mädchen da noch übrig als die Hoffnung, daß "der Dank der Mühen und Sorge... der Sieg des Volkes sein" wird? Deutlich wird an der verwendeten Sprache, daß die nationalsozialistischen Ideologeme in die Gedankenwelt der Schülerinnen ihre Spuren hinterlassen haben. Hier bei lässt sich eine Steigerung feststellen: Sind diese sprachlichen Versatzstücke in den früheren Arbeiten nur gelegentlich oder gar nicht zu bemerken, so treten sie 1942 gehäuft auf. Da der Krieg nun auch am eigenen Leibe erfahrbar war, Bombenangriffe an der Tagesordnung waren, reagierte auch die offizielle Propaganda mit immer stärkerer Bearbeitung der Bevölkerung. Was Wunder, daß dies in den Arbeiten der Schülerinnen wieder auftaucht. "Oft schon in der Geschichte hat Deutschland seinen Lebensraum verteidigen müssen. Oft hat es gegen eine große Übermacht gekämpft und den Sieg errungen. Nun fragen wir uns, was gab dem Volk die Kraft zu solchem Kämpfen?" Es folgt ein Abriß der deutschen Geschichte von Armin über die Befreiungskriege bis zum Kampf gegen England. "Der größte deutsche Sieg wird der Sieg des neuen Deutschland über seinen Unterdrücker England sein. Zwar hat der Führer dafür gesorgt, daß auch die Waffen denen unserer Gegner überlegen sind. Aber das wird letzten Endes nicht die Entscheidung sein. Allein der feste Glaube, die Haltung des Einzelnen und die Idee, die das ganze Volk beseelt, sind uns Gewähr für den Sieg.... Ein Sieg kann nur errungen werden, wenn alle bereit sind, sich für diesen Sieg einzusetzen, ja wenn sie ihr Leben dafür opfern." ( Abiturarbeit 1942 ) Aber auch hier muß differenziert werden: Liegt in einem Teil der Arbeiten die platte Übernahme der Propaganda vor, so hat sich doch auch ein Teil in distanzierterer Weise mit den jeweiligen Themen auseinandergesetzt und auf der Grundlage von im Unterricht behandelter Literatur. Die Übernahme von Ideologemen, die auch in diesen Arbeiten vorkommt erscheint deutlich aufgesetzt, ein Rest geistiger Unabhängigkeit bleibt sichtbar. Neben den oben angesprochen Themenkreisen, die massiv in die Schule hineingetragen wurden, finden sich auch Themen zum Fach Geschichte, die mit Österreichs Heimkehr ins Reich und seine Bedeutung, "Wie kam es zum Münchener Abkommen?" und "Inwiefern sind Liberalismus und Nationalsozialismus Gegensätze?" einen Bezug zur damals aktuellen Geschichte herstellen und kaum eine andere Möglichkeit als die Wiedergabe offizieller Positionen lassen. Hier wird die Einschränkung der Schülerinnen auf die offizielle politische Linie ganz besonders klar. Einige Themen finden sich auch zum Begriff "Heimat": "Drei Bilder aus meiner Heimat" von 1942 und "Das Gesicht unserer heimischen Kulturlandschaften von Ist die letzte Arbeit noch deutlich geprägt von geopraphischen Informationen und genügt damit noch am ehesten heutigen Ansprüchen, so ist die erste eher eine Hommage an die die Schülerinnen umgebende geographische Heimat, die aber den Bezug zur Blut und Boden Romantik eben nicht aufweist. Schwerpunkte sind hier Detailschilderungen des Bergischen Landes oder der Dörfer Rheindorf und Wiesdorf, was auf eine tiefe Heimatverbundenheit hinweist, aber die Sprache des dritten Reiches nicht erwendet. Abschließend sei noch angemerkt, daß in keiner der betrachteten Arbeiten ein positiver Zusammenhang zwischen der wiedergegenen offiziellen politischen Linie und der Bewertung zu beobachten ist. (Löppenberg-Dressler) 28
30 29
31 Die Kriegsverhältnisse störten wie überall die ruhige Entwicklung der Schule. Herbst 1944 mußte sie geschlossen werden. Am 20. Juni 1945 berichtet die "Oberschule für Mädchen" in Leverkusen an den Oberpräsidenten des Rheinprovinz-Militärdistrikts, Kulturabteilung Gruppe III: Höhere Schulen: Das Schulgebäude und die einzelnen Klassenräume sind in den letzten Wochen durch die Arbeit der Schüler und Schülerinnen der beiden Oberschulen 30 wieder in einen benutzungsfähigen Zustand versetzt worden. Die noch ausstehende Fensterverglasung erfolgt voraussichtllich Anfang August. Von dem Inventar (Schreibtische, Schränke, Lehr- und Lernmittel) ist vieles noch in den letzten Wochen durch Einbruch zerstört, bzw. entwendet worden. Ein Unterrichtsbetrieb der Oberschule könnte sofort aufgenommen werden; Kochunterricht kann z.zt. nicht erteilt werden, da die Küche mit Einrichtung für ein Krankenhaus abgetrennt worden ist.
32 Zweitausendzweihundert Lichter Frau Dr. Astrid Gehlhoff-Claes (Abiturjahrgang 1946)... ist die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Dr. Heinrich Claes aus der Weimarer Zeit, der 1933 von den Nationalsozialisten amtsenthoben, 1945 von der englischen Besatzungsmacht als Stadtdirektor wieder nach Leverkusen geholt wurde, wo er den Wiederaufbau der Stadt entschlossen anpackte. Unsere ehemalige Schülerin, heute als Schriftstellerin in Düsseldorf ansässig, hat in einem literarisch geprägten Beitrag für unsere Festschrift die schicksalhaften Erfahrungen der Bürgermeister-Familie Claes beschrieben, verbunden mit den ganz persönlichen Erlebnissen der damaligen Oberprimanerin Astrid Claes, die den pädagogischen Stil, der ihr widerfahren ist, durchaus ambivalent beurteilt. Als Germanistik-Studierende in Köln hat Astrid Claes zu Beginn der 50er Jahre die erste Dissertation über die Lyrik Gottfried Benns erstellt. In diesem Kontext ist ein lebhafter Briefwechsel zwischen dem damals in seiner letzten Lebensphase befindlichen Dichter (Benn starb 1956, 70jährig) mit der jungen Literaturwissenschaftlerin entstanden, die selber auch Gedichte geschrieben hatte. Frau Dr. Astrid Gehlhoff-Claes, die inzwischen auf ein vielfältiges schriftstellerisches Werk zurückblicken kann, hat den folgenden Beitrag anlässlich unserer Feier geschrieben. In Leverkusen, damals Wiesdorf, wo mein Vater Dr. Heinrich Claes von 1921 bis 1933 Bürgermeister war, in einem Haus hinter dem Rathaus bin ich zur Welt gekommen. Wie sehr hat es mir einst gefallen, als ich noch ein Kind war! Wie herrlich fand ich den vier Morgen großen Park mit der Wiese in der Mitte, den Wegen ringsum, den rosa Magnolien, den Rhododendren und den weißen Fliederbüschen vor dem Tor. Das Paradies meines früheren Lebens. Aber als mein Vater 1945 sagte, "ich bin wieder Bürgermeister, das heißt jetzt Stadtdirektor, wir kehren nach Leverkusen zurück", dachte ich daran nicht. Das Paradies war zerstört, seit die drei Jungen des Nazi-Bürgermeisters Tödtmann 1933 unseren Park besetzt, uns Spieltiere und Sandkasten weggenommen und jeden Versuch, dahin zurückzukehren, uns mit Schlägen und Tritten verwehrt hatten. Wir lebten, vier Schwestern mit den Eltern, in den Dachzimmern, das Haus verschwand aus dem Blick. Das Haus verschwand aus dem Sinn in Köln, wo wir zwölf Jahre lebten, nach diesem Schluß. Und erst recht konnte ich, als mein Vater 1945 von der Schule sprach, in die wir kämen, mir keine Schule in Leverkusen vorstellen. Denn 1933, beim Abschied, war ich fünf Jahre. Es gab nur eins, was in mir aufleuchtete beim Wort von der Rückkehr; was einem Kind, das oft wach lag, die letzten Nächte in Leverkusen erhellt hatte; und was die Tage, die schweren Tage dieser zwölf Jahre erhellte, wenn ich dachte, es ist dageblieben, es ist da! Denn nie konnte in meiner Erinnerung der Augenblick verblassen, als ich es im Februar 1933 von meinem Bett aus zum ersten Mal sah: ein Kreuz, ein mit 2200 Glühbirnen durch die Dunkelheit strahlendes Kreuz, dessen Namen ich damals noch nicht lesen konnte; das ich "Trost" nannte, weil ich Wärme, Hoffnung, etwas weniger Schmerz in seinem Licht empfand. 31
33 Etwas weniger Schmerz in zwölf Jahren, die mein Vater, wenn ich aus der Schule kam, in seinem roten Sessel am Fenster saß und auf die Türme, die Kuppel von St. Gereon sah; von seinem geliebten Beruf, seiner Stadt Leverkusen getrennt, auf ein anderes Kreuz hoffte. Ich fühlte diese Hoffnung, ich empfand auch als Kind das große Leid. Nur so faßte ich, was von seiner Erklärung -daß er zum Zentrum, einer politischen Partei, gehörte, daß jetzt eine neue Partei, sie allein, regierte - für einen Kinderverstand schwer zu fassen war. Nur so war auszuhalten, daß er Tag für Tag immer da war und auf uns wartete, uns auf Schritt und Tritt kontrollierte, weil er darin eine Aufgabe fand. Und nur so sehe ich heute, was ich damals, das Leid ahnend, tat: daß ich jeden Morgen, wie er es wollte, vor der Schule mit meinem Vater in die Messe ging, daß ich vom ersten Schultag an beste Noten erstrebte; daß ich einsam schon vom dritten Schuljahr aufs Lyzeum wechselte, meine Freundinnen, meine Lehrerinnen und Lehrer, die ich liebte, verlor, - weil mein Vater es sich wünschte, weil es für meinen Vater eine Freude war. Als wir in die Lise-Meitner-Schule in Leverkusen kamen, war die Villa Hügel renoviert, der Umzug überstanden. Nur sechs Monate blieben meiner Schwester Dagmar und mir dort bis zum Abitur, und wir hatten Ängste. Wir hatten, tief eingestochen im Herzen, den Stachel der fast zweijährigen schullosen Zeit seit unserer Flucht aus dem zerbombten Köln Zwei Jahre war nur vom Krieg die Rede gewesen, nie vom Lernen; jetzt in der alten, neuen Heimatstadt nur vom Abitur. Wie sollten wir lernen, mit Schülerinnen Schritt halten, denen Lernen selbstverständlicher Alltag geblieben war; die, so sah es für uns Rückkehrer aus, im Flug des Geistes über den Katastrophen des Krieges schwebend, den Lehrplan erfüllt hatten? Wir haben gelernt. Wie der Stern in der Nacht, der Falter im morgendlichen Garten, so sind Geist und Lernlust nicht auszulöschen, nicht zu ersticken, - sie kehren zurück. Und sie wurden wahrgenommen und liebevoll aufgenommen von denen, die unser Schicksal kannten, von Mitschülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern. Im Deutschunterricht war ich schnell vorn; Frau Diederichs sagte später, als sie meinen ersten Gedichtband "Der Mannequin" sah, "das habe ich immer gewußt." Und in meinem schwachen Fach Mathematik gab es Lore Buchloh und Inge Heyl, zwei Zahlengenies - Lore wurde später Mathematiklehrerin, und Inge steht heute in der Frauenbewegung ganz vorn -, die mir Zettel mit Lösungen unter der Bank zuschoben, wenn mich Dr. Aschenborn zum Gaudium der Klasse aufrief. "Daß aus Ihnen doch noch etwas geworden ist", schrieb er, als ich mit der ersten Dissertation über die Lyrik Gottfried Benns promovierte. Aber Gottfried Benn, als ich ihm die Doktorarbeit geschickt und ein eigenes Gedicht beigelegt hatte, schrieb an mich: "Das ist ein richtiges, wunderbares Gedicht. Ich wollte, es wäre von mir...es ist fast zu schön, um aus Leverkusen zu stammen." In Leverkusen bestand ich im Frühjahr 1946 das Abitur. Meine Lehrerfreunde - Frau Diederichs in Deutsch, Frau Meier in Geschichte und Kunstgeschichte, Herr Röhrsheim in Englisch - taten sich zusammen, um wegen meiner sehr guten Noten in ihren Fächern das geplante "Ungenügend" in Mathematik zum "Ausreichend" zu mildern, weil ich sonst nicht hätte studieren können." Das Bayer-Kreuz konnte mir nicht helfen, es war gar nicht mehr da. Weil es im Krieg, der Zeit der Verdunkelung, wegen Bombengefahr abgeschafft worden war; zu meiner Bestürzung aber auch nach unserer Rückkehr nicht zurückkehrte. Und ich wagte wie immer nicht zu fragen warum, wenn mein Vater die hohen Herren der I. G. Farben im Rathaus empfing, wenn Herr Haberland ihn einlud. "Darum ist diese Stadt für meinen Beruf so gut, weil man in Zusammenarbeit mit einer erfolgreichen Firma viel verwirklichen kann", sagte mein Vater mir. Vom Bayer-Kreuz sprach er nicht. Aber als er, statt weiterarbeiten zu können wie sein Freund Konrad Adenauer, trotz der zwölf Jahre Berufsverbot mit 65 Jahren in den Ruhestand geschickt wurde; als er, trotz Benennung einer Straße mit seinem Namen, nach dem Leben in der Dienstvilla bis zum Tod in einer kleinen Wohnung saß; als ich mit dem neuen Leid, bei einem Besuch am Fenster über die äußere und innere Enge hinweg mit grenzenloser Sehnsucht für ein Gedicht einen Orangenbaum suchte, der draußen die Nacht mit dem Glanz seines weißen Blütenmeeres erfüllte, leuchtete jählings wieder das Bayer-Kreuz auf! Wie schön, jauchzte das Licht in meiner Seele, ein blühender Orangenbaum zu sein, der Mond, die hohe Sonne, das Himmelslicht für den Schmerz. Ich, einsam geprägt von der Kindheit, der Trennung, ich war zu Haus. Und wenn ich später bei meinen schriftstellerischen Arbeit, bei den Lesungen in den Gefängnissen des Landes, bei Krankheiten die Schmerzbefreiung, die so verschiedenen heilenden Wirkungen von Aspirin kennenlernte; wenn Dunklheit sich über mein Leben senkte irgendwo, - welch poetische Macht erlangte da immer bei meinen Besuchen der Anblick des großen Lichts, die Erinnerung an das als Kind schon Gekannte Lichter, es ist ein Zauber in Gold, der den Ort in Bann hält, mein Leben. 32
34 Die Nachkriegszeit 33
35 Von der Oberschule für Mädchen zum Mädchen-Gymnasium Die Genehmigung der Wiedereröffnung durch die englische Militärbehörde vom verweist in den verstreuten Unterrichtsorten auf die verlorene Identität der Schule. Sie wird in der Carl-Duisberg-Schule, dem Evangelischen Gemeindehaus Wiesdorf und in der Evangelischen Volksschule Wiesdorf untergebracht. 34
36 35
37 Das evangelische Gemeindehaus Auch die strukturelle Identität der Schule war erst am Anfang eines Entwicklungsweges, der bis heute bei weitem noch nicht zum Stillstand gekommen zu sein scheint. Die Oberschule für Mädchen als zweizügige Vollanstalt wurde als neusprachliche Studienanstalt eröffnet, seit 1950 wurde sie "Mädchengymnasium" genannt. Gleichzeitig war sie in der 3. bis 6. Klasse ein Lyzeum mit Frauenoberschule (mit drei Klassen), die seit 1950 nur "Frauenoberschule" genannt wurde. Am feierte eine bereits wieder funktionierende Schulgemeinde ihr 25-jähriges Jubiläum. 36
38 Es sollte aber noch 12 Jahre dauern, bis 1960 mit der Fertigstellung des ersten Gebäudetrakts die Schule erstmals ihr eigenes "Zuhause" fand, was aber immer noch nicht zu innerer Ruhe und räumlicher Konzentration führte, im Gegenteil. Es kam zu zeitweisen Auslagerungen in die Berufschule Bismarckstraße, die Evangelische Volksschule Scharnhorststraße, in das Forum, in die Adolf- Reichwein-Schule, Alkenrath, sowie in acht Montageklassen erweiterte sich die innere Gliederung der Schule um die zusätzliche Einrichtung eines sozialwissenschaftlichen Zweiges, der auf Initiative der damaligen Direktorin Dr. Charlotte Niederhommert zustande kam, die damit ihre Vorstellungen von moderner Mädchenbildung weiter verwirklichen konnte. Dieser Zweig war seit 1956 lediglich an neun Schulen in NRW erprobt worden. 37
39 Schulleiterin Charlotte Niederhommert Das Kollegium Ostern
40 Die Einführung der Koedukation Das Schuljahr 1968/69 markiert in der Entwicklung der Schule in doppelter Weise einen Meilenstein, von dem sich die Merkmale ihrer weiteren Entwicklung ableiten: Es ist einerseits die Genehmigung des Kultusministers zur Einführung der Koedukation, zunächst nur für den neusprachlichen Zweig. So beginnen 41 Mädchen und ein Junge ihre Schullaufbahn. Die wohl heute kaum mehr nachvollziehbaren Erfahrungen in dieser Zeit stellen sich im Rückblick Christian Bügels folgendermaßen dar. von Christian Bügel, Abitur1980 Daß ausgerechnet ein ehemaliger Cedist - und dazu noch einer der Rabauken - eine Laudatio auf das "Lise Meitner" schreibt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, ist vielleicht aber auch eine kleine Genugtuung für diejenigen, an denen die Schließung "ihres CD" nicht spurlos vorbeigegangen ist. Natürlich waren beide Schulen während ihrer gemeinsamen Zeit durch vielfältige Beziehungen miteinander verbunden. Zum einen, das behaupten zumindest die von Generation zu Generation weitererzählten Legenden der Cedisten, war das Carl-Duisberg-Gymnasium die "Mutter aller Gymnasien" in Leverkusen. Zum anderen gab es in den Unterrichtspausen regelmäßig Pilgerströme, die zwischen beiden Schulen hin- und hergingen. Manchmal waren es die Lernenden, die in der anderen Schule unterrichtet wurden, manchmal die Liebenden, die ebenfalls Neues erkunden wollten. Trotz aller Anknüpfungspunkte waren beide Schulen zwei in sich geschlossene Welten, die eigene Kulturen und Verhaltensmuster entwickelt hatten und sie auch pflegten. Als ich 1978 auf das Lise-Meitner-Gymnasium kam, war mit dieser Umstand allerdings sehr egal. Diese Schule war - nach meinem Abgang aus dem CD- Gymnasium - meine einzige Chance auf dem direkten Weg zum Abitur zu gelangen. Nach dem rüden "männlichen" Schulalltag bei den Cedisten war der Wechsel in das ehemalige Mädchengymnasium vorerst wie der unmittelbare Einzug ins Paradies. Vom penetranten Sturmschellen nach jeder Unterrichtseinheit ging es nun zum huldvollen, entspannenden Pausengong. Nach Rauferein und "Männergesprächen" folgte nun der Pausenplausch im Raucherraum oder in der Teestube - umgeben von unzähligen Mitschülerinnen. Von baulichen Mißständen und Schließungsängsten war in meiner neuen schulischen Heimat nicht mehr die Rede. Alles in allem verlebte ich bis zu meinem Abitur im Mai 1980 eine sehr harmonische, fröhliche und eher ruhige Schulzeit. Es gefiel mir so gut, daß ich nach meinem Abitur sogar noch ein weiteres Jahr als Medientutor dranhängte. Für alle Ahnungslosen: In der Zeit des großen Wohlstandes gab es an ausgewählten Schulen des Landes die nach BAT bezahlte Funktion des Medientutors. Interessierte Abiturienten konnten sich für diese Stelle bewerben und übernahmen die Aufgabe, den gesamten Medienbereich der Schule zu betreuen. Vielleicht sind mir auch deshalb einige Lehrer in besonderer Erinnerung geblieben: Dahlmann, Benkenstein, Deneke, Schriek, Keller, Geylenberg, König, Müller, Kuckelberg und viele andere. Jeder von Ihnen hat eine eigene Geschichte: Auch der Hausmeister - Herr Holz - mit seinem Schäferhund. Der damalige Direktor der Schule, Herr Dahlmann, liebte es, Bekanntmachungen über die allgegenwärtige Lautsprecheranlage direkt unter Volk zu bringen. Sei es durch die mangelhafte Qualität der Anlage oder 39
41 die ungenaue Aussprache - nicht immer waren seine Botschaften eindeutig zu verstehen. Sehr zu Freude der Zuhörer titulierte er mich doch einmal nicht als Medientutor sondern als Mädchentutor - hörbar für alle über die Anlage. Gab es damals nicht einen stellvertretenden Schulleiter, der sich beharrlich weigerte, seine Stundenpläne mit EDV-Unterstützung zu erstellen? Zog der nicht Lochkarten mit einer Stricknadel aus einem großen Kasten (und trotzdem haben wir unser Abitur bekommen)? Und wie heiß der Physiklehrer, der die Theater AG leitet? Richtig, Windmann. Das letzte Jahr seiner Laufbahn soll er mit einem Maßband die Tage gezählt haben, die er noch zu unterrichten hatte. Dann war da noch der lange Englischlehrer Ostermann, der sich morgens elegant aus seinem gelben Sportwagen schälte. Oder Physiklehrer Schäfer, der analog zum legendären "da stelle mer uns ma janz blöd" immer wieder verlangte: "dat müssen Se sich plausibel machen". Den einen oder anderen hat man wiedergetroffen - Horst Thelen beispielsweise zufällig in Köln einem ESCOM-Laden. Immer noch so "durch den Wind" wie früher. Neben den kleinen und großen Geschichten sind auch andere Dinge haften geblieben. Die Schule war zu meiner Zeit politisch und politisierend. Pershing- Stationierung, Brokdorf und Friedensbewegung wurden jeden Tag ausführlich diskutiert. Auch die reformierte Oberstufe - so hieß sie wohl - war häufiger Stein des Anstoßes. Kursauswahl und Punktesystem waren in jedem Schülerkopf fest verankert. Wir wußten immer ganz genau, welche Fächer abiturrelevant waren, welche mit den anderen kompatibel sein konnten und wie wir den punktemäßig effektivsten Weg zum Abitur wählen konnten. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Das Beste am Rückblick: Drei Jungs und sechzig Mädchen waren wir in einer Stufe. Unvorstellbar schön muß das gewesen sein. Morgens in den Unterrichtsraum kommen und von hübschen Geschöpfen umringt sein. Okay, die meisten war zeitweise in festen Händen. Aber die Atmosphäre... Meine zwei Mitstreiter Achim Stautz und Manfred Konopka gingen - wenn ich mich recht erinnere - genauso wie ich relativ unbefangen mit diesem Überangebot an Weiblichkeit um. Gelegentlich hatten wir wahrscheinlich die Funktion von Katalysatoren, die zur Klärung der Luft beitragen konnten. Und dann gab's da noch zwei Klassenfahrten - die eine, unbedeutende, nach Maria Laach (das war wie das Officium für uns Matura-Anwärter), die andere, legendäre nach Prag. Wieder mit drei Jungs und sechzig Mädchen unterwegs in die Hauptstadt der Tschechoslowakei. Mit an Bord als Reiseleitung: Frau Knöfel, Herr Benkenstein und Herr Schäfer. Schon im Zug mußten wir unsere Mädels gegenüber mitreisenden Schülergruppen verteidigen (Gott sei Dank, kam der Literatur-Verweis auf Konsalik durch einen baggernden Abteilnachbarn bei den Unsrigen nicht wirklich gut an). Dann drei oder vier wunderschöne Tage an der Moldau. Die Besuche der Altstadt, das historische Rathaus, der Hradschin, das goldene Gäßchen und auch eine Fahrt nach Theresienstadt sind mir deutlich in Erinnerung geblieben. Die fast freundschaftliche Beziehung zwischen Lehrern und Schülern prägte diese Tage ebenso wie die gemeinsame Freude an den Erlebnissen. Das eine oder andere tschechische Bier hatte möglicherweise auch einen nicht unerheblichen Anteil daran. Das besondere Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern hat die Lise-Meitner-Schule in hohem Maße geprägt. Rügen oder Tadel zur Disziplinierung der Schüler wie sie an der CD-Schule an der Tagesordnung waren, war nicht vorgesehen. Das "Lise Meitner" hat - wenn es dies überhaupt gibt - das weibliche Element der Bildung verkörpert. Nicht nur wegen Vergangenheit als Mädchenschule oder dem überwiegenden Geschlecht der Eleven. Die Späße waren nie so derb wie an anderen Schulen, der Umgangston wahrscheinlich etwas weniger rauh. Auch hat der Name der Schule immer impliziert, daß Frauen mindestens genauso begabt und zu exzellenten Leistungen fähig sind wie Männer. Ein Umstand, auf den man tatsächlich immer wieder hinweisen muß. Warum ausgerechnet beim Abiturjahrgang 1980 ein Junge die Abiturrede hielt, ist auf diesem Hintergrund eher schwer erklärlich. Vielleicht lag es an dem seltenen Vorkommen dieser Spezies in dieser Stufe; vielleicht war es die Ahnung, daß einer der drei Jungs der erste männliche Absolvent des Abiturs an der Lise-Meitner-Schule war. Auszuschließen ist die Vermutung, daß bei wichtigen Anlässen häufig Cedisten gefragt sind. 40
42 Nicht nur die Wiese ist verschwunden Im Sommer 1968 wurde am Lise-Meitner-Gymnasium zum ersten Mal von den Abiturientinnen der heute übliche Abitur-Streich gefeiert. Auf dem Bild sind unsere ehemalige Schülerin Ingeborg Runkel und ihr damaliger Freund und heutiger Ehemann Gerhard Schwenke zu erkennen, der mittlerweile Lehrer an unserer Schule ist. Das "Opfer" dieses Badespaßes ist unsere ehemalige Kollegin Amelie Deneke. Zwei Tage mit den Lehrern von damals von Ingeborg Schwenke-Runkel Fünfzehn Jahre nach dem Abitur noch einmal die Schulbank der alten Penne gedrückt, die nicht mehr die alte ist. Erste und zweite Stunde: Deutsch; dritte Stunde: frei; vierte Stunde: Musik; fünfte und sechste Stunde: Französisch: Ein Bilderbuchstundenplan - mit zwei Hauptfächern und einem Nebenfach. Fast wie damals, mit denselben Lehrern an derselben Schule. Mit dem einen Unterschied: Freistunden für Schüler, die gab's damals, vor 15 Jahren, noch nicht. Zwei 41
43 Vormittage lang drücke ich nun wieder die Schulbank im Lise-Meitner-Gymnasium, nehme am Unterricht mit "meinem" alten Lehrern teil. Doch ist das noch meine Schule? Was zieht mich - ehemalige Schülerin des LMG, Abi 1968, Mutter einer gerade schulpflichtig gewordenen Tochter, Ehefrau eines Lehrers, selbst Lehrerin a. D. an die Schule zurück? Pure Neugier, die Hoffnung auf einen griffigen Stoff, die Suche nach der verlorenen Jugendzeit? Vielleicht alles Zusammen? Der Schulweg ist mir vertraut. Trotz der Verschiebung der Perspektiven, im Straßenbild und auch bei mir selbst. Den Drahtesel habe ich mit dem Auto vertauscht, statt an der Unterführung Schlebusch warte ich in der Schlange vor der nächsten Ampel. Schüler in Zweier- und Dreierfahrradreihen zwingen zum Langsamfahren. Der Parkplatz ist fast besetzt. Die ehemals grüne Wiese an der Straße mußte der Zeit ihren Tribut zollen. Zwei mächtige Kastanien haben überlebt. Der Eingang gleich neben dem bunten Meistermann-Fenster im Hauptgebäude ist neu für mich. 42
44 Hektik: Schüler strömen von allen Seiten, Lehrer nähern sich hurtigen Schritts. Die Jungen irritieren mich: "Städtisches Mädchengymnasium" steht auf meinem Abiturzeugnis. Schüler männlichen Geschlechts waren nur zu Feten zugelassen, im Jazz- Keller. Er ist stillgelegt. Stühle stapeln sich darin. Erste und zweite Stunde: Deutsch bei meinem Klassenlehrer der letzten beiden Schuljahre. Es war seine erste Klasse, sein erstes Abitur. Das verbindet. Auch über 15 Jahre hinweg, in denen wir uns nicht gesehen haben. Grundkurs in einer 12. Klasse. Mit dem Gongschlag stehen acht Schüler und Schülerinnen vor der Türe. Vier weitere trudeln in den ersten Unterrichtsminuten ein, die restlichen vier spielen Tennis. Ein Schulturnier steht an. Stundenthema: "Das Brot" von Wolfgang Borchert, für die Zwölftklässler ein harter Brocken. Erst in der zweiten Stunde lebt die Diskussion auf, als es um die Allgemeingültigkeit der Textausgabe geht. Wehmütige Erinnerung meines Klassenlehrers: "Wissen Sie noch, als wir den Nathan gelesen haben" Als Religions- und Philosophielehrer mithelfen mußten, Lessing theologisches Fundament der Ring-Parabel zu lösen?" Mir schwant es, dunkel. Unsere Abschlußfahrt ist mir viel gegenwärtiger. In den Schul-Annalen sind wir die "Rom-Klasse". Das "Allerheiligste" Dritte Stunde: frei. Gelegenheit zu kurzen Gesprächen. In den Pausen sind sie unmöglich. Das Lehrerzimmer habe ich früher nie von innen gesehen. Das "Allerheiligste" war tabu. Nun stehe ich mittendrin. Es sei erweitert worden, verschönert, überhaupt sei alles ganz anders als früher. Die einschneidenste Veränderung im Schulalltag brachte die Oberstufenreform. "Weniger für uns, als vielmehr für die Schüler", sagt ein Lehrer. Den Klassenverband gibt es ab Jahrgangsstufe 11 seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr. Klassenlehrer auch nicht. Fachgebundene Kursgruppen, von den Pennälern selbst gewählt, ersetzen die alte Klasse. Im Gespräch fehlt mir die liebgewonnene Alltagspoesie: Untertertia, Obersekunda, Oberprima. Wer kann mit diesen altmodischen Klassenbezeichnungen noch etwas anfangen? Klassen 9, 11 oder 13? Das klingt handfest, sachlich, entspricht der nüchternen Gebäudeatmosphäre. Bilderhaken an den Flurgängen zeugen von vergangenen Farbigkeit. In meiner Erinnerung ist die Schule bunter, trotz fehlender Manns-Bilder. Neubau aus der Expansionszeit, mit pädagogischem Zentrum und verschiedenen Klassenräumen. 6. Klasse: Eine quirliges Schülerknäuel wirbelt herein. Zwei Nachwuchspianisten hämmern Richard Clayderman. Dann folgt in raschem Tempowechsel der Unterrichtsstoff. Wir singen "All I want is an room somewhere" aus "My fair Lady". Die Jungenreihe vor mir hält sich die Ohren zu. Dann ein Rhythmus-Diktat. Mein Vordermann schreibt mit dem gleichen Kugelschreiber wie ich, das ist für ihn weit aufregender als Vierviertel- und Sechsachtel- Takte. Ein Musikrätsel folgt. Ein Zettelchen fliegt von vorne nach hinten, der Inhalt von Filzstiften wird mit Papierschnipseln vertauscht. Eine Unterstufenklasse, wie sie leibt und lebt. Mein Musiklehrer trägt's mit Gelassenheit, führt agil durch die Stunde. Den Schülern macht's Spaß, mir auch, eine Verjüngungskur. Fünfte und sechste Stunde: Französisch, Leistungskurs in der Oberstufe, elfte Klasse. Ruhe und Gelassenheit ringsherum. Der Text, eine Erzählung aus den "Histories" von Le Clézio wird nach bewährtem Muster erarbeitet. Lesen, Vokabeln erklären, darüber reden, nach Möglichkeit in der Originalsprache. Mein Herz klopft, als ich lesen soll, ich verhaspele mich, spüre das Griemeln, doch dann geht es ganz gut. "Hatten Sie auch Französisch als Leistungskurs?" fragt mich meine Nachbarin. Großes Erstaunen als ich erkläre, daß meine Schülergeneration noch nichts zu wählen hatte, daß es keine Kurse gab, man nicht wußte, in welchem Abiturfach man "drankkam". Ich muß ihr vorkommen wie ein Fossil aus schulischen Urzeiten. Mein Blick sucht farbige Lettern auf dem Schulhof: "Make Love not school" von unserer Abiturienta mit wasserfester Farbe gepinselt, war für die Ewigkeit bestimmt. Sie sind weg. Nein, tauschen möchte ich mit den heutigen Schülern nicht, Zukunftsängste, Sorgen um den Arbeitsplatz, numerus clausus, das waren unbekannte Vokabeln. Meine Schule? Noch! Aber in zwanzig Jahren würde mich niemand kennen, kein "alter" Lehrer würde mehr da sein, dann wär's meine Schule nicht mehr. (aus dem Kölner-Stadt-Anzeiger vom 11. Juni 1983) Rascher Tempowechsel Vierte Stunde: Ich suche den Musiksaal 2. Der Weg führt in einen Trakt, der mir unbekannt ist: ein 43
45 44
46 Die neue Epoche beginnt 45
47 Lise Meitner - Ein Name der verpflichtet Nach langer Diskussion in der Öffentlichkeit findet die Schule auf eigenen Vorschlag hin zu ihrer heutigen Namensidentität und "adoptiert" damit eine bestimmtes Leitbild für ihr Selbstverständnis und die weitere Entwicklung. Im Februar 1969, wenige Monate nach dem Tod von Lise-Meitner im Oktober 1968, wurde das "städt. neusprachliche und sozialwissenschaftliche Mädchengymnasium mit Gymnasium für Frauenbildung" umbenannt in: LISE-MEITNER-GYMNASIUM, Neusprachliches Gymnasium für Jungen und Mädchen mit sozialwissenschaftlichem Gymnasium für Mädchen mit Gymnasium für Frauenbildung. Der Protest einiger ehemaliger Schülerinnen noch zwei Monate später gegen diese Namensnennung ist kaum noch zu verstehen. Was vorausgegangen war, kann man an Hand von Zeitungsausschnitten - im Stadtarchiv einsehbar - versuchen nachzuvollziehen. Zwei Jahre zuvor hatte die damalige SMV ihr Schülervotum für Heinrich Heine, Thomas Mann und Bertolt Brecht abgegeben. Danach war bis zum Jahr 1969 von einer Namensgebung keine Rede. Mit Beginn der Koedukation an der Schule wurde sie erst wieder akut. Die Lehrerschaft sprach sich für Meitner- Hahn-Gymnasium aus. Die Parteien einigten sich auf Lise-Meitner-Gymnasium, einen Vorschlag der SPD, dem sich der Schulausschuß anschloß. Am 10. Februar wurde die Namensgebung vom Rat der Stadt beschlossen. Zu dem anschließenden Protest der Ehemaligen muß gesagt werden, daß zwei Jahre vorher, also zu Lebzeiten der Physikerin Lise Meitner, diese als Namensgeberin nicht in Frage kommen konnte; denn es wäre ungewöhnlich, den Namen einer lebenden Persönlichkeit zu wählen. Was tun wir, die Kolleginnen und Kollegen, die an der Lise-Meitner-Schule das Fach Physik vertreten, um dem Namen gerecht zu werden? Im Zentrum steht natürlich der Physikunterricht: Seit acht Jahren in Folge gibt es auch in Physik, wie in den anderen Naturwissenschaften, Leistungskurse an der Lise- Meitner-Schule. Die Chance, in der Schule über eine Galerie "Lise" zu verfügen, wurde genutzt: Eine "Lise-Meitner"-Ausstellung 1992 sollte auf diese hervorragende Frau aufmerksam machen, die ihr Leben so charakterisiert: "Das Leben muß nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist." In einer weiteren Austellung "Beruf Physikerin - Der verleugnete Anteil der Frauen in der Physik von der Antike bis zur Neuzeit" 1995 wurden weitgehend unbekannte Naturwissenschaftlerinnen vorgestellt. Die Ausstellung "Die Brille" 1997 bot Anschauliches auch für Jüngere. Seit 1991 gibt es für naturwissenschaftlich begabte Schüler und Schülerinnen ein Stipendium aus der Carl-Duisberg-Stiftung: Eine Gruppe von ca. zehn Schülerinnen und Schülern der Stufen 12/13 fährt nach München, um sich dort fünf Tage im Deutschen Museum aufzuhalten. Ausgezeichnete Erfahrungsberichte werden prämiert. So auch ein Bericht eines Schülers zum Thema: "Der Ehrensaal des Deutschen Museums", hierin ging er auch der Frage nach: Wie die Büste der Österreicherin Lise Meitner in den Ehrensaal des Deutschen Museums kam. (Edda Mehne) 46
48 Kölnische Rundschau, 24. Januar 1969 Neue Rhein-Zeitung, 6. Februar
49 48
50 Innere Reformen Mit der Einführung des neuen Schulleiters, Horst Dahlmann, begann für das Lise-Meitner-Gymnasium eine prägende Phase innerer Reformen und äußerer Weiterentwicklung. Horst Dahlmann, 1926 in Danzig geboren und 1994 verstorben, studierte Pädagogik und Psychologie, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Durch seine Mitarbeit in den Richtlinienausschüssen des Kultusministers für das Fach Gesellschaftswissenschaften und für das neue Fach Politische Bildung war er mit neuen curricularen Entwicklungen vertraut und konnte so richtungsweisend für die Weiterentwicklung der Schule werden. Entscheidungsstrukturen und -abläufe erhielten unter ihm eine neue Akzentuierung, so wurde der Lehrerrat, ein aus fünf vom Kollegium gewählten Vetretern bestehendes Gremium, ein wichtiger Ansprechpartner des Schulleiters. Mit ihm stand er in ständigem Gedankenaustausch, beriet mit ihm aktuellle Probleme vor, klärte mit ihm Vorschläge und Einsprüche. Es wurden gemeinsame Entscheidungen getroffen, falls diese nicht eines Konferenzbeschlusses bedurften. Die enttypisierte Mittelstufe Nach der bis dahin geltenden Gliederung der Gymnasialtypen mußte die Entscheidung für einen bestimmten Typ (z.b. neusprachlich, solzialwissenschaftlich) schon zu Beginn der 7. Klasse getroffen werden. Dies brachte Eltern, Schüler und Lehrer in große Not, war eine besondere Eignung und Neigung doch häufog noch nicht ausgeprägt. Das Kollegium des Lise-Meitner-Gymnasiums entwickelte schon noch bevor es allgemeine gesetzliche Regelung wurde- ein Modell der enttypisierten Mittelstufe für die Klassenstufen 9 und 10. Für alle SchülerInnen wurde neben dem verbindlichen, einheitlichen Pflichtbereich ein vierstündiger Wahlbereich eingeführt. Das Wahlangebot umfaßt als vierstündige Veranstaltungen -und nur in Klasse 9 neu wählbar- als 3. Fremdsprache Französisch oder Latein, in unserer Schule auch Russisch. Als zweistündige Kurse konnten angeboten werden Aufbaukurse in Mathematik, Französisch, Erdkunde, Religion, Hauswirtschaftslehre, Textiles Gestalten und Werken. Unsere Schule war die erste in Leverkusen, die dabei das Fach Politik erprobend einführte und damit eine generelle Entwicklung in NRW für das Schuljahr 1973/74 mit vorbereitete. "Die differenzierte gymnasiale Mittelstufe ist zunächst unter dem Gesichtspunkt konzipiert, den Schüler auf die Wahlmöglichkeiten der differenzierten gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II vozubereiten. Wenn der Schüler von Beginn der Klasse 11 an in einem gewissen Rahmen Gelegenheit gegeben werden soll, seine Schullaufbahn seiner Neigung, Begabungsrichtung und Leistungsdisposition zu bestimmen, so ist es erforderlich, daß man ihn zuvor wahlfähig macht,..." (Girgensohn, Vortwort zu Empfehlungen) 49
51 Konsequenterweise änderte sich nun der "Familienname" des Lise -Meitner-Gymnasiums: Mit Beginn des Schuljahres 1972/73 wurde aus dem neusprachlichen Gymnasium für Jungen und Mädchen, dem sozialwissenschaftlichen Mädchengymnasium und Gymnasium für Frauenbildung das neusprachliche, sozialwissenschaftliche und erziehungswissenschaftliche Gymnasium für Jungen und Mädchen. In diesem Jahr wird die ganze Dynamik von Tradition und Reform deutlich. Zum Zeitpunkt der Gewinnung einer neuen Identität feiert die Schulgemeinde der "50jährigen Dame Lise Meitner" quicklebendig und traditionsbewußt 1973 ihren ersten und fünfzigsten Geburtstag So stellt Oberstudiendirektor Dahlmann in seiner Festrede starke Mobilität und starke Dynamik als Charakteristika der Chronik des Lise-Meitner- Gymnasiums dar. Mobil insofern, als das beständige Wachstum die Raumnot bereits zu einem typischen Zug der Schule hätte werden lassen, und dynamisch deshalb, weil in der Umstellung auf neue Bildungsanforderungen diese Schule immer an der Spitze gelegen habe. Auf Beschluß der Gesamtkonferenz schloss sich die Schule bereits im Schuljahr 1973/74 der Neugestaltung der Oberstufe an. Das Lise-Meitner- Gymnasium war damit schon ein Jahr vor dem offiziellen Termin für den Beginn der Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in die zweite Versuchsphase eingetreten und hatte die Möglichkeit, die bereits erfolgte Differenzierung der Mittelstufe sinnvoll in die Differenzierung der Oberstufe einmünden zu lassen. Unser Oberstufenkoordinator, Herr Dieter Keller, der diesen Bereich auch heute noch verantwortlich gestaltet, erläuterte in der Chronik zum 50jährigen Bestehen die Neuerung folgendermaßen: "Die neue Oberstufe ist nicht mehr an Gymnasialtypen gebunden, sie ist "enttypisiert". Sie differenziert nach Begabungsrichtung und Interessen der Schüler, die durch Fächerwahl ihre Schullaufbahen nach individuellen Stundenplänen in bestimmtem Umfang selbst bestimmen können. Merkmale der Struktur der neuen Oberstufe sind neben der Enttypisierung das Gleichgewicht aller Fächer hinsichtlich der Stundenzahl und der Möglichkeit, Fach der schriftlichen Reifeprüfung zu werden. Damit verbunden ist die Einführung eine Kurssystems von Grund- und Leistungskursen, die Ablösung der Klassen als Organisationseinheit durch Kursgruppen, die Umsetzung der Lerninhaltein diesem Kurssystem und eine Leistungsbeurteilung durch ein Punktesystem in den Stufen 12 und 13." Das Kollegium in den Siebzigern 50
52 Äußere Differenzierung Der vorherigen inneren Erneuerung musste eine äußere Erweiterung und Differenzierung folgen. Bereits im Februar 1971 hatte der Regierungspräsident den Erweiterungsbau genehmigt, aber erst im April 1975 rückten die ersten Bagger und Arbeiter an. Mittelpunkt des Neubaus ist das Pädagogische Zentrum mit über 400 Plätzen, dazu kamen 17 Klassenräume und 10 Fachräume, so für Musik, Kunst und Werken, textiles Gestalten, Fotografie, mit Sprachlabor und Medienräumen für Erdkunde und Geschichte. Da man 1958 auch schon auf eine Grundsteinlegung verzichtet hatte, mauerte man die Steine mit den Gravierungen 1958 und 1975 einträchtig nebeneinander Am damals vermeintlich endgültigen Ausbau des Lise-Meitner-Gymnasiums fehlte noch der Umbau des alten Gebäudes sowie die Errichtung einer Sporthalle. Studiendirektor Günther Weps Rede anläßlich der Neubauübergabe am Lise-Meitner-Gymnasium (Günther Weps) Unsere Schule platzte aus der Naht. Wir suchten Hilfe mit Rat und Tat Und wandten uns an den Senat. Die Antwort gab uns bald die Stadt Wir hab n noch Platz in Alkenrath! Und mancher sedate Studienrat Ging ganz empört zum Lehrerrat Und sagt Ich wende mich ans Dezernat, Das ist auf uns ein Attentat! Eine Zumutung, das ist Alkenrath! Nichts half uns wider der Stadt Mandat. Getreu und gehorsam wie ein Soldat Fanden wir uns ab mit dem resultat Und schickten uns re junge Saat ins desolate Alkenrath. 51
53 Man fuhr mit Opel, Fiat, VW-Passat, Andre gelangten mit ihrem Rad Auf viel verschlung nen Trampelpfad Flink und geschickt wie n Akrobat Ganz schweißbedeckt nach Alkenrath. Oft war es eine Heldentat, Nachrichten zu bringen ins Externat. Zu spät kam jedes Inserat So rief ganz laut Frau Scheedrath Fährt jemand noch nach Alkenrath? So lebten die Kleinsten im reservat lernten Englisch, mathe und schrieben manchmal ein Diktat, Übten im Sport auch eifrig Spagat, Verbrachten auch manche Übeltat, so ganz allein in Alkenrath. doch eines Tages kam ein Triumvirat. Ein Geländeteil wurde umgeben mit maschendraht. Man konnt erblicken ein groß Konzentrat Von Baggern, raupen und Kränen mit Aggregat. Vorbei ist s bald mit Alkenrath. Bald wuchs empor ein Konglomerat Bei Temperaturen von weit über 30 Grad. Wir erhielten Baupläne als Duplikat, Hingen sie auf wie ein Plakat. Gezählt waren die Tage in Alkenrath. Die weitere Arbeit lief ab wie ein Automat. Drum ist heut noch nicht alles ganz parat. Und dennoch danken wir dem noblen Rat. Und alles jubelnd laut hurrat Vorbei, du Alptraum, Alkenrath! So höret noch unser feierlich Deklarat: Wären die Wände dort aus Gold von 20 Karat, Lägen dort Teppiche umrahmt von feinstem Brokat Und erstrahlte auch alles im herrlichsten Ornat: Nie wieder mehr nach Alkenrath! Beendet sei damit mein Refarat, Genügend beleuchtet die Moritat. Drum laßt uns schließen ein Konkordat Und vergessen all uns re Sorgen zum Quadrat: Kein Wort mehr über Alkenrath! Zur Verfügung gestellt von Herrn Studiendirektor Günther Weps (hoch lebe unser Dichter) 52
54 Der Endausbau Am Samstag, dem war es dann soweit. Nach 15monatiger Bauzeit konnte die Schule ihren Endausbau feiern. Oberbürgermeister Obladen war in seiner Festrede jedoch skeptisch: Ob das nun tatsächlich die letzte Station im Schulbau des Lise- Meitner-Gymnasiums sei, das müsse sich erst noch zeigen. Der neue Grundriss Physikunterricht bei Frau Mehne in den neuen Räumen 53
55 Und wiederum fällt ein historischer Termin, der die Tradition der Schule begründet, mit einem aktuellen Termin zusammen, der Innovationen und Möglichkeiten für die Zukunft beinhaltet. Lise Meitner hätte zum Zeitpunkt der Einweihung ihr 100. Lebensjahr vollendet. 54
56 Das Kollegium
57 Ich bin ein Hügel Auszug aus: Friederike Kretzens Roman: Ich bin ein Hügel erschienen im August 1998 Friederike Kretzen, geboren in Leverkusen, Abitur 1975 am Lise-Meitner- Gymnasium, studierte zunächst Soziologie und Ethnologie an der Universität Gießen und begann nebenbei eine Theatergruppe aufzubauen - für die sie auch Texte schrieb. Nach dem Studienabschluß (Diplom-Soziologin) arbeitete sie zunächst als Regieassistentin am Stadttheater Gießen, später als Dramaturgin am Bayerischen Staatstheater in München. Seit 1983 lebt sie als freie Schriftstellerin in Basel "im Exil" (dessen Nähe und Distanz zu Deutschland sie als ideal empfindet). Als Schriftstellerin ist sie Mitglied einer Runde, die regelmäßig Literatur im DRS - dem deutschsprachigen Rundfunk in der Schweiz - bespricht. Gelegentlich nimmt sie Lehraufträge an einer Zürcher Hochschule wahr. Ihr erster Roman "Die Souffleuse" - Teil einer Trilogie zum Thema "Frauen ohne Männer" - (erschienen im Verlag Nagel & Kimche, Zürich/ Frauenfeld 1989) wurde auf den Solothurner Literaturtagen als literarische Entdeckung gefeiert und mit dem neu geschaffenen Literaturpreis des Migros-Genossenschaftsbundes ausgezeichnet. In dem Roman Indiander (1996)schildert sie die Geschichte einer/ ihrer Kindheit in Leverkusen. Schreck heißt unser Mathematiklehrer. Im Krieg war er Offizier. Und offizierisch bringt er uns die Mathematik bei. Er hat noch beide Arme. Verächtlich zieht er die Luft durch die Nase ein. Dünne Luft, sagt er, weil wir nichts im Kopf haben. Hoffentlich aber in den Beinen, schreit er. Wir antworten: Jawohl, Herr Schreck. Unsere Redeweise vom: Schreck lass nach, ist fromm und nutzlos. Wir haben einen Lehrkräftemangel und eine Lernschwäche gleichzeitig. Unser Gymnasium ist eine höhere Schule für Frauenbildung. Französisch, Kochen, Fechten und Handarbeit sind wichtige Fächer und kaum zu unterscheiden. Ältere Damen sitzen am Pult und fuchteln mit ihren Armen im Takt, der die Fächer unterscheidet. Im Fechtunterricht tragen wir Lederwesten, auf denen das Herz links angenäht ist und als Zielpunkt für die Florettspitze dient. Ich zum Beispiel muss jedesmal weinen, wenn ich treffe. Schon ruft die Lehrerin, seien Sie nicht so hysterisch. Und fällt gegen mich aus und sticht auf mein Stoffherz ein. Alle drei Wochen können wir eine Woche pausieren vom Sportunterricht. Sie kontrolliert die Daten in unseren kleinen Sportheftchen, die wir ihr hinhalten müssen wie früher die Hände mit den schmutzigen Nägeln. Wir müssen die ganze Sportstunde auf einer der niedrigen Bänke sitzen und zugucken. Was ist der Mann, fragen wir unsere jugoslawische Biologielehrerin. Und sie sagt, in ihrem gebrochenen Deutsch: Lass Finger weg von, und dass wir von Spucke Kinder kriegen. Unsere Hauswirtschaftslehrerin schäumt. So gut es geht, versucht sie den Schaum, der sich beim Sprechen bildet, wieder hinunterzuschlucken. Doch in den Mundwinkeln bleibt stets ein verdickter Rest zurück. Ich muss an Schaumkronen denken, an Wellen und kann mir 56
58 nicht vorstellen, wo das Meer in ihr ist. Wenn sie von Weinschaumcreme, schwimmenden Inseln, Biskuitrollen und Kohlehydraten und nicht von Fisch redet. Frauen können nicht denken, sagt Schreck. Und wirft wie jeden Tag die Türe hinter sich ins Schloss. Fehlte noch, dass an seinen Fersen federähnliche Funken aufblitzten. Nun ist ja schon ersichtlich genug, dass aus uns nichts wird! Höher gebildete Mädchen ist einfach zu hoch gegriffen. Die Sterne, die Sterne oben. Der Sterne Leid, Schreck, kesselerfahren, Offizier. Lernt Kartoffeln zählen und Pflaumen, sagt er. Ein schneidiger Mann ist er. Für uns Mädchen von der Höheren Schule für Mädchenbildung. Wir werden alle einen Platz an der Seite von etwas anderem finden. Nicht laut und sanft und ansehbar. Wir möchten gerne reich sein, Kinder haben und einen köstlichen Mann. Oh liebes Leben, sagen wir uns in der Pause und als Entgegnung auf Schreck. Die Mathematik geht über Mädchen und zieht freundlich den Hut. Während wir uns den Kartoffeln zurechnen und ihren Augen. Wer sich in die Nesseln setzt, denkt sich: von wegen Nesseln. Und denkt auch: von wegen Nessuskleid. Und so sind wir sicher, dass unsere Lehrer keine wirklichen Menschen sind. Wirklich nicht. Die meisten von uns kommen aus gutem Haus. Ihre Väter sind Zahnärzte, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Architekten oder ganz einfach Ärzte-Ärzte. Nur Helga, Maritta und ich sind Ausnahmen. Marittas Vater ist Kohlenhändler und bei den Schützen. Helgas Vater arbeitet bei Bayer. Schon Heides Vater ist Vorarbeiter, und Elsemaries Vater ist nicht einfach ein Bauer, sondern ein reicher. Aus unseren Familien ist noch nie jemand auf eine höhere Schule gegangen. Nur wir. Und zu Hause sagen unsere Eltern: Wir sprechen nicht die Sprache, die ihr lernt. Aber lernt nur, Kinder. Meine Mutter sagt, ich hätte mich so gerne unterhalten, aber mit deinem Vater ist das eine Sache der Unmöglichkeit. Und zu der werde ich langsam auch. Auch mit dir kann ich mich nicht unterhalten, sagt meine Mutter. Was stimmt, denn sie meckert und sagt, du machst alles nur halb. Was gehört sich für ein Mädchen, ist die Frage, die ihr und den Lehrern gehört. Wir tun nicht viel in der Schule. Wir lernen fürs Leben. Ich schaue in Ulrike Peters verbrannte Kniekehlen, sie sitzt vor mir. Wir reden nicht mit ihr. Und sie redet mit den Lehrern nur, wenn diese sie auffordern. In ihren verbrannten Kniekehlen steht etwas zu lesen, das hinter die Ohren geschrieben gehört. Sie ist die Beste in der Klasse und weiß, wie ein Mädchen sich zu benehmen hat. Sag etwas, wenn du gefragt wirst. Gewöhne dich an Offiziere. Sie verstehen die Mathematik und kennen kein Erbarmen. Sie heißen Schreck und anders. So eine Mädchenklasse, wenn sie älter wird, sieht hübsch aus. Blühblümchen. Und manchmal grelle Lippen, schwarze Striche um die Augen, Haare, die zu Berge gekämmt sind. Oh, ihr hübschen Mädchen, sagt kein Lehrer. Wir lesen die Judenbuche, nachts werde ich an die Judenbuche gehängt. Mit der Zeit wächst die Mädchenbuche. Hängt euer Leben nicht an einen Mann, sagt unsere jugoslawische Biologielehrerin. Aber wie benimmt sich ein junges Mädchen? Wir lachen sehr viel. Was nicht böse gemeint ist. Wir haben nur so ein Gefühl. Die Glieder sind so locker an uns dran. Und so auch die Gefühle. Wenn überhaupt. Wir wissen nicht, wo wir anfangen und ob wir enden. Sind wir? Das sind die Fragen, die uns sehr beschäftigen. Jeden Tag. Wir suchen uns. Wer hat uns vom Baum der Erkenntnis geschnitten? Träume ich? Ich sage nichts davon. Nur zu Elsemarie. Sie kennt den schwarzen Vogel, vor dem ich mich fürchte. seitdem sie ihn mir auf dem Klavier vorgespielt hat. Im Zimmer neben dem Gastwirtschaftsraum, mit der Aufschrift: Privat. Sie spielte den Vogel auf dem Klavier, und er hat uns geholt, hat uns mit dem ganzen Zimmer aufgehoben und weggebracht aus dem Haus und der Küche, in der ihre Familie für die Gäste arbeitet, und weg von den Bierfässern im Keller und den Gästen, die aus den Bierfässern ihr Bier gezapft haben wollen. Weg auch von den Ställen, den Kühen, dem Campingparadies dahinter, mit sanft geschwungenen Wegen, die die Wohnwagen miteinander verbinden. Wie bei Micky Maus, wenn endlich alles wahr wird. Dann hört Elsemarie auf zu spielen, der Vogel lässt uns los. Oder ist es der Käfer? Sie sitzt wieder vor dem Klavier, ich sehe ihre breiten Schultern, die festen Oberarme, ihre weiße Haut. Sie wäre eine schöne Gefangene... Was ich fühle, ist ein einziger Aufruhr, den ich von einer Seite auf die andere treibe. Hier werfe ich Steine, dort lasse ich sie mir auf den Kopf fallen. Jahrelang gehe ich in die Schule, in der es um etwas, vielleicht auch um einiges geht, von dem ich nie was gehört habe. Auch nie etwas gesehen. Dass man beispielsweise die Tochter eines Zahnarztes 57
59 sein kann. Sie hat lange Locken, sanfte Augen und einen großen Busen. Oder dass es ein Bedürfnis ist, auf einem Pferd zu reiten. Oder einen Freund zu haben, sich küssen zu lassen, sich zu vergessen und aufzuhören zu denken. In der Schule sehe ich mich Berge rauf und runter laufen, ich fresse Bleistifte an. Ich drehe Zigaretten und lege sie eine neben die andere vor mir auf mein Pult. Das ist mein Munitionsgürtel, den ich mir anlege, weil ich zum Shoot out gehe, mittags um halb zwölf in die große Pause. Und mir schwöre, dass aus mir nichts wird. So dass der Rest nur noch so durch mich durchsickert. Ich merke nichts. Ich halte nichts. Ich bin schwach. Aber unbeirrbar. Elke nimmt meine Hände, es ist im Zeichensaal, in den ich es mit den Jahren, wenn auch immer noch verspätet, zitternd und sehr weiß geworden, schaffe. Sie nimmt sie in ihre Hände, betrachtet sie, und schon schreit sie. Schaut euch das mal an, das sind die Hände einer alten Frau. So was habe ich ja noch nie gesehen, so viele Falten. Deine Hände sind ja nichts als Knochen und Falten. Deine Hände sind ja nichts als Knochen und Falten. Margot heißt eine kleine, dünne Person in unserer Klasse, die neu dazugekommen ist. Sie hat keine Freundin, und ihr Gesicht ist grau. Ihre Haare sind borstig. Sie spricht unverständlich leise, und ich habe Lust, sie zu schlagen. Sie unterwirft sich sobald sie kann. Aber da wir selber schon so flach auf dem Boden liegen, ist es schwer, da noch drunter zu kommen. Sie will immer das Fenster auf haben, sie erstickt, sagt sie. Ich will keine Luft. Ich will Ruhe und einen abgeschlossenen Raum, wenn hier schon kein Herauskommen möglich ist. Wir sind ganz einfach Gefangene. Und eines Tages, nachdem sie wieder das Fenster aufgerissen hat, schlage ich zu. Leverkusen, liegt vor dem Fenster, der Stadtpark, dahinter die Sportanlagen für den Weltsporttag und die Werksangehörigen. Alle im gleichen Zustand, sie zählen von eins bis fünf, dann muss die Runde gelaufen sein, und die Schicht ist zu Ende. Ich bin in diese Stadt hineingeboren worden. Und kenne folglich dieses Rundendrehen von eins bis fünf. Bis abends spät noch Sport gemacht - und dann schlafen, was alles zurechtflickt. Diese Flicknächte, in denen ich von Jungen träume. Ich will ein Recht zu leben haben. Das erregt mich. Ich reite auf Jungen für Freiheit. Ich reite auf allem, was nicht wahr war. Pferde hingegen finde ich albern. Auf Schultaschen, Hefte, Bücher, und zwischen die Seiten kleben die Mädchen, die reiten, Pferde. Die Pferde heißen Susi, Peter, Timm. Ich muss Tom striegeln. Mit Peter gehe ich an ein Turnier. Gestern habe ich ihm rote Schleifen in die Mähne geflochten. Und schon reiten sie davon, Trixie, Susanne, Ramona. Womit nichts gesagt ist. Aber sie sind da. Mit ihren Namen, ihren Zahnarztvätern, den Müttern in Sportwagen, in Blue Jeans, auf dem Rücken ihrer Pferde, im Stadtpark, in dem sich auf den werkseigenen Sportanlagen die Werktätigen sportlich betätigen und von eins bis fünf zählen. Am Abend, bevor ich in meinen Zurechtflickschlaf sinke, der nach fünf kommt, schreibe ich die englische Hitparade aus dem Radio auf und lerne sie auswendig zum Austauschen am nächsten Morgen. Und auf Englisch komme ich von eins bis zehn. Dann versinke ich und träume von einer fremden Welt, und in der sind die Mädchen aus meiner Klasse, ihre Namen sind Kleider. Sie haben ein Aussehen. Einige haben sich mit abgerissenen Tapeten bekleidet. Ich möchte auch so ein Kleid haben. Ich will keine frische Luft haben. Ich will schwer atmen. Ich will Schwereres atmen. Um aufzutauchen. Ich träume in der Nacht, dass es geschieht. Alle warten. Wir sitzen an unseren Tischen in der Schule, jede hat ihren Kopf darauf gelegt. Wir schlafen, wir sind erstarrt, niemand sucht uns. Aber es wird sich schon einer finden. Dann beginnt der Unterricht: Meine Damen, bitte. Sie sagen uns so oft, macht keine Geschichten, dass wir selbst im Traum keine machen. Wir wüssten nicht wie. Nein, wirklich nicht, ich habe keine Wörter, an die ich mich halten könnte. Ich kann nicht sagen, was ist. Auch nicht, was sein soll. Da ist nur ein Gefühl. Eine Bewegung. Tag für Tag eine Ausdehnung, die durch Wörter, Tage und Räume geht. Was diese Ausdehnung angeht, so könnte ich sagen, sie geht mit mir. Oder ich mit ihr. Wir wohnen nicht, wir kommen nicht an. Wir sind eine Körperbewegung und noch eine und noch eine. So sprechen wir auch und haben Satz für Satz von den Gesten abgekupfert. Ein Abdruck. Meine Mutter schimpft mit mir. Mein Vater nimmt mich im Auto mit. Ich schreibe schlechte Noten. Und doch soll das das sein, das mir sagt, dass ich bin. Ich lache. Ich bin nicht. Das fällt auf euch zurück, sagen die Lehrer in der Schule. 58
60 59
61 Einführung des Schulleiters Gerhard Löw Am 17. Dezember 1985 fand im Pädagogischen Zentrum die Einführungsfeier für den neuen Schulleiter Gerhard Löw statt. Nach der Rede des Oberbürgermeisters Horst Henning trat der seinerzeit neu für die Schule zuständig gewordene Leitende Regierungs-Schuldirektor Karl Rüdiger ans Rednerpult, überbrachte und erläuterte die Ernennungs-Urkunde im Namen der Landesregierung. Damit war der offizielle Akt vollzogen. Die Schulgemeinde begrüßte den neuen Schulleiter mit einem dreistündigen, ebenso geistreichen wie vergnüglichen Programm. Der Begrüßungs-Song lautete: "Welcome and stay!" Zum Schluss ergriff Gerhard Löw, der bereits seit 1968 Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium ist, das Wort und legte gewissermaßen sein pädagogisches "Glaubensbekenntnis" ab, indem er sein "Plädoyer für den ästhetischen Humanismus Schillers" vortrug. Der neue Schulleiter Gerhard Löw im Gespräch mit Frau Kuckelberg und Herrn Kißler 60
62 Plädoyer für Schillers "Ästhetischen Humanismus Vor knapp 200 Jahren hat Friedrich Schiller - aufbauend auf Kants "Kritik der Urteilskraft" - in den "Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts" den "Ästhetischen Humanismus" begründet. Im fünfzehnten der insgesamt siebenundzwanzig "Briefe" formulierte Schiller den berühmten Satz: "Der Mensch... ist nur da ganz Mensch, wo er spielt". (Friedrich Schiller, sämtliche Werke, Carl Hauser Vlg. München, 2. A- 1960, 5. Bd., S. 618). Dieser schlicht klingende Satz wird in seiner großen und tiefen Bedeutung erst verstehbar, wenn man ihn innerhalb des Fragehorizonts erläutert, in dem er bei Schiller steht. Dabei muß der zum Teil langwierige Gedankengang des Autors verkürzt werden. Schillers Ausgangsfrage lautet: Welche Bedeutung hat die Schönheit für das Wesen des Menschen? Diese Frage ist nicht neu, im Gegenteil; sie ist ein fester Bestandteil der abendländischen Geistesgeschichte. Schon die beiden bekannten Philosophen Plato und Aristoteles haben diese Frage gestellt und - jeweils aus der Perspektive ihrer Seinsauslegung heraus - beantwortet. Plato fällt ein vernichtendes Urteil über die Kunst und das durch sie hervorgebrachte Schöne, weil er meint, die Schönheit der Kunst sei bloßer Schein, wodurch der Mensch dazu verführt werde, seinen festen Stand (sein Ethos) aufzugeben. Aristoteles mildert dieses vernichtende Urteil seines Lehrers Plato über die Kunst deutlich ab, indem er in einer Rangfolge der Kunst zwischen Philosophie und Geschichtswissenschaft den zweiten Platz zuerkennt. Die Begründung: In der Kunst werde zwar nicht wie in der Philosophie das Wesen der Dinge erkannt, aber immerhin würden wesentliche Anblicke von den Dingen durch die Kunst zum Vorschein gebracht. Seit Plato und Aristoteles ist das Urteil über die Kunst und die Künstler gespalten: Einerseits ist die Kunst etwas Nichtig-Scheinhaftes und der Künstler ein bloßer Gaukler (Plato), andererseits gilt Kunst als Wesensdarstellung und der Künstler wird als Wesensdarsteller anerkannt (Aristoteles). Neu ist die Frage Schillers also nicht, aber er bringt sie mit einer bis dahin nicht gekannten Entschiedenheit in Verbindung mit der Frage nach dem Wesen des Menschen. Für Schiller geht es darum, genau die Stelle im Wesen des Menschen zu ergründen, an der die Schönheit Bedeutung erlangt. Dazu muß er sich Einblick in das Wesen des Menschen verschaffen. Die diesbezügliche Analyse Schillers führt zu dem Ergebnis, daß der Mensch auf Grund seiner sinnlichgeistigen Doppelnatur durch zwei Wesensbestandteile gekennzeichnet ist: durch "Person" und "Zustand". D. h., daß in uns eine Kraft danach strebt, sich in allem Wechsel und Wandel der Zeit zu behaupten (Schiller nennt das den "Formtrieb"), eine andere Kraft in uns auf ständigen Wechsel der Zustände aus ist (Schiller nennt das den "Stofftrieb"). Nach Schillers Einsicht sind diese beiden Triebe einander entgegengesetzt, der eine dringt auf "absolute Formalität", der andere auf "absolute Realität", dem einen geht es um Unveränderlichkeit (Ewigkeit), dem anderen um ständige Veränderung (Zeit). Aufgrund dieser "Fundamentaltriebe" ergehen sozusagen entgegengesetzte Befehle an den Menschen: einerseits soll er sich als Person in allem Wandel behaupten, andererseits soll er sich selbst verwirklichen, in dem er sich dem Wandel öffnet. Schiller hat damit einen inneren Widerspruch im Wesen des Menschen entdeckt, durch den die Einheit des Menschseins zu zerbrechen droht. An dieser Stelle vollzieht Schiller eine entscheidende philosophische Denkbewegung. Von der schlichten Tatsache ausgehend, daß der Mensch trotz des inneren Widerspruchs existiert, fragt er sinngemäß: Was ermöglicht dem Menschen seine Einheit? Oder anders gefragt: Was ist es, was die Spaltung unseres Wesens verhindert? Schillers Antwort: Es müsse einen dritten Grundtrieb in uns geben, der die beiden gegenwendigen Grundtriebe zusammenhalte, der sie harmonisiere! Schiller setzt nun diesen postulierten dritten Grundtrieb, den er "Spieltrieb" nennt, zunächst 61
63 einfach hypothetisch an, um ihn dann in einem vierfachen Belegverfahren unabweisbar evident zu machen. Auch an diesem Teil der Schrift können nur die Quintessenzen genannt werden. Der Spieltrieb, so sieht es Schiller, müßte darauf gerichtet sein, "die Zeit in der Zeit" aufzuheben. Bei ihm ging es also nicht mehr nur - wie beim Formtrieb - um Aufhebung der Zeit, sondern um Zeitspannen, in denen die Zeit gleichsam stillstehen müßte, um Augenblicke, in denen der Mensch ganz und gar aus der Verstreutheit in Vergangenheit und Zukunft versammelt würde in "reine Gegenwart". In solchen Augenblicken wären alle Triebe des Menschen zweckfrei versammelt, der Mensch befände sich im Zustand der Harmonie oder - wie Kant es formuliert hat - in einem Zustand "interesselosen Wohlgefallens". Oder nochmals anders formuliert: Die aus unserer sinnlichgeistigen Doppelnatur resultierende Gespaltenheit wäre aufgehoben, die sich widerstreitenden Triebe befänden sich in einem "freien Spiel". Und dieses "freie Spiel" ist das gesuchte Dritte, ist der "Spieltrieb". Von dieser Stelle an hält Schiller die Hypothese für belegt und deshalb kann auch hier vom Irrealis in den Indikativ gewechselt werden. Wenn der Spieltrieb in uns wirksam wird, befinden wir uns im "ästhetischen Zustand", d. h., daß für uns die Zeit gleichsam stillsteht, wenigstens für Augenblicke, daß die geistigen Kräfte in uns sich nicht gegen die Mannigfaltigkeit des Sinnlichen durchsetzen, sondern beide Grundtriebe, um ein bekanntes Wort Adalbert Stifters zu gebrauchen, in ein "sanftes Gesetz" zurücktreten, in das Gesetz der Schönheit. Mit dem derartig als für den Menschen wesensnotwendig aufgewiesenen Spieltrieb hat Schiller den eingangs erwähnten "ästhetischen Humanismus" begründet, d. h. er hat ein Menschenbild entworfen, in dem Humanität ohne Ästhetik nicht möglich ist. Und damit sind zugleich die pädagogischen und politischen Konsequenzen aus diesem Menschenbild angesprochen. Eine Gesellschaft, die den in ihr lebenden Menschen spielerische, kreative Entfaltungsmöglichkeiten versperrt oder nicht genügend fördert, versperrt damit die Wege zur Humanität. Anders, nämlich positiv ausgedrückt: Menschen, die in ästhetischen Prozessen - ganz gleich welcher Art - Harmonieerlebnisse gehabt haben, sind eher befähigt und bereit, tolerant zu sein, sind eher befähigt und bereit, Kompromisse einzugehen und durchzuhalten, solche Menschen haben eine höhere Frustrationstolerenz, sind friedensfähiger als solche, denen Möglichkeiten zu kreativer Entfaltung versperrt geblieben sind. Auf die Schule übertragen, heißt das: Eine Schule, die sich - insbesondere angesichts der unvermeidlichen Sach-, Gruppen- und Selbstzwänge der heutigen Zivilisation - nicht ernsthaft darum bemüht, für Schüler, Lehrer und Eltern ästhetisch-kreative Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, begeht nicht nur eine läßliche, sondern eine pädagogische Todsünde. (Gerhard Löw) Damit dürfte klar geworden sein, was Schiller meint, wenn er sagt: "Der Mensch... ist nur da ganz Mensch, wo er spielt". Der Satz kann überschätzt und unterschätzt werden. Der Satzakzent liegt eindeutig auf dem Adverb "ganz". Der Mensch ist auch sonst Mensch, z. B. wenn er sich überwiegend rational oder überwiegend sinnlich verhält, aber nur im "ästhetischen Zustand" ist er ganz Mensch. Nur der ästhetische Zustand ermöglicht es dem Menschen, sein sinnlich-geistig gespaltenes Wesen in eine ursprüngliche Einheit zurückzubringen, eine Einheit, wie sie Schiller etwa in seiner Gedankenlyrik "Die Götter Griechenlands" elegisch ins Wort geholt hat. 62
64 Das Lise-Meitner-Gymnasium heute: Profile einer reformfreudigen Schule von Gerhard Löw Seit dem Erscheinen der Denkschrift "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" im Jahre 1995 gibt es die Vision von der Schule als einem "Haus des Lernens". Eine solche Schule ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, die Lehrenden wie die Lernenden in ihrer Individualität angenommen werden, die persönliche Eigenart in der Gestaltung von Schule ihren Platz findet, ist ein Ort, an dem Zeit gegeben wird zum Wachsen, gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt voreinander gepflegt werden, ist ein Ort, dessen Räume zum Verweilen einladen, dessen Angebote und Herausforderungen zum Lernen, zur selbsttätigen Auseinandersetzung locken, ist ein Ort, an dem Umwege und Fehler erlaubt sind und Bewertungen als Rückmeldung hilfreiche Orientierung geben, ist ein Ort, wo intensiv gearbeitet wird und die Freude am eigenen Lernen wachsen kann, ist ein Ort, an dem Lernen ansteckend wirkt. Im Haus des Lernens sind alle Lernende, in ihm wächst das Vertrauen, dass alle lernen können. Sicherlich bleibt die Wirklichkeit auch am Lise- Meitner-Gymnasium noch weit hinter dieser Vision zurück; dennoch können wir im Jahre unseres 75jährigen Schuljubiläums mit einiger Genugtuung feststellen, dass wir seit mindestens 12 Jahren wesentliche Schritte in Richtung auf die Schule der Zukunft hin getan haben. Durch unsere seit 1986 beharrlich vorangetragene innere Schulreform, durch die gleichzeitigen Veränderungen der Rahmenbedingungen des Lernens, durch unser unablässiges Bemühen um Demokratisierung des Schullebens auf allen Ebenen ist insgesamt ein so positives Schulklima entstanden, dass die Schüler und Schülerinnen, die Lehrer und Lehrerinnen, die Bibliothekarin und die Sekretärinnen, die Hausmeister und sonstige Personen überwiegend gern in dieses "Haus" kommen und darin lernen und arbeiten. Das seit 1986 entstandene Schulprogramm des Lise- Meitner-Gymnasiums ist als Ganzes oder in Teilen seit 1992 mehrfach publiziert worden: 1. P. Madelung, S. Pauls, D. Willenberg Köhler: Ein Gymnasium auf dem Weg zur Umgestaltung der Erprobungsstufe, Erfahrungsbericht über die Einführung der "freien Arbeit"; in: Engelbert Groß, Freies Arbeiten in weiterführenden Schulen, Auer- Verlag, Donauwörth, 1992, S Mitteilungsblatt der Landeselternschaft für Gymnasien Nr. 158, Sept im Anschluss an die Vorstellung unseres Konzepts auf der Jahreshauptversammlung vom 13. Mai 1995 (landesweit an alle Gymnasien verteilt). 3. In der Schrift des Ministeriums für Schule und 63
65 Weiterbildung zum Thema "Schul-Programme an Gymnasien", August 1995 ( Diese Schrift enthält 7 Beiträge unserer Schule und ist landesweit an alle Gymnasien verschickt worden.) 4. In: Schule neu gestalten - eine Dokumentation der Bertelsmann-Stiftung zum Wettbewerb "innovative Schulen", Gütersloh 1996 (Darin, S. 299: Unser Schulprofil in Kompaktform) 5. In der Dokumentation zum Bildungstag Nordrhein-Westfalen mit dem Thema "Haus des Lernens", hrsg. und gestaltet von der Bergischen Universität Wuppertal und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Okt (Auch hier: Unser pädagogisches Konzept in Kompaktform) 6. In der Zeitschrift "Schulbibliothek Aktuell": ein Artikel über die "Schulbibliothek des Lise-Meitner- Gymnasiums", hrsg.. vom Deutschen Bibliotheksinstitut Berlin, April 1997, S In dem Sondermagazin der Zeitschrift "Neue Deutsche Schule" der GEW zum Thema "Neues Lernen am Gymnasium", darin: Reformen an der Lise-Meitner-Schule, 1997, S Veränderte Unterrichtsformen und neue Lernarrangements am Lise-Meitner-Gymnasium In: Schulleitung und Schulentwicklung, Raabe-Verlag, Berlin 1998 Durch die aufgeführten Veröffentlichungen ist die 64
66 Schule nach und nach landesweit so bekannt geworden, dass wir viele Anfragen von Gymnasien aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens zwecks Beratungshilfe bekommen. Bei der Umsetzung dieser Anfragen in konkrete Kontakte sind unsere Teams keineswegs immer nur die Gebenden, sondern wir lernen im Erfahrungsaustausch und bei den Besuchen in anderen Gymnasien auch manches Wertvolle für unsere eigene schulische Weiterentwicklung. Mittlerweile haben wir auf diese Weise 56 Gymnasien aus unterschiedlichen Landesteilen kennengelernt; einige von ihnen haben Teile unseres pädagogischen Konzepts übernommen. Unsere Teilnahme an dem bundesweiten Wettbewerb "Innovative Schulen", veranstaltet von der Bertelsmann-Stiftung, hat mit dazu beigetragen, dass die Stiftung und das Ministerium die Stadt Leverkusen als Modell-Region für einen auf 5 Jahre hin angelegten Schul-Entwicklungs-Versuch ausgewählt haben. Für unsere Schule kam dieser "bedeutsamste Schulversuch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" (Presse-Zitat), der mit Finanzmitteln von rund 9 Millionen DM ausgestattet ist, genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach 12 Jahren innerer Schulreform aus eigener Kraft ist für uns jetzt professionelle Beratungshilfe von außen sehr willkommen, um all unsere Reformschritte zu evaluieren, zu konsolidieren, zu optimieren und sie behutsam weiter zu entwickeln. Auf der Grundlage eines von der Schulprogramm-Kommission erarbeiteten Konzepts hat sich die Schulkonferenz des Lise-Meitner- Gymnasiums einstimmig (ohne Stimmenthaltung!) für die Teilnahme an diesem Schulversuch entschieden, der mit dem Schuljahr 1997/98 begonnen hat (Näheres s. u.). Als vorläufigen Höhepunkt in der Außenwirkung des Lise-Meitner-Gymnasiums kann man unsere Teilnahme am "Netzwerk innovative Schulen" bezeichnen, das durch die Bertelsmann-Stiftung auf einem Groß-Kongress am 26. Und 27. März 1998 in Münster ins Leben gerufen worden ist. Insgesamt 400 Schulen aus allen 16 Bundesländern (darunter 40 Gymnasien) sind über Internet miteinander verbunden und können jederzeit ihre Erfahrungen austauschen. Auf diesem Kongress haben wir unser Konzept der inneren Schulreform am 26. März 1998 vor Vertretern von 30 Gymnasien aus ganz Deutschland und vor zum Teil hochrangigen Bildungsforschern und Bildungspolitikern vorgestellt. Die Resonanz war so positiv, dass bereits jetzt weitere Kontaktanfragen von Gymnasien aus anderen Bundesländern vorliegen. Im Gefolge von Münster hat ein renommierter Fach- Verlag für Bildungsmanagement mit uns einen Autoren-Vertrag abgeschlossen zwecks Erstellung eines Beitrags zum Thema "Veränderung von Unterrichtsformen und Lernarrangements" für das weitverbreitete Handbuch "Schulleitung und Schulentwicklung". Im Rahmen des o. a. "Netzwerks" werden durch die international tätige Bertelsmann-Stiftung für die einzelnen Bereiche der Schulentwicklung auch internationale Erfahrungen für uns verwertbar gemacht. Der Kongress hat am 27. März 1998 die sogenannte "Münstersche Erklärung" verabschiedet, die im folgenden - aus Raumgründen reduziert auf ihre Thesen und Forderungen, also ohne die an sich dazu gehörenden Erläuterungen - wiedergegeben werden: Grundthese: Gute Schulen sind pädagogisch innovative Schulen - pädagogisch innovative Schulen sind gute Schulen Als Schlussfolgerung daraus werden 10 Thesen aufgestellt: Eine Gesellschaft im Wandel verlangt eine sich wandelnde Schule Eine innovative Schulentwicklung ist möglich Es gilt Orientierungen zu schaffen, Eigenverantwortung zu stärken und Wettbewerb zu ermöglichen Innovative Schulen brauchen ein innovatives Schulsystem Schulentwicklung braucht öffentliche Verantwortung Schulentwicklung braucht gute und engagierte Lehrerinnen und Lehrer Schulentwicklung braucht Bundesgenossen vor Ort Schulentwicklung braucht Zeit Schulentwicklung braucht Mittel Schulentwicklung braucht Gemeinsamkeit Die Münstersche Erklärung endet mit einem Zitat des kanadischen Gewinners des Carl-Bertelsmann- Preises 1996, dem Durham Board of Education: "We cannot command the wind, but we can set the sails. Durch die vorangehenden Erläuterungen dürfte verständlich geworden sein, warum sich das heutige Lise- Meitner-Gymnasium als "reformfreudige Schule" versteht. Offensichtlich ist es der Schule in den letzten 12 Jahren gelungen, die Segel rechtzeitig und richtig zu setzen! In unserem aktuellen Schulprogramm sind selbstver- 65
67 ständlich auch traditionelle Bestandteile enthalten, die zum Teil weit in die 75jährige Geschichte zurückreichen. Mit besonderer Nachhaltigkeit sind vier pädagogische Aktionsfelder durch die Jahrzehnte hindurch bearbeitet worden: Die "Eine-Welt-Arbeit", die unser heutiges Schulprofil wesentlich mitprägt, geht in ihren Anfängen auf die 50er Jahre zurück (Näheres dazu : s. u.). Unsere Schulpartnerschaften mit einem französischen Lycee, mit zwei englischen High-Schools, mit einer amerikanischen High-School und unsere Kontakte zu russischen Schulen sind zwischen 14 und 33 Jahre alt. Darin drückt sich die neusprachliche Tradition des ehemaligen Mädchengymnasiums aus (Näheres dazu: s. u.). Seit Jahrzehnten gibt es im Lehrerkollegium eine ausgeprägte Bereitschaft, auf psycho-soziale Problemlagen der uns anvertrauten Schülerschaft mit großem Krafteinsatz offensiv zu reagieren. Beispiel: In den Jahren 1989 bis 1992 haben wir am Lise-Meitner- Gymnasium insgesamt 90 Aussiedlerkinder aufgenommen, ihnen allen die deutsche Sprache vermittelt und sie so gut wie eben möglich in ihrer Schullaufbahn gefördert. 60 dieser Kinder konnten bei uns bleiben, viele von ihnen haben sich erfreulich entwickelt; ein nicht unerheblicher Teil von ihnen gehört heute zu unserer Leistungsspitze in der Oberstufe, andere haben das Abitur in den letzten drei Jahren schon geschafft und sind jetzt unsere Ehemaligen Die Integration der Aussiedlerkinder in unsere Schule und damit in unsere Gesellschaft ist deshalb so positiv verlaufen, weil die damals aktive Eltern- und Schülerschaft in vielfacher Weise geholfen hat. Seit Jahrzehnten wird der Entwicklung der sozialen und politischen Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen der SV-Arbeit große Beachtung geschenkt. Im Jubiläumsjahr wird unsere Schülerschaft von einem engagierten Team konstruktiv arbeitender SV-Vertreter geleitet, deren Beiträge in der Schulkonferenz sehr ernst genommen werden. Achtung gebietend ist auch die Leistung der Liselchen-Redaktion, die viermal im Jahr eine lesenswerte Schülerzeitung herausbringt, zum Jubiläum ist sogar eine Sondernummer erschienen! Aus dem Kreis dieser sich für die Gemeinschaft einsetzenden jungen Leute kommen immer wieder Nachwuchskräfte für unser demokratisches Staatswesen. Darauf ist diese Schule stolz! Eine neuere Entwicklung liegt in der Schärfung unseres Schulprofils im Bereich der Naturwissenschaften. Seit 8 Jahren bieten wir Jahr für Jahr in allen drei Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) Leistungskurse an und haben für besonders befähigte Schülerinnen und Schüler auch zusätzliche Anforderungsstrukturen erarbeitet. Sicher hat diese Entwicklung etwas mit der Schließung des benachbarten Carl-Duisberg-Gymnasiums zu tun, dessen Rechtsnachfolger wir geworden sind. Wir haben uns intensiv darum bemüht, die an diesem Gymnasium seit Jahrzehnten gepflegte naturwissenschaftliche Tradition aufzugreifen und fortzusetzen. Selbstverständlich verpflichtet uns auch unsere Namenspatronin Lise Meitner, die als größte Physikerin des 20. Jahrhunderts gilt, dazu, unsere Bildungsbemühungen in diesem Bereich zu verstärken (vgl. dazu den Beitrag der Fachschaft Physik!). Im Rahmen des Fachs Literatur der Stufe 12 sowie auch im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften in der Sekundarstufe I und II hat sich in den letzten 15 Jahren eine Theatertradition entwickelt, die sich in vielfältigen Aufführungen (Klassisches und modernes Theater, Boulevardstücke, Musik-Theater, Musical, Kabarett, Kindertheater) ausdrückt. (s.u.) Seit drei Jahren werden auf den verschiedenen Stufen jeweils Chöre aufgebaut, die bei bestimmten Anlässen - als großer Schulchor zusammengefasst - auftreten. Besonders erfreulich ist, dass im Jubiläumsjahr unser neu aufgebautes Schulorchester erstmals vor einer großen Öffentlichkeit aufgetreten ist. Zusammen mit der traditionell starken Kunst- Fachabteilung und dem seit vielen Jahren hochentwickelten modernen Ausdruckstanz prägt damit der kreative Bereich insgesamt unser schulkulturelles Leben nachhaltig (Vgl. hierzu die Rede des Schulleiters G.L.: "Plädoyer für Schillers ästhetischen Humanismus"!). Zwischenbilanz: Die Entwicklung unseres Gymnasiums zu einer "reformfreudigen Schule" hat sich zwar in den letzten 12 Jahren verdichtet, vorbereitende Schritte dazu sind aber schon vorher getan worden. Einige unserer heutigen Profilmerkmale reichen weit in die 75jährige Schulgeschichte zurück. Von besonderer Bedeutung ist die Zeit seit Hinweise zur "neuen Epoche" der Schule seit 1968 Das gesamtgesellschaftlich inhaltsschwere Jahr 1968 ist für die Schule nicht nur wegen der Einführung der Koeduktation und als Todesjahr Lise Meitners wichtig, womit die Übernahme des Namens der Physikerin als Schulname zusammenhängt, sondern dieses Jahr ist für die weitere Entwicklung unserer Schule noch aus einem anderen Grund von 66
68 Bedeutung: Die "Einwanderung" von Nachwuchskräften mit 68er Idealen führt schrittweise zu einer Veränderung des bis dahin überwiegend traditionell geprägten Lehrerkollegiums. Immer deutlicher wird das Unbehagen an der strukturellen Enge der gymnasialen Schulform artikuliert. Ab 1971 läßt eine neue Schulleitung Reflexions- und Problematsisierungsprozesse zu. Auf Pädagogischen Tagen unter Einschluß von Schüler- und Elternschaft werden Ansätze zur Schulprogrammarbeit geleistet. Durch die Einführung des Kurssystems in der Oberstufe ab 1972, das an unserer Schule in einer Vorform schon erprobt worden war, tritt eine gewisse Beruhigung bei der reformwilligen Lehrergruppe ein. Von 1982 bis 1985 erlebt und überlebt die Schule gewissermaßen ein "Interregnum". Schulleiter krank, der tüchtige Stellvertreter hält die Schule administrativ souverän "über Wasser". Teile der didaktischen, pädagogischen und schulpolitischen Führungsaufgaben werden stillschweigend vom Lehrerrat und bestimmten Funktionsträgern übernommen, aus der Not wird eine Tugend gemacht! Erstaunliches Phänomen: Im Lehrerkollegium ist eine breite Bereitschaft entstanden, Verantwortung für das Ganze oder für Teile des Ganzen zu übernehmen. Mit anderen Worten: Was heutzutage vielfach als einzig mögliche, weil effektive Führungs-Theorie für Wirtschaft und öffentliche Verwaltung angesehen wird, hat sich am Lise-Meitner-Gymnasium faktisch schon zu Beginn der 80er Jahre auf Grund der erwähnten personellen Konstellationen herausgebildet: Verantwortliche Übernahme von bestimmten Führungsaufgaben durch Gruppen oder Einzelpersonen des Kollegiums! Am Ende der drei Jahre hat sich faktisch die "Macht" - hierarchisch betrachtet - "nach unten" verlagert. Oder anders formuliert, als Ergebnis ist ein Demokratisierungsschub mit Motivationssteigerung zu konstatieren. Der im Schuljahr 1984/85 mit Zustimmung des Lehrerkollegiums und der Schulkonferenz neu gewählte Schulleiter stammt aus dem Kollegium und hat den inneren Prozess der Schule seit 1968 miterlebt und mitgestaltet. Sein Führungskonzept: Die breite Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung aus der vorangehenden Zeit aufgreifen, weiter entwickeln und die dadurch sich entfaltenden kreativen Kräfte für innovative Schritte zur inneren Schulreform nutzen! So kommt es seit 1986 zu einem Prozeß der schrittweisen Veränderungen, der inzwischen alle Schulstufen einschließlich der Oberstufe "erfasst" hat. Im folgenden wird das dabei entstandene pädagogische Konzept der inneren Schulreform beschrieben, das in allen Teilen von den jeweils zuständigen Mitwirkungsgremien beraten und verabschiedet worden ist. 67
69 Eine Schule mit menschlichem Antlitz schaffen Karola Fings, Jg. 1962, von 1973 bis 1982 an der Lise-Meitner-Schule, 1983 Beginn des Studiums der Geschichte in Düsseldorf, in Berlin, 1988 Geburt des Sohnes Jesse, seitdem Arbeit als Journalistin und Historikerin, 1995 akademischer Abschluß (Magistra), schreibt derzeit ihre Doktorarbeit, lebt in Köln. Zahlreiche Ausstellungen und Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus sowie dessen Auswirkungen auf die gegenwärtige Gesellschaft, u.a. "Z. Zt. Zigeunerlager". Die Verfolgung der Düsseldorfer Sinti und Roma unter dem Nationalsozialismus, Köln 1993 (gemeinsam mit Frank Sparing); "Messelager Köln". Ein KZ-Außenlager im Zentrum der Stadt, Köln 1996; "Unter Vorbehalt". Rückkehr aus der Emigration nach 1945, Köln 1997 (gemeinsam mit Cordula Lissner und Wolfgang Blaschke). Politisches Engagement in zahlreichen Gruppen und Projekten, in der Schule SV-Arbeit und Schülerzeitung, dann Kommunalpolitik und Jugendbewegung, Engagement für NS- Opfer (v.a. Sinti und Roma, ZwangsarbeiterInnen) und Flüchtlinge, Antirassismus-Arbeit. Carola Fings, 10. Klasse Die Erinnerungen an meine Schulzeit am Lise- Meitner zerfallen in die drei Phasen von Unter-, Mittel- und Oberstufe. Die dumpfeste und gruseligste war die Zeit der Unterstufe. Die Klassenlehrerin versetzte einen regelmäßig in Angst und Schrecken, wenn sie ihr rotes Notenbüchlein hervorkramte und ein Opfer suchte, das sie mit Abfragen quälen konnte. Viele LehrerInnen fanden wir - wenn nicht schrullig - mindestens langweilig, ungerecht und gemein. Wir rächten uns dafür an den unerfahrenen Referendarinnen. Auf dem Schulhof jagten einem die Jungen hinterher und hatten eine Freude daran, uns die Wildlederröckchen mit den Druckknöpfen herunterzureißen. Lichtblicke waren der Mädchen-Club "Die mixfreudigen Sieben", der sich reihum in elterlichen Wohnungen traf und die Küchen- und Hausbarvorräte plünderte, die ersten Garagenpartys mit Flaschendrehen, und einige Reli-Stunden, die im Stadtpark abgehalten wurden. Die Jungs aus unserer Klasse hatten wir übrigens relativ schnell im Griff: noch zu meiner Zeit am Lise-Meitner machte sich bemerkbar, daß es sich um eine ehemalige Mädchenschule handelte, denn Mädchen waren auch in meinem Jahrgang noch deutlich in der Überzahl (etwa 2/3 zu 1/3 Jungs), und das war für meine Sozialisation sicherlich sehr positiv. Meine erste Strafarbeit kassierte ich von Norbert Kissler, der einmal als Vertretungslehrer zu uns in die Klasse kam. Ich kritzelte abwesend irgendwelche Zeichen vom Schultisch ab, als er mich anfuhr, ob ich denn wisse, was ich da male. Ich wußte es nicht, es war ein Hakenkreuz. Später, als Herr Kissler Berufsverbot 68
70 bekommen sollte, haben wir für ihn gekämpft. In der Mittelstufe wehte dann schon ein anderer Wind. Wir bekamen in einigen Fächern jüngere LehrerInnen, die händeringend unter uns SchülerInnen nach Verbündeten gegen das teilweise vergreiste Kollegium suchten. Politik war für mich aber immer noch kein sonderlich interessantes Betätigungsfeld, obwohl ich begann, mehr nach den "Großen" in der SV zu schielen, gegenüber denen man sich nun nicht mehr ganz so fuzzi vorkam. Spannender war es, auszutesten, welche Verbote man übertreten konnte, ohne gleich von der Schule zu fliegen. Wir schlichen uns in den Pausen in den Stadtpark, um die Jungs vom CD-Gymnasium zu treffen, machten blau, wählten Reli ab und lungerten in unseren Freistunden im Café Burghof rum. Ab der 10. Klasse begann mit der "Dritte-Welt-AG" meine schulpolitisch aktive Phase, die dann in der 11, mit der Auflösung des Klassenverbandes und der Cliquenbildung mit MitschülerInnen, die einem sympathisch und irgendwie gleichgesinnt waren, nennenswertere Ausmaße annahm. Fächer wie Philosophie, in denen wir uns Fragen stellten wie "Wonach handelt der Mensch?" oder "Gibt es einen freien Willen?", taten ihr übriges. Überhaupt wollten wir ernster genommen werden und trafen tatsächlich auf einige LehrerInnen, die einen nicht mehr wie kleine Kinder behandelten. Mit etlichen SchulfreundInnen trieb ich mich in der Wiesdorfer Jugendszene rum, und auch das hat uns politisiert. Wie zentral Politik für mich wurde, läßt sich deutlich an der Wahl meiner Leistungskurse ablesen. Nach der 11 ging ich zu meinem geschätzten Mathelehrer Kurt Halfenberg und erklärte ihm, ich könne, so sehr ich es auch bedaure, in Zukunft nicht mehr fünf Stunden pro Woche mit so einem abstrakten Fach wie Mathe verschwenden. Ich entschied mich für das Fach Deutsch, das immerhin die Möglichkeit bot, Sprache und Literatur in einem gesellschaftlichen Kontext kritisch zu hinterfragen. Die Zeit der Oberstufe insgesamt habe ich sehr stark als kollektiven Diskussions-, Entwicklungs- und Handlungsprozeß in Erinnerung. Es herrschte, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, unter den zwanzig, dreißig SchülerInnen - vielleicht waren es phasenweise sogar mehr -, die sich in der SV und der Schülerzeitung engagierten, ein recht solidarisches Klima. In diesem Gruppenprozeß, in den teilweise auch einige LehrerInnen eingebunden waren, entwickelten wir ein großes Selbstbewußtsein. Wir wollten die Welt verändern und mit der Schule, die wir als Abbildung der gesellschaftlichen Normen und Herrschaftverhältnisse begriffen, anfangen. Kritik an der verhaßten Zwangsjacke der Allgemeinen Carola Fings während einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus Foto: Hacky Hagemeyer 69
71 Schulordnung", dem lehrerzentrierten Frontalunterricht, den Lehrinhalten, dem öden Schulstundentakt und - als übelstem Ausdruck der leistungsorientierten Gesellschaft - dem Notensystem waren unser Alltagsgeschäft. Unsere Macht als SchülerInnen wollten wir mit dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir uns die Schule aneigneten, indem wir Räume schufen, die nur uns gehören sollten: Teestube, Raucherraum, AGs. Und wir trugen alles das, was uns als Jugendliche interessierte, in die Schule hinein, meist über die Schülerzeitung: Umweltzerstörung und Rechtsextremismus, Drogen, Frau- Sein, Mann-Sein, Homosexualität, Kriegsdienstverweigerung, Hausbesetzung, Musik, Theater und vieles mehr. Zu der Zeit der sehr rührigen Schülersprecherin Daniela Hesse waren wir derartig aktiv, daß wir in der SV sogar Ministerien bildeten. Silvie, Kerstin und ich waren Außenministerinnen, was mir völlig entfallen wäre, wenn ich nicht zufällig noch ein Protokoll aus dem Oktober 1980 gefunden hätte. Ziel unseres Engagements war es, die Schule als herrschaftsfreien Lernort, in dem auch Kreativität und Solidarität Platz finden, zu gestalten. Wir wollten dort - wo wir schon gezwungenermaßen eine lange Zeit unseres Lebens an dieser Schule zu verbringen hatten - zu kritischen Menschen heranwachsen, die gegen den als zerstörerisch empfundenen Leistungs- und Anpassungsdruck der Gesellschaft immunisiert werden. Die Schule sollte uns aus dem Elternhaus befreien. Lernen sollte Spaß machen, und das konnte es nach unserer Auffassung nur, wenn die Lerninhalte einen Bezug zu unserem Leben hatten. Die Notwendigkeit, eine Schule mit menschlichem Antlitz zu schaffen, wurde uns Tag für Tag vor Augen geführt, schließlich sahen wir in diesem System ständig Menschen scheitern, SchülerInnen wie LehrerInnen: Frustration, Aggression, Krankheit, Alkoholismus, Magersucht, Depressionen. Mit unseren vielen Diskussionen, Auseinandersetzungen und Aktivitäten haben wir sicherlich einiges am Schulklima geändert. Aber wir stießen immer wieder deutlich an die Grenzen: die Herrschaftsverhältnisse ließen sich zwar etwas aufweichen, auflösen ließen sie sich nicht. Die letzten drei Halbjahre bin ich nur noch so oft zur Schule gegangen, daß ich mein Stundensoll irgendwie erfüllte und auch mein Abi machen konnte. Mir waren andere Dinge wichtiger geworden. Meinen Ausstieg aus der Schule habe ich im Sommer 1981 mit einem fünfseitigen Artikel in der Schülerzeitung "Lisel" begründet. Die Schule empfand ich mehr und mehr als einen Fremdkörper in meinem Leben, die im Unterricht vermittelte Einübung von Kritik schien mir zu einer Farce verkommen zu sein, da damit nie konkrete Handlungen verbunden wurden, unsere Aktivitäten bewertete ich als demokratische Sandkastenspiele, am Selbstverständnis der Schule als staatlicher Erziehungsanstalt hatten wir für meine Begriffe zu wenig gerüttelt. Doch mit ungebrochenem Optimismus ("wo's schlecht ist, müßten auch Menschen sein, die was dagegen tun") hielt ich alles noch für entwicklungsfähig ("Wer darüber reden will, kann am 1. Freitag nach den Sommerferien in den Nichtraucheraufenthaltsraum 209 kommen, nach der 6. Stunde"). Daß ich den Beruf der Historikerin ergriffen habe, obwohl mir Geschichte in der Schule - bis auf die provokanten Stunden bei Michael Stark - nie Spaß gemacht hat, hat auch etwas mit den Überzeugungen zu tun, die sich unter anderem in den Auseinandersetzungen an der Schule entwickelt haben. Denn erst nach der Analyse der gegenwärtigen Verhältnisse und einem Verständnis von deren historischer Bedingtheit können Strategien zu deren Überwindung entwickelt werden. Oder, wie ich 1981 in der "Lisel" schrieb: "(1) Zustand erkennen, (2) Maßnahmen erdenken und (3) ergreifen". 70
72 Das Pädagogische Konzept des Lise-Meitner-Gymnasiums Hinweise zur Schulprogrammarbeit Das "Schulprogramm" des Lise-Meitner-Gymnasiums beruht nicht auf einem einheitlichen, inhaltlich orientierten Entwurf, sondern gründet eher in einem "methodischen" Konzept, nämlich dem, den traditionellen Unterricht so zu ergänzen, dass Lernart, Lernform und Lernwirkungen den Schülerinnen und Schülern eine größere Chance bieten, sich selbsttätig und selbständig mit sich, ihrer Um- und Mitwelt auseinanderzusetzen. Mit dieser Ergänzung versuchen wir, die schulische Bildung und Erziehung vor allem in dreifacher Hinsicht zu intensivieren: Durch größere Selbsttätigkeit soll die Sach- und Methodenkompetenz gestärkt werden (Freiarbeit, Projektarbeit, Jahresarbeit in Stufe 8, Praktikums- und Reise-Erfahrungs-Berichte in den Stufen 9 und 10, Projektphase in Stufe 11, Facharbeit in Stufe 12, Klassenraum als Arbeitsraum, Bibliotheken); durch stärkere Individualisierung des Lernprozesses soll der Raum für Persönlichkeitsbildung erweitert werden (Reform der Erprobungsstufe, prozessorientiertes Lernen); durch Handlungsorientierung im Nah- und Fernbereich soll die soziale Verantwortung gefördert werden (Einrichtung der Klassen, des Gebäudes, Eine-Welt-Arbeit, Ausstellungen, Betriebspraktikum in Stufe 9, Berufsorientierungswochen in Stufe 12 und Schüleraustauschprogramme in Sek. I und Sek. II) Die in Klammern genannten "Stichwörter" sollen darauf hinweisen, dass es bei einem Schulprogramm darum geht, die programmatischen Absichten in konkrete, die Schulstruktur bestimmende Elemente umzuwandeln. Um dies zu erreichen, sind neu einzuführende Elemente - nach breiter und intensiver Diskussion in den Mitwirkungsgremien - durch bindende Beschlüsse zu institutionalsieren. Die bei uns seit 12 Jahren praktizierte Freie Arbeit in den Stufen 5-7 ist nicht nur eine alternative Lernform mit Abwechslungscharakter, sondern löst zugleich intensivierte innerfachliche und fächerübergreifende Kommunikationsprozesse aus. Vgl. dazu Typische Situation für verändertes Lernen: Teamarbeit das unten abgebildete Stern-Modell zur "Katalysator- Funktions von Freier Arbeit". Nach den ersten Frustrationserlebnissen haben wir gelernt, dies als immerwährende Herausforderung zu begreifen, deren produktive Umsetzung in jedem Schuljahr aufs neue zum Teil mit wechselnden Personen (oft mühsam) erarbeitet werden muß. In der nachstehenden graphischen Skizze geben wir einen Überblick über die pädagogischen Aktions- Felder des Lise-Meitner-Gymnasiums. (Horst Thelen) 71
73 Pädagogische Aktions-Felder am LMG Innere Schulreform seit 1986 Intensivierung selbständiger Arbeitsformen - Freie Arbeit (Stufen 5-7, in 7 Projektorientierung) - Jahresarbeit (Stufe 8) seit Reisetagebücher von Auslandsaufenthalten bei Partnerschulen (Stufen 9 und 10) - Praktikumsbericht (Stufe 9) - IKG-Projekte in allen Kursen des WP II - Projektphase zu Beginn der Stufe 11 - Facharbeit (Stufe 12) seit ÜBETREUung seit 96 OberstufenschülerInnen arbeiten mit jüngeren SchülerInnen - Projektwoche, alle zwei Jahre Rahmenbedingungen - Unterstufenbücherei (Eltern-Arbeitskreis unter Leitung einer Lehrperson; Lesealter Jahre; Schriftstellerlesungen, z. B. Willi Fährmann, Peter Härtling, Gudrun Pausewang) - Zentrale Bücherei Schüler-Lehrer-Arbeitsbücherei 300 qm mit ca. 60 Arbeitsplätzen und einem Gruppenraum Naturwissenschaften Diff. 9/10 Naturwissenschaftlicher Kurs zur Umwelterziehung Oberstufe Leistungs- und Grundkurse Biologie, Chemie, Physik in allen Jahrgangsstufen Besonderheiten Carl-Duisberg-Stipendium für hochbefähigte Schüler/innen Besuch des Deutschen Museums, München Teilnahme an Wettbewerben: z. B. Jugend forscht und naturwissenschaftliche und mathematische Olympiaden Öffnung zur Berufs- und Arbeitswelt Betriebspraktikum der Stufe 9 14tägig Auswertung in einer schriftl. Arbeit (Schulung der Beobachtung anhand eines Kriterien-Katalogs und Einübung der Bericht-Form) Berufsorientierungwochen in Stufe 12 14tägig, mit Vor- und Nachbereitung Zweck: Erneuter Kontakt mit einem Berufsfeld als Entscheidungshilfe Raum der Stille Die Religionsfachabteilung bietet Meditationen für alle Altersstufen an. Künstlerisches Wahrzeichen Glaskunstfenster von Georg Meistermann Eine-Welt-Arbeit Ziel Aus Verantwortung für die Eine Welt das eigene Verhalten ändern und Benachteiligte unterstützen. Projekte - Unterstützung einer Lepra- Station in Tansania (seit 1959) - Blindenheilung und Dorfentwicklung in Bangladesh ( ) - Schulpartnerschaft mit dem Colegio San Luis in Chinandega, Nicaragua (seit 1986) Einrichtungen - Eine-Welt-Kreis (e. V., Lehrer, Schüler, Eltern) - Eine-Welt-Laden (Verkauf)Information - fair gehandelte Waren aus der "Dritten" Welt, umweltfreundliche Arbeitsmittel) - Eine-Welt-Cafe (Vollwertfrühstück/Ausstellungen) Unterricht im engeren Sinn Bindung an Richtlinien Bindung an Stundentafeln Bindung an 5-Tage-Woche Bindung an das 45-Minuten-Raster Bindung an stundenplantechnische Blockungen als Folge der Kurssysteme Galerie Lise seit 1987, bisher 56 Ausstellungen aus unterschiedl. Fachgebieten Zweck: "Dialog" zwischen Schule und Gesellschaft Chancen zur Projektarbeit Zusammenarbeit mit diversen Museen und Kultureinrichtungen in den alten und neuen Bundesländern Theaterarbeit und Musikleben - Teilnahme an regionalen und überregionalen Theaterfestivals - Theateraufführungen und Konzerte auswärtiger Künstler und Gruppen in der Schule, insb. aus Entwicklungsländern - Stufenchöre, Bands, Kammermusik Besonderheit Dr. Walter Haaß-Förderpreis für herausragende Leistungen im musisch-künstlerischen Bereich Großes Schulfest alle 2 Jahre an einem Sommer-Samstag 72 Fremdsprachen Besonderheiten - Russisch als 3. Fremdsprache (ab St. 9) - Spanisch ab Stufe 11 (insb. f. Realschüler) Fremdsprachen-Wettbewerbe - Russisch-Olympiade - Bundeswettbewerb Fremdsprachen Schulpartnerschaften Stufe 9 mit England (Eversham, Redditch) seit 1976 Stufe 10 mit Frankreich (Valence) seit 1966 Stufe 12 mit den USA (Pittsburgh) seit 1986 Stufen Austausch mit russischen Schulen, insb. St. Petersburg seit 1992, alle 2 Jahre Schulgestaltungskommisssion Lehrer, Eltern, Schüler Ziel: Das Gebäude soll nützlicher und schöner werden! Oberstufen- Arbeitsraum selbstverwaltet, künstlerisch gestaltet Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 1. Öffentliche Informations- und Duiskussionsveranstaltungen als unterrichtsbezogene Projekte mit den Autoren aktueller Bücher (z. B. Erhard Eppler, Friedrich Schorlemmer, Norbert Greinacher, Carl Amery, Robert Jungk, Elmar Schmäling, Peter Glotz) 2. Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von entwicklungspolitischen Studienreisen: Kolumbien 1987, Nicaragua/Guatemala 1991, Chinandega/Nicaragua 1998 Schullandheim Unnau - regelmäßige Nutzung für Wochenprojekte insbs. der Sek, I - Wochenendnutzung im Sinne pädagogischer "Feuerwehraktionen" insbs. für Kurse der Sek, II Großes Ehemaligentreffen unter dem Motto: Tief ist der Brunnen der Vergangenheit alle 5 Jahre Sport Teilnahme an regionalen und überregionalen Wettbewerben Tag der offenen Tür jährlich Schule arbeitet an einem Samstag mit fast vollem Unterrichtsprogramm und zusätzlichen Informationsmöglichkeiten
74 Zur Genese und Struktur der Aktions-Felder Diese Grafik ist das Ergebnis einer Kommissionsarbeit, die im Auftrag der Schulkonferenz im Herbst 1994 durchgeführt worden ist. Die grafische Skizze stellt in ihrer Gesamtheit eine Bestandsaufnahme der schulischen Aktionsfelder dar und versucht, durch eine unterschiedliche graphische Gestaltung die Aktionsfelder im Blick auf ein Schulprogramm hin zu akzentuieren. In der graphischen Skizze kann man drei Ebenen erkennen: In der Mitte der Skizze ist der Unterricht im engeren Sinne mit den entsprechenden Bindungen angeordnet; in der Mitte, weil er quantitativ und strukturell den größten Raum in der Schule einnimmt und (kritisch gesagt) besetzt. Auf der zweiten Ebene (hell unterlegt) befinden sich an unserer Schule, und wir vermuten, wie an jeder anderen auch, Elemente bzw. Aktionsfelder, die man als Fortführung bzw. Intensivierung der "normalen" pädagogischen Arbeit bezeichnen kann; wie z. B. Schulpartnerschaften, Wanderfahrten bzw. Schullandheimaufenthalte, äußere Gestaltung des Schulgebäudes und der Schulhöfe usw. Die für unsere Schule profilbildenden Programmpunkte sind in den dunkel unterlegten Kästen zu finden: Innere Schulreform Eine-Welt-Arbeit Öffnung zur Berufs- und Arbeitswelt Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und die Projekte der Galerie LISE selbildungs-verfahren" sprechen. Über Vernetzungsmöglichkeiten sollte man erst dann nachdenken, wenn die Inseln dauerhaft geworden sind. Drei Voraussetzungen scheinen uns allerdings erforderlich zu sein: Die Schule bzw. ein Teil davon (was der Normalfall sein dürfte) muß eine pädagogische Zielsetzung bzw. auch einzelne Ziele (im Sinne einer Utopie) entwickeln. Die reale Situation muß spürbare Mängel aufweisen bzw. Unzufriedenheit produzieren. (wobei einsichtig ist, daß sich diese beiden Voraussetzungen aufeinander beziehen) Es muß eine tatkräftige Gruppierung geben, deren Motivation sich aus der oben geforderten Zielsetzung speist. Nur das Zusammentreffen dieser drei Faktoren hat an unserer Schule zur Entwicklung der charakteristischen Programmpunkte geführt, die wir im folgenden vorstellen. (Horst Thelen) Es ist nicht beabsichtigt, durch diese grafische Zusammenstellung den Eindruck zu erwecken, als ob es sich um ein einheitliches, inhaltlich durchstrukturiertes Schulprogramm-Konzept handle; es geht vielmehr um eine - noch nicht einmal auf Vollständigkeit bedachte - Überblicksmöglichkeit über pädagogische Aktionsfelder, die - systematisch betrachtet - durchaus unterschiedlichen Ebenen zugeordnet werden können. Das halten wir jedoch nicht für einen Nachteil, sondern sehen darin unseren eigenen komplexen Schulprogramm-Prozeß zutreffend gespiegelt. Wir glauben nämlich nicht, dass sich ein Schulprogramm theoretisch setzen bzw. aus den Richtlinien und Lehrplänen deduzieren läßt (dagegen sprechen auch alle Ergebnisse der neueren konstruktivistischen Psychologie). Stattdessen möchten wir für ein anderes Vorgehen plädieren, durch das - basisorientiert - einzelne Reform-Inseln innerhalb der Schule gebildet werden. Vielleicht kann man deshalb von einem "In- 73
75 Die Innere Schulreform seit 1986 Die Einführung der Freien Arbeit am LISE-MEITNER-GYMNASIUM 1986 von Petra Madelung, Doris Willenberg-Köhler, Susanne Pauls Vor 12 Jahren wurde am Lise-Meitner-Gymnasium die Freie Arbeit eingeführt, die sich zum Kristallisationspunkt für eine innere Schulreform entwickelt hat. Anlass Sinkende Lernbereitschaft, nachlassende Konzentrationsfähigkeit und Schwierigkeiten, kontinuierlich zu arbeiten, zugleich aber auch Probleme im Sozialverhalten und die abnehmende Bedeutung der Schule als Ort der Sozialisation und Persönlichkeitswerdung waren vorläufige Diagnosen, die nach einem Therapieversuch verlangten und die in Verbindung mit der Einführung der neuen Grundschulrichtlinien 1985 zu einem Reformdruck auf die weiterführenden Schulen führten, dem wir nicht ausweichen wollten. Katalysatorfunktion von freier Arbeit Projektorientiertes Arbeiten Diagnose in der Erprobungsstufe Schulprogramm Schulleben Persönlichkeitsbildung Kompensation, Förderung Anknüpfung an Arbeit der GS Freie Arbeit Lerntechniken Zusammenarbeit mit GS-Lehreren Elternarbeit Diskussion unter FachkollegInnen/ in Fachkonferenzen Fächerübergreifendes Arbeiten Lehrerrolle Lernumfeldveränderrung -Klassenraum -Bibliotheken 74
76 Ziele Zentrales Motiv war es, die in den Grundschulrichtlinien neu angelegte Betonung der individuellen Förderung der Grundschüler und Grundschülerinnen und das Streben nach der Integration der einzelnen Fächer aufzunehmen, fortzusetzen und für die Arbeit im Gymnasium nutzbar zu machen. Dies schien am ehesten in der Freien Arbeit realisiert, mit der wir folgende Ziele anstreben: Selbstbestimmung und Selbständigkeit des Lernens werden erhöht, weil die Schüler und Schülerinnen den Lernprozeß selbst in der persönlichen Absprache mit dem Freiarbeits- oder Fachlehrer planen (Individualisierung). Das Selbstbewußtsein der Kinder wird durch persönliche Erfolgserlebnisse gestärkt, besonders bei der Erstellung eines Projektes Lern- und Übungsprozesse können je nach individuellem Leistungsvermögen organisiert und durchgeführt werden. Die Motivation erhöht sich, wenn Material oder Thema nach individuellem Interesse ausgewählt werden können. Das betrifft sowohl die Gegenstände als auch die Befindlichkeit des Kindes, das einmal Rückstände aufholen möchte, ein anderes Mal ein Interessengebiet vertiefen und ein drittes Mal einfach etwas tun möchte, was es mit Sicherheit kann und wo es deshalb bestimmt zu einem Erfolgserlebnis kommen wird. Die Schüler und Schülerinnen können demnach wählen zwischen Übungsaufgaben (v. a. Mathematik, Deutsch, Englisch), dem Herstellen von Anschauungsmaterial (z. B. für Biologie und Erdkunde), vertiefenden und ergänzenden Arbeiten zum Fachunterricht (z. B. Deutsch) und Projektarbeit (bezogen auf alle Fächer, auch fächerübergreifend). Die Kinder werden frühzeitig eingeführt in grundlegende Arbeitstechniken: Gebrauch von Nachschlagwerken, Benutzung der Bibliothek, Interviews machen und auswerten etc. Ganzheitliches Arbeiten wird verstärkt durch projektartige Erweiterung der Themen und Beanspruchung verschiedener Fähigkeiten (kognitiver, sinnlicher und kreativer). Verfahren Zwischen dem Beschluß der Lehrerkonferenz im Mai 1986, die Freie Arbeit als Versuch in den neuen 5. Klassen zweistündig pro Woche einzuführen, und der Genehmigung durch die Schulaufsicht vor Beginn des neuen Schuljahres fanden 14-tägige Treffen interessierter Kollegen und Kolleginnen statt, um Organisation und Inhalt von Freier Arbeit zu erörtern und zu koor- Dieses Kind ist ganz und gar vom Lernvorgang absorbiert, es befindet sich in einer sensiblen Phase ( Maria Montessori). Solche Lernhaltungen sind typisch für Freie Arbeit. 75
77 dinieren. Daneben holten wir uns Anregungen durch Hospitationen an Montessori-Gymnasien in Krefeld und Bonn. Ende 1986 beschloß die Lehrerkonferenz, die Freie Arbeit in den Klassen 5 und 6 durchzuführen. Im November 1988 erfolgte eine erste Bestandsaufnahme und der Beschluß, die Freie Arbeit auch in Stufe 7 fortzuführen. Es fanden ein Erfahrungsaustausch aller Freiarbeitslehrer und Freiarbeitslehrerinnen, eine Ausstellung der Materialien, ein Gesprächskreis mit Eltern und ein Pressegespräch statt. Materialien für die Freie Arbeit, die ästhetisch ansprechend sein, sinnliche Erfahrung ermöglichen und auf Selbstkontrolle angelegt sein sollen, wurden von den Fachlehrern und Fachlehrerinnen individuell oder in kleinen Fachgruppen erstellt. Mittlerweile bietet der Markt bereits eine Fülle von Materialien, die aber auch nicht unbesehen eingesetzt werden können, sondern für die jeweilige Funktion adaptiert werden müssen. Im Laufe der Jahre hat sich ein bewährter Grundstock in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik angesammelt, auf den Kollegen und Kolleginnen, die neu in der Unterstufe unterrichten, zurückgreifen können. In den anderen Fächern hapert es mit der Bereitstellung von Material und Aufgaben. Die Thematisierung der Einbindung aller Fächer auf den Fachkonferenzen hat noch nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. In der 7. Klasse lösen sich die Arbeitsformen allmählich von den klassischen Materialien. Die Erarbeitung kleinerer Projekte, die thematisch an den jeweiligen Fachunterricht der Klassenstufe angebunden sind (z. B. Geschichte, Erdkunde, Sport) und die auch neben dem Freiarbeitslehrer mit vom Fachlehrer betreut werden, erlangt größeres Gewicht. Jetzt greifen die Schüler und Schülerinnen verstärkt auf das Angebot unserer Bibliotheken und auf die Hilfestellung der Bibliothekarin zurück. nur von etwa 30 % der Kollegen und Kolleginnen getragen und mit Material unterstützt. Die fehlenden Strukturen zur Kooperation am Gymnasium erschweren die notwendige Zusammenarbeit der Fachkollegen und Fachkolleginnen. Die zwei Wochenstunden in den Klassen 5, 6 und 7 sind zu wenig, um den Arbeits- und Lernstil durchschlagend zu prägen. Die Probleme der gegenwärtigen Schulsituation kristallisieren sich in der Freien Arbeit: Viel zu große Klassen erschweren die intensive individuelle Betreuung und verhindern die für eine gute Lernatmosphäre wichtige und in der Freien Arbeit unabdingbare pädagogisch sinnvolle Gestaltung des Lernumfeldes. Dennoch meinen wir rückblickend, daß sich der Einsatz lohnt, da er die pädagogische Diskussion im Kollegium anregt, Chancen für neue und andere Erfahrung mit Schule eröffnet und weil er - ganz allgemein gesprochen - der Stagnation entgegenwirkt. Es wird zu prüfen sein, ob die Freie Arbeit in den Klassen 5 bis 7 ( ggf. auch auf folgende Jahrgangsstufen) ausgeweitet werden soll. In den 1992 erschienenen neuen Richtlinien für die Sekundarstufe I des Gymnasiums steht der folgende wichtige Satz: "Wo die Voraussetzungen gegeben sind, sollte auch die in vielen Grundschulen praktizierte "freie Arbeit" weitergeführt werden." Damit wird die Einführung der freien Arbeit am Lise- Meitner-Gymnasium durch das Ministerium endgültig als zukunftsweisend bestätigt. Da wir bisher die Freie Arbeit aus personellen und organisatorischen Gründen noch nicht über die Jahrgangsstufe 7 hinaus ausdehnen konnten, haben wir 1989 durch einen Lehrerkonferenzbeschluß die Jahresarbeit für die Stufe 8 eingeführt. Reflexion Trotz der positiven Zielsetzung, Versuche und Erfahrung soll nicht verschwiegen werden, daß sich auch Rückschläge einstellen und Hindernisse aufbauen, die sich kurz so skizzieren lassen: Auch nach zwölfjähriger Praxis wird die Freie Arbeit 76
78 Einführung der Jahresarbeit in Stufe 8 Freies Arbeiten in 5 bis 7 - und dann? Gesteuert durch Materialangebot und Beratung durch den/die FreiarbeitslehrerIn verändert sich die Freie Arbeit langsam vom Beginn der Stufe 5 hin zum Ende der Stufe 7. Die Zielrichtung heißt projektorientiertes Arbeiten, was kleinere individuelle sowie größere fächerübergreifende Projekte umfaßt. In der Stufe 8 fertigen unsere SchülerInnen eine sogenannte "Jahresarbeit" an, für die autonome Arbeitsplanung und das Aufrechterhalten der Motivation über einen längeren Zeitraum Voraussetzungen sind. Themen werden individuell von den SchülerInnen gewählt und mit den FachlehrerInnen besprochen, die die in etwa 4 Monaten entstehenden Arbeiten betreuen und vorsichtig wissenschaftsorientiertes Arbeiten fördern. Nach zwei Probeläufen ist die Jahresarbeit endgültig und verbindlich für alle Schüler und Schülerinnen eingeführt worden. Diese zusätzliche ganzheitliche Anforderung ist zu einer festen Größe im Bewusstsein unserer Schülerschaft geworden; nach 9 Jahren ist die anfänglich geäußerte Skepsis vergessen, die Jahresarbeit gehört mit zum Schulprogramm! Reise- und Erfahrungsberichte und Praktikumsberichte in 9 und 10 In den Stufen 9 und 10 liegen Akzente unserer Arbeit auf Austauschprogrammen mit englischen und französischen Partnerschulen, die in Reise- und Erfahrungsberichten z. T. in der Fremdsprache reflektiert werden, und einem zweiwöchigen Betriebspraktikum mit dem Ziel, einen wirklichkeitsnahen Einblick in die Wirtschaft- und Arbeitswelt zu gewinnen, wobei ein Praktikumsbericht wieder dazu dient, erworbene Kenntnisse systematisch darzustellen und neue Erfahrungen kritisch zu beleuchten. Das Bemühen um die Schriftlichkeit unserer Bildungsbestrebungen bleibt so durch die ganze Mittelstufe hindurch gewährleistet. Das Kollegium
79 Berufswahlvorbereitung an der Lise-Meitner-Schule in Leverkusen Die Berufswahlvorbereitung wird an der Lise-Meitner-Schule v. a. im Rahmen zweier großer Zeitblöcke in der Mittelstufe (Jahrgangsstufe 8-9) und in der Oberstufe (Jahrgangsstufe 12 bis 13) organisiert. Das zweiwöchige Betriebspraktikum (BP) in der Jahrgangsstufe 9 findet seit nunmehr 10 Jahren an der Lise-Meitner-Schule statt, während die zwei Berufsorientierungswochen (BOW) der Jahrgangsstufe 12 bereits 1979 "in Serie" gingen und damit das erste Praktikum dieser Art eines Leverkusener Gymnasium darstellte. Das Betriebspraktikum gibt den Schülern noch während ihrer Schulzeit die Möglichkeit, die ihnen fremde und weitgehend verschlossene Arbeits- und Wirtschaftswelt an einer konkreten Stelle kennenzulernen und zu erkunden. Über die in verschiedenen Lernbereichen vermittelten Kenntnisse hinaus können Schüler im Praktikum durch Beobachtung, Information und Ausübung elementarer Formen berufstypischer Tätigkeiten mit Ernst- und Bewährungscharakter konkrete Erfahrungen mit realitätsnahen Arbeits- und Sozialsituationen gewinnen. So werden sie zu kritisch-produktiver Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Bereichen angeregt. Das Betriebspraktikum wird in mehreren Unterrichtsreihen in den Stufen 8 und 9 vorbereitet und in Form eines umfangreicheren Praktikumsberichts, der die Schüler und Schülerinnen zur Sytematisierung und Reflexion der gewonnenen Erfahrungen anregt, ausgewertet. Das Betriebspraktikum ist nicht Teil einer vorweggenommenen Lehre oder produktive Arbeit zum Null-Tarif, sondern ein mehrwöchiger Aufenthalt in handwerklichen, industriellen, kaufmännischen oder Dienstleistungsbetrieben, der vor allem das Kennenlernen betrieblicher Strukturen und verschiedener Berufsfelder in Verbindung mit einfachen Arbeiten unter Anleitung umfaßt. In jedem Betrieb steht den Schülern ein Betreuer zur Seite. In Konfliktfällen vermitteln verantwortliche Lehrer. Da das Betriebspraktikum eine schulische Veranstaltung ist, entfällt eine finanzielle Vergütung für die Schüler. Die Schüler sind während des Praktikums durch den Schulträger unfall- und haftpflichtversichert und werden, soweit erforderlich, kostenlos ärztlich untersucht. Die anfallenden Fahrtkosten werden erstattet. Auch in den Berufsorientierungswochen "schnuppern" die Schülern und Schülerinnen in den von ihnen gewünschten Berufen. In den beiden Wochen sollen die Schüler und Schülerinnen anstelle des Unterrichts Gelegenheit haben, einen ihrem Studien- und Berufswunsch entsprechenden Arbeitsplatz soweit wie möglich kennenzulernen. Die Selbsterkundung in der Praxis soll als Impuls dazu beitragen, den angehenden Abiturienten und Abiturientinnen die zukünftigen Entscheidungsprozesse über Studium und Beruf zu erleichtern. Die BOW wird von vorbereitenden und nachbereitenden Maßnahmen flankiert, die in die Hochschultage der Jahrgangsstufe 13 münden, an denen die Schüler und Schülerinnen Gelegenheit erhalten, die Universität Köln und andere Hochschulen zu besuchen, um sich vor Ort über Studienfächer und Studiengänge, Prüfungsanforderungen und Berufsaussichten zu informieren. Die Öffnung zur Berufs- und Arbeitswelt, die an unserer Schule nunmehr seit fast zwanzig Jahren praktiziert wird, erfährt selbstverständlich durch diverse Betriebsbesichtigungen eine konkretanschauliche Ergänzung, die sicher in der Zukunft noch weiter ausgebaut wird. ( Michael Bramhoff ) 78
80 (Michael Bramhoff) 79
81 Projektphase in Stufe 11 Für die Erneuerung unserer Oberstufenarbeit sind ganzheitliches und interdisziplinäres Lernen sowie eine gezielte Förderung wissenschaftspropädeutischen Arbeitens die zentralen Stichwörter. Wir haben versucht diesen Zielvorstellungen durch Einrichtung einer Projektphase zu Beginn der Stufe 11 gerecht zu werden. In den bisher drei Probeläufen hat es zwar jeweils Verbesserungen in der Konzeption und im Verfahren gegeben, aber es ist uns allen klar: Weitere Optimierungen sind notwendig. Im Schuljahr 1998/99 werden wir die Projektphase dazu nutzen, das Methoden- und Kommunikations- Training nach Dr. Heinz Klippert einzuführen; dadurch soll die wissenschaftspropädeutische Kompetenz unserer Schülerschaft zu Beginn der Oberstufe systematisch gefördert werden. Facharbeit in Stufe 12 Nach all den Vorerfahrungen schreiben unsere Schüler/innen (seit dem Schuljahr 1994/95) in der Stufe 12 eine individuelle Facharbeit in einem frei gewählten Fach und bei einer relativ frei gewählten Lehrperson. 80
82 Man kann diese Arbeit als Oberstufen-Pendant zur Jahresarbeit der Stufe 8 bezeichnen. Während es in der Mittelstufe um erste Wissenschaftsorientierung geht, bietet die Facharbeit der Stufe 12 Gelegenheit zu wissenschaftspropädeutischer Arbeit in einem Fach oder ggf. auch fächerübergreifend. Die Facharbeit ist gewissermaßen die "Nagelprobe" für Studierfähigkeit. Themenzentrierte Literaturarbeit mit Einübung in den "wissenschaftlichen Apparat", problembezogene empirisch-statistische Untersuchungen, Feldund/oder Labor-Experimente oder auch kreativkünstlerische Problemdarstellungen sind die Möglichkeiten, unter denen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Wahl treffen können. Die Facharbeit soll in der Regel in einem der beiden Leistungskurse geschrieben werden, in jedem Fall aber in einem schriftlich gewählten Fach. Im ersten Probelauf ist die Arbeit in 12,II geschrieben worden, für Themenfindung, Literatursuche bzw. Materialarbeit und das Schreiben selbst standen jeweils etwa 6 Wochen Zeit zur Verfügung ( insgesasmt 18 Wochen). Mittlerweile lassen wir die Vorphase bereits in 12,I beginnen, so dass der Abgabetermin auf jeden Fall vor den Osterferien liegen kann. Bei diesen zeitlichen Rahmenbedingungen kann es sich nur um eine Arbeit mit begrenzter Themenstellung und unter angemessener Beratung handeln, denn der übrige Unterricht läuft ja während der Ausarbeitung weiter. Daher soll das Thema vom verantwortlichen Lehrer in Absprache mit dem Schüler festgelegt werden; der Lehrer soll sicherstellen, dass das Thema realistisch begrenzt wird. Während der Entstehungsphase sind mindestens vier Beratungsgespräche zwischen Schüler/in und betreuender Lehrperson verpflichtend. Eine Lehrperson soll möglichst nicht mehr als 5 Facharbeiten gleichzeitig betreuen, damit die individuelle Beratung gewährleistet bleibt. Sollten bei starken Jahrgängen Engpässe entstehen, so springen Lehrpersonen aus anderen Stufen ein, die aber die Lehrbefähigung für Oberstufe haben müssen. Als kleines Äquivalent für die Mehrbelastung der Beteiligten entfällt eine Klausur in 12/II für die Schüler in dem Fach, in dem sie die Facharbeit schreiben. Die Note der Facharbeit wird anstelle der Klausurnote eingetragen. Die fächerübergreifende Anforderungsstruktur bezüglich der Facharbeit ist vollständig erarbeitet (vgl. hierzu die abgedruckte Graphik!), die fächerspezifischen Anforderungen werden zur Zeit von den Fachkonferenzen erstellt. Die Einführung der Facharbeit am Lise-Meitner- Gymnasium ist vom Ministerium für Schule und Weiterbildung genehmigt worden. Anfangs war die Facharbeit in den Mitwirkungsgremien sehr umstritten. Nach zwei Probeläufen ging die Skepsis aber so weit zurück, dass letztendlich die Schülervertreter in der Schulkonferenz den Antrag auf endgültige verbindliche Einführung der Facharbeit in der Stufe 12 stellten. Dieser Antrag der Schüler wurde mit großer Mehrheit angenommen. Fazit: Inzwischen ist klar: Unsere Erfahrungen mit der Facharbeit fließen in die neuen Oberstufen- Richtlinien ein, durch die die Facharbeit obligatorisch an den Gymnasien Nordrhein-Westfalens eingeführt wird. Wieder einmal hat sich ein wesentliches Element unserer inneren Schulreform als zukunftsträchtig erwiesen! (G. Löw, Edda Mehne) 81
83 Computer und Telekommunikation von Michael Bramhoff Voraussetzungen: Die LMS hat sich erfolgreich um Aufnahme in das Projekt "NRW-Schulen ans Netz - Verständigung weltweit!" beworben und ist als geförderte Schule damit die Verpflichtung eingegangen, sog. Internet-Projekte durchzuführen und darüber zu berichten. Die Vorläufigen Richtlinien zur Umsetzung einer informations- und kommunikations-technologischen Grundbildung ( vgl. BASS Nr. 7 ) und die Denkschrift "Zukunft der Bildung..." betonen gleichermaßen die durch die Neuen Technologien bewirkten und veränderten Bedingungen eines "Lernen(s) in der Informationsgesellschaft" (Denkschrift, S.134), dem die Schule durch den "Aufbau von Medienkompetenz" (ebd., S. 137) Rechnung tragen müsse. Durch die Koppelung von "Computer und Telekommunikationsnetzen" (ebd., S. 26) entstehen weltweite Informations- und Kommunikationsnetze mit völlig neuartigen Anwendungsmöglichkeiten. Die Schüler sollen in diesen vernetzten Systemen "Informations-, Kommunikations- und Gestaltungskompetenz" (vgl. Telekommunikation in der Schule, hrsg. v. Landesinstitut f. Schule u. Weiterbildung, Soest 1996, S. 36) gewinnen, v.a. durch fächerübergreifende Unterrichtsprojekte. Folgerungen: Die Profilbildung unserer Schule sollte durch den Auf- und Ausbau konkreter Internet-Projekte um den Schwerpunkt "Telekommunikation im Unterricht" ergänzt werden. Diese Projekte sollten in einer ersten Versuchsphase zunächst im Differenzierungsbereich der Sek. I und als zeitlich begrenzte Unterrichtssequenzen in einzelnen Kursen der Sek II erprobt werden. "Telekommunikation im Unterricht" sollte im Rahmen des Modellversuchs der Bertelsmann- Stiftung als einer unserer pädagogischen Schwerpunkte angemeldet werden. Konkretionen: Die Anwendungsmöglichkeiten von Computernetzen (speziell: des Internet) als Unterrichtsmedium sind vielfältig. Recherche: Für praktisch alle U-Fächer lassen sich aus dem Internet relevante und aktuelle Materialien gewinnen, die unmittelbar im Unterricht ausgewertet werden können, sei es die Suche nach Fachliteratur, Zeitungsartikeln, Dokumenten aus Datenbanken. Da sich zunehmend alle öffentlichen und privaten Institutionen und Organisationen im Internet präsentieren, hat man auf deren Datenbestände direkten und aktuellen Zugriff. Dies gilt auch z.b. für Universitäten, Forschungsinstitute oder Bibliotheken. Besonders für das gesellschafts- und naturwissenschaftliche Aufgabenfeld ergeben sich lohnende Möglichkeiten. Eine ungeheure Datenmenge läßt sich auf einer einzigen CD-ROM konzentrieren, die dann als offline- Medium zu Nachschlagezwecken dienen kann (z.b. Enzyklopädie). Durch unmittelbare Verknüpfungen und die multimediale Präsentation wird auf einer guten CD-ROM vernetztes Denken gefördert. Kommunikation Durch Briefwechsel per lassen sich schnell und direkt weltweit Informationen austauschen, die in Unterrichtsprojekte, vor allem der Fremdsprachen, eingebunden werden können. Im Internet (Abteilung Usenet) existieren zahlreiche, themengebundene Diskussions- und Informationsforen (Newsgroups), an denen man partiell mit Klassen und Kursen teilnehmen kann (in Englisch, aber auch in Deutsch). Die Eröffnung einer eigenen Newsgroup ist kein Problem. Elektronische Publikation bzw. Repräsentation Das Internet, besonders das World Wide Web (WWW), eignet sich hervorragend für die Publikation von Unterrichtsergebnissen aller Art. Auch dabei lassen sich multimediale Elemente miteinander verbinden. Zu denken wäre hierbei an besonders gelungene Jahresarbeiten, Praktikumsberichte oder Facharbeiten, an künstlerische Produkte, an Berichte und Dokumentationen von Unterrichtsprozessen, und Projekten. Auch die Selbstdarstellung unserer Schule, das Schulprofil, pädagogische Schwerpunkte, Berichte 82
84 von Ausstellungen, Schülerzeitung, Eltern- und Schülerarbeit, können einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden; als Kommunikationsbasis für Schüler, Lehrer und Eltern könnte ein LMS-Forum im Netz dienen. [ Sicherlich wird es bald ein NetLev geben, in das wir uns "einklinken " können (und auch sollten). ] Unterrichtsbank Das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung wird einen NRW-Bildungsserver im Netz bereitstellen, der moderierte und geprüfte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellt (existiert allerdings erst in Anfängen), die jederzeit abgerufen werden können. Die einzelnen Schulen können (und sollten) diesen Bildungsserver auch mit eigenen Unterrichtsmaterialien bestücken, so daß auf lange Sicht eine umfangreiche und praktikable "Unterrichtsbank" entstehen kann. Es ist geplant, den Bildungsserver auch als landesweites Diskussionsforum für die Schulen zu nutzen. Resumee: Der Schwerpunkt "Telekommunikation im Unterricht" eignet sich besonders in Verbindung mit fächerübergreifendem Unterricht und mit der Gestaltung und Öffnung von Schule (GÖS) für eine Profilbildung im Rahmen eines eigenständigen Schulprogramms. Geschichte des Internet-Kurses Am Anfang war...eine Projektwoche der Stufe 11 an unserer Schule. Wir, ca. 12 Schülerinnen und Schüler aus der 11, wollten den gerade frisch installierten ISDN-Anschluß an unserer Schule für ein Internet-Projekt zu nutzen. Wir sprachen Herrn Bramhoff, der an unserer Schule für den Modellversuch "Schulen ans Netz" zuständig ist, wegen Betreuung und Beratung an. Herr Bramhoff war sofort begeistert von unserer Idee, und auf einer ersten Vorbesprechung einigten wir uns schnell darauf, für unsere Schule einen ersten Entwurf für eine Homepage zu "basteln". Da der vom Modellversuch "Schulen ans Netz" versprochene Rechner noch nicht eingetroffen war, mußten wir unsere Computer von zu Hause anschleppen. Mit drei Privatrechnern, von denen wir zwei ans Netz angeschlossen hatten, begannen wir am ersten Projekttag mit den Vorbereitungen zum Bau unserer Homepage. Damit waren viele Probleme verbunden, die es erst mal zu überwinden galt. Unter anderem hatten wir mit Softwarekonfiguration und defekten Hardwarekomponenten (u.a. ISDN- Netzterminator) zu kämpfen. Am Ende der Projektwoche hatten wir neben der Problembehebung nur ein kleines Gerüst der Homepage aufgebaut. Doch nun standen uns immerhin die Internet-Zugänge von AOL, CompuServe und T-Online zur Verfügung. Nach einigen Wochen traf dann endlich der "Schulen ans Netz"- Rechner ein. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Projektgruppe in eine Internet AG zu überführen. Die AG wurde vom "harten Kern" der Projektgruppe fortgeführt, um die Homepage endlich zu vollenden. Dabei hatten wir jedoch weitere Probleme, die wir aber mit unserem neu erworbenen Fachwissen souverän umschifften. Als die Homepage endlich "heiß" im Netz stand, konnten wir uns dann auch anderen Themen widmen. Wir hatten dann unter anderem einen - Austausch mit Finnland und Rußland, welcher sehr 83
85 Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung (IKG) für alle Die Lise-Meitner-Schule wird in den nächsten zwei Schuljahren ein neues Projekt starten, und zwar die Integration der informations- und kommunikationstechnologischen Grundbildung (IKG) in den Wahl-pflichtbereich II der Stufen 9 und 10. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten im Differenzierungsunterricht im Verlauf der zwei Schuljahre eine projektorientierte und anwendungsbezogene Grundbildung im Umgang mit dem Computer, deren Umfang allerdings zeitlich begrenzt ist. In allen Differenzierungskursen werden im Verlauf der zwei Schuljahre IKG-Projekte von ca. zehnwöchiger Dauer sukzessive durchgeführt. In diesen IKG-Projekten werden aktuelle Anwendungsprogramme für den Computer mit einer geeigneten Thematik des jeweiligen Kurses gekoppelt, so dass der Differenzierungsunterricht auch für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht den Kurs Informatik be-legen können oder wollen, einen Beitrag zur informations- und kommunikationstechnologischen Grund-bildung in der Schule leistet. Konkret werden die Projekte in den einzelnen Differenzierungskursen zwei inhaltliche Schwerpunkte haben: Anwendungsbezogene Kenntnisse,Datenverwaltung, Textverarbeitung, Tabellen, Internet (Recherche, Kommunikation, Publikation), Gestaltungsfähigkeit, Bildbearbeitung, Grafische Visualisierung, Multimediale Präsentation in HTML-Publikationen Im einzelnen wird sich der Unterricht mit der praktischen Lösung z. B. folgender Fragen beschäftigen: 1) Windows 95: Wie startet und beendet man Programme? Wie greift man auf die verschiedenen Laufwerke (Festplatte, Diskette, CD-ROM) zu? Wie verwaltet man Ordner und Dateien (speichern, kopieren, verschieben, löschen)? Word und Excel: Wie werden Texte und Tabellen mit dem Computer erstellt und verändert, wie werden sie formatiert (in eine äußerlich ansprechende Form gebracht), wie werden sie gedruckt und gespeichert? 2) Internet-Anwendungen: a) Wie kann der Computer via Telefonleitung zur schnellen Kommunikation genutzt werden? Wie lässt sich ein elektronischer Briefwechsel per organisieren? Dieses Projekt bietet sich natürlich in erster Linie für die Fremdsprachenkurse an, indem in der jeweiligen Fremdsprache unsere Schüler mit französischen und russischen Partnerschulen Erfahrungen zu einem bestimmten Thema austauschen und so Sprachkompetenz in einer authentischen Kommunikations-Situation erwerben können. b) Wie können das Internet und die Online-Dienste als Informationsquelle für den Unterricht genutzt werden? Wie sucht und findet man im Internet geeignete Daten zu bestimmten Themen und Sach-gebieten? Wie lädt man diese Daten auf den eigenencomputer, wie kann man sie speichern und drucken? c) Wie lassen sich Unterrichtsergebnisse im Internet publizieren, z. B. auf der schuleigenen Homepage ( d.h. wie erstellt man Dokumente im HTML-Format? 3) Picture Publisher, Paint Shop Pro: Wie lassen sich Bilder (Zeichnungen, Grafiken, Fotos, Clips) erstellen, scannen und nachbearbeiten? Wie kann man Unterrichtsprodukte grafisch visualisieren und präsentieren? Wie lassen sich HTML- Dokumente multimedial aufbereiten, z. B. akustisch (durch Sounds) und visuell (durch animierte Grafiken)? Abschließend möchten wir betonen, dass diese computergestützten Projekte in den Differenzierungskursen zeitlich begrenzt sind und insofern nur grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgangmit den digitalen Medien vermitteln können. (Michael Bramhoff) 84
86 erfolgreich war und als Beispiel für kommende - Austauschprogramme dienen sollte. Eine Videokonferenz mit einer Schule in den USA via Internet verlief jedoch im Sande, da der Zugang von AOL und den anderen Onlinediensten für die Videodaten zu langsam war. Nach diesem erfolglosen Versuch kümmerten wir uns erst einmal wieder um die Überarbeitung unserer Homepage. Es wurden zusätzliche Seiten erstellt und Grafiken eingefügt. Danach setzten wir uns zusammen und machten uns Gedanken über die Zukunft der Internet AG. Wir kamen zu dem Entschluß, das die Gruppe zu groß für die Arbeit an einem einzigen Rechner ist, und das die Anschaffung neuer Systeme nötig war. Ende des Schuljahrs '96/'97 wurde beschlossen, daß die AG nach der Sommerpause (=Sommerferien) in einen Grundkurs für die Oberstufe überführt werden sollte, den wir dann Telekommunikations GK - kurz "ComTech" - nannten. Von der Schuletatkonferenz wurde uns dann die Anschaffung zweier neuer Rechner finanziert. Diese wurden dann Ende der Ferien gekauft. Nach den Ferien wurden die Rechner dann endlich im Internet-Raum aufgestellt und mit einem Windows95 - Netzwerk untereinander verbunden. Über das Netzwerk kann inzwischen jeder Rechner auf das Internet zugreifen, und die Dateien können gemeinsam verwaltet werden. Ein neuer Provider sorgte hier für einen schnellen Zugang zum Netz der Netze. Endlich konnte zumindest halbwegs vernünftig gearbeitet werden. Also wurde beschlossen, die Homepage in Zusammenhang mit einem Multimedia- Wettbewerb einer Kölner Zeitung für Schulen vollständig zu überarbeiten. Wir einigten uns auf ein komplett anderes Layout und neue Inhalte. Natürlich wurden auch einige alte Inhalte übernommen. Bevor wir loslegen konnten, bekamen wir noch weitere Rechner, die allerdings älter und langsamer waren. Einige waren nicht mal funktionstüchtig. Aus den Bestandteilen dieser Rechner wurden von uns drei funktionierende PCs zusammengeschraubt, die wir dann in unser Netzwerk integrieren konnten. Natürlich gab es auch bei diesen Rechner wieder Probleme. Hauptsächlich lag dies an der Installation von Windows95, da nur einer der drei über ein CD- ROM-Laufwerk verfügte. Auch später traten Probleme in den Systemdateien auf, die aber beseitigt werden konnten. Derzeit läuft das Netzwerk zum Teil langsam aber einwandfrei. Jetzt machten wir uns endlich an die Programmierung der neuen Homepage, die hoffentlich vorläufig fertig ist, wenn dieser Text im Netz zu lesen ist... 85
87 ÜBETREUung - Schüler lernen von Schülern Üben, Klassenarbeitsvorbereitung und Nachhilfe in betreuten Kleingruppen von Bernd Müller Der Ursprung Bei den pädagogischen Tagen 1994 äußerten SchülerInnen der Klasse 8 den Wunsch, die in der Freiarbeit kennengelernte selbständige und gemeinschaftliche Arbeitsweise fortzusetzen (die Freie Arbeit endet mit Klasse 7). Sie wollten in kleinen Gruppen jeweils in einem bestimmten Fach Unterrichtsstoff wiederholen, Hausaufgaben anfertigen oder für Klassenarbeiten üben. Arbeitsräume und -mittel waren durch die große Schulbibliothek vorhanden, und eine fachkundige Anleitung wurde mit der BETREUung durch OberstufenschülerInnen gefunden. Antonia Illich, mit 8-Klässlerinnen, KSTA vom 28./29. März 1998, Bild von Holger Schmidt Das Projekt Das organisatorische Verfahren ist denkbar einfach: die KlassenlehrerInnen der Sek. I ermitteln die sich 86
88 selbst konstituierenden Lerngruppen (3 oder 4 Personen) mit ihren Fächer- und Terminwünschen, gleichzeitig fragen die KurslehrerInnen der Sek. II in den angebotenen Fächern nach interessierten OberstufenschülerInnen, wobei sie nur Betreuer- Innen weiterleiten, deren fachliche Eignung sie bestätigen können Der Projektleiter bildet aus den Gruppennachfragen und Betreuungsangeboten ÜBETREUungsgruppen, die sich bei einer Laufzeit von zwölf Wochen im festen Wochenrhythmus jeweils für eine Zeitstunde im Anschluß an den Unterricht treffen (eine Verlängerung der Laufzeit oder der Arbeitszeit kann individuell vereinbart werden). Die OberstufenschülerInnen informieren sich vor Beginn der Arbeitsphase bei den FachlehrerInnen der Unter- oder MittelstufenschülerInnen über deren spezifische Defizite und über geeignete Arbeitsmaterialien. Die Eltern melden parallel zur Gruppenkonstituierung der SchülerInnen ihre Kinder einzeln und verbindlich an und zahlen für jedes Gruppentreffen DM 5,-- pro Kind, wodurch die OberstufenschülerInnen je nach Gruppenstärke DM 15,-- oder 20,-- für jede Betreuungsstunde erhalten. Ein Organisationsbogen, der mit dem Anmeldeformular der OberstufenschülerInnen gekoppelt ist, sichert durch Gegenzeichnung jedes Einzelschrittes den reibungslosen Ablauf des Projekts (seine Abgabe beim Projektleiter am Ende einer Projektphase kann mit einer Evaluation verbunden werden). leitete Gruppenarbeitsmöglichkeit, es reagiert auf das Elternbedürfnis nach kostengünstiger und qualitativ nachvollziehbarer Lernhilfe, es unterstützt die FachlehrerInnen bei der gezielten Einzelförderung, und es stellt einen sinnvollen Nebenverdienst für die OberstufenschülerInnen dar - es tut dies alles, indem es Kenntnisse, Fähigkeiten und Motivationen von OberstufenschülerInnen nutzt, die bereits vorhanden sind und nicht weiter brachliegen müssen in einem "neuen Haus des Lernens". Das Ergebnis Das Projekt braucht keine zentrale Kontrolle, da sich die Beteiligten gegenseitig ansprechen, informieren und kontrollieren, es benötigt, wenn es einmal eingeführt ist, nur ein kleines Maß an Koordination und eine Anlaufstelle für Rückfragen und bindet so auf die Dauer wenig schulorganisatorische Arbeitskraft. Vom Schuljahr 1998/99 an wird die bisher steuernde und koordinierende Lehrperson ihre Aufgabe weitgehend an eine Oberstufenschülerin abgeben. Qualitätssicherung Das Projekt verspricht nicht mehr, als es halten kann, sichert aber die versprochenen Lernbedingungen durch institutionalisierte gegenseitige Kontrolle mit Organisationsbögen und evaluiert regelmäßig ihren Erfolg. Erschließung von Ressourcen Das Projekt führt unterschiedliche Interessen zu einer gemeinsamen Verwirklichung und zu gegenseitigem Gewinn zusammen: es bietet SchülerInnen eine ange- 87
89 Veränderte Rahmenbedingungen Die Unterstufenbücherei Lise-Meitner-Bibliothek Galerie Lise Eine-Welt-Cafe und Eine-Welt-Laden Veränderte Unterrichtsformen und neue Lernarrangements erfordern veränderte Rahmenbedingungen. 88
90 Die Unterstufenbücherei Die Einrichtung der Unterstufenbücherei ging auf die Initiative einer Kollegin und eines Kollegen zurück, die nach einer Vorlaufphase mit Besuchen bei diversen Schul- und Jugendbibliotheken das Projekt "Aufbau einer speziellen Bücherei für die Unterstufe" mit einer 6. Klasse und einigen Eltern innerhalb eines Schuljahres durchführten. von Petra Madelung Ziele Leseförderung und Freie Arbeit sind die beiden Felder, aus denen die Motivation für die Einrichtung einer speziellen Bücherei für die Unterstufe kommen könnte. Jede(r) Lehrer/in kennt die 10-jährigen (meist weiblichen) Leseratten, und jeder weiß, wie schwierig es ist, diesen Heißhunger auf Bücher über die Pubertät hinweg zu retten (oder gar Lesemuffel ein wenig hungrig zu machen!), und das, obwohl nicht zuletzt diese Erfahrung sich in einer kritischen Auseinandersetzung mit analytischen Lektüreverfahren und einer Hinwendung zur handlungs- und produktorientierten, kreativen Verfahren niedergeschlagen hat, was auch die neuen Richtlinien entscheidend geprägt hat. Allerdings kann auch eine veränderte Deutschdidaktik nicht zum gewünschten Ziel führen, wenn dem Deutschunterricht die Leseförderung allein überlassen bleibt. Die Schule muß versuchen, eine Art "Leseöffentlichkeit" (Hurrelmann) zu schaffen. Und an dieser Stelle kann eine Unterstufenbücherei einen wichtigen Beitrag leisten. Wir werben dafür in unserer Schulbroschüre mit folgendem Beitrag: "Was ist das, lesen?"..."lesen, das ist wie fliegen, fliegen aus unserer Küchentür hinaus hoch über die Bäume im Garten hin und weiter, immer weiter in fremde Länder und ferne Welten...Lesen, das ist wie segeln, segeln den Bach hinter dem Garten hinab und weiter, immer weiter durch reißende Ströme und endlose Meere....Lesen, ja das ist wie sehen mit anderen Augen....Weißt du, in jeder Geschichte findest du ein Stück von dir selbst. Du lernst dich selbst besser kennen." Schöner als Willi Fährmann in seinem Buch Der überaus starke Willibald kann man das kaum ausdrücken, und weil wir gerne etwas von dieser Faszination des Lesens an viele Kinder weitergeben möchten, haben wir vor elf Jahren die Unterstufenbücherei gegründet. Die Gründungs"väter" und -"mütter" waren SchülerInnen einer 6. Klasse, die mittlerweile schon zum Kreis der Ehemaligen gehören. Inzwischen gibt es ca Bücher: Abenteuer- bücher, Liebesromane, Gespenstergeschichten, Tierbücher, Sachbücher aus vielen Wissensgebieten, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Autor(en)innen von Joan Aiken, Kirsten Boie, Federica de Cesco, Collin Dann, Urs Fiechtner, Bernhard Grzimek über Peter Härtling, Erich Kästner, Astrid Lingren, Paul Maar, Christine Nöstlinger, Gudrun Pausewang bis zu Käthe Recheis, Heinz Sielmann, Mark Twain, Hermann Vinke, Renate Welsch, Arnulf Zitelmann sind mit ihren Kinder- und Jugendbüchern vertreten und auch das ist wieder nur eine kleine Auswahl. Es gibt unterschiedliche Gründe, in die UB zu kommen: Manche wollen ein ruhiges oder warmes Eckchen für die Pause und entdecken so nebenbei ein Buch, das sie lockt, andere haben nie genug Lesefutter und brauchen ständig Nachschub, manche suchen einen Arbeitsplatz für die Freie Arbeit oder auch Nachschlagwerke dafür. Manchmal kommen die Schüler/innen auch, weil es uns gelungen ist, eine(n) der Jugendbuchautor(en)innen in unsere Unterstufenbücherei zu einer Lesung einzuladen. So hatten wir im Oktober 1995 Gudrun Pausewang zu Gast; in den Jahren zuvor waren es Peter Härtling, Willi Fährmann und Urs Fiechtner. Ausleihe ist täglich in der 1. großen Pause - und das ist einem engagierten Team von Müttern zu verdanken, die sich zum Teil seit vielen Jahren um Bücher und Leser/innen kümmert. "Ist es mit dem Lesen wie mit dem Küssen?...Es ist wie bei Dornröschen??... Die Geschichten schlafen in den Büchern....Dann kommt einer, der liest und weckt sie auf. Das ist doch genau wie bei Dornröschen. Die wurde auch erst wieder lebendig, als der Prinz sie wachgeküßt hatte. Die Geschichten erwachen zum Leben, die Rosen beginnen zu duften, der Koch ohrfeigt den Küchenjungen, und Dornröschen blättert in einem Buch... Aufbau und Organisation Aufbau und praktische Überlegungen zur Raumgestaltung zur Buchauswahl und zur Anordnung der Bücher sollen nun einen Einblick in 89
91 unsere Erfahrungen mit unserer Unterstufenbücherei geben. Sie sollte ein Raum sein, in dem junge Schüler und Schülerinnen sich gerne aufhalten, vielleicht eine Art Oase in einem doch oft sehr unruhigen und auch deshalb anstrengenden Schulbetrieb. Teppichboden und bequeme Sitzmöbel scheinen uns fast genau so wichtig wie die Bücherregale. Man muß zum Schmökern "versinken" und - zumindest in den Pausen - Leseanregungen unverbindlich ausprobieren können. Das Angebot an Büchern sollte einladend und anleitend sein, das heißt, die Kinder sollen Bücher eventuell wiedererkennen, die sie aus dem eigenen Bücherregal oder aus der Grundschule kennen - so kann keine Schwellenangst entstehen; das heißt andererseits, die Kinder können hier Bücher entdecken, auf die sie selbst sonst nicht stoßen würden und deren Auswahl durchaus unter pädagogischen Gesichtspunkten erfolgt. Eine Unterstufenbücherei, die sich nur aus den Empfehlungen zum Deutschen Jugendbuchpreis speist, halten wir allerdings nicht für empfehlenswert, da diese Auswahl bei den Kindern leicht den Eindruck erwecken könnte, hier wollten Erwachsene ihr Leseverhalten in erzieherischem Sinn manipulieren. Die Anordnung der Bücher spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, daß die Kinder sich schnell heimisch fühlen sollen in ihrer Unterstufenbücherei. Wir haben uns für ein sehr einfaches System entschieden. Rot gekennzeichnet, in einem Teil des Raumes zusammengestellt und nach den Namen der Autoren alphabetisch geordnet, ist die erzählende Literatur. Blau gekennzeichnet und nach Fachgebieten geordnet (Geschichte, Politik, Geographie, Naturwissenschaften, Ökologie, Musik, Sport, Allgemeine Nachschlagwerke) sind die sogenannten Sachbücher. Der Buchmarkt ist auf diesem Gebiet zur Zeit sehr innovativ. Gab es vor einigen Jahren nur Was ist Was, so erscheinen heute laufend vor allem aus dem angelsächsischen Raum Sachbücher für Kinder und Jugendliche, die kompetent geschrieben und äußerst ansprechend gestaltet sind. An dieser Stelle muß nun ein Hinweis auf das zweite Motivationsfeld für die Einrichtung einer Unterstufenbücherei folgen. Das F r e i e Arbei- t e n an unserer Schule wäre sehr viel schwerer, wenn die Unterstufenbücherei nicht vielfältiges Material zur Verfügung stellen würde, da die Schüler und Schülerinnen für ihre zu Beginn kleinen und dann immer umfangreicher werdenden Projekte bis hin zur Jahresarbeit in Stufe 8 nutzen könnten. Der Zugriff auf dieses Material ist viel einfacher und schneller als in der großen Bücherei mit Bänden und einer komplizierteren Systematik. So unterstützt die Unterstufenbücherei ein Ziel des Freien Arbeitens, nämlich das Einüben selbständigen Arbeitens und insbesondere die Fertigkeit, Material zu finden, zu sichten und auszuwerten. Aus diesem Grund haben wir unsere Sachbuchabteilung in den letzten Jahren systematisch ausgebaut. Hinzu kommt, daß die Unterstufenbücherei ein zusätzlicher Arbeitsraum für Schüler und Schülerinnen während der Freiarbeits- Stunden ist. (Schlüssel im Sekretariat; Eintrag in Namensliste, um Verantwortlichkeit zu signalisieren.) Engagierte Mütter haben heute eine wichtige Funktion für den Fortbestand, da sich nach einigen Versuchen herausstellte, daß der Raum nur dann der Schulöffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, wenn die Bücher betreut werden. Eine Gruppe von zum Teil seit vielen Jahren tätigen Müttern, die ihren Nachwuchs bei den Pflegschaften der neuen 5. Klassen rekrutiert, berät täglich in der 1. großen Pause die Kinder, ordnet und pflegt die Bücher und stellt in einem speziellen Regal Bücher zu besonderen Themen zusammen und schafft dabei immer neue Leseanregungen. Als letzte, aber nicht unwichtigste Anmerkung zur Organisation sei erwähnt, daß die Katalogisierung selbstverständlich mit dem PC gemacht wird, Karteikarten und Kataloge mit einem Datenbankprogramm erstellt werden. Da wir in der Steinzeit der Schulcomputerei angefangen haben, arbeiten wir mit einer alten Version von Open Access; es gibt inzwischen weit komfortablere Bibliothekssoftwareauf dem Markt. Leseanregungen zu schaffen und eine "Leseöffentlichkeit" an der Schule zu etablieren ist auch das Ziel der mit einiger Regelmäßigkeit stattfindenden Autor/innen-Lesungen an unserer Schule, die jeweils in einigen Klassen projektartig vorbereitet werden (zum Beispiel: Besprechung ausgesuchter Werke, eigene kreative Versuche dazu, Gestaltung einer Ausstellung, Jahresarbeiten als Monographien, Theateraufführung nach Dramatisierung eines Buches). Besonders erfolgreich waren Projekte mit Willi Fährmann und Peter Härtling, weil sie in einem halbjährigen Vorlauf vorbereitet worden waren. Wenn allerdings nach Vorarbeit in den Klassen die Lesung nicht zum versprochenen Zeitpunkt stattfinden kann (Krankheit!), wenn sogar mehrfach verschoben werden muss, dann entstehen bei den Schülern Motivationsprobleme. Diese Erfahrung haben wir mit Gudrun Pausewang gemacht, die dann allerdings durch die Vorstellung ihres Buches "Der Schlund" doch noch einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Eine Unterstufenbücherei kann also auf unterschiedlichste Weise einen Beitrag dazu leisten, daß Lesen in 90
92 der Schule nicht als mühsame und lästige Vorbereitung noch mühsameren und zerpflückenden Interpretierens empfunden wird, sondern als interessante, spannende und Spaß bereitende Tätigkeit. 91
93 Lise-Meitner-Biblikothek ein Ort geistig-kultureller Kommunikation von Gerhard Löw Heike-Susanne Schmidt, Lehrerin mit gymnasialer Ausbildung, ist seit 1988 für den Auf- und Ausbau unserer inzwischen bundesweit bekannten Bibliothek verantwortlich. Die These vom Ende der "Gutenberg-Galaxis" Schon vor über 20 Jahren hat der kanadische Medienkundler McLuhan - großmundig - die These vom Ende der "Gutenberg-Galaxis" in die Welt gesetzt. Er meinte damit, daß das Buch sowie andere Druckerzeugnisse mehr und mehr durch die elektronischen Medien ersetzt würden. So atemberaubend die Entwicklung in der Medien- Technologie auch sein mag: Bis heute hat sich das Buch daneben behauptet, und es spricht einiges dafür, daß dies auch weiterhin so sein wird. Denn: Alle Menschen, die Bücher lesen, erfahren immer wieder, daß damit eine weitgehend andere, eine meistens viel intensivere geistige Betätigung verbunden ist als beim Umgang mit elektronischen Medien. Von daher ist es wohlbegründet, wenn alle mit Bildung in unserer Gesellschaft Beauftragten um die Fortsetzung des "Gutenberg-Zeitalters" kämpfen. 92
94 Lehrerbücherei, Schulbücherei - oder Schüler- Lehrerbücherei? Ein Gymnasium ohne Bücherei - das gibt es nicht. Allerdings dürfte die Konzeption und die Ausstattung dieser Einrichtung sehr unterschiedlich sein. Ob an einer Schule ausschließlich eine Lehrerbücherei existiert, ob es daneben auch eine Schülerbücherei gibt, oder ob eine integrierte Konzeption bevorzugt wird, hat ursächlich etwas mit dem pädagogischen Programm dieser Schule zu tun. Entscheidung für eine Schüler-Lehrer- Bücherei Am Lise-Meitner-Gymnasium haben wir schon vor 20 Jahren die Entscheidung getroffen, eine gemeinsame Schüler-Lehrer-Bücherei aufzubauen. Leider standen uns in den 70er Jahren für diesen Zweck nur einige abgelegene Räume im Kellergeschoß des Schulgebäudes zur Verfügung. Dieser Umstand hat - trotz des erheblichen Einsatzes einiger Lehrpersonen und einer Elterngruppe - dazu geführt, daß die Einrichtung - nach einer verheißungsvollen Anfangsphase - mehr und mehr an Bedeutung einbüßte und schließlich im wahrsten Sinne des Wortes ein "Keller"-Dasein fristete. Der "qualitative" Sprung: Ausleih- und Arbeitsbücherei Der entscheidende "qualitative" Sprung für unsere Bücherei vollzog sich um die Mitte der 80er Jahre. Mit einer neuen Schulleitung brach sich eine im Lehrerkollegium seit längerem vorhandene Reformbereitschaft Bahn. In Anknüpfung an die damals neuen Grundschul-Richtlinien führten wir die Freie Arbeit für die Stufen5-7,alsFortsetzung dieser veränderten Lernform eine für alle Schülerinnen und Schüler verbindliche Jahresarbeit in der Stufe 8, einen verbindlichen Betriebspraktikumsbericht in der Stufe 9 und eine für alle verbindliche Facharbeit in der Stufe 12 ein. Diese Reformschritte sollen der Schülerschaft mehr Selbsttätigkeit und Selbständigkeit ermöglichen. Den Initiatoren und Trägern dieser Reformbewegung stand von vornherein klar vor Augen: Jetzt brauchen wir endgültig eine an Schülerbedürfnisse orientierte Bücherei! Denn: Was soll die Anleitung zur Sebsttätigkeit, wenn nicht innerhalb der Schule die dazu notwendigen Rahmenbedingungen vorhanden sind? Nach einer Überprüfung unseres gesamten Raumprogramms durch die Schulgestaltungs-Kommission fiel eine für die weitere Entwicklung unserer Schule bedeutsame Entscheidung: Die Bibliothek wird aus ihrem "Keller"- Dasein befreit, sie erhält zentral gelegene, wertvolle Parterre-Räume als Domizil! Zunächst waren es zwei Klassenräume, die wir umgewidmet, mit Türdurchbruch und einem einheitlichen Teppichboden ausgestattet haben; heute - nach 10 Jahren - umfaßt unsere Bibliothek vier ineinanderübergehende Räume, insgesamt fast 300 qm Fläche, ca Bände, 60 Arbeitsplätze für Einzel- und Gruppenarbeit. Mindestens dreimal ist uns bei unserem Aufbau- Bemühen das Glück kräftig zur Hilfe gekommen: Der relativ große Buchbestand resultiert aus der Auflösung eines Nachbargymnasiums, dessen Rechtsnachfolger wir geworden sind. Mit Hinweis auf die "vielen" Bücher ist es uns gelungen auf dem Wege über eine ABM-Stelle schließlich eine reguläre Bibliothekars-Stelle zu erhalten. Eine international renommierte Möbel-Firma hat uns bei der Einrichtung der Räume großzügig unterstützt, so dass wir unsere Bibliothek zu einem erheblichen 93
95 Teil mit Designer-Möbeln aus der Bauhaus-Schule u. a. bestücken konnten. Die oben erwähnte Bibliothekars-Stelle wird seit 10 Jahren von einer Bibliothekarin mit gymnasialer Lehrerausbildung bekleidet, die mit großem Engagement, mit viel Sinn für Raumgestaltung und mit Liebe zum ästhetischen Detail unsere Bücherei zum geistig-kulturellen Zentrum der Schule und zugleich zum beliebtesten Aufenthaltsort der Schülerschaft gemacht hat. Kriterien für den Neuaufbau des Buchbestandes Beim Neu-Aufbau unseres Buchbestandes haben wir uns von folgenden Kriterien leiten lassen: Unsere Bücherei ist nach der "Duisberger Systematik" geordnet; damit sind wir mit allen öffentlichen Büchereien kompatibel. Der größte Teil unseres Buchbestandes ist EDVverschlagwortet, so daß - mit Hilfe des Computers - ein äußerst schneller und komfortabler Zugriff gewährleistet ist. Computerkundige Schüler dürfen auch selbst auf die Suche gehen. Alle Vorgänge - auch Ausleihe und Mahnung - werden über Computer abgewickelt, so daß man in unserer Bücherei vergeblich nach den traditionellen Katalog- Kästen suchen wird. Bei der Neuanschaffung von Literatur stehen die unterrichtsbezogenen Schülerbedürfnisse im Vordergrund. Häufig wird von Lehrern die von ihnen benutzte didaktische Sekundärliteratur in der Bücherei angegeben, damit diese dort auch für die Schülerschaft angeschafft werden kann. Neben der auf die schulische Ausbildung bezogenen Fachliteratur bietet unsere Bibliothek auch eine Auswahl an aktuellen Druckerzeugnissen wie "Der Spiegel", "Die Zeit", "Frankfurter Rundschau", "Die Süddeutsche", "Der Rheinische Merkur" u. a. Die optische Repräsentanz der Fächer in der Bücherei Von vornherein waren sich der Schulleiter und die Bibliothekarin darin einig, dass in dieser Bücherei nicht nur Regale und viele Bücher vorkommen, sondern die an der Schule unterrichteten Fächer in kleinen, repräsentativen Sammlungen oder durch symbolische Fakten ins Blickfeld gerückt werden sollen. So gibt es an den frei gebliebenen Wänden mehrere Portrait-Sammlungen zu unterschiedlichen Bereichen der abendländischen Geistesgeschichte (Bedeutende Literaten, Musiker, Frauen, Naturwissenschaftler/innen u. a.). In Vitrinen und Sammlungsschränken gibt es eine Sammlung bibliophiler Raritäten ( darunter einige kostbare alte 94
96 Literaturausgaben aus dem 18. und 19. Jahrhundert), eine ständig wachsende Musikaliensammlung, eine wertvolle Vogeleisammlung mit ca Vogeleiern aus aller Welt (gesammelt von ), die Sammlung ausgestopfter Tiere umfaßt etwa 50 Exponate, eine Mineraliensammlung aus der Fachabteilung Chemie, alte, Nostalgie verbreitende Instrumente aus der Fachabteilung Physik (z. B. eine wunderschöne Waage), eine Schmetterlingssammlung, eine Dokumentation zur Geschichte der Mode, eine Sammlung von Hüten erinnert an die Projekt-Ausstellung "Hüte, Hüte, meine Güte!" in der Galerie Lise, eine Sammlung von Christbaumschmuck ab 1900 und eine Sammlung von Barbie- Puppen ab 1950 veranschaulichen den Wandel des Zeitgeistes im Grenz-Bereich zwischen Kunst und Kitsch. Unübersehbar ist die kleine Vitrine, in der - unter Plexiglas gesichert - ein Stück von der Berliner Mauer an das damit verbundene historische Ereignis im Jahr 1989 erinnern soll. In Summa: Unsere Bücherei ist so ausgestattet und gestaltet, daß unsere Schülerinnen und Schüler durch die vielfältig anregende kulturelle Umgebung zu geistiger Betätigung motiviert und inspiriert werden. 95
97 Gipsbüsten in einer Schulbücherei? Mancher Besucher unserer Bibliothek fragt, warum dort große Gipsbüsten von Goethe, Schiller und Mozart sowie mancherlei kleinere Gipsbüsten oder Gipsreliefs von weiteren bedeutenden Frauen und Männern aus der abendländischen Geistesgeschichte zu sehen sind. Wer einige der klassischen Bibliotheken - wie die Klosterbibliothek St. Gallen oder die berühmte, von Goethe geförderte Anna- Amalia-Bibliothek in Weimar - kennt, der weiß, daß gerade Gipsbüsten (nicht etwa Bronze-Skulpturen) zum Inventar solcher Büchereien gehören. Wir haben selbstverständlich nicht die Absicht, diese klassischen Bibliotheken nachzuahmen (das wäre ohnehin ein hoffnungsloses Unterfangen), aber wir lösen durch diese dreidimensionalen Exponate aus Gips immer wieder neue Fragen und nicht selten lebhafte Diskussionen über die dargestellten Persönlichkeiten unter den Benutzern und Besuchern unserer Bücherei aus. Und das reicht uns zur Legitimation! Aus dem Schulleben nicht mehr wegzudenken Es dürfte nicht übertrieben sein, unsere Bibliothek - wie sie heute ist - als einen "Ort geistig-kultureller Kommunikation" für die gesamte Schulgemeinschaft zu bezeichnen. Jedenfalls können wir uns kaum noch vorstellen, wie wir ohne diese Einrichtung, die von Uhr geöffnet ist, in unserer Schule leben und lernen sollten. Die Bücherei wird tagtäglich von Schülern und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen am Vormittag und am Nachmittag frequentiert. Immer mehr Lehrpersonen haben gelernt, die Bücherei in ihre Unterrichtsplanungen mit einzubeziehen. Auch Eltern tauchen immer wieder in der Bücherei auf, und sei es nur, um ihre dort an Hausaufgaben arbeitenden Kinder abzuholen. Nur Mut - aus schlichten Klassenräumen läßt sich etwas machen! Früher konnte sich der hier schreibende Schulleiter gewisser Neidgefühle nicht erwehren, wenn er Schulbibliotheken betrat, die vom Architekten von vornherein als solche geplant waren, heute kann er solche Erlebnisse relativ gelassen ertragen; denn er weiß: Auch aus schlichten Klassenräumen läßt sich mit Engagement und Phantasie eine ebenso nützliche wie schöne Schul-Bücherei machen! 96
98 Galerie Lise Eine ständige Schulgalerie als Beispiel für Öffnung von Schule Am 26. Juni 1987 wurde sie im Rahmen eines großen Ehemaligen-Treffens eröffnet - unsere ständige GALERIE LISE. Der Name bezieht sich auf unsere Namenspatronin Lise Meitner. Unsere Galerie ist inzwischen zu einer Institution im kulturellen Leben der Stadt Leverkusen geworden. von Gerhard Löw 97
99 Susanne Ludwig, unsere ehemalige Schülerin (Abitur 1972), inzwischen erfolgreiche Künstlerin im In- und Ausland, hat damals die erste Ausstellung bestritten mit ihren ausdrucksvollen Ölbildern und Aquarellen. Als wir am 19. Januar 1996 in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Ausstellung "...es begann in Berlin..." - Eine Dokumentation zur deutschen Sozialgeschichte von 1945 bis heute - eröffnet haben, "erlebte" die GALERIE LISE ihre 45. Vernissage, womit mit rund 6000 Besuchern zugleich die bislang erfolgreichste Ausstellung begann. In den gut 11 Jahren ihres Bestehens hat unsere Galerie ein breites Spektrum unterschiedlicher Ausstellungen präsentieren können. Da gab es insgesamt 25. Kunstausstellungen von Schülerinnen und Schülern (aktiven und ehemaligen), von Künstlern aus Leverkusen und Umgebung sowie aus anderen Teilen der Republik, aus Rußland, aus Israel, aus Nigeria und von der Insel Bali; da gab es literarische Ausstellungen zu Eichendorff und Chamisso, Fotoausstellungen mit neuseeländischen Landschaften, zum Thema "Sehnsucht und Drogen", mit Schriftsteller-Portraits der Berliner Literatur-Szene seit 1945; es gab Ausstellungen von großen Musikern (Händel, Bach, Humperdinck); geschichtliche und naturwissenschaftliche Ausstellungen im Zusammenhang mit Studienfahrten der Stufe 12, eine meditative Ausstellung des Fachs Religion zum Thema "Der Totentanz von Basel" (HAP Grieshaber), eine Dokumentation zu "Leben und Werk" unserer Namenspatronin Lise Meitner (jetzt als Dauerausstellung in unserer Schule), eine Dokumentation zum Thema "Sinti und Roma" (von einer ehemaligen Schülerin erarbeitet), eine besonders aufwendige Ausstellung zum Schloß Wörlitz als kunstgeschichtlichem und gesellschaftspolitischem Phänomen der Aufklärungsepoche (zum Teil mit Original- Exponaten aus dem 18. Jahrhundert!) Der Wechsel von schulinternen und externen Ausstellungen ist gewollt und gewünscht, weil sich auf diese Weise ein fruchtbarer Dialog zwischen Trägern schulischer und außerschulischer Bildungsbemühungen entwickeln kann. Damit ist klar: GALERIE LISE ist in erster Linie eine pädagogische Einrichtung für das Lise-Meitner- Gymnasium; es erfüllt uns allerdings mit Genugtuung, daß unsere Schul-Galerie im Rahmen der regionalen Kultur-Szene Anerkennung gefunden hat. 98 Praktische Hinweise Raumfrage Die Räume der Galerie Lise sind eigentlich "Mehrzweckräume" und werden - auch während laufender Ausstellungen - als Sitzungsräume für Konferenzen und Sitzungen diverser Art benutzt. Die ausgewählten Räume sind neutral weiß gestrichen, mit einer Aufhängevorrichtung und mit einer flexiblen Beleuchtungsanlage versehen. Ein strapazierfähiger, farblich neutral gehaltener Teppichboden hebt die Raumatmosphäre ein wenig von der eines normalen Klassenraums ab. Im Hinblick auf Ausstellungen mit wertvollen Exponaten ist ein gewisser Sicherheits-Standard vorhanden: Sicher verschließbare Türen, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen an den Fenstern. Eine regelrechte elektronische Diebstahlsicherung wird bald eingebaut. Versicherungsfrage Die Versicherung der jeweiligen Ausstellungen erfolgt im Rahmen der allgemeinen Kultur-Police des Schulträgers. GALERIE LISE kann ihre Ausstellungen bis zu einem Wert von DM ohne zusätzliche Versicherungsprämien versichern. Nur bei darüber hinausgehenden Werten oder bei besonders empfindlichen Einzel-Exponaten fallen Zusatzkosten an. Wer "macht" die Galerie? Wie bei allen unseren Projekten gibt es auch hier eine "personale Seele", die je nach Art und Thema der Ausstellung durch bestimmte Fachabteilungen unterstützt wird. Da unsere Galerie inzwischen zum Schaufenster für alle an der Schule vertretenen Fächer und insbesondere für fächerverbindende Projekte geworden ist, muss das Management nicht aus der Fachabteilung Kunst kommen. Im Falle der GALERIE LISE liegt die Leitung der Schulgalerie beim Schulleiter, der allerdings von unserer hochmotivierten Bibliothekarin mit gymnasialer Lehrerausbildung lebhaft unterstützt wird. 11 Jahre Erfahrung Man mag zweifelnd fragen, wie es möglich ist, eine Schul-Galerie immer wieder mit neuen Ausstellungen zu bestücken, ohne daß - unter dem Druck des Schulalltags - die allbekannten Ermüdungserscheinungen auftreten. Wir haben in den 11 Jahren mehrere Erfahrungsphasen durchlaufen. Zuerst waren wir schon stolz, wenn wir attraktive schulinterne oder externe Ausstellungen mit einer schönen Vernissage eröffnet hatten.
100 Als dann die Besucherzahl bei unseren Ausstellungseröffnungen teilweise doch recht bescheiden ausfiel, gingen wir dazu über, einen Kurs oder eine Klasse projektartig in die Vorbereitung einer Ausstellung einzubinden, so daß ein schulinternes Grundinteresse gesichert war. Diese Möglichkeit haben wir inzwischen zu einem System mit langen Vorlaufzeiten ausgebaut. Beispiel 1: Die Foto-Ausstellung "Berlin - Berlin, Schriftsteller Portraits aus 30 Jahren", die wir in Kooperation mit dem Literatur-Archiv des Schiller-National- Museums in Marbach durchgeführt haben, wurde als Projekt von einer 9. Klasse übernommen. Die Schülerinnen und Schüler haben zu jedem porträtierten Schriftsteller bzw. zu den Schriftstellerinnen ein Informations-Paket (Leben, Werk, repräsentativer Text) ausgearbeitet, das in graphisch ansprechender Aufmachung unter die Fotos gehängt wurde. Zur Vernissage wurde der Fotograf, Roger Melis aus Berlin, eingeladen, der sehr anregend über seine Begegnungen mit den Schriftstellern erzählen konnte. Die Klasse selbst stellte bei der Eröffnung 4 der 30 Schriftstelle-Persönlichkeiten in kurzer Lebensskizzen und durch Rezitieren jeweils eines Textauszugs vor. Dazwischen gab es kurze, meditative Improvisationen auf dem Klavier. Um das Interesse an der Ausstellung auch nach der Vernissage aufrecht zu erhalten, wurden zwei weitere Rezitationsabende zu ausgewählten Schriftstellern durchgeführt. Beispiel 2: Engelbert Humperdinck Jahre Kinderoper "Hänsel und Gretel". Diese Ausstellung führten wir in Zusammenarbeit mit der musikwissenschaftlichen Abteilung der Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. durch. Dies war natürlich in erster Linie die Stunde unserer Musikfachabteilung, die Teile aus der Kinderoper einstudiert und bei der Vernissage zu Gehör gebracht hat. Aber auch unsere Kunst- und Textilfachabteilungen bereicherten die Ausstellung durch kreative Arbeiten zum Märchen "Hänsel und Gretel". Schließlich ließ es sich die Backmüttergruppe der Schule nicht nehmen, mehrere hundert kleine Hexenhäuser und ein vielbewundertes großes Exemplar zu backen, wodurch die Ausstellung sehr konkret eine sinnliche Dimension annahm. Der Verkaufserlös für die Hexenhäuser (1.000,-- DM) kam der Kinderkrebshilfe zugute. Durch solch positive Erfahrungen mutig gemacht, 99
101 wagte sich GALERIE LISE auch an größere Ausstellungen heran, für deren Aufbau nicht nur die Galerie-Räume, sondern größere Teile des Schulgebäudes benötigt wurden. So haben wir im Herbst '95 in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Düsseldorf eine äußerst effektive Groß-Ausstellung (500 qm Fläche) zu folgenden drei "brennenden" Themen unserer Gesellschaft durchgeführt: Gewalt und Angst Sucht und Drogen Konsum und Diebstahl Zehn unserer Lehrpersonen hatten sich intensiv in die nach dem Impuls-Prinzip strukturierte Ausstellung eingearbeitet und standen während sechs Wochen als Moderatoren für Klassen und Gruppen (auch von außerhalb der Schule) zur Verfügung. Die in jugendtypischem Layout (Disco-Atmosphäre mit metallischem Glanz und elektronischer Akustik) präsentierte Ausstellung ist mit ihrer prophylaktischen Zielsetzung in Leverkusen und Umgebung erfreulich gut angenommen worden. Vom Kult zum Tanz Noch kurz vor Weihnachten '95 gab es innerhalb unserer Galerie-Arbeit eine schulkulturelle Aufgipfelung mit der Ausstellung zur Geschichte des Tanzes ("Vom Kult zum Tanz!"), ein fächerübergreifendes Projekt schuleigener Tanz-, Musik- und Kunst- Gruppen. Zur Vernissage wurden Tänze aus unterschiedlichen Jahrhunderten bis hin zum modernen Ausdruckstanz vorgeführt. Bisher größte und erfolgreichste Ausstellung: Es begann in Berlin - Dokumente zur deutschen Sozialgeschichte Einen noch weit darüber hinausgehenden Wirkungsgrad konnten wir mit unserem bisher größten Ausstellungsprojekt erzielen, eine Wanderausstellung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik "Es begann in Berlin", die wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitsministerium im Frühjahr 1996 (nach dreijähriger Vorlaufphase) realisiert haben. Die Vernissage am Freitag, 19. Januar 1996, um Uhr, war für die Schule ein großer Tag, insofern an der vom Statssekretär des Ministeriums vorgenommenen Eröffnung viele Vertreter öffentlicher und privater Institutionen der Leverkusener Region teilgenommen haben (Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Stadtverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Krankenhäuser, andere Schulen, ortsansässige Firmen, insbesondere der Vorstand der Bayer AG Leverkusen, Polizeipräsident u. a.). 100 Unsere Fachabteilung für Geschichte und Sozialwissenschaften hatten ihre Unterrichtsplanungen langfristig auf das Thema eingestellt, damit große Teile unserer Schülerschaft für das Ausstellungsprojekt vorbereitet waren. Ein Leistungskurs für Geschichte und ein Leistungskurs für Sozialwissenschaften hatten gemeinsam mit ihren Lehrpersonen die Projektträgerschaft übernommen. Dem Geschichtskurs ist es gelungen, das Thema der Ausstellung lokalgeschichtlich in Form einer ergänzenden Ausstellung aufzuarbeiten, wobei besonders das Stadtarchiv und das umfangreiche Archiv der Bayer AG ausgewertet worden sind. Der sozialwissenschaftliche Kurs hat, ergänzt durch musikalische Beiträge einzelner Schüler, die Gesamtgestaltung der Vernissage übernommen. In dieses Ausstellungs-projekt waren auch große Teile unserer Elternschaft einbezogen, insofern sie bereitwillig Aufsichtsdienste in der Woche und am Wochendende übernommen haben. Das Arbeitsministerium hat uns nach Abschluß der Ausstellung mitgeteilt, daß diese Ausstellung, die seit 1987 durch die Bundesrepublik "wandert", noch nie so hohe Besucherzahlen gehabt hat wie in unserer Schule. Als Schlußfolgerung aus diesem Ergebnis wurde ein Prospekt entworfen, das künftig auch andere Schulen in der Bundesrepublik dazu anregen soll, diese Ausstellung zu übernehmen und zu verwerten. 1997: Zwei fächerverbindende Groß- Ausstellungen: Die Brille - zur Optik, zur Geschichte, zur Ästhetik Am 7. Mai 1997 schlug eine der großen Stunden der Fachabteilung Physik: Vernissage zur Aussstellung "Die Brille - zur Optik, zur Geschichte, zur Ästhetik"! In der etwa eineinhalbjährigen Vorlaufzeit hatten sich außer der federführenden Physik vier weitere Fächer zur Mitarbeit entschlossen: Geschichte mit Soziologie, Kunst, Literatur, Musik. Als außerschulische Kooperationspartner konnten wir gewinnen: Zentralverband Deutscher Augenoptiker, Kuratorium Gutes Sehen, mehrere Firmen, die uns optische Geräte ausliehen, die Optiker -Innungen von Leverkusen und Köln, insbesondere das Optik- Fachgeschäft Seidl aus Köln, dessen Chefin mit unseren Schülerinnen und Schülern der Stufe 10 eine Brillenmodenschau mit historischen und modernen Brillen realisierte. Das berühmte optische Museum Zeiss/ Jena hat seine Kooperations-Zusage leider wieder zurückgezogen, so dass wir gezwungen waren die Informations-Tafeln zur Geschichte der Brille selbst zu erarbeiten und herzustellen. Dies geschah zum Teil in den Osterferien, als sich bestimmte Lehrpersonen mit bestimmten Schüler-
102 101
103 gruppen in unserer Bücherei trafen, um unter großem Zeitaufwand ästhetisch aufwendig gestaltete Exponate fertigzustellen. Der Lohn für alle an der Ausstellung Mitwirkenden war der begeisterte Applaus, mit der die etwa 350 Besucher der Eröffnungsveranstaltung die Exponate und die Darbietungen im Rahmenprogramm bedachten. Die Ausstellung hatte während der gesamten Laufzeit Folgen. Die Physikfachabteilung hatte sich das Ziel gesetzt, die Sehfähigkeit möglichst vieler Schüler und Schülerinnen mit den modernen Geräten zu messen. Auf diese Weise wurde manche Fehlsichtigkeit entdeckt! Gleichzeitig war durch die Brillenmodernschau, als eine Art Gesamtkunstwerk mit sorgfältig zusammengestellter Musik und aufwendiger Licht- und Tontechnik gestaltet, ein erstaunlicher Rückgang der üblichen Aversionen gegen das Brillentragen zu beobachten. Das menschliche Herz - der herzliche Mensch Diese fächerverbindende Groß-Austellung der Galerie Lise wurde mit der 55. Vernissage am 29. Oktober 1997 eröffnet. Das Thema lässt erkennen, dass es um zweierlei geht: Das Herz als Zentrum des organischen Lebens Das Herz als Symbol für geistig-seelische Prozesse Die Idee zu dieser Ausstellung stammt vom Deutschen Hygiene-Museum aus Dresden. Dort hat um die Jahreswende 1995/96 eine ähnliche Ausstellung mit dem gleichen Titel stattgefunden. Unsere Kontaktanfrage wurde von Frau Dr. Hahn, einer leitenden Mitarbeiterin dieses Instituts, mit Begeisterung aufgegriffen und seitdem steht unsere Schule mit diesem in seiner Art einmaligen Museum in konstruktivem Kontakt. Diese Ausstellungs-Idee hat am Lise-Meitner- Gymnasium in insgesamt 10 Fächern zu produktiven Unterrichtsprozessen geführt. Unter der Projekt- Trägerschaft der Biologie haben sich die Fächer Kunst, Musik, Literatur, Textil, Geschichte, Sport, Tanz, Physik und Religion zu einem fächerverbindenden Groß-Projekt zusammengefunden. Das Resultat dieser Kooperation ist von dreifacher Art: die Ausstellung selbst, die vom 29. Oktober bis 17. Dezember 1997 in der Galerie Lise zu sehen war ein etwa zweistündiges Eröffnungsprogramm, das am 29. Okt. unter großer Beteiligung der Schulgemeinde stattgefunden hat ein Begleitprogramm aus 4 Abend- und 2 Vormittagsveranstaltungen, durch die bestimmte Aspekte aus der Ausstellung durch Information, 102
104 Darstellung und Diskussion aufgearbeitet worden sind. Das Herz-Projekt war mit besonders vielen positiven Kooperationserfahrungen verbunden. Neben dem Hygiene-Museum in Dresden haben sich die kardiologischen Fachabteilungen der Kliniken in und rund um Leverkusen als ausgesprochen kooperativ gezeigt. Besonders aufgeschlossen und großzügig in der Ausleihe von Exponaten war die Pathologie der Universitätsklinik Köln. Als ebenfalls sehr hilfsbereit zeigte sich die "Deutsche Herz-Stiftung" in Frankfurt. Positiv überrascht waren wir, als uns das Desy- Institut Hamburg die gerade veröffentliche neue Methode zur Darstellung von Herzkranzgefäßen zur Verfügung gestellt hat. Unsere Herz-Ausstellung ist in einer umfangreichen Dokumentation festgehalten worden. Interessenten können Sie bei der Schulleitung ausleihen. Bilanz zur Galerie Lise Die anfänglich in der innerschulischen Diskussion geäußerten Befürchtungen, unsere Galerie könnte zu sehr der Außendarstellung dienen, haben sich durch die tatsächliche Entwicklung längst erledigt. Unsere Galerie-Projekte sind weniger die "Sahnehäubchen oben drauf" als vielmehr der "Sauerteig innen drin", durch den immer mehr Fachabteilungen zu produktorientierter und fächerverbindender Arbeit angeregt werden. Außerdem hat sich die Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen außerschulischen Institutionen unserer Gesellschaft nicht nur als nützlich, sondern pädagogisch als wertvoll erwiesen. Besonders wertvoll sind die Kooperationspartner, die längerfristig mit uns zusammenarbeiten wollen. Dazu gehören z. B. das Schiller-National-Museum in Marbach, das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden, das Landeskriminalamt Düsseldorf, das Händelhaus in Halle u.a. Blick in die Zukunft Galerie Lise plant und bereitet folgende Projekte vor: Georg Büchner eine fächerübergreifende Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Schiller-National-Museum in Marbach Mathematik einmal anders! Unsere Galerie Lise wird in ein Museum für mathemathische Modelle aus Geschichte und Gegenwart verwandelt. Die weit ver-breitete Aversion gegen das "schwere" Fach soll aufgebrochen werden. Kooperationspartner: Mathematische Abteilung der Universität Gießen "Jung und Alt" eine fächerverbindende Ausstellung zum Generationenproblem an der Schwelle zum neuen Jahrtausend Kooperationspartner: Hygiene-Museum Dresden u. a. Gehirn" eine fächerverbindende Ausstellung im Jahre 2001 Kooperationspartner: Hygiene-Museum Dresden u. a. Die Ideen und Anregungen zu Ausstellungs-Projekten kommen zunehmend aus den unterschiedlichen Fachabteilungen unserer Schule. Es gibt mittlerweile Lehrpersonen, die ihre privaten Museums- oder Ausstellungsbesuche durchaus mit der Frage verbinden, ob sich da nicht eine sinnvolle Möglichkeit für unsere GALERIE LISE auftut. 103
105 Eine-Welt-Arbeit von Horst Thelen Im April des Jubiläumsjahres 1998 haben wir den Versuch gemacht, die seit 1959 bestehende Partnerschaft mit der Leprastation Mwena/Ndanda in Tansania durch eine Ausstellung im Rathaus einer größeren Öffentlichkeit bekanntzumachen. Luftbild des Leprakrankenhauses Diese Partnerschaft, vorbereitet durch eine Medikamentenspende an Albert Schweitzers "Urwaldkrankenhaus" in Lambarane (1958), begann ebenfalls mit einer Medikamentenlieferung. Seit der gewaltigen Steigerung der Frachtkosten jedoch leisten wir die Unterstützung in Form von Geld, das zum Kauf von Medikamenten bzw. dringend benötigter Gegenstände (etwa Patientenbetten) verwendet wird. Inzwischen sind beinahe DM in der Schule bei verschiedenen Aktionen, durch das "Eine-Welt- Café" und den "Eine-Welt-Laden", aber auch von Freunden aufgebracht worden. Durch die persönliche Beziehung zur Leitung der Leprastation, die durch gegenseitige Besuche vertieft wurde, wissen wir vom Umfang, vom Grad und der Notwendigkeit der Arbeit dort, aber auch vom Anteil, der - wenn auch gering - von uns geleistet wurde und wird. Schwester Lia, seit 1951 Leiterin, hat den Auf- und Ausbau der Station entscheidend vorangetrieben: Aus einem ärmlichen Gesundheitsposten für Leprakranke ist eine bedeutende Zentrale der Leprabekämpfung in der gesamten Südostregion Tansanias geworden. Die durchschnittlich 600 Patienten stammen zum Teil auch aus den angrenzenden Gebieten Mozambiques. 104
106 Was aber geschah - etwas genauer betrachtet - in den vier Jahrzehnten bei uns, an unserer Schule? Am Anfang stand das Entsetzen über das Leiden anderer Menschen - denn Lepra gehört zu den schrecklichsten Krankheiten der Erde -, das als Aufforderung zu entsprechendem Handeln, das als Ver-Antwortung begriffen wurde. Dieses Motiv wird wohl auch immer, trotz aller rationalen Einsichten über die Ursachen und Folgen von Not und Elend, ein grundlegendes Motiv bleiben und bleiben müssen. Aus der Betroffenheit erwuchsen in den ersten Jahren hauptsächlich Einzelaktionen, mit denen das Problembewußtsein geweckt und Spendengeld gesammelt werden sollte. Aber es blieb ein deutliches Ungenügen: Die theoretische Arbeit wurde als zu eng, die Umsetzung an der Schule als zu punktuell eingeschätzt. Vom Ende der 60er bis in die frühen 80er Jahre wurde zwischen den Interessierten das Problem der "Unterentwicklung" (So wurde das zu der Zeit genannt!) in einem weiteren Rahmen als dem bloßer Unterstützung durch Spenden diskutiert. Aspekte der Diskussion waren die globale Erfolglosigkeit der Entwicklungshilfeanstrengungen, aber auch fortschrittliche Gesellschaftsmodelle ( Ujamaa-Sozialismus in Tansania; Revolution in Nicaragua), die Imperialismuskritik und nicht zuletzt das Entstehen der ökologischen Frage. Erste Früchte zeigten sich in integrativen Konzepten der Aktionen an der Schule, z.b. Projekttagen, in denen versucht wurde, das gesamte Problemfeld der "Entwicklungshilfe" mit der Unterstützung konkreter Projekte zu verbinden. Die Intensivierung der Beschäftigung mit den angedeuteten Aspekten führte dann 1984 zur Gründung des "Eine-Welt-Kreises". Mit dem Namen wollten wir auch dem inzwischen erreichten Bewußtseinsstand Rechnung tragen, daß nämlich "Dritte-Welt-Probleme" keineswegs isolierte Probleme der "Dritte-Welt-Staaten" sind, sondern nur begriffen (bzw. gelöst) werden können im Geflecht der historischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren der e i n e n Welt. Dieser Gruppe von sieben Personen schwebte vor, daß anstelle punktueller Aktionen dauerhafte Einrichtungen in der Schule geschaffen werden müßten, die kontinuierliche Lernprozesse im Schulalltag mit folgenden Zielen ermöglichen sollten: Die Anerkennung des Rechts aller Menschen auf ein Leben in würdigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen; die Einsicht in die wechselseitige Abhängigkeit - vor allem aber in die überra- gende Verantwortung der Industrieländer im Blick auf die wirtschaftliche Lage der sogenannten Entwicklungsländer - und nicht zuletzt in das Angewiesensein aller Menschen auf eine gesunde Umwelt. Für den außerunterrichtlichen Bereich führten diese Überlegungen zur Planung zweier Einrichtungen: dem "Eine-Welt-Café" und dem "Eine-Welt-Laden". Das Café sollte drei Aufgaben erfüllen: Während der Unterrichtszeit gesunde Nahrung (Vollwert) und entsprechende Getränke anbieten Informationen zu Problemen der "Einen Welt" in einem "attraktiven" Rahmen (ohne den gewöhnlich erhobenen Zeigefinger) vermitteln Durch den erwirtschafteten Überschuß Projekte in der "Dritten Welt" unterstützen. Der "Eine-Welt-Laden" sollte fair gehandelte Produkte und Recyclingpapier anbieten und dadurch ein bewußteres und verantwortlicheres Konsumverhalten fördern, und zwar sowohl im Blick auf die "Dritte Welt" als auch im Blick auf ökologische Probleme. Die Schlange reicht bis auf den Flur 105
107 Café und Laden heute Nach 12 Jahren ist das Café (seit 1995 in zwei Räumen mit 60 Plätzen) der beliebteste und vielleicht wichtigste Treffpunkt der Schule geworden: Inzwischen wird es von einem eingetragenen Verein getragen, der eine Kraft angestellt hat, weshalb das Café täglich drei Stunden offengehalten werden kann. Durchschnittlich 200 Personen besuchen das Café jeden Tag, es ist auch ein begehrter Ort für Elternabende, Kurstreffen usw. Die Eßwaren werden von mehr als 30 Müttern (manchmal auch Vätern) in verschiedenen Backgruppen (daher der Name "Backmütter" bzw. "-väter") ehrenamtlich hergestellt. - Die Stadt Leverkusen und der Landschaftsverband Rheinland haben diese Einrichtung für 1997 mit dem Prädikat "Kinderfreundlich" ausgezeichnet. - Aus dem ursprünglichen Verkaufstisch im Flur ist ein fester Laden geworden, in dem Schüler/innen täglich in den großen Pausen die genannten Waren verkaufen. Der Laden ermöglicht es, den Gedanken sinnvoller Produkte, fairer Preise für die Produzenten und verantwortungsbewußten Konsums ohne Aufdringlichkeit allen Personen der Schulgemeinde nahezubringen. An der Kasse im Eine-Welt-Laden Weitere Projekte : Schulpartnerschaft und Dorfentwicklung Seit Beginn der Arbeit im "Eine-Welt-Kreis" haben wir ein zweites Projekt, nämlich Blindenheilung und Dorfentwicklung in Bangladesch unterstützt. Inzwischen wird diese Hilfe von anderer Stelle aus weitergeführt, der "Lichtbrücke" mit Sitz in Engelskirchen, jedoch von derselben Person, Frau v. Lüninck, die das Projekt bis zu ihrer Pensionierung bei uns betreut hat. Ein halbes Jahr vor Eröffnung des Cafés, im Dezember 1986, wurde eine weitere Partnerschaft begründet: die Schulpartnerschaft mit dem Colegio San Luis in Chinandega/Nicaragua. Im Sinne intensiver Vernetzung kamen bei diesem Projekt noch drei Faktoren hinzu. Erstens war diese Partnerschaft innerhalb der bürger- bzw. basisorientierten Städtepartnerschaft Leverkusens mit Chinandega angesiedelt, zweitens gab sie Raum für einen Arbeitseinsatz von Schülern und Lehrern an der Partnerschule in Nicaragua und drittens erhöhte die soziale und psychologische Nähe von Schule zu Schule die Chancen partnerschaftlichen Austauschs auf mehreren Ebenen. Für die Festwoche planen wir eine vorläufige Ausstellung unseres dritten Besuchs ( bei zwei Gegenbesuchen) der Partnerschule und Partnerstadt Chinandega, der vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Alle Teilnehmer, fünf Schüler/innen, zwei 106
108 Das Eingangstor des Colegio San Luis Backmütter" und drei Lehrer/innen konnten erfahren, wie richtig die inzwischen allgemein anerkannte Maxime ist, daß "Entwicklungshilfe" um so erfolgreicher ist, und zwar sowohl für die Seite der "Empfänger" wie die der "Geber", wenn sie auf gegenseitiger Kenntnis und persönlichem Austausch beruht. Nur ein solcher Kontakt kann einen menschlich angemessenen Rahmen auch für materielle Hilfe abgeben, weil er gegenseitige Anerkennung und die Erfahrung unmittelbarer Solidarität ermöglicht. Durch die bisher geleistete finanzielle Hilfe von unserer Seite (ca DM) konnten am Colegio San Luis Schulmöbel, Lehr- und Lernmittel angeschafft, notwendige Reparaturen durchgeführt und Stipendien für bedürftige Schüler/innen vergeben werden. Versuch eines Fazits Wir meinen, daß in der Geschichte der Einen-Welt- Arbeit an unserer Schule ablesbar ist, was Schule - zumindest in der Tendenz - leisten müßte und sein könnte: Einerseits müßten die drängenden gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Probleme Eingang in den Schulalltag finden und andererseits müßten aus der Schule heraus Aktionen erfolgen, die in die genannten Problembereiche eingreifen. Aber trotz der genannten und getanen Schritte sind die Zweifel nie verstummt, ob und inwieweit die Eine- Welt-Arbeit an der Schule bei Vielen bewußtseinsund verhaltensändernd wirkt, ob und inwieweit die Form unserer Hilfe eine passende Antwort auf das Nord-Süd Problem darstellt, ob und inwieweit unsere Motive einer genaueren Kritik standhalten könnten - aber, solange wir keine tauglichere Alternative sehen, glauben wir, unsere Arbeit fortsetzen zu müssen. 107
109 Mut und Hoffnung im Zeitalter der Globalisierung Ein Beitrag zum 75jährigen Bestehen des Lise-Meitner-Gymnasiums Dr. Rainer Engels, Geschäftsführer der Nord-Süd-politischen Lobbyinitiative GERMANWATCH Dr. Rainer Engels, Abiturjahrgang 1982, war schon während seiner Schulzeit ein an Geschichte und Politik hoch interessierter junger Mensch; seine Geschichtskenntnisse und sein Verständnis für politische Zusammenhänge waren bereits in der Mittelstufe überragend. Er beteiligte sich schon damals aktiv an der Friedensbewegung. Nach Beendigung der Schulzeit widmete er sich dem Studium der Agrarwissenschaften in Bonn, wodurch ihm die Welt-Ernährungsprobleme in voller Schärfe bewusst wurden. Konsequenterweise schrieb er seine Promotion über ein Thema aus dem Bereich der Bodenfruchtbarkeit über "Nützliche Bakterien". Heute ist Dr. Rainer Engels Geschäftsführer von "German Watch", einer der bedeutenden Organisationen im Rahmen der "Nord-Süd-Initiativen", die versuchen - trotz vielfacher politischer Gegenwinde - mehr soziale Gerechtigkeit in unserer Welt zu verwirklichen. Rainer Engels auf seiner Abiturfeier im Juni 1982 und heute 108
110 1. "Es genügt nicht, die Welt zu verändern. Das tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das sogar ohne unser Zutun. Wir haben diese Veränderung auch zu interpretieren. Und zwar, um diese zu verändern. Damit sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere. Und nicht schließlich in eine Welt ohne uns." (Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. ) 2. Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, 1980 "So wenig wie die Hoffnung darf auch die Furcht dazu verführen, den eigentlichen Zweck - das Gedeihen des Menschen in unverkümmerter Menschlichkeit - auf später zu verschieben und inzwischen eben diesen Zweck durch die Mittel zuschanden zu machen." (Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, 1979) Als ich vor 16 Jahren die Schule verließ, gab es den Begriff Globalisierung noch nicht und das zugehörige Phänomen der zunehmenden internationalen Vernetzung der Wirtschaft war bei weitem noch nicht so ausgeprägt. Die erste Ölkrise in den siebziger Jahren hatte einen Paradigmawechsel mit einer Spaltung der Weltbilder bewirkt, hin zu einerseits ökologischeren Sichtweisen, aber auch zur Ausbildung des Neoliberalismus. Unbemerkt zeichnete sich das Ende des Ost-West-Konfliktes und des planwirtschaftlichen Gesellschaftsmodells ab und die Arbeitslosigkeit begann, trotz anhaltenden Wirtschaftswachstums anzusteigen. Computer gab es am Lise-Meitner-Gymnasium nur für ein paar abgedrehte Mathe-Freaks im freiwilligen Informatikkurs und für uns SchülerzeitungsredakteurInnen (Lisel hieß das Blatt), die Stundenpläne wurden mit Lochkarten und Magnettafel erstellt. Auch die Gentechnik war ferne Zukunftsmusik. Bevor ich die Brücke zwischen der Ära vor Kohl und der Ära nach Kohl schlage, möchte ich noch etwas zu unserem Jubilar sagen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihre Vergangenheit im Rückblick verklären. Die idealistische Vorstellung einer Schule, die bei mir in der Unterstufe ungefähr mit Kästners fliegendem Klassenzimmer zusammenfiel, später mit selbstbestimmtem Lernen ohne Lehrplanzwänge, hat unsere Schule natürlich nicht erfüllen können. Es gab aber einige Lehrer, die auch so etwas im Kopf hatten und sich alle Mühe gegeben haben, uns etwas von dem Gefühl zu vermitteln, etwas Besonderes zu sein und eine Chance zu haben. Wozu auch immer. Früher waren die Zeiten auch nicht anders als heute. Es gab Lehrer, die konnten einem ihr Fach auf ewig verleiden. Mir hat die Lektüre von Caesars de bello gallico" auf immer den Wert des Lateinunterrichts diskreditiert. Auch Bundesjugendspiele als besonderes sportliches Mißvergnügen werden mir unvergeßlich bleiben. Andererseits habe ich in der Unterstufe in endlosen Waldläufen gelernt, die Souveränität über meinen Körper zu erlangen. Vorbildhafte Projekte gab es, etwa der Einsatz von Herrn Döllscher für Nordirland, oder die Partnerschaft der Schule mit einer Leprastation in Tansania, die Frau Sobocinski über Jahre hinweg mit immer mehr Leben erfüllt hat und die Kernzelle des heutigen Engagements von SchülerInnen und LehrerInnen für Nord-Süd-Fragen darstellt. Eine Besonderheit des Lise-Meitner-Gymnasiums lag und liegt in seiner Lage in der Stadt Leverkusen, einer Stadt voller Widersprüche und Extreme. Wer hier aufgewachsen ist, hat die Globalisierung vor Ort erlebt: mit Bayer hat einer der größten "global players" hier seinen Sitz und beherrscht das Stadtbild. LeverkusenerInnen meines Alters haben große Fischsterben im Rhein erlebt, einem Fluß, in dem noch unsere Eltern gebadet haben. Aber ein Gefühl der Ohnmacht ist nie aufkommen. Ich erinnere mich noch gut an die Greenpeace-Aktion an der Wiesdorfer Verladestation gegen die Dünnsäureverklappung in der Nordsee. Diese hat mir überzeugend gezeigt, daß Einzelne etwas bewegen können, sogar gegen Transnationale Unternehmen, und wie wichtig die Zivilgesellschaft in einer parlamentarischen Demokratie ist. Ein weiterer Aspekt dieser speziellen Leverkusener Situation ist es, die Vorteile und Nachteile der Globalisierung auch unmittelbar zu erleben. Ständige Rekordgewinne stehen immer unsichereren Arbeitsplätzen gegenüber, kleinere Unternehmen bestehen den Wettkampf nicht, andererseits fließen beachtliche Anteile der weltweiten Einnahmen in Kultur und Sport. Dies sind Rahmenbedingungen, die prägen. Diese und andere Widersprüche und Extreme hatten nicht unerheblichen Einfluß auf die Erwartungshaltung, mit der wir SchülerInnen - oder zumindest ein Teil von uns - an die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer herangingen. Geschichte, Soziologie, Philosophie, Literaturwissenschaften, ja selbst "Erdkunde", die LehrerInnen mußten sich unseren kritischen Fragen stellen und manche taten dies auch gerne. Auf dem Lise-Meitner-Gymnasium habe ich gelernt, kritisch zu hinterfragen und auch die Argumente der Gegenseite ernstzunehmen. Dies ist für meine jetzige Tätigkeit immens wichtig. Und damit kommt die Brücke zur Gegenwart. Ich möchte Ihnen am Beispiel der Investitionspolitik zeigen, welche Rolle heute eine kleine Nichtregierungsorganisation wie GERMANWATCH spie- 109
111 len kann und möchte Ihnen damit Mut machen, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Selten waren die Chancen zu einer Veränderung so groß, aber auch die Gefahren, wenn wir das Handeln den Politikern und zunehmend den Managern überlassen. Die Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise und dem dadurch enorm verstärkten Aufkeimen des Nationalsozialismus führte bereits während des Zweiten Weltkrieges zu Überlegungen, die Weltwirtschaft institutionell und durch Regeln vor ähnlichen Katastrophen zu schützen. Dies mündete in die Gründung der Bretton Woods Institutionen Weltbank und Internationaler Währungsfonds und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), welches 1995 von der Welthandelsorganisation (WTO) abgelöst wurde. Sowohl im Bereich der Finanzmärkte, als auch im Bereich des Welthandels hat diese Institutionalisierung zum Abbau von Hemmnissen des freien Kapital- und Warenverkehrs bis hin zu Erleichterungen des grenzüberschreitenden Austauschs von Dienstleistungen und geistigen Eigentumsrechten geführt. Nur die Auslandsinvestitionen sind von diesem globalen Liberalisierungstrend bisher ausgenommen. Dabei übersteigt der Zuwachs der Auslandsinvestitionen noch das Wachstum des Handels, und dieser wächst schon fast doppelt so schnell wie die Produktion. Nachdem die Industrieländer in der WTO am erbitterten Widerstand der Entwicklungsländer mit dem Versuch gescheitert sind, das Thema Investitionen auf die Tagesordnung zu bekommen, verhandeln Sie es nun in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der mit drei Ausnahmen nur Industrieländer angehören. Was dort verhandelt wird nennt sich Multilaterales Investitionsabkommen (MAI) und geht weit über ein reines Abkommen zum Schutz von Auslands- Investitionen vor ungerechtfertigter Enteignung hinaus. Auslandsinvestitionen müssen danach in jedem Fall gleich behandelt werden wie inländische Investitionen, es dürfen keine Auflagen wie z.b. die Verpflichtung zu einem Mindestanteil inländischen Kapitals oder inländischer Mitarbeiter mit den Investitionen verbunden werden, auch indirekte Enteignung durch verschärfte Umweltauflagen oder geänderte Zweckbindung von Grundstücken muß unverzüglich entschädigt werden und Investoren können gegen Staaten vor der Internationalen Handelskammer klagen. Diese Klagemöglichkeit haben Betroffene von Investitionen, die zum Beispiel für ein Großprojekt wie einen Staudamm ohne Entschädigung von ihrem Land vertrieben wurden, nicht. Überhaupt sind nur Rechte für Investoren und keine Pflichten im Vertragswerk vorgesehen, die Gefahr der Absenkung von Umwelt- und Sozialstandards zur Anlockung von Investitionen ist insbesondere in Entwicklungsländern real. Kritisch ist an diesem Abkommen neben der Ungleichbehandlung von Investoren gegenüber Arbeitern und Betroffenen auch die praktisch vollständige Verhinderung einer eigenständigen Investitionspolitik der Entwicklungsländer. Aus deren Sicht kann es nämlich durchaus Sinn machen, für eine bestimmte Zeit die eigene Wirtschaft zu fördern oder auf Dauer ganze Sektoren wie den Agrarbereich oder die Küstenfischerei mit einem Außenschutz zu versehen. Motive können sein: Der Versuch, an die Entwicklung der Industrieländer Anschluß zu finden, wie das die asiatischen Schwellenländer mit hohem Protektionismus vorgemacht haben, die Sicherung der Ernährung der Bevölkerung durch Förderungsmaßnahmen, Auflagen für die Produktion und Verwendung inklusive des Ausschlusses von Ausländern von Landbesitz. Auch hartgesottene Neoliberale hat die Südostasienkrise nachdenklich gemacht, ob die reine Lehre der Liberalisierung und Deregulierung noch zeitgemäß ist. Überall verspürt man eine Verunsicherung: der Amerikanische Kongress verweigert dem IWF die Finanzierung wegen wiederholten Versagens bei der Vorhersage von Krisen und der Verschwendung von Steuergeldern, die OECD gibt eine (ausgesprochen schlechte!) PR-Studie heraus, "um den Bürgern, die zunehmend kritisch werden, die Vorteile der Liberalisierung von Handel und Investitionen zu erklären", in Indien gehen Bauern, von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkt, gegen die WTO auf die Straße, in Indonesien gibt es eine starke Bewegung nicht nur gegen Suharto und seinen Klan, sondern auch gegen die Politik des Neoliberalismus, Frankreichs Kulturszene macht recht erfolgreich mobil gegen das Multilaterale Abkommen zu Investitonen (MAI), ganze Städte in den USA und Kanada erklären sich zur "MAI-freien Zone", die Hochkommissarin für Menschenrechte erstellt eine Studie, die untersucht, mit welchen Regelungen das MAI genau gegen Menschenrechte verstößt, daß dies der Fall ist, hat das Komitee für soziale, kulturelle und wirtschaftliche Menschenrechte der Vereinten Nationen bereits festgestellt. Auf der anderen Seite wird mit nie gekannter Power versucht, auf allen Ebenen die Liberalisierung von Investitionen durchzudrücken, bevor es womöglich zu spät ist: das Free Trade Agreement of the Americas (FTAA), eine geplante Freihandelszone für ganz Amerika, enthält ebenso Investitionselemente, wie die kürzlich gegründete "New Transatlantic Economic Partner- 110
112 -ship" zwischen der EU, den USA, Kanada und Mexiko. Daß die EU ihre Entwicklungszusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonien in Afrika, in der Karibik und im Pazifik an den Abbau von Investitionshemmnissen knüpfen will, komplettiert das Bild. Staatssekretär Schomerus aus dem Bundeswirtschaftsministerium übernimmt nun die Verhandlungsleitung beim MAI, dadurch bekommt GERMANWATCH eine international wichtige Rolle der Beobachtung und Information. Niemand in Deutschland (einschließlich der Parlamentarier) wußte etwas von den Verhandlungen zum MAI, bis wir vor einem Jahr die Geheimverhandlungen ans Licht der Öffentlichkeit geholt haben. Dies erforderte eine intensive Analyse des umfangreichen und komplizierten Verhandlungstextes, die Erstellung von Hinter-grundinformationen für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, eine Informationskampagne zur Mobilisierung der Öffentlichkeit und der Parlamentarier, Vorträge, Interviews, Zeitungsartikel. Der inzwischen gewachsene Widerstand aus der Bevölkerung hat dazu beigetragen, daß die Verhandlungen für ein halbes Jahr unterbrochen wurden, um in einen Dialog mit den Kritikern einzutreten und endlich die nicht vorhandenen Studien nachzuliefern, ohne die das MAI jeder rationalen Grundlage entbehrt: Welche Auswirkungen wird das MAI auf die Entwicklungsländer haben? Wie wirkt sich die durch das MAI verstärkte Globalisierung auf die Hungerbekämpfung aus? (840 Millionen Menschen sind unterernährt, obwohl genug Nahrung für alle da ist!). Welche Auswirkungen wird das MAI auf die Umweltgesetzgebung haben, auf nationaler wie Internationaler Ebene? Wird das MAI zum Sozialabbau und zur Billiglohnkonkurrenz unter katastrophalen Arbeitsbedingungen beitragen? Welche Auswirkungen sind zu erwarten auf die Entscheidungskompetenz der Parlamente, die Souveränitätsrechte der Bürger, die Gewaltenteilung im Staate und die Handlungsfähigkeit der Politik gegenüber der Wirtschaft? All diese Fragen sind bisher nicht annähernd beantwortet. Die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, zu denen GERMANWATCH gehört,werden nicht ruhen, auf diesen Mißstand aufmerksam zu machen. Zur Zeit wird in den Internationalen Netzwerken der Zivilgesellschaft eine Alternative entwickelt, bestehend aus Grundelementen eines "Multilateralen Abkommens zur Regulierung von Investitionen und zur Rahmensetzung für Transnationale Konzerne im Sinne Nachhaltiger Entwicklung". Nachhaltige Entwicklung bzw. Zukunftsfähigkeit ist das Leitbild des nächsten Jahrhunderts, an dem alle mitbauen müssen. Damit es auch im Jahr 2023 noch einen Grund zum Feiern gibt, wenn das Lise-Meitner- Gymnasium 100 Jahre alt sein wird. Für jetzt aber: herzlichen Glückwunsch zum 75jährigen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen und der nicht entmutigt wurde! "Das Känguruh ist über die Mauer gesprungen, Die Mauer vom Zoo. Mein Gott, war sie breit, Mein Gott, war es gescheit. (Jean-Dominique Bauby: Schmetterling und Taucherglocke, 1997) 111
113 Die Reforminseln am Lise-Meitner-Gymnasium Stand: Oktober 1998 Unterstufenbücherei Galerie Lise Jahresarbeit Stufe 8 Freie Arbeit 5-7 ÜBETREUung 6-9 Schüler helfen Schülern Veränderte Unterrichtsformen und Lernarrangements am LMG seit 1986 Mehr selbständiges Lernen Mehr ganzheitliches Lernen Mehr soziales Lernen Facharbeit 12 Projektphase in : Reisebericht Schulpartnerschaften 11: Berichte von Auslandsaufenthalten Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung (IKG) für alle! Stufe 9 und 10 Berufswahlvorbereitung in Sek. 1/2 Zentrale Bücherei Schülerstreitschlichtung Schüler helfen Schülern Sek.1 Eine-Welt-Café und Eine-Welt-Laden Die Grafik zeigt 9 Reforminseln und vier wesentliche Rahmenbedingungen, die wir im Laufe von 12 Jahren zum Teil als Alternativen, zum Teil als Ergänzungen zum traditionellen Lernen am Gymnasium etabliert haben. Durch unsere Teilnahme am Schulversuch Schule & Co. werden weitere Projekte hinzukommen. 112
114 Schule & Co. Der Schulversuch mit der Bertelsmann-Stiftung und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung. von Gerhard Löw und Petra Madelung Zielvorstellung Das Projekt muss auf dem Hintergrund der 1995 erschienenen "Denkschrift" der nordrheinwestfälischen Bildungskommission "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" gesehen werden. Die vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau berufene 20köpfige Kommission aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft und Kirche kam übereinstimmend zu der Einsicht, dass zentral gesteuerte Bildungssysteme (Typ Frankreich) keine Zukunft mehr haben. Von daher wurde - unter dem Leitbegriff "Haus des Lernens" - ein Bild von der "Schule der Zukunft" entworfen, das im wesentlichen durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist: 1. Qualitätsorientierte Selbststeuerung der Einzelschule 2. Entwicklung regionaler Bildungslandschaften Genau dies sind die übergeordneten Ziele des auf 5 Jahre hin angelegten Modellversuchs "Schule & Co. Im ersten Bereich sollen folgende Teilziele angestrebt werden: Entwicklung von Schulprogrammen mit Zielsetzungen, die auf "Schule im regionalen Umfeld" abgestimmt sind Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen, die das Erreichen der Ziele etappenweise überprüfbar machen Aufbau fester Kommunikationsstrukturen mit anderen Schulen zur Kooperation und Diskussion Durchführung von Schulvergleichen Entwicklung und Anwendung interner und externer Evaluation Dezentrale Verantwortungsmuster, eigenverantwortlicher Ressourceneinsatz Mitsprache für Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Transparenz der Informationen Unterstützung von Eigeninitiative Im zweiten Bereich sollen folgende Teilziele angestrebt werden: Enge Beteiligung der Träger privater und öffentlicher Bildungseinrichtungen am Schulleben Kooperation zwischen Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen aus den Bereichen Jugendhilfe, Soziales, Kultur, Sport Kooperation mit außerschulischen Partnern, wie Wirtschaft, Handel, Handwerk, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitsämtern, Kirchen Der Leser dieser Festschrift wird unschwer erkennen, dass nicht wenige dieser Ziele am Lise-Meitner- Gymnasium schon mehr oder weniger verwirklicht sind. Im "Modellversuch" geht es darum, das System der Einzelschule im Verbund mit anderen Schulen leistungsfähiger werden zu lassen. Dazu werden der Einzelschule schrittweise mehr Freiheiten zugestanden, es wird mehr Wettbewerb zwischen den Schulen um gute pädagogische Lösungen entstehen, gleichzeitig muss die Schule mehr Verantwortung für die Sicherung der Qualitätsstandards übernehmen. Kurz gesagt: Die "Schule der Zukunft" wird eine Schule zwischen "Freiheit und Verantwortung" sein. Nachdem die Bertelsmann-Stiftung gemeinsam mit dem Ministerium die Entscheidung getroffen hatte, den Kreis Herford und die Stadt Leverkusen zu Modell-Regionen zu machen, stellte das Lise-Meitner-Gymnasium einen Antrag auf Teilnahme an dem Schulversuch. Dazu musste die Schule selber sagen, welche Projektziele sie sich für die vorgesehenen fünf Jahre stellen wollte. Im Auftrag der Schulkonferenz erarbeitete unsere "Schulprogramm-Kommission" im Herbst 1996 ein Teilnahme-Konzept, das von der Schulkonferenz am einstimmig angenommen wurde. Das Konzept gliedert sich in 5 sogenannte "Zielfelder" und 2 "Querschnitts-Aufgaben". Soweit dieses Konzept nicht schon oben beschrieben worden ist, wird es hier abgedruckt. 113
115 Teilnahme-Antrag zum Schulversuch der Bertelsmann-Stiftung und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung Zielfeld 1: Innere Schulreform Unter innerer Schulreform verstehen wir alles, was den traditionellen gymnasialen Fachunterricht ergänzt bzw. erweitert. Wir nennen als Leitbegriffe: Individualisierung, Projektorientierung (fachbezogen und fächerübergreifend), Teamfähigkeit. Alle Maßnahmen der inneren Schulreform dienen dem Ziel die Studierfähigkeit unserer Absolventen zu stärken. Schritte zur inneren Schulreform seit 1986 ( s. o., gleichnamiges Kapitel!) Wir möchten diese Reformschritte im Rahmen des Schulversuchs inhaltlich sichern und unter Einbeziehung der modernen Medien (vgl. Zielfeld 3!) weiterentwickeln. Im Hinblick auf die Übergangsprobleme innerhalb unseres mehrgliedrigen Schulsystems möchten wir den Dialog mit interessierten Schulen in der Region verstärken; dabei spielt die Kooperation mit Grundschulen aus zwei Gründen eine besondere Rolle: Der Wegfall des schriftlichen Guten auf Seiten der Grundschule bringt eine veränderte Lage. Die Sicherung und Weiterentwicklung reformpädagogischer Ansätze, die in den Grundschulrichtlinien verankert sind, sollte im Kontakt mit Grundschulen erfolgen. Im Hinblick auf die Neuordnung der Lehrerausbildung möchten wir in Kooperation mit dem Studien-Seminar Leverkusen neue Segmente in die Ausbildung einbringen, z. B. Einführung aller Referendare und Referendarinnen in die Freie Arbeit, Einübung in das Klassenlehreramt. Im Hinblick auf die Verstärkung der Studierfähigkeit unserer Schülerschaft sind wir offen für Kontakte mit umliegenden Hochschulen und Universitäten;. dabei könnte z. B. unsere Facharbeit in der Stufe 12 Gegenstand des Dialogs sein. Zielfeld 2: Verbesserung des sozialen Lernens Auf Grund der allbekannten sozialen Erosions-Phänomene wird es zunehmend wichtiger unsere sozialpädagogische Beratungskompetenz zu verbessern. Für die Lehrerseite wünschen wir uns : Fortbildung verschiedener Art ( z. B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Gewaltprävention, praktisch verwertbare pädagogische Psychologie) Mehr Zusammenarbeit mit regionalen Institutionen (Schulpsychologischer Dienst, Jugendamt, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden, Polizei u. a.) Für die Schülerseite wünschen wir uns: Stärkung von Helferstrukturen ( Patensystem, Projekt Übetreuung schon vorhanden; erwünscht ist die Einführung der Schülerstreitschlichtung, erwogen wird die Einführung jahrgangsstufenübergreifender Ansätze ) Projekt in Stufe 5: Stillsein ist lernbar Projekt "Erlebnispädagogische Tage" in Stufe 8 Im Bereich des sozialen Lernens stoßen die Lehrer oft genug an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, weil unsere bisherige berufliche Ausbildung diese Qualifizierung nicht geleistet hat. Zielfeld 3: Computergestütztes Lernen und Kommunizieren Die neuen Informationstechnologien, insbesondere die Entstehung und Verbreitung weltweiter Informations- und Kommunikationsnetze mit völlig neuartigen Anwendungsmöglichkeiten, verändern die Bedingungen eines "Lernens in der Informationsgesellschaft". Wir wollen dieser neuen Herausforderung für die Schule mit unserem 3. Zielfeld Rechnung tragen, das - in enger Verknüpfung mit unseren reformpädagogischen Bemühungen - auf folgende pädagogische Leitvorstellungen bezogen ist: Öffnung von Schule - Initiierung von Unterrichtsprozessen in Richtung Kommunikation und Kooperation im regionalen Umfeld und auch weltweit. Selbstgesteuertes Lernen: Intensivierung selbständiger Lernformen in Richtung auf Informationsgewinnung und 114
116 -verarbeitung sowie neue Formen der Selbstkontrolle. Medienkompetenz: Qualifizierung im Umgang mit den elektronischen Medien in Richtung auf eine Stärkung des anwendungsbezogenen Wissens, der kreativen Gestaltungsfähigkeit und der kritischen Reflexion. Im Rahmen des Schulversuchs planen wir folgende konkrete Projekte: Computergestützte Telekommunkation mit einer am Schulversuch beteiligen Grundschule in Form eines projektorientierten -austauschs. Erprobung des Computereinsatzes in der Freien Arbeit mit dem Ziel, selbstgesteuerte Lernprozesse mit der Anwendung neuer Medien zu verknüpfen und damit zu verstärken. Neuordnung des Differenzierungsunterrichts im Wahlpflichtbereich II, indem alle Kurse des WP II - Bereichs abwechselnd ein mehrwöchiges Unterrichtsprojekt durchführen, das sich im Sinne Fächerverbindenden Lernens die Vermittlung inform mations- und kommunkikationstechnischer Grundbildung zum Ziel setzt. Errichtung eines Selbstlernzentrums für die Oberstufe, in dem Schülerinnen und Schüler mit Hilfe elektronischer sowie auch anderer Medien selbstgesteuerte Lernprozesse zwecks Gewinnung von Informations-, Kommunikations- und Gestaltungskompetenz, verbunden mit neuen Methoden der Selbstkontrolle. Diese Einrichtung wird für die Planung und Druchführung unserer Proejektphase in der 11 und für die Facharbeit in der Stufe 12 besondere Bedeutung erlangen. Einbeziehung der computergestützten Informationstechnik in unsere Zentrale Bibliothek. Zielfeld 4: Übernahme des Projekts der Schülerbezirksvertretung Die Schülervertretung schlägt vor, an den Oberstufen der Leverkusener Gymnasien die wechselseitige Belegbarkeit von Kursen im musisch-literarisch-künstlerischen Bereich zu ermöglichen. Aus organisatorischen Gründen kommen dabei in erster Linie die Kurse bzw. Arbeitsgemeinschaften infrage, die außerhalb des Rasters im Nachmittagsbereich stattfinden. Im Anschluss an die Erlebnisse und Erfahrungen mit dem internationalen Schultheaterfestival wird besonders die wechselseitige Öffnung der Literaturkurse für sinnvoll gehalten. Diese schulübergreifende Zusammenarbeit könnte im Rahmen des Schulversuchs schrittweise realisiert werden. Zielfeld 5: Intensivierung der Eine-Welt-Arbeit ( Vgl hierzu das Kapitel über unsere Eine-Welt-Arbeit!) Querschnittsaufgaben Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung wir als wichtigste Querschnitts-Aufgabe für alle oben dargelegten Zielfelder angesehen. Dazu braucht die Schule Qualifizierungsmaßnahmen zwekcks Erlernung von Evaluations- Methoden. Um die unweigerlich mit dem Schulversuch eintretenden Zusatzbelastungen tragbar zu machen, müssen Entlastungsstrategien für Schüler und Lehrer gefunden werden. Nach Auswertung der Antragsunterlagen durch die Bertelsmann-Stiftung ergab sich, dass 37 Schulen aus dem Kreis Herford und 15 Schulen aus Leverkusen teilnehmen würden. Während die Projektleitung geglaubt hatte, die teilnehmenden Schulen wünschten sich vor allem Hilfe in Schulmanagement und Organisationsentwicklung, stellte sich heraus, dass sehr viele Schulen ihren Reformbedarf hauptsächlich in der Verbesserung des Unterrichts selbst sehen. Dies ist wenig verwunderlich; denn fast alle Reformen der letzten Jahrzehnte haben sich auf die Veränderung von Schulstrukturen und Organisationsformen gerichtet, z. B. die Einführung der Gesamtschule oder die Einführung des Oberstufen- Kurssystems. Man hat wohl gehofft, dass damit eine 115
117 Veränderung der Unterrichtsarbeit einhergehen würde. Bei Licht betrachtet hat sich am traditionellen Frontalunterricht aber nur wenig geändert. Die Einsicht, dass der herkömmliche Unterricht durch offene Verfahren teilweise abgelöst, teilweise ergänzt werden muss, entspricht mittlerweile einem internationalen Trend in der Bildungsdiskusssion. Selbst die im Bildungssystem so progressiven Niederlande haben sich vorgenommen, jetzt die traditionellen Unterrichtsverfahren zu reformieren, weil die fortschrittlichen Organisationsformen im Bildungssystem allein die gewünschte Qualitäts-entwicklung nicht bringen. Unser Nachbarland Frankreich steht am Vorabend einer bildungspolitischen Revolution, denn dort muss sowohl das zentral gesteuerte Gesamt-System als auch das lehrerdominierte Unterrichtsverfahren grundlegend reformiert werden. Überall beginnt man zu begreifen, dass mit dem "Nürnberger Trichter" nichts mehr erreicht werden kann! Nach dieser Schwerpunktverlagerung auf den Kernbereich der Schule, den Unterricht, die durch die teilnehmenden Schulen selbst herbeigeführt worden ist, sieht das Angebot der Projektleitung jetzt folgendermaßen aus: Fortbildung im Bereich der pädagogischen Schulentwicklung nach Dr. Heinz Klippert Qualifizierungsmaßnahmen zwecks Durchführung schuleigener Projekte Schulleiterfortbildung in modernen Führungsmethoden Stand des Schulversuchs am Lise-Meitner- Gymnasium zu Beginn des Schuljahrs 1998/99 Nach den Vorgaben der Projektleitung wurde zu Beginn des Schuljahres 1997/98 unter Beachtung bestimmter Kriterien (Fächerstreuung, Altersklassen, Geschlechter) eine sogenannte "Steuergruppe" aus insgesamt 7 Personen gebildet, die den ganzen Schulversuch koordinieren und leiten soll. Der Schulleiter ist in dieser Gruppe "geborenes" Mitglied. Diese Steuergruppe wird von der Unternehmensberatung Dyrda Partner in 6-8 ganztägigen Seminaren pro Jahr für ihre Aufgabe qualifiziert. Die Steuergruppe darf von sich aus nicht in die von den Mitwirkungsgremien beschlossenen Projekte hineinregieren, sie soll sich auf die Koordination und die organisatorische Abwicklung beschränken. 116
118 Das neue Haus des Lernens Pädagogische Schulentwicklung nach Dr. Heinz Klippert: Dr. Heinz Klippert stammt von der Fortbildungsakademie der Evangelischen Kirche in Landau/ Rheinland-Pfalz. Er hat dort Methoden zum Training von Schlüssel-Qualifikationen entwickelt und diese in unterschiedlichen Bundesländern vor Ort erprobt. Er hat seine Vorstellungen in grafisch kompakter Form zusammengefasst. Sozialkompetenz Schlüsselqualifikation Persönliche Kompetenz Fachkompetenz Methodenkompetenz EVA Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen Mögliche Lernarbeiten Organisationsformen Arbeitsblätter bearbeiten Lernprodukte herstellen Vortragen / Kommunizieren Erkunden und Befragen etc. Freie Arbeit Wochenplanarbeit Stationenarbeit Projektarbeit etc. Methoden-Training Kommunikations-Training Team-Entwicklung 117
119 Das Kollegium 1998 Dem Leser dieser Schrift wird sicher auffallen, dass wir in der Zielvorstellung des oben beschriebenen Refom-Konzepts mit Klippert nahezu identisch, im Umsetzungkonzept teilidentisch sind. Mit Recht weist Heinz Klippert darauf hin, dass Freie Arbeit und Projektarbeit Hochformen des Lernens sind, zu deren erfolgreicher Durchführung den Schülern gewisse Basisfähigkeiten und - fertigkeiten vermittelt werden müssen, so dass sie selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen (EVA) auch praktizieren können. Klippert hält vor allem drei Trainingsfelder für unerlässlich: Methodentraining, Kommunikationstraining, Teamentwicklung. In Verbindung mit unterschiedlichen "Lernarbeiten", mit bestimmten "Organisationsformen" wird sukzessive mehr selbständiges Lernen möglich, und das wiederum führt zu mehr "Fachkompetenz", verstärkter "Methodenkompetenz" und wachsender "Sozialkompetenz". Alles zusammen steigert letztlich die "Persönliche Kompetenz" der Schüler. Kenner der Reformpädagogik bemerken sofort, dass 118
120 Heinz Klippert nichts grundsätzlich Neues verkündet, aber sein Konzept ist eine gut durchdachte Systematisierung vieler reformpädagogischer Einzelansätze; er bringt vieles auf den berühmten "Punkt", wobei man sich fragt, warum man eigentlich nicht selber darauf gekommen ist. Nachdem schon im Schuljahr 1997/98 in einzelnen Lerngruppen unserer Schule die Klippertschen Trainingsmethoden mit Erfolg ausprobiert worden sind, beginnt die systematische Einführung mit dem Schuljahr 1998/99 in den Stufen 7 und 11. Wir glauben mit Hilfe des Klippertschen Ansatzes unser in den letzten 12 Jahren entwickeltes Reformkonzept konsolidieren, verbreitern und weiterentwickeln zu können. Förderung schuleigener Projekte im Rahmen des Schulversuchs Neben der Weiterentwicklung bereits bestehender Projekte werden z. Zt. zwei neue schuleigene Projekte aus den o. a. Zielfeldern realisiert: Einführung der Schülerstreitschlichtung IKG für alle! (Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung) 15 Schülerinnen und Schüler der Stufe 9 sowie drei Lehrpersonen unserer Schule werden von einem Diplom-Psychologen in einem Lehrgang in der Methode der Streitschlichtung ausgebildet. Wenn die Ausbildung beendet ist, werden die Schülerinnen und Schüler in einem eigens dafür eingerichteten Streitschlichtungsraum als Streitschlichter für jüngere Jahrgänge, vor allem für 5. und 6. Klassen, zur Verfügung stehen. Dabei werden sie von den ausgebildeten Lehrkräften bei Bedarf betreut. Mit diesem Projekt aus dem Zielfeld "Verbesserung des sozialen Lernens" wollen wir die schon mit der "Schülerübetreuung" aufgebauten Schülerhelfer- strukturen an unserer Schule verstärken. Die Kosten für das Projekt in Höhe von 5000 DM werden teilweise aus Stiftungsmitteln, teilweise aus Fortbildungsmitteln des Landes bestritten. Seit langem existiert in den Richtlinien das Postulat nach Informations- und Kommunikationstechnischer Grundbildung für alle Schüler. Die Umsetzung war bisher allerdings weitgehend dem Zufall überlassen. Am Lise-Meitner-Gymnasium wird mit dem Schuljahr 1998/99 im Rahmen des Wahl-Pflichtbereichs II der Jahrgangsstufen 9 und 10 ein System eingeführt, durch das gewährleistet ist, dass jeder Schüler und jede Schülerin mit dem Ende der Stufe 10 die genannte Grundbildung durchlaufen hat. Darüber hinaus planen wir die Einrichtung von Selbstlernzentren für die Unterstufe und für die Oberstufe mit Hilfe der "neuen Technologien". Qualitätsentwicklung und Entwicklung von Entlastungsstrategien als Querschnittsaufgaben Mit dem Schuljahr 1998/99 beginnen im Rahmen des Modellversuchs Qualifizierungsmaßnahmen, durch die wir schrittweise Evaluationsmethoden zur internen Qualitätssicherung kennen lernen werden. In einer späteren Phase werden wir uns auch mit Methoden der externen Evaluation auseinandersetzen. Da die innerhalb des Schulversuchs zu leistende Reformarbeit für die Lehrer- und die Schülerschaft nicht unerhebliche Belastungen mit sich bringt, ist es unerlässlich auch über faktische Entlastungsmöglichkeiten nachzudenken, denn nur mit dieser Maßgabe sind später die Ergebnisse auf "Normal"- Schulen übertragbar. 119
121 120
122 Lise Mobil Schulpartnerschaften 121
123 "Lise mobil": Schulpartnerschaften von Bernd Ostermann Beziehungen zum europäischen Ausland sind erstmals für das Oberlyzeum i.e. im Jahrbuch 1929/30 dokumentiert und sollen wegen ihrer grundlegenden Bedeutung für die weitere Entwicklung trotz einer dann folgenden Zeit der Eingrenzung und Besinnung auf nationale "Werte" exemplarisch wiedergegeben werden. 122 Auf eine Anzeige im Headway, einer englischen Zeitung des Vökerbundes, meldeten sich aus den verschiedenen Teilen Englands und seiner Kolonialund Interessengebiete Briefschreiber, die...nur durch den Wunsch geeint sind, auf ihre Art zur Verständigung der Völker beizutragen. Sie machen unsere Schülerinnen bekannt mit Sitten und Gebräuchen ihres Landes, bringen Beschreibungen der Landschaft, in der sie wohnen,...tauschen Ansichten über literarische, politische und sie persönlich interessierende soziale Fragen. Viele Briefe sind in deutscher Sprache von den Engländern, in englischer Sprache von unseren Schülern abgefaßt. Dabei bietet sich reichlich Gelegenheit, die Eigenarten der fremden Sprache aus den Übersetzungsfehlern abzuleiten. Unsere Schülerinnen haben bei der Verbesserung des fehlerhaften deutschen Ausdrucks Gelegenheit, sich in klarer, stilistisch reiner Umformung zu üben, -eine sehr lehrreiche und nutzbringende Aufgabe. Überaus wertvoll sind die Verbesserungen, die von den Engländern an den englischen Briefen unserer Schülerinnen vorgenommen werden. Sie zeigen die idiomatische, echt englische Ausdrucksweise, geben vielfach methodische Hinweise zur Aneignung des idiomatischen Englisch und sind in eine so liebenswürdige und ermunternde Form gekleidet, daß sie gern und dankbar von den Schülerinnen hingenommen werden. Durch Schallplatten, die von englischen Lehrern selbst gesprochene Texte bringen, wird sogar das lebendige Wort an uns vermittelt. Wir hoffen, daß die Frucht dieses anregenden und mannigfaltigen Briefwechsels im Laufe der Zeit sogar ein Schülergruppenaustausch zwischen deutschen und englischen Schulen für einige Ferienwochen sein wird. Auf gegenseitige Gastfreundschaft gegründet, kann er selbst bei den heutigen Verhältnissen ohne allzu große geldliche Opfer unseren Schülerinnen ein lebendiges Bild der anderen Nation in bescheidenem Rahmen verschaffen..." Diese visionären Wünsche haben sich, wie die folgende Dokumentation belegt, in vielfacher Weise erfüllt und sind weit über die Vorstellungswelt Dr. Börgers hinausgegangen.
124 Die Schulpartnerschaft mit Frankreich von Ingrid Mayer Vielleicht gehören Sie als Leserin oder Leser dieser Festschrift zu den etwa 800 Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen unserer Schulpartnerschaft mit dem Lycèe Camille Vernet in Valence an einer Reise ins Nachbarland Frankreich teilgenommen haben. Die Anfänge der Partnerschaft reichen zurück bis in das Frühjahr Damals knüpfte Herr Karl König die ersten Briefkontakte des Städtischen Mädchengymnasiums zur neuen Partnerschule. Ansprechpartnerin war Madame Geneviève Debuysscher, Deutschlehrerin am Lycée Camille Vernet. Im Jahre 1966 erfolgte nach einjähriger Vorbereitungszeit der erste Schüleraustausch zwischen einer "Seconde" der neuen Partnerschule und einer 12. Klasse unserer Schule (damals noch "Unterprima" genannt). In den 32 Jahren ihres Bestehens hat diese Partnerschaft uns mit einer Region unseres Nachbarlandes vertraut gemacht, deren Schönheit sich dem Gedächtnis einprägt und zum Wiederkommen auffordert. Erinnern Sie sich an Avignon oder den Pont du Gard, das Picknick in Les Antiques oder die Felsenstadt Les Baux? An das Leben in der Familie der Partnerin oder des Partners, das ein Sich-Einlassen auf fremde Gewohnheiten erforderte, aber auch Entdeckungen aller Art ermöglichte? Und der Vergleich der Schulsysteme machte die Vorzüge des eigenen oft erst bewußt... Seit einigen Jahren findet der Austausch in der Jahrgangsstufe 10 statt - und ist oft ein Anstoß, das Studium der französischen Sprache in der Oberstufe fortzusetzen. Aber nicht nur die Begegnungen von Schülern füllen die Partnerschaft mit Leben. Seit dem 20. Geburtstag im Jahre 1986 findet alle fünf Jahre ein Lehreraustausch statt, der weit über die Fachschaft Französisch hinaus und über alle Sprachgrenzen hinweg Kontakte knüpft, Verständnis fördert, der Idee "Europa" den Boden bereitet. Die nächste Geburtstagsfeier ist für das Jahr 2000 geplant. Wir freuen uns darauf. 123
125 Die Schulpartnerschaft mit England Begeisterung und Verzweiflung lagen in der "heißen Phase" der Vorbereitung des diesjährigen Englandaustauschs nahe beieinander, denn leider konnte nicht für alle, die so gerne mitgefahren wären, ein(e) englische Partner(in) gefunden werden. Besser lässt sich wohl nicht zeigen, dass unser Schüleraustausch auch nach 22 Jahren nichts von seiner Attraktivität eingebüßt hat. Es sind die vielen ganz individuellen Erfahrungen, die diese vier Wochen (zwei hier und zwei in England) für uns alle eine bleibende Erinnerung werden lassen. Woran sich wohl unsere englischen Gäste erinnern werden? Ganz sicher an den für sie so exotischen Karnevalstrubel. Und was bleibt uns besonders im Gedächtnis haften? Vielleicht das Geheimnis der Funktionsweise englischer Duschen? Kekse mit penevon Reinhild Hohmann Lehrerzimmer Lise-Meitner-Schule, Januar 1998: "Krieg ich jetzt einen Engländer?" "Wann verteilen Sie die denn endlich?" "Ich muss da mit, bitte!" " Ich nehme auch nen Jungen, wenn's nicht anders geht." "Ich hab vergessen, ein Foto auf den Anmeldezettel zu kleben, macht das was? trantem Orangenaroma und Chips mit Essiggeschmack? Ganz neue Nicht-Lehrbuch-Wörter ("Die sagen immer amazing, was heißt das denn?")? Die englische Lehrerin, die einen unserer Schüler für einen Engländer hielt und ihn tadelte, weil er keine Uniform trug? Die Parties? Das Familienleben? Oder vielleicht die Ausflüge: das Black Country Freilichtmuseum, Shakespeares Stratford Warwick Castle, der (leider verregnete) Freizeitpark Alton Towers mit der selbstmörderischen Achterbahn? Unser Zwischenstop in London? Alle werden wir uns sicher in erster Linie an die große Herzlichkeit unserer englischen Gastgeber erinnern und den nächsten Austauschfahrern wünschen, dass sie eine ebenso schöne Zeit haben mögen wie wir! 124
126 Die Schulpartnerschaft mit Amerika von Ludwig Selbach Seit 1989 gehört die Lise-Meitner-Schule zu dem noch relativ kleinen Kreis von Gymnasien, die ein festes Austausch-Programm mit einer US-Schule unterhalten. Junge Menschen aus Deutschland und Amerika im Rahmen von Familie und Schule zusammenzuführühren ist das zentrale Anliegen des German- American Partnership Program (GAPP). Obwohl das deutsch-amerikanische Verhältnis auf Regierungsebene unproblematisch ist, mangelt es im Alltag und im privaten Bereich häufig an Kenntnis des jeweiligen Partnerlandes. Ein Austauschprogramm ist hervorragend geeignet, Menschen und Sprache eines fremden Landes kennenzulernen und auf diese Weise an der Basis zum Verständnis zwischen den Nationen beizutragen. Das von der deutschen und der amerikanischen Regierung unterstützte GAPP-Programm, dem wir angeschlossen sind, fordert bestimmmte Kriterien, die für einen erfolgversprechenden Schüleraustausch wichtig sind: die beteiligten Schüler besuchen das Land nicht als Touristen, sondern werden in Gastfamilien integriert die Austauschschüler lernen durch aktive Teilnahme am Unterricht zahlreiche gleichaltrige Jugendliche des Gastlandes kennen und entwickeln ein Verständnis für die Besonderheiten des amerikanischen bzw. des deutschen Schulsystems die Partnerschaft ist auf Gegenseitigkeit und Dauer angelegt der Austausch umfaßt etwa drei Wochen in jedem Land, mindestens zwei Wochen davon werden in den Gastfamilien am Schulort verbracht, aber auch Ausflüge und Exkursionen gehören dazu die teilnehmenden Schüler verfügen zumindest über Grundkenntnisse der Sprache des Partnerlanes, denn dies erleichtert die Integration in Schule und Familie erheblich die Schüler werden von erfahrenen Lehrkräften gründlich auf den Austausch vorbereitet und dabei begleitet Unsere Schule führt den Austausch in einem Zwei- Jahres-Rhythmus durch. Da Leverkusen recht enge Beziehungen zu Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat - dort befindet sich das Hauptquartier von BAYER USA - ist es günstig, daß unsere Partnerschule, die Upper St. Clair High 125
127 School, sich im Großraum Pittsburgh befindet. Viele Leverkusener, die vorübergehend in Pittsburgh tätig sind, wohnen im Einzugsbereich der USC High School. In einem Austauschjahr bereitet sich eine Gruppe von 20 bis 25 Schülerinnen und Schülern (überwiegend aus der Stufe 11) ab Januar intensiv auf den USA-Aufenthalt vor. Zahlreiche landeskundliche und sprachliche Besonderheiten werden behandelt, damit man sich in Schule, Gastfamilie und Freizeit zurechtfindet und das amerikanische Alltagsleben keine allzu großen Probleme bereitet. Der nächste Austausch ist für 1999 geplant. Im verganenen Jahr befand sich unsere Gruppe (24 Schüler, 2 Begleiter) vom 6. bis 27. April in den USA. Nach einem zweitägigen Aufenthalt in New York - zum Einstimmen auf die amerikanische Lebensart - ging es weiter nach Pittsburgh, wo die Gastfamilien schon warteten und ihren Besuchern aus Deutschland einen überaus herzlichen Empfang bereiteten. Das Schulleben an der Upper St. Clair High School, vielerlei private und offizielle Begegnungen im Rahmen des Austauschprogrammes sowie ein dreitägiger Ausflug in die Bundeshauptstadt Washington ließen keine Langeweile aufkommen. Nach drei Wochen in Upper St. Clair fiel das Abschiednehmen schwer, doch schon im Juni 1997 waren die amerikanischen Schüler und und ihre Begleiter zu Gast in Leverkusen und am Lise-Meitner- Gymnasium. Viele gemeinsame Unternehmungen sorgten dafür, daß man sich noch besser kennenlernte und einander - auch in der Verschiedenheit der Lebensart - zu akzeptiern lernte. Nach Aussagen der Teilnehmer war auch dieser Austausch wieder eine rundum gelungene Sache. Es spricht für das Konzept des Austausches, wenn eine Reihe von ehemaligen Teilnehmern auch Jahre später noch private freundschaftliche Kontakte zu ihren damaligen Partnern in den USA bzw. in Deutschland unterhalten. 126
128 Die Schulpartnerschaften mit Russland Seitdem hat sich ein volles Programm ergeben: Es gibt Kurse in den Klassen 9 und 10 des Differenzierungsbereichs, fortgeführte Grundkurse (gelegentlich auch Leistungskurse) in den Jahrgangstufen 11, 12 und 13 mit regelmäßigem schriftlichen und mündlichen Abitur. Studienfahrten in die Sowjetunion seit Anfang der 70er Jahre (nach Moskau - Leningrad) vertieften die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler über die Sprache und Kultur Rußlands. Dem kulturellen Austausch dienen die Schulpartneschaften ist das LMG als "Leistungsschule" in das sogenannte Bundesprogramm der Schulpartnerschaften der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion aufgenommen worden; das bedeutet finanzielle Förderung durch den Pädagogischen Austauschdienst (PAD). Wir erhielten eine Partnerschule in Baku/Aserbeidvon Birgit Krause Es ist ein Fach, das am Lise-Meitner-Gymnasium auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Anfang der 70er Jahre bereits wurde Russisch von einer Arbeitsgemeinschaft in ein Schulfach umgewandelt, das im Differenzierungsbereich der Klasse 9 erstmals als Wahlpflichtfach angeboten wurde. schan zugewiesen. Der Versuch des Austauschs scheiterte jedoch wegen des Zusammenbruchs der Sowjetunion erfolgt ein Schüleraustausch mit einer Schule in Moskau (Nr.858), dessen Durchführung durch eine Spendenaktion der Schulgemeinde ("Vor- Weihnachtsaktion 1991") erfolgreich gestaltet werden konnte. Im Rahmen der Neuorganisation des gesamten Partnerschaftsprogramms (1992) wurde, in Kooperation mit der Landrat-Lucas-Schule eine Austauschmaßnahme mit der Schule Nr. 351 in St. Petersburg durchgeführt. Schülerinnen und Schüler des LMG nehmen regelmäßig an der Russischolympiade des Landes NRW teil und 1992 belegten Schülerinnen der Jahrgangsstufe11 bzw. 12 den ersten Platz in diesem landesweiten Wettbewerb. 127
129 Im Februar 1997 erhielt die Lehrerschaft des Lise-Meitner-Gymnasiums folgende Information: Liebe Kolleginnen und Kollegen Endlich ist es soweit!! Auch unsere Schule ist seit heute online und präsentiert sich mit den ersten Web-Seiten im "Netz der Netze": im Internet. Die Adresse unserer Homepage lautet: Wir freuen uns über Ihren (hoffentlich regen) online- Besuch auf unseren Web-Seiten und sind auf Ihre Rückmeldung gespannt. Trotz der vielen Arbeit in den letzten Monaten, die die Internet-AG (bestehend aus Schülern der Jgst. 11 und 12) in die Gestaltung der Web-Seiten investiert hat, befindet sich das Projekt natürlich erst im Anfangsstadium und muss noch erheblich ausgeweitet werden, um unsere Schule angemessen im Internet zu präsentieren. Wir hoffen auf Ihre Mitarbeit und sind für Anregungen und Kritik dankbar. Wer zuhause nicht über einen Internet-Anschluss verfügt, kann natürlich gerne an unserem Schul-Rechner (R. 425) auf der LMS-Homepage surfen. Termine können mit mir oder mit den Kollegen Halfenberg und Jansen abgesprochen werden. Neben der Internet-AG sowie einigen Schüler/innen der Jgst. 12, die das Internet für ihre Facharbeit nutzen, sind in diesem Halbjahr bereits drei Internet- Unterrichtsprojekte angelaufen, über die ich Sie kurz informieren möchte: 1) Im Diff-Kurs "Medien" der Stufe 9 (Bramhoff) erstellen die Schüler/innen einen Jugend-Stadtführer für Leverkusen, den sie auf der LMS-Homepage publizieren werden. 2) Im Grundkurs Russisch der Stufe 11 (Borrmann/Krause) tauschen sich die Schüler/innen per (in kyrillischer Schrift!) mit einer russischen Partnerschule aus. Kollege Borrmann wird über diese U-Reihe seine Staatsarbeit schreiben. 3) Im Politik-Unterricht der Klasse 10c (Heck/Bramhoff) recherchieren die Schüler/-innen im Internet über die geplante Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Auch Kollege Heck hat dieses Thema für seine Staatsarbeit gewählt. Ich hoffe, dass im nächsten Schuljahr weitere Internet-Unterrichtsprojekte erprobt werden - eine kollegiumsinterne Fortbildung werden wir (Bra, Hf, Ja) zu diesem Thema nach den Osterferien anbieten. 128
130 Nachfolgend Überlegungen und Wertungen des im Fach Russisch durchgeführten Projekts, die exemplarisch für die Vielfalt der bereits durchgeführten anderen Projekte stehen mögen. Stefan Borrmann: -Projekte im Russischunterricht (Auszüge aus PRAXIS, PRAKTIKA 1/98) Die Organisation und Durchführung eines - Projektes im Russischunterricht eröffnet ein vielfältiges Lern- und Motivationspotential. Sie hebt räumliche Entfernungen auf und ermöglicht im Klassenzimmer authentische Kommunikation und die praktische Umsetzung kommunikativer und interkultureller Lernziele. Diese Erfahrung konnte ich in einem -Projekt machen, das ich im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit zusammen mit den Schüler/innen des Russisch-Grundkurses (3. Lernjahr) der Stufe 11 der Lise-Meitner-Schule in Leverkusen durchgeführt habe. Die Leverkusener Schüler/innen standen in diesem -Projekt in Korrespondenz mit Schüler/innen aus Novocheboksarsk (Republik Tschuwaschien), Novosibirsk und Moskau. Die in diesem Artikel abgedruckten Briefe bieten Eindrücke von der sprachlichen und inhaltlichen Vielfalt, die mit der Durchführung eines -Projektes verbunden ist. Die Briefe sollen den Leser bzw. die Leserin ermuntern, sich auf das Wagnis eines -Projektes einzulassen. Der Briefaustausch erwies sich im Laufe des Projektes als sehr umfangreich. Es wurden sehr verschiedene Themen besprochen, die sich in das gewählte Oberthema "Jugend im Gespräch" einfügten. Ausgangspunkt der Diskussion waren Texte aus der 1. Lektion des zweiten Bandes des Lehrwerks "Okno". Nachdem die Leverkusener Schüler im Unterricht den Text gelesen hatten, nutzten die Schüler die Gelegenheit, ihre russischsprachigen Partner zu den im Lehrwerktext beschriebenen Inhalten zu befragen. Das -Projekt zeigte über die konkrete Projektarbeit hinaus positive Folgen sowohl in den Bereichen des Leseverstehens als auch bei der Produktion eigener Texte. Vor allem im Bereich des Leseverstehens zeigte sich mit zunehmender Dauer des Projektes ein Abbau an Lesehemmungen gegenüber russischsprachigen Texten. Die Schüler und Schülerinnen haben sich mit einer großen Selbstverständlichkeit um die Erschließung der Textinhalte bemüht. Im Rahmen dieser authentischen Kommunikation haben sie im Sinne von "language awareness" sehr verschiedene sprachliche Register des Russischen (Register der "Jugendsprache", "poetischen Sprache" und "Alltagssprache", Empfänglichkeit des Russischen für Fremdwörter) wahrgenommen. Weiterhin hat die unmittelbare Auseinandersetzung mit den russischsprachigen Partnern ein vielfältiges interkulturelles Lernpotential entwickelt. Während ich mich im lehrbuchabhängigen Unterricht bislang alleine mit Hilfe ausgewählter Lehrwerkinhalte darum bemühen mußte, interkulturelles Lernen zu ermöglichen, konnte ich im - Projekt auf Impulse zurückgreifen, die sich aus dem konkreten -Austausch ergaben. 129
131 130
132 Gremien und Institutionen der Schulgemeinde 131
133 Schüler vertreten Schule verändern Seit 25 Jahren gibt es die Schülervertretung (SV) von Katja Thierjung 132 In den letzten 25 Jahren haben sich die Möglichkeiten der Einflußnahme von Schüler/Innen auf das schulische Leben sehr erweitert. Das Engagement war und ist immer abhängig gewesen von äußeren Bedingungen wie Gesetzen, der Bereitschaft der Schülervertreter und der Offenheit der Lehrer/Innen. Die Einflüsse, die die Schülerschaft auf das Schulleben ausübt, sind manchmal sehr auffällig und spektakulär, zu manchen Zeiten eher zurückhaltend und versteckt. Viele Veränderungen, Ereignisse und Bewegungen haben den Weg der SV in den letzten Jahren bestimmt: Bevor die Mädchenschule Lise-Meitner ein allgemeines Gymnasium für Mädchen und Jungen wurde, waren die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Schüler/Innen nur sehr begrenzt. Die Schule war eher traditionell und konservativ. Es gab zum Beispiel keine Schulkonferenz, auf der Eltern und Schüler mitbestimmen konnten. Stattdessen wurden nur Lehrerkonferenzen durchgeführt, an der die gesamte Lehrerschaft teilnahm. Klassen- und Schülersprecher wurden zwar gewählt, diese jedoch hatten keinen Einfluss auf schulpolitische Entscheidungen. 1968, als das Lise- Meitner ein allgemeines Gymnasium wurde, veränderten sich langsam die Mitbestimmungsrechte. Eine erste pädagogische Konferenz, an der sowohl Lehrer/Innen und Schüler/Innen teilnahmen, fand im Forum statt. Den Antrag zu dieser Konferenz, der viele Lehrer/Innen skeptisch gegenüberstanden, wurde von Susanne Müller, der damaligen Schülersprecherin und Herrn Löw gestellt. Herr Löw war gerade erst als junger Lehrer an das Lise-Meitner-Gymnasium gekommen und von der Schülerschaft zum Vertrauenslehrer gewählt worden. Obwohl es viele Vorbehalte gab, wurde das Mitbestimmungsrecht der Schüler/Innen an unserer Schule schrittweise erweitert. Dies war geradezu revolutionär, da noch kein Gesetz solche Veränderungen vorsah. Trotz eines gewissen Widerstandes von Seiten der Lehrerschaft wurden 1972 drei stimmberechtigte Schüler zu einer Konferenz mit 70 Lehrern zugelassen. Diese an sich unbedeutende Anzahl war zunächst ein Erfolg für die Schülermitverwaltung. Dieser vergrößerte sich noch, als bei den Versetzungskonferenzen ab der Klasse 10 jeweils zwei Schüler, die unter Schweigepflicht standen, teilnehmen durften. Das Schulmitwirkungsgesetz in der heutigen Form besteht seit Sein wichtigster Bestandteil war die Einrichtung der Schulkonferenz, die sich aus Lehrer/Innen, Eltern und Schüler/Innen zusammensetzt. Die Möglichkeiten der Schülervertretung wurden dadurch stark erweitert. Auch sie haben nun das Recht, Anträge zustellen, abzustimmen und ihre Sicht der Dinge darzustellen. Viele Gegner des neuen Gesetzes bestritten, daß Eltern und vor allem Schüler die Kompetenz hätten, Einfluß auf das Schulleben und seine Gestaltung zu nehmen. Dies stellte sich jedoch bald als Irrtum heraus. Seit dieser Zeit fühlen sich Schüler/Innen mitverantwortlich für ihre Schule und versuchen, ihre Anliegen durchzusetzen und ihre Ideen einzubringen. Auch das Interesse an politischen Problemen wuchs. Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre fanden verschiedene Friedensdemonstrationen, die von der SV organisiert worden waren, statt. Die Schülersprecherin Kerstin Müller beantragte mit Herrn Thelen, der schon zu dieser Zeit Vertrauenslehrer war, die Durchführung einer Projektwoche in Hinblick auf ein neues Lernen an der Schule. Die SV nahm auch später bei den Vorbereitungen und der Organisation teil. Doch schon zu dieser Zeit bestand das Problem, Schüler zu erreichen und sie über die Arbeit der SV zu informieren. Deswegen wurde ein SV-Tag veranstaltet, an dem mit Hilfe von Theateraufführungen und Gesprächsrunden versucht wurde, die Schüler/Innen für die SV-Arbeit zu interessieren. Die Teilnahme an pädogogischen Tagen stellte und stellt eine Möglichkeit für die SV dar, eine Verbesserung von Schule und Unterricht zu bewirken. Dies gilt auch für die Arbeit in den Schulkonferenzen, in den Fachkonferenzen und für die Organisation von Projekttagen. Finden Ausstellungen oder Veranstaltungen in der Galerie Lise statt, so versucht die SV auch hier, einen Beitrag zu leisten. Das gleiche gilt für die Schulprogammkommission, die im letzten Jahr zur
134 Verbesserung des Schulprofils und des Schulprogramms eingeführt wurde. Hier bemühen wir uns, unsere Interessen und Vorstellungen im schulpolitischen Bereich zu vertreten. Doch auch der Freizeitbereich ist uns natürlich wichtig. Es werden regelmäßig verschiedene Partys für alle Stufen organisiert, die bisher sehr oft zum Erfolg geworden sind. Weiterhin bieten Oberstufenschüler für die Fünfer eine Basketball-AG an. Diese Basketball-AG gehört auch zu einem Konzept, mit dem wir versuchen, schon ab der Klasse 5 Schüler in unsere Arbeit einzubeziehen. Deshalb besuchen wir jedes Jahr die neuen Klassen und berichten über unsere Funktion und Tätigkeit als SV. Neben unserer Vorstellung schreiben wir gleichzeitig einen Malwettbewerb aus, der immer begeistert wahrgenommen wird. Auch die Übernahme von Patenschaften in der Unterstufe durch Oberstufenschüler/Innen wird von der SV organisiert. Mit Hilfe von regelmäßigen Stufengesprächen versuchen wir die Probleme, Fragen und Wünsche der einzelnen Stufen zu erfahren und, wenn möglich, aufzugreifen. Bei unseren Projekten zeigt sich immer wieder, wie sehr die SV auf die Unterstützung von Seiten der Vertrauenslehrer, der Schulleitung und der Hausmeister angewiesen ist. Gerade das letzte große Projekt der SV, das Schulradio, wäre ohne die Hilfe der Hausmeister nicht zustande gekommen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an jeden einzelnen im Namen der gesamten SV! Hoffen wir, daß es auch in den nächsten Jahren gelingt, viele Schüler/Innen für die Arbeit der SV zu interessieren, denn das Engagement für unsere Schule lohnt sich! Die Schülerzeitung am LMG Redakteure zusammenrufen - Themen verteilen - fertige Artikel eintreiben - Anzeigen sammeln - alles mischen und mit Layout-Elementen anreichern - in den Druck bringen - fertig ist die Schülerzeitung! Wenn's doch so einfach wäre. Vom Prinzip her läuft die Erstellung einer Schülerzeitung zwar genau so ab, aber nur die Insider wissen um die nicht fristgerecht eingereichten Werbevorlagen, die noch zu füllenden halben Seiten oder die abstürzenden Computer - ganz zu schweigen von den Kniefällen, derer es bedarf, den sowieso schon völlig überlasteten Mitschülern ihre Artikel aus den Rippen zu schneiden. Was ist es dann, dieses ausschlaggebende Moment, das einen immer wieder dazu bringt, neben dem harten Schulalltag die Belastungen der redaktionellen Arbeit oder gar des Layouts auf sich zu nehmen? Nun, vielleicht ist es die Erkenntnis, dass die Schule eine unabhängige, schülernahe Informationsquelle braucht, die das Schulgeschehen auf ihre Weise kommentiert. Vielleicht ist es beim einen oder anderen das erste journalistische Training, das ihm seinen späteren Berufsweg ebnen soll. Auf jeden Fall aber ist es dieses unglaublich gute Gefühl, wenn einem die Hefte am Erscheinungstag förmlich aus den Händen gerissen werden, wenn sich Schüler über die Zitate fast totlachen und sich Lehrer über Kommentare ärgern und wenn einem der Hausmeister wegen dem einen oder anderen Seitenhieb lobend auf die Schulter klopft. Das dürfte schon immer die größte Motivation gewesen sein - zumindest hat die Schülerzeitung an unserer Schule eine lange Tradition. Die erste urkundliche Erwähnung journalistischer Aktivität findet sich in einem Verwaltungsbericht aus den 50er Jahren. Die "Mädchen der Oberprima" hätten ein "schönes Magazin" zusammengestellt. Was es 133
135 danach an Schülerzeitungen gegeben hat, ist kaum noch zu rekonstruieren. Die heutige Schülerzeitungsgeneration findet ihre Wurzeln Ende der 70er Jahre. Da gründete sich nämlich die legendäre "Lisel". Legendär deshalb, weil sie eine dermaßen politisch motivierte Redaktion hatte, dass sie sich mit Schulleitung und gar dem Verfassungsschutz anlegte. So druckte man in Nr. 8 (September 1982) einen Artikel ab, der eine gewisse Sympathie für die Ziele der RAF - nicht für ihre Methoden - erkennen ließ. Daraufhin wurde der Redaktion ihr Raum entzogen, ein Akt, der seitens des damaligen Direktors Dahlmann nicht als Zensur verstanden werden sollte, wohl aber so gewertet werden kann. Die "Lisel"- Redaktion ließ sich davon nicht beeindrucken und machte außerschulisch weiter. Eine Ausgabe später (Nr. 9, 1983) bekam sie es gar mit dem NRW- Innenministerium zu tun, als sie in einem Artikel der CDU allzu deutlich rechtsradikale Tendenzen ihres Wahlprogramms unterstellte. Pikant an der Sache ist, dass das Ministerium seinen Brief an die "Lisel- Meitner-Schule" schickte und so ungewollt Wasser auf die Mühlen der Redaktion goss. Berühmtheiten wie Kerstin Müller oder Oliver Niederjohann zählten damals zur "Lisel"-Redaktion. Verständlicherweise war die "Lisel" aufgrund 134
136 politischer Motivation ein reines Oberstufenblatt, das sich den Luxus gönnte, trotz seines Erscheinens in einer Schule gar nicht oder nur wenig über Schulisches zu berichten. Natürlich muss das auf dem Hintergrund der politischen Grabenkämpfe zu jener Zeit gesehen werden, in deren Zuge auch die Schüler um mehr Mitbestimmung in schulischen Gremien kämpften und die schließlich in der Gründung der Schulkonferenz mündeten und damit an Aktualität verloren. So wurde denn auch 1983 das "Liselchen" gegründet. Die erste Ausgabe erschien ohne Titel, da man noch keinen passenden gefunden hatte. "Unter- und mittelstufenbezogen" wollte man sein und sich so ganz klar von der großen Schwester "Lisel" abgrenzen. Interessanterweise waren einige Gründer des "Liselchen", so Marcus Gröber und eben Oliver Niederjohann, vorher in der "Lisel"-Redaktion involviert. Das "Liselchen" erfreute sich zunehmender Beliebtheit, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die "Lisel" an politischer Schlagkraft nachließ. Das endgültige Ende dieser ersten Schülerzeitung der Lise-Meitner-Schule kam im November 1985, als sich eine dritte Schülerzeitung gründete, nämlich der "Meitner-Blick", der allerdings nie über seine erste Ausgabe hinaus kam. Jedoch las sogar Horst Thelen, bis dato Stütze der "Lisel"-Redaktion, im "Meitner- Blick" seinem ehemaligen Schützling "Lisel" die Leviten - wenn es auch nur um eine Bundeswehr- Werdung ging. Wie auch immer, von da an war das "Liselchen" konkurrenzlos - und ist es bis heute geblieben. Geändert hat sich hingegen die personale Besetzung. Jedes Redaktionsteam drückte der Zeitung seinen Stempel auf. So standen unter den "Gründungsvätern" und "- müttern" die schulischen Belange im Vordergrund. Besonders die neu eingeführten "Zitate"-Seiten mit den originellsten Lehrersprüchen erfreuten sich stets großer Beliebtheit - bis heute sind es die wohl meistgelesenen Seiten einer jeden Ausgabe. Daneben gab es vor allem Kino- und Buchkritiken, aber auch Spielideen und Interviews. Besonders gut lesen sich die "Verhaltensforschungen", bei denen mutige Schüler ihre Lehrer in Extremsituationen versetzten und dann deren Reaktion beobachteten. Wieder etwas politischer wurde das "Liselchen", bis dato reine Sek.I-Zeitung, als Marcus Gröber die Redaktion verließ und Volker Schoegel seine Nachfolge als Chefredakteur antrat. Jetzt war die Zeitung endgültig unabhängig, da die Redaktion vollkommen eigenständig arbeitete. Das führte zu merklich kritischeren Artikeln und einer größeren Orientierung zu außerschulischen Themen. Allerdings waren Schüler aller Stufen in der Redaktion vertreten, so dass das "Liselchen" nun wirklich eine Zeitung für die ganze Schülerschaft war. Das änderte sich ein wenig, als Thomas Römer 1991 den "Chefposten" übernahm, nachdem die meisten aus der vorigen Redaktion Abitur gemacht hatten. Zusammen mit seiner Klasse, der damaligen 7b, war er bis 1995 federführend. Dadurch, dass das "Liselchen" in der Hand einer einzigen Klasse lag, büßte es seine Breitenwirkung ein. Zwar stand weiterhin die Schule im Vordergrund, jedoch engten zahlreiche Insider-Kommentare den Leserkreis unnötig ein. Nach einem Jahr Pause, in dem man das "Liselchen" bereits tot glaubte, beschloss die damalige SV, eine neue Redaktion ins Leben zu rufen. Diese blieb der alten Linie treu, primär über Schulisches zu berichten. Chefredakteur und Layouter in Personalunion war jetzt Philipp Grammes. Die neue Redaktion, die fast ausschließlich aus Oberstufenschülern bestand, schaffte es sogar, ihre Ausgaben regelmäßig vierteljährlich herauszubringen. Diese Tradition fortzusetzen und das erreichte Level zu halten hat sich Melanie Wiebe zur Aufgabe gemacht, die seit kurzem der erste weibliche "Chef" des "Liselchen" ist. Noch ein Wort zum Layout: Hier hat sich wohl am meisten getan in den letzten 15 Jahren. Waren die ersten Ausgaben noch regelrecht "zusammengeflickt", teilweise von Hand geschrieben und nicht bebildert, so entstehen die heutigen Ausgaben gänzlich am Computer. Konnte man in der Sommerausgabe 1985 noch stolz berichten, ein Photo gerastert und abgedruckt zu haben, werden heute die Bilder gescannt und elektronisch bearbeitet. Überhaupt ist die Arbeit der Redaktion um Einiges professioneller geworden. So wird das "Liselchen" inzwischen in einer Druckerei offset gedruckt und rein durch Anzeigen finanziert. Die Redaktion verfügt mittlerweile über eigene Software und seit Neuestem gibt es das "Liselchen" sogar im Internet ( An der Intention, eine Schülerzeitung zu machen, hat sich allerdings nichts geändert. Immer noch gilt es, schulische Informationen zu vermitteln und das Schulgeschehen kritisch zu kommentieren. So stümperhaft manche Artikel, so wenig interessant manche Themen auch sein mögen - kein anderes Medium erfreut sich derartig großer Beliebtheit und eines derartig festen Leserkreises wie eine Schülerzeitung. Die damit verbundenen Chancen nimmt das "Liselchen" seit 15 Jahren wahr und wird es auch in Zukunft tun - mit wachsendem Anspruch, mit wachsenden technischen Möglichkeiten und mit wachsender Beliebtheit. Dessen darf man sich sicher sein. Philipp Grammes 135
137 Neu: Schülerradio am LMG Das "Liselchen" hat Konkurrenz bekommen. Seit Dezember 1997 gibt es "Radio LMS", das täglich in der Pausenhalle zu hören ist. Hervorgegangen ist es aus den Ideen der SV, die das Informationsproblem an der Schule lösen wollte. In Hausmeister Arno Herbst fand man einen hochmotivierten Fürsprecher, der das nötige technische Equipment zusammenstellte und sogar die Finanzierung sicherte. Nun brauchten nur noch die nötigen Boxen in der Pausenhalle befestigt zu werden - und schon konnte das neue Medium auf Sendung gehen. Natürlich handelt es sich bei "Radio LMS" nicht um ein Radio im eigentlichen Sinne. Aber die Informationen können direkt übermittelt werden. Damit ist "Radio LMS" schneller als die Schülerzeitung - und manchmal auch schneller als die Durchsagen des Direktors. Insgesamt eröffnet es völlig neue Möglichkeiten, die noch längst nicht ausgeschöpft wurden. Da wäre z.b. an Schülerprojekte in Form von Wortbeiträgen zu denken oder an einen Einsatz des Radios im Dif.-Bereich. Den täglichen Programm-Ablauf garantiert die eigens gegründete Radio-Redaktion. Bisher wird fast ausschließlich Musik gesendet, doch das soll und wird sich noch ändern. Ob Geburtstagsgrüße oder Kinotips - nichts ist unmöglich. Und selbst wenn es bei der Musik bleiben sollte, so ist doch die Atmosphäre in der Pausenhalle merklich entspannter, ja fast kommt Disco-Laune auf. Da wundert es nicht, dass das Feedback von Schülerseite durchweg positiv ist. Selbst anfängliche Gegner der neuen Institution haben inzwischen einsehen müssen, dass unkoordiniert und extatisch zuckende Schülerinnen und Schüler nun zum Bild unserer Schule dazugehören wie das Meistermann-Fenster oder das Eine-Welt-Café. Und sind seine Möglichkeiten erst voll ausgeschöpft, so wird es aus dem Schulleben überhaupt nicht mehr wegzudenken sein. Philipp Grammes Der Förderverein Nachdem die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Lise-Meitner-Gymnasiums im Vorjahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte, freuen wir uns nunmehr, das 75-jährige Jubiläum der Schule mitzugestalten. Eine Chronik über 75 Jahre Schule bedeutet gleichzeitig eine Chronik der ihr angeschlossenen Gremien, also auch die des Fördervereins. Im Jahre 1971 wurde von dem heutigem Schulleiter, Herrn Löw, und dem ehemaligem Lehrer der Schule, Herrn Dr. Haaß, erstmalig der Gedanke an die Gründung eines Fördervereins vorgetragen. Nach einigen Schwierigkeiten kam es dann am 04. Mai 1972 zur Satzungserrichtung und somit zur Gründung des Vereins. Seit dieser Zeit versucht die Gesellschaft mit Hilfe ihrer Mitglieder, der Schule und den Schülern durch ideelle und finanzielle Hilfe beizustehen. Unter 136 dem ersten Vorsitzenden, Herrn Dr. Rensinghoff, konnten bereits im Jahr der Gründung 158 Mitglieder geworben werden. Diese Zahl stieg in den Folgejahren stetig an und erreichte im Jahre 1979 ihren Höchststand mit fast 700 Mitgliedern. Dies war vor allem der unermüdlichen Tätigkeit des damaligen Schulpflegschaftsvorsitzenden und Mitglied des Vorstands des Vereins, Herrn von Egidy, zu verdanken. Nicht zu vergessen sind hier auch Frau Spix, die dem Gründungsvorsitzenden folgte, und die Schatzmeister dieser Zeit, Herr Schulze-Westrick und Frau Müller.
138 Nach diesem Höhepunkt ging es in den Folgejahren - begründet auch durch fallende Schülerzahlen -wieder bergab. Trotz der Bemühungen der aktiven Mitglieder fiel der Mitgliederbestand im Jahre 1986 auf nur noch 385. Dieser Negativtrend konnte in den letzen Jahren gebremst werden. Nunmehr unterstützen wieder rund 525 Mitglieder die Arbeit des Vorstands. In den vergangenen 26 Jahren wurden durch Spenden und Mitgliedsbeiträge über ,- DM für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke aufgebracht. Durch die Unterstützung des Schüleraustauschs, der Bezuschussung von Klassenfahrten, der Unterstützung bedürftiger Schüler und der Anschaffung von z. B. Computern, Videokameras und -recorder, Tischtennisplatten, Musikinstrumenten und weiteren Unterrichtsmaterialien hat auch der Förderverein die Schule in vielen Bereichen geprägt. Eine Aufzählung aller Anschaffungen und Unterstützungen würde hier den Rahmen sprengen. Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch der Beitrag zum Auf- und Ausbau der Bibliothek. Dafür werden unter anderem jährlich rund 2000,- DM für weitere Buchanschaffungen zur Verfügung gestellt. Damit hat sich der Förderverein zu einem wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil der Schule entwickelt. Dieser Prozeß war jedoch nur durch die aktive und beharrliche Arbeit der jeweiligen Vorstands- und Beiratsmitglieder möglich. Stellvertretend für alle Beteiligten sollen an dieser Stelle - neben den bereits Erwähnten - die weiteren Vorsitzenden und die Schatzmeister genannt werden. Dies waren als weitere Vorsitzende Frau Baulig, Herr Niederjohann, Frau Rohwer und derzeit Herr Bierwirth-von Grünberg. Für die finanzielle Abwicklung trugen und tragen Frau Peters, Frau Zöll, Frau Schmitz und augenblicklich Frau Arand die Verantwortung. Zusätzlich zu den gewährten finanziellen Hilfen wird alljährlich der Dr. Walter Haaß Preis verliehen, der vom bereits erwähnten Mitbegründer der Gesellschaft, Herrn Dr. Haaß, gestiftet wurde. Nach seinem Willen sollen Abiturienten ausgezeichnet werden, die sich vor allem im musikalischen Bereich über das normale Maß hinaus für die Schule eingesetzt haben. So wurden z.b. im Jahr 1996 Natsuho Hayauchi, Sahra Schäfer und Yonga Liebertz für ihr musikalisches Können und der Mitwirkung an Austellungseröffnungen und klassischen Konzerten ausgezeichnet. Mit dem letztjährigen Preis wurden Ulf Gronen, Oliver Henes, Oliver Hillen und Steffen Sauder geehrt. Sie zeigten als Mitglieder der Band "Estonia Fantasies" ihr beachtliches musikalisches und technisches Können bei zwei Schülerkonzerten, dem ersten Rockkonzert der Schule und bereicherten mit ihren schwungvollen Samba-Rhythmen die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Lise-Meitner-Gymnasiums e. V. Leverkusen Konto bei der Stadtsparkasse Leverkusen Konto-Nr , BLZ Jubiläumsfeier des Vereins. Abschließend läßt sich sagen, daß die Freunde und Förderer in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Schülerverwaltung und der Schulpflegschaft versuchen, die schulischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dies konnte und kann jedoch nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgen. Um die immer größer werden Anforderungen im - von allen - gewünschten Rahmen erfüllen zu können, benötigt der Verein auch weiterin die Unterstützung durch Eltern, Schüler und Lehrerschaft. Klaus-D. Bierwirth-v. Grünberg 137
139 138
140 139 Das Fest zum 75jährigen Jubiläum
141 140
142 Der Festakt Am Freitag, dem 19. Juni 1998 fand der offizielle Festakt zum 75jährigen Bestehen im Forum der Stadt Leverkusen statt. Ehemalige und aktive Schülerschaft zeigten ein gemeinsames Festprogramm auf der Bühne. 141
143 142
144 143
145 144 Die Hauptredner waren: Frau Ursula Nowak, Leiterin der Pädagogischen Abteilung der Bezirksregierung Köln, Herr Stadtdirektor Dr. Schulze-Olden, Herr Oberstudiendirektor Gerhard Löw
146 Der Chor Time to Wonder 145 Das Musical Saturday Night von The Heather Brothers wird im großen Saal des Forums vom Literaturkurs aufgeführt.
147 Theater an der Lise-Meitner-Schule: Die Geschichte der "Bühne Lise von Hildegard Hombach-Voßen Es begann vor fast 20 Jahren. Damals führte eine Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Irmfried Windmann das Theaterstück "Leonce und Lena" von Büchner, ergänzt mit Musik von Ernst Malangré erfolgreich auf. Leider blieb dies ein Einzelwerk - bis - ja, eine große Neuerung in der Schullaufbahn der Schüler/innen eintrat: Ab 1983 wurden - verpflichtend in der Oberstufe als künstlerisches Fach alternierend zu Musik und Kunst - Literaturkurse eingerichtet, in denen die Kreativität, sprich eigenes Tun und Gestalten im schöpferischen Sinne im Vordergrund stand. Das führte zu verstärkter Theaterarbeit, denn die Schüler/innen hatten schnell erkannt, wo ihr Interesse lag: Spielen - Schauspielen - auf der Bühne stehen. Nach den ersten beiden Jahren mit zum Teil drei Parallelkursen unter den Leitungen von Thomas Knechtges, Gerd Nurtsch und Hildegard Hombach- Voßen mit Werken von Dürrenmatt und Frisch übernahm Herr Nurtsch die laufenden Bühnenproduktionen: So wurde von Shakespeare bis Strindberg, Brecht oder Horvath alles Interessante 146
148 herangezogen, um die Zuschauer in die verschiedensten Welten zu entführen. Alle diese Stücke wurden auch im Rahmen des Schüler-Theater-Festivals in Leverkusen aufgeführt. Damit waren die ersten Jahre intensiver Theaterarbeit schnell verflogen. Ab den 90er Jahren verwandelte sich die Theaterbühne in ein Mehrspartentheater. Es wurde mit Musik gearbeitet, d. h. Musicals produziert: "Linie 1!" von Ludwig/Heymann im Jahre 1993, das auch vor vollbesetztem Haus im Forum im Rahmen des Schüler-Theater-Festivals aufgeführt wurde, oder "Der kleine Horrorladen" von Asham/Menken, 1996 das sowohl im Programm des "1. Internationalen Schülertheaterfestival Schauforum" stand, als auch die Spielzeit 1996/97 im Bayer Erholungshaus eröffnete und zuletzt, im Festjahr 1998 "Endlich Samstag Nacht" (A Slice of Saturday Night) von The Heather Brothers. Ausserdem brachte in diesem Jahr noch eine Theater AG der Stufe 13 eine Boulevardkomödie "Ausser Kontrolle" von Ray Cooney auf die Bühne, die im Juni in der Kölner Schultheaterwoche ebenfalls aufgeführt wurde. In den Jahren dazwischen gab es Theaterstücke von Wilder bis Brecht, aber auch Schillers "Die Räuber", ergänzt um eine Ausstellung zu dem Dichter und seinem Werk in der Galerie Lise, sowie eine Eigenproduktion. Im letzten Jahr gab es erstmals eine andere Form des Theaters: Einen Kabarett- Abend unter der Leitung von Gaby Odendahl. Das 1996 durchgeführte "1. Internationale Schülertheaterfestival Schauforum", an der unsere Schule einen massgeblichen Anteil hatte, entstand durch eine intensive Zusammenarbeit mit einem australischen Literaturprofessor, Dr. Mehigan, der die Idee in einem Fortbildungsseminar des Goethe-Institutes entwarf. In Verbindung mit dem Goethe-Institut, dem Auswärtigen Amt und dem Kulturamt der Stadt Leverkusen und unter der Mitarbeit verschiedener Theaterlehrer Leverkusener Schulen konnte das Festival durchgeführt werden und zwar mit erheblicher positiver Resonanz. Neben der Arbeit in der Stufe 12 kamen auch die Schüler/innen der Klassenstufen 5-7 nicht zu kurz. Hier gab und gibt es die Musiktheater AG, die kleinere Musicals auf die Bühne brachte wie z. B. "Mahlzeit" von Mechthild von Schoenebeck u. a. Nachdem wir nun auch einen Namen haben, "Bühne Lise", können wir den nächsten Jahren gelassen entgegen sehen - sicherlich werden sich die beiden Sparten des Sprechtheaters und des Musicals mehr und mehr etablieren. 147
149 148 Leverkusener Anzeiger vom 20./21. Juni 1998
150 Was bleibt Kerstin Müller, Abiturjahrgang Sie hat ihre personale Kompetenz schon während ihrer Schulzeit auf sozialen und politischen Lernfeldern entwickelt, indem sie u. a. innerhalb der SV wichtige Funktionen übernommen hat. Ihr Jura-Studium sowie auch ihre juristische Referendarzeit absolvierte sie in Köln war Kerstin Müller Sprecherin der Grünen in Nordrhein-Westfalen, bis sie 1994 in den Bundestag einzog, wo sie seitdem in Arbeitsteilung mit Joschka Fischer Fraktionssprecherin der Bündnis 90/Die Grünen ist. Wir drucken nachfolgend das Manuskript ihrer Rede zum Festakt, die sie wegen dringender Anwesenheit im Bundestag nicht halten konnte. Rede zur Feierstunde des Lise-Meitner- Gymnasiums, Ich freue mich sehr, wieder einmal hier in meiner alten Schule zu sein, und freue mich besonders, dass ich trotz der wichtigen Debatte im Plenum doch noch rechtzeitig vor Schluß der Feierstunde kommen konnte. Mir hat es viel Spaß gemacht, aus Anlaß dieses Jubiläums noch einmal über meine Schulzeit nachzudenken und über die Folgen, die diese Zeit danach hatte. Die Schule war damals schon reformfreudig. Es gab eine Stimmung des Aufbruchs. Es gab natürlich auch viel Abneigung und Widerstand dagegen, viele berechtigte und unberechtigte Bedenken, aber - Hartnäckigkeit führt zum Ziel, wir haben uns durchgesetzt: Zum Beispiel was die Durchführung von Projektwochen an der Schule betrifft. Zu meiner Zeit, 1981, haben wir die allererste Projektwoche durchgesetzt. Das war gar nicht einfach! Horst Thelen und ich haben damals den Antrag an die Schulkonferenz unterschrieben. Sie hatte das vielversprechende Rahmenthema: "Was wir wirklich brauchen, und was wir dafür tun können." und war damals schon abgestellt auf die Verbindung von Theorie und Praxis von Schule und Gesellschaft. Und genau das fand ich so spannend: Die Öffnung der Schule, weg vom Elfenbeinturm, in dem traditionelles Wissen vermittelt wird, hin zur Gesellschaft, Schule, in der aktuelle Entwicklungen und Themen aufgegriffen werden, in der vor allem neue Lehr- und Lernmethoden erprobt werden. Die Wissensvermittlung ist und bleibt zwar als Aufgabe der Schule unverzichtbar. Ohne einen sicheren Grundstock an Wissen und Kenntnissen kann 149
151 man nicht agieren. Ich sehe z. B. mit Freude den Vorschlag, in der Differenzierung in Stufe 9 und 10 verbindlich einen Informatik- und Internet-Grundkurs vorzuschalten. Ohne solches Grundwissen geht es wohl nicht. Aber ganz ehrlich: Die allermeisten Fakten aus meiner Schulzeit habe ich längst vergessen, und ich tippe mal, den meisten Ehemaligen und Eltern hier im Raum geht es ebenso. Das, was bleibt, was man immer wieder braucht, und zwar in praktisch jeder Lebenslage, das sind die erworbenen Fähigkeiten: Rascher Zugriff auf neue Inhalte, flexible Arbeitstechniken und Kreativität und vor allem: Teamfähigkeit - Konsense zu suchen und zu finden und genauso Konflikte auszutragen und durchzustehen, bis vernünftige Ergebnisse vorliegen. Was bleibt, sind die Grundeinstellungen: Die Verantwortung begreifen, die wir füreinander und für unsere Zukunft haben, soziale Solidarität im eigenen Land wie im Nord-Süd Verhältnis statt Ellbogengesellschaft, schonenden Umgang mit der Natur statt Wegwerfmentalität, aktives Eintreten für die Achtung der Menschenrechte statt bedenkenloses Jagen nach wirtschaftlichem Vorteil: all das als unverzichtbare Werte wahrzunehmen. Und vor allen Dingen: Vielfalt, Veränderung, Neues und Fremdes nicht als Bedrohung zu empfinden, sondern Spaß daran zu haben, sich auseinanderzusetzen und Dinge voranzubringen. Solche Fähigkeiten, solche Einstellungen kann man Kerstin Müller in der Stufe 12 in der Schule erwerben, - wenn sie die Möglichkeit dazu bietet. Ich spreche da aus Erfahrung. Und ich finde es großartig, dass die Lise-Meitner- Schule auf diesem Weg seit meiner Zeit mit großen Schritten vorangegangen ist. Die bildungspolitische Debatte ist in den letzten Monaten heftig wieder aufgelebt. Das hat mit dem Wahlkampf zu tun, aber nicht nur damit. Das Tempo von Innovation hat in jeder Hinsicht enorm zugenommen. Leider suchen viele Debattenbeiträge gerade aus der Politik die Antwort auf die Veränderungen gerade nicht in neuen Lösungen, in der Weiterentwicklung und im Experiment, sondern in der Rückbesinnung auf die Vergangenheit, in der vermeintlich manches besser war. Ich kann das verstehen, denn in dieser Gesellschaft ist gerade in den letzten Jahren so vieles erstarrt, in dieser Zeit der Kanzlerdämmerung, des Verfalls einer seit 15 Jahren so schier unerschütterlich im Sattel sitzenden Regierungsmehrheit. Wir haben in Bonn das Gefühl, über dem Land liegt eine Art Mehltau, unter dem sich nur sehr mühsam etwas regt. Da hat Sehnsucht nach dem Guten Alten natürlich einen gewissen Boden, nur - vernünftig ist das nicht. Denn Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, die liegen nicht in der Vergangenheit, die müssen wir schon selber finden. Diese Grundeinstellung, sich immer wieder zur Gesellschaft hin zu öffnen, selbst nach Lösungen zu suchen, nach vorne zu denken, Erfahrungen gründlich zu verarbeiten und zugleich Neues zu probieren - die vermittelt die Lise-Meitner-Schule heute in ihrer ganzen Außendarstellung, auch in ihrem ergiebigen und spannenden Internetangebot, mit öffentlichkeitswirksamen Projekten, wie z. B. der Galerie und der Einen-Welt-Arbeit. Auf der Einladung zur heutigen Jubiläumsfeier gibt sich diese Schule einen bemerkenswerten Titel: Lise-Meitner-Gymnasium - eine reformfreudige Schule. Das ist ein mutiger Anspruch und das ist, finde ich, ein goldrichtiger Anspruch! Eine reformfreudige Schule, reformfreudige Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, die das unterstützen und tragen und Ehemalige, die genauso an ihrem Platz reformfreudig weiterwirken - das brauchen wir heute und in Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich der Lise-Meitner-Schule viel Erfolg für die nächsten 75 Jahre! 150
152 Eine Bildcollage zum Fest vom 20. Juni
153 152
154 Ergebnisse der Projektwoche Eine Präsentation einzelner Projekte als Übersicht. Die Texte wurden der in der Projektwoche von Schülern erstellten Zeitung Projektwochenpostille entnommen. Das Niedrigenergiehaus Niedrigenergiehaus ist das Projekt der zehnten Klasse, das eigentlich als Thema für den Unterricht gedacht war. Doch die Schüler fanden es so interessant, dass sie es als Projekt verfasst haben. U.a. benötigen sie dafür einen selbstgebauten Hohlspiegel, der aus Blech besteht. Mit diesem schüsselartigen Gegenstand werden die Projektmitglieder, sobald die Sonne scheint, Tee kochen. Ein anderer Gegenstand ist die Solarwasseranlage, womit man Wasser gewinnt, ohne Energie zu verbrauchen. 153
155 Kanga -Modenschau Traditionelles Kleidungsstück aus Tansania Lehrersteckbriefe Das Projektthema der Klasse 9a lautete Lehrercharakteristiken. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler Fragebögen an die Lehrer verteilt, welche sie mit Hilfe von Herrn Zander, dem Projektleiter erstellt haben. 154
156 Trakt 4 wird bunt Für die Verschönerung des Traktes 4 sorgten Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse unter der Leitung von Frau Fischer. Das Schulbiotop Unter der Leitung von Herrn Feldmar kümmert sich ein Teil der Klasse 7c um die Pflege des Biotops, indem sie den Schulteich entmüllten und entgrünten, die Wiese mähten, die Wege frei und die Bäume zurecht schnitten. Der Sinn des Biotops ist es, dass das Biotop für Schulzwecke, wie den Biologieunterricht genutzt werden kann. 155
157 Streitschlichtung Dieses Projekt wird in vielen Klassen bearbeitet. Es geht darum, Konflikte friedlich zu lösen. Dies wird den Schülern durch Spiele beigebracht. Die Stimmung in den verschieden Klassen war gut und man erfuhr viel über die Persönlichkeit der Leute. Sogar die Lehrer gestanden ihre Fehler und wurden von den Schülern nicht ausgebuht. Lise Meitner im Portrait Die Projektteilnehmer hatten sich vorgenommen, Lise Meitner, so wie sie in Büchern oder auf Bildern dargestellt ist, künstlerisch verfremdet abzumalen. Die Bilder wurden im Treppengang der Schule ausgestellt. 156
158 Das Lise - Mobil Ein ursprünglich grüner VW-Golf wurde mit den Umrissen der Länder unserer Partnerschulen bemalt. Diese Umrisse sind der Landesflagge entsprechend gemalt. Der Wagen wurde mit Ölfarben, Hochglanzlack und Farbblättern gestaltet. Die Gestaltung des Nebengebäudes (Trakt 5) 157
159 158 Programm zur Projektpräsentation
160 159
161 Das Bildgeschenk Roland Kohlhaas, Profilstück - Rahmenstück, Aquatinta-Radierung, 1988 Ein Geschenk unseres ehemaligen Schülers zum 75-jährigen Jubiläum. Der Künstler beschäftigt sich auf seine Weise mit Grenzsetzungen, Rahmenbedingungen. Ein Thema, das für die Institution Schule in ihrer inneren Struktur wie ihrer Einbettung in die soziale und politische Umwelt vielfältige Bezüge aufweist. 160
162 Internet Reaktionen 161
163 162
164 163 Personalia
165 164
166 165
167 166
168 167
169 168
170 169 Der Abiturjahrgang im Jubiläumsjahr 1998
171 Das Kollegium im Jubiläumsjahr 1998 Lehrkräfte: Bartmann-Brackmann, Dorothea Baukloh, Peter Bramhoff, Michael Breick, Karl-Heinz Bundschuh-Heß, Ursula Dicke, Rolf Döllscher, Hans Jürgen Duisberg, Wolfgang Eder, Uta Elsen, Rudolf Feldmar, Dr. Siegfried Fischer, Renate Gauchel, Knut Geylenberg, Klaus Gronewald, Anne Halfenberg, Kurt Herzog, Birgit Hilgert, Christiane Hohmann, Reinhild Hombach-Voßen, Hildegard Jansen, Marcelo Keller, Dieter Kluge, Ingrid Knechtges, Thomas Knöfel, Ute König, Josef Kohlhaas-Müller, Ute Krämer, Otto Krause, Birgit Kuckelberg, Margarete Lehmann-Greif, Dr. Martin Lichius-Quitter, Franziska Löppenberg-Dressler, Ferno Löw, Gerhard Lussi, Annette Maasfeld, Mechthild Madelung, Petra Mayer, Ingrid Mayer-Augustin, Cornelie Mehne, Edda Meis, Ulrike Müller, Bernd Nestler, Ursula Nordt, Karola Odendahl, Gaby Ostermann, Bernhard Palm-Coenen, Monika Radermacher, Heinz Rösgen, Sigrid Roszak, Rudolf Sackser, Dietfried Schäfer, Marlies Schindlmayr, Dr. Norbert Schwenke, Gerhard Scuffil, Antje Selbach, Hans-Ludwig Songhet, Regine Thelen, Horst Thul, Stefan Titz, Sonja Tweer, Gisela Uerdingen, Mireille Unkelbach, Thomas Vollmeyer-Helm, Ingrid Vorst, Dorothea Westhäuser, Angelika Willenberg-Köhler, Doris Whittaker, Martin Yücel, Maria Zander, Werner Zierold, Christian Referendare und Referendarinnen Berghoff, Ina Buss, Andrea Colberg, Carsten Ehrhard, Andreas Evert, Silja Hufschmidt, Ute Kaschek, Kathrin Knüver, Dorothe Krautz, Joachim Mayer, Thomas Johannes Neugaertner, Peter Nonnemann, Anna Margarete Püttmann-Brück, Melanie Schacht, Sonia Weber, Beate Wichmann, Kirsten 170
172 Das Verwaltungsteam Das sind die wichtigen Mitglieder unseres Verwaltungsteams, die Damen des Sekretariats und unsere Hausmeister. Ohne sie könnte unsere Schule wohl kaum so funktionieren. Margit Nagelschmidt Marie Luise Thoms Roswitha Welbers Uwe Schirmacher Arno Herbst 171
173 Dr. Alfred Goertz - Stellvertretender Schulleiter an der Lise-Meitner-Schule 1989 Zum Tod von Dr. Alfred Goertz "Trauer"-Meditation über einen philosophischen Begriff angesichts des Todes eines Freundes von J. König Ein Freund ist tot; der stellvertretende Schulleiter, der Kollege, der Lehrer und Ratgeber lebt nicht mehr. Die Betroffenheit bei Kollegen und Schülern äußerte sich in versteinerter Mimik bis zu verstohlenen und offenen Tränen... Geht man über die Phänomenologie des Trauererlebens hinaus, so zeigt sich außer der gefühlsbetonten Reaktion ein Reflexionsprozeß: Der Verlust der betrauerten Person erschüttert die Orientierung des Selbst in und an der gewohnten Welt und sozialen Umwelt, führt zum Aufbrechen vertrauter, gegebenenfalls auch religiöser Sinnerfahrung und handlungsleitender Orientierungsmuster, das heißt je größer der Verlust, desto intensiver die persönliche Orientierungskrise. Diese Krise kann wohl nur ganz allmählich und unter Mitwirkung äußerer Partner überwunden werden. In der Tat scheint nicht die Trauer "den Trauernden einziger Trost" zu sein, sondern gerade die aktive Tätigkeit in der Gemeinschaft dürfte wirksam und sinnvoll sein, insofern sich im Handeln der Lebenssinn neu bildet. Handlung lenkt naturgemäß von allzu starker Selbstbezüglichkeit, Selbstmitleid ab, kann hilfreich sein, die Gefahr der Schwermut und bleibenden Depressionen zu überwinden. Insofern ist "Trauerarbeit" nicht als Melancholie, das heißt als ein Trauern um ein verlorenes Gut für den Trauernden selbst, angebracht, sondern als wissendes und sühnendes In-Sich- Gehen... Alfred Goertz ist tot - sein Fehlen wird uns tagtäglich immer neu bewußt. Allerdings wäre er der Letzte, der uns im Hinblick auf seinen Tod auf eine Derealisierung der Außenwelt verwiesen hätte. Demnach liegt es an uns, den äußerst zugespitzten Verunsicherungsprozeß in aktiv-kreativer Selbstreflexion und neuer Sinngebung insbesondere durch andere Bezugspartner allmählich zu überwinden. Und schließlich ist in christlicher Hoffnungsperspektive die Mahnung des Apostels Paulus vor der Trauer im Sinne einer regressiven Schwermut ernstzunehmen: "Wir wollen auch nicht in Unkenntnis lassen über die Toten, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben" (1. Thess 4,13) (Schulbrief Nr.4 Februar 1989 S. 6/7, Auszüge) 172
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Es gilt das gesprochene Wort.
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
175 Jahre Gymnasium Schramberg Schulfest am Samstag, 25. Juli 2015 um Uhr auf dem Schulhof des Gymnasiums Grußwort OB
 175 Jahre Gymnasium Schramberg Schulfest am Samstag, 25. Juli 2015 um 11.00 Uhr auf dem Schulhof des Gymnasiums Grußwort OB Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist bis zu Beginn der Veranstaltung Sehr
175 Jahre Gymnasium Schramberg Schulfest am Samstag, 25. Juli 2015 um 11.00 Uhr auf dem Schulhof des Gymnasiums Grußwort OB Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist bis zu Beginn der Veranstaltung Sehr
Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW
 Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Seite 0 Faire Perspektiven für die europäische Jugend sichern den sozialen Frieden in Europa Herausforderung auch für das DFJW Rede Bundesministerin Dr. Kristina Schröder anlässlich der Eröffnung des Festaktes
Extra-Newsletter 2012 der Maria-Ward-Schule Aschaffenburg. Extrablatt
 Maria - Ward - Schule Mädchengymnasium der Maria-Ward-Stiftung, Aschaffenburg Mädchenrealschule der Maria-Ward-Stiftung, Aschaffenburg Brentanoplatz 8-10 63739 Aschaffenburg Telefon: 06021/3136-14 Fax
Maria - Ward - Schule Mädchengymnasium der Maria-Ward-Stiftung, Aschaffenburg Mädchenrealschule der Maria-Ward-Stiftung, Aschaffenburg Brentanoplatz 8-10 63739 Aschaffenburg Telefon: 06021/3136-14 Fax
10,5. Europäische Schulen. Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen
 10,5 Europäische Schulen Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen 7 13 Europäische Schulen in sechs Ländern Die Europäischen Schulen wurden gegründet, um die Kinder der Beschäftigten in den europäischen
10,5 Europäische Schulen Vielfalt der Kulturen, Traditionen und Sprachen 7 13 Europäische Schulen in sechs Ländern Die Europäischen Schulen wurden gegründet, um die Kinder der Beschäftigten in den europäischen
Krieger des Lichts. Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola
 Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
Амелия Хайруллова (Amelia Khairullova) 8. Klasse Samarskaja Waldorfskaja Schkola Krieger des Lichts Prolog Höre mich, Mensch. Was machst du mit der Erde? Wenn du dich darum nicht kümmerst, Wird alles bald
125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel
 Rede Oberbürgermeister Anlässlich 125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel am 24.05.2013, 18:00 Uhr, Casino Uerdingen - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 11 Sehr geehrter Herr Dr. Labunski, sehr geehrte Damen
Rede Oberbürgermeister Anlässlich 125 Jahre KV-Ortszirkel Sprudel am 24.05.2013, 18:00 Uhr, Casino Uerdingen - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 11 Sehr geehrter Herr Dr. Labunski, sehr geehrte Damen
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT
 MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT LATEIN UND GRIECHISCH IN BADEN-WÜRTTEMBERG Eine aktuelle Information des Kultusministeriums über das Schuljahr 2008/2009 Das Kultusministerium informiert jährlich
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT LATEIN UND GRIECHISCH IN BADEN-WÜRTTEMBERG Eine aktuelle Information des Kultusministeriums über das Schuljahr 2008/2009 Das Kultusministerium informiert jährlich
Vorab-Übersetzung des Textes
 Grußwort S.K.H. des Kronprinzen von Japan anlässlich des Abendessens, gegeben von S. E. Herrn Christian Wulff, Präsident der Bundesrepublik Deutschland, und Frau Bettina Wulff im Schloss Bellevue am 22.
Grußwort S.K.H. des Kronprinzen von Japan anlässlich des Abendessens, gegeben von S. E. Herrn Christian Wulff, Präsident der Bundesrepublik Deutschland, und Frau Bettina Wulff im Schloss Bellevue am 22.
Leitungswechsel zum Schuljahr 2007/2008. St. Raphael-Schulen/Gymnasium Heidelberg. OStD Dr. Franz Kuhn und OStD Ulrich Amann
 Mit Erreichen der Altersgrenze trat OStD Dr. Franz Kuhn nach mehr als 25 Jahren in der Verantwortung als Schulleiter des Gymnasiums der St. Raphael-Schulen Heidelberg in den Ruhestand. 1942 in Heidelberg
Mit Erreichen der Altersgrenze trat OStD Dr. Franz Kuhn nach mehr als 25 Jahren in der Verantwortung als Schulleiter des Gymnasiums der St. Raphael-Schulen Heidelberg in den Ruhestand. 1942 in Heidelberg
- 1. Rede von Landrat Michael Makiolla anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Lippe Berufskollegs in Lünen am
 - 1 Rede von Landrat Michael Makiolla anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Lippe Berufskollegs in Lünen am 18.09.2009 Sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrter Herr Bürgermeister Stodollick, sehr geehrte
- 1 Rede von Landrat Michael Makiolla anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Lippe Berufskollegs in Lünen am 18.09.2009 Sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrter Herr Bürgermeister Stodollick, sehr geehrte
Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck.
 Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
Einleitung Meine Tante wird am 7. März 1940 ermordet. Sie heißt Anna Lehnkering und ist 24 Jahre alt. Anna wird vergast. In der Tötungs-Anstalt Grafeneck. Anna ist ein liebes und ruhiges Mädchen. Aber
Emma Graf. 1 Emma Graf, Vorwort, in Jahrbuch der Schweizerfrauen 1915, S. 3.
 1 Emma Graf Emma Graf wurde am 11. Oktober 1865 geboren. Mit ihren acht Geschwistern wuchs sie als Tochter des Geschäftsführers der Eisenhandlung Geiser&CIE in Langenthal auf. Nach der Schulzeit und einem
1 Emma Graf Emma Graf wurde am 11. Oktober 1865 geboren. Mit ihren acht Geschwistern wuchs sie als Tochter des Geschäftsführers der Eisenhandlung Geiser&CIE in Langenthal auf. Nach der Schulzeit und einem
Grußwort. der Ministerin für Schule und Weiterbildung. des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Grußwort Namensgebungsfeier der Städtischen Gesamtschule in Alexander- Coppel-Gesamtschule in Solingen
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Grußwort Namensgebungsfeier der Städtischen Gesamtschule in Alexander- Coppel-Gesamtschule in Solingen
1911 ist das Jahr, in dem der Reichstag die Reichsversicherungsordnung verabschiedete, die als Vorläufer des Sozialgesetzbuches die Grundlage für den
 1911 ist das Jahr, in dem der Reichstag die Reichsversicherungsordnung verabschiedete, die als Vorläufer des Sozialgesetzbuches die Grundlage für den Sozialstaat in Deutschland legte. Auf Initiative von
1911 ist das Jahr, in dem der Reichstag die Reichsversicherungsordnung verabschiedete, die als Vorläufer des Sozialgesetzbuches die Grundlage für den Sozialstaat in Deutschland legte. Auf Initiative von
INHALTSVERZEICHNIS. Die wichtigsten organisatorischen Veränderungen im allgemeinbildenden Schulwesen im historischen Überbjick 25
 INHALTSVERZEICHNIS Die österreichische Schule der Gegenwart 1. Das Schulorganisationsgesetz 1962 1 2. Die bisherigen Schulorganisationsgesetz-Novellen 3 3. Die Bildungsaufgabe der österreichischen Schule
INHALTSVERZEICHNIS Die österreichische Schule der Gegenwart 1. Das Schulorganisationsgesetz 1962 1 2. Die bisherigen Schulorganisationsgesetz-Novellen 3 3. Die Bildungsaufgabe der österreichischen Schule
ich darf Sie zur Feier der Verabschiedung von Frau Sonnenberger ganz herzlich begrüßen.
 Verabschiedung Frau Sonnenberger am 31.01.2018 - Es gilt das gesprochene Wort - Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zur Feier der Verabschiedung von Frau Sonnenberger ganz herzlich begrüßen. Liebe
Verabschiedung Frau Sonnenberger am 31.01.2018 - Es gilt das gesprochene Wort - Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zur Feier der Verabschiedung von Frau Sonnenberger ganz herzlich begrüßen. Liebe
60 Jahre Kita Verberger Straße
 Rede Oberbürgermeister Anlässlich des Jubiläumsfestes 60 Jahre Städtische Kindertageseinrichtung Verberger Straße am 13.07.2013, 11:00 Uhr, Verberger Straße 23 - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 10
Rede Oberbürgermeister Anlässlich des Jubiläumsfestes 60 Jahre Städtische Kindertageseinrichtung Verberger Straße am 13.07.2013, 11:00 Uhr, Verberger Straße 23 - das gesprochene Wort gilt Seite 1 von 10
Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig
 90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
90. Geburtstag Dr. Werner Ludwig Seite 1 von 6 Rede von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse anlässlich des Empfangs zum 90. Geburtstag von Alt-OB und Ehrenbürger Dr. Werner Ludwig, im Pfalzbau. Es gilt das
Rede zum Volkstrauertag Dieter Thoms
 Rede zum Volkstrauertag 18.11.2018 Dieter Thoms Sehr geehrte Anwesende, wir gedenken am heutigen Volkstrauertag den Opfern der Kriege und erinnern an das Leid der Bevölkerung. Dieses Jahr bietet die Gelegenheit
Rede zum Volkstrauertag 18.11.2018 Dieter Thoms Sehr geehrte Anwesende, wir gedenken am heutigen Volkstrauertag den Opfern der Kriege und erinnern an das Leid der Bevölkerung. Dieses Jahr bietet die Gelegenheit
Kirchentag Barrierefrei
 Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
Kirchentag Barrierefrei Leichte Sprache Das ist der Kirchen-Tag Seite 1 Inhalt Lieber Leser, liebe Leserin! Seite 3 Was ist der Kirchen-Tag? Seite 4 Was gibt es beim Kirchen-Tag? Seite 5 Was ist beim Kirchen-Tag
Sonder-Heft. Infos über die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Lieber Leser und liebe Leserin! Heute bekommen Sie ein neues Heft.
 Seite 1 M e n s c h z u e r s t N e t z w e r k P e o p l e F i r s t D e u t s c h l a n d e. V. Sonder-Heft Infos über die Stiftung Anerkennung und Hilfe Lieber Leser und liebe Leserin! Heute bekommen
Seite 1 M e n s c h z u e r s t N e t z w e r k P e o p l e F i r s t D e u t s c h l a n d e. V. Sonder-Heft Infos über die Stiftung Anerkennung und Hilfe Lieber Leser und liebe Leserin! Heute bekommen
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
über das Maß der Pflicht hinaus die Kräfte dem Vaterland zu widmen.
 Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
Sperrfrist: 16. November 2014, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der
I. Begrüßung das humanistische Bildungsideal
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 18.06.2012, 11:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Siegerehrung des Landeswettbewerbs
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 18.06.2012, 11:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Siegerehrung des Landeswettbewerbs
I. Erfolg hat eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Anrede
 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 15.11.2011, 13:00 Uhr - Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung des
- Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 15.11.2011, 13:00 Uhr - Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung des
I. Kultureller Austausch zwischen Bayern und Frankreich in der Vergangenheit Begrüßung
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.05.2011, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des bayerisch-französischen Festkonzerts
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.05.2011, 19:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des bayerisch-französischen Festkonzerts
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen Die Einführungsphase der Profiloberstufe (Klassenstufe 10) ALLGEMEINE HINWEISE ZUR GYMNASIALEN OBERSTUFE Ziele der gymnasialen Oberstufe Die Profiloberstufe des Gymnasiums
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen Die Einführungsphase der Profiloberstufe (Klassenstufe 10) ALLGEMEINE HINWEISE ZUR GYMNASIALEN OBERSTUFE Ziele der gymnasialen Oberstufe Die Profiloberstufe des Gymnasiums
Das neunjährige Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13 und führt zum Abitur (allgemeine Hochschulreife)
 Das neunjährige Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13 und führt zum Abitur (allgemeine Hochschulreife) Nach der 10.Klasse wird der mittlere Bildungsabschluss (Oberstufenreife) erreicht. Es vermittelt
Das neunjährige Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 13 und führt zum Abitur (allgemeine Hochschulreife) Nach der 10.Klasse wird der mittlere Bildungsabschluss (Oberstufenreife) erreicht. Es vermittelt
Grußwort. Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal
 Grußwort Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Voigtsberger! Lieber
Grußwort Parlamentarischer Abend der NRW-Stiftung Dienstag, 13. September 2016, 18 Uhr Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenarsaal Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrter Herr Präsident Voigtsberger! Lieber
Copyright: Julia Gilfert 2017
 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Gedenkgottesdienst für die Opfer der NS- Euthanasie in der Hephata-Diakonie Schwalmstadt-Treysa am Buß- und Bettag 2017 Redebeitrag in Leichter Sprache von
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Gedenkgottesdienst für die Opfer der NS- Euthanasie in der Hephata-Diakonie Schwalmstadt-Treysa am Buß- und Bettag 2017 Redebeitrag in Leichter Sprache von
Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages
 Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
- Es gilt das gesprochene Wort -
 Rede der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann MdL Bestenehrung 2012 17. September 2012, 19.00 21.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort - Liebe Schülerinnen
Rede der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann MdL Bestenehrung 2012 17. September 2012, 19.00 21.00 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort - Liebe Schülerinnen
Rede. des Herrn Staatsministers. anlässlich der. Überreichung der. Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. an Herrn Willi Lippert
 Der Bayerische Staatsminister der Justiz Prof. Dr. Winfried Bausback Rede des Herrn Staatsministers anlässlich der Überreichung der Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten an Herrn Willi Lippert
Der Bayerische Staatsminister der Justiz Prof. Dr. Winfried Bausback Rede des Herrn Staatsministers anlässlich der Überreichung der Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten an Herrn Willi Lippert
Grußwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB,
 Grußwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Abschlussfeier der Internationalen Mathematikolympiade am 21. Juli 2009 in Bremen Es gilt das gesprochene
Grußwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Abschlussfeier der Internationalen Mathematikolympiade am 21. Juli 2009 in Bremen Es gilt das gesprochene
Junge Leute, die Entscheidung liegt bei euch!
 www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Junge Leute, die Entscheidung liegt bei euch! Ein Beispiel Sie war die freundlichste alte Dame, die man sich vorstellen kann. Verkrüppelt durch schwere Arthritis,
www.biblische-lehre-wm.de Version 8. Juli 2015 Junge Leute, die Entscheidung liegt bei euch! Ein Beispiel Sie war die freundlichste alte Dame, die man sich vorstellen kann. Verkrüppelt durch schwere Arthritis,
Private Hildegardisschule Bingen. Die Mädchenschule in unserer Region
 Private Hildegardisschule Bingen Die Mädchenschule in unserer Region Hildegardisschule Bingen Schule mit Tradition und Zukunft Der Fakten-Check Die Hildegardisschule Bingen ist eine private Mädchenschule
Private Hildegardisschule Bingen Die Mädchenschule in unserer Region Hildegardisschule Bingen Schule mit Tradition und Zukunft Der Fakten-Check Die Hildegardisschule Bingen ist eine private Mädchenschule
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg
 Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau! Sehr geehrte Frau von
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich der Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Herbert von Karajans am 5. April 2008 in Salzburg Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau! Sehr geehrte Frau von
Es gilt das gesprochene Wort!
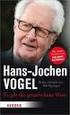 Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
Rede der Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen. beim Feierlichen Gelöbnis
 0 Rede der Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen beim Feierlichen Gelöbnis an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr am 4. August 2017 in Hannover Redezeit: ca. 10
0 Rede der Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen beim Feierlichen Gelöbnis an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr am 4. August 2017 in Hannover Redezeit: ca. 10
Kaufmännische Berufsschule Wetzikon/ Wirtschaftsschule KV Wetzikon 100 Jahr-Jubiläum, 31. August 2007, Wetzikon
 Kaufmännische Berufsschule Wetzikon/ Wirtschaftsschule KV Wetzikon 100 Jahr-Jubiläum, 31. August 2007, Wetzikon Grussbotschaft von Regierungsrätin Regine Aeppli Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident Sehr
Kaufmännische Berufsschule Wetzikon/ Wirtschaftsschule KV Wetzikon 100 Jahr-Jubiläum, 31. August 2007, Wetzikon Grussbotschaft von Regierungsrätin Regine Aeppli Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident Sehr
- 1 - Grußwort. Gabriele Bauer. Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim. Verabschiedung RSDin Vera Nowack. Rosenheim, 27.
 - 1 - Grußwort Gabriele Bauer Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim Verabschiedung RSDin Vera Nowack Rosenheim, 27. Juli 2011 Frei ab Beginn der Rede Es gilt das gesprochene Wort Anrede, wer wissen will,
- 1 - Grußwort Gabriele Bauer Oberbürgermeisterin der Stadt Rosenheim Verabschiedung RSDin Vera Nowack Rosenheim, 27. Juli 2011 Frei ab Beginn der Rede Es gilt das gesprochene Wort Anrede, wer wissen will,
I. Das Schulporträt Begriff und Forschungslage
 Gliederung I. Das Schulporträt Begriff und Forschungslage 1 Einleitung S.1 1.1 Zur Forschungslage und Begriffsdeutung S.3 1.1.1 Schulprogramm und Leitbild S.8 1.1.2 Das Schulporträt S.10 1.2 Fragestellung
Gliederung I. Das Schulporträt Begriff und Forschungslage 1 Einleitung S.1 1.1 Zur Forschungslage und Begriffsdeutung S.3 1.1.1 Schulprogramm und Leitbild S.8 1.1.2 Das Schulporträt S.10 1.2 Fragestellung
Die gymnasiale Oberstufe der IGS Pellenz
 Die gymnasiale Oberstufe der IGS Pellenz 1 Die MSS an der IGS Pellenz Plaidt Die gymnasiale Oberstufe der IGS Pellenz Plaidt ist entsprechend der Rahmenbedingungen der Mainzer Studienstufe (MSS) aufgebaut.
Die gymnasiale Oberstufe der IGS Pellenz 1 Die MSS an der IGS Pellenz Plaidt Die gymnasiale Oberstufe der IGS Pellenz Plaidt ist entsprechend der Rahmenbedingungen der Mainzer Studienstufe (MSS) aufgebaut.
Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule
 Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule Es gilt das gesprochene Wort Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Schulleiter Herr Lück-Lilienbeck,
Rede anlässlich 20 - jährigem Jubiläum der 1. Remscheider Gesamtschule Albert - Einstein - Schule Es gilt das gesprochene Wort Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Schulleiter Herr Lück-Lilienbeck,
Kieler Zarenbriefe. Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes Ausgabe No
 Kieler Zarenbriefe Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes Ausgabe No. 1-2018 Festschrift Zum 10-jährigen Jubiläum des Kieler Zarenvereins Inhaltsverzeichnis: Grußworte des Stadtpräsidenten
Kieler Zarenbriefe Beiträge zur Geschichte und Kultur des Ostseeraumes Ausgabe No. 1-2018 Festschrift Zum 10-jährigen Jubiläum des Kieler Zarenvereins Inhaltsverzeichnis: Grußworte des Stadtpräsidenten
Was muss ich machen? Eine Übersicht über die Fächer in der Qualifikationsphase
 Was muss ich machen? Eine Übersicht über die Fächer in der Qualifikationsphase Dieses Dokument bietet eine Übersicht über alle Fächer und, die in der Qualifikationsphase (Q-Phase) belegt werden können
Was muss ich machen? Eine Übersicht über die Fächer in der Qualifikationsphase Dieses Dokument bietet eine Übersicht über alle Fächer und, die in der Qualifikationsphase (Q-Phase) belegt werden können
Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen
 Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Profiloberstufe ab 2009/10 / Stand Mai 2016
 Terminplan Abitur 2018 1/16: Information Wahlen 3/16: Profilgruppen gebildet 8/17: Wahl der Prüfungsfächer 4/18: schriftliches Abitur 6/18: mündliches Abitur 22.06.2018: Abiturfeier (?) Leitbild Studierfähigkeit
Terminplan Abitur 2018 1/16: Information Wahlen 3/16: Profilgruppen gebildet 8/17: Wahl der Prüfungsfächer 4/18: schriftliches Abitur 6/18: mündliches Abitur 22.06.2018: Abiturfeier (?) Leitbild Studierfähigkeit
Es gilt das gesprochene Wort.
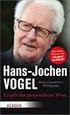 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Michaeli Schule Köln Freie Waldorfschule mit inklusivem
Die Gymnasiale Oberstufe für die Abiturjahrgänge ab 2016
 Die Gymnasiale Oberstufe für die Abiturjahrgänge ab 2016 Organisation, Verpflichtungen und Auflagen Selbstverständlich erfüllt die Oberstufe des ÖG alle staatlichen Auflagen. Dies bedeutet für die Einführungsphase
Die Gymnasiale Oberstufe für die Abiturjahrgänge ab 2016 Organisation, Verpflichtungen und Auflagen Selbstverständlich erfüllt die Oberstufe des ÖG alle staatlichen Auflagen. Dies bedeutet für die Einführungsphase
Abitursrede von 1987 von Lars Baumbusch
 Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Informationen zur Wahl der Kurse in der Qualifikationsphase
 Informationen zur Wahl der Kurse in der Qualifikationsphase Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! Um die Wahlen für die Qualifikationsphase zu erleichtern, sind in dieser Broschüre kurz die Struktur
Informationen zur Wahl der Kurse in der Qualifikationsphase Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! Um die Wahlen für die Qualifikationsphase zu erleichtern, sind in dieser Broschüre kurz die Struktur
Mit Jugendlichen über das Leben und den Glauben reden.
 KATHOLISC HE PRIVAT UNIV ER SITÄT L I NZ Mit Jugendlichen über das Leben und den Glauben reden. Lehramt für Katholische Religion / Sekundarstufe Kombination mit Zweitfach Leitgedanke Religion(en) kennen.
KATHOLISC HE PRIVAT UNIV ER SITÄT L I NZ Mit Jugendlichen über das Leben und den Glauben reden. Lehramt für Katholische Religion / Sekundarstufe Kombination mit Zweitfach Leitgedanke Religion(en) kennen.
Herzlichen Glückwunsch! Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium wurde 50 Jahre alt.
 Herzlichen Glückwunsch! Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium wurde 50 Jahre alt. Im Jahr 1965 wurde durch das Bayerische Kultusministerium der Sozialwissenschaftliche Zweig als neue gymnasiale Ausbildungsrichtung
Herzlichen Glückwunsch! Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium wurde 50 Jahre alt. Im Jahr 1965 wurde durch das Bayerische Kultusministerium der Sozialwissenschaftliche Zweig als neue gymnasiale Ausbildungsrichtung
Während unserer Schulzeit genossen wir jeweils 14 Tage in unserem Schullandheim unterhalb der Lausche in Waltersdorf.
 Sehr geehrte Frau Evers, gern komme ich Ihrer Bitte nach und versuche, einen kurzen Abriss unserer Schulzeit an Ihrem Gymnasium und unseren Klassentreffen zu geben und füge dazu einige Bilder bei. Im September
Sehr geehrte Frau Evers, gern komme ich Ihrer Bitte nach und versuche, einen kurzen Abriss unserer Schulzeit an Ihrem Gymnasium und unseren Klassentreffen zu geben und füge dazu einige Bilder bei. Im September
Informationen zum Wahlbogen für die Qualifikationsphase
 Informationen zum Wahlbogen für die Qualifikationsphase In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (Jahrgang 11/12, aufgeteilt in vier Schulhalbjahre) muss jeder Schüler eine gewisse Anzahl von
Informationen zum Wahlbogen für die Qualifikationsphase In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (Jahrgang 11/12, aufgeteilt in vier Schulhalbjahre) muss jeder Schüler eine gewisse Anzahl von
Schule im Kaiserreich
 Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Schule im Kaiserreich 1. Kapitel: Der Kaiser lebte hoch! Hoch! Hoch! Vor 100 Jahren regierte ein Kaiser in Deutschland. Das ist sehr lange her! Drehen wir die Zeit zurück! Das war, als die Mama, die Oma,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Nationalsozialistische Ideologie und Gesellschaft - Hitler-Deutschland zwischen Feierkult, Judenverfolgung und Bombenterror
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Stationenlernen Nationalsozialistische Ideologie und Gesellschaft - Hitler-Deutschland zwischen Feierkult, Judenverfolgung und Bombenterror
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Die gymnasiale Oberstufe: Informationen zur Profilwahl
 Die gymnasiale Oberstufe: Informationen zur Profilwahl Deine Situation: Du stehst kurz vor der Wahl deines Profils (Schwerpunkt) für die Oberstufe. Diese bereitet dich in zwei Schuljahren auf die Abiturprüfungen
Die gymnasiale Oberstufe: Informationen zur Profilwahl Deine Situation: Du stehst kurz vor der Wahl deines Profils (Schwerpunkt) für die Oberstufe. Diese bereitet dich in zwei Schuljahren auf die Abiturprüfungen
Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft
 Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft Ist der Lehrer nicht klug, dann bleiben die Schüler dumm, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Denn Lehren heißt zweimal lernen, einmal, um es
Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft Ist der Lehrer nicht klug, dann bleiben die Schüler dumm, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Denn Lehren heißt zweimal lernen, einmal, um es
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen Die Qualifikationsphase Jahrgangsstufen 11+12 Abitur 2018 Allgemeine Hinweise zur Qualifikationsphase > Kursunterricht Der Unterricht in den letzten beiden Jahren des Gymnasiums
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen Die Qualifikationsphase Jahrgangsstufen 11+12 Abitur 2018 Allgemeine Hinweise zur Qualifikationsphase > Kursunterricht Der Unterricht in den letzten beiden Jahren des Gymnasiums
I. Begrüßung: Kontext der Initiative Anrede
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
Amplonius-Gymnasium Rheinberg. Rooted in the Middle Ages, founded in 1903 and still going strong
 Amplonius-Gymnasium Rheinberg Rooted in the Middle Ages, founded in 1903 and still going strong Heinz Pannenbecker VII/2014 Teil 3: Das Progymnasium Die Vorläuferschulen: Amplonius-Progymnasium 1945 Am
Amplonius-Gymnasium Rheinberg Rooted in the Middle Ages, founded in 1903 and still going strong Heinz Pannenbecker VII/2014 Teil 3: Das Progymnasium Die Vorläuferschulen: Amplonius-Progymnasium 1945 Am
Hitler - Der Architekt
 Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Geschichte Matthias Heise Hitler - Der Architekt Studienarbeit Hitler - Der Architekt Hauptseminar Hitler - Eine Biographie im 20. Jh. " Dr. M. Gailus, Technische Universität Berlin, WS 2003/2004 Matthias
Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, Uhr Museum Blumenstein, Solothurn. Kurzansprache Regierungsrat Dr.
 1 Es gilt das gesprochene Wort Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, 19.00 Uhr Museum Blumenstein, Solothurn Kurzansprache Regierungsrat Dr. Remo Ankli Sehr geehrter Herr Stadtpräsident
1 Es gilt das gesprochene Wort Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, 19.00 Uhr Museum Blumenstein, Solothurn Kurzansprache Regierungsrat Dr. Remo Ankli Sehr geehrter Herr Stadtpräsident
Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart
 Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart Von Christian B. Schad, Konventionsbeauftragter des DRK-Kreisverbandes Stuttgart Auf Seite 120 der bekannten
Spannende Lokalgeschichte: Aufklärung über Rudolf Müllers gymnasiale Tätigkeit in Stuttgart Von Christian B. Schad, Konventionsbeauftragter des DRK-Kreisverbandes Stuttgart Auf Seite 120 der bekannten
Informationen zur Profiloberstufe an der Theodor Heuss Schule. Schuljahr 2013/2014
 Informationen zur Profiloberstufe an der Theodor Heuss Schule Schuljahr 2013/2014 Organisation der Oberstufe Die dreijährige Oberstufe* gliedert sich in die einjährige Einführungsphase und die zweijährige
Informationen zur Profiloberstufe an der Theodor Heuss Schule Schuljahr 2013/2014 Organisation der Oberstufe Die dreijährige Oberstufe* gliedert sich in die einjährige Einführungsphase und die zweijährige
I. Der Wettbewerb Mobben stoppen 2.0 Integration fördern
 1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 22.11.2012, 15:30 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 22.11.2012, 15:30 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
Informationen zur gymnasialen Oberstufe. an der Gesamtschule Gronau
 Informationen zur gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule Gronau Wer kann in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen werden? Voraussetzung für die Aufnahme sind die Fachoberschulreife mit Qualifikation
Informationen zur gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule Gronau Wer kann in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen werden? Voraussetzung für die Aufnahme sind die Fachoberschulreife mit Qualifikation
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau
 Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau
 Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Provinzfest 100 Jahre Don Bosco in Deutschland am 3. Juni 2016 in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags
 Es gilt das gesprochene Wort! Provinzfest 100 Jahre Don Bosco in Deutschland am 3. Juni 2016 in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Lieber Pater Grünner, Ihre
Es gilt das gesprochene Wort! Provinzfest 100 Jahre Don Bosco in Deutschland am 3. Juni 2016 in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Lieber Pater Grünner, Ihre
ELTERNVERSAMMLUNG KLASSE 9 ZUR GOST - neue GOSTV 2009
 ELTERNVERSAMMLUNG KLASSE 9 ZUR GOST - neue GOSTV 2009 Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 wurde eine neue GOSTV gültig, laut Beschluss der Landesregierung vom 21. August 2009. Damit gibt es nach der GOSTV
ELTERNVERSAMMLUNG KLASSE 9 ZUR GOST - neue GOSTV 2009 Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 wurde eine neue GOSTV gültig, laut Beschluss der Landesregierung vom 21. August 2009. Damit gibt es nach der GOSTV
TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG WARUM TAUFEN WIR: MT 28,16-20
 GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
GreifBar Werk & Gemeinde in der Pommerschen Evangelischen Kirche TAUFE VON MARKUS ENGFER GreifBar plus 307 am 15. April 2012 LIED: IN CHRIST ALONE BEGRÜßUNG Herzlich willkommen: Markus, Yvette, gehört
Fragebogen für Eltern
 Fragebogen für Eltern Prof. Dr. E. Klieme Pädagogisches Institut Fachbereich Kognitionspsychologie/Didaktik Prof. Dr. K. Reusser 1 Liebe Eltern, im Folgenden interessiert uns vor allem Ihre Meinung zum
Fragebogen für Eltern Prof. Dr. E. Klieme Pädagogisches Institut Fachbereich Kognitionspsychologie/Didaktik Prof. Dr. K. Reusser 1 Liebe Eltern, im Folgenden interessiert uns vor allem Ihre Meinung zum
Jahre trug die Jugendhochschule am Bogensee den Namen Wilhelm Pieck
 Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" Konzeption Inhaltliche Gestaltung des Treffens des Arbeitskreises Geschichte der Jugendhochschule anlässlich des 70. Jahrestages der Verleihung
Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" Konzeption Inhaltliche Gestaltung des Treffens des Arbeitskreises Geschichte der Jugendhochschule anlässlich des 70. Jahrestages der Verleihung
Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht
 Pädagogik Klaudia Kock, geb. Buczek Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht Essay 1 Ruhr-Universität Bochum Bochum, den 14.02.2013 Katholisch-Theologische
Pädagogik Klaudia Kock, geb. Buczek Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht Essay 1 Ruhr-Universität Bochum Bochum, den 14.02.2013 Katholisch-Theologische
Birgit Kolb Vorratsdatenspeicherung Unter Berücksichtigung der TKG-Novelle 2011
 Birgit Kolb Vorratsdatenspeicherung Unter Berücksichtigung der TKG-Novelle 2011 Birgit Kolb Vorratsdaten speicherung Unter Berücksichtigung der TKG-Novelle 2011 Bibliographische Information der Deutschen
Birgit Kolb Vorratsdatenspeicherung Unter Berücksichtigung der TKG-Novelle 2011 Birgit Kolb Vorratsdaten speicherung Unter Berücksichtigung der TKG-Novelle 2011 Bibliographische Information der Deutschen
Es gilt das gesprochene Wort!
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 24. Juni 2015, 14 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt das gesprochene
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 24. Juni 2015, 14 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt das gesprochene
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27.
 Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27. Januar 2014, 11:00 Uhr Aula Sophie - Scholl - Gymnasium, Tirpitzstraße
Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anlässlich der Veranstaltung Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Montag, 27. Januar 2014, 11:00 Uhr Aula Sophie - Scholl - Gymnasium, Tirpitzstraße
Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1
 Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1 Zusammenfassung der Ergebnisse In einem anonymen Fragebogen wurden die zehn Schülerinnen und Schüler des bilingualen Politik/Wirtschaft-Unterrichtes
Evaluation Bilingualer Politik/Wirtschaft-Unterricht am FRG 1 Zusammenfassung der Ergebnisse In einem anonymen Fragebogen wurden die zehn Schülerinnen und Schüler des bilingualen Politik/Wirtschaft-Unterrichtes
Rede. von. Dr. Peter Gauweiler, MdB Staatsminister a.d. Vorsitzender des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
 Rede von Dr. Peter Gauweiler, MdB Staatsminister a.d. Vorsitzender des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Alumnitreffen 2011 Europanetzwerk Deutsch Berlin, am 25.05.2011 Es gilt das
Rede von Dr. Peter Gauweiler, MdB Staatsminister a.d. Vorsitzender des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Alumnitreffen 2011 Europanetzwerk Deutsch Berlin, am 25.05.2011 Es gilt das
I. Begrüßung 50 Jahre Griechisch-Orthodoxe Metropolie in Deutschland
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 12.07.2013, 18:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich 50 Jahre Griechisch-Orthodoxe Metropolie
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 12.07.2013, 18:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich 50 Jahre Griechisch-Orthodoxe Metropolie
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau
 Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Informationen über die Profiloberstufe
 Informationen über die Profiloberstufe Februar 2018 Themen Kernfächer Profile: Belegverpflichtungen und Wahlmöglichkeiten Abiturprüfung Allgemeine Hochschulreife Besondere Lernleistung Deutsch Mathematik
Informationen über die Profiloberstufe Februar 2018 Themen Kernfächer Profile: Belegverpflichtungen und Wahlmöglichkeiten Abiturprüfung Allgemeine Hochschulreife Besondere Lernleistung Deutsch Mathematik
Vorwort zu: Der Verein baudenkmal bundesschule bernau ( ). Eine Chronik
 Vorwort zu: Der Verein baudenkmal bundesschule bernau (1990 2005). Eine Chronik Der am 4. Mai 1990 gegründete Verein baudenkmal bundesschule bernau (bbb) legt mit dieser Chronik Rechenschaft über seine
Vorwort zu: Der Verein baudenkmal bundesschule bernau (1990 2005). Eine Chronik Der am 4. Mai 1990 gegründete Verein baudenkmal bundesschule bernau (bbb) legt mit dieser Chronik Rechenschaft über seine
Es gilt das gesprochene Wort. I. Begrüßung Geschichte des Unterrichts von Menschen mit Behinderung. Anrede
 Sperrfrist: 31.01.2012, 13:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Informationsveranstaltung
Sperrfrist: 31.01.2012, 13:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Informationsveranstaltung
Schule der 10- bis 14-Jährigen
 Partner im Projekt Schule der 10- bis 14-Jährigen Pädagogische Hochschule Vorarlberg School of Education der Universität Innsbruck Landesschulrat für Vorarlberg Land Vorarlberg Schule der 10- bis 14-Jährigen
Partner im Projekt Schule der 10- bis 14-Jährigen Pädagogische Hochschule Vorarlberg School of Education der Universität Innsbruck Landesschulrat für Vorarlberg Land Vorarlberg Schule der 10- bis 14-Jährigen
Die Organisation der Sekundarstufe I Differenzierung, Fördermaßnahmen, Fordermaßnahmen Woher kommen die Kinder zu uns in den 5. Jahrgang?
 FSM/Hen Stand: März 2015 Die Organisation der Sekundarstufe I Differenzierung, Fördermaßnahmen, Fordermaßnahmen Woher kommen die Kinder zu uns in den 5. Jahrgang? Aus Familien mit unterschiedlichen Ideen
FSM/Hen Stand: März 2015 Die Organisation der Sekundarstufe I Differenzierung, Fördermaßnahmen, Fordermaßnahmen Woher kommen die Kinder zu uns in den 5. Jahrgang? Aus Familien mit unterschiedlichen Ideen
Begrüßung zum Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am , Uhr, Ratssaal
 Begrüßung zum Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2018, 11.00 Uhr, Ratssaal Ich freue mich, dass auch heute die Plätze hier im Ratssaal so gut gefüllt sind. Sehr geehrte Damen und Herren, im
Begrüßung zum Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2018, 11.00 Uhr, Ratssaal Ich freue mich, dass auch heute die Plätze hier im Ratssaal so gut gefüllt sind. Sehr geehrte Damen und Herren, im
Es ist mir eine große Freude, heute das Zentrum für Israel-Studien an der Ludwig- Maximilians-Universität München mit Ihnen feierlich zu eröffnen.
 Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr.
 Schule am Floßplatz - Grundschule Fax-Nr. 0341/ 2 11 98 56 Hohe Str. 45 04107 Leipzig Tel. 0341/ 91046021 Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr. Hinweise für Eltern zum Aufnahmeverfahren an Oberschulen
Schule am Floßplatz - Grundschule Fax-Nr. 0341/ 2 11 98 56 Hohe Str. 45 04107 Leipzig Tel. 0341/ 91046021 Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr. Hinweise für Eltern zum Aufnahmeverfahren an Oberschulen
Schule der 10- bis 14-Jährigen
 Partner im Projekt Schule der 10- bis 14-Jährigen Pädagogische Hochschule Vorarlberg School of Education der Universität Innsbruck Landesschulrat für Vorarlberg Land Vorarlberg Schule der 10- bis 14-Jährigen
Partner im Projekt Schule der 10- bis 14-Jährigen Pädagogische Hochschule Vorarlberg School of Education der Universität Innsbruck Landesschulrat für Vorarlberg Land Vorarlberg Schule der 10- bis 14-Jährigen
Ordensschulen, ein Angebot in ganz Österreich
 Ordensschulen Ordensschulen, ein Angebot in ganz Österreich Ordensschulen stellen eine wesentliche Säule des Schulwesens in Österreich dar. Rund 50.000 österreichische Schülerinnen und Schüler besuchen
Ordensschulen Ordensschulen, ein Angebot in ganz Österreich Ordensschulen stellen eine wesentliche Säule des Schulwesens in Österreich dar. Rund 50.000 österreichische Schülerinnen und Schüler besuchen
I. Bedeutung des Wettbewerbs Mobben stoppen. Begrüßung. Der Wettbewerb Mobben Stoppen ist eine ganz außergewöhnliche Initiative:
 1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 15.11.2011, 15:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 15.11.2011, 15:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
