Model-Driven Integration Engineering in der E-Government-Domäne Meldewesen
|
|
|
- Ilse Sommer
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Model-Driven Integration Engineering in der E-Government-Domäne Meldewesen Stefan Kühne, Maik Thränert Institut für Informatik, Universität Leipzig Leipzig Werner Rotzoll, Jan Lehmann DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH Schwerin Abstract Im Rahmen des E-Government integrieren IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung bestehende Anwendungen von Bund, Ländern und Kommunen in komplexen Infrastrukturen. Durch domänenspezifische Modellierungssprachen lässt sich die Komplexität der Integrationsvorhaben reduzieren. Am Beispiel der E-Government-Domäne Meldewesen wird in diesem Beitrag der Ansatz Model-Driven Integration Engineering (MDIE) vorgestellt. Er beschreibt u. a. die Entwicklung kompakter, intuitiver Modellierungssprachen für Integrationsvorhaben in einer fachlichen Domäne und fokussiert dabei die direkte Weiterverwendung der modellierten Sachverhalte über Modelloperationen. 1 Integrationsproblematik im E-Government Derzeit werden in allen Bundesländern große Anstrengungen in der E-Government-Domäne Meldewesen unternommen, eine Infrastruktur aufzubauen und erste Dienste, wie einfache Melderegisterauskunft [Osci06, S. 352] oder Rückmeldung [Osci06, S. 133] anzubieten. Allgemein betrachtet, entwickeln IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung E-Government-Dienste, indem sie bestehende Anwendungen von Bund, Ländern und Kommunen in komplexen Infrastrukturen vernetzen und integrieren. Dabei sind sie mit typischen Herausforderungen von In-
2 tegrationsprojekten konfrontiert, die sich aus der Vielfältigkeit und Heterogenität bestehender Systeme ergeben. Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich aus Änderungen z. B. hinsichtlich Kundenanforderungen, Gesetzesvorgaben oder verfügbaren Implementierungstechnologien. Die Komplexität der Integrationsvorhaben zeigt sich bereits in aus fachlicher Sicht vergleichsweise einfachen Prozessen, wie der einfachen Melderegisterauskunft. Deren technische Umsetzung basiert auf verschiedenen Infrastruktur- und Basiskomponenten einer E-Government- Plattform, wie Portal, Virtuelle Poststelle oder Verzeichnisdiensten. Die Orchestrierung dieser Komponenten erfolgt unter Nutzung von Workflows in einem Business Process Management System. Für eine effizientere Umsetzung derartiger Integrationsprojekte im E-Government wird in diesem Beitrag der Ansatz Model-Driven Integration Engineering (MDIE) vorgeschlagen, welcher die Anwendung modellgetriebener Techniken im Anwendungsbereich des Integration Engineering (IE) [Raut93, FäTW05, SDTK05] fokussiert. Der MDIE-Ansatz wird am Beispiel der E-Government-Domäne Meldewesen vorgestellt. 1 Es wird gezeigt, wie Konzepte dieses Bereichs identifiziert und analysiert, das gewonnene Domänenwissen in eine kompakte, spezifische Modellierungssprache überführt und Modelle der Sprache über Transformationen weiterverarbeitet werden können. Die Anwendung des MDIE-Ansatzes ermöglicht die (Integrations-) projektübergreifende Wiederverwendung von Domänenwissen sowie Komplexitätsreduktionen, womit Verbesserungen des Entwicklungsprozesses, insbesondere hinsichtlich Flexibilität, Entwicklungsgeschwindigkeit, Entwicklungskosten, Qualität sowie Transparenz für beteiligte Personengruppen (z. B. Auftraggeber), adressiert werden. 2 Der Ansatz des Model-Driven Integration Engineering 2.1 Modellgetriebene Entwicklungsansätze Modellgetriebene Entwicklungsansätze wie das Model-Driven Engineering (MDE) [Bézi05, FaNg05, Schm06], Model-Driven Software Development (MDSD) [StVö06] oder Generative Software Development (GSD) [Czar04, CzEi00] betonen die zentrale Rolle formaler Modelle im Lebenszyklus eines Softwaresystems bzw. einer Softwaresystemfamilie. Ein Modell dient hierbei als stellvertretende Beschreibung eines zugrunde liegenden Systems (Original), in wel- 1 Beispielhaft wurden hierfür die Ergebnisse des Projektvorhabens Meldewesen für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern [LeRo06] in die Untersuchungen einbezogen.
3 chem ausschließlich zweckdienliche Informationen repräsentiert sind. Da ein Modell selbst als System aufzufassen ist, kann vom technischen Informationssystem in mehreren Stufen hinsichtlich verschiedener Sichten und Abstraktionsebenen abstrahiert werden. Ein zentraler Bestandteil modellgetriebener Ansätze ist die Definition von Modelloperationen, wie Modelltransformationen, Modellvalidierungen oder Modelldifferenzen, auf Basis formaler Modelle zur Automatisierung des Entwicklungsprozesses. Modelltransformationen ermöglichen beispielsweise die Anreicherung von Modellen mit zusätzlichen Informationen (z. B. technischen), die informationserhaltende Formüberführung von Modellen oder die Extraktion und Aggregation bestimmter Eigenschaften zur Bewertung von Modellen. Modellvalidierungen überprüfen, ob modellierte Sachverhalte gültig hinsichtlich definierter Anforderungen sind. Die Modelloperationen rechtfertigen somit die zentrale Rolle formaler Modelle im Entwicklungsprozess, da sie direkt zu signifikanten Mehrwerten, wie effizientere Entwicklung oder bessere Qualität, beitragen können. In den modellgetriebenen Ansätze MDE, MDSD und GSD werden die Konzepte technologieunabhängig definiert. Für den praktischen Einsatz existieren zahlreiche Konkretisierungen, wie beispielsweise die Model Driven Architecture [ObjeoJ], das Model-integrated Computing [KSLB03], das architecture-centric Model-Driven Software Development [StVö06, S. 21 ff.] oder Microsofts Software Factories [GrSh04]. Dabei werden die Konzepte für verschiedene Anwendungsbereiche mit Methoden, Werkzeugen und Standards hinterlegt. Erfahrungen zeigen, dass die Ansätze in sehr unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie bei der Entwicklung verteilter eingebetteter Systeme oder komplexer Enterprise-Anwendungen, erfolgreich eingesetzt werden und zu Verbesserungen im Entwicklungsprozess führen können [Schm06]. Ein noch wenig betrachteter Anwendungsbereich modellgetriebener Ansätze ist das Integration Engineering. 2.2 Integration Engineering Beim Integration Engineering (IE) handelt es sich um eine Engineering-Disziplin, die Prinzipien, Modelle, Methoden und Werkzeuge entwickelt, bewertet und zur Verfügung stellt, sodass diese in einem ingenieurmäßigen Prozess der Integrierung eingesetzt werden können. [ThKü06, S. 14] Vereinfacht formuliert, liefert das IE das»handwerkszeug«mit zugehörigen Einsatzanweisungen, damit Integrierung durchgeführt werden kann. [Thrä05, S. 21] Dabei betrachtet das IE Informationssysteme (IS) als relevante Integrationsobjekte, sodass diese zu Integrierten Informationssystemen (IIS) umgestaltet werden. Da es sich bei einem Informati-
4 onssystem um ein sozio-technisches System [Birk05] handelt, spielen neben den technischen auch die organisatorischen Aspekte einer Integration eine wichtige Rolle, obgleich sich die Ausführungen in diesem Beitrag primär den technischen Integrationsproblemen zuwenden. Grundsätzlich sind sowohl die Neuentwicklung von integrierten Informationssystemen ( Integration ex ante ) als auch die Zusammenführung bereits existierender Informationssysteme ( Integration ex post ) [KuRa96, S. 170] Aufgabenbereiche des IE. Zur ex-post-integration gehören z. B. die Anpassung und Integrierung eines Informationssystems in eine bestehende IT- Infrastruktur, die Integrierung von IS oder deren Komponenten untereinander sowie die Anbindung bestehender IS an eine zentrale Plattform. Zur ex-ante-integration gehört auch die Desintegration eines IS bzw. IIS mit dem Ziel eines Refactoring, sodass eine bessere Integrierbarkeit dieses IS bzw. IIS erreicht wird. Ebenso zur ex-ante-integration gehört die Harmonisierung der Anwendungsarchitektur, wie z. B. die Einführung einer einheitlichen technischen Kommunikationsbasis unter Nutzung von z. B. Web Services oder auch die Harmonisierung von Anwendungsmodellen durch Schaffung einer einheitlichen Metamodellinfrastruktur. Die Anwendungsbereiche des IE sind dabei sehr vielseitig. Dazu gehören beispielsweise der Maschinenbau [WeSo05], E-Government [LeRK06] oder E-Commerce [HäKü06; FFSD06]. Das Integration Engineering versucht dabei ständig, durch neue Methoden, Werkzeuge und Vorgehensweisen eine Effizienzsteigerung zu erzielen. In diesem Sinne wurde auch der im Folgenden dargestellte Ansatz des Model-Driven Integration Engineering entwickelt. 2.3 Model-Driven Integration Engineering Die Anwendung des Paradigmas modellgetriebener Entwicklung im Anwendungsbereich des IE führt zur Disziplin des Model-Driven Integration Engineering (MDIE) [ThKü06]. Dabei werden modellgetriebene Ansätze zur Lösung von IE-Problemen ausgewählt und angepasst. Konkreter formuliert liegt der Fokus des MDIE in der Auswahl, Anpassung und ggf. Neuentwicklung von Prinzipien, Modellen, Methoden, Werkzeugen und Vorgehensweisen modellgetriebener Ansätze zur formalen domänenspezifischen Modellierung und Anwendung von Modelloperationen (wie Modelltransformationen oder Modellvalidierungen)
5 für die IE-Aufgabenbereiche Beschreibung der Integrationsform als Ausgangsbasis und Ziel einer Integrierung sowie Überführung von Integrationsformen. Eine Zielsetzung des MDIE ist die kompakte, problemangepasste und intuitive Modellierung als Basis für ein besseres Verständnis sowie leichtere Handhabbarkeit im Vergleich zum zugrunde liegenden System. Modellierungssprachen mit weit gefasstem Anwendungsbereich (Unified Languages) unterliegen der Problematik, dass die fokussierten Aspekte des Systems nur mit generischen Sprachkonstrukten repräsentiert werden können. Dies führt tendenziell zu feingranularen Beschreibungen. Problemangepasste Modellierungssprachen (Specific Languages) adressieren dagegen einen meist fachlich beschränkten Anwendungsbereich (Domäne). Die spezifischen Gegebenheiten und Charakteristika der Domänen werden berücksichtigt, indem für die Konzepte der Domäne spezifische Sprachkonstrukte zur Verfügung gestellt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine direkte Repräsentation der Sachverhalte und damit kompakte Modellierung, was zu reduziertem Aufwand bei der Erstellung von Modellen und zu einer verbesserten Kommunikation zwischen den beteiligten Personengruppen führt. Ein weiteres Ziel des MDIE ist die Definition von Modelloperationen auf Basis formaler domänenspezifischer MDIE-Modellierungen. Entsprechende Transformationen ermöglichen bspw. die Anreicherung von Modellen mit technischen Informationen oder die Extraktion bestimmter Modellaspekte beispielsweise zur Bewertung der Integrationsform. Mithilfe von Validierungen können Modelle bspw. hinsichtlich Konsistenz, Vollständigkeit oder Anforderungskonformität überprüft werden. Die im Rahmen modellgetriebener Ansätze definierten Modelloperationen führen zur Automatisierung von manuellen Arbeitsschritten. 2.4 Anwendung des MDIE im E-Government Die Potenziale modellgetriebener Entwicklungsansätze übertragen sich auf das MDIE. Insbesondere verspricht dessen Anwendung Verbesserungen hinsichtlich Qualität, Portabilität, Flexibilität und Transparenz der Integrationslösung. Dem gegenüber stehen zusätzliche Aufwände, die sich aus Erstellung und Pflege zusätzlicher MDIE-Artefakte wie domänenspezifische Sprachen, Transformationen und Validierungen ergeben. Inwiefern sich bezüglich des Entwicklungsprozesses langfristige Kostensenkungen und Steigerungen der Entwicklungsgeschwindigkeit ergeben, hängt demnach von den Gegebenheiten des Einsatzgebietes (der Domäne) ab. Hierbei spielen Faktoren wie die Stabilität von Konzepten oder die Anzahl und Umfang der Projekte eine wesentliche Rolle.
6 Wie in Abschnitt 1 geschildert, stellt die Umsetzung behördenübergreifender E-Government- Prozesse auf Basis existierender Fachverfahren eine aktuelle Herausforderung für IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung dar. Die effiziente Anwendbarkeit des MDIE-Ansatzes in der Domäne E-Government wird durch folgende Charakteristika begünstigt: Der Domäne liegt eine gewachsene und gefestigte Terminologie zugrunde. Durch Vorgaben des Gesetzgebers sowie einer Reihe von Standards und Richtlinien von E-Government-Initiativen und Arbeitsgruppen bestehen stabile Konzepte, hinsichtlich des Gegenstandsbereichs der Integrierung und der Integrationsmittel. Anzahl und Umfang potenzieller Integrationsprojekte sind beträchtlich. Die einzelnen Integrationsprojekte stehen in einem zeitlichen und logischen Zusammenhang. Demzufolge bestehen Bedarfe hinsichtlich Wiederverwendung von Entwicklungsartefakten, Erfahrungen, usw. Im Folgenden soll der MDIE-Ansatz anhand der E-Government-Domäne Meldewesen demonstriert werden. Zunächst wird in Abschnitt 3 die Domäne eingegrenzt, die am Entwicklungsprozess beteiligten Personengruppen identifiziert, deren spezifischen Informationsbedarfe in eine Modellierungsarchitektur eingeordnet sowie der für den MDIE-Ansatz relevante Bereich abgegrenzt. In Abschnitt 4 werden die für die ausgewählte Modellierungsebene relevanten Konzepte identifiziert, analysiert und anschließend in eine domänenspezifische Modellierungssprache überführt. Abschnitt 5 zeigt, wie Modelle der entwickelten Sprache auf eine Ausführungsumgebung abgebildet werden können. 3 Die E-Government-Domäne Meldewesen 3.1 Der Nachrichtenstandard OSCI-XMeld Das Online Services Computer Interface (OSCI) ist ein zweischichtiger Protokollstandard zum sicheren Austausch von Nachrichten über das Internet mit besonderer Eignung für das E-Government [Bund06]. Die sichere und vertrauliche Übertragung digital signierter Dokumente ist in der Transportschicht (OSCI-Transport) beschrieben. Hier wird beispielsweise die OSCI- Nachrichtenstruktur definiert, welche sich in die drei Sicherheitsebenen Administrationsebene, Auftragsebene und Inhaltsdaten untergliedert [Osci01]. Die Strukturierung und semantische
7 Standardisierung von Nachrichteninhalten erfolgt in OSCI in der Anwendungsschicht. Hierzu werden in verschiedenen Projekten, wie XMeld, XBau und XJustiz, entsprechende Standards definiert. Für den Bereich Meldewesen ist der Standard XMeld [Osci06] relevant. Das Meldewesen versorgt eine Vielzahl staatlicher Stellen mit verwaltungsinternen Daten der Einwohner. Rechtliche Grundlage für eine Umsetzung im Sinne des E-Government ist das novellierte Melderechtsrahmengesetz (MRRG), dessen länderspezifische Umsetzung in Landesmeldegesetzen (LMG) und die erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeld- DÜV). Im Standard XMeld werden Syntax und Semantik von Nachrichten definiert, welche zwischen Meldeämtern und Kommunikationspartnern, wie Bürger, gewerblicher Kunde oder auswärtiges Meldeamt unter bestimmten, festgelegten Umständen ausgetauscht werden. Für die Einordnung der Nachrichten in einen Prozesskontext werden verschiedene Szenarien wie Anmeldung, Rückmeldung oder einfache Melderegisterauskunft definiert. 3.2 Stakeholderanalyse für eine domänenspezifische Modellierung Für eine domänenspezifische Modellierung nach MDIE sind zunächst relevante Personengruppen und deren Informationsbedarfe zu identifizieren. Zur Umsetzung von E-Government-Diensten gehören folgende Gruppen: Auftraggeber (Land, Kommune, Meldebehörde): Der Auftraggeber hat einen Informationsbedarf hinsichtlich der Umsetzung von gesetzlichen Grundlagen (Bundesgesetze, Landesgesetze und Richtlinien von Arbeitsgruppen), z. B. in welcher Form behördenübergreifende Prozesse ablaufen. Im Fall des Meldewesens, welches auf Landesebene umgesetzt wird, sind die fachlichen Anforderungen an Komponenten der Meldebehörden relevant. Entwickler und Systemintegrator: Relevant sind hier funktionale und technische Aspekte (z. B. IT-Prozess, Prozessschnittstellen und fachliche Anforderungen an Komponenten), welche für die Entwicklung neuer bzw. die Integration vorhandener Komponenten erforderlich sind. Systembetreuer: Der Systembetreuer verwaltet die Systeme im laufenden Betrieb. Er muss Fehler im Wirkbetrieb Prozessen und Komponenten zuordnen können. Der Informationsbedarf ist demnach ähnlich dem der Gruppe Entwickler und Systemintegrator, jedoch aus einer anderen Perspektive. Service-Manager: Der Service-Manager steht zwischen den Gruppen Auftraggeber, Entwickler/Systemintegrator und Systembetreuer. Er ist für die fachgerechte Umsetzung von Diensten verantwortlich. Demzufolge sind organisatorische Aspekte wie Service-Level-Agreements,
8 Konfiguration/Change-Management, aber auch funktionale Aspekte wie Prozessablauf und Prozessschnittstellen relevant. Weitere Gruppen: Weitere Gruppen sind u. a. Marketing, Datenschützer, User Help Desk, Medien, Bürger, Nutzer der Anwendung, Diensteanbieter und Zertifizierungslabor. Die unterschiedlichen Zielstellungen dieser Personengruppen erfordern eine Modellierung auf verschiedenen Abstraktionsebenen (vgl. Abb. 1). Das Spektrum reicht dabei von fachlichabstrakten Modellierungsebenen, welche für Auftraggeber und Service-Management relevant sind, bis zu technisch-konkreten Modellierungsebenen für die Gruppen Entwicklung und Systemintegration. Dabei ist die dynamische Prozesssicht, in der statische Sichten, wie Organisations-, Ressourcen- oder Datensicht, miteinander verknüpft sind, für alle beteiligte Personengruppen von hoher Priorität. Auf dieser Basis können bei der Entwicklung von E-Government- Diensten bspw. die Anforderungen an das Integrationssystem oder der systemübergreifende Entwurf spezifiziert werden. Auch im Betrieb ist die Prozesssicht relevant, z. B. bei der Zuordnung von Fehlern zu Systemkomponenten. Neben den gruppenbezogenen Informationsbedarfen ist die Prozesssicht ebenso für die gruppenübergreifende Abstimmung relevant. In Abb. 1 ist eine mögliche Modellierungsarchitektur dargestellt. Diese setzt auf einer vorhandenen E-Government-Plattform, bestehend aus verschiedenen Infrastruktur- und Basiskomponenten, auf. Die technische Integration der Komponenten wird auf Integrationsebene beschrieben. Hier können z. B. auf Basis von Web-Service-Technologien die Komponenten systemübergreifend orchestriert werden. Die darüber liegenden Modellierungsebenen, wie die technische und fachliche Prozessmodellierungsebene, beschreiben Prozesse mit abnehmend technischem Detaillierungsgrad bzw. zunehmend fachlichem Abstraktionsgrad. Die Modellierungsebene Technische Prozessmodellierung ist primär für die Personengruppe Systemintegration relevant und liegt daher im Fokus des MDIE-Ansatzes. Sie dient jedoch auch Szenarienübersicht Funktions- und Komponentenübersicht Fachliche Prozessmodellierung Technische Prozessmodellierung Technische Integration (z. B. BPEL4WS) Auftraggeber Service-Manager Entwickler und Systemintegrator E-Government-Plattform (z. B. Verzeichnisdienst, BPMS, Portal, Payment) Systembetreuer Abb. 1: Modellierungsebenen
9 zur Abstimmung mit den Gruppen Entwicklung und Service-Management und bildet die Schnittstelle zwischen fachlicher Modellierung und technischer Umsetzung. Sie abstrahiert von technischen Details zugrunde liegender Integrationssprachen und enthält Aspekte der fachlichen Domäne (E-Government, Meldewesen). Zielstellung des MDIE-Ansatzes ist die automatisierte Abbildung von Modellen der technischen Prozessmodellierungsebene auf die technische Integrationsebene (vgl. Pfeil in Abb. 1). Dies wird realisiert über Modelltransformationen, welche die fachlichen Modellierungskonstrukte mit den abstrahierten technischen Aspekten anreichern. 4 Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache für die technische Prozessmodellierung im Bereich Meldewesen 4.1 Identifizierung und Analyse relevanter Konzepte Nach Einschränkung der Domäne und Identifikation relevanter Personengruppen besteht der nächste Schritt in der Identifikation und Analyse relevanter Domänenkonzepte. Für den auf die technische Prozessmodellierungsebene eingeschränkten Bereich wurden hierfür Spezifikationsdokumente aus der Domäne E-Government bzw. der Subdomäne Meldewesen (z. B. SAGA- Architektur [Kbst05], XMeld-Spezifikation [Osci06]) sowie Implementierungsartefakte einer exemplarischen Umsetzung des Szenarios einfache Melderegisterauskunft (wie Orchestrierungen und Teilorchestrierungen von am Prozess beteiligten Komponeten auf Basis der Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS), Schnittstellenbeschreibungen von Diensten auf Basis der Web Service Description Language (WSDL) und Nachrichtenformate auf Basis von XML-Schema-Beschreibungen) ausgewertet. Die Teilergebnisse der Konzeptanalyse wurden sodann in einem iterativen/inkrementellen Prozess mit Domänenexperten aus den Gruppen Systemintegrator, Entwickler und Service-Manager diskutiert und abgestimmt. Als allgemeine Basiskonzepte für die technische Prozessmodellierung wurden für Prozessbeschreibungssprachen typische Konstrukte wie Prozess, Aktivität, Nachricht, Attribut, Ereignis, Prozessstart, Prozessende, System und Systemschnittstelle identifiziert. Zwischen diesen allgemeinen Konzepten bestehen vielfältige Beziehungen. So besteht ein Prozess z. B. aus Aktivitäten, eine Nachricht ist Input für eine Aktivität oder ein Prozess terminiert mit dem Prozessende. Diese Konzepte sind elementar und treten mehrfach in verschiedenen Ausprägungen auf.
10 Auf diesen Basiskonzepten bauen fachdomänenspezifische Konzepte auf, wie XMeldNachricht, VerzeichnisdienstNachricht, XMeldAttribut, Fehlernachricht, Protokollierung, Fehlerbehandlung, Nachrichtenkonvertierung, Verzeichnisdienst, Intermediär. Diese Konzepte haben noch stark technischen Charakter, erweitern die zugrunde liegenden Basiskonzepte jedoch mit domänenspezifischer Semantik. So ist beispielsweise das Konzept XMeldNachricht eine Einschränkung des Konzepts Nachricht auf die im XMeld-Standard definierten Nachrichtentypen (dargestellt als Vererbungsbeziehungen in Abb. 2). Neben den Basiskonzepten und domänenspezifischen Konzepten gibt es weiterhin zusammengesetzte Konzepte, welche sich aus Komposition bestehender Konzepte zusammensetzen. Diese repräsentieren Muster, die in zugrunde liegenden Implementierungsartefakten gehäuft und in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Beispiele hierfür sind Daten empfangen, Daten senden, versenden, Kommunikation mit Verzeichnisdienst, Kommunikation mit Web Service oder XMeldNachricht bearbeiten. Das Konzept Kommunikation mit Verzeichnisdienst bspw. ist abgeleitet vom Konzept Aktivität. Es umfasst neben dem Aufruf einer Verzeichnisdienstoperation durch Senden und Empfangen von Nachrichten an einen Verzeichnisdienst optional auch eine Fehlerbehandlung, in der die Operation nach vorgegebenen Zeitintervallen n- mal wiederholt wird. Anschließend kann eine Fehlerprotokollierung erfolgen. In Abb. 3 sind zwei mögliche Ausprägungen des Konzepts Kommunikation mit Verzeichnisdienst (auf technischer Integrationsebene) dargestellt. Die Menge der möglichen Ausprägungen eines Konzepts wird durch dessen Variabilität bestimmt. Eine Analyse der Variabilitäten der Konzepte einer Domäne ist Grundlage für die spätere Entwicklung der domänenspezifischen Sprache, da durch sie die Beziehungen der Konzepte, z. B. bestimmte Wechselwirkungen, expliziert werden. Die Erfassung der Variabilitäten kann mithilfe der in [AnCz04] beschriebenen Domänenunspezifische Konzepte Nachricht Aktivitaet AnwendungsSystem Domänenspezifische Konzepte Anfrage Antwort KommunikationVD Verzeichnisdienst XMeldNachricht Fehlerbehandlung DsmlNachricht Fehlerbehandlung Verzeichnisdienst Abb. 2: Konzepte der E-Government-Domäne Meldewesen (Ausschnitt)
11 Merkmalanalyse durchgeführt werden. Hierfür wird für die Konzepte einer Domäne ein Merkmalmodell erstellt, welches für jedes Konzept ein Merkmaldiagramm enthält. In Abb. 3 (Mitte) ist das zugehörige Merkmaldiagramm für das Konzept Kommunikation mit Verzeichnisdienst angegeben. Es enthält das Merkmal Nachrichtenkommunikation, welche aus den Konzepten Nachrichten senden und Nachrichten empfangen besteht. Abhängig vom Prozesskontext wird dabei eine der aufgeführten Operationen ausgeführt. Ist die optionale Fehlerbehandlung in einer Konfiguration ausgeprägt, so sind hierfür die Anzahl der Anfrageversuche sowie die Wartezeit zwischen den Wiederholungen zu spezifizieren. Die zusammengesetzten Konzepte sind speziell. Durch die Komposition entstehen Abhängigkeitsbeziehungen von Basiskonzepten, was zur Folge hat, dass zusammengesetzte Konzepte weniger stabil hinsichtlich Änderungen in der Domäne sind. Des Weiteren entsteht Redundanz im Konzeptraum, was zu verringerter Übersichtlichkeit führt. Dennoch wird im MDIE-Ansatz Abb. 3: Merkmaldiagramm des Konzepts Kommunikation mit Verzeichnisdienst (erstellt mit dem Eclipse-Plugin fmp [AnCz04]) und zwei verschiedene Ausprägungen (links und rechts)
12 die Einführung von zusammengesetzten Konzepten bei häufig auftretenden Kombinationen als sinnvoll erachtet. Sie sind die Grundlage für eine kompakte und damit übersichtliche bzw. für Fachexperten intuitive Modellierung. 4.2 Abbildung der Konzepte auf eine domänenspezifische Sprache Nach der Exploration des Konzeptraums besteht der nächste Schritt in der Definition der domänenspezifische Sprache, welche im Folgenden als EGov TP bezeichnet wird, sowie deren Implementierung in Form eines Editors. Domänenspezifische Sprachen können in unterschiedlicher Form abgebildet werden. Czarnecki klassifiziert bspw. die Ansätze hinsichtlich Flexibilität und unterscheidet zwischen dem Entscheidungsbaum-basierten Konfigurationsansatz, dem Merkmal-basierten Konfigurationsansatz und der Graph-basierten Modellierungssprache [Czar04]. Für die betrachtete Subdomäne technische Prozessmodellierung im Meldewesen ist die Flexibilität des letztgenannten Ansatzes erforderlich. Für die Definition einer graphischen domänenspezifischen Modellierungssprache existieren leicht- und schwergewichtige Ansätze. Die Grundlage in leichtgewichtigen Ansätzen bildet eine universelle Modellierungssprache, welche durch entsprechende Mechanismen erweitert bzw. eingeschränkt werden kann. Durch Vorgabe von Annotationsmöglichkeiten können domänenspezifischen Konzepten in die Sprache eingebracht werden. Ein Beispiel für dieses Vorgehen ist der UML-Profil-Mechanismus, welcher die Definition von Stereotypen und Constraints für Modellierungselemente erlaubt. Bei schwergewichtigen Ansätzen werden grundlegend neue Modellierungssprachen mit Hilfe von Metasprachen definiert. Dieses Vorgehen ist aufwendiger, da hierbei Grundkonzepte nachmodelliert werden müssen, die beim leichtgewichtigen Ansatz bereits durch die Basissprache gegeben sind. Schwergewichtige Ansätze sind jedoch flexibler, da Modellierungselemente über Konstrukte der Metamodellierungssprache (z. B. Vererbungsbeziehungen, Aggregationsbeziehungen) präziser und vielschichtiger definiert werden können. Ein weiterer Vorteil schwergewichtiger Ansätze ist, dass bei der Definition der konkreten Syntax der Modellierungssprache größerer Freiraum besteht. So können beispielsweise für Fachexperten intuitive graphische Symbole definiert werden. Zu den schwergewichtigen Ansätzen gehören bspw. Meta Object Facility 2.0 (MOF 2.0) [Obje06], das Eclipse Modeling Framework (EMF) bzw. das darauf aufbauende Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF), MetaGME [BGKS06], MetaEdit+ von MetaCase oder Microsoft DSL Tools. Alle Metamodellierungswerkzeuge ermöglichen in ähnlicher Weise das Editieren domänenspezifischen Sprachen, das Erzeugen zugehöriger do-
13 mänenspezifischer Modellierungswerkzeuge, sowie deren Anwendung bzw. Validierung [At- Kü05]. 2 Im Fall der Sprache EGov TP fiel die Entscheidung auf den schwergewichtigen Ansatz, da er die direkte Abbildung der Domänenkonzepte sowie deren vielfältigen Beziehungen auf Sprachkonstrukte ermöglicht. Die Implementierung der EGov TP erfolgte auf Basis der Eclipse-Werkzeugplattform (insbes. Eclipse EMF und GMF). Die dem EMF-Framework zugrunde liegende Metasprache Ecore [BSME03] ermöglicht die direkte Repräsentation der identifizierten Domänenkonzepte (vgl. Abschnitt 4.1) in einem entsprechenden Metamodell, daher kann Abb. 2 als Ausschnitt aus dem Metamodell gesehen werden. Basierend auf dem Ecore-Metamodell können verschiedene graphische Editoren definiert werden. Hierzu wird für jedes Metamodellelement spezifiziert, in welcher (graphischen) Form entsprechende Instanzen darzustellen sind. Aus diesen Editor-Spezifikationen können mit GMF als Eclipse-Plugin lauffähige Editoren (vgl. Abb. 4) generiert werden. Das in Abb. 4 dargestellte Prozessdiagramm zeigt einen Ausschnitt aus der Beispielmodellierung einfache Melderegisterauskunft. Das Konzept Kommunikation mit Verzeichnisdienst tritt dabei in den Instanzen MeldebehoerdeAngeschlossen und HoleSchnittstellenInformationen auf. Ein Vergleich der Instanzen mit Ausprägungen desselben Konzepts auf technischer Integrationsebene (vgl. Abb. 3) zeigt, dass sich auf technischer Prozessmodellierungsebene eine deutlich kompaktere und damit übersichtlichere Modellierung erreichen lässt. 4.3 Weiterverwendung von domänenspezifischen Modellen durch Modelltransformationen Die technische Prozessmodellierung anhand der domänenspezifischen Sprache erlaubt eine kompakte und für Fachexperten verständliche Modellierung der umzusetzenden Integrationsprozesse. Prozessmodelle bilden anschließend die Grundlage für automatisierte Modelloperationen. Die grundlegendste Operation ist die Modelltransformation, da sie die Wiederverwendung der im Modell repräsentierten Informationen in anderen Kontexten ermöglicht. In [Viss01] werden Transformationen hinsichtlich des Abstraktionsgrad der Quell- und Zielsprache in vertikale und horizontale Transformationen untergliedert. Für den betrachteten Anwendungsfall ist die Abbildung der technischen Prozessmodellierung auf Sprachen der Integrationsebene (z. B. BPEL4WS, WSDL) relevant. Es handelt sich dabei um vertikale Modelltransformationen (Refinement) einer High-Level-Modellierungssprache auf Low-Level-Sprachen. 2 Atkinson und Kühne verweisen auf prinzipielle Probleme, z. B. Inkompatibilitäten zwischen Modellen und veränderter domänenspezifischer Modellierungssprache. Dennoch ist dieser Ansatz derzeit stark verbreitet.
14 5 Zusammenfassung In diesem Artikel wurde der MDIE-Ansatz vorgestellt, welcher eine Anwendung modellgetriebener Techniken auf den Anwendungsbereich des Integration Engineering darstellt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Integration domänenspezifischer Konzepte in Prozessmodellierungssprachen zur Reduktion der Modellierungskomplexität. Die Anwendung des MDIE- Modellierungselemente Prozessdiagramm Modellübersicht Prozessdiagrammübersicht Attributleiste für Modellierungselemente Abb. 4: Graphisches Modellierungswerkzeug für die technische Prozessmodellierungssprache EGov TP Die Ergebnisse der Domänenanalyse sind die Grundlage für die Definition von Transformationsregeln, welche die Abbildungsvorschriften von EGov TP -Modellen auf Sprachen der Integrationsebene definieren. Im MDIE-Ansatz fließen die Konzepte der Domänenanalyse direkt in die domänenspezifische Modellierungssprache ein. Die Merkmaldiagramme explizieren die den Konzepten zugrunde liegenden Variabilitäten. Den Ausprägungen dieser Merkmaldiagramme (Konfigurationen) werden konkrete Ausprägungen wie in Abb. 3 zugeordnet (vgl. hierzu [CzAn05]). Die Beziehungen der technischen Prozessmodellierungen (z. B. Kontrollflusskanten) geben an, wie diese Konzeptausprägungen in den Sprachen der Integrationsebene zu verknüpfen sind. In [CzHe06, MeGo05] werden verfügbare Transformationstechniken und -werkzeuge für eine konkrete Umsetzung dieser Transformationsstrategie klassifiziert.
15 Ansatzes in der E-Government-Domäne Meldewesen zeigte exemplarisch, dass die angewendeten Abstraktionsmechanismen die Komplexität der zugrunde liegenden Integrationssprachen reduzieren können. Es wurde eine Transformationsstrategie skizziert, welche die direkte Weiterverwendung repräsentierter Sachverhalte ermöglicht. Andere Modelltransformationen wie die Extraktion bestimmter Modellaspekte (Systeme, Schnittstellen, Nachrichtenformate) zur Analyse bzw. andere Modelloperationen wie Modellvalidierung oder Modelldifferenzen sind gleichfalls denkbar. Für eine umfassende Bewertung des MDIE-Ansatzes sind jedoch weiterführende Arbeiten erforderlich. So sind für quantitative Kosten-/Nutzenbewertungen empirische Studien durchzuführen. Des Weiteren sind Vorgehensaspekte der MDIE-Artefakte, z. B. der Weiterentwicklung domänenspezifischer Sprachen im betrachteten Bereich sowie der Abstimmung zwischen verschiedenen domänenspezifischen Sprachen (DSL-Management) zu bestimmen. Literaturverzeichnis [AnCz04] [AtKü05] [Bézi05] [BGKS06] Antkiewicz, M.; Czarnecki, K.: FeaturePlugin: Feature Modeling Plug-In for Eclipse. In: OOPSLA 04 Eclipse Technology exchange (ETX) Workshop, Atkinson, C.; Kühne, T.: Concepts for Comparing Modeling Tool Architectures. In: ACM/IEEE 8th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, MoDELS / UML 2005, Bézivin, J.: On the Unification Power of Models. In: Software and System Modeling (SoSym) 4 (2005) 2, S Balasubramanian, K.; Gokhale, A.; Karsai, G.; Sztipanovits, J.; Neema, S.: Developing Applications Using Model-Driven Design Environments. In: IEEE Computer, Februar 2006, 2006, S [Birk05] Birker, K.: Das neue Lexikon der BWL. Cornelsen, 2005.
16 [BSME03] [Bund06] [CzAn05] [Czar04] [CzEi00] [CzHe06] [FaNg05] [FäTW05] [FFSD06] Budinsky, F.; Steinberg, D.; Merks, E.; Ellersick, R.; Grose, T. J.: eclipse Modeling Framework. Addison-Wesley (the eclipse series), Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Projektgruppe EGovernment (Hrsg.): Das E-Government-Glossar: Pragmatische Definitionen, Begriffserläuterungen und Abkürzungsverzeichnis. egov/download/6_egloss.pdf, , Abruf am Czarnecki, K.; Antkiewicz, M.: Mapping Features to Models: A Template Approach Based on Superimposed Variants. In: Generative Programming and Component Engineering (GPCE 2005), 2005, S Czarnecki, K.: Overview of Generative Software Development. In: Banâtre, J.- P.: Unconventional Programming Paradigms (UPP) Springer, LNCS 3566, 2004, S Czarnecki, K.; Eisenecker, U. W.: Generative Programming: Methods, Tools, and Applications. Addison-Wesley, Czarnecki, K.; Helsen, S.: Feature-based survey of model transformation approaches. In: IBM Systems Journal 45 (2006) 3, S Favre, J.-M.; NGuyen, T.: Towards a Megamodel to Model Software Evolution Through Transformations. In: Electronic Notes in Theoretical Computer Science 127 (2005) 3, S Fähnrich, K.-P.; Thränert, M.; Wetzel, P. (Hrsg.): Umsetzung von kooperativen Geschäftsprozessen auf eine internetbasierte IT-Struktur: Arbeiten aus dem Forschungsvorhaben Integration Engineering. Leipziger Beiträge zur Informatik. Band III, Eigenverlag Leipziger Informatik-Verbund (LIV), Fötsch, D.; Feja, S.; Sauer, S.; David, A.: Problemstellungen agiler Schnittstellen am Beispiel des Commerce Management Systems von Truition/AGETO. In: [FKSW06], S
17 [FKSW06] [GrSh04] [HäKü06] [Kbst05] [KSLB03] [KuRa96] [LeRK06] [LeRo06] [MeGo05] Fähnrich, K.-P.; Kühne, S.; Speck, A.; Wagner, J.: Integration betrieblicher Informationssysteme, Problemanalysen und Lösungsansätze des Model-Driven Integration Engineering. Eigenverlag Leipziger Informatik-Verbund (LIV), Leipzig, Greenfield, J.; Short, K.: Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools. Wiley Publishing, Hänsgen, P.; Kühne, S.: Modellgetriebene Softwareentwicklung zur Lösung von Integrations- und Migrationsproblemen am Beispiel des E-Commerce-Systems Intershop Enfinity. In: [FKSW06], S KBSt: SAGA Version 2.1: Standards und Architekturen für E-Government- Anwendungen Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung (KBSt), , Abruf am Karsai, G.; Sztipanovits, J.; Ledeczi, A.; Bapty, T.: Model-integrated development of embedded software. In: Proceedings of the IEEE. 91 (2003) 1, S Kurbel, K.; Rautenstrauch, C.: Integration Engineering: Konkurrenz oder Komplement zum Information Engineering? Methodische Ansätze zur Integration von Informationssystemen. In: Heilmann, H. (Hrsg.): Information Engineering: Wirtschaftsinformatik im Schnittpunkt von Wirtschafts-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften. Oldenbourg, 1996, S Lehmann, J.; Rotzoll, W.; Kühne, S.: Analyse der E-Government-Domäne Meldewesen am Beispiel des Dienstes einfache Melderegisterauskunft. In: [FKSW06], S Lehmann, J.; Rotzoll, W.: E-Government-Dienste im Meldewesen Mecklenburg- Vorpommern. Interne Entwicklerdokumentationen, Mens, T.; Gorp, P. v.: A Taxonomy of Model Transformation. In: International Workshop on Graph and Model Transformation (GraMoT) , S
18 [Obje06] Object Management Group: Meta Object Facility (MOF) Core Specification: Version 2.0, Object Management Group, , Abruf am [ObjeoJ] Object Management Group: OMG Model Driven Architecture. Abruf am [Osci01] [Osci06] [Raut93] OSCI Leitstelle (Hrsg.): OSCI: Die informelle Beschreibung Eine Ergänzung zur OSCI Spezifikation. Technischer Bericht, summary.pdf, 2001, Abruf am Projektgruppe OSCI-XMeld (Hrsg.): OSCI XMeld Spezifikation , Abruf am Rautenstrauch, C.: Integration Engineering: Konzeption, Entwicklung und Einsatz integrierter Softwaresysteme. Addison-Wesley, [Schm06] Schmidt, D. C.: Model-Driven Engineering. In: IEEE Computer 39 (2006) 2, S [SDTK05] [StVö06] [ThKü06] Specht, T.; Drawehn, J.; Thränert, M.; Kühne, S.: Modeling Cooperative Business Processes and Transformation to a Service Oriented Architecture. In: 7th International IEEE Conference on E-Commerce Technology, 2005, S Stahl, T.; Völter, M.: Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management. Wiley Publishing, Thränert, M.; Kühne, S.: Model-Driven Integration Engineering und seine Anwendung im Projekt OrViA. In: [FKSW06], S [Thrä05] Thränert, M.: Integration Eine Begriffsbestimmung. In: [FäTW05], S [Viss01] [WeSo05] Visser, E.: A Survey of Rewriting Strategies in Program Transformation Systems. In: Electronic Notes in Theoretical Computer Science 57 (2001) 2. Wetzel, P.; Soutchilin, A.: Integration Engineering im Maschinen- und Anlagenbau. In: [FäTW05], S
Metamodellierung am Beispiel der E-Government-Domäne Meldewesen und Eclipse GMF
 Metamodellierung am Beispiel der E-Government-Domäne Meldewesen und Eclipse GMF Prof. Dr. Klaus-Peter Fähnrich Stefan Kühne, Maik Thränert, Martin Gebauer, Heiko Kern Universität Leipzig, Betriebliche
Metamodellierung am Beispiel der E-Government-Domäne Meldewesen und Eclipse GMF Prof. Dr. Klaus-Peter Fähnrich Stefan Kühne, Maik Thränert, Martin Gebauer, Heiko Kern Universität Leipzig, Betriebliche
EINFÜHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSINFORMATIK -ÜBUNGEN- Marina Tropmann-Frick mtr@is.informatik.uni-kiel.de www.is.informatik.uni-kiel.
 EINFÜHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSINFORMATIK -ÜBUNGEN- Marina Tropmann-Frick mtr@is.informatik.uni-kiel.de www.is.informatik.uni-kiel.de/~mtr FRAGEN / ANMERKUNGEN Vorlesung Neue Übungsaufgaben MODELLIERUNG
EINFÜHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSINFORMATIK -ÜBUNGEN- Marina Tropmann-Frick mtr@is.informatik.uni-kiel.de www.is.informatik.uni-kiel.de/~mtr FRAGEN / ANMERKUNGEN Vorlesung Neue Übungsaufgaben MODELLIERUNG
BPM im Kontext von Unternehmensarchitekturen. Konstantin Gress
 BPM im Kontext von Unternehmensarchitekturen Konstantin Gress Agenda 1 Worum geht s BPM, EA und SOA im Überblick 2 Link zwischen EA und BPM 3 Link zwischen SOA und BPM 4 Wie spielt das zusammen? 5 Q&A
BPM im Kontext von Unternehmensarchitekturen Konstantin Gress Agenda 1 Worum geht s BPM, EA und SOA im Überblick 2 Link zwischen EA und BPM 3 Link zwischen SOA und BPM 4 Wie spielt das zusammen? 5 Q&A
Copyright 2014 Delta Software Technology GmbH. All Rights reserved.
 Karlsruhe, 21. Mai 2014 Softwareentwicklung - Modellgetrieben und trotzdem agil Daniela Schilling Delta Software Technology GmbH The Perfect Way to Better Software Modellgetriebene Entwicklung Garant für
Karlsruhe, 21. Mai 2014 Softwareentwicklung - Modellgetrieben und trotzdem agil Daniela Schilling Delta Software Technology GmbH The Perfect Way to Better Software Modellgetriebene Entwicklung Garant für
Model Driven Development im Überblick
 Model Driven Development im Überblick Arif Chughtai Diplom-Informatiker (FH) www.digicomp-academy, Seite 1 September 05 Inhalt Motivation Überblick MDA Kleines Beispiel Werkzeuge www.digicomp-academy,
Model Driven Development im Überblick Arif Chughtai Diplom-Informatiker (FH) www.digicomp-academy, Seite 1 September 05 Inhalt Motivation Überblick MDA Kleines Beispiel Werkzeuge www.digicomp-academy,
Comparing Software Factories and Software Product Lines
 Comparing Software Factories and Software Product Lines Martin Kleine kleine.martin@gmx.de Betreuer: Andreas Wuebbeke Agenda Motivation Zentrale Konzepte Software Produktlinien Software Factories Vergleich
Comparing Software Factories and Software Product Lines Martin Kleine kleine.martin@gmx.de Betreuer: Andreas Wuebbeke Agenda Motivation Zentrale Konzepte Software Produktlinien Software Factories Vergleich
Integration mit. Wie AristaFlow Sie in Ihrem Unternehmen unterstützen kann, zeigen wir Ihnen am nachfolgenden Beispiel einer Support-Anfrage.
 Integration mit Die Integration der AristaFlow Business Process Management Suite (BPM) mit dem Enterprise Information Management System FILERO (EIMS) bildet die optimale Basis für flexible Optimierung
Integration mit Die Integration der AristaFlow Business Process Management Suite (BPM) mit dem Enterprise Information Management System FILERO (EIMS) bildet die optimale Basis für flexible Optimierung
Einführung in modellgetriebene Softwareentwicklung. 24. Oktober 2012
 Einführung in modellgetriebene Softwareentwicklung 24. Oktober 2012 Überblick Was sind die Grundprinzipien der modellgetriebenen Softwareentwicklung? Entwicklung einer MDD-Infrastruktur Modellgetriebene
Einführung in modellgetriebene Softwareentwicklung 24. Oktober 2012 Überblick Was sind die Grundprinzipien der modellgetriebenen Softwareentwicklung? Entwicklung einer MDD-Infrastruktur Modellgetriebene
Zwischenbericht der UAG NEGS- Fortschreibung
 Zwischenbericht der UAG NEGS- Fortschreibung Vorlage zur 16. Sitzung des IT-Planungsrats am 18. März 2015 Entwurf vom 29. Januar 2015 Inhaltsverzeichnis 1 Anlass für die Fortschreibung der NEGS... 3 2
Zwischenbericht der UAG NEGS- Fortschreibung Vorlage zur 16. Sitzung des IT-Planungsrats am 18. März 2015 Entwurf vom 29. Januar 2015 Inhaltsverzeichnis 1 Anlass für die Fortschreibung der NEGS... 3 2
Dr. Hanno Schauer Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur. UML-Klassendiagramme als Werkzeug im Unterricht
 Dr. Hanno Schauer Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur UML-Klassendiagramme als Werkzeug im Unterricht Blitzlicht? In welcher Programmiersprache(n) unterrichten Sie?? In welchem Umfang unterrichten Sie Objektorientierung??
Dr. Hanno Schauer Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur UML-Klassendiagramme als Werkzeug im Unterricht Blitzlicht? In welcher Programmiersprache(n) unterrichten Sie?? In welchem Umfang unterrichten Sie Objektorientierung??
Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank
 Turning visions into business Oktober 2010 Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank David Croome Warum Assessments? Ein strategisches Ziel des IT-Bereichs der Großbank
Turning visions into business Oktober 2010 Erfolgreiche ITIL Assessments mit CMMI bei führender internationaler Bank David Croome Warum Assessments? Ein strategisches Ziel des IT-Bereichs der Großbank
Was ist EMF? Wie wird EMF eingesetzt? Was ist ecore? Das Generatormodell Fazit
 Was ist EMF? Wie wird EMF eingesetzt? Was ist ecore? Das Generatormodell Fazit EMF ist ein eigenständiges Eclipse-Projekt (Eclipse Modeling Framework Project) EMF ist ein Modellierungsframework und Tool
Was ist EMF? Wie wird EMF eingesetzt? Was ist ecore? Das Generatormodell Fazit EMF ist ein eigenständiges Eclipse-Projekt (Eclipse Modeling Framework Project) EMF ist ein Modellierungsframework und Tool
UML-DSLs effizient eingesetzt. Insight 07, 13.11.2007 Klaus Weber
 UML-DSLs effizient eingesetzt Insight 07, 13.11.2007 Klaus Weber Einladung Domänenspezifische Sprachen (DSLs) sind notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer MDA-Strategie. MID favorisiert statt der
UML-DSLs effizient eingesetzt Insight 07, 13.11.2007 Klaus Weber Einladung Domänenspezifische Sprachen (DSLs) sind notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer MDA-Strategie. MID favorisiert statt der
WSO de. <work-system-organisation im Internet> Allgemeine Information
 WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
WSO de Allgemeine Information Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorwort 3 2. Mein Geschäftsfeld 4 3. Kompetent aus Erfahrung 5 4. Dienstleistung 5 5. Schulungsthemen 6
EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette
 Ausarbeitung zum Fachseminar Wintersemester 2008/09 EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette Referent: Prof. Dr. Linn Ausarbeitung: Zlatko Tadic e-mail: ztadic@hotmail.com Fachhochschule Wiesbaden Fachbereich
Ausarbeitung zum Fachseminar Wintersemester 2008/09 EPK Ereignisgesteuerte Prozesskette Referent: Prof. Dr. Linn Ausarbeitung: Zlatko Tadic e-mail: ztadic@hotmail.com Fachhochschule Wiesbaden Fachbereich
Mitteilung zur Kenntnisnahme
 17. Wahlperiode Drucksache 17/1319 14.11.2013 Mitteilung zur Kenntnisnahme Leitlinien für einen standardisierten IT-Arbeitsplatz offen und Zukunftsorientiert Drucksachen 17/1077 Neu und 17/0996 und Zwischenbericht
17. Wahlperiode Drucksache 17/1319 14.11.2013 Mitteilung zur Kenntnisnahme Leitlinien für einen standardisierten IT-Arbeitsplatz offen und Zukunftsorientiert Drucksachen 17/1077 Neu und 17/0996 und Zwischenbericht
Grundlagen Software Engineering
 Grundlagen Software Engineering Rational Unified Process () GSE: Prof. Dr. Liggesmeyer, 1 Rational Unified Process () Software Entwicklungsprozess Anpassbares und erweiterbares Grundgerüst Sprache der
Grundlagen Software Engineering Rational Unified Process () GSE: Prof. Dr. Liggesmeyer, 1 Rational Unified Process () Software Entwicklungsprozess Anpassbares und erweiterbares Grundgerüst Sprache der
Geschäftsprozessimplementierung mit BPMN, ADF und WebCenter
 Geschäftsprozessimplementierung mit BPMN, ADF und WebCenter Johannes Michler PROMATIS software GmbH Ettlingen Schlüsselworte Geschäftsprozess, Horus, SOA, BPMN, ADF, WebCenter Einleitung Die Umsetzung
Geschäftsprozessimplementierung mit BPMN, ADF und WebCenter Johannes Michler PROMATIS software GmbH Ettlingen Schlüsselworte Geschäftsprozess, Horus, SOA, BPMN, ADF, WebCenter Einleitung Die Umsetzung
4. AuD Tafelübung T-C3
 4. AuD Tafelübung T-C3 Simon Ruderich 17. November 2010 Arrays Unregelmäßige Arrays i n t [ ] [ ] x = new i n t [ 3 ] [ 4 ] ; x [ 2 ] = new i n t [ 2 ] ; for ( i n t i = 0; i < x. l e n g t h ; i ++) {
4. AuD Tafelübung T-C3 Simon Ruderich 17. November 2010 Arrays Unregelmäßige Arrays i n t [ ] [ ] x = new i n t [ 3 ] [ 4 ] ; x [ 2 ] = new i n t [ 2 ] ; for ( i n t i = 0; i < x. l e n g t h ; i ++) {
Leseprobe. Thomas Konert, Achim Schmidt. Design for Six Sigma umsetzen ISBN: 978-3-446-41230-9. Weitere Informationen oder Bestellungen unter
 Leseprobe Thomas Konert, Achim Schmidt Design for Six Sigma umsetzen ISBN: 978-3-446-41230-9 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-41230-9 sowie im Buchhandel. Carl
Leseprobe Thomas Konert, Achim Schmidt Design for Six Sigma umsetzen ISBN: 978-3-446-41230-9 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-41230-9 sowie im Buchhandel. Carl
SEA. Modellgetriebene Softwareentwicklung in der BA
 SEA Modellgetriebene Softwareentwicklung in der BA MDA bei der BA Ziele/Vorteile: für die Fachabteilung für die Systementwicklung für den Betrieb Wie wird MDA in der BA umgesetzt? Seite 2 MDA bei der BA
SEA Modellgetriebene Softwareentwicklung in der BA MDA bei der BA Ziele/Vorteile: für die Fachabteilung für die Systementwicklung für den Betrieb Wie wird MDA in der BA umgesetzt? Seite 2 MDA bei der BA
1 Mathematische Grundlagen
 Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Mathematische Grundlagen - 1-1 Mathematische Grundlagen Der Begriff der Menge ist einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik. Mengen dienen dazu, Dinge oder Objekte zu einer Einheit zusammenzufassen.
Orientierungshilfen für SAP PI (Visualisierungen)
 EINSATZFELDER FÜR DIE KONFIGURATIONS-SZENARIEN INTERNE KOMMUNIKATION UND PARTNER-KOMMUNIKATION UND DIE SERVICE-TYPEN BUSINESS-SYSTEM, BUSINESS-SERVICE UND INTEGRATIONSPROZESS Betriebswirtschaftliche Anwendungen
EINSATZFELDER FÜR DIE KONFIGURATIONS-SZENARIEN INTERNE KOMMUNIKATION UND PARTNER-KOMMUNIKATION UND DIE SERVICE-TYPEN BUSINESS-SYSTEM, BUSINESS-SERVICE UND INTEGRATIONSPROZESS Betriebswirtschaftliche Anwendungen
Model Driven Architecture Praxisbeispiel
 1 EJOSA OpenUSS CampusSource Model Driven Architecture Praxisbeispiel 2 Situation von CampusSource-Plattformen Ähnliche Funktionen (Verwaltung von Studenten und Dozenten, Diskussionsforen,...), jedoch
1 EJOSA OpenUSS CampusSource Model Driven Architecture Praxisbeispiel 2 Situation von CampusSource-Plattformen Ähnliche Funktionen (Verwaltung von Studenten und Dozenten, Diskussionsforen,...), jedoch
Standard. Individual. Migration von DOORS Classic nach DOORS Next Generation (DNG) IVS Individualisierung von Standardsoftware
 IVS Individualisierung von software Migration von DOORS Classic nach DOORS Next Generation (DNG) 2 IBM DOORS...... ist in vielen Unternehmen seit 20 Jahren im Einsatz... enthält daher oftmals hunderte
IVS Individualisierung von software Migration von DOORS Classic nach DOORS Next Generation (DNG) 2 IBM DOORS...... ist in vielen Unternehmen seit 20 Jahren im Einsatz... enthält daher oftmals hunderte
LIGHTHOUSE ist ein Erasmus+ KA2 Strategie Partnerschaftsprojekt, gefördert von der Europäischen Kommission.
 2015 1. Intellektuelle Leistung State-of-the -art-bericht zur Karriereberatung und individuellen Beratung für MigrantInnen: Kontextanalysen, Anforderungen und Empfehlungen KURZFASSUNG / DEUTSCH UNTERSTÜTZUNG
2015 1. Intellektuelle Leistung State-of-the -art-bericht zur Karriereberatung und individuellen Beratung für MigrantInnen: Kontextanalysen, Anforderungen und Empfehlungen KURZFASSUNG / DEUTSCH UNTERSTÜTZUNG
Informationswirtschaft II Rational Unified Process (RUP)
 Informationswirtschaft II Rational Unified Process (RUP) Wolfgang H. Janko, Michael Hahsler und Stefan Koch Inhalt Historische Entwicklung Kennzeichen von RUP Lebenszyklus und Phasen Arbeitsabläufe Das
Informationswirtschaft II Rational Unified Process (RUP) Wolfgang H. Janko, Michael Hahsler und Stefan Koch Inhalt Historische Entwicklung Kennzeichen von RUP Lebenszyklus und Phasen Arbeitsabläufe Das
Informationswirtschaft II
 Rational Unified Process (RUP) Informationswirtschaft II Wolfgang H. Janko, Michael Hahsler und Stefan Koch Seite 1 Inhalt Historische Entwicklung Kennzeichen von RUP Lebenszyklus und Phasen Arbeitsabläufe
Rational Unified Process (RUP) Informationswirtschaft II Wolfgang H. Janko, Michael Hahsler und Stefan Koch Seite 1 Inhalt Historische Entwicklung Kennzeichen von RUP Lebenszyklus und Phasen Arbeitsabläufe
Softwarequalität: Zusammenfassung und Ausblick. 17. Juli 2013
 Softwarequalität: Zusammenfassung und Ausblick 17. Juli 2013 Überblick Rückblick: Qualitätskriterien Qualitätsmanagement Qualitätssicherungsmaßnahmen Thesen zur Softwarequalität Ausblick: Lehrveranstaltungen
Softwarequalität: Zusammenfassung und Ausblick 17. Juli 2013 Überblick Rückblick: Qualitätskriterien Qualitätsmanagement Qualitätssicherungsmaßnahmen Thesen zur Softwarequalität Ausblick: Lehrveranstaltungen
Zum Beispiel ein Test
 Zum Beispiel ein Test Torsten Mandry OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH Gummersbach Schlüsselworte Beispiele, Specification by Example, Akzeptanztest, Lebende Spezifikation, Java Einleitung Beispiele helfen
Zum Beispiel ein Test Torsten Mandry OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH Gummersbach Schlüsselworte Beispiele, Specification by Example, Akzeptanztest, Lebende Spezifikation, Java Einleitung Beispiele helfen
1. Einleitung. 1.1 Hintergrund. 1.2 Motivation. 1.3 Forschungsansatz - These
 1. Einleitung 1.1 Hintergrund Im Rahmen der Erstellung von Prüfberichten im Kontrollamt der Stadt Wien traten seit dem Jahr 2006 verstärkt Bemühungen auf, diese mithilfe einer einheitlichen und standardisierten
1. Einleitung 1.1 Hintergrund Im Rahmen der Erstellung von Prüfberichten im Kontrollamt der Stadt Wien traten seit dem Jahr 2006 verstärkt Bemühungen auf, diese mithilfe einer einheitlichen und standardisierten
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements. von Stephanie Wilke am 14.08.08
 Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Prozessbewertung und -verbesserung nach ITIL im Kontext des betrieblichen Informationsmanagements von Stephanie Wilke am 14.08.08 Überblick Einleitung Was ist ITIL? Gegenüberstellung der Prozesse Neuer
Einführung von De-Mail im Land Bremen
 BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 18/513 Landtag 18. Wahlperiode 10.07.2012 Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU Einführung von De-Mail im Land Bremen Antwort des Senats auf die
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 18/513 Landtag 18. Wahlperiode 10.07.2012 Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU Einführung von De-Mail im Land Bremen Antwort des Senats auf die
Abschlussklausur Geschäftsprozessmodellierung und Workflowmanagement
 Abschlussklausur Geschäftsprozessmodellierung und Workflowmanagement (Wintersemester 2007/2008, Freitag, 08.02.2008, Leo18) Es können maximal 120 Punkte erreicht werden. 1 Punkt entspricht etwa einer Minute
Abschlussklausur Geschäftsprozessmodellierung und Workflowmanagement (Wintersemester 2007/2008, Freitag, 08.02.2008, Leo18) Es können maximal 120 Punkte erreicht werden. 1 Punkt entspricht etwa einer Minute
Aufgabenheft. Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Modul 32701 - Business/IT-Alignment. 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr. Univ.-Prof. Dr. U.
 Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft Aufgabenheft : Termin: Prüfer: Modul 32701 - Business/IT-Alignment 26.09.2014, 09:00 11:00 Uhr Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl Aufbau und Bewertung der Aufgabe 1 2 3 4 Summe
Test zur Bereitschaft für die Cloud
 Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
Bericht zum EMC Test zur Bereitschaft für die Cloud Test zur Bereitschaft für die Cloud EMC VERTRAULICH NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG Testen Sie, ob Sie bereit sind für die Cloud Vielen Dank, dass Sie sich
EINFÜHRUNG DER erechnung
 1 EINFÜHRUNG DER erechnung DIE VORGEHENSWEISE IM ÜBERBLICK Martin Rebs Bereichsleiter Beratung Schütze Consulting AG 28.04.2016 Juliane Mannewitz Beraterin erechnung und epayment Schütze Consulting AG
1 EINFÜHRUNG DER erechnung DIE VORGEHENSWEISE IM ÜBERBLICK Martin Rebs Bereichsleiter Beratung Schütze Consulting AG 28.04.2016 Juliane Mannewitz Beraterin erechnung und epayment Schütze Consulting AG
Übersicht. Eclipse Foundation. Eclipse Plugins & Projects. Eclipse Ganymede Simultaneous Release. Web Tools Platform Projekt. WSDL Editor.
 Eclipse WSDL-Editor Übersicht Eclipse Foundation Eclipse Plugins & Projects Eclipse Ganymede Simultaneous Release Web Tools Platform Projekt WSDL Editor Bug #237918 Eclipse Foundation Was ist Eclipse?
Eclipse WSDL-Editor Übersicht Eclipse Foundation Eclipse Plugins & Projects Eclipse Ganymede Simultaneous Release Web Tools Platform Projekt WSDL Editor Bug #237918 Eclipse Foundation Was ist Eclipse?
Generative Prozessmodelle Patrick Otto MDD Konferenz 22.03.2009
 Generative Prozessmodelle Patrick Otto MDD Konferenz 22.03.2009 Gliederung 1. Generative Programmierung 2. Möglichkeiten und Einsatzgebiet 3. Prozess / Tools 4. Zusammenfassung 19.03.2009 GENERATIVE PROGRAMMIERUNG
Generative Prozessmodelle Patrick Otto MDD Konferenz 22.03.2009 Gliederung 1. Generative Programmierung 2. Möglichkeiten und Einsatzgebiet 3. Prozess / Tools 4. Zusammenfassung 19.03.2009 GENERATIVE PROGRAMMIERUNG
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1. Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse:
 Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Informationssystemanalyse Problemstellung 2 1 Problemstellung Trotz aller Methoden, Techniken usw. zeigen Untersuchungen sehr negative Ergebnisse: große Software-Systeme werden im Schnitt ein Jahr zu spät
Referenz-Konfiguration für IP Office Server. IP Office 8.1
 Referenz-Konfiguration für IP Office Server Edition IP Office 8.1 15-604135 Dezember 2012 Inhalt Kapitel 1: Einführung... 5 Zweck des Dokuments... 5 Zielgruppe... 5 Zugehörige Dokumente... 5 Kapitel 2:
Referenz-Konfiguration für IP Office Server Edition IP Office 8.1 15-604135 Dezember 2012 Inhalt Kapitel 1: Einführung... 5 Zweck des Dokuments... 5 Zielgruppe... 5 Zugehörige Dokumente... 5 Kapitel 2:
Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante
 ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
Erhebung von Anforderungen an den Einsatz von ebusiness-standards in kleinen und mittleren Unternehmen
 Erhebung von Anforderungen an den Einsatz von ebusiness-standards in kleinen und mittleren Unternehmen Experteninterview Das Projekt in Kürze: Was nutzen ebusiness-standards? Wie können kleine und mittlere
Erhebung von Anforderungen an den Einsatz von ebusiness-standards in kleinen und mittleren Unternehmen Experteninterview Das Projekt in Kürze: Was nutzen ebusiness-standards? Wie können kleine und mittlere
MSXFORUM - Exchange Server 2003 > SMTP Konfiguration von Exchange 2003
 Page 1 of 8 SMTP Konfiguration von Exchange 2003 Kategorie : Exchange Server 2003 Veröffentlicht von webmaster am 25.02.2005 SMTP steht für Simple Mail Transport Protocol, welches ein Protokoll ist, womit
Page 1 of 8 SMTP Konfiguration von Exchange 2003 Kategorie : Exchange Server 2003 Veröffentlicht von webmaster am 25.02.2005 SMTP steht für Simple Mail Transport Protocol, welches ein Protokoll ist, womit
Vortrag von: Ilias Agorakis & Robert Roginer
 MDA Model Driven Architecture Vortrag von: Ilias Agorakis & Robert Roginer Anwendungen der SWT - WS 08/09 Inhalt Was ist MDA? Object Management Group (OMG) Ziele Konzepte der MDA Werkzeuge Vor- und Nachteile
MDA Model Driven Architecture Vortrag von: Ilias Agorakis & Robert Roginer Anwendungen der SWT - WS 08/09 Inhalt Was ist MDA? Object Management Group (OMG) Ziele Konzepte der MDA Werkzeuge Vor- und Nachteile
Requirements Engineering I
 Norbert Seyff Requirements Engineering I UML Unified Modeling Language! 2006-2012 Martin Glinz und Norbert Seyff. Alle Rechte vorbehalten. Speicherung und Wiedergabe für den persönlichen, nicht kommerziellen
Norbert Seyff Requirements Engineering I UML Unified Modeling Language! 2006-2012 Martin Glinz und Norbert Seyff. Alle Rechte vorbehalten. Speicherung und Wiedergabe für den persönlichen, nicht kommerziellen
Evaluation nach Maß. Die Evaluation des BMBF-Foresight-Prozesses
 Evaluation nach Maß Die Evaluation des BMBF-Foresight-Prozesses Beitrag zur IFQ-Jahrestagung Bonn, 1.1.008 Validität im Kontext des BMBF-Foresight-Prozesses Validität Fähigkeit eines Untersuchungsinstrumentes,
Evaluation nach Maß Die Evaluation des BMBF-Foresight-Prozesses Beitrag zur IFQ-Jahrestagung Bonn, 1.1.008 Validität im Kontext des BMBF-Foresight-Prozesses Validität Fähigkeit eines Untersuchungsinstrumentes,
Software Engineering. Sommersemester 2012, Dr. Andreas Metzger
 Software Engineering (Übungsblatt 2) Sommersemester 2012, Dr. Andreas Metzger Übungsblatt-Themen: Prinzip, Technik, Methode und Werkzeug; Arten von Wartung; Modularität (Kohäsion/ Kopplung); Inkrementelle
Software Engineering (Übungsblatt 2) Sommersemester 2012, Dr. Andreas Metzger Übungsblatt-Themen: Prinzip, Technik, Methode und Werkzeug; Arten von Wartung; Modularität (Kohäsion/ Kopplung); Inkrementelle
Projektmanagement Kapitel 3 Tools die Werkzeuge. Projektstrukturplan PSP
 Projektmanagement Projektstrukturplan Seite 1 von 6 Projektmanagement Kapitel 3 Tools die Werkzeuge Projektstrukturplan PSP 1.1 Definition Der Projektstrukturplan stellt die, aus dem Kundenvertrag geschuldete
Projektmanagement Projektstrukturplan Seite 1 von 6 Projektmanagement Kapitel 3 Tools die Werkzeuge Projektstrukturplan PSP 1.1 Definition Der Projektstrukturplan stellt die, aus dem Kundenvertrag geschuldete
Mitteilung zur Kenntnisnahme
 17. Wahlperiode Drucksache 17/1970 14.11.2014 Mitteilung zur Kenntnisnahme Lizenzmanagement Drucksache 17/0400 ( II.A.14.6) Schlussbericht Abgeordnetenhaus von Berlin 17. Wahlperiode Seite 2 Drucksache
17. Wahlperiode Drucksache 17/1970 14.11.2014 Mitteilung zur Kenntnisnahme Lizenzmanagement Drucksache 17/0400 ( II.A.14.6) Schlussbericht Abgeordnetenhaus von Berlin 17. Wahlperiode Seite 2 Drucksache
gallestro BPM - weit mehr als malen...
 Ob gallestro das richtige Tool für Ihr Unternehmen ist, können wir ohne weitere rmationen nicht beurteilen und lassen hier die Frage offen. In dieser rmationsreihe möchten wir Ihre Entscheidungsfindung
Ob gallestro das richtige Tool für Ihr Unternehmen ist, können wir ohne weitere rmationen nicht beurteilen und lassen hier die Frage offen. In dieser rmationsreihe möchten wir Ihre Entscheidungsfindung
Agile Softwareentwicklung in der Versicherungs-IT Fehlschlag oder Heilsbringer?
 OOP 2012 Agile Softwareentwicklung in der Versicherungs-IT Fehlschlag oder Heilsbringer? André Köhler Softwareforen Leipzig GmbH Geschäftsführer füh 1 Softwareforen Leipzig - Unternehmensprofil Spin-Off
OOP 2012 Agile Softwareentwicklung in der Versicherungs-IT Fehlschlag oder Heilsbringer? André Köhler Softwareforen Leipzig GmbH Geschäftsführer füh 1 Softwareforen Leipzig - Unternehmensprofil Spin-Off
Generatives Programmieren
 Generatives Programmieren Seminar Produktlinien WS03/04 Tammo van Lessen 08.01.2004 Outline Einleitung Generatoren Generatives Programmieren Fazit Einleitung Industrielle Entwicklung 1826 Austauschbare
Generatives Programmieren Seminar Produktlinien WS03/04 Tammo van Lessen 08.01.2004 Outline Einleitung Generatoren Generatives Programmieren Fazit Einleitung Industrielle Entwicklung 1826 Austauschbare
Alumnisoftware. Mit Fokus auf intuitive Bedienung und. die wesentlichen Funktionen für Ihre. Alumniarbeit, unterstützt Sie Konnekt
 Alumnisoftware Mit Fokus auf intuitive Bedienung und die wesentlichen Funktionen für Ihre Alumniarbeit, unterstützt Sie Konnekt bei Ihrem Auftritt im Internet - für mehr Kontakt zu Ihren Mitgliedern und
Alumnisoftware Mit Fokus auf intuitive Bedienung und die wesentlichen Funktionen für Ihre Alumniarbeit, unterstützt Sie Konnekt bei Ihrem Auftritt im Internet - für mehr Kontakt zu Ihren Mitgliedern und
Artenkataster. Hinweise zur Datenbereitstellung. Freie und Hansestadt Hamburg. IT Solutions GmbH. V e r s i o n 1. 0 0.
 V e r s i o n 1. 0 0 Stand Juni 2011 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt IT Solutions GmbH Artenkataster Auftraggeber Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung
V e r s i o n 1. 0 0 Stand Juni 2011 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt IT Solutions GmbH Artenkataster Auftraggeber Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung
Mehr Interaktion! Aber einfach und schnell!
 Mehr Interaktion! Aber einfach und schnell! Dirk Böning-Corterier, Oliver Meinusch DB Systel GmbH Frankfurt am Main Schlüsselworte Interaktion, Umfrage, Wand, Impulse, Voting, Abfrage, APEX Einleitung
Mehr Interaktion! Aber einfach und schnell! Dirk Böning-Corterier, Oliver Meinusch DB Systel GmbH Frankfurt am Main Schlüsselworte Interaktion, Umfrage, Wand, Impulse, Voting, Abfrage, APEX Einleitung
Vorlesung vom 18.04.2005 - Einführung in die geschäftsprozessorientierte Unternehmensführung
 Vorlesung vom 18.04.2005 - Einführung in die geschäftsprozessorientierte Unternehmensführung 08.30 Begrüßung durch Dipl.-Kfm. Björn Simon organisatorische Grundlagen der Veranstaltung (Hinweis auf obligatorische
Vorlesung vom 18.04.2005 - Einführung in die geschäftsprozessorientierte Unternehmensführung 08.30 Begrüßung durch Dipl.-Kfm. Björn Simon organisatorische Grundlagen der Veranstaltung (Hinweis auf obligatorische
BUSINESS-COACHING. für PROFESSIONALS FÜHRUNGS- UND FACHKRÄFTE, UNTERNEHMER, SELBSTSTÄNDIGE UND EXECUTIVES. Dr. Doris Ohnesorge & Ingo Kaderli
 BUSINESS-COACHING für PROFESSIONALS FÜHRUNGS- UND FACHKRÄFTE, UNTERNEHMER, SELBSTSTÄNDIGE UND EXECUTIVES Dr. Doris Ohnesorge & Ingo Kaderli Österreich: +43.664.143.1076 / Schweiz: +41.793.325.415 office@dr-ohnesorge.com
BUSINESS-COACHING für PROFESSIONALS FÜHRUNGS- UND FACHKRÄFTE, UNTERNEHMER, SELBSTSTÄNDIGE UND EXECUTIVES Dr. Doris Ohnesorge & Ingo Kaderli Österreich: +43.664.143.1076 / Schweiz: +41.793.325.415 office@dr-ohnesorge.com
SWOT-Analyse. Der BABOK V2.0 (Business Analysis Body Of Knowledge) definiert die SWOT-Analyse wie folgt:
 SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
SWOT-Analyse Die SWOT-Analyse stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und wurde in den 1960er-Jahren von der Harvard Business School zur Anwendung in Unternehmen vorgeschlagen. Die SWOT-Analyse
DAS WEBBASIERTE WAFFENVERWALTUNGSSYSTEM
 DAS WEBBASIERTE WAFFENVERWALTUNGSSYSTEM Inhaltsverzeichnis Seite Neue Gesetze, neuer Schwung 5 Warum citkowaffe? Die Vorteile auf einen Blick 7 Sicherer Betrieb der Anwendung 9 Zentraler Betrieb der Schnittstellen
DAS WEBBASIERTE WAFFENVERWALTUNGSSYSTEM Inhaltsverzeichnis Seite Neue Gesetze, neuer Schwung 5 Warum citkowaffe? Die Vorteile auf einen Blick 7 Sicherer Betrieb der Anwendung 9 Zentraler Betrieb der Schnittstellen
Workflow, Business Process Management, 4.Teil
 Workflow, Business Process Management, 4.Teil 24. Januar 2004 Der vorliegende Text darf für Zwecke der Vorlesung Workflow, Business Process Management des Autors vervielfältigt werden. Eine weitere Nutzung
Workflow, Business Process Management, 4.Teil 24. Januar 2004 Der vorliegende Text darf für Zwecke der Vorlesung Workflow, Business Process Management des Autors vervielfältigt werden. Eine weitere Nutzung
1. In welchen Prozess soll LPA eingeführt werden und warum? (Auslöser und Prozess)
 Name: Leitfragen zur Einführung von Layered Process Audit 1. In welchen Prozess soll LPA eingeführt werden und warum? (Auslöser und Prozess) a. Welche Prozesse oder auch Produkte könnten durch die Einführung
Name: Leitfragen zur Einführung von Layered Process Audit 1. In welchen Prozess soll LPA eingeführt werden und warum? (Auslöser und Prozess) a. Welche Prozesse oder auch Produkte könnten durch die Einführung
DAS TEAM MANAGEMENT PROFIL IM ÜBERBLICK. Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam.
 Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
Marketingmaßnahmen effektiv gestalten
 Marketingmaßnahmen effektiv gestalten WARUM KREATIVE LEISTUNG UND TECHNISCHE KOMPETENZ ZUSAMMENGEHÖREN Dr. Maik-Henrik Teichmann Director Consulting E-Mail: presseservice@cocomore.com Um digitale Marketingmaßnahmen
Marketingmaßnahmen effektiv gestalten WARUM KREATIVE LEISTUNG UND TECHNISCHE KOMPETENZ ZUSAMMENGEHÖREN Dr. Maik-Henrik Teichmann Director Consulting E-Mail: presseservice@cocomore.com Um digitale Marketingmaßnahmen
Themen. Web Services und SOA. Stefan Szalowski Daten- und Online-Kommunikation Web Services
 Themen Web Services und SOA Wer kennt den Begriff Web Services? Was verstehen Sie unter Web Services? Die Idee von Web Services Ausgangspunkt ist eine (evtl. schon bestehende) Software Anwendung oder Anwendungskomponente
Themen Web Services und SOA Wer kennt den Begriff Web Services? Was verstehen Sie unter Web Services? Die Idee von Web Services Ausgangspunkt ist eine (evtl. schon bestehende) Software Anwendung oder Anwendungskomponente
Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz
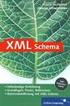 Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Anwendungshandbuch Vorgaben und Erläuterungen zu den XML-Schemata im Bahnstromnetz Version: 1.0 Herausgabedatum: 31.07.2015 Ausgabedatum: 01.11.2015 Autor: DB Energie http://www.dbenergie.de Seite: 1 1.
Bildungsstandards konkret formulierte Lernergebnisse Kompetenzen innen bis zum Ende der 4. Schulstufe in Deutsch und Mathematik
 Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden,
 Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
Softwareentwicklungspraktikum Sommersemester 2007. Grobentwurf
 Softwareentwicklungspraktikum Sommersemester 2007 Grobentwurf Auftraggeber Technische Universität Braunschweig
Softwareentwicklungspraktikum Sommersemester 2007 Grobentwurf Auftraggeber Technische Universität Braunschweig
Dokumentation. Black- und Whitelists. Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser
 Dokumentation Black- und Whitelists Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser Inhalt INHALT 1 Kategorie Black- und Whitelists... 2 1.1 Was sind Black- und Whitelists?...
Dokumentation Black- und Whitelists Absenderadressen auf eine Blacklist oder eine Whitelist setzen. Zugriff per Webbrowser Inhalt INHALT 1 Kategorie Black- und Whitelists... 2 1.1 Was sind Black- und Whitelists?...
Product Line Engineering (PLE)
 Product Line Engineering (PLE) Produktlinienentwicklung Von Christoph Kuberczyk Christoph Kuberczyk, SE in der Wissenschaft 2015, Product Line Engineering 1 Gliederung 1. Was ist PLE? 2. Motivation 3.
Product Line Engineering (PLE) Produktlinienentwicklung Von Christoph Kuberczyk Christoph Kuberczyk, SE in der Wissenschaft 2015, Product Line Engineering 1 Gliederung 1. Was ist PLE? 2. Motivation 3.
Übersicht über SLA4D-Grid &! Ziele des Workshops
 Service Level Agreements for D-Grid Übersicht über SLA4D-Grid &! Ziele des Workshops Philipp Wieder, TU Dortmund Service Level Agreement Workshop 3. September 2009 http://www.sla4d-grid.de Inhalt Übersicht
Service Level Agreements for D-Grid Übersicht über SLA4D-Grid &! Ziele des Workshops Philipp Wieder, TU Dortmund Service Level Agreement Workshop 3. September 2009 http://www.sla4d-grid.de Inhalt Übersicht
Den Unterschied machen Ein Leitfaden für IT- Entscheider in Versicherungsunternehmen
 Den Unterschied machen Ein Leitfaden für IT- Entscheider in Versicherungsunternehmen Den Unterschied machen Ein Leitfaden für IT- Entscheider in Versicherungsunternehmen Das Asskura- Modell ist ein Werkzeug,
Den Unterschied machen Ein Leitfaden für IT- Entscheider in Versicherungsunternehmen Den Unterschied machen Ein Leitfaden für IT- Entscheider in Versicherungsunternehmen Das Asskura- Modell ist ein Werkzeug,
etutor Benutzerhandbuch XQuery Benutzerhandbuch Georg Nitsche
 etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
etutor Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch XQuery Georg Nitsche Version 1.0 Stand März 2006 Versionsverlauf: Version Autor Datum Änderungen 1.0 gn 06.03.2006 Fertigstellung der ersten Version Inhaltsverzeichnis:
Requirements Engineering für IT Systeme
 Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
Requirements Engineering für IT Systeme Warum Systemanforderungen mit Unternehmenszielen anfangen Holger Dexel Webinar, 24.06.2013 Agenda Anforderungsdefinitionen Von der Herausforderung zur Lösung - ein
INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN CUSTOMSOFT CS GMBH
 01 INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN 02 05 02 GUMMERSBACH MEHRWERT DURCH KOMPETENZ ERIC BARTELS Softwarearchitekt/ Anwendungsentwickler M_+49 (0) 173-30 54 146 F _+49 (0) 22 61-96 96 91 E _eric.bartels@customsoft.de
01 INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN 02 05 02 GUMMERSBACH MEHRWERT DURCH KOMPETENZ ERIC BARTELS Softwarearchitekt/ Anwendungsentwickler M_+49 (0) 173-30 54 146 F _+49 (0) 22 61-96 96 91 E _eric.bartels@customsoft.de
Produktskizze. 28. November 2005 Projektgruppe Syspect
 28. November 2005 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät II Department für Informatik Abteilung Entwicklung korrekter Systeme Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Die graphische Oberfläche der
28. November 2005 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät II Department für Informatik Abteilung Entwicklung korrekter Systeme Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 2 Die graphische Oberfläche der
Ein Beispiel. Ein Unternehmen will Internettechnologien im Rahmen des E- Business nutzen Welche Geschäftsprozesse?
 Ein Beispiel Ein Unternehmen will Internettechnologien im Rahmen des E- Business nutzen Welche Geschäftsprozesse? Dipl.-Kfm. Claus Häberle WS 2015 /16 # 42 XML (vereinfacht) visa
Ein Beispiel Ein Unternehmen will Internettechnologien im Rahmen des E- Business nutzen Welche Geschäftsprozesse? Dipl.-Kfm. Claus Häberle WS 2015 /16 # 42 XML (vereinfacht) visa
arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek
 arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek Speaker Andreas Holubek VP Engineering andreas.holubek@arlanis.com arlanis Software AG, D-14467 Potsdam 2009, arlanis
arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek Speaker Andreas Holubek VP Engineering andreas.holubek@arlanis.com arlanis Software AG, D-14467 Potsdam 2009, arlanis
Gefährdungsbeurteilungen im Bereich der Elektrotechnik
 Gefährdungsbeurteilungen im Bereich der Elektrotechnik Grundlagen der Gefährdungsbeurteilungsthematik im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel: Strukturierung, Zuständigkeiten, Verfahren, praktische
Gefährdungsbeurteilungen im Bereich der Elektrotechnik Grundlagen der Gefährdungsbeurteilungsthematik im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel: Strukturierung, Zuständigkeiten, Verfahren, praktische
Semantic Web Technologies I! Lehrveranstaltung im WS10/11! Dr. Andreas Harth! Dr. Sebastian Rudolph!
 Semantic Web Technologies I! Lehrveranstaltung im WS10/11! Dr. Andreas Harth! Dr. Sebastian Rudolph! www.semantic-web-grundlagen.de Ontology Engineering! Dr. Sebastian Rudolph! Semantic Web Architecture
Semantic Web Technologies I! Lehrveranstaltung im WS10/11! Dr. Andreas Harth! Dr. Sebastian Rudolph! www.semantic-web-grundlagen.de Ontology Engineering! Dr. Sebastian Rudolph! Semantic Web Architecture
Grundlagen verteilter Systeme
 Universität Augsburg Insitut für Informatik Prof. Dr. Bernhard Bauer Wolf Fischer Christian Saad Wintersemester 08/09 Übungsblatt 3 12.11.08 Grundlagen verteilter Systeme Lösungsvorschlag Aufgabe 1: a)
Universität Augsburg Insitut für Informatik Prof. Dr. Bernhard Bauer Wolf Fischer Christian Saad Wintersemester 08/09 Übungsblatt 3 12.11.08 Grundlagen verteilter Systeme Lösungsvorschlag Aufgabe 1: a)
Bundeskanzlei BK Programm GEVER Bund. als Basis für GEVER. 29. November 2012
 Bundeskanzlei BK Programm GEVER Bund Geschäftsprozesse als Basis für GEVER 29. November 2012 Zielsetzung der Präsentation Sie erhalten einen Überblick über den Stand der Entwicklung von GEVER als Geschäftsverwaltungssystem
Bundeskanzlei BK Programm GEVER Bund Geschäftsprozesse als Basis für GEVER 29. November 2012 Zielsetzung der Präsentation Sie erhalten einen Überblick über den Stand der Entwicklung von GEVER als Geschäftsverwaltungssystem
Entwicklung domänenspezifischer Software
 Entwicklung domänenspezifischer Software Dargestellt am Beispiel des Prozessmanagements Von der Universität Bayreuth zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte
Entwicklung domänenspezifischer Software Dargestellt am Beispiel des Prozessmanagements Von der Universität Bayreuth zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte
Systemen im Wandel. Autor: Dr. Gerd Frenzen Coromell GmbH Seite 1 von 5
 Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Das Management von Informations- Systemen im Wandel Die Informations-Technologie (IT) war lange Zeit ausschließlich ein Hilfsmittel, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Personal einzusparen. Sie hat
Wo sind meine Anforderungen?
 Whitepaper Telekommunikation Wo sind meine Anforderungen? Eine effektive Lösung auf Basis von Confluence und JIRA 2011 SYRACOM AG 1 Einleitung Erfahrene Projektmitarbeiter sehen sich oftmals im Projektalltag
Whitepaper Telekommunikation Wo sind meine Anforderungen? Eine effektive Lösung auf Basis von Confluence und JIRA 2011 SYRACOM AG 1 Einleitung Erfahrene Projektmitarbeiter sehen sich oftmals im Projektalltag
Organisation des Qualitätsmanagements
 Organisation des Qualitätsmanagements Eine zentrale Frage für die einzelnen Funktionen ist die Organisation dieses Bereiches. Gerade bei größeren Organisationen Für seine Studie mit dem Titel Strukturen
Organisation des Qualitätsmanagements Eine zentrale Frage für die einzelnen Funktionen ist die Organisation dieses Bereiches. Gerade bei größeren Organisationen Für seine Studie mit dem Titel Strukturen
Transparente SOA Governance mit Modellierung. OOP 2010 München, 28. Januar 2010, 12:30 Uhr Modeling Day
 Transparente SOA Governance mit Modellierung OOP 2010 München, 28. Januar 2010, 12:30 Uhr Modeling Day I N H A L T 1. SOA Governance 2. Service Repositories 3. SOA Governance mit Modellen I N H A L T 1.
Transparente SOA Governance mit Modellierung OOP 2010 München, 28. Januar 2010, 12:30 Uhr Modeling Day I N H A L T 1. SOA Governance 2. Service Repositories 3. SOA Governance mit Modellen I N H A L T 1.
Version smarter mobile(zu finden unter Einstellungen, Siehe Bild) : Gerät/Typ(z.B. Panasonic Toughbook, Ipad Air, Handy Samsung S1):
 Supportanfrage ESN Bitte füllen Sie zu jeder Supportanfrage diese Vorlage aus. Sie helfen uns damit, Ihre Anfrage kompetent und schnell beantworten zu können. Verwenden Sie für jedes einzelne Thema jeweils
Supportanfrage ESN Bitte füllen Sie zu jeder Supportanfrage diese Vorlage aus. Sie helfen uns damit, Ihre Anfrage kompetent und schnell beantworten zu können. Verwenden Sie für jedes einzelne Thema jeweils
Christian Kühnel, BMW Group AGILE ENTWICKLUNG VON FAHRERASSISTENZSOFTWARE. AGILE CARS 2014.
 Christian Kühnel, BMW Group AGILE ENTWICKLUNG VON FAHRERASSISTENZSOFTWARE. AGILE CARS 2014. PROJEKT ÜBERBLICK Entwicklung von Fahrerassistenz-Software zur Vorverarbeitung und Fusion von Sensordaten aus
Christian Kühnel, BMW Group AGILE ENTWICKLUNG VON FAHRERASSISTENZSOFTWARE. AGILE CARS 2014. PROJEKT ÜBERBLICK Entwicklung von Fahrerassistenz-Software zur Vorverarbeitung und Fusion von Sensordaten aus
12Amt für Informationstechnik
 12Amt für Informationstechnik und Statistik 29 Dienstleister für Vernetzung Die Aufgabenbereiche des Amtes für Informationstechnik und Statistik sind bereits aus der Namensgebung zu erkennen. Der Informationstechnik
12Amt für Informationstechnik und Statistik 29 Dienstleister für Vernetzung Die Aufgabenbereiche des Amtes für Informationstechnik und Statistik sind bereits aus der Namensgebung zu erkennen. Der Informationstechnik
Forschungsprofil des Lehrstuhls Technologie- und Innovationsmanagement
 Forschungsprofil des Lehrstuhls Technologie- und Innovationsmanagement Geschäftsmodellinnovationen Embedded Systems Wahrnehmung von Technologien Neue Medien im Innovationsmanagement E-Mobility Lehrstuhl
Forschungsprofil des Lehrstuhls Technologie- und Innovationsmanagement Geschäftsmodellinnovationen Embedded Systems Wahrnehmung von Technologien Neue Medien im Innovationsmanagement E-Mobility Lehrstuhl
Das Metamodell der UML und in FUJABA. Vortrag von Alexander Geburzi
 Das Metamodell der UML und in FUJABA Vortrag von Alexander Geburzi Gliederung Metamodellierung Metamodell der UML Metamodell in FUJABA Metamodellierung - Metamodell der UML - Metamodell in FUJABA 2/20
Das Metamodell der UML und in FUJABA Vortrag von Alexander Geburzi Gliederung Metamodellierung Metamodell der UML Metamodell in FUJABA Metamodellierung - Metamodell der UML - Metamodell in FUJABA 2/20
Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum
 C A R L V O N O S S I E T Z K Y Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum Johannes Diemke Vortrag im Rahmen der Projektgruppe Oldenburger Robot Soccer Team im Wintersemester 2009/2010 Was
C A R L V O N O S S I E T Z K Y Agile Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung: Scrum Johannes Diemke Vortrag im Rahmen der Projektgruppe Oldenburger Robot Soccer Team im Wintersemester 2009/2010 Was
INNOVATOR im Entwicklungsprozess
 Erfahrungsbericht INNOVATOR im Entwicklungsprozess Basis für Host- und Java-Anwendungen Dr. Carl-Werner Oehlrich, Principal Consultant MID GmbH Das Modellierungswerkzeug INNOVATOR Geschäftsprozess-Modellierung
Erfahrungsbericht INNOVATOR im Entwicklungsprozess Basis für Host- und Java-Anwendungen Dr. Carl-Werner Oehlrich, Principal Consultant MID GmbH Das Modellierungswerkzeug INNOVATOR Geschäftsprozess-Modellierung
Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1. Analyse Design Implementierung. Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse abgedeckt
 Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1 Einordnung der Veranstaltung Analyse Design Implementierung Slide 1 Informationssystemanalyse Objektorientierter Software-Entwurf Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse
Objektorientierter Software-Entwurf Grundlagen 1 1 Einordnung der Veranstaltung Analyse Design Implementierung Slide 1 Informationssystemanalyse Objektorientierter Software-Entwurf Frühe Phasen durch Informationssystemanalyse
EAM Ein IT-Tool? MID Insight 2013. Torsten Müller, KPMG Gerhard Rempp, MID. Nürnberg, 12. November 2013
 EAM Ein IT-Tool? MID Insight 2013 Torsten Müller, KPMG Gerhard Rempp, MID Nürnberg, 12. November 2013 ! Wo wird EA eingesetzt? Welchen Beitrag leistet EA dabei? Was kann EAM noch? Ist EAM nur ein IT-Tool?
EAM Ein IT-Tool? MID Insight 2013 Torsten Müller, KPMG Gerhard Rempp, MID Nürnberg, 12. November 2013 ! Wo wird EA eingesetzt? Welchen Beitrag leistet EA dabei? Was kann EAM noch? Ist EAM nur ein IT-Tool?
IVS Arbeitsgruppe Softwaretechnik Abschnitt 3.3.1 Management komplexer Integrationslösungen
 Vorlesung - IVS Arbeitsgruppe Softwaretechnik Abschnitt 3.3.1 Management komplexer Integrationslösungen Seite 1 Typische Situation in Integrationsprojekten Verwendung komplexer und teuerer Integrationsframeworks.
Vorlesung - IVS Arbeitsgruppe Softwaretechnik Abschnitt 3.3.1 Management komplexer Integrationslösungen Seite 1 Typische Situation in Integrationsprojekten Verwendung komplexer und teuerer Integrationsframeworks.
Phasen und Tätigkeiten des Produktlebenszyklus
 Wirtschaftsinformatik III - PLM Rechnerpraktikum Produktstrukturen Dokumentenmanagement 13. Januar 2011 Phasen und Tätigkeiten des Produktlebenszyklus 2 Produktdatenentstehung Daten im Produkt- lebenszyklus
Wirtschaftsinformatik III - PLM Rechnerpraktikum Produktstrukturen Dokumentenmanagement 13. Januar 2011 Phasen und Tätigkeiten des Produktlebenszyklus 2 Produktdatenentstehung Daten im Produkt- lebenszyklus
