144. Kommunikationstraining. Abstract Kommunikationstraining 2387
|
|
|
- Ralf Brinkerhoff
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 144. Kommunikationstraining Kommunikationstraining 1. Rhetorik und Kommunikationstrainings 2. Das Feld der Kommunikationstrainings 3. Kommunikationsberatung und -training auf gesprächsanalytischer Basis 4. Literatur (in Auswahl) Abstract Section 1 discusses the pedagogical influence on and development of the communicative abilities of native speakers within the theory and practice of contemporary rhetoric. Section 2 provides a short overview of the diversity of communication training courses as a special form o f applied rhetoric. Ten criteria are described by which communication training programs can be differentiated. Finally, Section 3 exemplifies the structure, methodology and eff iciency of communication training courses based on conversation analysis.
2 2388 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte 1. Rhetorik und Kommunikationstrainings In Gestalt der klassischen Rhetorik setzt sich eine Auffassung durch, die kommunikative Fähigkeiten nicht länger als natürliche Ausstattung oder als ausschließlich naturwüchsig sich veränderndes Vermögen des Menschen sieht, sondern sie in Analogie zu anderen menschlichen Fähigkeiten als durch gezielte Maßnahmen beeinflussbare, veränderbare und entwickelbare Fähigkeiten versteht. Zunächst auf die Kommunikationsform der Rede beschränkt wird in der Geschichte der Rhetorik diese Auffassung generalisiert und auf eine Vielzahl anderer kommunikativer Formen und Fähigkeiten erweitert. Neben den Erwerb und die Veränderung von Kommunikations- und Gesprächsfähigkeiten in der Kommunikationspraxis selbst tritt damit das Programm eines systematischen Lehrens und Lernens dieser Fähigkeiten. Aus heutiger Perspektive umfasst Rhetorik sowohl die Praxis wie auch die Theorie der angeleiteten, systematischen Beeinflussung, Veränderung und Entwicklung muttersprachlicher kommunikativer Fähigkeiten. Unterschieden wird dabei zwischen der praktischen bzw. angewandten Rhetorik als konkreter Praxis der Schulung und Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten und der theoretischen Rhetorik als wissenschaftlicher Reflexion darüber, wie das Lehren und Lernen von Kommunikation am besten zu bewerkstelligen sei. Die praktische Absicht ist dabei für die theoretische Rhetorik konstitutiv. Das heutige Verständnis von Rhetorik umfasst sowohl den Erwerb neuer wie auch die Veränderung vorhandener kommunikativer Fähigkeiten (Optimierung, Umlernen). Es bezieht sich auf alle kommunikativen Formen und Fähigkeiten, sofern ihr Erwerb und ihre Entwicklung auf angeleitete und systematische Weise erfolgt. Ausgeschlossen aus dem Bereich der Rhetorik sind nach diesem Verständnis Prozesse des ungesteuerten Erwerbs bzw. der natürlichen Veränderung kommunikativer Fähigkeiten. Auch der gesteuerte oder ungesteuerte Erwerb kommunikativer Fähigkeiten in einer Fremdsprache ist nicht ihr Gegenstand. Die Aufgaben der theoretischen Rhetorik werden gegenwärtig nicht von einer einzelnen, einheitlichen wissenschaftlichen Disziplin bearbeitet, sondern sie werden mit unterschiedlicher Perspektive von verschiedenen Wissenschaften wahrgenommen. Dies reicht von der Disziplin Rhetorik, soweit sie an den Universitäten vertreten ist, über die Psychologie zur Pädagogik und Sprechwissenschaft bis hin zur Linguistik, insbesondere in Gestalt der angewandten Gesprächsforschung. Die Reflexion darüber, wie Kommunikations- und Gesprächsfähigkeiten systematisch entwickelt werden können, firmiert in diesen Disziplinen außer unter Rhetorik auch unter Begriffen wie Gesprächspädagogik (Allhoff 1992), -erziehung (Vogt 1995), -didaktik (Vogt 1997), Didaktik der mündlichen Kommunikation (Pabst-Weinschenk 1994; Grünwaldt 1998), Didaktik rhetorischer Kommunikation (Bartsch 1998), Förderung von Gesprächsfähigkeiten (Neuland 1995; Fiehler 1998) bzw. Gesprächskultur (Neuland 1996) oder Gesprächsrhetorik (Kallmeyer 1996). Die praktische bzw. angewandte Rhetorik wird in vielen gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen praktiziert. Sie erfolgt in Form von verschiedenartigsten Kursen, Seminaren und Trainings, durch verschiedene Formen von Beratung (z. B. als Coaching) oder durch das Selbststudium entsprechender Ratgeberliteratur (vgl. Bremerich-Vos 1991 und Antos 1996). Gegenstand der folgenden Ausführungen ist die praktische Rhetorik in Form von Kommunikationstrainings, die auf den Erwerb oder die Entwicklung von Formen und Fähigkeiten des mündlichen Kommunizierens abzielen.
3 144. Kommunikationstraining Das Feld der Kommunikationstrainings Auf dem wachsenden Feld der Kommunikationstrainings, das zugleich auch ein riesiger Markt ist, treffen sich die verschiedensten Personen, Konzeptionen und Disziplinen mit einem breiten und differenzierten Angebot. Dies reicht von der Psychologie und therapeutischen Konzepten (Gesprächstherapie, Transaktionsanalyse, Neurolinguistisches Programmieren etc.) über die Neue Rhetorik, Sprechwissenschaft (Geißner 1982), Dialoganalyse (Weigand 1994), Gesprächsrhetorik (Kallmeyer 1996) und angewandte Gesprächsforschung bis hin zur praktischen Rhetorik in ihren allgemeinen und sektoralen Spielarten (vgl. auch Bartsch 1998). Die angeleitete, systematische Entwicklung von muttersprachlichen Kommunikations- und Gesprächsfähigkeiten erfolgt dabei - mit und ohne Bezug auf den Begriff Rhetorik - aus vielfältigen Motiven und in den verschiedensten Zusammenhängen. Fragt man nach den Motiven, so sind es vor allem tatsächliche und vermeintliche Sprach- und Kommunikationsprobleme, wie viele Menschen sie im beruflichen, öffentlichen und privaten Bereich erleben, die zu einer gewaltigen gesellschaftlichen Nachfrage nach Kommunikationstrainings führen (Antos 1996). Diese Probleme resultieren vor allem aus den steigenden kommunikativen Anforderungen, die die gesellschaftliche Differenzierung mit sich bringt, und aus dem Umgang mit neuen Kommunikationstechnologien. So wächst der Anteil kommunikationsintensiver Berufe beständig. Kommunikation hat sich zu einer zentralen Produktivkraft und Kommunikationsfähigkeit zu einer gesellschaftlichen Schlüsselqualifikation entwickelt. Kommunikationstrainings finden in verschiedenen Zusammenhängen statt. Sie sind hauptsächlich in der beruflichen Aus- und Weiterbildung vieler Institutionen für die jeweiligen kommunikationsintensiven Berufe platziert. Sie werden aber auch auf private Initiative im Rahmen der Freizeit besucht (z. B. entsprechende Volkshochschulkurse oder kommerzielle Seminare). Die angebotenen Kommunikationstrainings unterscheiden sich in einer Vielzahl von Dimensionen: (1) Zielsetzung: Häufig genannte Ziele für Kommunikationstrainings sind der Erwerb bzw. die Weiterentwicklung berufsnotwendiger kommunikativer Fähigkeiten, das Erkennen, Überwinden und Vermeiden von Kommunikationsproblemen, Persönlichkeitsentwicklung oder der Erwerb von Möglichkeiten, andere zu beeinflussen und zu manipulieren. (2) Diagnose- vs. Therapieorientierung: Die Schwerpunktsetzung der Schulungen kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein: Es kann ein analytisches und deskriptives Interesse in Hinblick auf die Herausarbeitung und Beschreibung von bestehenden Kommunikationsproblemen überwiegen (bei zum Teil unspezifischen Vorstellungen über Veränderungsmöglichkeiten und -wege) oder die Absicht und die Praxis der Veränderung im Vordergrund stehen. (3) Persönlichkeits- vs. Verhaltensorientierung: Ein nächster Unterschied besteht im Ansatzpunkt: Wird eine Veränderung der Persönlichkeit (ihrer psychischen Struktur, Dispositionen, Einstellungen etc.) angestrebt (wobei Veränderungen des Kommunikationsverhaltens dann mittelbar eintreten, aber in Umfang und Richtung nicht genau bestimmt oder geplant werden können) oder zielt das Training unmittelbar auf Veränderungen des Kommunikationsverhaltens? (4) Empirie: Unterschiedlich ist auch das Verhältnis und der Zugang zur Realität des Kommunizierens. Woher stammt das Wissen über vorhandene kommunikative Fä-
4 2390 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte higkeiten bei den Teilnehmer/innen, über Kommunikationsprobleme und über Veränderungsnotwendigkeiten? Wie wird es gewonnen? Die drei wesentlichen Zugangsformen sind hier ein Sich-Stützen auf akkumuliertes Erfahrungswissen, die Simulation von Kommunikationssituationen in Rohenspielen und die Verwendung von authentischen Gesprächsaufzeichnungen. (5) Idealvorstellung von Kommunikation: Unterschiede bestehen auch in den Idealvorstellungen von Kommunikation und den daraus abgeleiteten Zielsetzungen: Wie soll Kommunikation sein? Was ist ein gutes, angemessenes, effektives etc. Kommunikationsverhalten? Geht es vorrangig um das gemeinschaftliche Erreichen von Zielen oder um das kommunikative Durchsetzen eigener Interessen? In welche Richtung soll das Kommunikationsverhalten durch das Training verändert werden? (6) Konzeptualisierung von Kommunikation: Unterschiedlich sind ferner die grundlegenden Sichtweisen und Auffassungen davon, was Kommunikation ist und wie sie funktioniert. So kann Kommunikation als eine dem Menschen äußerliche, instrumentehe Fähigkeit bzw. Technik verstanden werden (etwa wie das Binden einer Schuhschleife oder das Autofahren), aber auch als tief in der Persönlichkeitsstruktur verankerte, individuell-spezifische Form der Entäußerung und des Weltbezugs. Beide Konzeptualisierungen implizieren unterschiedliche Auffassungen über die Veränderbarkeit und Schulbarkeit von Kommunikation (bzw. den hierfür erforderlichen Aufwand). Sie bedingen zugleich auch eine unterschiedliche Praxis der Veränderung von Kommunikationsverhalten. Verschiedene grundlegende Konzeptualisierungen von Kommunikation manifestieren sich auch in zentralen Maximen und Modellen (z. B. Jeder mehrt nur seinen eigenen Nutzen; Die wahren Absichten werden nicht geäußert, Sender/Empfänger-Modell, 4-Ohren-Modeh der Kommunikation, Sach- und Beziehungsebene der Kommunikation, Kommunikation als Interaktion). Zum Teil basieren diese grundlegenden Auffassungen auf bestimmten Sprach- bzw. Kommunikationstheorien. (7) Bezugstheorien: Sofern überhaupt systematisch auf (sprach)wissenschaftliche Theorien rekurriert wird, kann auf unterschiedliche Theorien Bezug genommen werden: Sprachwirkungsforschung, Sprechakttheorie, Nonverbale Kommunikation, Rhetorik, Gesprächsanalyse etc. (8) Gegenstand: Das Training kann auf kommunikative Fähigkeiten verschiedener Ebenen gerichtet sein: (a) den Erwerb bzw. die Optimierung bestimmter Gesprächsformen oder -typen (z. B. eine Rede halten, Verkaufsgespräche führen, eine Besprechung leiten etc.), (b) den Erwerb bzw. die Optimierung der Fähigkeiten zur Bearbeitung lokaler Gesprächsaufgaben (z. B. dem anderen zuhören, sich angemessen einbringen, den anderen ausreden lassen, auf frühere Beiträge eingehen, einen Konflikt austragen etc.) und/oder (c) die sprachliche und sprecherische Gestaltung der Gesprächsbeiträge (z. B. Argumentiere im Fünfsatz, Sprich in ganzen Sätzen, Vermeide ähs etc.). (9) Lehren von Kommunikation: Trainings unterscheiden sich hinsichtlich der Auffassungen, was es heißt, Veränderungen von Kommunikationsverhalten zu lehren, und wie man es macht (Fiehler 2002a). D. h. es bestehen didaktische und vor allem methodische Unterschiede. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang sind Unterschiede, woher Trainer/innen wissen und wie sicher sie sich sind, was richtig ist (Präskription vs. Explikation von Alternativen).
5 144. Kommunikationstraining 2391 (10) Lernen von Kommunikation: Unterschiede bestehen letztlich auch in den Auffassungen, was Kommunikationslernen bzw. -umlernen heißt. Wie schwierig ist es? Wie viel Aufwand muss betrieben werden? Welche Methoden sind geeignet? Wann kann man sicher sein, dass etwas gelernt wurde? Reicht einmaliges Lernen oder muss regelmäßig,trainiert4werden? etc. (Hartung 2004a; Mönnich 2004). Die Vielfalt der Ansätze zur Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten belegt, dass es eine breite und differenzierte Praxis von Kommunikationsberatung und -training gibt (vgl. Brünner/Fiehler 2002), sie belegt aber zugleich auch, dass eine konsistente oder gar konsensuelle Theorie des Fehrens und Fernens von Kommunikation bisher nicht vorliegt. Im Folgenden sollen am Beispiel gesprächsanalytisch fundierter Kommunikationstrainings die Grundlagen und die Methodik dieser speziellen Trainingsform dargestellt werden. Dabei wird zugleich verdeutlicht, wo gesprächsanalytisch fundierte Trainings auf den zehn genannten Varianzdimensionen verortet sind. In allgemeiner Hinsicht versteht die Gesprächsforschung Kommunikation und Gespräche als eine gemeinsame Hervorbringung, deren Verlauf und Resultate nicht nur von einer Seite determiniert werden. Gesprächsanalytisch fundierte Trainings zielen ab auf eine gemeinsam bestimmte Kommunikation, die möglichst wenig durch Kommunikationsprobleme belastet ist. Die Teilnehmer/innen sollen befähigt werden, im Vollzug der Kommunikation solche Probleme zu erkennen und sie zu vermeiden. Sofern Kommunikationsprobleme eingetreten sind, sollen sie in der Fage sein, sie zu lösen. 3. Kommunikationsberatung und -training auf gesprächsanalytischer Basis Betrachtet man das Feld der praktischen Rhetorik genauer, so muss man feststellen, dass linguistisches Wissen über Kommunikation und Gespräche in den gängigen Formen von Beratung und Training kaum eine Rolle spielt und dass es auch nur in Ausnahmefällen Finguist/innen sind, die in diesem Feld hauptberuflich arbeiten (vgl. Hess-Füttich 1991; Hartig 1994; Brünner/Fiehler 2002; zur historischen Dimension des Verhältnisses von praktischer Rhetorik und Sprachwissenschaft vgl. Cherubim 1992). Dies ist verwunderlich, da die Analyse von Kommunikationsprozessen zum genuinen Gegenstand der Finguistik gehört und keine andere Disziplin über ein so breites und empirisch fundiertes Wissen über Kommunikation und Gespräche verfügt wie die Gesprächsforschung. Im Folgenden sollen das Verhältnis von Gesprächsforschung und Anwendung umrissen (3.1.) und die Methodik einer gesprächsanalytisch fundierten Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten skizziert werden (3.2.). Sodann werden Felder benannt, in denen die angewandte Gesprächsforschung tätig war und ist (3.3.) und die Besonderheiten der gesprächsanalytisch fundierten Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten zusammenfassend beschrieben (3.4.) Gesprächsforschung und Anwendung Die Gesprächsforschung hat sich in mehreren Varianten und unter verschiedenen Bezeichnungen (Gesprächs-, Konversations-, Diskurs-, Dialog-, Kommunikations-/-ana-
6 2392 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte lyse, -forschung, -linguistik) in den letzten 30 Jahren in der Linguistik und Soziologie etabliert. Ihr Ziel ist die wissenschaftliche Erforschung der Organisationsprinzipien von Kommunikation und der Regularitäten des kommunikativen Handelns in Gesprächen. Die Aufzeichnung authentischer Gespräche, ihre detaillierte Verschriftlichung (Transkription) und die Analyse dieser Transkripte unter aus dem Material entwickelten Fragestellungen bilden den Kern der gesprächsanalytischen Arbeitsweise (für Näheres vgl. Becker-Mrotzek/Meier 2002; Deppermann 1999). Auf der Basis dieser Methodologie hat die Gesprächsforschung umfangreiche Untersuchungen zu den kommunikativen Besonderheiten der verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen (Schule, Gericht, Arzt-Patienten-Kommunikation, Bürger-Verwaltungs-Kommunikation, Kommunikation im Unternehmen etc.), der massenmedialen und der privaten Kommunikation durchgeführt (vgl. Becker-Mrotzek 1999). Resultat dieser Untersuchungen sind generalisierende deskriptive Aussagen über Regularitäten des Gesprächsverhaltens (z. B. befolgte Regeln, Muster, Handlungsschemata). Sie beziehen sich auf Gespräche generell, auf einzelne Gesprächstypen und auf lokale Gesprächsaufgaben. Mitte der 80er Jahre beginnt die Gesprächsforschung den Bereich der angeleiteten Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten wahrzunehmen (Kallmeyer 1985). Sie ist dabei noch nicht auf praktische Anwendung ausgerichtet, sondern versteht sich primär als wissenschaftliche Disziplin. Das Arbeitsfeld und die Arbeitsweise der Gesprächsforschung enthalten jedoch Elemente, die eine praktische Anwendung ihrer Ergebnisse befördern: Die Aufzeichnung und Untersuchung von authentischen Gesprächen (sehr häufig aus institutionellen und professionellen Kontexten), der Umgang mit den Personen im Feld, die häufig im Zusammenhang mit der Datenerhebung den Wunsch nach Rückmeldung von Ergebnissen äußern, und die beobachtete kommunikative Praxis, bei der aus der Außenperspektive häufig Probleme und Störungen auffallen, legen es in besonderer Weise nahe, diese Praxis nicht nur zu beschreiben, sondern auch über Möglichkeiten einer Veränderung oder Verbesserung nachzudenken. In einem zweiten Schritt interessieren sich gesprächsanalytische Untersuchungen also auch für die systematische Identifizierung von Verständigungsproblemen und Kommunikationsstörungen in den verschiedenen Interaktionsformen und Gesprächstypen. Neben das Wissen um Organisationsprinzipien und Regularitäten der Kommunikation tritt so ein Wissen über typische Sprach- und Kommunikationsprobleme, die bei bestimmten Gesprächsformen und -aufgaben auftreten. Sprach- und Kommunikationsprobleme sind damit die zentrale Schnittstelle der Gesprächsforschung zu ihrer Anwendung in Kommunikationsberatung und -training (vgl. Antos 1996; Fiehler 2002b). Resultat dieser Entwicklung ist, dass die Gesprächsforschung sich in einem steigenden Maß auch als anwendungsorientierte Disziplin versteht. Seinen organisatorischen Ausdruck fand dies 1987 in der Gründung des Arbeitskreises Angewandte Gesprächsforschung, der sich die Umsetzung gesprächsanalytischer Forschungsergebnisse in Kommunikationsberatung und -training sowie die theoretische Reflexion dieser Umsetzung zur Aufgabe gemacht hat (vgl. Becker-Mrotzek/Brünner 1992) Methodik der angewandten Gesprächsforschung Der Arbeitsprozess der angewandten Gesprächsforschung im Rahmen von Kommunikationsberatung und -training lässt sich idealtypisch als eine Abfolge von fünf Schritten
7 144. Kommunikationstraining 2393 beschreiben (zu Konzeption und Ablauf gesprächsanalytischer Trainings vgl. auch Becker-Mrotzek/Brünner 2002a; Fiehler/Schmitt 2004): (1) Zunächst muss die kommunikative Praxis, die als ungenügend empfunden wird, möglichst authentisch und in ausreichendem Umfang dokumentiert werden. D.h. der erste Schritt besteht in der Erstellung einer Datenbasis. Dies geschieht zeitlich vor Beratung und Training, damit die Aufzeichnungen transkribiert und ausgewertet werden können. Ergänzt wird dies dadurch, dass der/die Gesprächsanalytiker/in sich mit der Einbettung und dem institutionellen Rahmen der Gespräche vertraut macht. Die Ermöglichung und Durchführung entsprechender Gesprächsaufnahmen ist im Regelfall eine conditio sine qua non für eine gesprächsanalytische Kommunikationsberatung und -Schulung. D. h. andere Formen der Problemvergegenwärtigung (wie der Rekurs auf Erfahrungswissen, Beschreibungen der Probleme durch die Beteiligten, teilnehmende Beobachtung durch Gesprächsanalytiker/innen oder die Verwendung von Aufnahmen des gleichen Gesprächstyps, die analoge Kommunikationsprobleme zeigen, aber aus einem anderen Zusammenhang stammen), sind zwar als begleitende Maßnahmen sinnvoll, allein aber unzureichend. Auch Simulationen der betreffenden Gespräche - vor oder innerhalb des Trainings - sind eine Datengrundlage zweiter Wahl und nur sinnvoll, wenn sie durch sorgfältige Konstruktion dem authentischen Fall möglichst angenähert sind (vgl. die Methode Simulation authentischer Fälle in Becker-Mrotzek/Brünner 2002b). (2) Der zweite Schritt besteht in der Identifikation von Sprach- und Kommunikationsproblemen durch den/die Gesprächsanalytiker/in in der Datenbasis. Die Datenbasis in Form von Aufzeichnungen und Transkripten authentischer Gespräche ist für den/die Gesprächsanalytiker/in Grundlage für die Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsproblemen. Die Verwendung von Transkripten spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch sie unterscheidet sich die Arbeitsweise von Gesprächsanalytiker/innen wesentlich von anderen Trainingskonzeptionen. Transkripte sind die,zeitlupe4 und das,mikroskop4des Gesprächsanalytikers, mit deren Hilfe in Analysen turn-by-turn sowohl die Genese wie auch die Auswirkungen von Sprach- und Kommunikationsproblemen detailliert und systematisch untersucht werden können (vgl. Lalouschek/Menz (2002, Abschnitt 3.2) für ein illustratives Beispiel einer solchen Problemanalyse). Die Probleme werden anhand der Transkripte herauspräpariert, wobei das bereits erarbeitete gesprächsanalytische Wissen über Kommunikationsprobleme, die für bestimmte Gesprächsformen und -aufgaben charakteristisch sind, im Eiintergrund steht. Die Analyse zielt weniger auf singuläre oder überwiegend persönliche Probleme der Interaktionsbeteiligten, sondern auf überindividuelle strukturelle Probleme bei der Realisierung kommunikativer Aufgaben im Rahmen spezifischer Gesprächstypen. Die Analyse des Gesprächsmaterials unter dem Aspekt von Kommunikationsproblemen erfolgt zeitlich vor dem Training. Die Trennung von Analyse- und Trainingskontext vermeidet Ad-hoc-Analysen, wie sie bei Gesprächsbesprechungen in der Trainingssituation üblich sind. Die allgemeine Struktur des Prozesses der Diagnose von Sprach- und Kommunikationsproblemen lässt sich wie folgt charakterisieren: (a) Ein faktisches Kommunikationsverhalten wird - im Prozess des Monitorings der Kommunikation oder in der nachträglichen Reflexion mit Vorstellungen darüber
8 2394 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte konfrontiert, wie Kommunikation sein soll. Es wird an Zielvorstellungen oder allgemeiner: an Normen für kommunikatives Verhalten gemessen. (b) Eine Diskrepanz wird registriert. Gemessen an diesen Normen ist die faktische Kommunikation nicht so, wie es die Normen vorsehen. (c) Die Diskrepanz wird negativ bewertet. Durch die negative Bewertung gewinnt das in Frage stehende Kommunikationsverhalten den Status eines Kommunikationsproblems. Die negative Bewertung dieser Diskrepanz, also die Feststellung einer kommunikativen Defizienz, erzeugt zugleich die Motivation zur Lösung oder Beseitigung des Problems. Festzuhalten ist, dass im Prozess der Diagnose von Kommunikationsproblemen wie klar bewusst auch immer Normvorstellungen eine zentrale Rolle spielen. Die Identifizierung kann immer nur auf der Grundlage normativer Vorstellungen darüber erfolgen, wie Kommunikationsverhalten sein sollte. Im Zuge der Diagnose ist auch zu entscheiden, ob es sich bei einem auffälligen Phänomen überhaupt um ein Kommunikationsproblem handelt. Kommunikationsprobleme sind ein spezifischer Typ von Problemen, und es ist eine vorgängige Entscheidung, ob man ein Problem (dominant) als eines der Kommunikation oder als eines z. B. der Persönlichkeit, der sozialen Beziehung oder der Arbeitsorganisation typisieren will. Die Analyse der Datenbasis zielt aber nicht nur auf die Herausarbeitung von Kommunikationsproblemen ab. Ergänzend gilt die Aufmerksamkeit auch Passagen, die im Verständnis des/der Gesprächsanalytikers/in besonders gelungen erscheinen. An ihnen lässt sich zeigen, welche Verfahren und Strategien bei der Bearbeitung von Gesprächsaufgaben positive Wirkungen und Bewertungen hervorrufen und worauf diese Wirkungen und Bewertungen im Einzelnen beruhen. Gerade im Kontrast zu Verhaltensweisen, die problematisch wirken, kann so eine Didaktik des gelingenden Kommunizierens entwickelt werden. (3) Der dritte Schritt besteht in der Vermittlung der Diagnoseergebnisse an die Teilnehmer/innen im Training und der Aushandlung, welche dieser Probleme bearbeitet werden sollen. Im Training geht es zunächst darum, dass auch die Teilnehmer/innen an Beispielen aus dem Datenmaterial darlegen, in welcher Hinsicht und an welchen Stellen sie die Kommunikation als unvollkommen empfinden und wo sie Kommunikationsprobleme identifizieren. Dabei geht es insbesondere auch um die Explikation und Bewusstmachung der Normen für Kommunikationsverhalten, die die Teilnehmer/innen im Kopf haben und auf deren Grundlage sie Gespräche bewerten und Kommunikationsprobleme identifizieren. Teilnehmer/innen und Gesprächsanalytiker/innen brauchen keineswegs darin übereinzustimmen, was sie als Kommunikationsproblem(e) identifizieren: Hier kann Übereinstimmung, aber auch weitgehende Divergenz bestehen. Dies ist einerseits zurückzuführen auf unterschiedliche Relevanzen und Wissenshintergründe, andererseits aber auch auf unterschiedliche Normen als Beurteilungshintergrund. Wenn Divergenzen bestehen, ist ein gemeinsamer Prozess der Aushandlung erforderlich. Am Ende dieses Prozesses muss ein Konsens im Sinne eines Arbeitsbündnisses hergestellt sein, welche Probleme bearbeitet werden sollen und welche Zielvorstellungen bzw. Normen für das Kommunikationsverhalten gemeinsam als grundlegend betrachtet werden. (4) Zum faktischen Kommunikationsverhalten, das die Kommunikationsprobleme produziert, werden in einem vierten Schritt systematisch alternative Verhaltensweisen ge-
9 144. Kommunikationstraining 2395 sucht und diskutiert. Im Zentrum steht die Explikation und Bewusstmachung des Alternativenspektrums und die Sensibilisierung für mögliche Verläufe der Kommunikation, nicht die Präskription einzelner Verhaltensweisen. Auch die systematische Explikation des Alternativenspektrums erfolgt gemeinsam mit den Teilnehmer/innen. Wichtig ist hier, Verhaltensmöglichkeiten nicht nur durch die reine Negation oder Umkehrung problematischer Verhaltensweisen zu bestimmen (z. B.: Dem anderen ins Wort zu fallen ist problematisch. Deshalb ist es generell zu vermeiden.), sondern möglichst vielfältige Alternativen in ihren Konsequenzen, Wirkungen und Implikationen zu durchdenken. Dass nicht nur eine Alternative favorisiert, sondern jeweils mehrere diskutiert werden, hat zudem die Funktion, eine Polarisierung der Möglichkeiten in richtig vs. falsch oder gut vs. schlecht zu vermeiden und das positive wie negative Potenzial jeder einzelnen Möglichkeit zu verdeutlichen. Die Suche und Diskussion von Alternativen zielt damit auch nicht auf eine Entscheidung für eine der Verhaltensweisen ab. Es bleibt den Teilnehmer/innen überlassen, aus diesem Spektrum diejenigen Verhaltensweisen auszuwählen, die ihnen für die eigene Person am geeignetsten erscheinen, um sie in der Praxis auszuprobieren. Diese prinzipielle Offenheit, die Präskription soweit wie möglich vermeidet, stößt dabei häufig auf andersgeartete Erwartungen der Teilnehmer/innen, die wissen wollen, was denn nun,richtig4 ist. Wesentliches Lernziel der angewandten Gesprächsforschung ist aber gerade die Einsicht, dass dies im Bereich der Kommunikation oft nicht eindeutig und allgemeingültig gesagt werden kann. (5) Die alternativen Verhaltensweisen werden von den Teilnehmer/innen im Training und dann in ihrer beruflichen Praxis erprobt und in einer erneuten Beratung bzw. einem weiteren Training wird auf der Grundlage neuer Aufzeichnungen analysiert, ob sich diese Alternativen bewährt haben (gesprächsanalytische Evaluation). Der zentrale Ort für die Erprobung alternativer Verhaltensweisen sind nach gesprächsanalytischer Auffassung nicht Gesprächssimulationen im Training (wenngleich auch sie wichtige Funktionen haben), sondern es ist die Kommunikation in der (beruflichen) Praxis außerhalb des Trainings. Das bedeutet, dass diese Praxis erneut dokumentiert und analysiert werden muss. Gesprächsanalytisch basierte Trainings sollten demnach keine einmalige Veranstaltung sein, sondern sich zyklisch wiederholen. Gesprächsverhalten ist nach Auffassung der Gesprächsforschung nicht etwas, was man punktuell erlernt und dann für alle Zeit beherrscht, sondern etwas, was eines permanenten Trainings und eines fortgesetzten Bemühens um Kultivierung bedarf. Wesentliche Besonderheiten gesprächsanalytischer Trainings bestehen in der Art und Weise der Bewertung von Kommunikationsverhalten und in dem Typ der Normen, auf den sie rekurrieren. Auch die Gesprächsforschung kommt, wenn sie im Kontext der Entwicklung von Gesprächsfähigkeiten agiert, nicht ohne Bewertungen und Normen aus. Sie kommen vor allem bei der Diagnose von Kommunikationsproblemen und der Alternativenfindung zum Tragen. Dabei ist die angewandte Gesprächsforschung aber generell darum bemüht, dass es primär nicht ihre Bewertungen und Normen sind, sondern dass hinsichtlich dieser Bewertungen und Normen mit den Beteiligten Konsens hergestellt wird. Jedoch sollten Verhaltensweisen, bei denen sich durch empirische Analysen zeigen lässt, dass sie systematisch zu Kommunikationsproblemen führen, grundsätzlich vermieden werden. Nor-
10 2396 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte mativ handelt die angewandte Gesprächsforschung auch, wenn sie eingespielte Regularitäten, Muster und Gesprächsschemata bewusst macht und dafür plädiert, sie auch der zukünftigen kommunikativen Praxis zugrunde zu legen. Normen können um daran zu erinnern - deskriptiv basiert oder präskriptiv sein. Normen, auf die Gesprächsanalytiker/innen im Prozess der Anwendung rekurrieren, sind im wesentlichen deskriptiv begründet. Sie beruhen auf Einsichten in Organisationsprinzipien und Regularitäten der Kommunikation, wie sie in gesprächsanalytischen Untersuchungen gewonnen und beschrieben werden. Für die Gesprächsforschung spielt es eine wesentliche Rolle, ob und wieweit ein Gesprächsverhalten von deskriptiv ermittelten,normalformen4 (Cicourel 1975; Giesecke 1982) abweicht. Normalformen, wie sie sich in kommunikativen Regeln, Mustern oder Handlungsschemata widerspiegeln, sind gesellschaftlich für bestimmte Zwecke ausgebildete Standardlösungen für die Bewältigung kommunikativer Aufgaben. Sie legen das Gesprächsverhalten nicht im Detail fest, aber sie umreißen den Rahmen, in dem es sich bewegt. Die Normalformen haben sich gesellschaftlich vielfach bewährt und sind im Zuge ihrer Ausarbeitung optimiert worden. Wechselseitig wird erwartet, dass man sie benutzt und dass man nicht ohne Not gegen sie verstößt, sie modifiziert oder sie außer Acht lässt. Sie besitzen so die normative Kraft des Faktischen und Bewährten. Bei einer Abweichung von Normalformen erhöht sich deutlich die Wahrscheinlichkeit von Kommunikationsproblemen, und ein erheblicher Teil der beobachteten Kommunikationsprobleme ist in der Tat Resultat der Abweichung von den betreffenden Normalformen. Mit empirischen Regularitäten als Basis für ihre Empfehlungen unterscheidet sich die Gesprächsanalyse von vielen anderen Formen der Sprachkritik, der Kommunikationsberatung und des Kommunikationstrainings. Die gängige Praxis in vielen Trainings besteht darin, präskriptive Normen für Kommunikationsverhalten zu propagieren und in rezeptartigen Handlungsanweisungen zu operationalisieren, wobei häufig unklar ist, wie sich diese Normen legitimieren und wodurch die Annahme gesichert ist, dass die Befolgung der Handlungsanweisungen wirklich zu einer besseren oder effektiveren Kommunikation führt (vgl. Fiehler 1995a). Neben der Veränderung derjenigen Verhaltensweisen, die zu Kommunikationsproblemen geführt haben und führen, bilden kognitives Fernen über Regularitäten und Organisationsprinzipien von Kommunikation sowie eine allgemeine Sensibilisierung für Gesprächsprozesse wichtige Komponenten gesprächsanalytisch basierter Trainings. Außer durch die klassische Wissensvermittlung im Fehr-Fern-Diskurs geschieht beides vor allem im Kontext von Transkriptanalysen. Die gemeinsame Untersuchung von Transkripten kann sich außer auf die Problemanalyse auch auf vielfältige Aspekte des,funktionierens von Gesprächen beziehen und für diese sensibilisieren (vgl. Schmitt 2002) Anwendungsfelder Die dargestellte Methodik wurde von Gesprächsanalytiker/innen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erprobt (vgl. vor allem Fiehler/Sucharowski 1992; Becker-Mrotzek/Brünner 1999; Brünner/Fiehler/Kindt 2002). Überwiegend war dabei professionelles Gesprächsverhalten Gegenstand der Schulung. Beratungs- und Trainingsschwerpunkte der angewandten Gesprächsforschung liegen in folgenden Feldern:
11 144. Kommunikationstraining 2397 Wirtschaftskommunikation (Brünner 2000; Hartung 2004b; Betriebliche Ausbildung: Brünner 1992; Reklamationsgespräche: Fiehler/Kindt 1994; Fiehler/Kindt/Schnieders 2002; Schnieders 2005; Besprechungen: Dannerer 1999; Schmitt/Heidtmann 2005; Servicegespräche: Bendel 2001; Call- Center-Gespräche: Bendel 2002; außerbetriebliche Kommunikation: Becker-Mrotzek 1994). Bürger-Verwaltungs-Kommunikation (Becker-Mrotzek/Ehlich/Fickermann 1992; Spranz-Fogasy 1999; Wolf 2005). Medizinische Kommunikation (Menz/Nowak 1992; Spranz-Fogasy 1992, 2005; Lalouschek 2002a, 2002b, 2004; Schultze 2002; Streeck 2002; Fiehler 2005; Sachweh 2005). Pflegekommunikation (Krankenpflege: Walther/Weinhold 1997; Weinhold 1997; Altenpflege: Sachweh 1999, 2002). Beratungsgespräche (Aidsberatung: Bliesener 1992; Genetische Beratung: Hartog 1992; Telefonseelsorge: Behrend/Gülich/Kastner 1992; Gülich/Kastne 2002). Schulische und Hochschulkommunikation (Entwicklung von Gesprächsfähigkeiten bei Schüler/innen: Becker-Mrotzek 1995; Fiehler 1998; Neuland 1995, 1996; Vogt 1997, 2004; Becker-Mrotzek/Brünner 2006; Lehrerausund -Weiterbildung: Bremerich-Vos 1992; Boettcher/Bremerich-Vos 1986; Friedrich 2002; Hochschule: Meer 2001; 2003). Interkulturelle Kommunikation (Liedke/Redder/Scheiter 2002; Lambertini/ten Thije 2004) Besonderheiten einer gesprächsanalytisch fundierten Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten Die Besonderheiten und Vorteile einer gesprächsanalytisch fundierten Beratung und Kommunikationsschulung lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen: Fundus: Es kann auf die umfangreiche von der Gesprächsforschung erarbeitete Wissensgrundlage über Muster und Organisationsprinzipien der Kommunikation einerseits und über typische Formen von Kommunikationsproblemen andererseits zurückgegriffen werden. Empirisch: Die Diagnose von Kommunikationsproblemen erfolgt durch die Analyse authentischer Gespräche des Alltags und der Berufspraxis. Mikroskopisch: Die Verwendung von Transkripten ermöglicht eine genauere und detailliertere Analyse von Kommunikationsproblemen. Analytisch: Jeder Beratung und jedem Training geht die gründliche Analyse des empirischen Materials voraus. Kommunikationsprobleme werden so systematisch und empirisch erhoben. Die zeitliche Trennung von Analyse und Beratung/Training ermöglicht einen vollständigeren Überblick über auffällige und problematische Phänomene in den einzelnen Gesprächen, als er bei einer Ad-hoc-Besprechung zu erreichen ist. Dialogisch: Ob etwas ein Kommunikationsproblem ist, wird nicht allein vom Berater/ Trainer gesetzt, sondern in einem Diskussionsprozess mit den Beteiligten geklärt. Altemativenorientiert: Im Zentrum steht die Explikation und Bewusstmachung des Alternativenspektrums, nicht die Präskription einzelner Verhaltensweisen. Zyklisch: Die Beratung und das Training werden nicht als einmaliger Akt verstanden, sondern als etwas, was sich rundenweise wiederholen sollte.
12 2398 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte Evaluation: Die zyklische Struktur der Beratung erlaubt einerseits eine Bestimmung der Effekte des Trainings und andererseits eine empirisch fundierte Analyse der Transferprobleme. Inhaltlich bedeutet die Anwendung der Gesprächsforschung in Kommunikationsberatung und -training eine Einschränkung und Spezialisierung ihres Erkenntnisinteresses. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit nicht mehr überwiegend auf Organisationsprinzipien und Regularitäten, sondern verstärkt auch auf Sprach- und Kommunikationsprobleme. Systematische Anwendung stellt aber zugleich auch eine Bereicherung der Gesprächsanalyse dar, insofern sie den Kontakt zu den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen vermittelt und ihr neue Datenquellen und empirisches Material erschließt. Anwendung ist auch die Voraussetzung für eine Professionalisierung der Gesprächsforschung im Beratungs- und Trainingssektor. Dieser Bereich stellt für die in dieser Hinsicht ja nicht unbedingt verwöhnten Sprachwissenschaftler/innen ein relevantes Berufsfeld dar: Indem die Angewandte Gesprächsforschung allmählich beginnt, auf den steigenden Beratungsbedarf in zentralen gesellschaftlichen Bereichen zu reagieren, könnte sie als eine der wenigen Teildisziplinen der Linguistik - deren öffentlich stets noch bezweifelte gesellschaftliche Nützlichkeit4eindrucksvoll demonstrieren. (Neuland 1996, 171). Die Grenzen der Anwendung von Gesprächsforschung liegen dort, wo die Kommunikationsprobleme enden und andere Typen von Problemen - psychische, soziale etc. - beginnen. Hier ist sie nicht primär zuständig, wohl aber in Kooperation mit anderen Disziplinen und Trainingskonzeptionen gefragt und gefordert, weil diese Probleme in der Regel auch in Kommunikationsprozessen Ausdruck finden. Eine weitere Grenze liegt da, wo Kommunikationsprobleme sich nicht oder nicht primär in unmittelbarer Interaktion manifestieren, so z. B. bei Problemen der Organisation gesellschaftlicher Kommunikation, Problemen im Rahmen von Sprachkontakt, sprachbiographischen Problemen etc. Hier greift ihre Methodologie nur begrenzt. An diesen Punkten besteht die Chance und Notwendigkeit zu einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, in der beide Seiten versuchen, ihre Methodologien und Erkenntnismöglichkeiten systematisch aufeinander zu beziehen. 4. Literatur (in Auswahl) Allhoff, Dieter-W. (1992): Rhetorik als Gesprächspädagogik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18, Antos, Gerd (1996): Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag. Am Beispiel von Sprachratgebem und Kommunikationstrainings. Tübingen. Bader, Eugen (1994): Rede-Rhetorik, Schreib-Rhetorik, Konversationsrhetorik. Eine historisch-systematische Analyse. Tübingen. Bartsch, Elmar (1998): Kulturen der Didaktik rhetorischer Kommunikation. In: Ralph Köhnen (Hrsg.): Wege zur Kultur. Perspektiven für einen integrativen Deutschunterricht. Frankfurt a. M. u.a., Becker-Mrotzek, Michael (1994): Gesprächsschulung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen öffentlicher Dienstleistungsuntemehmen auf linguistischer Grundlage. In: Elmar Bartsch (Hrsg.): Sprechen, Führen, Kooperieren in Betrieb und Verwaltung. Kommunikation in Unternehmen. München/Basel,
13 144. Kommunikationstraining 2399 Becker-Mrotzek, Michael (1995): Angewandte Diskursforschung und Sprachdidaktik. In: Der Deutschunterricht 1, Becker-Mrotzek, Michael (1999): Diskursforschung und Kommunikation. 2. Aufl. Heidelberg (Studienbibliographien Sprachwissenschaft, 4). Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (1992): Angewandte Gesprächsforschung: Ziele Methoden - Probleme. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (1999): Gesprächsforschung für die Praxis: Ziele, Methoden, Ergebnisse. In: Gerhard Stickel (Hrsg.): Sprache Sprachwissenschaft Öffentlichkeit. Berlin/New York, Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (2002a): Diskursanalytische Fortbildungskonzepte. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (2002b): Simulation authentischer Fälle (SAF). In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (Hrsg.) (2004): Analyse und Vermittlung von Gesprächskompetenz. Frankfurt a. M. ( Becker-Mrotzek, Michael/Gisela Brünner (2006): Gesprächsanalyse und Gesprächsführung. Eine Unterrichtsreihe für die Sekundarstufe II. Radolfzell. ( de/2006/raabits.htm) Becker-Mrotzek, Michael/Konrad Ehlich/Ingeborg Fickermann (1992): Bürger-Verwaltungs-Diskurse. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Becker-Mrotzek, Michael/Christoph Meier (2002): Arbeitsweisen und Standardverfahren der Angewandten Diskursforschung. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Behrend, Sabine/Elisabeth Gülich/Mary Kästner (1992): Gesprächsanalyse im Kontext der Telefonseelsorge. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Bendel, Sylvia (2001): Die interaktive Bearbeitung von Servicefehlem: Problemgespräche und Gesprächsprobleme zwischen Gästen und Angestellten an der Hotelreception. In: Gesprächsforschung Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 2 (2001), ( gespraechsforschung-ozs.de/heft2001/heft2001.htm). Bendel, Sylvia (2002): Gesprächskompetenz am Telefon. Ein Weiterbildungskonzept für Bankangestellte auf der Basis authentischer Gespräche. In: Michael Becker-Mrotzek/Reinhard Fiehler (Hrsg.): Untemehmenskommunikation. Tübingen, (Forum für Fachsprachen Forschung, 58). Bliesener, Thomas (1992): Ausbildung und Supervision von Aidsberatem. Weiterentwicklung eines Modells zur Anwendung von Telefonsimulation und Gesprächsanalyse. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Bliesener, Thomas/Ruth Brons-Albert (Hrsg.) (1994): Rollenspiele in Verhaltens- und Kommunikationstrainings. Opladen. Boettcher, Wolfgang (1991): Beratungsgespräch und Gesprächsberatung. Von der schwierigen Beziehung zwischen Gesprächsanalyse und Weiterbildung. In: Deutsche Sprache 3, Boettcher, Wolfgang/Albert Bremerich-Vos (1986): Pädagogische Beratung. Zur Unterrichtsnachbesprechung in der 2. Phase der Lehrerausbildung. In: Werner Kallmeyer (Hrsg.): Kommunikationstypologie. Düsseldorf, Bremerich-Vos, Albert (1991): Populäre rhetorische Ratgeber. Historisch-systematische Untersuchungen. Tübingen. Bremerich-Vos, Albert (1992): Diskursanalytische Arbeit mit Fach- und Seminarleitem. In: Fiehler/ Sucharowski (1992), Brons-Albert, Ruth (1995a): Auswirkungen von Kommunikationstraining auf das Gesprächsverhalten. Tübingen. Brons-Albert, Ruth (1995b): Verkaufsgespräche und Verkaufstrainings. Opladen. Brünner, Gisela (1992): Kommunikationsberatung in der betrieblichen Ausbildung. Ein Erfahrungsbericht zum Bereich des Bergbaus. In: Fiehler/Sucharowski (1992),
14 2400 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte Brünner, Gisela (2000): Wirtschaftskommunikation. Linguistische Analysen ihrer mündlichen Formen. Tübingen. Brünner, Gisela/Reinhard Fiehler (2002): Kommunikationstrainerinnen über Kommunikation. Eine Befragung von Trainerinnen zu ihrer Arbeit und ihrem Verhältnis zur Sprachwissenschaft. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Brünner, Gisela/Reinhard Fiehler/Walther Kindt (Hrsg.) (2002): Angewandte Diskursforschung. Bd. 1: Grundlagen und Beispielanalysen u. Bd. 2: Methoden und Anwendungsbereiche. Radolfzell. ( und Cherubim, Dieter (1992): Rhetorik, Sprachwissenschaft, und Sprachpraxis. Mit einem Blick auf Komplimentierbücher und Sprachratgeber am Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Carl Joachim Classen/Heinz-Joachim Müllenbrock (Hrsg.) (1992): Die Macht des Wortes: Aspekte gegenwärtiger Rhetorikforschung. Marburg, Cicourel, Aron V. (1975): Sprache in der sozialen Interaktion. München. Dannerer, Monika (1999): Besprechungen im Betrieb. Empirische Analysen und didaktische Perspektiven. München. Deppermann, Arnulf (1999): Gespräche analysieren. Eine Einführung in konversationsanalytische Methoden. Opladen. Fiehler, Reinhard (1994): Untemehmensphilosophie und Kommunikationsschulung. Neue Wege und neue Probleme für betriebliche Kommunikationstrainings. In: Theo Bungarten (Hrsg.): Kommunikationstraining und -trainingsprogramme im wirtschaftlichen Umfeld. Tostedt, Fiehler, Reinhard (1995a): Implizite und explizite Bewertungsgrundlagen für kommunikatives Verhalten in betrieblichen Kommunikationstrainings. In: Bernd Ulrich Biere/Rudolf Hoberg (Hrsg.): Bewertungskriterien in der Sprachberatung. Tübingen, Fiehler, Reinhard (1995b): Perspektiven und Grenzen der Anwendung von Kommunikationsanalyse. In: Reinhard Fiehler/Dieter Metzing (Hrsg.): Untersuchungen zur Kommunikationsstruktur. Bielefeld, Fiehler, Reinhard (1998): Bewertungen und Normen als Problem bei der Förderung mündlicher Gesprächslähigkeiten in der Schule. In: Der Deutschunterricht 1, Fiehler, Reinhard (2002a): Kann man Kommunikation lehren? Zur Veränderbarkeit von Kommunikationsverhalten durch Kommunikationstraining. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Fiehler, Reinhard (2002b): Verständigungsprobleme und gestörte Kommunikation. Einführung in die Thematik. In: Reinhard Fiehler (Hrsg.): Verständigungsprobleme und gestörte Kommunikation. Radolfzell, 7 15 ( Fiehler, Reinhard (2005): Erleben und Emotionalität im Arzt-Patienten-Gespräch. In: Mechthild Neises/Susanne Ditz/Thomas Spranz-Fogasy (Hrsg.): Psychosomatische Gesprächsführung in der Frauenheilkunde. Ein interdisziplinärer Ansatz zur verbalen Intervention. Stuttgart, KO BS. Fiehler, Reinhard/Walther Kindt (1994): Reklamationsgespräche. Schulungsperspektiven auf der Basis von Ergebnissen diskursanalytischer Untersuchungen. In: Elmar Bartsch (Hrsg.): Sprechen, Führen, Kooperieren in Betrieb und Verwaltung. Kommunikation in Unternehmen. München/Basel, Fiehler, Reinhard/Walther Kindt/Guido Schnieders (2002): Kommunikationsprobleme in Reklamationsgesprächen. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Fiehler, Reinhard/Reinhold Schmitt (2004): Gesprächstraining. In: Karlfried Knapp et al. (Hrsg.): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Basel/Tübingen, Fiehler, Reinhard/Wolfgang Sucharowski (Hrsg.) (1992): Kommunikationsberatung und Kommunikationstraining. Anwendungsfelder der Diskursforschung. Opladen. Flieger, Erhard/Georg Wist/Reinhard Fiehler (1992): Kommunikationstrainings im Vertrieb und Diskursanalyse. Erfahrungsbericht über eine Kooperation. In: Fiehler/Sucharowski (1992),
15 144. Kommunikationstraining 2401 Friedrich, Georg (2002): Gesprächsführung Ausbildungsziel der Lehrerqualifikation. In: Brünner/ Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Geißner, Hellmut (1982): Gesprächserziehung. Didaktik und Methodik der mündlichen Kommunikation. Frankfurt am Main. Giesecke, Michael (1982): Die Normalformanalyse, ein kommunikationswissenschaftliches Untersuchungsverfahren für interaktioneile Vorgänge in Institutionen. In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.): Beiträge zu einer empirischen Sprachsoziologie. Tübingen, Grosse, Siegfried/Karl-Heinz Bausch (Hrsg.) (1985): Praktische Rhetorik. Beiträge zu ihrer Funktion in der Aus- und Fortbildung. Mannheim. Grünwaldt, Hans Joachim (1998): Zur Didaktik und Methodik mündlicher Kommunikations- Übungen. In: Der Deutschunterricht 1, Gülich, Elisabeth/Mary Kästner (2002): Rollen Verständnis und Kooperation in Gesprächen der Telefonseelsorge. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Hartig, Matthias (1994): Kommunikative Kompetenz und die Ausbildung zum Kommunikationstrainer als Zukunftsperspektive einer anwendungsbezogenen Germanistik. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 26, H. 1, Hartog, Jennifer (1992): Kommunikationsprobleme in der genetischen Beratung und ihre Folgen für eine sinnvolle Kommunikationsberatung. In: Fiehler/Sucharowski (1992) Hartung, Martin (2004a): Wie lässt sich Gesprächskompetenz wirksam und nachhaltig vermitteln? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis. In: Becker-Mrotzek/Brünner (2004), Hartung, Martin (2004b): Gesprächsanalyse in der betrieblichen Praxis. In: Karlfried Knapp u.a. (Hrsg.) (2004): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Basel/Tübingen, Hess-Lüttich, Emest W. B. (1991): Effektive Gesprächsführung. Evaluationskriterien in der Angewandten Rhetorik. In: Gert Ueding (Hrsg.): Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Tübingen, Kallmeyer, Werner (1985): Ein Orientierungsversuch im Feld der praktischen Rhetorik. In: Grosse/ Bausch (1985), Kallmeyer, Werner (1996): Einleitung. In: Werner Kallmeyer (Hrsg.): Gesprächsrhetorik. Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozeß. Tübingen, Lalouschek, Johanna (2002a): Frage-Antwort-Sequenzen im ärztlichen Gespräch. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Lalouschek, Johanna (2002b): Hypertonie? oder das Gespräch mit Patientinnen als Störung ärztlichen Tuns. In: Reinhard Fiehler (Hrsg.): Verständigungsprobleme und gestörte Kommunikation. Opladen, ( Lalouschek, Johanna (2004): Kommunikatives Selbst-Coaching im beruflichen Alltag. Ein sprachwissenschaftliches Trainingskonzept am Beispiel der klinischen Gesprächsführung. In: Becker- Mrotzek/Brünner (2004), Lalouschek, Johanna/Florian Menz (2002): Empirische Datenerhebung und Authentizität von Gesprächen. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Lambertini, Lucia/Jan D. ten Thije (2004): Die Vermittlung interkulturellen Handlungswissens mittels der Simulation authentischer Fälle. In: Becker-Mrotzek/Brünner (2004), Lepschy, Annette (2002): Lehr- und Lemmethoden zur Entwicklung von Gesprächsfähigkeit. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Liedke, Martina/Angelika Redder/Susanne Scheiter (2002): Interkulturelles Handeln lehren ein diskursanalytischer Trainingsansatz. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Meer, Dorothee (2001): So, das nimmt ja gar kein Ende, is ja furchbar Ein gesprächsanalytisch fundiertes Fortbildungskonzept zu Sprechstundengesprächen an der Hochschule. In: Gesprächsforschung Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 2, ( forschung-ozs.de/heft2001/heft2001.htm). Meer, Dorothee (2003): Dann jetz Schluss mit der Sprechstundenrallye. Sprechstundengespräche an der Hochschule. Ein Ratgeber für Lehrende und Studierende. Baltmannsweiler.
16 2402 X III Rhetorik und Stilistik in der Anwendung II: didaktische Aspekte Menz, Florian/Peter Nowak (1992): Kommunikationstraining für Ärzte und Ärztinnen in Österreich: Eine Anamnese. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Mönnich, Annette (2004): Gesprächsführung lernen. Welche impliziten Konzeptualisierungen des Kommunikationsiemens sind in Methoden zur Entwicklung der Gesprächsfähigkeit zu finden? In: Becker-Mrotzek/Brünner (2004), Neuland, Eva (1995): Mündliche Kommunikation: Gesprächsforschung Gesprächsförderung. Entwicklungen, Tendenzen und Perspektiven. In: Der Deutschunterricht 1, Neuland, Eva (1996): Miteinander Reden Lernen. Überlegungen zur Förderung von Gesprächskultur. In: Ann Peyer/Paul R. Portmann (Hrsg.): Norm, Moral und Didaktik Die Linguistik und ihre Schmuddelkinder. Tübingen, Pabst-Weinschenk, Marita (1994): Zum Verständnis der Sprecherziehung heute: Didaktik der mündlichen Kommunikation. In: Wirkendes Wort 3, Sachweh, Svenja (1999): Schätzle hinsitze! Kommunikation in der Altenpflege. Frankfurt a. M. u. a. Sachweh, Svenja (2002): Noch ein Löffelchen? Effektive Kommunikation in der Altenpflege. Bern u. a. Sachweh, Svenja (2005): Gut Herr Doktor! Gespräche mit alten Patientinnen. In: Mechthild Neises/Susanne Ditz/Thomas Spranz-Fogasy (Hrsg.): Psychosomatische Gesprächsführung in der Frauenheilkunde. Ein interdisziplinärer Ansatz zur verbalen Intervention. Stuttgart, Schmitt, Reinhold (2002): Rollenspiele als authentische Gespräche. Überlegungen zu deren Produktivität im Trainingszusammenhang. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Schmitt, Reinhold/Daniela Heidtmann (2005): Die Analyse von Meetings: Bericht über ein gesprächsanalytisches Transferprojekt in einem Software-Unternehmen. In: Gerd Antos/Sigurd Wichter (Hrsg.): Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem. Frankfurt a. M., Schnieders, Guido (2005): Reklamationsgespräche. Eine diskursanalytische Studie. Tübingen. Schultze, Carsten (2002): Videotranskripte in ärztlichen Qualitätszirkeln. Zur Durchführung des Göttinger Videoseminars. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 2, Spranz-Fogasy, Thomas (1992): Ärztliche Gesprächsführung Inhalte und Erfahrungen gesprächsanalytisch fundierter Weiterbildung. In: Fiehler/Sucharowski (1992), Spranz-Fogasy, Thomas (1999): David und Goliath Bürgerin umweltpolitischen Auseinandersetzungen mit Behörden. In: Michael Becker-Mrotzek/Christine Doppler (Hrsg.): Medium Sprache im Beruf. Eine Aufgabe für die Linguistik. Tübingen, Spranz-Fogasy, Thomas (2005): Kommunikatives Handeln in ärztlichen Gesprächen Gesprächseröffnung und Beschwerdenexploration. In: Mechthild Neises/Susanne Ditz/Thomas Spranz-Fogasy (Hrsg.): Psychosomatische Gesprächsführung in der Frauenheilkunde. Ein interdisziplinärer Ansatz zur verbalen Intervention. Stuttgart, Streeck, Sabine (2002): Dominanz und Kooperation in der neuropädiatrischen Sprechstunde. In: Brünner/Fiehler/Kindt (2002). Bd. 1, Ueding, Gert/Bemd Steinbrink (1994): Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode. 3. Aufl. Stuttgart. Vogt, Rüdiger (1995): Was heißt Gesprächserziehung? Institutioneile Bedingungen von mündlicher Kommunikation (nicht nur) in der Sekundarstufe 1. In: Der Deutschunterricht 1, Vogt, Rüdiger (1997): Zum Verhältnis von Gesprächsanalyse und Gesprächsdidaktik. In: Marita Pabst-Weinschenk/Roland W. Wagner/Carl Ludwig Naumann (Hrsg.): Sprecherziehung im Unterricht. München/Basel, Vogt, Rüdiger (2004): Miteinander-Sprechen lernen: Schulische Förderung von Gesprächsfähigkeit. In: Becker-Mrotzek/Brünner (2004), Walther, Sabine/Christine Weinhold (1997): Die Übergabe ein Fachgespräch unter Pflegenden. Stuttgart/New York. (Pflegedidaktik. Hrsg.: Bischoff-Wanner, Claudia et al.) Weinhold, Christine (1997): Kommunikation zwischen Patienten und Pflegepersonal. Bern u. a.
17 145. Das professionelle Verfassen von Reden 2403 Weigand, Edda (1994): Dialoganalyse und Gesprächstraining. In: Gerd Fritz/Franz Hundsnurscher (Hrsg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tübingen, Wolf, Ricarda (2005): Biographische Darstellungen in der Rentenberatung Eine gesprächsanalytische Untersuchung mit Schlussfolgerungen für die Aus- und Weiterbildung. In: Gesprächsforschung Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 6 (2005), ( gespraechsforschung-ozs.de/heft2005/heft2005.htm). Reinhard Fiehler, Mannheim (Deutschland)
Einführung in die Bände
 Erschienen in: Brünner, Gisela/Fiehler, Reinhard/Kindt, Walther (Hrsg.): Angewandte Diskursforschung. Band 2: Methoden und Anwendungsbereiche. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1999. S. 7-15. Einführung
Erschienen in: Brünner, Gisela/Fiehler, Reinhard/Kindt, Walther (Hrsg.): Angewandte Diskursforschung. Band 2: Methoden und Anwendungsbereiche. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1999. S. 7-15. Einführung
offene Netzwerke. In diesem Sinn wird auch interkulturelle Kompetenz eher als Prozess denn als Lernziel verstanden.
 correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
correct zu verstehen. Ohne Definitionen von interkultureller Kompetenz vorwegnehmen zu wollen: Vor allem gehört dazu, einen selbstbewussten Standpunkt in Bezug auf kulturelle Vielfalt und interkulturelles
Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter!
 Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit
Bürgerhilfe Florstadt
 Welche Menschen kommen? Erfahrungen mit der Aufnahme vor Ort vorgestellt von Anneliese Eckhardt, BHF Florstadt Flüchtlinge sind eine heterogene Gruppe Was heißt das für Sie? Jeder Einzelne ist ein Individuum,
Welche Menschen kommen? Erfahrungen mit der Aufnahme vor Ort vorgestellt von Anneliese Eckhardt, BHF Florstadt Flüchtlinge sind eine heterogene Gruppe Was heißt das für Sie? Jeder Einzelne ist ein Individuum,
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Verständnisfragen. Was bedeutet Mediation für Sie?
 Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Bearbeitungsstand:10.01.2007 07:09, Seite 1 von 6 Mediation verstehen Viele reden über Mediation. Das machen wir doch schon immer so! behaupten sie. Tatsächlich sind die Vorstellungen von dem, was Mediation
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP.
 Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
TRAINING & COACHING. 3C DIALOG ist Ihr Ansprechpartner für die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter.
 TRAINING & COACHING 3C DIALOG ist Ihr Ansprechpartner für die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter. KUNDENDIALOG Erfolgreiche Gespräche führen Kommunikation kann so einfach sein oder auch so schwierig.
TRAINING & COACHING 3C DIALOG ist Ihr Ansprechpartner für die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter. KUNDENDIALOG Erfolgreiche Gespräche führen Kommunikation kann so einfach sein oder auch so schwierig.
Psychologie im Arbeitsschutz
 Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Fachvortrag zur Arbeitsschutztagung 2014 zum Thema: Psychologie im Arbeitsschutz von Dipl. Ing. Mirco Pretzel 23. Januar 2014 Quelle: Dt. Kaltwalzmuseum Hagen-Hohenlimburg 1. Einleitung Was hat mit moderner
Mobile Intranet in Unternehmen
 Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet
Fortbildungsangebote für Lehrer und Lehrerinnen
 Thema Besonders geeignet für Schwerpunkte Inklusion von Schülern mit gravierenden Problemen beim Erlernen der Mathematik Schulen/ Fachschaften, die sich in Sinne der Inklusion stärker den Schülern mit
Thema Besonders geeignet für Schwerpunkte Inklusion von Schülern mit gravierenden Problemen beim Erlernen der Mathematik Schulen/ Fachschaften, die sich in Sinne der Inklusion stärker den Schülern mit
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren
 Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als
Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky
 #upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
#upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Themenbroschüre Business Coaching IPA. Personalentwicklung und Arbeitsorganisation
 Themenbroschüre Business Coaching IPA Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation Stärken und Potenziale nutzen Ihr Ziel als Personalverantwortlicher ist es Ihre Fach- und Führungskräfte optimal
Themenbroschüre Business Coaching IPA Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation Stärken und Potenziale nutzen Ihr Ziel als Personalverantwortlicher ist es Ihre Fach- und Führungskräfte optimal
3.2.6 Die Motivanalyse
 107 3.2 Die Bestimmung von Kommunikations-Zielgruppen 3.2.6 Die Motivanalyse Mit dem Priorisierungsschritt aus Kapitel 3.2.5 haben Sie all jene Personen selektiert, die Sie für den geplanten Kommunikationsprozess
107 3.2 Die Bestimmung von Kommunikations-Zielgruppen 3.2.6 Die Motivanalyse Mit dem Priorisierungsschritt aus Kapitel 3.2.5 haben Sie all jene Personen selektiert, die Sie für den geplanten Kommunikationsprozess
Organisationsentwicklung Outdoor Seminare Teamentwicklung
 Organisationsentwicklung Outdoor Seminare Teamentwicklung Organisationsentwicklung Chaos als Weg zu neuer Ordnung - Ordnung als Weg aus dem Chaos Um Handlungsfähigkeit zu erhalten sind wir gezwungen aus
Organisationsentwicklung Outdoor Seminare Teamentwicklung Organisationsentwicklung Chaos als Weg zu neuer Ordnung - Ordnung als Weg aus dem Chaos Um Handlungsfähigkeit zu erhalten sind wir gezwungen aus
Fotoprotokoll / Zusammenfassung. des Seminars Methodik der Gesprächsführung und Coaching. Vertriebs- & Management - Training
 Fotoprotokoll / Zusammenfassung Vertriebs- & Management - Training des Seminars Methodik der Gesprächsführung und Coaching Vertriebs- & Management - Training Herzlich Willkommen auf Schloss Waldeck am
Fotoprotokoll / Zusammenfassung Vertriebs- & Management - Training des Seminars Methodik der Gesprächsführung und Coaching Vertriebs- & Management - Training Herzlich Willkommen auf Schloss Waldeck am
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016
 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele
Einleitung. Was dieses Buch beinhaltet
 LESEPROBE Einleitung Was dieses Buch beinhaltet Dieses Arbeitsbuch nimmt Sprache und Literatur aus der Vermittlungsperspektive in den Blick, d.h. Sprache und Literatur werden sowohl als Medien als auch
LESEPROBE Einleitung Was dieses Buch beinhaltet Dieses Arbeitsbuch nimmt Sprache und Literatur aus der Vermittlungsperspektive in den Blick, d.h. Sprache und Literatur werden sowohl als Medien als auch
Leseprobe. Bruno Augustoni. Professionell präsentieren. ISBN (Buch): 978-3-446-44285-6. ISBN (E-Book): 978-3-446-44335-8
 Leseprobe Bruno Augustoni Professionell präsentieren ISBN (Buch): 978-3-446-44285-6 ISBN (E-Book): 978-3-446-44335-8 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://wwwhanser-fachbuchde/978-3-446-44285-6
Leseprobe Bruno Augustoni Professionell präsentieren ISBN (Buch): 978-3-446-44285-6 ISBN (E-Book): 978-3-446-44335-8 Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://wwwhanser-fachbuchde/978-3-446-44285-6
Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit
 Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit der Arbeitsgruppe Bildung und Training des Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Seit Dezember
Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit der Arbeitsgruppe Bildung und Training des Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Seit Dezember
igrow für Unternehmen
 igrow für Unternehmen igrow ist kein klassisches Online-Coaching und auch kein traditionelles E-Learning. Wir nennen es elearning by doing. Was wir wissen ist, dass gerade erfolgreiche Unternehmen den
igrow für Unternehmen igrow ist kein klassisches Online-Coaching und auch kein traditionelles E-Learning. Wir nennen es elearning by doing. Was wir wissen ist, dass gerade erfolgreiche Unternehmen den
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele
 Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in Hamburg und Berlin zu einer Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 4. März 2015 q5337/31319 Le forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer
agitat Werkzeuge kann man brauchen und missbrauchen - vom Einsatz von NLP in der Führung
 agitat Werkzeuge kann man brauchen und missbrauchen - vom Einsatz von NLP in der Führung Der Inhalt dieses Vortrages Moderne Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter
agitat Werkzeuge kann man brauchen und missbrauchen - vom Einsatz von NLP in der Führung Der Inhalt dieses Vortrages Moderne Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter
Kreativ visualisieren
 Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns
Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?
 Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
Syllabus/Modulbeschreibung
 BETRIEBS- UND SOZIALWIRTSCHAFT Syllabus/Modulbeschreibung Modul G A 01: Theorie und Empirie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Winkelhake Studiengang: Master (M.A.)
BETRIEBS- UND SOZIALWIRTSCHAFT Syllabus/Modulbeschreibung Modul G A 01: Theorie und Empirie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Winkelhake Studiengang: Master (M.A.)
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Titel:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Portfolio: "Kabale und Liebe" von Friedrich von Schiller Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Titel:
Na, wie war ich? Feedback Ergebnisse für den Coach Olaf Hinz
 Na, wie war ich? Feedback Ergebnisse für den Coach Olaf Hinz Professionelles Business Coaching ist eine unverzichtbare Säule moderner Führungskräfteentwicklung. Professionell ist meiner Meinung ein Coach
Na, wie war ich? Feedback Ergebnisse für den Coach Olaf Hinz Professionelles Business Coaching ist eine unverzichtbare Säule moderner Führungskräfteentwicklung. Professionell ist meiner Meinung ein Coach
ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele
 ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits
Weiterbildungsangebote des Sommersemesters 2014 für Personalangehörige der Universität des Saarlandes
 Gliederung: Weiterbildungsangebote des Sommersemesters 2014 für Personalangehörige der Universität des Saarlandes 1. Innovationsmanagement 2 2. Projektmanagement 3 3. Kooperations- und Führungskultur 4
Gliederung: Weiterbildungsangebote des Sommersemesters 2014 für Personalangehörige der Universität des Saarlandes 1. Innovationsmanagement 2 2. Projektmanagement 3 3. Kooperations- und Führungskultur 4
Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at]
![Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Rhetorik und Argumentationstheorie. [frederik.gierlinger@univie.ac.at]](/thumbs/38/18012562.jpg) Rhetorik und Argumentationstheorie 1 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Ablauf der Veranstaltung Termine 1-6 Erarbeitung diverser Grundbegriffe Termine 7-12 Besprechung von philosophischen Aufsätzen Termin
Rhetorik und Argumentationstheorie 1 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Ablauf der Veranstaltung Termine 1-6 Erarbeitung diverser Grundbegriffe Termine 7-12 Besprechung von philosophischen Aufsätzen Termin
Bernadette Büsgen HR-Consulting www.buesgen-consult.de
 Reiss Profile Es ist besser mit dem Wind zu segeln, als gegen ihn! Möchten Sie anhand Ihres Reiss Rofiles erkennen, woher Ihr Wind weht? Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Leben aktiv zu gestalten.
Reiss Profile Es ist besser mit dem Wind zu segeln, als gegen ihn! Möchten Sie anhand Ihres Reiss Rofiles erkennen, woher Ihr Wind weht? Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Leben aktiv zu gestalten.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich?
 2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
2.1 Präsentieren wozu eigentlich? Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h.
WEITERBILDEN INHOUSE-TRAININGS 2016 MAßGESCHNEIDERTE KONZEPTE FÜR IHRE UNTERNEHMENSPRAXIS
 WEITERBILDEN INHOUSE-TRAININGS 2016 MAßGESCHNEIDERTE KONZEPTE FÜR IHRE UNTERNEHMENSPRAXIS Top-Manager und Leader Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte Nachwuchstalente UNSER AUFTRAG: IHRE
WEITERBILDEN INHOUSE-TRAININGS 2016 MAßGESCHNEIDERTE KONZEPTE FÜR IHRE UNTERNEHMENSPRAXIS Top-Manager und Leader Kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte Nachwuchstalente UNSER AUFTRAG: IHRE
2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
 Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Checkliste für die Beurteilung psychologischer Gutachten durch Fachfremde Gliederung eines Gutachtens 1. Nennung des Auftraggebers und Fragestellung des Auftraggebers. 2. Psychologische Fragen. Nicht genannt.
Soziale Kommunikation. Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke. Kommunikationsprobleme
 Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke Kommunikationsprobleme 1) Was ist Kommunikation? 2) Vom Austausch zur Unterscheidung 3) Zusammenfassung
Vorlesung Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Sommersemester 2011 PD Dr. phil. habil. Udo Thiedeke Kommunikationsprobleme 1) Was ist Kommunikation? 2) Vom Austausch zur Unterscheidung 3) Zusammenfassung
für Lehrlinge Die Workshops sind so aufgebaut, dass sie je nach Bedarf individuell für jedes Lehrjahr zusammengestellt werden können.
 Spezial-Workshops für Lehrlinge Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden! Pearl S. Buck Jedes Unternehmen ist auf gute, leistungsfähige und motivierte Lehrlinge
Spezial-Workshops für Lehrlinge Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden! Pearl S. Buck Jedes Unternehmen ist auf gute, leistungsfähige und motivierte Lehrlinge
Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann
 UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
UNIVERSITÄT ZU KÖLN Erziehungswissenschaftliche Fakultät Institut für Psychologie Tipps für die praktische Durchführung von Referaten Prof. Dr. Ellen Aschermann Ablauf eines Referates Einleitung Gliederung
Grundlagen der Gesprächsführung: Argumentation
 Grundlagen der Gesprächsführung: Argumentation Welche sprachlichen Möglichkeiten haben wir, um Einstellungen zu verändern und Handlungen zu beeinflussen? Referent: Daniel Bedra Welche sprachlichen Möglichkeiten
Grundlagen der Gesprächsführung: Argumentation Welche sprachlichen Möglichkeiten haben wir, um Einstellungen zu verändern und Handlungen zu beeinflussen? Referent: Daniel Bedra Welche sprachlichen Möglichkeiten
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit
 Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Eva Douma: Die Vorteile und Nachteile der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit Frau Dr. Eva Douma ist Organisations-Beraterin in Frankfurt am Main Das ist eine Zusammen-Fassung des Vortrages: Busines
Diese Broschüre fasst die wichtigsten Informationen zusammen, damit Sie einen Entscheid treffen können.
 Aufklärung über die Weiterverwendung/Nutzung von biologischem Material und/oder gesundheitsbezogen Daten für die biomedizinische Forschung. (Version V-2.0 vom 16.07.2014, Biobanken) Sehr geehrte Patientin,
Aufklärung über die Weiterverwendung/Nutzung von biologischem Material und/oder gesundheitsbezogen Daten für die biomedizinische Forschung. (Version V-2.0 vom 16.07.2014, Biobanken) Sehr geehrte Patientin,
Weiterbildungen 2014/15
 Weiterbildungen 2014/15 Kurs 1 Das Konzept Lebensqualität In den letzten Jahren hat sich die Lebensqualität im Behinderten-, Alten-, Sozial- und Gesundheitswesen als übergreifendes Konzept etabliert. Aber
Weiterbildungen 2014/15 Kurs 1 Das Konzept Lebensqualität In den letzten Jahren hat sich die Lebensqualität im Behinderten-, Alten-, Sozial- und Gesundheitswesen als übergreifendes Konzept etabliert. Aber
Das Führungsplanspiel
 Diagnostik Training Systeme Das Führungsplanspiel Das Führungsplanspiel ist ein Verfahren, in dem Teilnehmer ihre Führungskompetenzen in simulierten, herausfordernden praxisrelevanten Führungssituationen
Diagnostik Training Systeme Das Führungsplanspiel Das Führungsplanspiel ist ein Verfahren, in dem Teilnehmer ihre Führungskompetenzen in simulierten, herausfordernden praxisrelevanten Führungssituationen
Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege
 Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Aktuelle Berichte Arbeitsmarkteffekte von Umschulungen im Bereich der Altenpflege 19/2015 In aller Kürze Im Bereich der Weiterbildungen mit Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf für Arbeitslose
Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert.
 Der Gutachtenstil: Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert. Das Ergebnis steht am Schluß. Charakteristikum
Der Gutachtenstil: Charakteristikum des Gutachtenstils: Es wird mit einer Frage begonnen, sodann werden die Voraussetzungen Schritt für Schritt aufgezeigt und erörtert. Das Ergebnis steht am Schluß. Charakteristikum
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden,
 Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU
 Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU 2 DIE MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG (MPU) IST HOCH ANGESEHEN Das Image der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) ist zwiespältig: Das ist
Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU 2 DIE MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG (MPU) IST HOCH ANGESEHEN Das Image der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) ist zwiespältig: Das ist
Zur Rekonstruktion von Interkulturalität
 Zur Rekonstruktion von Interkulturalität Koole & ten Thije (2001) ten Thije (2002) 1 Copyright bei Dr. Kristin Bührig, Hamburg 2004. Alle Rechte vorbehalten. Zu beziehen auf: www.pragmatiknetz.de Zweck
Zur Rekonstruktion von Interkulturalität Koole & ten Thije (2001) ten Thije (2002) 1 Copyright bei Dr. Kristin Bührig, Hamburg 2004. Alle Rechte vorbehalten. Zu beziehen auf: www.pragmatiknetz.de Zweck
Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Kooperation der Lernorte
 Nr: 99 Erlassdatum: 27. November 1997 Fundstelle: BAnz 9/1998; BWP 6/1997; Ergebnisniederschrift Sitzung HA 3/1997 Beschließender Ausschuss: Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
Nr: 99 Erlassdatum: 27. November 1997 Fundstelle: BAnz 9/1998; BWP 6/1997; Ergebnisniederschrift Sitzung HA 3/1997 Beschließender Ausschuss: Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
Professionalisierung interaktiver Arbeit: Das Forschungskonzept
 Wolfgang Dunkel, G. Günter Voß, Wolfgang Menz, Margit Weihrich, Kerstin Rieder Professionalisierung interaktiver Arbeit: Das Forschungskonzept PiA Kick Off IBZ München München, 12.3.2009 Ablauf der Präsentation
Wolfgang Dunkel, G. Günter Voß, Wolfgang Menz, Margit Weihrich, Kerstin Rieder Professionalisierung interaktiver Arbeit: Das Forschungskonzept PiA Kick Off IBZ München München, 12.3.2009 Ablauf der Präsentation
In 20 Tagen sind Sie ein ausgebildeter Trainer,...
 In 20 Tagen sind Sie ein ausgebildeter,... ... wenn Sie sich für eine Heitsch & Partner-ausbildung entscheiden und die folgenden Schritte mit uns gehen. Ihre bei Heitsch & Partner Jens Petersen Sigrun
In 20 Tagen sind Sie ein ausgebildeter,... ... wenn Sie sich für eine Heitsch & Partner-ausbildung entscheiden und die folgenden Schritte mit uns gehen. Ihre bei Heitsch & Partner Jens Petersen Sigrun
BEURTEILUNGS GESPRÄCHEN
 PERSONALENTWICKLUNG POTENTIALBEURTEILUNG DURCHFÜHRUNG VON BEURTEILUNGS GESPRÄCHEN Beurteilung 5. Beurteilungsgespräch 1 Die 6 Phasen des Beurteilungsvorganges 1. Bewertungskriterien festlegen und bekannt
PERSONALENTWICKLUNG POTENTIALBEURTEILUNG DURCHFÜHRUNG VON BEURTEILUNGS GESPRÄCHEN Beurteilung 5. Beurteilungsgespräch 1 Die 6 Phasen des Beurteilungsvorganges 1. Bewertungskriterien festlegen und bekannt
DAS TEAM MANAGEMENT PROFIL IM ÜBERBLICK. Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam.
 Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
Sie arbeiten im Team und wollen besser werden. Das erreichen Sie nur gemeinsam. Das Team Management Profil: Was haben Sie davon? In Unternehmen, die mit dem Team Management Profil arbeiten, entsteht ein
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Das Forschungskonzept: Qualitäts- und Fehlermanagement im Kinderschutz Umsetzung und Sicht der Beteiligten
 Das Forschungskonzept: Qualitäts- und Fehlermanagement im Kinderschutz Umsetzung und Sicht der Beteiligten Prof. Dr. Uwe Flick Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.v. Inhalt Ansatz der Forschung
Das Forschungskonzept: Qualitäts- und Fehlermanagement im Kinderschutz Umsetzung und Sicht der Beteiligten Prof. Dr. Uwe Flick Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.v. Inhalt Ansatz der Forschung
Information zum Projekt. Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier
 Information zum Projekt Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Wir führen ein Projekt durch zur Mitwirkung von Menschen mit Demenz in
Information zum Projekt Mitwirkung von Menschen mit Demenz in ihrem Stadtteil oder Quartier Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Wir führen ein Projekt durch zur Mitwirkung von Menschen mit Demenz in
Führung und Gesundheit. Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können
 Führung und Gesundheit Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können Was ist gesundheitsförderliche Führung? Haben denn Führung und Gesundheit der Mitarbeiter etwas miteinander zu tun?
Führung und Gesundheit Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können Was ist gesundheitsförderliche Führung? Haben denn Führung und Gesundheit der Mitarbeiter etwas miteinander zu tun?
Lehrer-Umfrage "LRS / Legasthenie" im deutschsprachigen Raum LegaKids 2010
 Lehrer-Umfrage "LRS / Legasthenie" im deutschsprachigen Raum LegaKids 2010 Liebe Lehrerinnen und Lehrer, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist eine wesentliche Voraussetzung, um sich in Schule, Beruf
Lehrer-Umfrage "LRS / Legasthenie" im deutschsprachigen Raum LegaKids 2010 Liebe Lehrerinnen und Lehrer, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben ist eine wesentliche Voraussetzung, um sich in Schule, Beruf
WORKSHOPS. Ihr Nutzen: ERLEBNISORIENTIERTE. mit Trainingsschauspielern. Das war das intensivste Training, dass ich je erlebt habe!
 Ihr Nutzen: Wir arbeiten erlebnisorientiert, direkt an den Bedürfnissen und aktuellen Themen der Teilnehmer. Theoretischen Input gibt es immer aufbauend an den genau passenden Stellen. Stephanie Markstahler
Ihr Nutzen: Wir arbeiten erlebnisorientiert, direkt an den Bedürfnissen und aktuellen Themen der Teilnehmer. Theoretischen Input gibt es immer aufbauend an den genau passenden Stellen. Stephanie Markstahler
Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert?
 Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Die Bedeutung der Kinder für ihre alkoholabhängigen Mütter
 anlässlich des 25. Kongresses des Fachverbandes Sucht e.v. Meilensteine der Suchtbehandlung Jana Fritz & Irmgard Vogt Institut für Suchtforschung FH FFM Forschungsprojekte des Instituts für Suchtforschung
anlässlich des 25. Kongresses des Fachverbandes Sucht e.v. Meilensteine der Suchtbehandlung Jana Fritz & Irmgard Vogt Institut für Suchtforschung FH FFM Forschungsprojekte des Instituts für Suchtforschung
Konflikte in Beratungssituationen
 Konflikte in Beratungssituationen Beraten (Einstieg) Ziel jeder Beratung: die diskursive Vermittlung zwischen den Perspektiven Übernahme der Beraterperspektive durch den Ratsuchenden das Ziel vollzieht
Konflikte in Beratungssituationen Beraten (Einstieg) Ziel jeder Beratung: die diskursive Vermittlung zwischen den Perspektiven Übernahme der Beraterperspektive durch den Ratsuchenden das Ziel vollzieht
Bearbeitung von Konflikten und Behandlung von Interessensgegensätzen / Führen von Konfliktgesprächen im Unternehmen
 www.pop-personalentwicklung.de Angebot und Konzeption 2012 zur Qualifizierung von Führungskräften zur Bearbeitung von Konflikten und zur Handhabung von Techniken der Mediation Bearbeitung von Konflikten
www.pop-personalentwicklung.de Angebot und Konzeption 2012 zur Qualifizierung von Führungskräften zur Bearbeitung von Konflikten und zur Handhabung von Techniken der Mediation Bearbeitung von Konflikten
Neue Medien in der Erwachsenenbildung
 Stang, Richard Neue Medien in der Erwachsenenbildung Statement zum DIE-Forum Weiterbildung 2000 "Zukunftsfelder der Erwachsenenbildung" Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Online im Internet: URL:
Stang, Richard Neue Medien in der Erwachsenenbildung Statement zum DIE-Forum Weiterbildung 2000 "Zukunftsfelder der Erwachsenenbildung" Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Online im Internet: URL:
Bildungsstandards konkret formulierte Lernergebnisse Kompetenzen innen bis zum Ende der 4. Schulstufe in Deutsch und Mathematik
 Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Bildungsstandards Da in den Medien das Thema "Bildungsstandards" sehr häufig diskutiert wird, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick zu diesem sehr umfangreichen Thema geben. Bildungsstandards sind konkret
Persönliches Kompetenz-Portfolio
 1 Persönliches Kompetenz-Portfolio Dieser Fragebogen unterstützt Sie dabei, Ihre persönlichen Kompetenzen zu erfassen. Sie können ihn als Entscheidungshilfe benutzen, z. B. für die Auswahl einer geeigneten
1 Persönliches Kompetenz-Portfolio Dieser Fragebogen unterstützt Sie dabei, Ihre persönlichen Kompetenzen zu erfassen. Sie können ihn als Entscheidungshilfe benutzen, z. B. für die Auswahl einer geeigneten
Anleitung. Empowerment-Fragebogen VrijBaan / AEIOU
 Anleitung Diese Befragung dient vor allem dazu, Sie bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Anhand der Ergebnisse sollen Sie lernen, Ihre eigene Situation besser einzuschätzen und eventuell
Anleitung Diese Befragung dient vor allem dazu, Sie bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Anhand der Ergebnisse sollen Sie lernen, Ihre eigene Situation besser einzuschätzen und eventuell
Modelling. Ralf Stumpf Seminare
 Ralf Stumpf Seminare Ralf Stumpf und Mirela Ivanceanu GbR Jablonskistrasse 25 10405 Berlin Fon 0 30-66 30 27 34 www.ralf-stumpf.de info@ralf-stumpf.de Modelling Modelling ist Lernen von einem Vorbild.
Ralf Stumpf Seminare Ralf Stumpf und Mirela Ivanceanu GbR Jablonskistrasse 25 10405 Berlin Fon 0 30-66 30 27 34 www.ralf-stumpf.de info@ralf-stumpf.de Modelling Modelling ist Lernen von einem Vorbild.
1. Für welche Tätigkeitsbereiche haben Sie nach Ihrer Einschätzung in der Vergangenheit die größten Zeitanteile aufgewandt?
 Thema: Rückblick 1. Für welche Tätigkeitsbereiche haben Sie nach Ihrer Einschätzung in der Vergangenheit die größten Zeitanteile aufgewandt? 2. Wie sind Ihre Zuständigkeiten und Aufgaben geregelt bzw.
Thema: Rückblick 1. Für welche Tätigkeitsbereiche haben Sie nach Ihrer Einschätzung in der Vergangenheit die größten Zeitanteile aufgewandt? 2. Wie sind Ihre Zuständigkeiten und Aufgaben geregelt bzw.
Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende. Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten?
 Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten? 1 Was ist «Moral»? «ETHIK» und «MORAL» Moralische Grundsätze
Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten? 1 Was ist «Moral»? «ETHIK» und «MORAL» Moralische Grundsätze
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Evaluation des Projektes
 AuF im LSB Berlin Evaluation des Projektes Führungs-Akademie des DOSB /// Willy-Brandt-Platz 2 /// 50679 Köln /// Tel 0221/221 220 13 /// Fax 0221/221 220 14 /// info@fuehrungs-akademie.de /// www.fuehrungs-akademie.de
AuF im LSB Berlin Evaluation des Projektes Führungs-Akademie des DOSB /// Willy-Brandt-Platz 2 /// 50679 Köln /// Tel 0221/221 220 13 /// Fax 0221/221 220 14 /// info@fuehrungs-akademie.de /// www.fuehrungs-akademie.de
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern
 Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Coaching für Führungskräfte. Potenziale entwickeln
 Coaching für Führungskräfte Potenziale entwickeln Nr. 1, bereiten Probleme. Oder fällt Ihnen auf, dass ehemals hoch leistungswillige und -fähige Mitarbeiter in Führungskompetenz letzter Zeit demotiviert
Coaching für Führungskräfte Potenziale entwickeln Nr. 1, bereiten Probleme. Oder fällt Ihnen auf, dass ehemals hoch leistungswillige und -fähige Mitarbeiter in Führungskompetenz letzter Zeit demotiviert
Kompetenzorientierter Unterrichtsentwurf zum ersten Lernbaustein des E Learning Moduls: Erstellen einer Broschüre zum Thema,,Allergie
 Germanistik David Spisla Kompetenzorientierter Unterrichtsentwurf zum ersten Lernbaustein des E Learning Moduls: Erstellen einer Broschüre zum Thema,,Allergie Thema des Lernbausteins:Was ist eine Allergie?
Germanistik David Spisla Kompetenzorientierter Unterrichtsentwurf zum ersten Lernbaustein des E Learning Moduls: Erstellen einer Broschüre zum Thema,,Allergie Thema des Lernbausteins:Was ist eine Allergie?
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter!
 Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
Planspiele in der Wirtschaft.
 Planspiele in der Wirtschaft. Kompetenz als Erfolgsfaktor Der Wettbewerb der Unternehmen wird immer mehr zu einem Wettbewerb um Kompetenzen. Dazu gehört natürlich fundiertes Sach- und Fachwissen, aber
Planspiele in der Wirtschaft. Kompetenz als Erfolgsfaktor Der Wettbewerb der Unternehmen wird immer mehr zu einem Wettbewerb um Kompetenzen. Dazu gehört natürlich fundiertes Sach- und Fachwissen, aber
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich?
 Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Darum geht es in diesem Heft
 Die Hilfe für Menschen mit Demenz von der Allianz für Menschen mit Demenz in Leichter Sprache Darum geht es in diesem Heft Viele Menschen in Deutschland haben Demenz. Das ist eine Krankheit vom Gehirn.
Die Hilfe für Menschen mit Demenz von der Allianz für Menschen mit Demenz in Leichter Sprache Darum geht es in diesem Heft Viele Menschen in Deutschland haben Demenz. Das ist eine Krankheit vom Gehirn.
Möglichkeiten der Umsetzung der KMK- Förderstrategie aus pädagogischpsychologischer
 Möglichkeiten der Umsetzung der KMK- Förderstrategie aus pädagogischpsychologischer Perspektive Wolfgang Schneider Institut für Psychologie Universität Würzburg Ausgangsproblem: Zunehmende Heterogenität
Möglichkeiten der Umsetzung der KMK- Förderstrategie aus pädagogischpsychologischer Perspektive Wolfgang Schneider Institut für Psychologie Universität Würzburg Ausgangsproblem: Zunehmende Heterogenität
Kreislauf Betriebsberatung Gesundheits-Coaching + Gesundheitsfördernde Führung
 Der Beratungsablauf Im Rahmen dieses Projekts werden insgesamt 20 Kleinbetriebe aus Niederösterreich die Möglichkeit haben, die Betriebsberatung Betriebliches Gesundheits-Coaching und Gesundheitsförderliches
Der Beratungsablauf Im Rahmen dieses Projekts werden insgesamt 20 Kleinbetriebe aus Niederösterreich die Möglichkeit haben, die Betriebsberatung Betriebliches Gesundheits-Coaching und Gesundheitsförderliches
Zeitmanagement. Wie Sie Ihre Zeit erfolgreich nutzen. www.borse-coaching.de. Borse Training & Coaching Wilhelmstr. 16 65185 Wiesbaden 0611 880 45 91
 Zeitmanagement Wie Sie Ihre Zeit erfolgreich nutzen Borse Training & Coaching Wilhelmstr. 16 65185 Wiesbaden 0611 880 45 91 www.borse-coaching.de Zeitmanagement - Zeit für Ihren Erfolg! Laut einer Studie
Zeitmanagement Wie Sie Ihre Zeit erfolgreich nutzen Borse Training & Coaching Wilhelmstr. 16 65185 Wiesbaden 0611 880 45 91 www.borse-coaching.de Zeitmanagement - Zeit für Ihren Erfolg! Laut einer Studie
Mittendrin und dazwischen -
 Verbundprojekt Professionalisierung der regionalen Bildungsberatung in Deutschland Mittendrin und dazwischen - Bildungsberatung für die Beratung der Zielgruppe 50+ Präsentation Nadja Plothe Regionales
Verbundprojekt Professionalisierung der regionalen Bildungsberatung in Deutschland Mittendrin und dazwischen - Bildungsberatung für die Beratung der Zielgruppe 50+ Präsentation Nadja Plothe Regionales
AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010
 Dipl. Naturheilpraktikerin AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010 Sind Sie interessiert an der STEINHEILKUNDE und möchten mehr dazu erfahren? Nachfolgend finden Sie die unterschiedlichen Angebote für Ausbildungen in
Dipl. Naturheilpraktikerin AUSBILDUNGSPROGRAMM 2010 Sind Sie interessiert an der STEINHEILKUNDE und möchten mehr dazu erfahren? Nachfolgend finden Sie die unterschiedlichen Angebote für Ausbildungen in
II. Zum Jugendbegleiter-Programm
 II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
II. Zum Jugendbegleiter-Programm A. Zu den Jugendbegleiter/inne/n 1. Einsatz von Jugendbegleiter/inne/n Seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 setzen die 501 Modellschulen 7.068 Jugendbegleiter/innen ein.
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen
 Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Hinweise in Leichter Sprache zum Vertrag über das Betreute Wohnen Sie möchten im Betreuten Wohnen leben. Dafür müssen Sie einen Vertrag abschließen. Und Sie müssen den Vertrag unterschreiben. Das steht
Siegen beginnt im Kopf. ein Projekt des Fechter-Bundes-Sachsen-Anhalt
 Siegen beginnt im Kopf ein Projekt des Fechter-Bundes-Sachsen-Anhalt Die Wettkampfhöhepunkte der vergangenen Saison haben gezeigt, dass die Fechter des FB S/A durchaus in der Lage sind, Spitzenleistungen
Siegen beginnt im Kopf ein Projekt des Fechter-Bundes-Sachsen-Anhalt Die Wettkampfhöhepunkte der vergangenen Saison haben gezeigt, dass die Fechter des FB S/A durchaus in der Lage sind, Spitzenleistungen
Artikel 161 'Gesprächsforschung und Kommunikationstraining'
 Reinhard Fiehler Institut für deutsche Sprache Postfach 10 16 21 D-68016 Mannheim 0621 / 1581-215 fiehler@ids-mannheim.de Artikel 161 'Gesprächsforschung und Kommunikationstraining' HSK "Text- und Gesprächslinguistik"
Reinhard Fiehler Institut für deutsche Sprache Postfach 10 16 21 D-68016 Mannheim 0621 / 1581-215 fiehler@ids-mannheim.de Artikel 161 'Gesprächsforschung und Kommunikationstraining' HSK "Text- und Gesprächslinguistik"
Erziehungswissenschaften: 35 LP
 Erziehungswissenschaften: 35 LP Module für Psychologie (Realschule: 14 LP, Modellstudiengang Gymnasium: 12 LP) LP Modulbezeichnung Angebote studienbegleit. Teilprüfungen 4 EWS 1 Pädagogische Psychologie
Erziehungswissenschaften: 35 LP Module für Psychologie (Realschule: 14 LP, Modellstudiengang Gymnasium: 12 LP) LP Modulbezeichnung Angebote studienbegleit. Teilprüfungen 4 EWS 1 Pädagogische Psychologie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
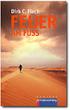 Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Ein Vorwort, das Sie lesen müssen! Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem entschieden. Sie
Unvoreingenommene Neugier
 Grundhaltung: Unvoreingenommene Neugier Das ist die Haltung des Forschers. Er beschäftigt sich nicht mit unbewiesenen Annahmen und Glaubenssätzen, sondern stellt Hypothesen auf und versucht, diese zu verifizieren
Grundhaltung: Unvoreingenommene Neugier Das ist die Haltung des Forschers. Er beschäftigt sich nicht mit unbewiesenen Annahmen und Glaubenssätzen, sondern stellt Hypothesen auf und versucht, diese zu verifizieren
Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft
 -1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
-1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht
Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung
 DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
Qualitätsbereich. Mahlzeiten und Essen
 Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Konflikte sind immer persönlich
 Konflikte sind immer persönlich Wie Charaktere unsere Konflikte initiieren und steuern PRO9 Personal bietet Ihnen eine wissenschaftlich fundierte Fortbildung im charakterorientierten Konfliktmanagement.
Konflikte sind immer persönlich Wie Charaktere unsere Konflikte initiieren und steuern PRO9 Personal bietet Ihnen eine wissenschaftlich fundierte Fortbildung im charakterorientierten Konfliktmanagement.
Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen
 Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen auf der Grundlage des Anforderungs- und Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der Pflege und persönlichen Assistenz älterer
Leitfaden zum Personalentwicklungsgespräch für pflegerische Leitungen auf der Grundlage des Anforderungs- und Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der Pflege und persönlichen Assistenz älterer
Deutschland-Check Nr. 35
 Beschäftigung älterer Arbeitnehmer Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 13. Dezember 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer Ergebnisse des IW-Unternehmervotums Bericht der IW Consult GmbH Köln, 13. Dezember 2012 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668
