von Heiner Rassbeck und Wolfgang Scheremet
|
|
|
- Charlotte Franke
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Diskussionspapiere Discussion Papers Diskussionspapier 25 Gespaltener Arbeitsmarkt im vereinten Deutschland von Heiner Rassbeck und Wolfgang Scheremet Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin German Institute for Economic Research, Berlin
2 Die in diesem Papier vertretenen Auffassungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Verfassers und nicht in der des Instituts. Opinions expressed in this paper are those of the author and do not necessarily reflect views of the Institute.
3 Diskussionspapier 25 Gespaltener Arbeitsmarkt im vereinten Deutschland von Heiner Flassbeck und Wolfgang Scheremet Berlin, im Juni 1991
4 2 I Einleitung Die wirtschaftliche und die politische Vereinigung Deutschlands sind formal vollzogen. Die Lebensbedingungen der Menschen in beiden Teilregionen Deutschlands haben sich dank massiver Finanztransfers von West nach Ost angenähert, auch wenn die Kluft noch groß bleibt. Zwar ist Deutschland noch weit vom Endziel der politischen Vereinigung, der Gleichheit der Lebensverhältnisse, entfernt, doch kann Solidarität des Westens hier viel bewirken. Gleichwohl bleibt Deutschland wirtschaftlich tief gespalten. Diese Spaltung manifestiert sich am Arbeitsmarkt. Hier hat die wirtschaftliche und politische Vereinigung keinerlei Annäherung der Verhältnisse gebracht, sondern den Graben vertieft. Ostdeutschland, wo Vollbeschäftigung über 40 Jahre eines der obersten staatlichen Ziele war, erlebte binnen weniger Wochen einen fast völligen Zusammenbruch des Arbeitsmarktes, während Westdeutschland die beste Arbeitsmarktentwicklung seit Jahrzehnten registrierte. Einige ausgewählte Arbeitsmarktzahlen verdeutlichen die Dimension der Spaltung. Während im zweiten Halbjahr des Jahres 1990 in Westdeutschland die Zahl der Erwerbstätigen um oder 3,1 vh gegenüber dem Vorjahr zunahm, sank die Zahl der erwerbstätigen Personen im Osten Deutschlands um 1,3 Millionen oder um 14 vh. Im verarbeitenden Gewerbe, in dem rund 40 vh der Arbeitskräfte beschäftigt waren, reduzierte sich der Bestand an Arbeitsplätzen um knapp 20 vh. Aufgrund dieses drastischen Abbaus von Arbeitsplätzen in nicht mehr wettbewerbsfähigen Sektoren und Branchen, der nicht mit der Schaffung einer entsprechend großen Zahl von neuen Arbeitsplätzen verbunden war, stieg die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland in kürzester Zeit dramatisch an. Ende April 1991 wurden etwa Arbeitslose registriert. Dies entspricht einer Rate von 9,5 vh. Der Umfang des Beschäftigungseinbruchs läßt sich aber nicht allein mit dem Blick auf die Arbeitslosigkeit abgreifen. Zusätzlich zum Arbeitslosenbestand müssen auch Niveau und Entwicklung der Kurzarbeit, sowie die Besonderheiten
5 3 des Arbeitsförderungsgesetzes für das Gebiet der früheren DDR, mit in die Arbeitsmarktanalyse einbezogen werden. Die Kurzarbeiterregelung des Einigungsvertrages sieht vor, daß Kurzarbeitergeld auch dann gewährt wird, wenn ein Auftragsmangel nicht nur vorübergehender Natur, sondern dauerhaft ist, bzw. wenn Entlassungen durch betriebsorganisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vermieden werden können. Kurzarbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument, die unter diese Regelung fällt, ist daher nicht mit der Kurzarbeit in Westdeutschland gleichzusetzen. Im Gegenteil, diese Kurzarbeit hat mehr den Charakter von Arbeitslosigkeit. Der durchschnittliche Arbeitsanfall der zwei Millionen Kurzarbeiter lag Ende April 1991 bei 56 vh. Im September des vorangegangenen Jahres hatte er noch bei 44 vh gelegen. Während damals noch für 32 vh der Kurzarbeiter die Arbeitszeit um mehr als die Hälfte reduziert gewesen war, belief sich dieser Anteil im April ebenfalls auf etwa 56 vh. Aber nicht nur der durchschnittliche Arbeitsausfall pro Kurzarbeiter stieg, es erhöhte sich auch kontinuierlich die individuelle Dauer der Betroffenheit von Kurzarbeit. So arbeiteten im April bereits 61 vh der Kurzarbeiter länger als 6 Monate verkürzt und für weitere 28 vh dauerte die Kurzarbeit zwischen drei und 6 Monate. Rechnet man den durchschnittlichen Arbeitsausfall von über 50 vh auf Vollzeitarbeitslose um, so wäre die Zahl der Arbeitslosen um mehr als eine Million höher anzusetzen. Die so um das Vollzeitäquivalent der Kurzarbeit korrigierte Arbeitslosenquote läge dann im April 1991 bei etwa 22 vh (vgl. Abb. 1).
6 4 II Die wirtschaftliche Entwicklung vor und nach der Währungsunion 1 Die Entwicklung der Arbeitsmärkte im vereinigten Deutschland sind das Spiegelbild des wirtschaftlichen Gefälles der Gütermärkte zwischen Ost- und Westdeutschland. Die gemeinsame Ursache für diese Entwicklung - auf der einen Seite der stärkste Anstieg der Beschäftigung seit Ende der sechziger Jahre und auf der anderen Seite ein Beschäftigungseinbruch von unvergleichlichem Ausmaß - ist der schon seit langem angelegte Niedergang der Wirtschaft in Ostdeutschland. Zentral geplante und verwaltete Wirtschaftssysteme sind nur dann funktionsfähig, wenn sie Inflation zulassen bzw. bewußt einsetzen. Diese fundamentale Einsicht liberaler Ökonomen 2 führt zum Kern der Erklärung der überaus schlechten Ausgangssituation der ehemaligen DDR zu Beginn des vergangenen Jahres. Die These Inflation sei ein Grundübel von Planwirtschaften, scheint paradox blieb doch in der Regel in solchen Wirtschaftssystemen das Preisniveau konstant, ja haben die Machthaber doch strikt darauf geachtet, daß nominale Einkommenssteigerungen nicht durch Preissteigerungen entwertet wurden. Das heißt aber nur, daß offene Inflation nicht aufgetreten ist und schließt das Phänomen, das man "zurückgestaute Inflation" nennt, nicht aus. Die Inflationierung der Wirtschaft zeigt sich nicht in steigenden Preisen, aber gleichwohl in "zuviel Geld für zuwenig Güter". Planwirtschaften können ihre Produkte nur absetzen, wenn ein permanenter Kaufkraftüberhang besteht. Dieser Kaufkraftüberhang (Geldüberhang) kann nur entstehen, wenn den in Geldeinheiten ausgezahlten Löhnen 1 Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung nach der Währungsunion geben: Akerlof, G.A. und A.K. Rose, J.L. Yellen, H. Hessenius, Vortragsmanuskript für die Konferenz des Brooking Panel on Economic Activity, Washington D. Co, Lipschitz, L. und D. McDonald (Hrsg.) German Unification - Economic Issues, International Monetary Fund, Occasional Paper 75, Washington D.C Vgl. z.b. Eucken: Deutschland vor und nach der Währungsreform und F.A. Hayek Vollbeschäftigung, Planwirtschaft und Inflation, in: A. Hunold, Vollbeschäftigung, Inflation und Planwirtschaft, Erlenbach-Zürich, 1951.
7 5 und sonstigen Einkommen kein Güterangebot entspricht, das die Haushalte auch nachfragen würden, wenn sie Entscheidungsfreiheit hätten. Da aber die Grenzen geschlossen sind, gibt es keine Entscheidungsfreiheit. Die gemessene Produktivität von Planwirtschaften ist also zwingend falsch, weil sie Produktion mißt, deren Produkte in der angebotenen Qualität und Menge von den Konsumenten nicht nachgefragt würden, wenn Wahlmöglichkeiten bestünden. Um die Kausalität noch einmal zu verdeutlichen: Weil das planwirtschaftliche System nicht in der Lage ist, auf die Präferenzen der Konsumenten in der nötigen Differenzierung und Menge einzugehen, bzw. Präferenzen zu erzeugen, wie das der Unternehmer in der Marktwirtschaft tut, kann es die qualitativ schlechten und in unzureichender Menge angebotenen Produkte nur verkaufen, wenn ein permanenter Kaufkraftüberhang geschaffen wird. Dieser entsteht durch zu hohe Löhne, d.h. Löhne, die die gemessene Produktivität nicht, die potentielle (marktmäßige) Produktivität aber deutlich übersteigen. Durch die relativ hohen Löhne wird der Eindruck eines relativ hohen Wohlstands vermittelt, der aber, wie ein Blick in die Regale der Kaufhäuser zeigte, tatsächlich nicht existiert. Das ist die spezifische Form von Geldillusion, mit der Planwirtschaften operieren. Die Verwirklichung dieser Illusion hat einen hohen Preis. Da die hohen Reallöhne nicht nur in der Form hoher Nominallöhne, sondern ganz massiv auch durch das künstliche Niedrighalten der Preise mit Hilfe von Subventionen ("zweite Lohntüte") realisiert werden, kommt es zu enormen Allokationsverzerrungen in Form von Verschwendung von Energie, Wasser und Lebensmitteln beispielsweise oder den täglichen Warteschlangen und der Hortungsmentalität der Käufer. Noch entscheidender aber ist, daß die Volkswirtschaft dieses permanente "über die Verhältnisse leben" nur mit einem Substanzverzehr, also mit sinkenden Nettoinvestitionen, erkaufen kann. Der Konsumstandard ist nur hoch, weil darin nicht der Wertverlust an Gebäuden, die Veralterung des Kapitalstocks und die enorme Belastung der Umwelt zum Ausdruck kommt. Erst die Konfrontation mit Marktbedingungen und der Abbau der Subventionierung
8 zeigten, wie obsolet die sachlichen Produktionskapazitäten sind und wie niedrig der Lebensstandard tatsächlich war. 6 Mit der Einführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 1990 wurde der Eindruck erweckt, als sei die Umstellung aller laufenden Transaktionen, also auch der Löhne, zu einem Kurs von 1:1 wirtschaftlich vertretbar gewesen bzw. von der Solidarität des Westens gedeckt. Gleichzeitig setzte die Politik auf die Freisetzung innerer Dynamik in Ostdeutschland, der Einführung der Marktwirtschaft. Hier liegt die entscheidende Lnkonsistenz des politischen Handelns. Ein Weg zur Freisetzung von Marktkräften wäre sowohl über ein niedriges Lohn- und Kostenniveau in Ostdeutschland denkbar gewesen als auch - bei einem höheren Lohnniveau - mit Hilfe ausreichend großer Solidarität im Westen. Gewählt wurde aber ein Weg relativ hoher Löhne in Ostdeutschland, ohne für eine ausreichende Solidarität im Westen zu sorgen. Das heißt, schon mit der konkreten Umsetzung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde implizit die Entscheidung getroffen, die wirtschaftliche Vereinigung um den Preis der Spaltung der Arbeitsmärkte durchzuführen. Mit anderen Worten, den Großteil der Kosten der Anpassung müssen - wieder einmal - die Arbeitslosen tragen, während die Gesellschaft als Ganzes mit marginalen Einschränkungen ihres Lebensstandards davonzukommen versucht. Der zentrale Denkfehler vieler Politiker war sicherlich die allzu schlichte Übertragung der Erfahrungen mit der Währungs- und Wirtschaftsreform von 1948 in der Bundesrepublik auf die Verhältnisse in Ostdeutschland. Viele glaubten, schon durch die Einführung der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen - ganz unabhängig von deren konkreter Ausgestaltung - sei wirtschaftliche Dynamik zu erreichen. Schematisch gesprochen, die Einführung der Marktwirtschaft würde in einem Diagramm mit einer hypothetischen Angebots- und Nachfragefunktion eine Verschiebung der gesamtwirtschaftlichen Angebotskurve nach rechts bewirken. Das Resultat wären sinkende Preise bei einer gleichzeitigen Ausweitung der
9 7 Transaktionsmenge gewesen. Diese naive Vorstellung ist gründlich widerlegt worden. Über den Erfolg der Einführung von Marktwirtschaft und der Öffnung der Grenzen zum Weltmarkt entscheidet in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit, also das relative Kostenniveau, einer Volkswirtschaft. Der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik während der fünfziger Jahre etwa war der Exportsektor, dessen Expansion durch eine unterbewertete D-Mark sowie durch langanhaltende Konstanz der Lohnstückkosten möglich war. Die Einführung der D-Mark, bedeutete implizit einen Wechselkurs von 1:1 für alle laufende Transaktionen zu akzeptieren. Nimmt man den internen Verrechnungskurs der ehemaligen DDR zum Vergleich, ist das mit einer 300-prozentigen Aufwertung der Währung für das Wirtschaftsgebiet Ostdeutschlands gleichzusetzen. Die Auswirkungen dieses Aufwertungsschocks waren lehrbuchgemäß. Die erheblich verbilligten Importgüter lösten einen Importsog aus. Exportgüter konnten wegen zu hoher Preise und/oder unzureichender Produktqualität weder auf den Inlandsmärkten noch auf den Auslandsmärkten abgesetzt werden. Auch im Handel Ostdeutschlands mit den früheren RGW-Ländern, dem vielfach eine Pufferfunktion zur Abfederung der Strukturanpassung zugewiesen wurde, konnten keine weiteren Erfolge erzielt werden. Durch die Umstellung der Abrechnung von Transfer-Rubel auf konvertierbare Währungen wurden die ostdeutschen Produkte auch dort zu teuer. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Ostdeutschland verschlechterte sich zusätzlich durch zweistellige Zuwachsraten der Löhne und Gehälter, die nicht durch entsprechende Produktivitätszuwächse ausgeglichen werden konnten. Kostensenkungsspielräume durch die Verbilligung von Vorprodukten, den Abbau hoher staatlicher Abgaben und die Freisetzung von Arbeitskräften reichten nicht aus oder konnten angesichts des Ausmaßes des Produktionseinbruchs nicht umgesetzt werden. Sogar das Gegenteil trat ein: die Produktivität hat sich im Verlauf des zweiten Halbjahres 1990 erheblich verringert, während die Kosten stiegen. Insgesamt kam es nicht zu der erwarteten Verschiebung der Angebotskurve nach rechts, sondern - durch den Verlust der Inlands- und der Export-
10 8 markte - zu einer Linksverschiebung der Nachfragekurve bei einer gleichzeitigen Verschiebung der Angebotskurve nach links aufgrund der Verschlechterung der Kostensituation. Der Gesamteffekt war eine dramatische Verringerung der im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Industrieproduktion sank innerhalb eines halben Jahres um 50 vh (vgl. Abb. 2). Die durch die Transferströme von West nach Ost stabilisierten Einkommen wurden folglich überwiegend im Westen nachfragewirksam. Das reale Bruttoinlandsprodukt Westdeutschlands stieg im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres um 5,5 vh. Dadurch konnte die Beschäftigung im gleichen Zeitraum um 3,1 vh - das sind knapp neue Arbeitsplätze innerhalb eines Jahres - expandieren. Das war der sowohl relativ als auch absolut kräftigste Anstieg der Beschäftigung im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik. Insbesondere die verbrauchsnahen Bereiche, wie die Nahrungs- und Genußmittelindustrie, das verbrauchsgüterproduzierende Gewerbe sowie der Handel, profitierten von dem Nachfrageschub aus Ostdeutschland. III Der Pendlerstrom als Scharnier der Arbeitsmärkte in Ost- und Westdeutschland Auch wenn sich die beiden Arbeitsmärkte weiterhin auseinanderbewegen, sind die Entwicklungen dennoch nicht unabhängig voneinander. Das Scharnier, das die beiden Arbeitsmärkte verbindet, ist die Arbeitskräftewanderung von Ostnach Westdeutschland. Infolge dieser Wanderung - in Form von echter Migration und durch Pendlerströme - ist es in Zukunft kaum mehr möglich, Strategien für einen Arbeitsmarkt zu entwickeln, ohne die Reaktionen von ökonomischen Variablen des anderen Teilarbeitsmarktes zu berücksichtigen. Massive Auswirkungen hat diese Migrationsbereitschaft - im weiteren sollen unter Migration sowohl echte Umzüge als auch Pendler subsummiert werden -auf das Niveau der Löhne und Gehälter in Ostdeutschland. Die Migrationsbereitschaft ist innerhalb Deutschlands durch die gleiche Sprache, die relativ
11 9 große soziale Akzeptanz der Migranten und durch die äußerst geringen Migrationskosten sehr hoch. Diese hohe Migrationsbereitschaft fällt nun mit äußerst ungünstigen Rahmenbedingungen in Ostdeutschland zusammen. Die monatlichen Durchschnittseinkommen lagen in Ostdeutschland im Durchschnitt der zweiten Jahreshälfte 1990 bei knapp DM und in Westdeutschland bei etwa DM. Das durchschnittliche Einkommen lag also in Ostdeutschland bei etwa 40 vh des westdeutschen Niveaus. Nimmt man die erheblich ungünstigeren Arbeitsmarktperspektiven in Ostdeutschland hinzu, ist es nicht verwunderlich, daß es zu ausgeprägten Wanderungsbewegungen von Ostnach Westdeutschland kommt. Das Ausmaß der Migration quantitativ abzugreifen ist allerdings äußerst schwierig, da die Zahl der Übersiedler seit Öffnung der Grenzen nicht mehr erfaßt wird. Vorläufige Schätzungen gehen für 1990 von etwa Personen im erwerbsfähigen Alter aus, die ihren Wohnsitz von Ost- nach Westdeutschland verlegt haben. Hinzu kamen am Jahresende 1990 noch etwa Pendler. Diese Abwanderung von Arbeitskräften könnte sich zu einem erheblichen Hemmniss beim Wiederaufbau Ostdeutschlands erweisen, da damit ein wichtiger Standortvorteil des Gebietes der früheren DDR, nämlich das gut ausgebildete Arbeitskräftepotential, gefährdet ist. Nicht zuletzt auch mit Blick auf diese Abwanderung von "Humankapital" wurden die erheblichen Einkommenszuwächse der vergangenen Monate in Ostdeutschland begründet. Mit diesem Argument, sowie mit dem Hinweis auf die ökonomische Gesetzmäßigkeit, daß auf einem Markt für ein homogenes Gut nur ein einheitlicher Preis möglich ist, wurden Einkommensverbesserungen von 30 vh innerhalb eines Jahres gerechtfertigt (im Durchschnitt des zweiten Halbjahres 1990). Im Jahr 1991 werden die Tariflöhne noch stärker steigen, nämlich um etwa 60 vh. Die zentrale wirtschaftspolitische Frage ist, ob solche Lohnerhöhungen bei verbundenen Arbeitsmärkten als Marktergebnis interpretiert werden und damit
12 10 hingenommen werden müssen. Das wäre dann der Fall, wenn - schematisch gesprochen - das Ausmaß der Mobilität von Arbeit erklären kann, daß das Tempo des Lohnanstieges das Tempo der Produktivitätsentwicklung so wesentlich überschreitet. Wären dagegen diese Lohnsteigerungen nicht Marktergebnis, sondern Ausdruck der Tatsache, daß die Gewerkschaften ein Machtvakuum auf Seiten der Arbeitgeber ausnutzen, muß die Wirtschaftspolitik damit rechnen, daß zusätzliche Hilfen für die Wirtschaft in Ostdeutschland lediglich dazu führen, daß die Gewerkschaften solche wirtschaftspolitischen Maßnahmen - ohne zusätzliche Sanktionen des Arbeitsmarktes befürchten zu müssen - zum Anlaß für eine noch raschere Lohnangleichung nehmen. Bestätigte sich diese Hypothese, wäre weitgehende Abstinenz des Staates angebracht, um diese Lohnanpassungsstrategie über Sanktionen des Arbeitsmarktes zu unterlaufen und die moral hazard-konstellation für die Gewerkschaften zu beenden. Letzteres scheint im Verlauf des Jahres 1991 notwendig zu werden, denn die Hypothese, die rasche Angleichung der Löhne von Ost- an Westdeutschland könne als Marktergebnis interpretiert werden, erweist sich bei näherem Hinsehen als nicht stichhaltig. Das reine Marktmodell läßt sich wie folgt skizzieren: Öffnet man die Grenzen zwischen zwei Ländern mit unterschiedlicher Kapitalausstattung, Arbeitsproduktivität und Lohnniveau zu einem Wechselkurs, der die Produktionsniveaus in beiden Ländern gerade stabilisiert, also wettbewerbsneutral ist, dann werden offensichtlich bei mobiler Arbeit Abwanderungen aus dem Niedriglohnland - in das Hochlohnland - einsetzen. Die Wanderung führt dazu, daß in dem Niedriglohnland Arbeitskräfte knapp werden und im Hochlohnland ein Angebotsüberschuß an Arbeit entsteht. Daraus ergibt sich eine Nivellierungstendenz der Löhne (steigende im Niedriglohnland, sinkende im Hochlohnland), die Grenzunternehmen im Niedriglohnland zur Schließung zwingt und im Hochlohnland neue Produktionsmöglichkeiten entstehen läßt. Entscheidend für die Beurteilung dieser Situation ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Offensichtlich entsteht infolge der Mobilität von Arbeit in keinem der beiden Länder dauerhafte Arbeitslosigkeit. Insbesondere die Situation im
13 11 Niedriglohnland ist gekennzeichnet von Arbeitskräfteknappheit, nicht aber von Arbeitskräfteüberfluß und Arbeitslosigkeit. Daß sich die Lohnentwicklung dort von der Produktivitätsentwicklung vorübergehend löst, ist Ausdruck von Arbeitskräftemangel und - unter Marktbedingungen - niemals mit dem Entstehen von Arbeitslosigkeit verbunden. Das läßt für die Beurteilung der Situation der Arbeitsmärkte in Deutschland nur einen Schluß zu: Mit der Einführung der Währungsunion, also quasi einem Wechselkurs von 1:1 für alle laufenden Transaktionen, wurde in Ostdeutschland schon ein Lohnniveau fixiert, das die Wanderungsbereitschaft der Menschen in Ostdeutschland falsch eingeschätzt hat. Das explosionsartige Ansteigen der Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zeigt, daß damit nicht ein Lohnniveau festgelegt wurde, das aufgrund der Mobilität von Arbeit notwendig gewesen wäre. Dem Grad der Mobilität hätte ein Wechselkurs und damit ein Lohnniveau in Ostdeutschland entsprochen, das dort eine Konstellation mit Arbeitskräfteknappheit erzeugt hätte. Doch selbst wenn dieser Anfangsirrtum aus vielen Gründen nicht zu vermeiden gewesen ist, dann bietet doch das Mobilitätsargument keinerlei Erklärung für das andauernde Auseinanderlaufen der Arbeitsmarktentwicklung in Ost und West. Sinkende Arbeitslosigkeit in Westdeutschland trotz Zuwanderung und steigende in Ostdeutschland trotz Abwanderung verlangt - den Marktgesetzen folgend - steigende Löhne in Westdeutschland und sinkende in Ostdeutschland um die Wettbewerbsverhältnisse auf den Gütermärkten und damit die Arbeitsmarktperspektiven in beiden Teilen einander anzunähern. Die Wanderung stoppen kann man dadurch freilich auch nicht 3. Es ist aber eine falsche Sicht zu sagen, der Wanderungsprozeß könne durch eine rasche Lohnangleichung gestoppt werden, wenn unbestreitbar 3 Man müßte hinzufügen: Weil Märkte nicht bestimmte Mengenbewegungen zum Stillstand bringen wollen, sondern ähnliche Bedingungen von Angebot und Nachfrage auf allen Märkten herzustellen tendieren.
14 12 ist, daß das Niedriglohnland dem Hochlohnland im Wettbewerb auf den Gütermärkten weit unterlegen ist und dadurch die Ausgangssituation von Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Das läßt sich an einem einfachen Modell leicht zeigen 4. IV. Die Auswirkung der Lohnentwicklung auf Migration und Kapitalstockanpassung Die Situation der ostdeutschen Ökonomie ist, im Vergleich zu westlichen Industrieländern, gekennzeichnet durch einen alten unproduktiven Kapitalstock. Mittels dieses Kapitalstocks konnte nur produziert werden solange die Wirtschaft abgeschottet war. Bei einer offenen Volkswirtschaft ist ein neuer Kapitalstock zu schaffen, der Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Gütermärkten gewährleistet. Der Aufbau dieses neuen Kapitalstocks muß zunächst vom Westen finanziert werden, da die Kapitalbildung in Ostdeutschland nicht ausreichend sein kann solange kein sich selbst tragender Aufschwung in Gang kommt. Da der Industriestandort Ostdeutschland mit anderen Standorten konkurrieren muß, ist die Kapitalakkumulation in Ostdeutschland aber nicht unabhängig von den Bedingungen auf anderen Märkten. Der gewünschte Kapitalstock in Ostdeutschland hängt daher nicht nur vom Lohnniveau Ost sondern auch vom Lohnniveau West ab. Zusätzlich sind für die Investitionsentscheidungen aber auch andere Rahmenbedingungen, wie Infrastrukturausstattung, politische Stabilität, Gesetzgebung usw. relevant. Die Investitionsfunktion zur Darstellung der Kapitalakkumulation ist keynesianischen Ursprungs. Sie kann unter der Annahme 4 Meckel, Jürgen (1990), Lohnpolitik als Instrument zur Eindämmung der deutsch deutsch en Übersiedlung, Diskussionspapiere Serie II- Nr. 110, Sonderforschungsbereich 178, Universität Konstanz.
15 13 exogener Güterpreise und Finanzmarktzinssätze, konvexer Anpassungskosten mikrotheoretisch fundiert werden und hat etwa folgendes Aussehen 5. I = I(w - w, c - c) + w sei das Lohnniveau des konkurrierenden Wirtschaftsraumes - hier Westdeutschland - w das Lohnniveau in Ostdeutschland. In c bzw. c sind die sonstigen Rahmenbedingungen - als "State of the Nature" - zusammengefaßt, die für Investitionsentscheidungen relevant sind. Das Lohnniveau bestimmt bei gegebenen Preis und Zins das optimale Einsatzverhältnis von Kapital und Arbeit und beeinflußt so die Kapitalkumulation. Das Lohnniveau und die "States of the Nature" in Westdeutschland beeinflussen die Kapitalbildung in Ostdeutschland über die optimale Aufteilung der finanziellen Ressourcen zwischen Ost- und Westdeutschland. Zur Vereinfachung ist angenommen, die Differenz der jeweiligen Größen sei für die Investitionsentscheidung relevant. Die angegebenen Vorzeichen zeigen die komperativ-statischen Eigenschaften der Funktion. Langfristig führt so eine konstante Differenz der Lohnsätze zu einer konstanten Investitionsnachfrage in Ostdeutschland 6. 5 Modelle dieser Art sind selbstverständlich nicht geeignet, die wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen beiden Teilen Deutschlands unmittelbar adäquat abzubilden. Insbesondere die Annahme exogener Güterpreise ist generell nicht gerechtfertigt. Das Preisniveaus in Westdeutschland paßt sich sicherlich - keynesianisch - an die Lohnentwicklung an. Gleichwohl lassen sich mit diesem Modell einige Grundzusammenhänge verdeutlichen, weil durch die Wettbewerbsverhältnisse auf dem Gütermarkt für Ostdeutschland das Preisniveau tatsächlich vorgegeben ist, so daß hier die neoklassichen Mechanismen voll greifen. Zur mikrotheoretischen Fundierung der Investitionsfunktion vgl.: Söderström, H. T., (1976), Produktion and Investment under Costs of Adjustment, A Survey, Zeitschrift für Nationalökonomie 36, S Eine Differenz der Löhne von null führt nicht notwendigerweise zu Investitionen von null!
16 14 Mit zunehmender Kapitalakkumulation steigt die Summe der Abschreibungen und somit die der Ersatzinvestitionen. Der Steady-State ist erreicht (d.h. der Kapitalstock bleibt unverändert), wenn die Summe der Abschreibungen gerade den Investitionen entsprechen, die Nettoinvestitionen also gleich Null sind. Der gewünschte Kapitalstock ist definiert durch: K*(w - w, c - c) =, = 1,2 OÍ Der Index 1 bezeichnet im folgenden den bestehenden Kapitalstock, der Index 2 den neu aufzubauenden Kapitalstock. Die Kapitalakkumulation erfolgt über eine einfache Akzeleratorgleichung: K. «Ô.KOv - w, c - c) - KJ, i = ia K 2 zeichnet sich durch neue Technologie, höhere Kapitalproduktivität sowie ein höheres Kapital-Arbeits-Einsatzverhältnis aus (implizit resultiert daraus eine höhere Arbeitsproduktivität). Erweiterungsinvestitionen werden primär in den neuen Kapitalstock getätigt. Wie weiter unten beschrieben, wird in Bezug auf den alten Kapitalstock lediglich desinvestiert. Die Migrationsentscheidung ist nicht lediglich durch die Differenz der Lohnhöhe zwischen Ost- und Westdeutschland determiniert. Vielmehr wird auch die Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen, durch ein Beschäftigungsverhältnis ein bestimmtes Einkommen zu erzielen. Relevant für die Modellierung einer Migrationsfunktion sind daher weniger die Lohndifferenz als vielmehr die
17 15 Unterschiede in den erwarteten Einkommen. Bestätigt wird diese Hypothese durch empirische Untersuchungen über die Arbeitskräftewanderung der sechziger und siebziger Jahre. Es zeigt sich, daß für die Arbeiterwanderung nach Westdeutschland, die Arbeitslosenquote und damit die Beschäftigungswahrscheinlichkeit sowohl im Heimatland als auch in der Bundesrepublik verantwortlich waren 7. Zur Vereinfachung benutzen wir für das erwartete Einkommen das Produkt aus Lohn- und Beschäftigungsquote. Die Beschäftigungsquote wiederum ist der Quotient aus Arbeitsnachfrage (L) und Arbeitsangebot (N). N Folglich ist die Beschäftigungsquote gleich 1- Arbeitslosenquote. Kurzfristig ist die Arbeitskräftenachfrage bei einer gegebenen Kapitalausstattung durch die Höhe des Lohnsatzes fixiert. Langfristig bestimmt die Höhe des Lohnes die Kapitalausstattung und damit die Beschäftigung. Die Wirkungsrichtung ist bei beiden Variablen dieselbe. Die Arbeitsnachfrage hängt negativ vom Lohnsatz ab. Bei inflexiblen Löhnen ist das Ausmaß der Arbeitslosigkeit positiv mit der Höhe des Lohnsatzes korreliert. Damit ist die Entwicklung der erwarteten Einkommen bei Lohnänderungen nicht eindeutig (z._b. der Lohn steigt, die Arbeitsnachfrage geht zurück). In welche Richtung sich das Produkt aus Lohnsatz und Beschäftigung bei einer Lohnerhöhung bewegt, hängt von der Elastizität des erwarteten Einkommens bezüglich einer Lohnsatzänderung ab. Wird das erwartete Einkommen in Beziehung zu dem Kapitalkostenanteil an den Gesamtkosten und zu der Faktorsubstitutionselastizität gesetzt, so kann gezeigt werden, daß bei gegebenem Kapitalstock die Wirkungsrichtung von Lohnänderungen auf das erwartete 7 Vgl. Smolny, W., (1990) Macroeconomic Consequences of International Labour Migration, Diskussionspapier Serie II - Nr. 123, Sonderforschungsbereich 178, Universität Konstanz.
18 16 Einkommen von bestimmten Konstellationen dieser beiden Parameter abhängt 8. Das erwartete Einkommen steigt infolge einer Lohnerhöhung, wenn die Summe aus Faktorsubstitutionselastizität und Kapitalkostenanteil positiv ist. Eine notwendige Bedingung dafür ist aber, da der Kapitalkostenanteil zwischen null und eins liegt, daß die Faktorsubstitutionselastizität größer als -1 ist. Änderungen des Lohn-Zinsverhältnisses bewirken in diesem Fall nur geringe Änderungen des Einsatzverhältnisses von Kapital und Arbeit, d.h. das Rationalisierungspotential der Wirtschaft in dieser Situation ist gering. Bei für den ostdeutschen Wirtschaftsraum plausiblen Werten dieser beiden Parameter allerdings - nämlich einem hohen Rationalisierungspotential und relativ geringernn Kapitalkostenanteil - wird der positive Effekt einer Lohnsatzerhöhung auf das erwartete Einkommen durch den negativen Effekt der geringeren Beschäftigungswahrscheinlichkeit überkompensiert. Bei dieser Konstellation steigt zwar das absolute Lohnniveau, aber die erwarteten Einkommen sinken. Die Arbeitskräftewanderung wird durch folgende Funktion modelliert (Ñ > 0 bedeutet Abwanderung aus Ostdeutschland): N = k HyvJC) - fry* w ' - w b(n) N J k > 0 ê'(n) > 0 b (AO ist die Beschäftigungsquote in Westdeutschland. Sie hängt positiv von der Zahl der Personen ab, die in Ostdeutschland als Arbeitsanbieter auftreten; d.h. je mehr Arbeitskräfte von Ost- nach Westdeutschland wandern umso geringer 8 Vgl. Meckel 1990, (Anm. 4).
19 17 ist die Beschäftigungswahrscheinlichkeit (-quote) in Westdeutschland aufgrund des zusätzlichen Arbeitskräfteangebotes. Damit wird deutlich, daß die Abwanderung von Arbeitskräften aus Ostdeutschland durch eine Angleichung des Lohnsatzes an das westdeutsche Niveau nicht zu verhindern ist. Es steigt zwar das Lohnniveau in Ostdeutschland. Durch die geringere Arbeitskräftenachfrage aufgrund der gestiegenen Löhne sowie durch den niedrigeren Kapitalstock 9 sinkt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit. Entscheidend für die Arbeitskräftewanderung ist die Differenz der erwarteten Einkommen zwischen Ost- und Westdeutschland. Diese Differenz wird aber größer, da die erwarteten Einkommen in Ostdeutschland gesunken sind. Das Modell beinhaltet somit drei Bewegungsgleichungen: eine zur Darstellung der Migration und der sie auslösenden Situation des Arbeitsmarktes sowie zwei Gleichungen für die Kapitalstockentwicklung des alten und neuen Kapitalstocks. Das langfristige Gleichgewicht des Systems, d.h. Stillstand der Arbeitskräftewanderungen zwischen Ost und West sowie ein konstanter Kapitalstock läßt sich grafisch in einem Phasendiagramm wie in Abb. 3 im K-N-Raum darstellen. Die Gleichgewichtswerte von Kapitalstock und Arbeitsangebot K*j und N* ergeben sich im Schnittpunkt der K 0- und AT=0-Linien. Die eingezeichneten Pfeile zeigen die dynamischen Eigenschaften der Größen bei Abweichungen von ihren Steady-State-Werten. Rechts der Geraden Ñ = 0 ist das erwartete Einkommen in Ostdeutschland geringer als in Westdeutschland, beispielsweise durch ein geringes Lohnniveau oder infolge von Arbeitslosigkeit. Durch die Differenz in den erwarteten Einkommen wird Arbeitskräftewanderung ausgelöst und zwar von Ost- nach Westdeutschland. In Ostdeutschland verringert sich dadurch die arbeitsfähige Bevölkerung und das Arbeitsangebot (Ñ<0). Die Abwanderung hält an, bis die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland soweit gesunken und in Westdeutschland gestiegen ist, daß es über den Ausgleich der erwarteten 9 Der langfristig gewünschte Kapitalstock hängt negativ vom ostdeutschen Lohnsatz ab, und beeinflußt so über die Zahl der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze ebenfalls die Arbeitskräftenachfrage und die Beschäftigungsquote.
20 18 Einkommen zu einem Abwanderungsstop kommt. Links der Ñ = O-Geraden ergibt sich die umgekehrte Situation. Das Arbeitsangebot steigt durch Zuwanderung solange bis die Unterschiede der erwarteten Einkommen ausgeglichen werden und das Arbeitsangebot wieder konstant ist (Ñ 0). Vergleichbares gilt für Punkte abseits der K. O-Geraden. Bei Punkten oberhalb von K i = 0 ist der gewünschte Kapitalstock kleiner als der tatsächliche. Die Anpassung an das neue Gleichgewicht ist geprägt durch Desinvestitionen. Entsprechend wird bei Punkten unterhalb von K* solange investiert bis der neue gewünschte Kapitalstock erreicht ist. Durch implizites Differenzieren erhalten wir die Steigungen der Geraden BK ; dn K = 0 = 0 ÔK. dn N = 0 > 0 Die komparativ statischen Eigenschaften der beiden Kurven bei Veränderungen der Löhne ergeben sich gemäß Í5 5H k, «o sc ( ), a(m> - w) _ a/r ( ) d(w - H') d(w - w) (-1) < 0 BKi dk* ('). 5 dw g = o 5(vv d(w -- w) dw d{w - w) dn\ L w dl N N dw L w + wb 1 N 2 < 0 falls die Elastizität des erwarteten Einkommens bezüglich Änderungen des Lohnes negativ ist.
21 19 Durch die Einführung der D-Mark mit einem Kurs von 1 : 1 sowie der Öffnung der Grenzen wurde ein Teil des bestehenden Kapitalstocks (Kj) schlagartig obsolet, d.h., wir befinden uns in Abb. 4 in einem Punkt oberhalb von K i = 0. Der Kapitalstock, der mit dem nun relevanten Lohnsatz sowie dem neuen Preisund Zinsniveau kompatibel ist, ist geringer als der bisherige Kapitalstock, weil viele Anbieter weder preislich noch qualitativ mit westlichen Anbietern mithalten können. Die Ausgangssituation kann daher durch den Punkt A in Abb. 4 beschrieben werden. Durch den Wegfall der Grenzanbieter ist die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze geringer geworden; Arbeitslosigkeit ist die Folge. Die Situation im Punkt A ist durch eine positive Differenz der erwarteten Einkommen zwischen Ost- und Westdeutschland gekennzeichnet. Der Anpassungsprozeß an das neue Gleichgewicht B vollzieht sich über negative Nettoinvestitionen und ständige Abwanderungen. Durch die ausgeprägten Lohnerhöhungen verringert sich der alte Kapitalstocks Kj* weiter. Eine Produktion ist mit diesem Kapitalstock nicht mehr profitabel möglich. Zur Vereinfachung sei angenommen, die Höhe des Kapitalstocks aus früheren Beständen sei gleich Null (vgl. Abb. 4). Für ein Lohnniveau, das in etwa dem des Westens entspricht, ist dann auch ein dem Westen vergleichbarer Kapitalstock mit einer entsprechend hohen Kapitalintensität notwendig. Würde kein frisches Kapital nach Ostdeutschland fließen, so läge das neue Gleichgewicht in C. Der Kapitalstockabbau wird von einer ständig steigenden Arbeitslosigkeit begleitet, die die erwarteten Einkommen senkt und eine fortgesetzte Abwanderung bewirkt. Das bedeutet, daß zusätzlich zu dem bestehenden Kapitalstock, der durch monotonen Kapitalstockabbau gekennzeichnet ist, ein neuer Kapitalstock aufgebaut werden muß. Dieser neue Kapitalstock besitzt eine höhere Kapitalintensität. Jedes Beschäftigungsniveau ist daher mit einem höheren Kapitalstock als ursprünglich verbunden. Zu dem alten gewünschten Kaptitalstock K* 1 = O muß ein neuer Kapitalstock K* 2 addiert werden. Auf die Höhe des aggregierten
22 20 Kapitalstocks im Verlauf des Anpassungsprozesses von A nach D wirken daher gleichzeitig zwei gegenläufige Kräfte ein. Der aggregierte Kapitalstock sinkt, solange die negativen Nettoinvestition im alten Kapitalstock größer sind als Nettoinvestitionen in den neuen Kapitalstock. Diese Abnahme des aggregierten Kapitalstocks ist dargestellt durch die nach unten gerichteten Pfeile in Abb. tyi (CK"i + /C,) < 0). Nach oben gerichtete Pfeile zeigen entsprechend den wachsenden aggregierten Kapitalstock an. Durch den höheren Lohnsatz w 1 verschiebt sich die Ñ = O-Gerade nach links. Der Anpassungsprozeß ist gekennzeichnet durch Arbeitslosigkeit und temporäre Abwanderung. Zu Beginn der Anpassung gehen mehr Arbeitsplätze verloren als neue geschaffen werden. Die dadurch entstehende Arbeitslosigkeit führt zu geringeren erwarteten Einkommen. Die steigende Differenz der erwarteten Einkommen zwischen Ost - und Westdeutschland bewirkt eine Verringerung des Arbeitsangebotes durch Abwanderung (N sinkt). Das System bewegt sich ausgehend von B nach links und nach unten in Richtung auf C. Im Zuge des Aufbaus des neuen Kapitalstocks werden verstärkt neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Abbau des aggregierten Kapitalstocks verringert sich. Die Beschäftigungswahrscheinlichkeit steigt wieder. Da die Beschäftigungswahrscheinlichkeit in Westdeutschland durch die stetige Zuwanderung gesunken ist und gleichzeitig im Zuge der Schaffung neuer Arbeitsplätze die Wahrscheinlichkeit in Ostdeutschland steigt eine Beschäftigung zu finden, verringert sich die Differenz der erwarteten Einkommen. Es kommt zur Rückwanderung von West- nach Ostdeutschland. N steigt wieder. Der Anpassungsprozeß bei dieser Konstellation - monotoner Kapitalstockabbau von Kj auf Null sowie Aufbau des neuen Kapitalstocks K 2* - verläuft von A nach D. Die Beschäftigungskrise während des Anpassungsprozeßes wird daher umso tiefer sein, je langsamer der neue Kapitalstock aufgebaut und je schneller der alte Kapitalstock abgebaut wird. Der Abbau des alten Kapitalstocks ist exogen durch die Abschreibungsrate vorgegeben. Eine Möglichkeit, den Umstrukturie-
23 21 rungsprozeß beschäftigungspolitisch abzufedern liegt darin, die Lebensdauer des alten Kapitalstocks künstlich zu verlängern und dadurch die Beschäftigung mit diesem alten Kapitalstock zu stabilisieren. Dies ist allerdings nicht kostenlos. Eine Subventionierung von Teilen der Wirtschaft in Ostdeutschland ist aber aus sozialpolitischen Gründen wohl unumgänglich, solange eine noch ungenügende Zahl von Arbeitsplätzen durch den neuen Kapitalstock geschaffen wird. Aber auch in Hinblick auf die Sicherung des zukünftigen Industriestandortes Ostdeutschland erscheint die Subventionierung von Arbeitsplätzen notwendig, um den Verlust von technischem Wissen und den Verlust der Arbeitsfähigkeit durch Arbeitslosigkeit zu minimieren. Allerdings muß dabei sichergestellt werden, daß die Subventionierung zeitlich begrenzt wird, um den Zwang zur Umstrukturierung der Wirtschaft nicht zu verringern. Die Analyse mit diesem Modell hat eines deutlich gezeigt. Die hohen Lohnzuwächse können die Abwanderung von Arbeitskräften nicht stoppen. Sie verringern zwar die Differenz des Einkommensniveaus zwischen Ost- und Westdeutschland, gleichzeitig sinkt aber auch die Arbeitsnachfrage in Ostdeutschland. Die entstehende Arbeitslosigkeit senkt die erwarteten Einkommen, die jedoch für die Wanderungsentscheidung relevant sind. Längerfristig führen höhere Löhne zu einer geringeren Kapitalakkumulation in Ostdeutschland. Dadurch entstehen weniger Arbeitsplätze. Das Argument, durch geringeres Lohnwachstum in Ostdeutschland würde der Strukturwandel verzögert, so daß auch Betriebe mit niedriger Wertschöpfung überleben werden, berücksichtigt nicht, daß durch hohe Lohnzuwächse dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit aufgrund zu geringer Kapitalakkumulation möglich ist. Jede moderne Volkswirtschaft ist dadurch gekennzeichnet, daß der aggregierte Kapitalstock aus mehreren "Jahrgängen" mit unterschiedlicher Kapitalintensität und unterschiedlicher Produktivität besteht. Ältere "Jahrgänge" werden in einem stetigen Prozeß durch neue "Jahrgänge" ersetzt. Die durchschnittliche Produktivität steigt daher bei einer kontinuierlichen Investitionstätigkeit jeweils bei dem Austausch einer alten Maschinengeneration durch eine neue an. Die Produktivi-
24 22 tat der älteren "Jahrgänge" ist jedoch hoch genug, um eine ausreichend hohe Zahl von Arbeitsplätzen zu gewährleisten. Die Beschäftigung verteilt sich so auf die unterschiedlichen Maschinengenerationen. Im Falle der ostdeutschen Wirtschaft ist diese Möglichkeit des kontinuierlichen Umbaus der Maschinenparks in der gegebenen Situation, d.h. alter Kapitalstock und hohe Lohnsteigerungen, aber verbaut worden. Für ein den westlichen Löhnen vergleichbares Lohnniveau muß der Kapitalstock von Anfang an neu aufgebaut werden. Dadurch entstehen die erheblichen finanziellen Aufwendungen. Der Strukturwandel kann nicht aus der laufenden Produktionstätigkeit finanziert werden. Für die berufstätigen Menschen steht im Verlauf des Aufbaus eine nicht ausreichende Zahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung. Es gab in jüngster Zeit eine Vielzahl von Vorschlägen, um dem Dilemma zwischen Abwanderung durch große Einkommensunterschiede und Abwanderung durch steigende Arbeitslosigkeit im Osten zu entgehen. Ein Vorschlag läuft darauf hinaus, durch Lohnzurückhaltung im Westen den Einkommensrückstand zu verringern. Bei Betrachtung der Wanderungsgleichung Ñ = X LiWyK) - W. A w - w b(n) N wird jedoch deutlich, daß dadurch zwar der zweite Ausdruck der eckigen Klammer kleiner wird, gleichzeitig sinkt aber auch die Arbeitsnachfrage in Ostdeutschland, da sie von der Höhe des Kapitalstocks abhängt. Der wiederum hängt, wie oben gezeigt, implizit vom Lohnniveau in Westdeutschland ab ( K*(w - w, c - c)) und zwar mit positivem Vorzeichen. Der linke Ausdruck der eckigen Klammer sinkt also ebenfalls.
25 23 Ein geringeres Lohnniveau in Westdeutschland erhöht folglich die Attraktivität des Industriestandortes Westdeutschland 10. Es wird entsprechend mehr Kapital im Westen und weniger im Osten investiert. Durch das sinkende Lohnniveau in Westdeutschland sinkt zwar das erwartete Einkommen in Westdeutschland 11, gleichzeitig sinkt aber auch das erwartete Einkommen in Ostdeutschland durch die geringere Kapitalakkumulation. Der Gesamteffekt ist unbestimmt. Je stärker die Investitionen in Ost- und Westdeutschland auf den Lohnverzicht der westdeutschen Arbeitnehmer reagieren, d.h. je weniger in Ostdeutschland und je mehr in Westdeutschland investiert wird, umso kleiner ist der gewünschte Kapitalstock in den neuen Bundesländern und umso geringer sind die Beschäftigungsquote und die erwarteten Einkommen. Dies führt aber tendenziell wieder zu steigender Abwanderung. Durch Lohnverzicht kann daher zwar die Abwanderung möglicherweise gebremst werden, er führt aber längerfristig zu einer geringeren Zahl von Arbeitsplätzen in Ostdeutschland. Eine positive und genügend große Lohndifferenz zwischen Ost- und Westdeutschland für eine längere Zeit ist eine Voraussetzung dafür, daß Kapital nach Ostdeutschland fließt. Ein weiterer Vorschlag zielt darauf ab, über Lohnsubventionen einen gespaltenen Lohnsatz in Ostdeutschland zu schaffen. Dies würde einerseits einen geringeren Produktlohn für die Unternehmen gewährleisten, zum anderen aber zu einer Stabilisierung der erwarteten Einkommen und dadurch zu geringerer Abwanderung führen. Diese an sich bestechende Lösungsmöglichkeit wird aber vor allem durch zwei Argumente unterhöhlt: Zunächst ist zu bedenken, daß durch 10 Auch die explizite Einbeziehung der Gewinne in die Investitionsfunktion würde an diesem Ergebnis nichts ändern. Die Wirkungsrichtung wäre dieselbe, da bei einem Zurückbleiben der Lohnentwicklung hinter der Produktivitätsentwicklung der Gewinn in Westdeutschland steigen würde und dadurch die Investitionsanreize in Westdeutschland ebenfalls größer würden. 11 Bei für Westdeutschland realistischen Konstellationen von^ Substitutionselastizität und Kapitalkostenanteil - nämlich relativ geringe Substitutionselastizität und hoher Kapitalkostenanteil - ist die Elastizität des erwarteten Einkommens auf Änderungen der westdeutschen Lohnes im Gegensatz zur Situation in Ostdeutschland positiv.
26 24 Transfers dieser Art zwar der Konsum gestärkt, aber für investive Zwecke Kapital gebunden wird. Zudem hätten die notwendigen finanziellen Aufwendungen nicht unerhebliche Auswirkungen auf den gesamtdeutschen Staatshaushalt und dadurch auf die Kapitalmärkte. Entscheidend aber ist, daß diese Lohnsubvention voraussichtlich von den Tarifparteien antizipiert bzw. in ihre Verhandlungen einbezogen würde. Diese "moral-hazard'-situation könnte zu noch höheren Lohnabschlüssen führen. Dann bliebe entweder trotz Subventionierung die Lohndifferenz ungenügend, um wettbewerbsfähige Strukturen entstehen zu lassen, oder es entstünde ein Dauersubventionstatbestand ungeheuren Ausmaßes. Lohnsubventionen werden aber (im Prinzip) schon jetzt geleistet. Ohne Lohnsubventionen, finanziert durch von der Treuhandanstalt verbürgte Kredite bzw. durch die Finanzierung der Kurzarbeit "Null" von Seiten der Bundesanstalt für Arbeit, wäre der Abbau der Beschäftigung in Ostdeutschland viel drastischer gewesen als er tatsächlich eingetreten ist. Neben der Lohndifferenz beeinflussen aber auch die Unterschiede der unternehmerischen Rahmenbedingungen (c - c) - die "States of the Nature" - die Investitionsentscheidung. Diese Unterschiede, beispielsweise der Infrastruktur, müssen so schnell wie möglich ausgeglichen werden. Auch bei einer großen Differenz der Löhne kann es nämlich dadurch zu Investitionshemmnissen kommen, daß schlechtere Rahmenbedingungen in Ostdeutschland den noch bestehenden Lohnkostenvorteil dominieren. Insofern gibt es immer eine unmittelbar negativ zu Buche schlagende Komponente, wenn knappes öffentliches Geld für Subventionen anstatt für Infrastrukturmaßnahmen aufgewendet wird. Wenn man aber annimmt, daß sich die Unterschiede der Löhne zwischen Ostund Westdeutschland rasch nivellieren, ist in der Industrie ein Kapitalstock notwendig, der - in Bezug auf die Arbeits- und Kapitalproduktivität und das Kapital- Arbeits- Einsatzverhältnis - dem westdeutschen Kapitalstock entspricht;
27 25 d.h., für einen durchschnittlichen Arbeitsplatz in der Industrie ist in Ostdeutschland ein Kapitaleinsatz von etwa DM notwendig. In der Industrie der früheren DDR waren etwas mehr als 3 Mill. Menschen beschäftigt. Der Anteil der Beschäftigten in der Industrie wird jedoch - gemessen an der Situation von auch langfristig geringer sein. Wenn sich in Ostdeutschland ähnliche Beschäftigungsstrukturen herausbilden wie in Westdeutschland, so müssen im Industriesektor für etwas mehr als 2 Mill. Menschen Arbeitsplätze geschaffen werden. Dafür ist - bei DM pro Arbeitsplatz - ein Kapitaleinsatz von etwa 500 Mrd. DM notwendig. Im Verlauf des Jahres 1991 werden voraussichtlich Direktinvestitionen in der Gesamtwirtschaft von 20 Mrd. DM getätigt werden. Insgesamt dürfte die Investitionstätigkeit in der Industrie bei nur geringen Investitionen der bestehenden ostdeutschen Unternehmen weit unter 50 Mrd. DM liegen. Das heißt, bei rascher Angleichung der Löhne an das Westniveau ist eine enorme Verstärkung des Kapitalflusses selbst dann notwendig, wenn - ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen und weiter steigenden Kapitalintensität im Westen - in etwa einem Jahrzehnt eine wirtschaftliche Fundierung der Lohnentwicklung möglich sein soll. Dieses Kapital könnte sicher nur zu einem verschwindend geringen Teil in Ostdeutschland selbst gebildet werden, denn während des gesamten Übergangsprozesses gibt es dort kaum Gewinnchancen für einheimische Investoren und bestehende Unternehmen. Die westdeutsche Industrie investiert pro Jahr in Westdeutschland etwa 120 Mrd. DM. Wie es möglich sein sollte, nur 50 Mrd. über den Zeitraum eines Jahrzehnts hier zu mobilisieren, entzieht sich jedem rationalen Kalkül. Aus diesen Überlegungen ergibt sich recht eindeutig, daß die Strategie einer raschen Lohnangleichung die wirtschaftlichen Möglichkeiten der gesamten Bundesrepublik erheblich überfordert, denn es ist auch undenkbar, daß der Staat über einen so langen Zeitraum die erforderlichen hohen Transfers leisten kann, ohne an Grenzen seiner Finanzierungsmöglichkeiten in der einen oder anderen Form zu stoßen. Kommt es nicht zu einem raschen Umdenkungsprozeß bei allen
28 26 Beteiligten, ist nicht auszuschließen, daß das Experiment "Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion" schon in recht kurzer Zeit als gescheitert angesehen werden muß. Fazit Ein solches Ergebnis drängt zu der Frage, ob es Alternativen zu diesem Experiment gegeben hätte. Das ist eine sehr schwierige, vielleicht aber auch müßige Frage. Entscheidend ist im nachhinein nicht, ob und unter welchen externen Rahmenbedingungen ein eigener Weg der DDR in die Gemeinschaft mit der Bundesrepublik möglich gewesen wäre, sondern auch hier, ob und wie die Menschen auf diesen Weg vorbereitet worden wären. Jedes dieser Experimente wäre zum Scheitern verurteilt gewesen, hätten die Menschen nicht die Geduld aufgebracht, die notwendig ist, um dem realen Rückstand ihrer Volkswirtschaft in der Übergangsphase Rechnung zu tragen. Daß viele zu ungeduldig sein würden, war nicht zu ändern. Der entscheidende Irrtum der Politik war der Glaube, mit der Verwirklichung einer Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion die Wanderungsbewegung stoppen zu können. Weil nicht verstanden worden war, daß die Ungeduldigen nicht aufzuhalten sind, hat man auch bei den Geduldigen falsche Erwartungen geweckt. Wo Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge vieles bewirkt hätte, wurde Wunschdenken erzeugt. Wo Warnungen vor zu großen Erwartungen angebracht gewesen wäre, wurden "Geschenke" versprochen. Wo kühler Sachverstand am Platz gewesen wäre, wurden Emotionen geweckt. Eine Währungsunion und die rasche politische Vereinigung der beiden deutschen Staaten mögen unumgänglich und letztlich richtig gewesen sein, die konkrete Umsetzung war von vielen Fehldeutungen und Inkonsistenzen geprägt. Weder in Ost- noch in Westdeutschland wurde in ausreichendem Maße versucht, den Menschen die wirtschaftlichen Implikationen eines solchen Schrittes so klar vor Augen zu führen, daß sie selbst die Wirkung ihres eigenen Verhaltens hätten abschätzen können. Insbesondere in Ostdeutschland wäre das notwendig
29 27 gewesen. Nach 40 Jahren wirtschaftlicher Konfusion hatte kaum jemand dort die Chance, zu verstehen, was die Entscheidung für die D-Mark als gemeinsame deutsche Währung bedeutet. Vielen schien dies sicherlich der Weg zu sein, um rasch westdeutschen Lebensstandard zu erreichen. Daß der Austausch von Währungen dies nicht bewirken - unter ungünstigen Umständen ja sogar behindern kann -, erfährt man aber leider nicht bei Demonstrationen und im Wahlkampf. Das Ergebnis des deutschen Vereinigungsprozesses ist unter dem Gesichtspunkt demokratischer Legitimation ambivalent. Zwar haben die Menschen in Ostdeutschland im vergangenen Jahr mehrfach entsprechend demokratischer Spielregeln gewählt. Eine echte Wahl aber hatten sie nicht, weil ihnen nicht dargelegt wurde, und es dadurch nur sehr schwer zu verstehen und zu durchschauen war, welche Programme mit welchen Konsequenzen zur Wahl standen. Demokratie kann sich nicht in der Festschreibung von Verfahrensregeln erschöpfen. Unabdingbar ist, daß die Wähler eine Idee davon haben, was zur Wahl steht. In normalen Zeiten allmählicher Wandlungen mag das auch ohne besondere politische Anstrengungen gewährleistet sein. In Umbruchsituationen ist das anders.
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Kfm. Philipp Buss Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2013/2014
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie
 Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Beschäftigte, Löhne und Arbeitslosigkeit in einer modernen Ökonomie MB Fünf wichtige Trends auf dem Arbeitsmarkt Wichtige Trends auf Arbeitsmärkten Trends bei Reallöhnen Im 20. Jahrhundert haben alle Industrieländer
Jahreskurs Makroökonomik, Teil 1
 Professor Dr. Oliver Landmann WS 2011/12 Jahreskurs Makroökonomik, Teil 1 Wiederholungsklausur vom 19. April 2012 Aufgabe 1 (30%) Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind, und
Professor Dr. Oliver Landmann WS 2011/12 Jahreskurs Makroökonomik, Teil 1 Wiederholungsklausur vom 19. April 2012 Aufgabe 1 (30%) Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind, und
Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet:
 1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
1. Die IS-Kurve [8 Punkte] Die Gleichung für die IS-Kurve einer geschlossenen Volkswirtschaft lautet: 1 c(1 t) I + G i = Y + b b Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes liegt in Punkt A. Später
Das aggregierte Angebot
 Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Der Transmissionsmechanismus nach Keynes
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Sabrina Böck Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008
Kapitel 2 Der Gütermarkt. Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban. Pearson Studium 2014 Olivier Olivier Blanchard/Gerhard Illing: Illing: Makroökonomie
 Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Kapitel 2 Der Gütermarkt Lekt. Dr. Irina-Marilena Ban 1 Pearson Studium 2014 2014 Literaturhinweise Blanchard, Olivier, Illing, Gerhard, Makroökonomie, 5. Aufl., Pearson 2009, Kap. 3. 2 Vorlesungsübersicht
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
age 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 7: Das AS-AD-Modell Günter W. Beck 1 age 2 2 Überblick Einleitung Das aggregierte Angebot Die aggregierte Nachfrage Gleichgewicht in der kurzen
Das (einfache) Solow-Modell
 Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Kapitel 3 Das (einfache) Solow-Modell Zunächst wird ein Grundmodell ohne Bevölkerungswachstum und ohne technischen Fortschritt entwickelt. Ausgangspunkt ist die Produktionstechnologie welche in jeder Periode
Tutorium Makroökonomie I. Blatt 6. Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell
 Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
Tutorium Makroökonomie I Blatt 6 Arbeitsmarkt, Okunsches Gesetz, AS AD Modell Aufgabe 1 (Multiple Choice: wahr/falsch) Betrachten Sie den Arbeitsmarkt einer Volkswirtschaft, auf dem die privaten Haushalte
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 4 Das AS-AD- Modell
 ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
ME II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Das AS-AD- Modell Version: 23.05.2011 4.1 Der Arbeitsmarkt zentrale Annahmen des IS-LM-Modells werden aufgehoben in der mittleren Frist passen sich Preise an
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen
 Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
Kurzfristige ökonomische Fluktuationen MB Rezessionen und Expansionen Konjunkturschwankungen Rezession: Beschreibt eine Periode deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums als normal (formale Definition:
KE 3 Seite 3 AN2 AN1 B* 1 B*
 KE 3 Seite 2 1 Lohnstarrheiten I: Mindestlöhne 1.1 Wo stehen wir? Bis zu dieser Stelle haben wir die Einsicht gewonnen, daß Arbeitslosigkeit von einem Lohnniveau verursacht werden kann, das oberhalb des
KE 3 Seite 2 1 Lohnstarrheiten I: Mindestlöhne 1.1 Wo stehen wir? Bis zu dieser Stelle haben wir die Einsicht gewonnen, daß Arbeitslosigkeit von einem Lohnniveau verursacht werden kann, das oberhalb des
Abschlussklausur vom 25. Februar 2013
 1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
1 Abschlussklausur vom 25. Februar 2013 Teil 1: 10 Multiple-Choice-Fragen (15 Punkte) 1. Das BNE entspricht dem Volkseinkommen, sofern A Die Summe aus indirekten Steuern und Subventionen 0 ist. B Die indirekten
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft
 Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft Einführung in die Makroökonomie SS 2012 16. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012)Der Gütermarkt einer offenen Volkswirtschaft 16. Juni 2012 1
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14. Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 04.03.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Wann führt eine reale Abwertung
Freiburg, 04.03.2014 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik I Wintersemester 2013/14 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Wann führt eine reale Abwertung
Wachstum und Außenwirtschaft. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wachstum
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wachstum
6.8 Die Wirkungen von Angebotsschocks
 Beispiel 3a): positiver Angebotsschock - unerwarteter technischer Fortschritt - Sinken der Einstandspreise importierter Rohstoffe - Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen Angebotsschocks verändern
Beispiel 3a): positiver Angebotsschock - unerwarteter technischer Fortschritt - Sinken der Einstandspreise importierter Rohstoffe - Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen Angebotsschocks verändern
JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho Freiburg, WS 205/6 JK Makroökonomik I: Nachholklausur vom 20.06.206 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (0 Fragen, 5 Punkte)
Thema 4: Das IS-LM-Modell. Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM)
 Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
Thema 4: Das IS-LM-Modell Zusammenfassung der beiden Modelle des Gütermarktes (IS) und des Geldmarktes (LM) Beide Modelle gelten - so wie das zusammenfassende Modell - für die kurze Frist 1 4.1 Gütermarkt
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. 2. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow, Kap. V.2.a; Barro/Gordon (1983a)
 3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
Universität Siegen. Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach. Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2013 (2. Prüfungstermin) LÖSUNG
 1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2013 (2. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Überprüfen
1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2013 (2. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Überprüfen
Argumentieren Sie im Rahmen des IS/LM-Modells ohne explizite Berücksichtigung des Arbeitsmarktes. Gehen Sie von einem konstanten Preisniveau P aus.
 MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
MC- Übungsaufgaben für die Klausur Aufgabe 1 (IS-LM) In einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlichem Rentensystem besteht Unsicherheit darüber, ob auch in Zukunft der Staat eine Rente garantieren
Klausur SS 2016: Makroökonomik II (1.PT) Universität Siegen. Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach
 1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2016 (1. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Die Klausur
1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2016 (1. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Die Klausur
Eine geschlossene Volkswirtschaft sei durch folgende Funktionen gekennzeichnet:
 Dr. Stefan Kooths 1/6 Übungsaufgaben Aufgabe 1 Eine geschlossene Volkswirtschaft sei durch folgende Funktionen gekennzeichnet: (1) I = 90 2 r (Investitionsfunktion) (2) C = 60 + 0,8 YV (Konsumfunktion)
Dr. Stefan Kooths 1/6 Übungsaufgaben Aufgabe 1 Eine geschlossene Volkswirtschaft sei durch folgende Funktionen gekennzeichnet: (1) I = 90 2 r (Investitionsfunktion) (2) C = 60 + 0,8 YV (Konsumfunktion)
Mindestlohn Mindestlohn: Theorie und Empirie 1
 Mindestlohn Westfälische Wilhelms-Universität Wintersemester 2008/09 Topics in Economics Dozent: Dr. Jörg Lingens Referenten: Thorsten Luig und Hendrik Steingröver 05.11.2008 Mindestlohn: Theorie und Empirie
Mindestlohn Westfälische Wilhelms-Universität Wintersemester 2008/09 Topics in Economics Dozent: Dr. Jörg Lingens Referenten: Thorsten Luig und Hendrik Steingröver 05.11.2008 Mindestlohn: Theorie und Empirie
Aufgabenblatt 3. Das Dornbusch- Fischer- Samuelson Modell. zeigen, dass konstanter Anteil des Einkommens für den Konsum jeden Gutes verwendet wird
 Außenhandelstheorie- und politik Wintersemester 2013/2014 Aufgabenblatt 3 Das Dornbusch- Fischer- Samuelson Modell Aufgabe 1.) -vollkommener Wettbewerb; -Cobb-Douglas Präferenzen zeigen, dass konstanter
Außenhandelstheorie- und politik Wintersemester 2013/2014 Aufgabenblatt 3 Das Dornbusch- Fischer- Samuelson Modell Aufgabe 1.) -vollkommener Wettbewerb; -Cobb-Douglas Präferenzen zeigen, dass konstanter
Das aggregierte Angebot
 Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Das aggregierte Angebot 3.1 Erläutern Sie die kurzfristige Anpassung der Preise und der Produktion in einem Modell monopolistischer Konkurrenz auf dem Gütermarkt, einer limitationalen Produktionsfunktion
Restriktive Fiskalpolitik im AS-
 Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Fiskalpolitik im AS-AD-Modell Restriktive Fiskalpolitik im AS- AD-Modell Eine Senkung des Budgetdefizits führt zunächst zu einem Fall der Produktion und einem Rückgang der Preise. Im Zeitverlauf kehrt
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit
 Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Rezepte gegen Arbeitslosigkeit Offizielle Arbeitslosenquote (1980-2005) % 5 4 3 2 1 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Quelle: seco 2 Arbeitslosenquoten Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK und USA
Fachkräftesicherung in Sachsen: Schlussfolgerungen und Strategieansätze für Wirtschaft und Politik
 Fachkräftesicherung in Sachsen: Schlussfolgerungen und Strategieansätze für Wirtschaft und Politik Dresden, 31. Januar 2013 Prof. Dr. Joachim Ragnitz Künftige Herausforderung: Zunehmender Arbeitskräftemangel
Fachkräftesicherung in Sachsen: Schlussfolgerungen und Strategieansätze für Wirtschaft und Politik Dresden, 31. Januar 2013 Prof. Dr. Joachim Ragnitz Künftige Herausforderung: Zunehmender Arbeitskräftemangel
Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt
 Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt Folie 1 6.2 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bzw. das Arbeitskräftepotenzial, umfasst alle Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren,
Kapitel 6 Der Arbeitsmarkt Folie 1 6.2 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bzw. das Arbeitskräftepotenzial, umfasst alle Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren,
Klausur zur Vorlesung Konjunktur- und Wachstumspolitik SS 2009
 Klausur zur Vorlesung Konjunktur- und Wachstumspolitik SS 2009 Alle Aufgaben sind zu beantworten. Antworten Sie möglichst kurz und direkt auf dem Aufgabenblatt! Aufgabe 1 (14 Punkte) Wie ermittelt man
Klausur zur Vorlesung Konjunktur- und Wachstumspolitik SS 2009 Alle Aufgaben sind zu beantworten. Antworten Sie möglichst kurz und direkt auf dem Aufgabenblatt! Aufgabe 1 (14 Punkte) Wie ermittelt man
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Makroökonomik. Übungsfragen. 3 Das aggregierte Angebot
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell
 Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 21. Juni 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Oene Volkswirtschaft III - Mundell Fleming Modell 21. Juni
Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013
 Freiburg, 25.07.2013 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013 Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die Preissetzungsfunktion sei = 1+. Nehmen Sie an, der Gewinnaufschlag,,
Freiburg, 25.07.2013 Abschlussklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2013 Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Die Preissetzungsfunktion sei = 1+. Nehmen Sie an, der Gewinnaufschlag,,
LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 5
 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz Aufgabe 1: Das IS-LM Modell LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 5 Gegeben seien die
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Jun.-Prof. Dr. Philipp Engler, Michael Paetz Aufgabe 1: Das IS-LM Modell LÖSUNG ZUR VORLESUNG MAKROÖKONOMIK I (SoSe 14) Aufgabenblatt 5 Gegeben seien die
Wirtschaftspolitik und Markt
 Wirtschaftspolitik und Markt http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/ lexikon-der-wirtschaft/ 84 Wirtschaftspolitische Ziele der sozialen Marktwirtschaft: Magisches Viereck: Stabilität des Preisniveaus hoher
Wirtschaftspolitik und Markt http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/ lexikon-der-wirtschaft/ 84 Wirtschaftspolitische Ziele der sozialen Marktwirtschaft: Magisches Viereck: Stabilität des Preisniveaus hoher
Konvergenz und Bedingte Konvergenz. = h 0 ( ) ( ) i 2 0 Zudem sinkt die Wachstumsrate der pro-kopf-produktion mit dem Niveau.
 TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
TU Dortmund, WS 12/13, Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung 14 Konvergenz und Bedingte Konvergenz Fundamentale Gleichung in Pro-Kopf-Größen = und = = ( ) = ( ) = = [ ( ) ] Die Wachstumsrate sinkt mit
Volkswirtschaft Modul 2
 Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
Volkswirtschaft Modul 2 Teil II Angebot und Nachfrage I: Wie Märkte funktionieren 2012 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH www.sp-dozenten.de Institut für Wirtschaftswissenschaft.
a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzyklus zugrunde?
 Aufgabe 1 (25 Punkte) Branchenzklen versus Konjunkturzklen a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzklus zugrunde? Das Güterangebot wird bestimmt durch den
Aufgabe 1 (25 Punkte) Branchenzklen versus Konjunkturzklen a) Welche Annahmen über Güterangebot und Güternachfrage liegen dem Modell eines Branchenzklus zugrunde? Das Güterangebot wird bestimmt durch den
Geschlossene Volkswirtschaft: Ersparnis: S = I = 75 da geschlossene VW. b) Private und staatliche Ersparnis: c) Erhöhung der Staatsausgaben:
 Aufgabe 1: Geschlossene Volkswirtschaft: a) Y = C + I + G Y = Y T 10 r + 200 10r + G 1.200 = 1.200 100 10r + 200 10r + 150 20 r = 250 r = 12,5 I = 200 = Investitionen: 10 *12,5 75 Ersparnis: = I = 75 da
Aufgabe 1: Geschlossene Volkswirtschaft: a) Y = C + I + G Y = Y T 10 r + 200 10r + G 1.200 = 1.200 100 10r + 200 10r + 150 20 r = 250 r = 12,5 I = 200 = Investitionen: 10 *12,5 75 Ersparnis: = I = 75 da
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Technischer Fortschritt die kurze, mittlere und lange Frist
 Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Technischer Fortschritt die kurze, mittlere und lange Frist Version: 17.10.2011 Dimensionen des technischen Fortschritts 1. Es gibt optimistische und pessimistische
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 4 Technischer Fortschritt die kurze, mittlere und lange Frist Version: 17.10.2011 Dimensionen des technischen Fortschritts 1. Es gibt optimistische und pessimistische
GEHT DEN DEUTSCHEN DIE ARBEIT AUS? WEGE ZU MEHR BESCHÄFTIGUNG
 HORST SIEBERT GEHT DEN DEUTSCHEN DIE ARBEIT AUS? WEGE ZU MEHR BESCHÄFTIGUNG Inhalt Vorwort 11 Kapitel 1 Fünf Millionen Arbeitslose 15 Zunehmender Sockel der Arbeitslosigkeit 15 Das Ziel der Vollbeschäftigung
HORST SIEBERT GEHT DEN DEUTSCHEN DIE ARBEIT AUS? WEGE ZU MEHR BESCHÄFTIGUNG Inhalt Vorwort 11 Kapitel 1 Fünf Millionen Arbeitslose 15 Zunehmender Sockel der Arbeitslosigkeit 15 Das Ziel der Vollbeschäftigung
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005. Wirtschaftswachstum
 Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Christine Brandt Wintersemester 2004/2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 01 Tel. 0731 50 24266 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
 Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
Regionalökonomik (BA) Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung Prof. Dr. Falko Jüßen 30. Oktober 2014 1 / 33 Einleitung Rückblick Ricardo-Modell Das Ricardo-Modell hat die potentiellen Handelsgewinne
LM-Kurve klassische Bereich Liquiditätsfalle
 20 Brückenkurs nur eine einzige Zinssatz-Volkseinkommen-Kombination, die zu einem Geldmarktgleichgewicht führt, sondern eine ganze Reihe von Kombinationen. In einem i-y-diagramm lassen sich diese Kombinationen
20 Brückenkurs nur eine einzige Zinssatz-Volkseinkommen-Kombination, die zu einem Geldmarktgleichgewicht führt, sondern eine ganze Reihe von Kombinationen. In einem i-y-diagramm lassen sich diese Kombinationen
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser. Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik
 Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
Makro II, Prof. Dr. T. Wollmershäuser Kapitel 8 Erwartungsbildung, Wirtschaftsaktivität und Politik Version: 12.12.2011 Erwartungen und Nachfrage: eine Zusammenfassung Erwartungskanäle und Nachfrage Erwartungen
Tutorium zur Vorlesung: Grundzüge der VWL I / Makroökonomische Theorie Prof. Dr. P.J.J. Welfens. Übungsblatt
 Übungsblatt Aufgabe 1: (15 Punkte) Das Arbeitsangebot ist gegeben durch: W/P = 1,9L - 100 Die Arbeitsnachfrage ist gegeben durch: W/P = -0,1L + 500 (W/P ist der Reallohnsatz / L ist die Beschäftigtenniveau)
Übungsblatt Aufgabe 1: (15 Punkte) Das Arbeitsangebot ist gegeben durch: W/P = 1,9L - 100 Die Arbeitsnachfrage ist gegeben durch: W/P = -0,1L + 500 (W/P ist der Reallohnsatz / L ist die Beschäftigtenniveau)
Lösungen zu Aufgabensammlung. Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I
 Thema Dokumentart Makroökonomie: Konjunkturtheorie und -politik Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was versteht man unter Konjunkturschwankungen?
Thema Dokumentart Makroökonomie: Konjunkturtheorie und -politik Lösungen zu Aufgabensammlung LÖSUNGEN Konjunkturtheorie: Aufgabensammlung I Aufgabe 1 1.1 Was versteht man unter Konjunkturschwankungen?
Makroökonomie 1. Skript: Teil 1
 Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Makroökonomie 1 Skript: Teil 1 Prof. Volker Wieland Prof. Volker Wieland - Makroökonomie 1 Einführung / 1 Übersicht I. Einführung Makroökonomische Denkweise und Kennzahlen II. Die Volkswirtschaft bei langfristiger
Darstellung des Außenhandels im Prozess der deutschen Vereinigung
 Darstellung des Außenhandels im Prozess der deutschen Vereinigung Udo Ludwig, Klaus Voy 9. Berliner VGR-Kolloquium 23. und 24. Juni 2016 in Berlin Metamorphose der VGR im deutschen Vereinigungsprozess
Darstellung des Außenhandels im Prozess der deutschen Vereinigung Udo Ludwig, Klaus Voy 9. Berliner VGR-Kolloquium 23. und 24. Juni 2016 in Berlin Metamorphose der VGR im deutschen Vereinigungsprozess
3.3 Kapitalstock und Investitionen
 3.3 Kapitalstock und Investitionen Langfristige Anpassung: Substitution und Kapazitäten Die Annahmen des Modells: Die Nachfrage bestimmt sich aus einer logarithmisch linearen Nachfragekurve D = p η Z bzw.
3.3 Kapitalstock und Investitionen Langfristige Anpassung: Substitution und Kapazitäten Die Annahmen des Modells: Die Nachfrage bestimmt sich aus einer logarithmisch linearen Nachfragekurve D = p η Z bzw.
Beschäftigungstheorie
 Prof. Dr. Oliver Landmann SS 2008 Beschäftigungstheorie Nachholklausur vom 7. Oktober 2008 Aufgabe 1 (20%) Beantworten Sie jeweils in wenigen Sätzen: a) Unter welchen Bedingungen wird eine Person statistisch
Prof. Dr. Oliver Landmann SS 2008 Beschäftigungstheorie Nachholklausur vom 7. Oktober 2008 Aufgabe 1 (20%) Beantworten Sie jeweils in wenigen Sätzen: a) Unter welchen Bedingungen wird eine Person statistisch
11. Übung Makroökonomischen Theorie
 11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
11. Übung akroökonomischen Theorie Aufgabe 28 Es seien b = 0,35 und r = 0,1. Außerdem steht die monetäre Basis B = 1.200 zur Verfügung. Die Produktion in der Volkswirtschaft betrage Y = 4.000. Die Nachfrage
Arbeitsmarkt. Arbeitsangebot Arbeitsnachfrage L = Faktor Arbeit, Beschäftigte, Labour W, (W/P) = Lohn, Reallohn
 Arbeitsmarkt Arbeitsangebot Arbeitsnachfrage L = Faktor Arbeit, Beschäftigte, Labour W, (W/P) = Lohn, Reallohn Nachfrage - Elastizitäten Besonderheiten: Geringfügig Beschäftigte: -2,04 Internationalisierung:
Arbeitsmarkt Arbeitsangebot Arbeitsnachfrage L = Faktor Arbeit, Beschäftigte, Labour W, (W/P) = Lohn, Reallohn Nachfrage - Elastizitäten Besonderheiten: Geringfügig Beschäftigte: -2,04 Internationalisierung:
IS: y(schock,i), wobei y positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/P=L(y,i) wobei L positiv von y und negativ von i abhängt
 Aufgabenblatt 3, Aufgabe 3 IS-LM/AD- Negativer Schock der Güternachfrage IS: (Schock,i), wobei positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/=L(,i) wobei L positiv von und negativ von i abhängt a)
Aufgabenblatt 3, Aufgabe 3 IS-LM/AD- Negativer Schock der Güternachfrage IS: (Schock,i), wobei positiv vom Schock und negativ von i abhängt LM: M/=L(,i) wobei L positiv von und negativ von i abhängt a)
Arbeitslose und Arbeitslosenquote
 Arbeitslose und Arbeitslosenquote In absoluten In absoluten Zahlen Zahlen und und in in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen, 1980 1980 bis 2013 bis 2013 in Mio. Westdeutschland Deutschland Prozent 6,0
Arbeitslose und Arbeitslosenquote In absoluten In absoluten Zahlen Zahlen und und in in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen, 1980 1980 bis 2013 bis 2013 in Mio. Westdeutschland Deutschland Prozent 6,0
Gütermarkt. 2.1 Preisanpassung
 Gütermarkt Auf dem Gütermarkt findet zwischen den Unternehmen und den Haushalten der Tausch von produzierten Gütern statt. Die Anbieter und die Nachfrager richten ihre angebotene, respektive nachgefragte
Gütermarkt Auf dem Gütermarkt findet zwischen den Unternehmen und den Haushalten der Tausch von produzierten Gütern statt. Die Anbieter und die Nachfrager richten ihre angebotene, respektive nachgefragte
Das AS-AD Modell. Einführung in die Makroökonomie SS Mai 2012
 Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Das AS-AD Modell Einführung in die Makroökonomie SS 2012 18. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Das AS-AD Modell 18. Mai 2012 1 / 38 Was bisher geschah Mit Hilfe des IS-LM Modells war es
Konjunktur und Wachstum
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-WiWi Christian Peukert Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. 2. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow, Kap. V.2.a; Barro/Gordon (1983a)
 3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
3. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbank 1. Kurz- und langfristige Phillipskurve Literatur: Illing, Kap. 3.1; Jarchow, Kap. V.1.. Das Barro-Gordon-Modell (statische Version) Illing, Kap. 5.1, ; Jarchow,
Wirtschafts- und sozialpolitische Informationen des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen
 WISO-Info Nr. 2/2005, März 2005 Wirtschafts- und sozialpolitische Informationen des GB-Bezirks Hessen-Thüringen Inhalt ie Folgen massiver Lohnzurückhaltung: Boomender Export und stagnierende Binnennachfrage
WISO-Info Nr. 2/2005, März 2005 Wirtschafts- und sozialpolitische Informationen des GB-Bezirks Hessen-Thüringen Inhalt ie Folgen massiver Lohnzurückhaltung: Boomender Export und stagnierende Binnennachfrage
1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5. 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 81
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Themen und Konzepte der Volkswirtschaftslehre 5 1 Begriffe 6 2 Aufgaben 8 3 Lernkarten 23 2 Die Marktwirtschaft und die Rolle des Staates 29 1 Begriffe 30 2 Aufgaben
Kapitel 27 Eine allgemeine Theorie der Unterbeschäftigung
 Kapitel 27 Eine allgemeine Theorie der Unterbeschäftigung Lernziele Wie analysieren Ökonomen, was die Höhe des aggregierten Outputs und die Beschäftigung in der kurzen Frist, wenn Löhne und Preise fix
Kapitel 27 Eine allgemeine Theorie der Unterbeschäftigung Lernziele Wie analysieren Ökonomen, was die Höhe des aggregierten Outputs und die Beschäftigung in der kurzen Frist, wenn Löhne und Preise fix
Makroökonomik für Betriebswirte
 Makroökonomik für Betriebswirte 7.2 Das Modell Dr. Michael Paetz Universität Hamburg Fachbereich Volkswirtschaftslehre Dezember 2017 Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de Outline Das Modell 1. Einführung
Makroökonomik für Betriebswirte 7.2 Das Modell Dr. Michael Paetz Universität Hamburg Fachbereich Volkswirtschaftslehre Dezember 2017 Email: Michael.Paetz@wiso.uni-hamburg.de Outline Das Modell 1. Einführung
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom
 Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
Unter fixen Wechselkursen sinkt das Einkommen vorrübergehen und das Preisniveau reduziert sich
 Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
Aufgabe 26 Aus dem Mundell-Flemming-Modell ist bekannt, dass 1. bei Flexiblen Wechselkursen: - Ein Anstieg des Weltmarktzinses führt zu einem Überangebot an inländischer Währung (da i< i w ) - Um dieses
Viel erreicht, noch viel zu tun
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln 25 Jahre Währungsunion 25.06.2015 Lesezeit 3 Min. Viel erreicht, noch viel zu tun Am 1. Juli 1990 wurde die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln 25 Jahre Währungsunion 25.06.2015 Lesezeit 3 Min. Viel erreicht, noch viel zu tun Am 1. Juli 1990 wurde die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom
 Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho 1 Freiburg, WS 2016/17 JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom 14.08.2017 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (10 Fragen,
Prof. Dr. Oliver Landmann Dr. Stefanie Flotho 1 Freiburg, WS 2016/17 JK Makroökonomik I: Wiederholungsklausur vom 14.08.2017 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (10 Fragen,
Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester Bitte auf dem Lösungsblatt angeben!
 Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Freiburg, 12.01.2015 Nachholklausur zur Vorlesung Makroökonomik II Sommersemester 2014 Klausur A Bitte auf dem Lösungsblatt angeben! Teil I: Multiple Choice (15 Punkte) 1. Das Solow-Modell bildet von den
Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt
 Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 2011 Folie 1 Übungsaufgabe 6 1 6 1 Nehmen Sie an, die Höhe des Lohnes hänge positiv
Kapitel 6 Übungsaufgaben zu Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Florian Verheyen, Master Econ. Makroökonomik I Sommersemester 2011 Folie 1 Übungsaufgabe 6 1 6 1 Nehmen Sie an, die Höhe des Lohnes hänge positiv
Klausurvorbereitung. 2. Ein wichtiges Ergebnis aus dem Modell von Solow zum langfristigen Wachstum ist, dass...
 Klausurvorbereitung Teil I: Multiple-Choice-Fragen Kreisen Sie jeweils ein, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Es können mehrere Aussagen wahr bzw. falsch sein. Pro MC-Frage werden fünf richtig eingekreiste
Klausurvorbereitung Teil I: Multiple-Choice-Fragen Kreisen Sie jeweils ein, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Es können mehrere Aussagen wahr bzw. falsch sein. Pro MC-Frage werden fünf richtig eingekreiste
Klausur SS 2015: Makroökonomik II (2.PT) Universität Siegen. Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach
 1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2015 (2. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Überprüfen
1 Universität Siegen Fakultät III Univ.-Professor Dr. Jan Franke-Viebach Klausur zur Makroökonomik II Sommersemester 2015 (2. Prüfungstermin) Bearbeitungszeit: 60 Minuten LÖSUNG Zur Beachtung: 1. Überprüfen
Arbeitskräftemangel
 BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG KONSUMSTRASSE 20. CH-3007 BERN. TEL +41 (0)31 380 60 80. FAX +41 (0)31 398 33 63 INFO@BUEROBASS.CH. WWW.BUEROBASS.CH Arbeitskräftemangel 2010-2030
BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG KONSUMSTRASSE 20. CH-3007 BERN. TEL +41 (0)31 380 60 80. FAX +41 (0)31 398 33 63 INFO@BUEROBASS.CH. WWW.BUEROBASS.CH Arbeitskräftemangel 2010-2030
Übung zu Mikroökonomik II
 Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Prof. Dr. G. Rübel SS 2005 Dr. H. Möller-de Beer Dipl.-Vw. E. Söbbeke Übung zu Mikroökonomik II Aufgabe 1: Eine gewinnmaximierende Unternehmung produziere ein Gut mit zwei kontinuierlich substituierbaren
Helmholtzstr. 20, Raum E 05. Wachstum und Außenwirtschaft. Übungsfragen
 Prof. Dr. Werner Smolny Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Werner Smolny Wintersemester 2006/2007 Institut für Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie
 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2 Überblick
Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 1 1 Makroökonomie I/Grundlagen der Makroökonomie Kapitel 6: Der Arbeitsmarkt Günter W. Beck 1 Makroökonomie I/Grundzüge der Makroökonomie Page 2 2 Überblick
Die Entwicklung im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe Thüringens und ein Vergleich mit Deutschland und den neuen Bundesländern von 2000 bis 2008
 - Juli 2009 Detlev Ewald Telefon: 03681 354-210 e-mail: Detlev.Ewald@statistik.thueringen.de Die Entwicklung im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe Thüringens und ein Vergleich mit Deutschland und den neuen
- Juli 2009 Detlev Ewald Telefon: 03681 354-210 e-mail: Detlev.Ewald@statistik.thueringen.de Die Entwicklung im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe Thüringens und ein Vergleich mit Deutschland und den neuen
Forschungsauftrag. 1) Wählen Sie ein Beispiel, in dem Sie die Beziehung zwischen dem Input Arbeit und dem Output darstellen.
 Forschungsauftrag 1) Wählen Sie ein Beispiel, in dem Sie die Beziehung zwischen dem Input Arbeit und dem Output darstellen. 2) Definieren Sie Produktivität, Effizienz und Effektivität? 3) Welche Faktoren
Forschungsauftrag 1) Wählen Sie ein Beispiel, in dem Sie die Beziehung zwischen dem Input Arbeit und dem Output darstellen. 2) Definieren Sie Produktivität, Effizienz und Effektivität? 3) Welche Faktoren
Internationale Ökonomie I. Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell. Dr. Dominik Maltritz
 Internationale Ökonomie I Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick 3. Das Riccardo-Modell: Komparative Vorteile
Internationale Ökonomie I Vorlesung 5: Das Standard-Handels-Modell Dr. Dominik Maltritz Vorlesungsgliederung 1. Einführung 2. Der Welthandel: Ein Überblick 3. Das Riccardo-Modell: Komparative Vorteile
Internationale Wirtschaft Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist
 Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist 1 Kapitelübersicht Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen Volkswirtschaft Die Gleichung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
Kapitel 17: Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist 1 Kapitelübersicht Determinanten der volkswirtschaftlichen Nachfrage in einer offenen Volkswirtschaft Die Gleichung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
Allgemeine Hinweise zur Klausur:
 Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL (Bachelor Wirtschaft) März 2008 Allgemeine Hinweise zur Klausur: Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten Die maximale erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt 90
Prof. Dr. B. Erke / Prof. Dr. Th. Siebe VWL (Bachelor Wirtschaft) März 2008 Allgemeine Hinweise zur Klausur: Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten Die maximale erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt 90
Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4)
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnzurückhaltung?
 Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnzurückhaltung? Rafael Wildauer, 23. Mai 2017 Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Exportüberschüsse und Freihandel gelten fälschlicherweise als Synonyme für gute Wirtschaftspolitik.
Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnzurückhaltung? Rafael Wildauer, 23. Mai 2017 Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Exportüberschüsse und Freihandel gelten fälschlicherweise als Synonyme für gute Wirtschaftspolitik.
Übung 6 - Solow-Modell
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Dipl.-Math. oec. Daniel Siepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2010/11
Geld- und Fiskalpolitik (2) und Währungsintegration. Aufgabe 1
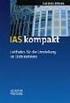 UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
UNIVERSITÄT SIEGEN Theorie und Praxis für Karrieren von morgen Univ.-Professor Dr. Carsten Hefeker Dipl.-Volksw. Katja Popkova Fachbereich 5 Einführung in die Probleme der europäischen Wirtschaft Wintersemester
Der Ablauf bei der Erstellung empirischer Arbeiten
 1 Prof. Dr. Werner Smolny SS 2002 Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung Der Ablauf bei der Erstellung empirischer Arbeiten A Die wirtschaftliche Fragestellung und das theoretische Modell 1.
1 Prof. Dr. Werner Smolny SS 2002 Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung Der Ablauf bei der Erstellung empirischer Arbeiten A Die wirtschaftliche Fragestellung und das theoretische Modell 1.
Phillips Kurve. Einführung in die Makroökonomie. 10. Mai 2012 SS Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10.
 Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Phillips Kurve Einführung in die Makroökonomie SS 2012 10. Mai 2012 Einführung in die Makroökonomie (SS 2012) Phillips Kurve 10. Mai 2012 1 / 23 Hintergrund 1958 stellte A. W. Phillips die Inflationsrate
Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität. Y n = C + I (1)
 2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
2.1 Konsumverhalten und Multiplikator Geschlossene Volkswirtschaft ohne staatliche Aktivität Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Y n setzt sich aus dem privaten Konsum C und den Investitionen I zusammen
Die Entscheidung der privaten Haushalte über die optimale Zeitallokation 19
 Inhaltsverzeichnis I Einführung 1 1 Der Arbeitsmarkt im Überblick: Fragen an die Arbeitsmarktökonomik 3 1.1 Überblick über das Arbeitsmarktgeschehen, Fragen an die Arbeitsmarktökonomik und Aufbau dieses
Inhaltsverzeichnis I Einführung 1 1 Der Arbeitsmarkt im Überblick: Fragen an die Arbeitsmarktökonomik 3 1.1 Überblick über das Arbeitsmarktgeschehen, Fragen an die Arbeitsmarktökonomik und Aufbau dieses
GRUNDWISSEN WIRTSCHAFT UND RECHT Jgst. Peutinger-Gymnasium Augsburg
 Operatoren in schriftlichen und mündlichen Leistungserhebungen siehe Grundwissen Wirtschaft und Recht 9. Jgst. 10.1 Denken in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen Wie verhalten sich Haushalte und Unternehmen
Operatoren in schriftlichen und mündlichen Leistungserhebungen siehe Grundwissen Wirtschaft und Recht 9. Jgst. 10.1 Denken in gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen Wie verhalten sich Haushalte und Unternehmen
Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester Helmholtzstr. 20, Raum E 05. Wachstum und Außenwirtschaft. Übungsfragen
 Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Werner Smolny Sommersemester 2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 05 Tel. 0731 50 24261 UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Konjunktur. Ursachen von Konjunkturschwankungen. Makroökonomik
 Konjunktur Ursachen von Konjunkturschwankungen Makroökonomik 4.6. 2007 1 Plan der Vorlesung 1. Das Taylormodell der Konjunktur 1. Erklärte Grössen 2. Annahmen 3. Modellbestandteile 1. Überblick 2. Investitionsfunktion
Konjunktur Ursachen von Konjunkturschwankungen Makroökonomik 4.6. 2007 1 Plan der Vorlesung 1. Das Taylormodell der Konjunktur 1. Erklärte Grössen 2. Annahmen 3. Modellbestandteile 1. Überblick 2. Investitionsfunktion
Geld und Währung. Übungsfragen
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Universität Ulm 89069 Ulm Germany Prof. Dr. Werner Smolny Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Institutsdirektor Wintersemester
Das Heckscher-Ohlin-Modell. Wintersemester 2013/2014
 Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Das Heckscher-Ohlin-Modell Wintersemester 2013/2014 Ressourcen und Außenhandel unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren einzige Ursache für Unterschiede in Autarkiepreisen zwischen zwei Ländern
Mikroökonomie I Kapitel 2 Angebot und Nachfrage WS 2004/2005
 Mikroökonomie I Kapitel 2 Angebot und Nachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Angebot und Nachfrage Der Marktmechanismus Veränderungen im Marktgleichgewicht Die Elastizität der Nachfrage und des
Mikroökonomie I Kapitel 2 Angebot und Nachfrage WS 2004/2005 Themen in diesem Kapitel Angebot und Nachfrage Der Marktmechanismus Veränderungen im Marktgleichgewicht Die Elastizität der Nachfrage und des
Der Arbeitsmarkt. Prof. Dr. Volker Clausen Makroökonomik 1 Sommersemester 2008 Folie 1. Der Arbeitsmarkt
 Der Arbeitsmarkt Prof. Dr. Volker Clausen Makroökonomik 1 Sommersemester 2008 Folie 1 Der Arbeitsmarkt 6.1 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt 6.2 Die Entwicklung der 6.3 Wie Löhne bestimmt werden 6.4
Der Arbeitsmarkt Prof. Dr. Volker Clausen Makroökonomik 1 Sommersemester 2008 Folie 1 Der Arbeitsmarkt 6.1 Ein Überblick über den Arbeitsmarkt 6.2 Die Entwicklung der 6.3 Wie Löhne bestimmt werden 6.4
