hintergrund // dezember 2015 Gesamtwirtschaftliche Ziele und Indikatoren zur Rohstoffinanspruchnahme
|
|
|
- Stefanie Althaus
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 hintergrund // dezember 2015 Gesamtwirtschaftliche Ziele und Indikatoren zur Rohstoffinanspruchnahme
2 Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Postfach Dessau-Roßlau Tel: Internet: /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Autoren: Jens Günther (I 1.1) Michael Golde (I 1.4) unter Mitwirkung von: Kora Kristof (I 1) Matthias Koller (I 1.1) Andreas Burger (I 1.4) Sylvia Schwermer (I 1.5) Gestaltung: Silke Seider (Umweltbundesamt) Publikationen als pdf: gesamtwirtschaftliche-ziele-indikatoren-zur Bildquellen: Titelbild: focus finder / Fotolia.com Seite 8 : markavgust / Fotolia.com Seite 14: Nobilior / Fotolia.com Stand: November 2015 ISSN X
3 Inhalt 1. Einführung 4 2. Vorschläge für gesamtwirtschaftliche Rohstoffindikatoren Rohstoffproduktivität Gesamtrohstoffproduktivität Vergleich der unterschiedlichen Produktivitäten an Beispielen Absolute Rohstoffinanspruchnahme Vorschläge für gesamtwirtschaftliche Ziele zur Rohstoffnutzung Ziele für Rohstoffproduktivität und Gesamtrohstoffproduktivität Ziele für die absolute Rohstoffinanspruchnahme Zusammenfassung und Ausblick Literatur 17 Abbildungen und Tabellen Abbildung 1: Rohstoffproduktivität in Deutschland Abbildung 2: Globale Primärrohstoffentnahme Abbildung 3: Letzte inländische Rohstoffverwendung (RMC) pro Kopf Tabelle 1: Entwicklung der Gesamtrohstoffproduktivität für Deutschland Tabelle 2: UBA-Vorschlag für gesamtwirtschaftliche Indikatoren und Ziele Abkürzungen BIP DMI DMIabiot RMC RMI TMC Bruttoinlandsprodukt Direct Material Input (Direkter Material Input) abiotischer Anteil des Direkten Material Inputs Raw Material Consumption (Inländische Primärrohstoffverwendung) Raw Material Input (Inländischer Primärrohstoffeinsatz) Total Material Consumption (Globale Rohstoffverwendung)
4 1. Einführung In einer begrenzten Welt ist die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Schlüsselfrage. Sie erfordert eine Politik, welche unsere Ressourceninanspruchnahme heute und in der Zukunft direkt adressiert. Die Rohstoffnutzung erzeugt kurz- und langfristig negative Umweltwirkungen. Sie wirft Fragen der intergenerationellen und globalen Gerechtigkeit auf und ist mit sozialen und ökonomischen Aspekten wie z. B. Versorgungssicherheit verbunden. Wenn es unser Ziel ist, den Rohstoffeinsatz auf ein nachhaltiges Niveau zu reduzieren, wird sich dies auch auf weitere politische und gesellschaftliche Ziele auswirken. Um diese unterschiedlichen Aspekte abzubilden, sind verschiedene Indikatoren notwendig. Gesamtwirtschaftliche Indikatoren als Kompass der Ressourcenpolitik Gesamtwirtschaftliche Indikatoren zur Rohstoffinanspruchnahme sollen ein umfassendes Spiegelbild der Ressourcennutzung in einer Volkswirtschaft geben. Sie zeigen an, wie sich die Rohstoffinanspruchnahme über den Zeitverlauf verändert und ob sich die Ressourcennutzung in die gewünschte Richtung bewegt. Damit ermöglichen sie eine Einschätzung, ob die aktuelle Ressourcenpolitik effektiv und zielführend ausgestaltet ist. Auch ressourcenpolitische Ziele können nur dann überprüft und weiterentwickelt werden, wenn aussagekräftige und mit robusten Daten unterlegte Indikatoren vorliegen. Daher können gesamtwirtschaftliche Indikatoren als Kompass für eine aktive und ambitionierte Ressourcenpolitik dienen. Für die konkrete Gestaltung und Evaluierung von einzelnen Maßnahmen und Instrumenten der Ressourcenpolitik sind allerdings weitere, ergänzende Indikatoren notwendig. Dies sind unter anderem Kenngrößen zur Belastung der Umwelt als Senke (beispielsweise Treibhausgasemissionen, Versauerung), zur Nutzung anderer Ressourcen wie Boden (z. B. Flächeninanspruchnahme) oder Wasser, zur Kreislaufwirtschaft (z. B. Verwertungsquoten von Abfällen) sowie Indikatoren zu konkreten Stoffströmen, Produkten oder Sektoren. Diese Indikatoren werden an anderer Stelle thematisiert 1. Es gibt zahlreiche Vorschläge für gesamtwirtschaftliche Indikatoren, einige Indikatoren werden bereits genutzt. Die methodischen Grundlagen für die Erfassung der Rohstoffnutzung sind gelegt 2, auch wenn noch an verschiedenen Stellen eine methodische Weiterentwicklung und eine Verbesserung der Datenbasis sinnvoll und notwendig ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie ein Indikatorenset aussehen könnte, das auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ein möglichst aussagekräftiges Bild der Ressourcennutzung insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Rohstoffen zeichnet. Dieser Aspekt steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. Effiziente Nutzung und absolute Senkung nötig Nach der Entnahme aus der Umwelt durchlaufen Rohstoffe das ökonomische System. Sie werden zu Konsum- oder Investitionsgütern verarbeitet, wiederverwertet oder sie finden ihren Weg als Abfall zurück in die Umwelt. Um abzubilden, ob in diesen Prozessen sparsam mit den Rohstoffen umgegangen wird, ist es sinnvoll, die Rohstoffinanspruchnahme mit ökonomischen Kenngrößen zu verbinden. Das Ergebnis sind rohstoffbezogene Produktivitäten. Diese messen die Wertschöpfung, die mit bestimmten Mengen an Rohstoffen oder Materialien erzielt wird. Ihre Entwicklung 1 Vgl. z. B. Umweltbundesamt (2015) 2 Siehe z. B. OECD (2008) 4
5 kann zeigen, wie effizient die Produktionsprozesse in Bezug auf die damit erzielte Wertschöpfung sind. Sie ist damit ein Maßstab an dem sich Politik orientieren und gegebenenfalls Handlungsbedarf identifizieren kann. Im Jahr 2002 wurde der Indikator Rohstoffproduktivität in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen. Auch Eurostat publiziert auf europäischer Ebene regelmäßig den Indikator Rohstoffproduktivität. In einer endlichen Welt gibt es Grenzen der Rohstoffnutzung. Wo sie liegen, ist jedoch nicht genau bekannt. Im Sinne eines Vorsorgeprinzips muss es für die Ressourcenpolitik daher darum gehen, ein nach aktuellem Kenntnisstand möglichst nachhaltiges Niveau der Rohstoffnutzung anzustreben. Das bedeutet, dass neben den Effizienzindikatoren Kennziffern benötigt werden, die Auskunft über die physische absolute Rohstoffinanspruchnahme geben. So wird im Ressourceneffizienzprogramm ProgRess die absolute Rohstoffinanspruchnahme pro Kopf als weiterer Indikator ausgewiesen (Bundesregierung 2012, S. 31f.). Auch Eurostat berechnet inzwischen die Rohstoffinanspruchnahme pro Einwohner für die EU-27 insgesamt (Eurostat 2014). Nur ein Set aus Indikatoren zur Rohstoffproduktivität und zur absoluten Rohstoffinanspruchnahme kann anzeigen, ob wir uns als Gesellschaft auf dem richtigen Weg hin zu einer nachhaltigen Rohstoffnutzung befinden. Ressourcenpolitik erfordert ein Set von Indikatoren und Ziele Nur wenn Indikatoren mit Zielen unterlegt werden, kann Ressourcenpolitik richtungssicher und systematisch betrieben und ihre Wirksamkeit überprüft werden. Auf verschiedenen Ebenen wurden bereits Ziele formuliert oder befinden sich in der Diskussion. Einen starken Impuls für die Debatte hat es im Zusammenhang mit dem Anstieg der Rohstoffpreise vor einigen Jahren gegeben. Die Begrenztheit der Ressourcennutzung und der notwendige Handlungsbedarf wurden dadurch nochmals verdeutlicht. Bislang haben Politik und Berichterstattung vor allem Produktivitätsindikatoren und -ziele im Blick (EEA 2011). So ist in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ein Ziel zur Steigerung der Rohstoffproduktivität verankert; auf europäischer Ebene wird darüber diskutiert (EREP 2014). Auf Ebene der Vereinten Nationen enthalten die Vorschläge zu den Sustainable Development Goals die explizite Forderung nach einem weltweit nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die Steigerung der Ressourcenproduktivität benennen sie dabei als ein Unterziel (Target 8.4, 9.4, 11.b in UN 2015). Gesamtwirtschaftliche Ziele und Indikatoren sind unverzichtbare Elemente einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Rohstoffpolitik. Daher wird im Folgenden ein Set von repräsentativen gesamtwirtschaftlichen Indikatoren und Zielen vorgestellt, welches die absolute physische Rohstoffinanspruchnahme und die Rohstoffproduktivität umfasst. Diese Indikatoren bilden zwei wesentliche Aspekte ab: das Ziel einer nachhaltigen und sparsamen Rohstoffnutzung und das Ziel einer effizienten Ressourcennutzung. Das Ziel- und Indikatoren-Set auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sollte für die Meso- und Mikroebene ergänzt werden durch ein produkt- und stoffstromspezifisches sowie kreislaufwirtschaftliches Ziel- und Indikatoren- Set. Flankierend dazu sind Ziele und Indikatoren für andere natürliche Ressourcen wie Wasser und Boden notwendig. 5
6 2. Vorschläge für gesamtwirtschaftliche Rohstoffindikatoren 2.1 Rohstoffproduktivität Der Leitindikator Rohstoffproduktivität der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie setzt die Wertschöpfung gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Beziehung zum Materialeinsatz, der mit dieser Wertschöpfung einhergeht 3,4. Der Materialeinsatz umfasst sowohl die Entnahme abiotischer inländischer Rohstoffe und die Rohstoffimporte (Metalle, Industrie- und Baumineralien, fossile Rohstoffe) als auch die mit ihrem Eigengewicht erfassten Importe von Halb- und Fertigwaren 5. Rechnerisch ist die Rohstoffproduktivität der Nachhaltigkeitsstrategie definiert als BIP/DMIabiot. Aufgrund seiner Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist dieser Indikator vor allem als gesamtwirtschaftliche Kenngröße für die effiziente Verwendung des Produktionsfaktors abiotische Materialien zu verstehen. Seine Entwicklung verdeutlicht, wie effizient eine Volkswirtschaft die Materialien als Produktionsfaktor im Zeitverlauf nutzt. Daher wird er üblicherweise als Index in einer Zeitreihe dargestellt (vgl. Abbildung 1). Entwicklung der Rohstoffproduktivität die Daten Die Rohstoffproduktivität hat in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten zugenommen. Trotz eines erheblichen Wachstums des BIP ging der Materialeinsatz zurück. Vor allem der Einsatz von Baumaterialien reduzierte sich um 31,5 % von 1994 auf 2012 (Statistisches Bundesamt 2014b). Der Trend zur steigenden Rohstoffproduktivität hat sich zuletzt jedoch etwas abgeschwächt. Der Indikator wird auch dadurch beeinflusst, dass zunehmend importierte Halb- und Fertigwaren eingesetzt werden, das heißt rohstoffintensive Produktionsschritte zunehmend im Ausland stattfinden. Da der Indikator auf der Messung des Materialinputs in Deutschland beruht, führt diese Verlagerung der Produktion dazu, dass Produktivitätsfortschritte im Hinblick auf die Rohstoffnutzung überzeichnet werden. 3 Zum Begriff der Rohstoffproduktivität und weiterer Fachtermini siehe auch Umweltbundesamt (2012). 4 Der Materialeinsatz wird mit dem abiotischen Anteil des Indikators DMI (Direct Material Input) gemessen. 5 Der Begriff Rohstoffproduktivität ist insofern irreführend, als der Indikator tatsächlich nur Materialproduktivität misst. Biotische Rohstoffe vervollständigen das Bild Bisher bezieht sich der Indikator Rohstoffproduktivität lediglich auf abiotische Materialien wie Metalle und Mineralien. Das Umweltbundesamt empfiehlt, zukünftig auch die biotischen Rohstoffe in die Berechnung einzubeziehen. Damit wird vor allem vermieden, dass die Substitution von abiotischen durch biotische Rohstoffe als Produktivitätsfortschritt erscheint. Die Verfügbarkeit von biotischen Rohstoffen und die Auswirkungen ihrer Nutzung auf die Umwelt werden immer wichtiger und sollten daher in Indikatoren und Zielen einer umweltverträglichen Rohstoffnutzung berücksichtigt werden: Biotische Rohstoffe müssen ebenso effizient genutzt werden wie abiotische Rohstoffe. Gleichzeitig würde man sich dadurch an die auf europäischer und internationaler Ebene benutzten Indikatoren anpassen, denn Eurostat, UNEP und die OECD beziehen die biotischen Rohstoffe in ihre Rohstoffindikatoren bereits mit ein. Materialeinsatz bildet tatsächliche Rohstoffnutzung ungenügend ab Der derzeit verwendete Indikator Rohstoffproduktivität ist gut etabliert. Dies gilt sowohl für den Indikator der Nachhaltigkeitsstrategie (BIP/DMIabiot) als auch für den auf europäischer Ebene publizierten (BIP/ DMC). Allerdings weist seine Interpretation Grenzen auf. Der in die Berechnung des Indikators einfließende direkte Materialinput enthält sowohl Rohstoffe als auch Halb- und Fertigwaren. Für die Produktion dieser Halb- und Fertigwaren werden wiederum Rohstoffe verwendet. Findet die Produktion im Inland statt, sind diese Rohstoffe im Indikator enthalten. Findet die Produktion jedoch im Ausland statt, geht nur das Gewicht der importierten Halb- und Fertigwaren in die Berechnung ein, nicht die zur Herstellung tatsächlich notwendigen Rohstoffe. Die Menge an benötigten Rohstoffen wird daher unterschätzt und die Produktivität somit überschätzt. Problematisch wird dies insbesondere, wenn eine signifikante Menge an Halb- oder Fertigwaren im- oder exportiert wird (wie das für Deutschland mit seinen starken Außenhandelsverflechtungen der Fall ist) und wenn sich die Handelsstrukturen im Zeitablauf ändern. Die Menge der direkt genutzten Materialien, wie sie im DMI zum Ausdruck kommt, steht dadurch immer weniger im Zusammenhang mit dem tatsächlich notwendigen Einsatz an Primärrohstoffen. Da der DMI nur den 6
7 Abbildung 1 Rohstoffproduktivität in Deutschland 220 Index 1994 = 100 Ziel: ,8* 147,8 127,2 86, * 2020 Rohstoffproduktivität (abiotisch) Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) Rohstoffentnahme und Importe (abiotisch) Rohstoffentnahme und Importe (einschließlich indirekte Importe, abiotisch) Quelle: Statistisches Bundesamt (2015a), S. 7 Materialinput misst, kann er nicht abbilden, ob zur Erstellung dieser Materialien viel oder wenig Rohstoffe nötig sind. Um sicherzustellen, dass ein Indikator für effiziente Rohstoffnutzung auch den gesamten Verbrauch an Primärrohstoffen berücksichtigt, schlägt das Umweltbundesamt vor, die Rohstoffnutzung mittels Rohstoffäquivalenten 6 zu messen nicht mittels Materialeinsatz, wie es der aktuelle Indikator vorsieht. Systemgrenzen von Wertschöpfung und Rohstoffverbrauch müssen übereinstimmen Für die Berechnung eines konsistenten und richtungssicheren Produktivitätsindikators ist es wichtig, dass Zähler und Nenner vergleichbare Größen darstellen. Das BIP als monetäre Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Zähler) und der Materialinput als physische Größe der Materialflussrechnung (Nenner) müssen sich vor allem innerhalb deckungsgleicher Systemgrenzen bewegen. Ansonsten können wirtschaftliche Aktivitäten, die innerhalb der einen, aber außerhalb der anderen Systemgrenze ablaufen, den Indikator verzerren. 6 Rohstoffäquivalente umfassen alle Rohstoffe, die für die Herstellung von Materialien und Produkten benötigt werden. Bei der Berechnung werden Halb- und Fertigwaren die entsprechenden Rohstoffaufwendungen zugeordnet. Zwei Beispiele sollen dies veranschaulichen: Finden bei einem Produkt während des Herstellungsprozesses Weiterverarbeitungsschritte im Ausland statt, wird die Materialnutzung jedes Mal gezählt und als Input im Nenner des Indikators erfasst, wenn dieses Produkt in die inländische Wirtschaft fließt. Im Zähler wird als Output jedoch nur der inländische Wertschöpfungsanteil berücksichtigt. Eine Veränderung der Außenhandelsstruktur hat also erhebliche Auswirkungen auf den Indikator Rohstoffproduktivität (BIP/DMI). Auch Änderungen der Produktionsstruktur beeinflussen den Indikator. So fällt z. B. der berechnete Materialaufwand in der einheimischen Wirtschaft deutlich geringer aus, wenn nicht mehr einheimische Metallerze, sondern importierte Metalle verwendet werden. Das Abfallerz wird dann nicht mehr bilanziert, da es im Ausland anfällt. Damit entfällt im Inland zwar die Wertschöpfung bei der Erzgewinnung und -aufbereitung, aber es wird eine Tätigkeit ins Ausland verlagert, die im Vergleich zu anderen Sektoren der Wirtschaft sehr materialintensiv ist, d. h. nur eine relativ geringe Wertschöpfung pro Kilogramm Material erbringt. Im Ergebnis steigt der Quotient BIP/DMI. 7
8 Am tatsächlichen Rohstoffbedarf hat sich durch diese Verlagerung aber nichts geändert, nur die internationale Arbeitsteilung ist eine andere. Im Inland befinden sich jetzt die materialeffizienteren Sektoren. Dies ist jedoch nicht auf einen effizienteren Rohstoffeinsatz zurückzuführen, sondern allein auf eine Verlagerung der Produktion. Wenn in der Folge Produktionsprozesse im Ausland ineffizienter ablaufen als im Inland, kann der scheinbare Effizienzgewinn im Inland sogar mit einer geringeren Materialeffizienz weltweit einhergehen. Diese Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in der Außenhandelsstruktur zeigt, dass der Indikator Rohstoffproduktivität, gemessen als BIP/ DMI (oder BIP/DMIabiot), weiterentwickelt werden muss. Das Umweltbundesamt schlägt deshalb vor, in Zukunft zusätzlich den Indikator Gesamtrohstoffproduktivität auszuweisen Gesamtrohstoffproduktivität Die Gesamtrohstoffproduktivität stellt den Wert aller Güter, die aus dem Inland zur letzten Verwendung (Konsum oder Investition im Inland und Export) abgegebenen werden, in Beziehung zu den für ihre Herstellung verwendeten Rohstoffen. Sie bezeichnet also das Verhältnis der gesamten (inländischen und der für die Importe benötigten ausländischen) Wertschöpfung zum Rohstoffeinsatz, der für ihre Erbringung insgesamt notwendig ist (inländische Rohstoffentnah- me und alle ausländischen Rohstoffaufwendungen). Dabei lässt sich die Wertschöpfung als Summe von (preisbereinigtem) BIP und Importen darstellen. Der gesamte Rohstoffinput wird durch den Indikator RMI (Raw Material Input) abgebildet. Errechnen lässt sich die Gesamtrohstoffproduktivität also mit dem Quotienten (BIP+Importe)/RMI. Anders als der direkte Materialinput (DMI) erfasst der Indikator RMI nicht nur die unmittelbar im Inland benötigten Materialien in unterschiedlichen Verarbeitungsgraden, sondern auch alle ausländischen Vorleistungen, die für die Fertigung importierter Produkte notwendig sind. Für die importierten Materialien werden also alle zur Herstellung benötigten Rohstoffe einbezogen. Im Ergebnis rechnet man mit Rohstoffäquivalenten. So ergibt sich für Deutschland im Mittel pro Tonne an direktem Import ein Rohstoffäquivalent von 2,5 t, bei exportierten Gütern sind es sogar 3,9 t 8. Entsprechende Werte werden bereits detailliert für einzelne Gütergruppen bzw. Sektoren berechnet. Verlagerungen von rohstoffintensiven Sektoren zwischen In- und Ausland haben auf den Indikator der Gesamtrohstoffproduktivität keine Auswirkungen. Er bildet ab, wenn produktivere Verfahren verwendet werden, unabhängig davon, ob das im In- oder im Ausland geschieht, und ist insofern richtungssicher. 7 Für eine formale Herleitung von konsistenten Produktivitätsindikatoren siehe Statistisches Bundesamt (2015). 8 Eigene Berechnungen nach Statistisches Bundesamt (2014b). 8
9 Entwicklung der Gesamtrohstoffproduktivität die Daten Bei der Betrachtung der Gesamtrohstoffproduktivität Deutschlands zeigt sich eine leichte Steigerung für das letzte Jahrzehnt. Mit einer starken Zunahme von BIP und Importen war ein leichter Rückgang des RMI verbunden. Um verschiedene zentrale Einflussfaktoren wie Wirtschaftswachstum, sektoralen Strukturwandel oder Verlagerungseffekte darzustellen, sollte man zukünftig Dekompositionsanalysen durchführen. Mit solchen Analysen kann die Größe der einzelnen Effekte und ihr Beitrag zur Veränderung der Gesamtrohstoffproduktivität geschätzt werden. Tabelle 1 Entwicklung der Gesamtrohstoffproduktivität für Deutschland Index (2000=100) p Gesamtrohstoffproduktivität für Deutschland P = vorläufig Quelle: interne Auswertung des Statistischen Bundesamtes 2.3 Vergleich der unterschiedlichen Produktivitäten an Beispielen Die nachfolgenden Beispiele sollen noch einmal die Unsicherheiten und Probleme im Gebrauch der unterschiedlichen rohstoffbezogenen Produktivitäten aufzeigen und die Aussagekraft der einzelnen Indikatoren verdeutlichen. Effizienzsteigerung im Inland Ein Holzregal wird in Deutschland gefertigt, sämtliche Materialien wie Regalböden, Schrauben und Leim werden aus heimischen Rohstoffen hergestellt. Durch einen effizienteren Produktionsprozess wird weniger Holz zur Herstellung der Regalböden benötigt. DMI sinkt, RMI sinkt, BIP bleibt gleich: Die Rohstoffproduktivität BIP/DMI und die Gesamtrohstoffproduktivität (BIP+Importe)/RMI steigen. In diesem Beispiel findet alles im Inland statt, daher entspricht der Materialaufwand dem Rohstoffaufwand und die Systemgrenzen sind einheitlich. Produktionsverlagerung ins Ausland (geringere Effizienz) Die Regalböden werden nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland hergestellt. Dabei wird aufgrund ineffizienter Prozesse mehr Holz benötigt als bei der Produktion in Deutschland. DMI sinkt (da Holzabfälle nun im Ausland anfallen), RMI steigt (wegen ineffizienterem Produktionsprozess), BIP sinkt (da ein Teil der Wertschöpfung ins Ausland verlagert wird): Die Rohstoffproduktivität kann steigen oder fallen, obwohl mehr Rohstoffe eingesetzt werden. Wenn die Herstellung der Regalbretter im Inland relativ materialintensiv war (im Vergleich zu den anderen Sektoren), steigt die Rohstoffproduktivität. Wenn die Herstellung der Regalbretter im Inland relativ materialeffizient war (im Vergleich zu den anderen Sektoren), sinkt die Rohstoffproduktivität. Die Gesamtrohstoffproduktivität sinkt. Produktionsverlagerung ins Ausland (höhere Effizienz) Die Regalböden werden nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland hergestellt. Dabei wird aufgrund hocheffizienter Prozesse weniger Holz benötigt als bei der Produktion in Deutschland. DMI sinkt (da Holzabfälle nun im Ausland anfallen), RMI sinkt wegen effizienterem Produktionsprozess), BIP sinkt (da ein Teil der Wertschöpfung ins Ausland verlagert wird): Hier kann die Rohstoffproduktivität ebenfalls steigen oder fallen, obwohl weniger Rohstoffe eingesetzt werden. Wenn die Herstellung der Regalbretter im Inland relativ materialintensiv war (im Vergleich zu den anderen Sektoren), steigt die Rohstoffproduktivität. Wenn die Herstellung der Regalbretter im Inland relativ materialeffizient war (im Vergleich zu den anderen Sektoren), sinkt die Rohstoffproduktivität. Die Gesamtrohstoffproduktivität steigt. Die beiden letzten Beispiele zeigen, dass die Auslagerung relativ materialintensiver Verarbeitungsschritte ins Ausland die Rohstoffproduktivität steigen lässt und 9
10 vice versa. Ob die Verarbeitung im Ausland rohstoffintensiver oder effizienter als im Inland ist, kann die Rohstoffproduktivität BIP/DMI nicht anzeigen. Produktionsverlagerung ins Ausland (gleiche Effizienz, Reimport) Alle Teile werden im Inland hergestellt. Zur Endmontage werden die Teile jedoch ins Ausland exportiert und zum Verkauf wieder importiert. An der Effizienz der Herstellung ändert sich gegenüber der Ausgangssituation nichts. Der Rohstoffbedarf ist gleich geblieben, nur ein Teil der Wertschöpfung hat sich ins Ausland verlagert. DMI steigt (da ein zusätzlicher Import der Materialien stattfindet), RMI steigt (noch stärker, da der zusätzliche Import mit dem gesamten dafür notwendigen Rohstoffeinsatz sozusagen mit vollem Rohstoffrucksack gemessen wird), BIP sinkt (da ein Teil der Wertschöpfung ins Ausland verlagert wird): Die Rohstoffproduktivität sinkt, obwohl gleich viele Rohstoffe eingesetzt werden. Denn jedes Mal, wenn die Materialien in die inländische Wirtschaft fließen, wird das Material gezählt. Die Gesamtrohstoffproduktivität ändert sich dagegen nur wenig 9, da zwar die zusätzlichen Importe mit dem Rohstoffrucksack gemessen werden, aber gleichzeitig auch die zusätzliche Wertschöpfung der Importe berücksichtigt wird. Dieses Beispiel zeigt, welches Problem bei unterschiedlichen Systemgrenzen in Zähler und Nenner auftritt. Die Beispiele zeigen, dass der Indikator Gesamtrohstoffproduktivität richtungssicher auf Veränderungen der Handelsstruktur sowie Veränderungen der Produktivität im In- und Ausland reagiert. Bei der Rohstoffproduktivität ist dies jedoch nicht immer der Fall. 9 Da der Reimport mehrmals sowohl in Nenner als auch Zähler gezählt wird, ist für das Ergebnis entscheidend, ob diese mehrmals berücksichtigten Produktionsschritte effizienter oder weniger effizienter als der Rest der Wirtschaft sind. Sind diese effizienter, so steigt die Effizienz (weil effiziente Produktionsschritte überrepräsentiert sind), sind diese weniger effizienter, sinkt die Effizienz. Da Reimporte typischerweise nur einen sehr kleinen Teil der Wertschöpfung umfassen und durch die Berücksichtigung in Nenner und Zähler letztlich nur die Differenz der Produktivität aller reimportierten Güter zur sonstigen Produktivität eine Rolle spielt, dürfte der Einfluss auf die Gesamtrohstoffproduktivität vernachlässigbar sein. 2.4 Absolute Rohstoffinanspruchnahme Die weltweite Inanspruchnahme von Primärrohstoffen hat sich in den letzten hundert Jahren nahezu verzehnfacht auf 68 Milliarden Tonnen in 2009 (Abbildung 2). Im Jahr 2050 wird die wachsende Weltbevölkerung schätzungsweise mehr als 140 Milliarden Tonnen benötigen, wenn sie weiter so produziert und konsumiert wie bisher. Bis dahin werden voraussichtlich 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. In vielen Schwellenländern wächst die Wirtschaft schnell. Eine relative Entkopplung von Wirtschaftswachstum und der Ressourceninanspruchnahme, wie sie in einer steigenden Produktivität zum Ausdruck käme, reicht somit nicht aus, um dem weiter steigenden Rohstoffbedarf gerecht zu werden. Es gilt die globale Rohstoffentnahme absolut zu begrenzen. Auch die Enquête-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität des Deutschen Bundestags schreibt, dass die ökologischen Grenzen der Umweltbelastung der Erde die Grenzen unseres Handelns bestimmen und kommt zum Schluss Ziel muss also vielfach nicht nur eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch, sondern eine absolute Reduktion des Umweltverbrauchs sein (Deutscher Bundestag 2013, S. 25). Für eine nachhaltige Entwicklung ist daher nicht nur wichtig, wie wir mit Ressourcen umgehen, sondern vor allem auch wie viel wir davon absolut in Anspruch nehmen. Daher müssen die bisher ausgewiesenen Indikatoren zur Rohstoffproduktivität um einen Indikator zur absoluten Rohstoffinanspruchnahme ergänzt werden. Inländische Primärrohstoffverwendung als Indikator für die absolute Rohstoffinanspruchnahme Ein Indikator für die absolute Rohstoffinanspruchnahme sollte alle der Natur entnommenen Rohstoffe für die menschliche Nutzung umfassen. Er kann damit den Umfang der durch den Menschen verursachten Stoffströme darstellen. Die inländische Primärrohstoffverwendung (Raw Material Consumption, RMC) ist dazu als Indikator sehr gut geeignet. Sie bildet den Eigenbedarf einer Volkswirtschaft ab: alle Rohstoffe, die direkt und indirekt für die letzte inländische Verwendung also für inländischen Konsum und Investitionen genutzt werden; auch die dabei entstehenden Abfälle werden berücksichtigt. Für diesen Indikator müssen neben den inländischen Rohstoffentnahmen 10
11 Abbildung 2 Globale Primärrohstoffentnahme Milliarden Tonnen fossile Energieträger Erze sonstige mineralische Rohstoffe Biomasse Quelle: Krausmann et. al (2009) alle Rohstoffe erfasst werden, die im Ausland für die Erstellung der importierten Vorleistungen benötigt werden. Im Gegenzug werden alle exportierten Güter und die dafür erforderlichen Rohstoffe abgezogen. Um die Interpretation zu erleichtern, ist eine Unterteilung des Indikators in Rohstoffkategorien (fossile Energieträger, Erze, sonstige mineralische Rohstoffe und Biomasse) sinnvoll. Für die Berechnung werden Rohstoffäquivalente verwendet. Der RMC bezieht sich auf eine bestimmte Region, z. B. Deutschland. Es bietet sich an, den Indikator auf die Einwohnerzahl zu normieren: Pro Kopf gerechnet ist die Rohstoffinanspruchnahme nicht Abbildung 3 Letzte inländische Rohstoffverwendung (RMC)* pro Kopf ** 20 18,2 15 2,8 16,1 3,2 14,8 15,1 3,2 3,1 15,7 3,3 Tonnen 10 8,8 6,8 6,5 6,5 7,1 5 1,7 0,9 0,3 0,5 0,3 4,9 5,2 4,8 5,0 5, *** Fossile Energieträger Erze sonstige mineralische Rohstoffe Biomasse * RMC = Raw Material Consumption ** Jahresdurchschnittswert auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung früherer Zählungen. *** vorläufige Angaben Quelle: Statistisches Bundesamt (2014b), S
12 nur anschaulicher, sie ermöglicht auch internationale Vergleiche nicht zuletzt in Bezug auf die Frage nach einer global gerechten Rohstoffnutzung. Entwicklung der absoluten Rohstoffinanspruchnahme Der RMC ging in Deutschland vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2011 um fast ein Sechstel (15 %) zurück. Das ist vor allem auf eine Verminderung der Investitionen in Ausrüstungen, sonstige Anlagen und Bauten zurückzuführen (Statistisches Bundesamt 2014b, S. 44). Die für die Berechnung des Indikators RMC notwendigen Daten liegen in einer hinreichenden Genauigkeit vor. Bei der Erfassung der Produktionsschritte, die im Ausland erfolgen und dem damit verbundenen Materialverbrauch, sind Schätzungen und Vereinfachungen vorzunehmen. Die damit verbundene Datenunsicherheit sollte allerdings nicht überbewertet werden: Zum einen hat sich die Berechnung in der letzten Zeit erheblich verbessert, zum anderen ist auch für die Berechnung anderer, vermeintlich exakter Indikatoren wie des BIP eine Reihe von Schätzungen erforderlich. Ungenutzte Entnahmen vervollständigen das Bild Allerdings umfasst der RMC nicht alle Rohstoffaufwendungen. Bei der Rohstoffförderung fällt regelmäßig Material an, das nicht verwertet wird. Diese sogenannten ungenutzten Entnahmen insbesondere Abraum werden nicht einbezogen. Allein im Inland fallen jährlich mehr als 2 Mrd. t davon an, zum größten Teil im Braunkohletagebau. Mit diesen Stoffströmen sind erhebliche Umweltschäden verbunden, daher sollten sie bei der Berechnung der Rohstoffinanspruchnahme berücksichtigt werden. Die Datenlage, besonders im Ausland, und die Berechnungsmethoden und -standards für ungenutzte Entnahmen sind derzeit jedoch noch nicht befriedigend. Das Umweltbundesamt empfiehlt, diese Defizite schnellstmöglich zu überwinden, so dass zukünftig der Indikator Rohstoffinanspruchnahme sowohl für genutzte als auch die ungenutzte Entnahme erfasst werden und eine entsprechende Darstellung erfolgen kann. 3. Vorschläge für gesamtwirtschaftliche Ziele zur Rohstoffnutzung 3.1 Ziele für Rohstoffproduktivität und Gesamtrohstoffproduktivität Die Entwicklung der Rohstoffproduktivität zeigt, ob es Fortschritte in Richtung einer effizienten Rohstoffnutzung gegeben hat. Die Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt bereits das Ziel, die Rohstoffproduktivität gemessen mit dem Indikator BIP/DMIabiot bis 2020 gegenüber 1994 zu verdoppeln. Diese Zielsetzung gilt es in doppelter Hinsicht zu erweitern: Zum einen müssen Ziele über 2020 hinaus formuliert werden, um der zukünftigen Politik Richtung zu geben und deren Ausgestaltung daran zu messen. Zum anderen muss ein konsistenter Indikator ergänzt werden, der weder auf Veränderungen in der Außenhandelsstruktur noch auf die Substitution von abiotischen durch biotische Rohstoffe reagiert (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2). Ziel für Rohstoffproduktivität Eine Weiterführung der derzeitigen Rohstoffproduktivität BIP/DMI ist sinnvoll, auch wenn ihre Interpretierbarkeit beschränkt ist (siehe Abschnitt 2.1). Dieser Indikator ist etabliert, liegt seit 1994 in Zeitreihe vor und lässt sich aus den verfügbaren Statistiken relativ leicht berechnen. Da sich die Rohstoffproduktivität am besten als Zeitreihe interpretieren lässt, liegt es nahe, die Entwicklung der letzten Jahre als Basis für die weitere Zielentwicklung zu verwenden. Zwischen 1994 und 2010 ist die Rohstoffproduktivität (unter Einbeziehung der biotischen Rohstoffe in den DMI) um etwa 2 % pro Jahr gestiegen 10. Dieser Anstieg ist etwas geringer als der Anstieg des Indikators der Nachhaltigkeitsstrategie, der sich ausschließlich auf die abiotischen Rohstoffe bezieht (BIP/DMIabiot). Der Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass die Nutzung der biotischen Rohstoffe in den letzten Jahren leicht angestiegen ist. Insgesamt hat sich der Anstieg der Rohstoffproduktivität etwas abgeflacht: Im Zeitraum 2000 bis 2010 betrug er nur noch 1,7 % pro Jahr. Auf der einen Seite deuten die Zahlen der letzten Jahre auf eine weitere Abflachung dieses Basistrends hin. Auf der anderen Seite zeigen Untersuchungen jedoch immer wieder, dass das Potenzial der wirtschaftlich und technisch 10 Eigene Berechnungen auf Basis von Statistisches Bundesamt (2014a) und (2014c) (Tabellen 5.1 und 5.2). 12
13 möglichen Effizienzsteigerungen insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe nicht ausgeschöpft werden 11. Allein die heutigen technologischen Potenziale im Laufe von etwa 10 Jahren zu erschließen, brächte einen Effizienzgewinn von 10 %. Geht man auf dieser Basis davon aus, dass der technische Fortschritt weitergeht wie bisher, ist eine deutlich größere Effizienzsteigerung vorstellbar: Eine Zielmarge von etwa 1 Prozentpunkt über dem langjährigen durchschnittlichen Trend erscheint durchaus realistisch. Mit entsprechender Anstrengung sollte deshalb in Zukunft ein Anstieg der Rohstoffproduktivität über das Maß der letzten Jahre hinaus möglich sein. Das Umweltbundesamt hält eine Produktivitätssteigerung von 2,5 % jährlich für erstrebenswert. Dieser Wert ergibt sich aus einem Basistrend, der mit 1,5 % pro Jahr etwas schwächer ansteigt als in der Vergangenheit, und möglichen zusätzlichen Effizienzgewinnen von 1 % jährlich. Dieses Ziel ist ambitioniert, aber durchaus realistisch. Die Rohstoffproduktivität auf Basis abiotischer und biotischer Rohstoffe würde damit bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 2010 zunehmen 12. Ziel für Gesamtrohstoffproduktivität Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt, sollte der Indikator Rohstoffproduktivität durch den der Gesamtrohstoffproduktivität (BIP+Importe)/RMI ergänzt werden. Auch für die Gesamtrohstoffproduktivität bietet es sich an, Ziele am Trend der letzten Jahre auszurichten. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 ist die Gesamtrohstoffproduktivität für Deutschland jährlich um 1,3 % gestiegen 13. Als ambitioniertes und realistisches Ziel erscheint hier ebenso die Annahme einer möglichen Produktivitätszunahme von 1 Prozentpunkt über dem Trend für die nächsten Jahre plausibel. Schließlich ist nicht nur in Deutschland mit steigender Effizienz zu rechnen, eine forcierte Ressourceneffizienzpolitik sollte auch in anderen Ländern zu Materialeinsparungen in der Produktion führen. Die Berücksichtigung der globalen Vorketten bei der Berechnung der Gesamtrohstoffproduktivität macht 11 Siehe z. B. Albrecht et al. (2013), Baron et al. (2005), Emec et al. (2013), Schröter, Lerch, Jäger (2011). 12 Dieser Wert ist ebenso wie die nächsten Ziele auf 10 Prozentpunkte gerundet. Da der Basistrend und die Annahme von zusätzlichen Effizienzgewinnen nur eine ungefähre Tendenz wiedergeben können, wären exaktere Zahlen für die Ziele irreführend. 13 Eine längere Zeitreihe liegt nicht vor. die Schätzung der künftigen Entwicklung allerdings auch unsicherer. Als erstrebenswerte und vorsichtig erwartbare jährliche Produktivitätssteigerung sind 2-2,5 % plausibel. Daraus ergibt sich ein Zielkorridor für die Zunahme der Gesamtrohstoffproduktivität bis 2030 um % gegenüber Ziele für die absolute Rohstoffinanspruchnahme Ziele für die absolute Rohstoffinanspruchnahme sollten sich an einer nachhaltigen Nutzung innerhalb der ökologischen Grenzen des Erdsystems orientieren. Denn bereits heute belasten das Tempo und die Intensität der Nutzung die Ökosysteme zunehmend und gefährden so den Wohlstand und die Lebensqualität der Weltbevölkerung. So tragen z. B. allein die Förderung und weitere Bearbeitung von Metallerzen mit etwa 7-8 % zum Weltenergieverbrauch bei und belasten damit auch das Klima. Landflächen und andere natürliche Ressourcen für die Produktion von Biomasse geraten durch die steigende Nachfrage nach Agrarund Forstgütern weltweit immer stärker unter Druck. Auch die Überfischung der Meere ist ein Problem. In der Literatur werden verschiedene Ansätze und Referenzzeiträume für die Ermittlung einer global nachhaltigen pro Kopf Rohstoffinanspruchnahme (RMC) beschrieben 14. Eine Auswertung dieser Ansätze ergibt für Deutschland 5-8 t/a als Größenordnung für einen langfristigen, bis 2050 reichenden Zielkorridor 15. Das Umweltbundesamt unterstützt mit Blick auf das Vorsorgeprinzip und die notwendige Sicherung der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit die Forderung nach einer Begrenzung der Rohstoffentnahme im Rahmen dieses Zielkorridors. Reduktion der Rohstoffnutzung muss ambitioniert starten Da dieses Ziel langfristig, mit dem Horizont 2050 oder sogar darüber hinaus 16, angelegt ist, sind zusätzlich kurz- und mittelfristige (Etappen-)Ziele notwendig. Diese sollten sich an der technischen und ökonomischen Machbarkeit orientieren; d. h. sie sollten das 14 Einen knappen Überblick bietet z. B. Bringezu (2015). 15 Siehe z. B. Szenarien in UNEP (2011), IRP (2014), Bringezu (2015), Bringezu / Schütz (2014). 16 Der Ressourcenverbrauch hängt erheblich von unserer Infrastruktur ab. Da der Umbau hin zu einer ressourceneffizienten Infrastruktur Jahrzehnte benötigt, kann ein solches Ziel nur langfristig, generationenübergreifend angelegt sein. 13
14 nachgewiesene und realisierbare Einsparpotenzial einzelner Produkte und Prozesse berücksichtigen. Für konkrete, derzeit realisierbare Einsparpotenziale gibt es punktuell schon Schätzungen 17. Eine gesamtwirtschaftliche Schätzung, die alle wesentlichen Prozesse und Produkte einschließlich grundsätzlicher Strukturveränderungen der Nachfrage erfasst, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Um ein langfristiges, ambitioniertes Ziel von jährlich 5-8 t/kopf bis 2050 zu erreichen, müssen wir in Deutschland unsere Rohstoffinanspruchnahme in den nächsten 40 Jahren um durchschnittlich 2-2,5 % pro Jahr gegenüber 2010 zurückfahren. Es ist anzunehmen, dass die low hanging fruits zuerst geerntet werden dass also zunächst dort eingespart wird, wo es relativ einfach ist. Im Laufe des Prozesses wird es immer schwieriger werden, den Bedarf an Rohstoffen zu senken. Deshalb ist es plausibel anzunehmen, dass in den nächsten Jahren größere Schritte bei der Reduktion des Rohstoffeinsatzes möglich und nötig sind als in der ferneren Zukunft. Integrierte Umweltpolitik verspricht deutliche Rohstoffeinsparung Die Ziele einer integrierten Umweltpolitik versprechen insgesamt eine deutliche Rohstoffeinsparung. So sollte die angestrebte Reduktion von Treibhausgasen insbesondere durch den Umbau des Energiesystems auf erneuerbare Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz mittels Gebäudesanierung und durch veränderte Mobilitätskonzepte den Verbrauch fossiler Rohstoffe deutlich verringern. Zudem lässt die anvisierte Reduktion der Flächeninanspruchnahme zusammen mit den Zielen der Kreislaufwirtschaft zu erwähnen ist hier vor allem eine zunehmende Nutzung des anthropogenen Lagers einen deutlich geringeren Bedarf an Baumineralien erwarten. Daher plädiert das Umweltbundesamt dafür, einen jährlichen Rückgang der Rohstoffinanspruchnahme um mindestens 2,5 % anzustreben. Dies entspricht einem Zielkorridor für die absolute Rohstoffinanspruchnahme (RMC) pro Kopf von 8-10 t/a bis 2030 bzw. einer Senkung um % gegenüber Ungenutzte Entnahmen bislang nicht ausreichend quantifizierbar Im Sinne des Vorsorgeprinzips sollte der Mensch möglichst wenig in die Natur eingreifen, um Rohstoffe zu gewinnen. Deshalb ist die angestrebte Reduzierung der absoluten Rohstoffinanspruchnahme um das Ziel zu ergänzen, auch die ungenutzten Entnahmen zu verringern. Der Forschungsstand und vor allem die Datenverfügbarkeit lassen aktuell jedoch noch keine ausreichend genaue Quantifizierung für ein Ziel für nicht verwertete Rohstoffe zu. Aus diesem Grund wird derzeit auf eine Zielvorgabe für die Reduktion der ungenutzten Entnahmen verzichtet; perspektivisch sind sie aber zu formulieren. 17 Vgl. z. B. Emec et al oder Albrecht et al
15 4. Zusammenfassung und Ausblick Eine nachhaltige Rohstoffnutzung muss innerhalb der ökologischen Grenzen des Erdsystems liegen. Denn bereits heute belasten Tempo und Intensität der Ressourcennutzung die Ökosysteme zunehmend und gefährden damit auch den Wohlstand und die Lebensqualität der Weltbevölkerung. Sinnvoll ausgewählte gesamtwirtschaftliche Indikatoren zur Rohstoffinanspruchnahme zeichnen ein übergreifendes Bild der Ressourcennutzung in einer Volkswirtschaft und berücksichtigen dabei auch die Rohstoffinanspruchnahme durch Importe und Exporte. Daher können diese Indikatoren und die daran ansetzenden Ziele als Kompass für eine erfolgreiche, an Nachhaltigkeit orientierte Ressourcenpolitik dienen. Für die Meso- und Mikroebene sind ergänzend produkt- und stoffstromspezifische sowie kreislaufwirtschaftliche Ziele und Indikatoren erforderlich. Auch für die anderen Ressourcen, wie Fläche und Wasser sind Ziele und Indikatoren notwendig. Der Vorschlag des Umweltbundesamts für gesamtwirtschaftliche Indikatoren und Ziele Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen gesamtwirtschaftlichen Indikatoren und Ziele. Bei allen Indikatoren werden sowohl biotische als auch abiotische Rohstoffe einbezogen. Die drei neu vorgeschlagenen Indikatoren treffen unterschiedliche Aussagen und beschreiben unterschiedliche Ansatzpunkte für die Politik. Deshalb ist es sinnvoll, sie gemeinsam auszuweisen und zu betrachten. Um die Aussagefähigkeit zu steigern, wird außerdem vorgeschlagen, auch die Verteilung der Rohstoffinanspruchnahme auf die großen Rohstoffgruppen (Erze, sonstige mineralische Rohstoffe, fossile Energieträger, Biomasse) zu berichten. Darüber hinaus sollten vertiefende Analysen punktuell Informationen darüber liefern, was einzelne Bedürfnisfelder wie z. B. Wohnen, Mobilität oder Ernährung an Rohstoffen beanspruchen. Die Kernproblematik eine übermäßige Rohstoffinanspruchnahme durch unsere Gesellschaft bildet am besten der Indikator RMC (pro Kopf) ab. Daher plädiert das Umweltbundesamt dafür, diesen Indikator in Zukunft stärker in den Mittelpunkt der Berichterstattung zu stellen. Tabelle 2 UBA-Vorschlag für gesamtwirtschaftliche Indikatoren und Ziele Indikator Aussage Charakteristikum Rohstoffproduktivität (= Indikator der Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt um biotische Rohstoffe) Wertschöpfung, die mit den eingesetzten Materialien im Inland erzielt wird Etablierter Indikator, der eine Aussage über die inländische Materialeffizienz trifft; mit Schwächen bei der Interpretierbarkeit Ziel 2030 gegenüber % Steigerung BIP/DMI Gesamtrohstoffproduktivität (BIP+Importe)/RMI Wertschöpfung, die mit den eingesetzten Rohstoffen erzielt wird Neu vorgeschlagener, konsistenter Indikator, der eine Aussage über die Rohstoffeffizienz in der gesamten Wertschöpfungskette trifft % Steigerung Primärrohstoffinanspruchnahme pro Kopf RMC/Einwohner Rohstoffmenge, die pro Kopf für die letzte inländische Verwendung benötigt wird Indikator, der die notwendige absolute Verringerung der Rohstoffinanspruchnahme direkt adressiert % Senkung Quelle: Umweltbundesamt 15
16 Die hier vorgeschlagenen Ziele sind ambitioniert, aber umsetzbar 18. Sie gehen nur um jeweils 1 Prozentpunkt über einen business as usual -Trend hinaus. Eine Orientierung an anspruchsvollen Zielen ist jedoch unumgänglich, um eine langfristig nachhaltige Nutzung der Rohstoffe zu erreichen. Was noch getan werden sollte Forschungs- und Weiterentwicklungsbedarf Die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen innerhalb der ökologischen Leitplanken ist das erklärte Ziel der Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik der Bundesregierung. Zur genauen Ausgestaltung und Beschreibung dieses Zieles besteht in einzelnen Punkten jedoch sowohl bei den Indikatoren als auch den quantitativen Zielen noch Forschungsbedarf: Was die Indikatoren betrifft, muss die Datenerfassung verbessert und versucht werden, die Methodik zu harmonisieren. Dies gilt besonders für die Erfassung der ungenutzten Entnahmen. Außerdem sollten über Dekompositionsanalysen die Triebkräfte und Ursachen von Veränderungen besser untersucht werden. Auch das Verständnis über die Auswirkungen der natürlichen und anthropogen verursachten Stoffströme ist weiter zu verbessern. Das ist besonders für die Festlegung langfristiger Ziele nötig. Wenn die Datenbasis für die technischen und ökonomischen Potenziale von Rohstoffeinsparungen weiter vertieft wird, können daraus noch bessere und detailliertere mittel- und langfristige Ziele abgeleitet werden. 18 Die hier genannten Ziele sind in vielen Fällen nicht unmittelbar vergleichbar mit Zielen, die in der Literatur genannt oder in anderen Ländern verwendet werden. So werden teilweise DMC (Domestic Material Consumption) oder DMC pro Einwohner genannt. Da der DMC auf globaler Ebene dem RMC entspricht, kann diese Verwendung sinnvoll sein. Für ein Land wie Deutschland, welches auf umfangreiche Ressourcenimporte angewiesen ist, ist der DMC aber nicht hinreichend genau. Auf konkrete Ziele für TMC verzichten wir derzeit, da die Berechnungsgrundlagen aus unserer Sicht noch nicht hinreichend harmonisiert sind. 16
17 5. Literatur Albrecht, S.; Brandstetter, P.; Fröhling, M.; Sedlbauer, K.; Trippe, F.; Schultmann, F. (2013): Abschätzung der Ressourceneffizienz-Potenziale im Förderschwerpunkt r2. Abschlussbericht der Arbeiten im Integrations- und Transferprojekt zum Förderschwerpunkt r2 Innovative Technologien für Ressourceneffizienz rohstoffintensive Produktionsprozesse, Karlsruhe und Stuttgart. Bahn-Walkowiak, B.; Steger, S. (2013): Politische und rechtliche Ansätze für inputorientierte Ressourcenziele in Europa und weltweit. Arbeitspapier AS 1.1 im Projekt Ressourcenpolitik: Analyse der ressourcenpolitischen Debatte und Entwicklung von Politikoptionen (PolRess). Baron, R., K. Alberti, J. Gerber, E. Jochem, H. Bradke, C. Dreher, V. Ott, K. Kristof, C. Liedtke and J. Acosta Fernandez (2005): Studie zur Konzeption eines Programms für die Steigerung der Materialeffizienz in mittelständischen Unternehmen: Abschlussbericht. Bringezu, S. (2015): Possible Target Corridor for Sustainable Use of Global Material Resources. Resources (4), S Bringezu, S. und Schütz, H. (2013): Ziele und Indikatoren für die Umsetzung von ProgRess.Arbeitspapier AS 1.2/1.3 im Projekt Ressourcenpolitik: Analyse der ressourcenpolitischen Debatte und Entwicklung von Politikoptionen (PolRess). Bringezu, S. und Schütz, H. (2014): Indikatoren und Ziele zur Steigerung der Ressourcenproduktivität. Arbeitspapier 1.4 im Projekt Ressourcenpolitik: Analyse der ressourcenpolitischen Debatte und Entwicklung von Politikoptionen (PolRess). Bundesregierung (2012): Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess), Herausgeber: BMU, 2012, Berlin Bundesregierung (2015): An Morgen denken. Gemeinsam handeln. Abschlusserklärung G7-Gipfel, Juni blob=publicationfile&v=5 Deutscher Bundestag (2013): Enquête-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität des Deutschen Bundestags, Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft, Schlussbericht, Drucksache 17/13300 EEA [European Environment Agency] (2011): Resource efficiency in Europe: Policies and approaches in 31 EEA member and cooperating countries ; prepared by Kazmierczyk, Pawel ; Stenbaek Hansen, Mikkel ; Günther, Jens ; McKinnon, David ; Loewe, Christian ; Lingvall, Fredrik ; Kallay, Tamas Kristof ; Szlezak, Jozsef ; Bahn- Walkowiak, Bettina ; Herczeg, Marton ; Wittmer, Dominic: EEA Report No 5/2011 Copenhagen: European Environment Agency. Emec, S.; Stock, T.; Bilge, P.; Tufinkgi, P.; Kaden, C.; Seliger, G. (2013): Analyse von Potenzialen der Materialund Energieeffizienz in ausgewählten Branchen der Metall verarbeitenden Industrie. VDI-ZRE. Berlin. 81 S. EREP (2014): Manifesto & Policy Recommendations, European Resource Efficiency Platform, Brussels, März 2014 Eurostat (2014): Material flow accounts - flows in raw material equivalents Stand August 2014 IRP (2014): Managing and conserving the natural resource base for sustained economic and social development A reflection from the International Resource Panel on the establishment of Sustainable Development Goals aimed at decoupling economic growth from escalating resource use and environmental degradation. Online im Internet: Contributing%20to%20the%20SDGs%20Process.pdf (abgerufen: ) 17
18 Krausmann, F.; Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K.H., Haberl, H., Fischer-Kowalski, M. (2009): Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century, Ecological Economics Vol. 68 (10), S , Version 1.2 (August 2011) including data , OECD (2008): Measuring Material Flows and Resource Productivity, Volume I, The OECD Guide Schmidt-Bleek, F. et al. (2014): The Challenge of the Whole: Creating System Policies to Tackle Sustainability in M. Angrick et al. (eds.), Factor X: Policy, Strategies and Instruments for a Sustainable Resource Use, Eco-efficiency in Industry and Science 29, Springer, Dortrecht 2014 Schröter M., Lerch C., Jäger A. (2011): Materialeffizienz in der Produktion: Einsparpotenziale und Verbreitung von Konzepten zur Materialeinsparung im Verarbeitenden Gewerbe, Endberichterstattung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Fraunhofer ISI, Karlsruhe, Dezember 2011 Statistisches Bundesamt (2014): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2014, Statistisches Bundesamt, Juni 2014, Wiesbaden Statistisches Bundesamt (2014a): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Daten zum Indikatorenbericht 2014, Statistisches Bundesamt, Juni 2014, Wiesbaden Statistisches Bundesamt (2014b): Umweltnutzung und Wirtschaft: Bericht zu den umweltökonomischen Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt, 2014, Wiesbaden Statistisches Bundesamt (2014c): Umweltnutzung und Wirtschaft Tabellen zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen, Statistisches Bundesamt, 2014, Wiesbaden Statistisches Bundesamt (2015): Rohstoffe für Deutschland - Bedarfsanalyse für Konsum, Investition und Export auf Makro- und Mesoebene, Abschlussbericht zum Ufoplanvorhaben FKZ , in Vorbereitung Statistisches Bundesamt (2015a): Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatoren zu Umwelt und Ökonomie. Statistisches Bundesamt, 2015, Wiesbaden Umweltbundesamt (2012): Glossar zum Ressourcenschutz. Dessau-Roßlau; sites/default/files/medien/publikation/long/4242.pdf Umweltbundesamt (2015): Daten zur Umwelt 2015 Umwelttrends in Deutschland. Dessau-Roßlau. 144 S. UN (2015): Transforming our World The 2030 Agenda for Sustainable Development, Draft Outcome document of the United Nations Summit for the adoption of the post development agenda (A/69/L.85) un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/69/l.85&lang=e UNEP (2011): Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A. 18
19
20 Diese Broschüre als Download Kurzlink:
Ressourcenverbrauch in. Österreich. Studie zum Ressourceneffizienz Aktionsplan. Eva Milota Direktion Raumwirtschaft. Wien 08.
 Ressourcenverbrauch in Eva Milota Direktion Raumwirtschaft Wien 08. Mai 2012 Österreich Studie zum Ressourceneffizienz Aktionsplan www.statistik.at Wir bewegen Informationen Ressourcenverbrauch Ressourceneffizienz
Ressourcenverbrauch in Eva Milota Direktion Raumwirtschaft Wien 08. Mai 2012 Österreich Studie zum Ressourceneffizienz Aktionsplan www.statistik.at Wir bewegen Informationen Ressourcenverbrauch Ressourceneffizienz
Eine integrierte Politik der Ressourcen- schonung für Umwelt und Wirtschaft
 Eine integrierte Politik der Ressourcen- schonung für Umwelt und Wirtschaft NABU- Veranstaltungsreihe Ressourcenschutz Ressourcenpolitik 2.0 Was bewirken Allianzen aus Unternehmen und NGO? 12. März 2013
Eine integrierte Politik der Ressourcen- schonung für Umwelt und Wirtschaft NABU- Veranstaltungsreihe Ressourcenschutz Ressourcenpolitik 2.0 Was bewirken Allianzen aus Unternehmen und NGO? 12. März 2013
Rohstoffeinsatz und Rohstoffproduktivität in Baden-Württemberg
 Rohstoffeinsatz und Rohstoffproduktivität in Baden-Württemberg Helmut Büringer Dr. rer. pol. Helmut Büringer ist Leiter des Referats Umweltbeobachtung, Ökologie, Umweltökonomische Gesamtrechnungen im Statistischen
Rohstoffeinsatz und Rohstoffproduktivität in Baden-Württemberg Helmut Büringer Dr. rer. pol. Helmut Büringer ist Leiter des Referats Umweltbeobachtung, Ökologie, Umweltökonomische Gesamtrechnungen im Statistischen
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren?
 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum: Kann dies in der Praxis funktionieren? Beitrag zum Symposium Ressourcenschonendes Wirtschaften Technische Universität Wien, 25. März 204 Univ.-Prof. Dr. Michael Getzner
Indikatoren zur Ressourcenschonung: Anforderungen aus Sicht der Umweltverbände. Dr. Benjamin Bongardt 02.03.2015
 Indikatoren zur Ressourcenschonung: Anforderungen aus Sicht der Umweltverbände Dr. Benjamin Bongardt 02.03.2015 ZIEL von Ressourceneffizienz zu Ressourcenschonung 2 Ziel: geringere weltweite Materialentnahme
Indikatoren zur Ressourcenschonung: Anforderungen aus Sicht der Umweltverbände Dr. Benjamin Bongardt 02.03.2015 ZIEL von Ressourceneffizienz zu Ressourcenschonung 2 Ziel: geringere weltweite Materialentnahme
Ressourcennutzung der österreichischen Wirtschaft Herausforderungen für eine Circular Economy
 Ressourcennutzung der österreichischen Wirtschaft Herausforderungen für eine Circular Economy Stefan Giljum 7.6.2017 Inhalt 1. Ressourcennutzung: globale Trends 2. Die Situation der österreichischen Wirtschaft
Ressourcennutzung der österreichischen Wirtschaft Herausforderungen für eine Circular Economy Stefan Giljum 7.6.2017 Inhalt 1. Ressourcennutzung: globale Trends 2. Die Situation der österreichischen Wirtschaft
Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II. Zusammenfassung
 Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II Zusammenfassung Deutschland hat im Februar 2012 mit dem Deutschen Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) als einer der ersten Staaten weltweit Leitideen, Handlungsansätze
Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II Zusammenfassung Deutschland hat im Februar 2012 mit dem Deutschen Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) als einer der ersten Staaten weltweit Leitideen, Handlungsansätze
RESSOURCENNUTZUNG IN ÖSTERREICH
 RESSOURCENWENDE: EIN GEMEINSAMER FAHRPLAN FÜR ÖSTERREICH RESSOURCENNUTZUNG IN ÖSTERREICH 23. FEBRUAR 2016 DR. WOLFRAM TERTSCHNIG --- 1 --- bmlfuw.gv.at POLITISCHES GESTALTUNGSZIEL RESSOURCENEFFIZIENZ 2012:
RESSOURCENWENDE: EIN GEMEINSAMER FAHRPLAN FÜR ÖSTERREICH RESSOURCENNUTZUNG IN ÖSTERREICH 23. FEBRUAR 2016 DR. WOLFRAM TERTSCHNIG --- 1 --- bmlfuw.gv.at POLITISCHES GESTALTUNGSZIEL RESSOURCENEFFIZIENZ 2012:
Projekthintergrund und Motivation
 Für Mensch & Umwelt ROSHSTOFFINDIKATOREN UND RESSOURCENPOLITIK 8.DEZEMBER 2016, BMUB BERLIN UFOPLAN-PROJEKT DETERESS Projekthintergrund und Motivation Dipl.-Wirt.-Chem. Felix Müller Fachgebiet III 2.2
Für Mensch & Umwelt ROSHSTOFFINDIKATOREN UND RESSOURCENPOLITIK 8.DEZEMBER 2016, BMUB BERLIN UFOPLAN-PROJEKT DETERESS Projekthintergrund und Motivation Dipl.-Wirt.-Chem. Felix Müller Fachgebiet III 2.2
Eco-efficiency, resource use and dematerialisation in the European Union
 Workshop: Efficiency, Environment & Employment 2006 Eco-efficiency, resource use and dematerialisation in the European Union Helga Weisz Institute for Social Ecology, Faculty for Interdisciplinary Studies
Workshop: Efficiency, Environment & Employment 2006 Eco-efficiency, resource use and dematerialisation in the European Union Helga Weisz Institute for Social Ecology, Faculty for Interdisciplinary Studies
Indikatoren zu Materialeinsatz und Rohstoffverbrauch
 Stand: September 2016 Feststoffe Indikatoren zu Materialeinsatz und Rohstoffverbrauch Definition der berechneten Größe Indikatoren lassen anhand ihres Verlaufs über einen gewissen Zeitraum Aussagen über
Stand: September 2016 Feststoffe Indikatoren zu Materialeinsatz und Rohstoffverbrauch Definition der berechneten Größe Indikatoren lassen anhand ihres Verlaufs über einen gewissen Zeitraum Aussagen über
Projektbericht. Der Grüne Wohlstandskompass Umsetzung auf Länder- und kommunaler Ebene. Trainee-Programm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2014.
 Projektbericht Der Grüne Wohlstandskompass Umsetzung auf Länder- und kommunaler Ebene Trainee-Programm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2014 Malte Sandner Vorläufige Version Dr. Malte Sandner Ungerstrasse 9 30451
Projektbericht Der Grüne Wohlstandskompass Umsetzung auf Länder- und kommunaler Ebene Trainee-Programm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2014 Malte Sandner Vorläufige Version Dr. Malte Sandner Ungerstrasse 9 30451
Kreislaufwirtschaft Projekte und Ziele der Bundesregierung. Dr. Helge Wendenburg Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
 Kreislaufwirtschaft Projekte und Ziele der Bundesregierung Dr. Helge Wendenburg Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Ressourceneffizienz Progress II am 2.3.2016 vom Kabinett
Kreislaufwirtschaft Projekte und Ziele der Bundesregierung Dr. Helge Wendenburg Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Ressourceneffizienz Progress II am 2.3.2016 vom Kabinett
Effizienz vernetzen - Das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) stellt sich vor
 Effizienz vernetzen - Das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) stellt sich vor Dr. Susanne Schmid Ressourceneffizienz was ist gemeint? Natürliche Ressourcen Wasser Luft Boden Rohstoffe Fläche Strömende
Effizienz vernetzen - Das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern (REZ) stellt sich vor Dr. Susanne Schmid Ressourceneffizienz was ist gemeint? Natürliche Ressourcen Wasser Luft Boden Rohstoffe Fläche Strömende
Wolfgang Eichhammer Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe
 Ehrgeizige Ziele und Vorgaben der EU für 2050 Wolfgang Eichhammer Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe Die Europäische Union verhandelt mit ihren Mitgliedstaaten derzeit
Ehrgeizige Ziele und Vorgaben der EU für 2050 Wolfgang Eichhammer Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe Die Europäische Union verhandelt mit ihren Mitgliedstaaten derzeit
Sind Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit vereinbar? von
 Ringvorlesung zum Thema "Postwachstumsökonomie" an der Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg 28.4. 2010 Sind Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit vereinbar? von Prof. Dr. Bernd Meyer Universität
Ringvorlesung zum Thema "Postwachstumsökonomie" an der Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg 28.4. 2010 Sind Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit vereinbar? von Prof. Dr. Bernd Meyer Universität
Vortrag UBR, 18. Januar Einstieg in die Kreislaufwirtschaft Ökologische Notwendigkeit und ökonomischer Nutzen. Volker Korten
 Vortrag UBR, 18. Januar 2017 Einstieg in die Kreislaufwirtschaft Ökologische Notwendigkeit und ökonomischer Nutzen Volker Korten Drei große Themen haben das Umweltbewusstsein maßgebend geprägt Ausstieg
Vortrag UBR, 18. Januar 2017 Einstieg in die Kreislaufwirtschaft Ökologische Notwendigkeit und ökonomischer Nutzen Volker Korten Drei große Themen haben das Umweltbewusstsein maßgebend geprägt Ausstieg
Was verträgt unsere Erde noch?
 Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Was verträgt unsere Erde noch? Jill Jäger Was bedeutet globaler Wandel? Die tief greifenden Veränderungen der Umwelt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtet wurden: Klimawandel, Wüstenbildung,
Ressourcenproduktivität Indikatoren und Fortschritte
 Ressourcenproduktivität Indikatoren und Fortschritte Hendrik Biebeler / Thorsten Lang / Vera Schlegel, Oktober 2014 Bei der Bewertung des Ressourceneinsatzes in Deutschland spielt die Auswahl von Indikatoren
Ressourcenproduktivität Indikatoren und Fortschritte Hendrik Biebeler / Thorsten Lang / Vera Schlegel, Oktober 2014 Bei der Bewertung des Ressourceneinsatzes in Deutschland spielt die Auswahl von Indikatoren
Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP
 Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP Plausibilitätsprüfung bisheriger Studien durch eine einfache Schätzung Fassung: 17. Februar 2017 Dr. Ricardo Giucci, Woldemar Walter Ergebnisse unserer
Die Wirkung der EU-Russland-Sanktionen auf das EU-BIP Plausibilitätsprüfung bisheriger Studien durch eine einfache Schätzung Fassung: 17. Februar 2017 Dr. Ricardo Giucci, Woldemar Walter Ergebnisse unserer
Analysen zur außenwirtschaftlichen. Mit Input-Output-Tabellen
 Analysen zur außenwirtschaftlichen Verflechtung Mit Input-Output-Tabellen Liane Ritter, Angela Heinze Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Konferenz Außenwirtschaft in Zeiten der Globalisierung Möglichkeiten
Analysen zur außenwirtschaftlichen Verflechtung Mit Input-Output-Tabellen Liane Ritter, Angela Heinze Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Konferenz Außenwirtschaft in Zeiten der Globalisierung Möglichkeiten
Wohlstand & Lebensqualität Zusammenfassung
 Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Einfacher Wirtschaftskreislauf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP als Wohlstandsindikator misst die Wirtschaftsleistung (d. h. die erstellten Güter, abzüglich der Vorleistungen), die eine Volkswirtschaft
Fachgespräch: Das Potential der Förderabgabe für Ressourcenschutz und Länderfinanzen
 Fachgespräch: Das Potential der Förderabgabe für Ressourcenschutz und Länderfinanzen 18. Oktober 2011 Referent: Damian Ludewig Diplom-Volkswirt FÖS-Geschäftsführer Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft
Fachgespräch: Das Potential der Förderabgabe für Ressourcenschutz und Länderfinanzen 18. Oktober 2011 Referent: Damian Ludewig Diplom-Volkswirt FÖS-Geschäftsführer Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft
Wirtschaftspolitik. Wirtschaftswachstum. Quantitatives und qualitatives Wirtschaftswachstum. Einsatz der. Verwirklichung des techn.
 Wirtschaftspolitik Wirtschaftswachstum 1. Grenzen des quantitativen Wachstums 1.1 Quantitatives und qualitatives Wirtschaftswachstum Anhand vieler Punkte lässt sich verdeutlichen, dass die Leistungen der
Wirtschaftspolitik Wirtschaftswachstum 1. Grenzen des quantitativen Wachstums 1.1 Quantitatives und qualitatives Wirtschaftswachstum Anhand vieler Punkte lässt sich verdeutlichen, dass die Leistungen der
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.v.
 Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.v. Mareke Wieben Vorstandsbevollmächtigte Mehr als Effizienz Ein anderer Umgang mit Ressourcen Anstieg der Weltbevölkerung Laut UNO Schätzung
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.v. Mareke Wieben Vorstandsbevollmächtigte Mehr als Effizienz Ein anderer Umgang mit Ressourcen Anstieg der Weltbevölkerung Laut UNO Schätzung
Ressourcen: Wert- oder Werkstoff? Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
 Ressourcen: Wert- oder Werkstoff? Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise Dr. René Scheumann Technische Universität Berlin Department of Environmental Technology Chair of Sustainable Engineering
Ressourcen: Wert- oder Werkstoff? Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise Dr. René Scheumann Technische Universität Berlin Department of Environmental Technology Chair of Sustainable Engineering
Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4)
 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre II Übung Makroökonomie zur Vorlesung Makroökonomische Theorie (Montag 10-12 Uhr und Mittwoch 8-10 Uhr HS Loh 3/4) Übungstermine Montag 12-14 Uhr und 14 16 Uhr HS 4 (M.
Carbon Footprint Tax
 Energiesteuern im Rahmen einer umfassenden Ressourcenbesteuerung Friedrich Hinterberger FÖS/BMZ Konferenz Nachhaltige Ressourcenpolitik Berlin, 6.10.2010 Inhaltsverzeichnis Ressourcen besteuern Carbon
Energiesteuern im Rahmen einer umfassenden Ressourcenbesteuerung Friedrich Hinterberger FÖS/BMZ Konferenz Nachhaltige Ressourcenpolitik Berlin, 6.10.2010 Inhaltsverzeichnis Ressourcen besteuern Carbon
EPD im Zusammenhang mit A/U/F, Ziele, Nutzen und Werte. Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung, Informationen vom Runden Tisch
 Nachhaltiges Bauen Umweltproduktdeklarationen und Nachweise Seite 1 EPD im Zusammenhang mit A/U/F, Ziele, Nutzen und Werte Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung, Informationen vom Runden Tisch
Nachhaltiges Bauen Umweltproduktdeklarationen und Nachweise Seite 1 EPD im Zusammenhang mit A/U/F, Ziele, Nutzen und Werte Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung, Informationen vom Runden Tisch
Ressourceneffizienz warum eigentlich? Und vor allem: Wie messen wir sie?
 Prof. Dr. Mario Schmidt http://umwelt.hs-pforzheim.de Ressourceneffizienz warum eigentlich? Und vor allem: Wie messen wir sie? Warum Ressourceneffizienz? Die Rohstoffvorräte unserer Erde sind begrenzt.
Prof. Dr. Mario Schmidt http://umwelt.hs-pforzheim.de Ressourceneffizienz warum eigentlich? Und vor allem: Wie messen wir sie? Warum Ressourceneffizienz? Die Rohstoffvorräte unserer Erde sind begrenzt.
Möglichkeiten zur Darstellung von Nachhaltigkeit in Modellen
 Möglichkeiten zur Darstellung von Nachhaltigkeit in Modellen 1 Inhaltsverzeichnis 1. Der Begriff der Nachhaltigkeit 2. Das Drei-Säulen Modell 3. Nachhaltigkeitsdreieck 4. Möglichkeiten zur Darstellung
Möglichkeiten zur Darstellung von Nachhaltigkeit in Modellen 1 Inhaltsverzeichnis 1. Der Begriff der Nachhaltigkeit 2. Das Drei-Säulen Modell 3. Nachhaltigkeitsdreieck 4. Möglichkeiten zur Darstellung
Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie
 Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie Tagung zur Dienstleistungsfreiheit in der EU: Deutsche und Ungarische Perspektiven Budapest,
Ökonomische Effekte der Dienstleistungsfreiheit: Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Dienstleistungsrichtlinie Tagung zur Dienstleistungsfreiheit in der EU: Deutsche und Ungarische Perspektiven Budapest,
Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien.
 Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien. Herausgeber/Institute: FÖS Autoren: Swantje Fiedler, Bettina
Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förderungen un gesamtgesellschaftlichen Kosten von Atom, Kohle und erneuerbaren Energien. Herausgeber/Institute: FÖS Autoren: Swantje Fiedler, Bettina
Ein Tourismus-Satellitenkonto für Österreich
 Presseinformation Ein Tourismus-Satellitenkonto für Österreich Methodik, Ergebnisse und Prognosen für die Jahre 2000 bis 2007 Peter Laimer (ST.AT), Egon Smeral (WIFO) Studie von Statistik Austria und Österreichischem
Presseinformation Ein Tourismus-Satellitenkonto für Österreich Methodik, Ergebnisse und Prognosen für die Jahre 2000 bis 2007 Peter Laimer (ST.AT), Egon Smeral (WIFO) Studie von Statistik Austria und Österreichischem
rohstoffeffizienz: wirtschaft entlasten, umwelt schonen
 rohstoffeffizienz: wirtschaft entlasten, umwelt schonen Ergebnisse der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 2010 Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 17. November 2010 in Berlin Statistisches Bundesamt
rohstoffeffizienz: wirtschaft entlasten, umwelt schonen Ergebnisse der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 2010 Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 17. November 2010 in Berlin Statistisches Bundesamt
Sparkasse Saarbrücken. EMAS-Umweltmanagement bei der Sparkasse Saarbrücken
 bei der Agenda Übersicht Unternehmensspezifische Kennzahlen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit Übersicht Zahlen und Fakten: Vorstand Hans-Werner Sander (Vorstandsvorsitzender) Uwe Kuntz (stv. Vorstandsvorsitzender)
bei der Agenda Übersicht Unternehmensspezifische Kennzahlen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit Übersicht Zahlen und Fakten: Vorstand Hans-Werner Sander (Vorstandsvorsitzender) Uwe Kuntz (stv. Vorstandsvorsitzender)
Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels
 Index 16 15 14 Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels Index (1960 = 1), in konstanten Preisen, Entwicklung in Prozent, weltweit 1960 bis 1960 bis : + 1.586,8 % 1960 bis : + 457,2 % 15,6-12,0
Index 16 15 14 Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels Index (1960 = 1), in konstanten Preisen, Entwicklung in Prozent, weltweit 1960 bis 1960 bis : + 1.586,8 % 1960 bis : + 457,2 % 15,6-12,0
Studienvergleich. Titel
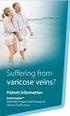 Studienvergleich Titel Evaluierung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (Marktanreizprogramm) für den Zeitraum 2009 bis 2011. Evaluierung des Förderjahres 2009 (Zwischenbericht)
Studienvergleich Titel Evaluierung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (Marktanreizprogramm) für den Zeitraum 2009 bis 2011. Evaluierung des Förderjahres 2009 (Zwischenbericht)
Wachstum ohne zusätzlichen Naturverbrauch?
 21. Ratstreffen des Hamburger Zukunftsrats Evangelische Akademie Hamburg 13.2.2004 Wachstum ohne zusätzlichen Naturverbrauch? Vorläufige Ergebnisse einer Materialflussanalyse für Hamburg, 1992 2001 Dr.
21. Ratstreffen des Hamburger Zukunftsrats Evangelische Akademie Hamburg 13.2.2004 Wachstum ohne zusätzlichen Naturverbrauch? Vorläufige Ergebnisse einer Materialflussanalyse für Hamburg, 1992 2001 Dr.
EE Arbeitsplätze in Deutschland
 Bundesverband Erneuerbare Energien e.v. Forum Erneuerbare Energien auf der Hannover Messe 2014 Hannover 11. April 2014 EE Arbeitsplätze in Deutschland Philip Ulrich Ulrike Lehr Gesellschaft für Wirtschaftliche
Bundesverband Erneuerbare Energien e.v. Forum Erneuerbare Energien auf der Hannover Messe 2014 Hannover 11. April 2014 EE Arbeitsplätze in Deutschland Philip Ulrich Ulrike Lehr Gesellschaft für Wirtschaftliche
ENERGIESTRATEGIE 2020 ZWISCHENSTAND STATISTISCHE WERTE (STAND ENDE 2015)
 1 ENERGIESTRATEGIE 2020 ZWISCHENSTAND STATISTISCHE WERTE (STAND ENDE 2015) 2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Zusammenfassung... 3 1. Zielsetzung der Energiestrategie 2020... 3 2. Methodik der Erfolgskontrolle...
1 ENERGIESTRATEGIE 2020 ZWISCHENSTAND STATISTISCHE WERTE (STAND ENDE 2015) 2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Zusammenfassung... 3 1. Zielsetzung der Energiestrategie 2020... 3 2. Methodik der Erfolgskontrolle...
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom
 Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
Zusammenfassung der Vorlesung 1 vom 19.10.2008 Gegenstand der Makroökonomik ist die Gesamtwirtschaft. Wichtige Indikatoren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind die Entwicklung von Einkommen, Preisen und
Kombination von amtlichen statistischen Daten mit der ECOIN- VENT-Datenbank zur Erzeugung von Sachbilanzen Fallbeispiel Bauprodukte
 Kombination von amtlichen statistischen Daten mit der ECOIN- VENT-Datenbank zur Erzeugung von Sachbilanzen Fallbeispiel Bauprodukte Bodo Müller Eine Sachbilanz ist der Teil einer Ökobilanz, in der die
Kombination von amtlichen statistischen Daten mit der ECOIN- VENT-Datenbank zur Erzeugung von Sachbilanzen Fallbeispiel Bauprodukte Bodo Müller Eine Sachbilanz ist der Teil einer Ökobilanz, in der die
Makroökonomik. Übung 2 - Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. 2.1 Grundlegendes zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
Universität Ulm 89069 Ulm Germany M.Sc. Filiz Bestepe Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2014/2015 Makroökonomik
Gesamtwirtschaftliche Wirkungen des Klimaund Ressourcenschutzes auf nationaler und europäischer Ebene von
 Ressourceneffizienz für die postkarbone Gesellschaft Wettbewerbsvorteile für Deutschland Parlamentarischer Abend der Aaachener Stiftung Kathy Beys, Parlamentarische Gesellschaft, Berlin, 25. 3. 2010 Gesamtwirtschaftliche
Ressourceneffizienz für die postkarbone Gesellschaft Wettbewerbsvorteile für Deutschland Parlamentarischer Abend der Aaachener Stiftung Kathy Beys, Parlamentarische Gesellschaft, Berlin, 25. 3. 2010 Gesamtwirtschaftliche
Rohstoffwende 2049 aus Sicht der mineralischen Bauund Rohstoffindustrie
 Rohstoffwende 2049 aus Sicht der mineralischen Bauund Rohstoffindustrie Öko-Institut, Rohstoffwende 2049, Jahrestagung 2016, 1. Dezember 2016, Berlin Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. Baustoff-,
Rohstoffwende 2049 aus Sicht der mineralischen Bauund Rohstoffindustrie Öko-Institut, Rohstoffwende 2049, Jahrestagung 2016, 1. Dezember 2016, Berlin Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. Baustoff-,
Der Wert strategischer Infrastruktur für den Industriestandort Österreich DI Dieter Drexel. Wien, 30. Mai 2012
 Der Wert strategischer Infrastruktur für den Industriestandort Österreich DI Dieter Drexel Wien, 30. Mai 2012 Outline Qualität der österreichischen Infrastruktur Status Quo Nationale Versorgungssicherheit
Der Wert strategischer Infrastruktur für den Industriestandort Österreich DI Dieter Drexel Wien, 30. Mai 2012 Outline Qualität der österreichischen Infrastruktur Status Quo Nationale Versorgungssicherheit
Fahrplan 2050 Ein Pfad zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bei geringen Treibhausgas-emissionen
 Fahrplan 2050 Ein Pfad zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bei geringen Treibhausgas-emissionen Damyana Stoynova GD Klimapolitik Europäische Kommission Klimawandel begrenzen eine globale Herausforderung
Fahrplan 2050 Ein Pfad zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit bei geringen Treibhausgas-emissionen Damyana Stoynova GD Klimapolitik Europäische Kommission Klimawandel begrenzen eine globale Herausforderung
Studienvergleich. Titel. Zielsetzung und Fragestellung
 Studienvergleich Titel Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland im Jahr 2011 - eine erste Abschätzung - Zielsetzung und Fragestellung Die Studie stellt die wesentlichen Entwicklungen
Studienvergleich Titel Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland im Jahr 2011 - eine erste Abschätzung - Zielsetzung und Fragestellung Die Studie stellt die wesentlichen Entwicklungen
Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050
 50 Jahre ÖGEW Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050 11. November, Naturhistorisches Museum, Wien Dipl.Ing. Karl Rose Geschäftsführer Strategy Lab GmbH, Wien Zukunft der fossilen Energieträger?
50 Jahre ÖGEW Zukunft der fossilen Rohstoffe Ausblick bis 2050 11. November, Naturhistorisches Museum, Wien Dipl.Ing. Karl Rose Geschäftsführer Strategy Lab GmbH, Wien Zukunft der fossilen Energieträger?
Beschäftigung und Wertschöpfung durch die Gesundheitswirtschaft
 Beschäftigung und Wertschöpfung durch die Gesundheitswirtschaft Klaus- Dirk Henke und Sabine Troppens, TU Berlin 3. APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft Demographischer Wandel im Gesundheitswesen
Beschäftigung und Wertschöpfung durch die Gesundheitswirtschaft Klaus- Dirk Henke und Sabine Troppens, TU Berlin 3. APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft Demographischer Wandel im Gesundheitswesen
Beiträge zur Ordnungspolitik aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Energieversorgung in Deutschland
 Beiträge zur Ordnungspolitik aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 45 Hubertus Bardt Energieversorgung in Deutschland Wirtschaftlich, sicher und umweltverträglich Beiträge zur Ordnungspolitik
Beiträge zur Ordnungspolitik aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 45 Hubertus Bardt Energieversorgung in Deutschland Wirtschaftlich, sicher und umweltverträglich Beiträge zur Ordnungspolitik
r³ Strategische Metalle und Mineralien Statusseminar und 5. URBAN MINING Kongress
 r³ Strategische Metalle und Mineralien Statusseminar und 5. URBAN MINING Kongress PD Dr. Lothar Mennicken Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Messe Essen, 11.06.2014 Wirtschaftsstrategische
r³ Strategische Metalle und Mineralien Statusseminar und 5. URBAN MINING Kongress PD Dr. Lothar Mennicken Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Messe Essen, 11.06.2014 Wirtschaftsstrategische
Ressourceneffizienz im Rahmen der G20
 Ressourceneffizienz im Rahmen der G20 Ressourceneffizienz im Rahmen der G20 Birgit Schwenk und Moritz Mues Wirtschaft Strategien 1. Herausforderung Ressourceneffizienz...38 2. Ressourceneffizienz in der
Ressourceneffizienz im Rahmen der G20 Ressourceneffizienz im Rahmen der G20 Birgit Schwenk und Moritz Mues Wirtschaft Strategien 1. Herausforderung Ressourceneffizienz...38 2. Ressourceneffizienz in der
Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz
 Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz Dr. Corinna Fischer Tagung Damit gutes Leben mit der Natur einfacher wird - Suffizienzpolitik für Naturbewahrung und Ressourcenschutz
Möglichkeiten und Grenzen von Suffizienzpolitik mit dem Ziel Ressourcenschutz Dr. Corinna Fischer Tagung Damit gutes Leben mit der Natur einfacher wird - Suffizienzpolitik für Naturbewahrung und Ressourcenschutz
Direkter Materialinput in Rohstoffäquivalenten nach Rohstoffarten
 Direkter Materialinput in Rohstoffäquivalenten nach Rohstoffarten Karl Schoer Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrechnungen 8. Weimarer Kolloquium Ressourceneffizienz im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte
Direkter Materialinput in Rohstoffäquivalenten nach Rohstoffarten Karl Schoer Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrechnungen 8. Weimarer Kolloquium Ressourceneffizienz im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte
Energie- und Ressourceneffizienz im Bausektor
 Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. Energie- und Ressourceneffizienz im Bausektor Dr.-Ing. Berthold Schäfer bbs Dachverband der Baustoff-, Steine-Erden-Industrie Wirtschafts- und industriepolitische
Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. Energie- und Ressourceneffizienz im Bausektor Dr.-Ing. Berthold Schäfer bbs Dachverband der Baustoff-, Steine-Erden-Industrie Wirtschafts- und industriepolitische
Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt
 Dipl.-Ing. Halit Ünver 19. November 2014 Datenbanken / Künstliche Intelligenz, FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt halit.uenver@uni-ulm.de Seite 2 Agenda Einführung
Dipl.-Ing. Halit Ünver 19. November 2014 Datenbanken / Künstliche Intelligenz, FAW/n, Lehrstuhl für Informatik Teil 3: Einfluss von ICT auf die Arbeitswelt halit.uenver@uni-ulm.de Seite 2 Agenda Einführung
SOFT MOBILITY Maßnahmen für eine klimaverträgliche Verkehrspolitik in Europa Michael Cramer, MdEP.
 SOFT MOBILITY Maßnahmen für eine klimaverträgliche Verkehrspolitik in Europa Michael Cramer, MdEP www.michael-cramer.eu Quelle: Eurostat Die Emission von Treibhausgasen aus dem Verkehr in Europa steigt
SOFT MOBILITY Maßnahmen für eine klimaverträgliche Verkehrspolitik in Europa Michael Cramer, MdEP www.michael-cramer.eu Quelle: Eurostat Die Emission von Treibhausgasen aus dem Verkehr in Europa steigt
Der Umgang mit knappen natürlichen Ressourcen auf internationaler Ebene Implikationen für die Schweiz
 Der Umgang mit knappen natürlichen Ressourcen auf internationaler Ebene Implikationen für die Schweiz DIALOG NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SCHWEIZ Die Bedeutung der weltweiten Ressourcenverfügbarkeit für die
Der Umgang mit knappen natürlichen Ressourcen auf internationaler Ebene Implikationen für die Schweiz DIALOG NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SCHWEIZ Die Bedeutung der weltweiten Ressourcenverfügbarkeit für die
Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung
 Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 20. Januar 2016 22.01.2016
Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 20. Januar 2016 22.01.2016
Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft
 Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft Dipl.-Ing. Bernd Hausmann (LFI-RWTH) Inhalt Fakten zum Klimawandel Gründe für den Wandel Prognosen für die Zukunft - Wie ändert sich
Klimawandel Fakten aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft Dipl.-Ing. Bernd Hausmann (LFI-RWTH) Inhalt Fakten zum Klimawandel Gründe für den Wandel Prognosen für die Zukunft - Wie ändert sich
Themenpapier 1: Weltbevölkerung, Wohlstand
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Fachbereich Ökonomie und Soziales Themenpapier 1: Weltbevölkerung, Wohlstand 1 Einleitung Bevölkerung und Wohlstand sind
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Fachbereich Ökonomie und Soziales Themenpapier 1: Weltbevölkerung, Wohlstand 1 Einleitung Bevölkerung und Wohlstand sind
Unterstützung effizienter Ressourcennutzung
 Unterstützung effizienter Ressourcennutzung Dr. Tatjana Kiesow, PT-DLR Lichtenwalde, 19.05.2016 Deutsche Materialeffizienzagentur - demea entstanden im Jahr 2005 auf Initiative des Bundesministeriums für
Unterstützung effizienter Ressourcennutzung Dr. Tatjana Kiesow, PT-DLR Lichtenwalde, 19.05.2016 Deutsche Materialeffizienzagentur - demea entstanden im Jahr 2005 auf Initiative des Bundesministeriums für
Regionale Nutzung erneuerbarer Energien
 Anteil einzelner Energieträger an den erneuerbaren Energien und Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Primärenergie-Versorgung in Prozent, Primärenergie-Versorgung in abs. Zahlen, 2008 0,4 1,7
Anteil einzelner Energieträger an den erneuerbaren Energien und Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Primärenergie-Versorgung in Prozent, Primärenergie-Versorgung in abs. Zahlen, 2008 0,4 1,7
Update Abschnitt MIPS (Material-Input pro Serviceeinheit) aus dem Buch
 Update Abschnitt 9.3.5 MIPS (Material- pro Serviceeinheit) aus dem Buch MIPS (Material- pro Serviceeinheit) Dieses Konzept wurde im WUPPERTAL INSTITUT FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIE von FRIEDRICH SCHMIDT-BLEEK
Update Abschnitt 9.3.5 MIPS (Material- pro Serviceeinheit) aus dem Buch MIPS (Material- pro Serviceeinheit) Dieses Konzept wurde im WUPPERTAL INSTITUT FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIE von FRIEDRICH SCHMIDT-BLEEK
Ansatzpunkte zur Formulierung von Nachhaltigkeitszielen
 Ansatzpunkte zur Formulierung von Nachhaltigkeitszielen Transferworkshop Nachhaltigkeit steuern mit dem Sustainable- Value-Ansatz, 19.9.2008, Berlin Dr. Tobias Hahn, Andrea Liesen IZT Institut für Zukunftsstudien
Ansatzpunkte zur Formulierung von Nachhaltigkeitszielen Transferworkshop Nachhaltigkeit steuern mit dem Sustainable- Value-Ansatz, 19.9.2008, Berlin Dr. Tobias Hahn, Andrea Liesen IZT Institut für Zukunftsstudien
Nachhaltiges Wachstum
 Nachhaltiges Wachstum Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Tagung des MISEREOR-Unternehmerforums 17. April 2015, Bonn 05.05.2015 1 Inhalt 1. Messung von Wachstum 2. Unterschiedliche Positionen
Nachhaltiges Wachstum Prof. Dr. Michael von Hauff TU Kaiserslautern Tagung des MISEREOR-Unternehmerforums 17. April 2015, Bonn 05.05.2015 1 Inhalt 1. Messung von Wachstum 2. Unterschiedliche Positionen
Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Makroökonomik Prof. Dr. Dr. Gerhard Schwödiauer Jochen Güntner Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) Zur Messung der Wirtschaftsleistung eines
Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Makroökonomik Prof. Dr. Dr. Gerhard Schwödiauer Jochen Güntner Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) Zur Messung der Wirtschaftsleistung eines
7. Einheit Nachhaltigkeit
 7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
7. Einheit Nachhaltigkeit Wachstum Wachstum (umgefähre Werte) 7 6 5 4 3 2 1 400 350 300 250 200 150 100 50 Bevölkerung (Mrd.) BIP (Int. $, 100 Mrd.) 0 1750 1800 1850 1900 1950 2000 0 Grenzen des Wachstums
Was legitimiert unsere Organisation als nachhaltig in der Schweiz?
 Was legitimiert unsere Organisation als nachhaltig in der Schweiz? Arbeitspapier für einen internen Sensibilisierungsworkshop Seite 2 von 7 Einleitung Für wen eignet sich dieses Dokument? Für Change Maker
Was legitimiert unsere Organisation als nachhaltig in der Schweiz? Arbeitspapier für einen internen Sensibilisierungsworkshop Seite 2 von 7 Einleitung Für wen eignet sich dieses Dokument? Für Change Maker
Sprechvorlage von Herrn Dr. Dennis A. Ostwald zur Ergebnispräsentation. Die ökonomische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg
 Sprechvorlage von Herrn Dr. Dennis A. Ostwald zur Ergebnispräsentation Die ökonomische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Senatorin Prüfer-Storcks,
Sprechvorlage von Herrn Dr. Dennis A. Ostwald zur Ergebnispräsentation Die ökonomische Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Hamburg Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Senatorin Prüfer-Storcks,
Nachhaltige Innovationen eine thematische Einführung
 Nachhaltige Innovationen eine thematische Einführung Hanka Thomas Dr. Antje Zehm Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. StrategieWerkstatt: Industrie der Zukunft Dresden,
Nachhaltige Innovationen eine thematische Einführung Hanka Thomas Dr. Antje Zehm Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen e. V. StrategieWerkstatt: Industrie der Zukunft Dresden,
Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung
 Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung Prof. Dr. Manfred Stock, Vorsitzender des Beirats für Nachhaltige Entwicklung des Landes Brandenburg Berichterstattung des Beirats
Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung Prof. Dr. Manfred Stock, Vorsitzender des Beirats für Nachhaltige Entwicklung des Landes Brandenburg Berichterstattung des Beirats
Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft
 Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA GMH, 11.8.2014 Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft Widerspruch oder Win-Win?
Eidgenössisches Department für auswärtige Angelegenheiten EDA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA GMH, 11.8.2014 Globale Nachhaltigkeitsziele & die Schweizer Wirtschaft Widerspruch oder Win-Win?
Öffentlicher Schuldenstand*
 Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ausgewählte europäische Staaten, 1997 bis 2011 Prozent 165 Griechenland 160 * Bruttoschuld des Staates (konsolidiert) 150 140 145
Materialeffizienz hilft den Unternehmen
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Metall- und Elektro-Industrie 28.04.2017 Lesezeit 4 Min. Materialeffizienz hilft den Unternehmen Für die exportorientierte Metall- und Elektro-Industrie
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Metall- und Elektro-Industrie 28.04.2017 Lesezeit 4 Min. Materialeffizienz hilft den Unternehmen Für die exportorientierte Metall- und Elektro-Industrie
Indirekte Landnutzungsänderungen eine Definition
 Indirekte Landnutzungsänderungen eine Definition Anbau von Rohstoffen für Biokraftstoffe auf zuvor für Lebens- und Futtermittelproduktion genutzten Flächen. Verknappung des Angebots an Rohstoffen für andere
Indirekte Landnutzungsänderungen eine Definition Anbau von Rohstoffen für Biokraftstoffe auf zuvor für Lebens- und Futtermittelproduktion genutzten Flächen. Verknappung des Angebots an Rohstoffen für andere
Stand der abfallpolitischen Diskussion
 Stand der abfallpolitischen Diskussion Andreas Jaron Themen Umweltpolitische Ziele Stand und Funktionen der Abfall-/Kreislaufwirtschaft Wirkungen und neue Herausforderungen Gesetzesvorhaben Arbeit der
Stand der abfallpolitischen Diskussion Andreas Jaron Themen Umweltpolitische Ziele Stand und Funktionen der Abfall-/Kreislaufwirtschaft Wirkungen und neue Herausforderungen Gesetzesvorhaben Arbeit der
Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz. Kai Kleinwächter, M.A.
 Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz Kai Kleinwächter, M.A. Zentrale Begriffe - Wirtschaftspolitik - Stabilitätsgesetz => stetiges / angemessenes Wirtschaftswachstum => Preisniveaustabilität =>
Wirtschaftswissenschaften 6 Stabilitätsgesetz Kai Kleinwächter, M.A. Zentrale Begriffe - Wirtschaftspolitik - Stabilitätsgesetz => stetiges / angemessenes Wirtschaftswachstum => Preisniveaustabilität =>
(Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich
 (Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich Dienstag, 4. März 2014 Umwelt Management Austria Wohlstand ohne Wachstum?
(Materielles) Wachstum eine Grundbedingung für Wirtschaft und Wohlstand? Mag. Karin Steigenberger, BA Wirtschaftskammer Österreich Dienstag, 4. März 2014 Umwelt Management Austria Wohlstand ohne Wachstum?
ENERGIEPRODUKTIVITÄT - EINFLUSSFAKTOREN
 ENERGIEPRODUKTIVITÄT - EINFLUSSFAKTOREN Helmut Mayer 25. Wissenschaftliches Kolloquium DAS PRODUKTIVITÄTS-PARADOXON 24./25. November 2016 Statistisches Bundesamt G 204 Mayer Umweltproduktivitäten in den
ENERGIEPRODUKTIVITÄT - EINFLUSSFAKTOREN Helmut Mayer 25. Wissenschaftliches Kolloquium DAS PRODUKTIVITÄTS-PARADOXON 24./25. November 2016 Statistisches Bundesamt G 204 Mayer Umweltproduktivitäten in den
Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Ökonomie und Umweltbeobachtung Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft Ökobilanzplattform
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Ökonomie und Umweltbeobachtung Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft Ökobilanzplattform
Innovationen für eine nachhaltige Biomassenutzung in der Oberrheinregion
 Innovationen für eine nachhaltige Biomassenutzung in der Oberrheinregion Prof. Dr. Wolf Fichtner Prof. Dr. Frank Schultmann (DFIU) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Straßburg, 29.11.2013 Oberrheinisches
Innovationen für eine nachhaltige Biomassenutzung in der Oberrheinregion Prof. Dr. Wolf Fichtner Prof. Dr. Frank Schultmann (DFIU) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Straßburg, 29.11.2013 Oberrheinisches
Herausforderungen für die Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum
 Der Rebound Effekt Herausforderungen für die Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum Green Economy Konferenz des BMBF & BMU, 18.11.2014 Tilman Santarius Germanwatch e.v. www.santarius.de
Der Rebound Effekt Herausforderungen für die Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum Green Economy Konferenz des BMBF & BMU, 18.11.2014 Tilman Santarius Germanwatch e.v. www.santarius.de
Im Jahre 2008 verbrauchte jede/r Österreichin/er durchschnittlich pro Tag:
 Verbrauch natürlicher Ressourcen in Österreich Im Jahre 2008 verbrauchte jede/r Österreichin/er durchschnittlich pro Tag: 66 kg Materialien 470 MJ Energie (~ 11 Liter Erdöl) 240 Liter Wasser 9.500 m 2
Verbrauch natürlicher Ressourcen in Österreich Im Jahre 2008 verbrauchte jede/r Österreichin/er durchschnittlich pro Tag: 66 kg Materialien 470 MJ Energie (~ 11 Liter Erdöl) 240 Liter Wasser 9.500 m 2
100% EE-Versorgung Jochen Flasbarth Präsident, Umweltbundesamt Villa Post in Hagen,
 Langfristziele der Energiewende 100% EE-Versorgung 2050 Jochen Flasbarth Präsident, Umweltbundesamt Villa Post in Hagen, 18.07.2013 Organisationsstruktur des UBA Energiewende worum geht es? geringe Kosten
Langfristziele der Energiewende 100% EE-Versorgung 2050 Jochen Flasbarth Präsident, Umweltbundesamt Villa Post in Hagen, 18.07.2013 Organisationsstruktur des UBA Energiewende worum geht es? geringe Kosten
Die 2000-Watt-Gesellschaft
 Die 2000-Watt-Gesellschaft G. Togni 1 Die 2000-Watt-Gesellschaft Giuseppina Togni Dipl. Phys. ETH Präsidentin S.A.F.E. Schw. Agentur für Energieeffizienz Zürich, Schweiz 2 Die 2000-Watt-Gesellschaft G.
Die 2000-Watt-Gesellschaft G. Togni 1 Die 2000-Watt-Gesellschaft Giuseppina Togni Dipl. Phys. ETH Präsidentin S.A.F.E. Schw. Agentur für Energieeffizienz Zürich, Schweiz 2 Die 2000-Watt-Gesellschaft G.
Arbeitskräftemangel
 BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG KONSUMSTRASSE 20. CH-3007 BERN. TEL +41 (0)31 380 60 80. FAX +41 (0)31 398 33 63 INFO@BUEROBASS.CH. WWW.BUEROBASS.CH Arbeitskräftemangel 2010-2030
BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG KONSUMSTRASSE 20. CH-3007 BERN. TEL +41 (0)31 380 60 80. FAX +41 (0)31 398 33 63 INFO@BUEROBASS.CH. WWW.BUEROBASS.CH Arbeitskräftemangel 2010-2030
DAS Produktivitäts-Paradoxon Messung, Analyse, Erklärungsansätze
 Einführung in das Thema DAS Produktivitäts-Paradoxon Messung, Analyse, Erklärungsansätze 25. Wissenschaftliches Kolloquium 24./25. November 2016 in Wiesbaden Das Produktivitäts-Paradoxon: Tatbestand einer
Einführung in das Thema DAS Produktivitäts-Paradoxon Messung, Analyse, Erklärungsansätze 25. Wissenschaftliches Kolloquium 24./25. November 2016 in Wiesbaden Das Produktivitäts-Paradoxon: Tatbestand einer
Sojagranulat wie nachhaltig ist es wirklich?
 Sojagranulat wie nachhaltig ist es wirklich? WARUM IST SOJA EIN NACHHALTIGKEITSTHEMA? Soja leistet als pflanzliche Eiweißquelle in verschiedensten Formen einen wesentlichen Beitrag zur Welternährung. Doch
Sojagranulat wie nachhaltig ist es wirklich? WARUM IST SOJA EIN NACHHALTIGKEITSTHEMA? Soja leistet als pflanzliche Eiweißquelle in verschiedensten Formen einen wesentlichen Beitrag zur Welternährung. Doch
Zurückbesinnen statt weitermachen
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Türkei 24.11.2016 Lesezeit 4 Min. Zurückbesinnen statt weitermachen Immer intensiver diskutiert die Europäische Union, ob sie die Beitrittsverhandlungen
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Türkei 24.11.2016 Lesezeit 4 Min. Zurückbesinnen statt weitermachen Immer intensiver diskutiert die Europäische Union, ob sie die Beitrittsverhandlungen
Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen Statistisches Bundesamt
 Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen 1999-2015 Statistisches Bundesamt Herausgeber (Sachvermögen): Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Internet: www.destatis.de Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen 1999-2015 Statistisches Bundesamt Herausgeber (Sachvermögen): Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Internet: www.destatis.de Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
 Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Dr. Jörg Mayer-Ries Bundesministerium für Umwelt Referat Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Umweltpolitik
Bedeutung und Perspektiven von Indikatoren als Instrument der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Dr. Jörg Mayer-Ries Bundesministerium für Umwelt Referat Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Umweltpolitik
Konjunktur und Wachstum
 Konjunktur und Wachstum Skript zur 6. Sitzung, 12.05.2015 Solow: Growth Accounting Neue Wachstumstheorien I Institutionen und Wachstum S e i t e 1 10 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...3 2. Growth Accounting...3
Konjunktur und Wachstum Skript zur 6. Sitzung, 12.05.2015 Solow: Growth Accounting Neue Wachstumstheorien I Institutionen und Wachstum S e i t e 1 10 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...3 2. Growth Accounting...3
Ressourcencheck für Kliniken Impulse für mehr Effizienz
 Ressourcencheck für Kliniken Impulse für mehr Effizienz BUND-Netzwerktreffen Energie sparendes Krankenhaus 12. September 2012, Berlin Dr.-Ing. Nicole Becker VDI Zentrum für Ressourceneffizienz GmbH BUND-Netzwerktreffen
Ressourcencheck für Kliniken Impulse für mehr Effizienz BUND-Netzwerktreffen Energie sparendes Krankenhaus 12. September 2012, Berlin Dr.-Ing. Nicole Becker VDI Zentrum für Ressourceneffizienz GmbH BUND-Netzwerktreffen
Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen
 Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen 1999-2016 Statistisches Bundesamt Herausgeber (Sachvermögen): Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Internet: www.destatis.de Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Sektorale und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanzen 1999-2016 Statistisches Bundesamt Herausgeber (Sachvermögen): Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Internet: www.destatis.de Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Teil VIII DIE MAKROÖKONOMISCHEN DATEN
 Teil VIII DIE MAKROÖKONOMISCHEN DATEN 1 Die Messung des Volkseinkommens 23 Inhalt Wie unterscheidet sich die Makroökonomie von der Mikroökonomie? Wie wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) definiert und ermittelt?
Teil VIII DIE MAKROÖKONOMISCHEN DATEN 1 Die Messung des Volkseinkommens 23 Inhalt Wie unterscheidet sich die Makroökonomie von der Mikroökonomie? Wie wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) definiert und ermittelt?
Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ministerialdirigent Edgar Freund Erneuerbare Energien in Kasachstan Energiestrategie 2050 15.09.2014 Inhaltsübersicht 1. Politischer Hintergrund
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Landesrat Rudi Anschober 23. September 2016 zum Thema Wie Oberösterreich vom Klimaschutz profitiert - Zwischenbilanz und Ausblick: bisherige Auswirkungen auf
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Landesrat Rudi Anschober 23. September 2016 zum Thema Wie Oberösterreich vom Klimaschutz profitiert - Zwischenbilanz und Ausblick: bisherige Auswirkungen auf
