Abweichende Wortstellung im MF. Wortstellung im Mittelfeld bei Lernern und Muttersprachlern des Deutschen. Falko-Essaykorpus.
|
|
|
- Helga Vogt
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wortstellung im Mittelfeld bei n und n des Deutschen Vorstellung der Magisterarbeit, Emil Kroymann Abweichende Wortstellung im MF Ein Beispiel (1) Wenn man die Jobannoncen den Firmen lesen, wollen sie immer, dass man relevante Erfahrung hat. Auch die Wirtschaftsuniversität sagt seit Anfang, dass es sehr wichtig mit einem Studienjob sei, aber warum hat sie nicht dieses sehr wichtige Punkt in das Studium integriert???? (cbs006_2006_09#155, L1: Dänisch) Problemstellung: Wie häufig tritt diese Abweichung auf? Falko-Essaykorpus Querschnittkorpus mit Vergleichsteil Textsorte: Aufsatz Verschiedene Themen zur Auswahl (Studium, Kriminalität, Entlohnung, Arbeit) Themenstellung in jeweils zwei Sätzen Textproduktion in einer Stunde, ohne Hilfsmittel Falko-Essaykorpus Fortgeschrittene Fremdsprachenlerner des Deutschen C-Test als Maß für Fortgeschrittenheit Verschiedene Muttersprachen Z.B. Englisch, Dänisch, Türkisch, Usbekisch Multilinguale Sprecher Gruppe Textanzahl 186 Typen 9659 Token Gruppe Textanzahl 186 Typen 9659 Token Stellung nominaler Argumente im MF Stellung nominaler Argumente im MF Zwei Generalisierungen von Lenerz 1977 (1) Grammatisch: Dativobjekt vor Akkusativobjekt (2) Semantisch-Pragmatisch: a. Definite NPn vor indefiniten NPn b. Nicht-fokussierte vor fokussierten NPn Mittelfeld: zwischen C 0 und der Basisposition des Verbs (V 0 ) Falls (1) gilt, muss (2) nicht gelten Falls (2) gilt, muss (1) nicht gelten Ich konzentriere mich hier auf definite NPn 1
2 Stellung nominaler Argumente im MF Generalisierungen von Lenerz 1977: Fokus auf dem Akkusativobjekt (1) {Was hat Hans dem Kassierer gegeben?} a. Hans hat dem Kassierer das GELD gegeben b. * Hans hat das GELD dem Kassierer gegeben Fokus auf dem Dativobjekt (1) {Wem hat Hans das Geld gegeben?} a. Hans hat das Geld dem KasSIErer gegeben b. Hans hat dem KasSIErer das Geld gegeben Stellung nominaler Argumente im MF Neuere Theorien zur Stellung nominaler Argumente Regeln für die Grundabfolge der Argumente (vom Verb abhängig) Scrambling erzeugt alternative Abfolgen Scrambling ist durch Fokus restringiert Scrambling (1) [ VP dem Kassierer das Geld geben] (2) [ VP das Geld [ VP dem Kassierer t geben]] (siehe Haider 2005) Wodurch unterscheiden sich die Basisposition und die gescramblete Position eines Objekts? Fokusprojektion Fokusprojektion: Der Akzent auf einem Objekt lizensiert die Fokussierung der VP (1) {Was hat Paul gegessen?} Paul hat den FISCH gegessen. (2) {Was hat Paul gemacht?} Paul hat den FISCH gegessen. (siehe Selkirk 1995) Fokusprojektion ist nur möglich, wenn das Objekt sich in seiner Basisposition befindet. Wortstellung und Fokusprojektion Basisposition eines Objekts lässt sich durch Prozess-bezogene Adverbiale (z.b. sorgfältig, vorsichtig) ermitteln (1) {Und was hat Beate gemacht?} SORGfältig den ArtIKEL gelesen. (2) {Zuerst hat Beate das Buch überflogen, und was hat Beate dann gemacht?} die ZuSAMMENfassung SORGfältig gelesen Wortstellung und Fokusprojektion Prozess-bezogene Adverbiale ermöglichen eine eindeutige Abgrenzung der Basisposition eines Objekts Indefinite NP rechts kann nur existentiell interpretiert werden Indefinite NP links kann nur präsuppositional interpretiert werden (1) Beate hat sorgfältig einen ArTIKel gelesen (2) Beate hat EINen Artikel SORGfältig gelesen (siehe Eckhart 2003) Wortstellung und Fokusprojektion Fokusprojektion unterscheidet zwischen Wortstellungsvarianten, auch wenn kein Adverbial vorhanden ist (1) {Wenn man in die USA einreisen will, } a. muss man VORstrafen ANgeben b. muss man VORstrafen angeben Derselbe Unterschied in der Interpretation der indefiniten NP (siehe Büring 2001b) 2
3 Wortstellung und Fokusprojektion Beispiel relative Abfolge (1) {Warum wurde Veronika festgenommen? Nur, weil sie einen Kaminhaken in ihrem Kofferraum hatte?} a. Nein, weil sie ihrem MAcker den Kaminhaken ÜBERzog b. Nein, weil sie den Kaminhaken ihrem MAcker überzog (2) {Wem hat Hans das Geld gegeben?} a. Er hat das Geld [ VP dem KasSIErer t Akk gegeben] b. Er hat dem KasSIErer das Geld [ VP t Dat t Akk gegeben] (siehe Büring 2001a) Wortstellung und Fokusprojektion Zusammenfassung Falls ein Objekt in seiner Basisposition steht, muss Fokusprojektion möglich sein In diesem Fall steht es rechts Prozessbezogener Adverbiale Scrambling bezieht sich immer auf einzelne Objekte Problem: Fokusprojektion schlecht überprüfbar (abstrakte Eigenschaft) Fokuspartikel (insb. Negation) Das Negationsadverbial nicht und die Fokuspartikel auch, nur und sogar zeigen das gleiche syntaktische Verhalten Bedeutungsbeitrag eines Fokuspartikels stützt sich auf Beziehung zu einem Fokus im Satz Beispiel Sondernegation: (1) Camilla hat nicht Prinz Charles getroffen, sondern die Queen Beispiel Satznegation: (2) Camilla hat Prinz Charles nicht getroffen Syntax der Fokuspartikel Adjunktionsbeschränkung Ein Fokuspartikel adjungiert an eine maximale erweiterte Projektion des Verbs Adjazenzbeschränkung Ein Fokuspartikel muss so nah wie möglich an seinem Fokus stehen (lineare Abfolge der Konstituenten) Präzedenzbeschränkung Ein Fokuspartikel muss seinem Fokus voran gehen (siehe Büring & Hartmann 2001, Jacobs 1982, 1983) Adjunktionsbeschränkung Adjunktion ist nur an maximale erweiterte VPn und APn möglich (1) * Ich habe mit nicht Hans geredet, sondern Paul (2) Ich habe nicht mit Hans geredet, sondern mit Paul Adjunktion nicht an DPn möglich Adjunktionsbeschränkung Adjunktion ist nur an maximale erweiterte VPn und APn möglich (1) weil man den Wagen nicht in die Garage fahren kann, sondern nur schieben. (2) Siglinde wird nicht kommen müssen, sondern nur dürfen (3) * Siglinde wird kommen nicht müssen, sondern nur dürfen 3
4 Adjazenzbeschränkung Negations und Fokus müssen adjazent stehen (1) Gestern hat Rufus nicht dem Mädchen Blumen geschenkt, sondern seiner Frau. (2) * Gestern hat nicht Rufus dem Mädchen Blumen geschenkt, sondern seiner Frau. Ausnahmen: Fokus innerhalb PP Fokuskonstituente extraponiert Präzedenzbeschränkung Der Fokus muss der Negation folgen (1) * da Kim MARgret nicht liebte, sondern Carola Ausnahme: Fokus auf dem finiten Verb in der linkes Satzklammer (2) Sie WOLLte die Bank nicht nur ausrauben, sie hat es auch getan Ausnahme: Topikalisierung der fokussierten Konstituente? Scrambling und Adjazenz Adjazenzbeschränkung löst Scrambling aus (1) * Manche Menschen können nicht ihre Kinder zur Schule schicken. (2) Manche Menschen können ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Scrambling und Adjazenz Interessant: Scrambling unabhängig vom Fokusstatus des Objekts selbst (1) {Was ist passiert?} Wir konnten den HANS nicht FINden. # Wir konnten nicht den HANS FINden. # Wir konnten nicht den HANS finden. (2) {Wo ist Hans?} Wir konnten den Hans nicht FINden. * Wir konnten nicht den Hans FINden. Scrambling und Adjazenz Interessant: Prozess-bezogene Adverbiale im Fokus (3)* Manche Menschen können nicht plötzlich ihre Kinder zur Schule schicken. (4)* Manche Menschen können nicht ihre Kinder plötzlich zur Schule schicken. (5)Manche Menschen können ihre Kinder nicht plötzlich zur Schule schicken Adjazenzbeschränkung bezieht sich auf bereits gescramblete Wortstellung Scrambling und Adjazenz Interessant: Sätze, in denen die rechte Satzklammer nicht gefüllt ist (1) {Was gibt s neues von Karla} a. Wahrscheinlich kauft sie das Haus nicht, sondern mietet es nur. b. * Wahrscheinlich kauft sie nicht das Haus, sondern mietet es nur. Solche Sätze werde ich in der Untersuchung nicht beachten 4
5 Hypothese: keine Unterschiede zwischen L2 und L1 Arbeitshypothesen für diese Untersuchung: Bei n wie bei n des Falko- Essaykorpus treten keine abweichenden Wortstellungen der in (1) angegebenen Form auf (wobei (2) die entsprechende korrekte Struktur ist). (1) * nicht [ VP AkkObj (XP F ) V F ] (2) AkkObj nicht [ VP (XP F ) V F ] Betrachtete Sätze Kriterien für die betrachteten Sätze: Definites Akkusativobjekt und Negationsadverbial im MF Fokus (der Negation) auf dem Verb oder der VP des Satzes Fokus enthält das Akkusativobjekt nicht Eine Teilkonstituente, die der Basisposition des Akkusativobjekts folgt, gehört zum Fokus (der Negation) Problem: Basisposition d. Akkusativobjekts Welche Elemente d. Satzes folgen der Basisposition d. Akkusativobjekts? Test basiert auf Fokusprojektion + existentieller Interpretation eines indefiniten Objekts Präpositionalobjekte (1) {Warum Hans nicht hier?} Weil er ein KIND ins Krankenhaus bringt. Problem: Basisposition d. Akkusativobjekts Welche Elemente d. Satzes folgen der Basisposition d. Akkusativobjekts? Prädikative Komplemente (2){Warum kommt Michael nicht mehr ins Training?} Weil er ein ProBLEM zu ernst nimmt. (3){Warum sitzt Hans auf der Bank?} Weil er einen MITspieler schlecht gemacht hat. Problem: Ermittlung d. Adjunktionsstelle AP-Adjunktion der Negation ist möglich (1) Sie handeln damit, schlagen sich teilweise um die Drogen und verbegen all dies dennoch vor ihren Eltern und der Polizei. Politiker sehen das allerdings nicht so ernst. (dew21_2007_09#330, L1: Deutsch) Hauptverb nicht im Skopus der Negation, Paraphrase Politiker sehen das weniger ernst. Problem: Ermittlung d. Fokus der Negation Einfache Vorgehensweise Erster Schritt: Sätze mit engem Fokus Zweiter Schritt: Betontes nicht Dritter Schritt: Gehört das Akkusativobjekt zum Fokus der Negation? 5
6 Problem: Ermittlung d. Fokus der Negation Sätze mit engem Fokus (1) Man kann nicht den Fach lernen, sondern die andere Sachen, die man WAHRend der Beziehungen mit anderen Menschen braucht, kann man hier lernen. (usb010_2006_10#289, L1: Usbekisch) (2) Das heisst, nach ihrem Studium können diese Studenten ihre Befähigung nur als Angestellte gebrauchen. Sie können ihre Befähigung nicht ausserhalb dem Arbeitsmarkt benutzen (kne03_2006_07#295, L1: Kikuyu) Problem: Ermittlung d. Fokus der Negation Sätze mit betontem nicht (1) Wenn man als Kriminal dumm oder unbegabt oder zu ehrlich ist, dann am Ende zahlt die dementsprechende Kriminalität nicht, aber wenn man diese Eigenschaften nicht besitzt und sich nicht erwischen lässt, dann kann sich Kriminalität dem Menschen schon löhnen. (fu126_2006_10c#137, L1: Englisch) Kontext der Polaritätsfokus verlangt: Es wird zwischen der positiven u. der negierten Aussage ausgewählt Problem: Ermittlung d. Fokus der Negation Gehört das Akkusativobjekt zum Fokus? (1) Der Universitätsabschluss - vollständig wertlos? Man könnte behaupten, dass die meisten Universitätsabschlüsse nicht praxisorientiert sind, und dass sie desswegen nicht die Studenten auf die wirkliche Welt vorbereiten. (hu007_2006_10#126, L1: Norwegisch) Test durch Verschiebeprobe und Intuition Ausschlusskriterien I: Sätze mit mehr als einem Fokuspartikel Nur Sätze die ausschließlich ein Negationsadverbial enthalten dürfen betrachtet werden Das Deutsche kennt einige Fokusadverbiale, z.b. mehr (1) Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man von jeglichen Verbrechen die Finger lassen sollte. Denn was würde passieren, wenn alle Menschen das Gesetz nicht mehr Ernst nehmen (dhw002_2007_06#287, L1: Deutsch) Aber: (2) Die Studenten leben viele Jahren von nur wenig Geld, und wenn sie nach der Studium nicht mehr verdienen würde als z.b. ein Arbeiter ohne Ausbildung [ ] (cbs004_2007_10#140, L1: Dänisch) Ausschlusskriterien I: Sätze mit mehr als einem Fokuspartikel Weitere Adverbiale (siehe König 1991): allein, auch nur, ausgerechnet, ausschließlich, bereits, besonders, bloß, einzig, eben, ebenfalls, erst, gar, genau, geschweige denn, gerade, gleich, gleichfalls, insbesondere, lediglich, (nicht) einmal, noch, nur, schon, selbst, sogar, vor allem, wenigstens, zumal, zumindest. Achtung Fallstricke, z.b. kann allein auch als Prozess-bezogenes Adverbial auftreten Im Falko-Essaykorpus treten in relevanter Position auf: nur, (nicht) mehr, noch Ausschlusskriterien I: Sätze mit mehr als einem Fokuspartikel Vorsicht bei gar, überhaupt und fast Diese Fokusadverbiale können das Negationsadverbial modifizieren Modifikation des negierten Artikels kein (1) In gar/überhaupt/fast keinem Land regnet es so viel wie in Indien Müssen betont werden wenn sie vor der Negation auftreten (2) Hans hat überhaupt nicht geschlafen 6
7 Ausschlusskriterien I: Sätze mit mehr als einem Fokuspartikel Manchmal werden quantifizierende Adverbiale (z.b. immer und manchmal) ebenfalls als Fokusadverbiale angesehen (siehe z.b. Jäger & Wagner 2003). Die folgenden beiden Sätze habe ich deshalb ausgeschlossen. (1) Dies gilt besonders für Kinder und jugendliche. Sie können oft ihre Zukunft ganz verändert sehen als ein Ergebnis ihrer Taten. Sie können manchmal nicht die Folgen ihrer Taten begreifen, [ ] (cbs008_2006_09#229, L1: Dänisch & Norwegisch) (2) In der Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und im Fernsehen wird ständig über Ladendiebstähle, Schmuggeln, Morde und andere strafbare Handlungen mitgeteilt. Selbstverständlich kann die Polizei die Verbrecher nicht immer finden [ ] (fk019_2006_08#197, L1: Russisch & Ukrainisch) Ausschlusskriterien II: Syntaktische Bedingungen Falls ein Akkusativobjekt dem Subjekt vorangeht handelt es sich um ein IP-Adjunkt. (1) {Fliegt Beates Drachen auch?} a. Ich denke, dass Beate den Drachen solide gebaut hat. b. * Ich denke, dass den Drachen Beate solide gebaut hat. Subjekt in SpecIP falls definit und unbetont Also liegt in diesem Fall IP-Adjunktion vor Ausschlusskriterien II: Syntaktische Bedingungen Koordinierte VPn Erwartung: Scrambling unterliegt dem Coordinate Structure Constraint (CSC) (1) * Was i hat Bruno gestern t i geschlachtet und Sandrine heute das Huhn zubereitet. (2) Was i hat Bruno gestern t i geschlachtet und Sandrine heute t i zubereitet. Aber: (3) ich denke eher, es ist ein Fehler der Gesellschaft, dass sie diese Menschen nicht einbringt und sie fördert. Kein Ausschlusskriterium Ausschlusskriterien II: Syntaktische Bedingungen A+I-Konstruktionen (1) {Ist Gerda schon da?} Nein, Ich habe Gerda nicht kommen sehen. Negation in diesem Fall Adjunkt des Obersatzes, d.h. Objekt steht im Obersatz Übliche Analyse von A+I-Konstruktionen ist die Analyse als Raising-to-Objekt: Subjekt d. eingebetteten Satzes wird syntaktisch Bewegt zur Objektsposition d. Obersatzes (siehe Grewendorf 1995, Runner 2005) Ausschlusskriterien III: Nicht-definite NPn Schwache Definite NPn Definite NPn, die durch ein indefinites Attribut erweitert werden, heißen schwach definit. Verhalten sich wie indefinite NPn (1) {Und was hat Beate dann gemacht?} a. sorgfältig das Buch eines LingUISten gelesen b. das Buch EINes Linguisten SORGfältig gelesen (siehe Poesio 1994, Löbner 1985) Ausschlusskriterien III: Nicht-definite NPn Quantifizierte NPn (z.b. alle Studenten) Auch Kombinationen von definitem Artikel und quantifizierendem Adjektiv zählen als quantifizierte NP die meisten Studenten, die gleiche Idee, dasselbe Mädchen Problem: Skopussensitivität (1) Da Paul die meisten Tricks nicht kennt. (2) Da Paul nicht die meisten Tricks kennt. 7
8 Ausschlusskriterien IV: Personal- und Reflexivpronomen Unbetonte Personal- und Reflexivpronomen, nehmen eine feste Position im MF ein Nur Subjekt kann vorangehen Abfolge Nom > Akk > Dat (1) * Hans hat das Fahrrad ihm gekauft. (2) Hans hat ihm das Fahrrad gekauft. (3) Das Fahrrad hat Hans ihm gekauft. (4) Claudia hat es dem Hans geschenkt. (5) * Claudia hat dem Hans es geschenkt. (6) Weil Claudia es dem Hans geschenkt hat, Ausschlusskriterien IV: Personal- und Reflexivpronomen Demonstrativpronomen sind keine Personalpronomen (1) {Warum wurde Veronika festgenommen? Nur weil sie einen Kaminhaken im Kofferaum hatte} a. Nein, weil sie ihrem MACKer den ÜBERzog b. Nein, weil sie ihrem MACKer diesen ÜBERzog Dativobjekt betont, Demonstrativpronomen unbetont, Verb betont Ausschlusskriterium V: Textübernahme Eine Aufgabenstellung lautet wie folgt: Die meisten Studiengänge sind nicht praxisorientiert und bereiten die Studenten nicht auf die wirkliche Welt vor. Sie sind deswegen von geringem Wert. Die Hervorhebung zeigt: ein Teilsatz gehört zur Klasse der untersuchten Sätze Problem: Wortstellung nicht durch die Kompetenz des s realisiert Ausschlusskriterium V: Textübernahme Viele Vorkommen des Verbs vorbereiten mit Ergänzungen die Studenten und auf die wirkliche Welt Kann entschieden werden, ob eine Wortstellung durch Abschreiben entstanden ist oder nicht? Nein Deshalb werden Sätze, die genau dem Wortlaut der Aufgabenstellung entsprechen nicht betrachtet (bis auf Tippfehler) Ergebnis der Untersuchung WS/Gruppe korrekt abweichend Tritt die abweichende Wortstellung bei den n zufällig auf? Hypothesentest Vergleich zweier Stichproben Ziel dieser Arbeit: Vergleich von n und n, d.h. Vergleich zweier Stichproben: Darstellung als Kreuztabelle WS/Gruppe korrekt abweichend Entspricht: Vergleich zweier dichotomer Merkmale p-wert kann mit der Hypergeometrischen Verteilung berechnet werden 8
9 Hypothesentest Hypergeometrische Verteilung Die Formulierung der Nullhypothese Hypergeometrische Verteilung enthält den Parameter θ, genannt Odds-Ratio Odds = Chancenverhältnis Odds = (π / 1- π) θ = (π L / 1- π L ) / (π M / 1- π M ) Nullhypothese muss den Wert von θ festlegen (siehe Agresti 2002) Hypothesentest Vergleich von n und n Nullhypothese: Einseitige Variante: Abweichende Wortstellung tritt bei den n nicht häufiger auf als bei den n H0: θ <= 1 Zweiseitige Variante: Auftretenshäufigkeit der abweichenden Wortstellung unterscheidet sich bei n und bei n H0: θ = 1 Hypothesentest Vergleich von n und n Hypothesentest Vergleich von n und n WS/Gruppe WS/Gruppe korrekt korrekt abweichend 12 0 abweichend 12 0 Ergebnis (Einseitige Nullhypothese): p = 0, Ergebnis (Zweiseitige Nullhypothese): p = 0,01076 Für α = 0,05 ergibt sich Konfidenzintervall (einseitig): 0 <= θ* <= 0,50 Konfidenzintervall (zweiseitig): 0 <= θ* <= 0,65 Interpretation: Das Chancenverhältnis, die korrekte Wortstellung zu realisieren, ist für höchstens halb so gut (einseitige Hypothese), wie für Literatur Literatur Alan Agresti Categorical Data Analysis. Wiley Daniel Büring 2001a. Let s phrase it! Focus, word order and prosodic phrasing in German Double Object Constructions. In: Competition in Syntax. Hrsg. von Gereon Müller & Wolfgang Sternefeld. Mouton de Gruyter Daniel Büring 2001b. What definites do that indefinites definitely don t In: Audiatur Vox Sapentiae A Festschrift for Arnim von Stechow. Hrsg. von. Caroline Féry. & Wolfgang Sternefeld. Studia grammatica 52. Berlin, Akademie Verlag Daniel Büring & Katharina Hartmann The syntax and semantics of focussensitive particles in German. Natural Language & Linguistic Theory 19: Seiten Regine Eckhardt Manner adverbs and information structure: Evidence from the adverbial modification of verbs of creation. In: Modifying Adjuncts. Hrsg. von Ewald Lang, Claudia Maienborn & Cathrine Fabrizius-Hansen. Berlin, Mouton de Gruyter Hubert Haider Mittelfeld Phenomena (Scrambling in Germanic). The Blackwell Companion to Syntax. Hrsg. von Martin Everaert, Henk van Riemsdijk, Rob Goedemans & Bart Hollebrandse. Blackwell Publishing Florian T. Jäger & Michael Wagner Association with focus and linear order in German. Manuskript. Sylviane Granger Learner corpora. In: Corpus Linguistics. An International handbook. Hrsg. von Anke Lüdeling & Merja Kytö. Handbücher zur Sprache und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science. Berlin, Mouton de Gruyter Günter Grewendorff 1995 German. A grammatical sketch. In: Syntax: An international handbook of contemporary research. Hrsg. von Joachim Jacobs, Arnim von Stechow, Wolfgang Sternefeld & Theo Vennemann. S Berlin, de Gruyter Wolfgang Klein & Clive Perdue The Basic Variety. Second Language Research 13.4: Seiten Ekkehard König 1991 The meaning of focus particles. A comparative perspective. London/New York, Routledge Jürgen Lenerz Zur Abfolge nominaler Satzglieder im Deutschen. Tübingen, Narr. Sebastian Löbner 1985 Definites. Journal of Semantics 4: Seiten Anke Lüdeling, Seanna Doolittle, Hagen Hirschmann, Karin Schmidt, Maik Walter Das korpus Falko Zeitschrift DaF Massimo Poesio Weak Definites. Proceedings of the Fourth Conference on Semantics and Linguistic Theory (SALT-4) Jeffrey T. Runner The Accusative Plus Infinitive Construction in English The Blackwell Companion to Syntax. Hrsg. von Martin Everaert, Henk van Riemsdijk, Rob Goedemans & Bart Hollebrandse. Blackwell Publishing 9
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung Syntaktische Funktionen
 Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Stefan Sudhoff Fokuspartikeln innerhalb von DPn im Deutschen
 Stefan Sudhoff Fokuspartikeln innerhalb von DPn im Deutschen Der vorliegende Beitrag 1 beschäftigt sich mit Vorkommen sogenannter Fokuspartikeln (nur, auch, sogar etc.) innerhalb von DPn im Deutschen.
Stefan Sudhoff Fokuspartikeln innerhalb von DPn im Deutschen Der vorliegende Beitrag 1 beschäftigt sich mit Vorkommen sogenannter Fokuspartikeln (nur, auch, sogar etc.) innerhalb von DPn im Deutschen.
A Medial Topic Position for German W. Frey 2004
 A Medial Topic Position for German W. Frey 2004 Ausgewählte Momente der deutschen Syntax 10.01.11 Dr. Fabian Heck Referentin: Nathalie Scherf, MA Linguistik 2 Gliederung 1. Definition des Begriffs Topik
A Medial Topic Position for German W. Frey 2004 Ausgewählte Momente der deutschen Syntax 10.01.11 Dr. Fabian Heck Referentin: Nathalie Scherf, MA Linguistik 2 Gliederung 1. Definition des Begriffs Topik
1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar:
 1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar: 1. Die Überschwemmungen hinterließen ernorme Schäden. 2. Der amtierende Bundeskanzler verzichtet auf eine erneute Kandidatur.
1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar: 1. Die Überschwemmungen hinterließen ernorme Schäden. 2. Der amtierende Bundeskanzler verzichtet auf eine erneute Kandidatur.
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung)
 Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
Syntax - Das Berechnen syntaktischer Strukturen beim menschlichen Sprachverstehen (Fortsetzung) Markus Bader 9. Februar 2004 Inhaltsverzeichnis 4 Übertragung ins e 1 4.3 Bewegung und Satztyp................................
Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder
 Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder Sätze und ihre Bestandteile haben eine hierarchische Struktur. Die Bestandteile eines Satzes (Konstituenten) bestehen aus geordneten Wortfolgen, die ihrerseits wieder
Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder Sätze und ihre Bestandteile haben eine hierarchische Struktur. Die Bestandteile eines Satzes (Konstituenten) bestehen aus geordneten Wortfolgen, die ihrerseits wieder
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Scrambling. 1. Das Problem Satzstruktur nach Adger 2003: (1) daß [ vp die Maria [ v [ VP dem Karl [ V das Buch t i ]][ gibt i v ]]]
![Scrambling. 1. Das Problem Satzstruktur nach Adger 2003: (1) daß [ vp die Maria [ v [ VP dem Karl [ V das Buch t i ]][ gibt i v ]]] Scrambling. 1. Das Problem Satzstruktur nach Adger 2003: (1) daß [ vp die Maria [ v [ VP dem Karl [ V das Buch t i ]][ gibt i v ]]]](/thumbs/54/34732388.jpg) Lennart Bierkandt Universität Leipzig Proseminar Syntax II 28. 6. 2005 Scrambling 1. Das Problem Satzstruktur nach Adger 2003: (1) daß [ vp die Maria [ v [ VP dem Karl [ V das Buch t i ]][ gibt i v ]]]
Lennart Bierkandt Universität Leipzig Proseminar Syntax II 28. 6. 2005 Scrambling 1. Das Problem Satzstruktur nach Adger 2003: (1) daß [ vp die Maria [ v [ VP dem Karl [ V das Buch t i ]][ gibt i v ]]]
ELEMENTE EINES SATZES 1
 Satzbau ELEMENTE EINES SATZES 1 Ein Satz besteht in der Regel mindestens aus einem Subjekt und einem Verb. Es (Subjekt) regnet (Verb). Welches Satzelement hinter dem Verb folgt, hängt vom Verb ab. Es gibt
Satzbau ELEMENTE EINES SATZES 1 Ein Satz besteht in der Regel mindestens aus einem Subjekt und einem Verb. Es (Subjekt) regnet (Verb). Welches Satzelement hinter dem Verb folgt, hängt vom Verb ab. Es gibt
Aus: Hubert Truckenbrodt und Kathrin Eichler: Einführung in die moderne Sprachwissenschaft. Ms., ZAS Berlin und DFKI Saarbrücken, 2010.
 Aus: Hubert Truckenbrodt und Kathrin Eichler: Einführung in die moderne Sprachwissenschaft. Ms., ZAS Berlin und DFKI Saarbrücken, 2010. Syntax 4: Grundlagen der Phrasenstruktur II: Komplexere VPs und NPs,
Aus: Hubert Truckenbrodt und Kathrin Eichler: Einführung in die moderne Sprachwissenschaft. Ms., ZAS Berlin und DFKI Saarbrücken, 2010. Syntax 4: Grundlagen der Phrasenstruktur II: Komplexere VPs und NPs,
Lösungen zu Einheit 7
 Lösungen zu Einheit 7 1. Welcher Wortart ist eine in der NP der eine Ausnahmefall zuzuordnen? Wie erklären Sie diese Zuordnung? Mithilfe der Zuordnung im Wortartenbaum, der flektierten Stellung zwischen
Lösungen zu Einheit 7 1. Welcher Wortart ist eine in der NP der eine Ausnahmefall zuzuordnen? Wie erklären Sie diese Zuordnung? Mithilfe der Zuordnung im Wortartenbaum, der flektierten Stellung zwischen
8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests
 8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests Dr. Antje Kiesel Institut für Angewandte Mathematik WS 2011/2012 Beispiel. Sie wollen den durchschnittlichen Fruchtsaftgehalt eines bestimmten Orangennektars
8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests Dr. Antje Kiesel Institut für Angewandte Mathematik WS 2011/2012 Beispiel. Sie wollen den durchschnittlichen Fruchtsaftgehalt eines bestimmten Orangennektars
SATZGLIEDER UND WORTARTEN
 SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
Grundwissen Grammatik
 Fit für das Bachelorstudium Grundwissen Grammatik Downloads zum Buch Lösungen und Übungsaufgaben Übungsaufgaben zum Kapitel 2 Satzglieder (S. 89-90) Ü-1 Ermitteln und bestimmen Sie die Prädikate und die
Fit für das Bachelorstudium Grundwissen Grammatik Downloads zum Buch Lösungen und Übungsaufgaben Übungsaufgaben zum Kapitel 2 Satzglieder (S. 89-90) Ü-1 Ermitteln und bestimmen Sie die Prädikate und die
LÖSUNG Lapbook Grammatik, Teil 2: Sätze
 LÖSUNG Lapbook Grammatik, Teil 2: Sätze Hinweis: Es bietet sich an, in einer Farbe pro Thema zu arbeiten. D.h. bei den Wortarten wird eine Farbe für die Vorlagen genommen, bei Satzarten / Satzgliedern
LÖSUNG Lapbook Grammatik, Teil 2: Sätze Hinweis: Es bietet sich an, in einer Farbe pro Thema zu arbeiten. D.h. bei den Wortarten wird eine Farbe für die Vorlagen genommen, bei Satzarten / Satzgliedern
5.3 Geltungs- und Fokusbereich der Negation
 Dudengrammatik (2016) / 1 5.3 Geltungs- und Fokusbereich der Negation 1429 Bei der Syntax der Negation sind zwei Erscheinungen auseinanderzuhalten, die oft verwechselt werden: der Geltungsbereich oder
Dudengrammatik (2016) / 1 5.3 Geltungs- und Fokusbereich der Negation 1429 Bei der Syntax der Negation sind zwei Erscheinungen auseinanderzuhalten, die oft verwechselt werden: der Geltungsbereich oder
Grammatik des Standarddeutschen III. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Nach Ablauf der heutigen Sitzung können Sie praktisch alle Satzglieder in einem beliebigen deutschen Satz identifizieren.
 Was Satzgliederbestimmung Ziel Nach Ablauf der heutigen Sitzung können Sie praktisch alle Satzglieder in einem beliebigen deutschen Satz identifizieren. Warum Kenntnis der Satzglieder ist Voraussetzung
Was Satzgliederbestimmung Ziel Nach Ablauf der heutigen Sitzung können Sie praktisch alle Satzglieder in einem beliebigen deutschen Satz identifizieren. Warum Kenntnis der Satzglieder ist Voraussetzung
Phrase vs. Satzglied. 1. Bedeutung der Kapitän hat das Fernrohr:
 Phrase vs. Satzglied Übung 1: Bestimmen Sie die Phrasen bzw. Satzglie für die zwei möglichen Bedeutungen des folgenden Satzes: Der Kapitän beobachtet den Piraten mit dem Fernrohr. 1. Bedeutung Kapitän
Phrase vs. Satzglied Übung 1: Bestimmen Sie die Phrasen bzw. Satzglie für die zwei möglichen Bedeutungen des folgenden Satzes: Der Kapitän beobachtet den Piraten mit dem Fernrohr. 1. Bedeutung Kapitän
UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH
 GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
HS: Korpuslinguistische Behandlung von Phänomenen des Deutschen
 HS: Korpuslinguistische Behandlung von Phänomenen des Deutschen WS 2005/2006 Anke Lüdeling with a lot of help from Stefan Evert & Marco Baroni Kontrastive Analyse (CIA) (quantitativer) Vergleich von zwei
HS: Korpuslinguistische Behandlung von Phänomenen des Deutschen WS 2005/2006 Anke Lüdeling with a lot of help from Stefan Evert & Marco Baroni Kontrastive Analyse (CIA) (quantitativer) Vergleich von zwei
Satzlehre Satzglieder funktional bestimmen Lösung
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Satzlehre Satzglieder funktional bestimmen Lösung 1 Satzlehre Satzglieder funktional bestimmen Lösung 1. Schritt: Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder. Das
Gymbasis Deutsch: Grammatik Satzlehre Satzglieder funktional bestimmen Lösung 1 Satzlehre Satzglieder funktional bestimmen Lösung 1. Schritt: Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder. Das
der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress Inger Petersen, Universität Oldenburg
 Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Aufgabe 3 (Wortmeldung erforderlich) Nennen Sie in hierarchischer Anordnung vom Großen zum Kleinen fünf grammatische Beschreibungsebenen der Sprache.
 Drittes Gruppenspiel am 09.07.2003 Fragen und Antworten Aufgabe 1 (Wortmeldung erforderlich) Welche Kategorisierungen gibt es bei finiten Verbformen? Person, Numerus, Tempus, Modus, Genus Verbi Aufgabe
Drittes Gruppenspiel am 09.07.2003 Fragen und Antworten Aufgabe 1 (Wortmeldung erforderlich) Welche Kategorisierungen gibt es bei finiten Verbformen? Person, Numerus, Tempus, Modus, Genus Verbi Aufgabe
Syntax I. Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger
 Syntax I Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger Repetition Morphologie Calvin: Ich verbe gern Wörter. ( Jet ) Es ist geverbt worden.
Syntax I Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger Repetition Morphologie Calvin: Ich verbe gern Wörter. ( Jet ) Es ist geverbt worden.
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. Satzgliedwert. ohne Satzwert. mit Fügteilcharakter. ohne. Fügteilcharakter
 Wort flektierbar nicht flektierbar mit Satzwert ohne Satzwert mit Satzgliedwert ohne Satzgliedwert mit Fügteilcharakter ohne Fügteilcharakter mit Kasusforderung ohne Kasusforderung Modalwort Adverb Präposition
Wort flektierbar nicht flektierbar mit Satzwert ohne Satzwert mit Satzgliedwert ohne Satzgliedwert mit Fügteilcharakter ohne Fügteilcharakter mit Kasusforderung ohne Kasusforderung Modalwort Adverb Präposition
Statistische Tests. Kapitel Grundbegriffe. Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe
 Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Kapitel 4 Statistische Tests 4.1 Grundbegriffe Wir betrachten wieder ein parametrisches Modell {P θ : θ Θ} und eine zugehörige Zufallsstichprobe X 1,..., X n. Wir wollen nun die Beobachtung der X 1,...,
Historische Syntax des Deutschen II
 Robert Peter Ebert Historische Syntax des Deutschen II 1300-1750 2. überarbeitete Auflage WEIDLER Buchverlag Berlin Inhalt Abkürzungsverzeichnis 9 Einleitung 11 1. Zur Erforschung der deutschen Syntax
Robert Peter Ebert Historische Syntax des Deutschen II 1300-1750 2. überarbeitete Auflage WEIDLER Buchverlag Berlin Inhalt Abkürzungsverzeichnis 9 Einleitung 11 1. Zur Erforschung der deutschen Syntax
DGA 33 Themen der Deutschen Syntax Universität Athen, WiSe Winfried Lechner Skriptum, Teil 3 K-KOMMANDO
 DGA Themen der Deutschen Syntax Universität Athen, WiSe 015-16 Winfried Lechner Skriptum, Teil K-KOMMANDO Dieser Abschnitt führt die syntaktische Beziehung des K-Kommandos ein. Es werden zudem Tests vorgestellt,
DGA Themen der Deutschen Syntax Universität Athen, WiSe 015-16 Winfried Lechner Skriptum, Teil K-KOMMANDO Dieser Abschnitt führt die syntaktische Beziehung des K-Kommandos ein. Es werden zudem Tests vorgestellt,
Präsupposition, Fokus, Topik
 Johannes Dölling WiSe 2012/13 Präsupposition, Fokus, Topik (Modul 04-046-2018 Semantik/Pragmatik: Bedeutung und Diskurs) Seminar Mi 13.15-14.45 Beethovenstr. H1 5.16 Ein Kennzeichen von Kommunikation ist,
Johannes Dölling WiSe 2012/13 Präsupposition, Fokus, Topik (Modul 04-046-2018 Semantik/Pragmatik: Bedeutung und Diskurs) Seminar Mi 13.15-14.45 Beethovenstr. H1 5.16 Ein Kennzeichen von Kommunikation ist,
Fersentalerisch: SVO SOV?
 Linguistica tedesca- LS 44S - A.A. 07/08 - Das Fersentalerische, eine deutsche Sprachinsel in Norditalien 1 Birgit Alber, 7.4. 2008 Fersentalerisch: SVO SOV? SVO - Sprachen: Subjekt Verb Objekt SOV Sprachen:
Linguistica tedesca- LS 44S - A.A. 07/08 - Das Fersentalerische, eine deutsche Sprachinsel in Norditalien 1 Birgit Alber, 7.4. 2008 Fersentalerisch: SVO SOV? SVO - Sprachen: Subjekt Verb Objekt SOV Sprachen:
Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases)
 Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Das Verb bestimmt, in welchem Fall das Substantiv steht. Manche Verben wollen nur den Nominativ, andere wollen zusätzlich den Akkusativ
Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Das Verb bestimmt, in welchem Fall das Substantiv steht. Manche Verben wollen nur den Nominativ, andere wollen zusätzlich den Akkusativ
Wortarten und Satzglieder
 Wortarten und Satzglieder Aufgabe: Lesen Sie den folgenden Text zum Thema Wohnen. (read the text) Lesen Sie anschließend den Text einmal laut vor. (read the text aloud) Übersetzen Sie alle Wörter, die
Wortarten und Satzglieder Aufgabe: Lesen Sie den folgenden Text zum Thema Wohnen. (read the text) Lesen Sie anschließend den Text einmal laut vor. (read the text aloud) Übersetzen Sie alle Wörter, die
Die Begleiter des Nomens / Les déterminants du nom... 11
 / Sommaire Die Begleiter des Nomens / Les déterminants du nom... 11 1 Der unbestimmte Artikel... 12 2 Der bestimmte Artikel... 13 3 Der mit einer Präposition zusammengezogene Artikel... 14 4 Der Gebrauch
/ Sommaire Die Begleiter des Nomens / Les déterminants du nom... 11 1 Der unbestimmte Artikel... 12 2 Der bestimmte Artikel... 13 3 Der mit einer Präposition zusammengezogene Artikel... 14 4 Der Gebrauch
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
9 RadioD. p Texte der Hörszenen: S.137. Gibt es? p Fragesätze ohne Fragewort: A 3, S.164; C 2 2, S.170
 9 RadioD. berblick Information Paula ist in Berlin und vermisst Philipp. Er ist in München und entdeckt in der Zeitung, dass es ein Musical über König Ludwig gibt in Neuschwanstein. Mit anderen Touristen
9 RadioD. berblick Information Paula ist in Berlin und vermisst Philipp. Er ist in München und entdeckt in der Zeitung, dass es ein Musical über König Ludwig gibt in Neuschwanstein. Mit anderen Touristen
13 Übersetzung umgangssprachlicher Sätze in die Sprache AL
 13 Übersetzung umgangssprachlicher Sätze in die Sprache AL Lässt sich die Kenntnis der logischen Eigenschaften der Sätze von AL auch zur Beurteilung umgangssprachlicher Sätze und Argumente nutzen? Grundsätzliches
13 Übersetzung umgangssprachlicher Sätze in die Sprache AL Lässt sich die Kenntnis der logischen Eigenschaften der Sätze von AL auch zur Beurteilung umgangssprachlicher Sätze und Argumente nutzen? Grundsätzliches
Stefan Engelberg (IDS Mannheim), Workshop Corpora in Lexical Research, Bucharest, Nov. 2008 [Folie 1] DWDS-Kernkorpus / DWDS corpus analysis
![Stefan Engelberg (IDS Mannheim), Workshop Corpora in Lexical Research, Bucharest, Nov. 2008 [Folie 1] DWDS-Kernkorpus / DWDS corpus analysis Stefan Engelberg (IDS Mannheim), Workshop Corpora in Lexical Research, Bucharest, Nov. 2008 [Folie 1] DWDS-Kernkorpus / DWDS corpus analysis](/thumbs/25/6525885.jpg) Content 1. Empirical linguistics 2. Text corpora and corpus linguistics 3. Concordances 4. Application I: The German progressive 5. Part-of-speech tagging 6. Fequency analysis 7. Application II: Compounds
Content 1. Empirical linguistics 2. Text corpora and corpus linguistics 3. Concordances 4. Application I: The German progressive 5. Part-of-speech tagging 6. Fequency analysis 7. Application II: Compounds
Einführung in die Sprachwissenschaft -Tutorium-
 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Seminar für Computerlinguistik Wintersemester 2010/2011 Einführung in die Sprachwissenschaft -Tutorium- Dienstag, 16.00 18.00 Uhr Seminarraum 10 Aufgaben Kapitel 1
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Seminar für Computerlinguistik Wintersemester 2010/2011 Einführung in die Sprachwissenschaft -Tutorium- Dienstag, 16.00 18.00 Uhr Seminarraum 10 Aufgaben Kapitel 1
3. Das Prüfen von Hypothesen. Hypothese?! Stichprobe Signifikanztests in der Wirtschaft
 3. Das Prüfen von Hypothesen Hypothese?! Stichprobe 3.1. Signifikanztests in der Wirtschaft Prüfung, ob eine (theoretische) Hypothese über die Verteilung eines Merkmals X und ihre Parameter mit einer (empirischen)
3. Das Prüfen von Hypothesen Hypothese?! Stichprobe 3.1. Signifikanztests in der Wirtschaft Prüfung, ob eine (theoretische) Hypothese über die Verteilung eines Merkmals X und ihre Parameter mit einer (empirischen)
Einführung in die Induktive Statistik: Testen von Hypothesen
 Einführung in die Induktive Statistik: Testen von Hypothesen Jan Gertheiss LMU München Sommersemester 2011 Vielen Dank an Christian Heumann für das Überlassen von TEX-Code! Testen: Einführung und Konzepte
Einführung in die Induktive Statistik: Testen von Hypothesen Jan Gertheiss LMU München Sommersemester 2011 Vielen Dank an Christian Heumann für das Überlassen von TEX-Code! Testen: Einführung und Konzepte
Ergänzende "wenn-sätze" - ein Problemaufriss
 Germanistik Sandra Müller Ergänzende "wenn-sätze" - ein Problemaufriss Studienarbeit Ergänzende "wenn-sätze" - ein Problemaufriss Inhaltsverzeichnis I. Vorbemerkungen S.2 II. Syntaktische Besonderheiten
Germanistik Sandra Müller Ergänzende "wenn-sätze" - ein Problemaufriss Studienarbeit Ergänzende "wenn-sätze" - ein Problemaufriss Inhaltsverzeichnis I. Vorbemerkungen S.2 II. Syntaktische Besonderheiten
Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Zur Basis- und Oberflächenposition des thematischen Objekts in lassen-medialkonstruktionen und lassen-passiven
 Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Zur Basis- und Oberflächenposition des thematischen Objekts in lassen-medialkonstruktionen und lassen-passiven 0. Einleitung Marcel Pitteroff periphrastische Konstruktionen
Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Zur Basis- und Oberflächenposition des thematischen Objekts in lassen-medialkonstruktionen und lassen-passiven 0. Einleitung Marcel Pitteroff periphrastische Konstruktionen
EF Semantik: Musterlösung zu Aufgabenblatt 2
 EF Semantik: Musterlösung zu Aufgabenblatt 2 Magdalena Schwager magdalena@schwager.at Sommersemester 2010, Universität Wien Lösen Sie folgende Aufgaben (1)-(4) und geben Sie sie zusammengetackert bei András,
EF Semantik: Musterlösung zu Aufgabenblatt 2 Magdalena Schwager magdalena@schwager.at Sommersemester 2010, Universität Wien Lösen Sie folgende Aufgaben (1)-(4) und geben Sie sie zusammengetackert bei András,
Grammatische Terminologie
 Grammatische Terminologie Vorschlag der Arbeitsgruppe Schulgrammatische Terminologie im Vergleich mit der von der KMK 1982 verabschiedeten Liste (Satz, Wort) Ausgangspunkt des Vergleichs ist der Neuvorschlag
Grammatische Terminologie Vorschlag der Arbeitsgruppe Schulgrammatische Terminologie im Vergleich mit der von der KMK 1982 verabschiedeten Liste (Satz, Wort) Ausgangspunkt des Vergleichs ist der Neuvorschlag
Pronomen Überblicksübung: Lösung
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten : Bestimmung der Überblick: Lösung 1 Überblicksübung: Lösung Unterstreiche zuerst in folgenden Sätzen alle (inklusive Artikel). Gib dann alle grammatischen Merkmale
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten : Bestimmung der Überblick: Lösung 1 Überblicksübung: Lösung Unterstreiche zuerst in folgenden Sätzen alle (inklusive Artikel). Gib dann alle grammatischen Merkmale
Stichwortverzeichnis. Anhang. Bedingungssatz siehe Konditionalsatz Befehlsform
 Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Syntax Verb-Zweit. Modul 04-006-1003 Syntax und Semantik. Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/ heck. Institut für Linguistik
 Syntax Verb-Zweit Modul 04-006-1003 Syntax und Semantik Institut für Linguistik Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/ heck Modell der topologischen Felder Plan: Im folgenden soll die Verb-Zweit-Eigenschaft
Syntax Verb-Zweit Modul 04-006-1003 Syntax und Semantik Institut für Linguistik Universität Leipzig www.uni-leipzig.de/ heck Modell der topologischen Felder Plan: Im folgenden soll die Verb-Zweit-Eigenschaft
Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1
 Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1 1. Übungen zum Wortschatz 1. Abschreiben: Wörter mit ck und tz 2. Aufschreiben aus dem Gedächtnis: Wörter mit ck und tz 3. Abschreiben: Wörter mit
Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1 1. Übungen zum Wortschatz 1. Abschreiben: Wörter mit ck und tz 2. Aufschreiben aus dem Gedächtnis: Wörter mit ck und tz 3. Abschreiben: Wörter mit
Verb clusters in colloquial German Bader & Schmid (2009)
 Universität Leipzig 18. Juni 2012 Institut für Linguistik Morphologie I: Komplexe Verben Katja Barnickel SS 12 Salzmann/Heck 1. Überblick Verb clusters in colloquial German Bader & Schmid (2009) Teil I
Universität Leipzig 18. Juni 2012 Institut für Linguistik Morphologie I: Komplexe Verben Katja Barnickel SS 12 Salzmann/Heck 1. Überblick Verb clusters in colloquial German Bader & Schmid (2009) Teil I
Syntaktische Typologie
 Morphologie und Syntax (BA) PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 26. Mai 2008 1 / 39 Gliederung 1 Übungsaufgabe
Morphologie und Syntax (BA) PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 26. Mai 2008 1 / 39 Gliederung 1 Übungsaufgabe
Es sollen 2 verschiedene Reparaturmechanismen angewendet werden: *XB soll durch Änderung von X repariert werden
 Modul 046-2012 (Morphologie: Wortbildung) Kolloquium: Opazität 10. Juli 2012 Gereon Müller & Jochen Trommer Die partiell vorangestellte Ordnung in 3-Verbclustern: Eine Instanz von Counter-Bleeding in der
Modul 046-2012 (Morphologie: Wortbildung) Kolloquium: Opazität 10. Juli 2012 Gereon Müller & Jochen Trommer Die partiell vorangestellte Ordnung in 3-Verbclustern: Eine Instanz von Counter-Bleeding in der
11.2. Englisch als wissenschaftsgeschichtliches Muster
 Peter Gallmann, Jena, 2015/16: Leere Kategorien 11.1. Ausgangslage Verbreitete Annahme in der Generativen Grammatik (vor allem bei bestimmten Theorievarianten, etwa bei»government and Binding«, beim»cartographic
Peter Gallmann, Jena, 2015/16: Leere Kategorien 11.1. Ausgangslage Verbreitete Annahme in der Generativen Grammatik (vor allem bei bestimmten Theorievarianten, etwa bei»government and Binding«, beim»cartographic
Grundlagen der Statistik
 Grundlagen der Statistik Übung 15 009 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Übersicht über die mit den Übungsaufgaben geprüften Lehrzielgruppen Lehrzielgruppe
Grundlagen der Statistik Übung 15 009 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Übersicht über die mit den Übungsaufgaben geprüften Lehrzielgruppen Lehrzielgruppe
Inhaltsverzeichnis 2 INHALT. Durchstarten in der deutschen Grammatik... 7
 Inhaltsverzeichnis Durchstarten in der deutschen Grammatik................................... 7 1. KAPITEL: Formveränderung von Wörtern.................................. 8 A Die Aufgabe der Flexion.............................................
Inhaltsverzeichnis Durchstarten in der deutschen Grammatik................................... 7 1. KAPITEL: Formveränderung von Wörtern.................................. 8 A Die Aufgabe der Flexion.............................................
Grammatikbingo Anleitung
 Grammatikbingo Anleitung 1. Die Schüler legen auf einem Blatt oder in ihrem Heft eine Tabelle mit 16 Feldern (4x4) an. Die Tabelle sollte ca. die Hälfte des Blattes einnehmen. 2. Der Lehrer liest die Aufgaben
Grammatikbingo Anleitung 1. Die Schüler legen auf einem Blatt oder in ihrem Heft eine Tabelle mit 16 Feldern (4x4) an. Die Tabelle sollte ca. die Hälfte des Blattes einnehmen. 2. Der Lehrer liest die Aufgaben
Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen
 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel XIII - p-wert und Beziehung zwischen Tests und Konfidenzintervallen Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller
Vorkurs Mediencode 7595-50. Die wichtigsten grammatikalischen Termini
 Vorkurs Mediencode 7595-50 Die wichtigsten grammatikalischen Termini Für die Arbeit mit Ihrem Lateinbuch benötigen Sie eine Reihe von grammatikalischen Fachbegriffen und auch ein Grundverständnis wichtiger
Vorkurs Mediencode 7595-50 Die wichtigsten grammatikalischen Termini Für die Arbeit mit Ihrem Lateinbuch benötigen Sie eine Reihe von grammatikalischen Fachbegriffen und auch ein Grundverständnis wichtiger
Satzlehre Satzglieder formal und funktional bestimmen: Übung 1
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Satzlehre Satzglieder: formal und funktional bestimmen Übung 1 1 Satzlehre Satzglieder formal und funktional bestimmen: Übung 1 Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder
Gymbasis Deutsch: Grammatik Satzlehre Satzglieder: formal und funktional bestimmen Übung 1 1 Satzlehre Satzglieder formal und funktional bestimmen: Übung 1 Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder
Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung
 Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung Bearbeitet von Rainer Jacob 1. Auflage 2016. Buch. 160 S. Softcover ISBN 978 3 8490 1592 3 Format (B x L): 16,1 x 22,8 cm Gewicht:
Abitur-Training - Englisch Grammatikübungen Oberstufe mit Videoanreicherung Bearbeitet von Rainer Jacob 1. Auflage 2016. Buch. 160 S. Softcover ISBN 978 3 8490 1592 3 Format (B x L): 16,1 x 22,8 cm Gewicht:
Fabian Heck Perlmutter & Soames Beethovenstr. 15, Raum Sommmersemester 2007
 Transformationsgrammatik der 60er/70er Fabian Heck Perlmutter & Soames 1979 Institut für Linguistik Dienstag, 11h15-12h45 Universität Leipzig Beethovenstr. 15, Raum 1.516 Sommmersemester 2007 14. Regelordnungen
Transformationsgrammatik der 60er/70er Fabian Heck Perlmutter & Soames 1979 Institut für Linguistik Dienstag, 11h15-12h45 Universität Leipzig Beethovenstr. 15, Raum 1.516 Sommmersemester 2007 14. Regelordnungen
SUB Hamburg. Die Grammatik. Spanisch
 SUB Hamburg Die Grammatik. Spanisch 1. Das Nomen 1.1 Das Geschlecht des Nomens 1.1.1 Die Endung des Nomens und das grammatische Geschlecht 1.2 Die Pluralbildung 1.2.1 Die Pluralbildung der zusammengesetzten
SUB Hamburg Die Grammatik. Spanisch 1. Das Nomen 1.1 Das Geschlecht des Nomens 1.1.1 Die Endung des Nomens und das grammatische Geschlecht 1.2 Die Pluralbildung 1.2.1 Die Pluralbildung der zusammengesetzten
Formale Methoden 1. Gerhard Jäger 12. Dezember Uni Bielefeld, WS 2007/2008 1/22
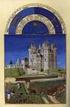 1/22 Formale Methoden 1 Gerhard Jäger Gerhard.Jaeger@uni-bielefeld.de Uni Bielefeld, WS 2007/2008 12. Dezember 2007 2/22 Bäume Baumdiagramme Ein Baumdiagramm eines Satzes stellt drei Arten von Information
1/22 Formale Methoden 1 Gerhard Jäger Gerhard.Jaeger@uni-bielefeld.de Uni Bielefeld, WS 2007/2008 12. Dezember 2007 2/22 Bäume Baumdiagramme Ein Baumdiagramm eines Satzes stellt drei Arten von Information
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010
 DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
Verbinden Sie die Phrasen mit den verschiedenen semantischen Raum -konzepten: Stelle/ Platz/ Ort/ Raum
 Deutsch Da Frühling 2005 Name: Test 2 [108 Punkte] I. Wortschatz Stelle/ Platz/Ort/ Raum 9 Punkte Verbinden Sie die Phrasen mit den verschiedenen semantischen Raum -konzepten: Stelle/ Platz/ Ort/ Raum
Deutsch Da Frühling 2005 Name: Test 2 [108 Punkte] I. Wortschatz Stelle/ Platz/Ort/ Raum 9 Punkte Verbinden Sie die Phrasen mit den verschiedenen semantischen Raum -konzepten: Stelle/ Platz/ Ort/ Raum
Falko. Error annotations in Falko 2.x. Marc Reznicek & Cedric Krummes
 Falko Error annotations in Falko 2.x Marc Reznicek & Cedric Krummes Symposium What s Hard in German? Structural Difficulties, Research Approaches and Pedagogic Solutions Bangor University Monday and Tuesday,
Falko Error annotations in Falko 2.x Marc Reznicek & Cedric Krummes Symposium What s Hard in German? Structural Difficulties, Research Approaches and Pedagogic Solutions Bangor University Monday and Tuesday,
Einführung in die Semantik, 9. Sitzung Prädikate, definite NPs
 Einführung in die Semantik, 9. Sitzung Prädikate, definite NPs, Modifikatoren Göttingen 12. Dezember 2006 Prädikate Adjektive Präpositionalphrasen Attributive Adjektive Attributive Präpositionalphrasen
Einführung in die Semantik, 9. Sitzung Prädikate, definite NPs, Modifikatoren Göttingen 12. Dezember 2006 Prädikate Adjektive Präpositionalphrasen Attributive Adjektive Attributive Präpositionalphrasen
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
Die Partikeln. Adverbien Präpositionen Konjunktionen
 Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT
 ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT Alle aufgeführten Kurse sind 100 % kostenfrei und können unter http://www.unterricht.de abgerufen werden. SATZBAU & WORTSTELLUNG - WORD ORDER Aussagesätze / Affirmative
ÜBERBLICK ÜBER DAS KURS-ANGEBOT Alle aufgeführten Kurse sind 100 % kostenfrei und können unter http://www.unterricht.de abgerufen werden. SATZBAU & WORTSTELLUNG - WORD ORDER Aussagesätze / Affirmative
Zitieren und Paraphrasieren. Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß
 Zitieren und Paraphrasieren Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß 2 Aufgabe: Schreiben Sie einen kurzen Text zum Thema: Warum ist es sinnvoll, die Geschichte von Sprache zu erforschen? Verwenden Sie
Zitieren und Paraphrasieren Recherche- und Schreibseminar Melanie Seiß 2 Aufgabe: Schreiben Sie einen kurzen Text zum Thema: Warum ist es sinnvoll, die Geschichte von Sprache zu erforschen? Verwenden Sie
Subjekt- und Objekt-Sätze
 05-70a Qualifizierungsstufe I / GD 1. Was sind? Akkusativ-Objekt (a) Ich erwarte meinen Freund. Nomen (b) Ich erwarte, dass mein Freund heute kommt. dass-satz (c) Ich erwarte, meinen Freund zu treffen.
05-70a Qualifizierungsstufe I / GD 1. Was sind? Akkusativ-Objekt (a) Ich erwarte meinen Freund. Nomen (b) Ich erwarte, dass mein Freund heute kommt. dass-satz (c) Ich erwarte, meinen Freund zu treffen.
Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen
 @ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
@ 8005-21, Seite 1 Vollständige Liste mit Könnens-Standards zur Erstellung didaktischer Analysen Abschnitt 1 (allgemeine Lernvoraussetzungen) Die Lerner kennen die Eigennamen, können die Personen auf Abbildungen
Algorithmen und Formale Sprachen
 Algorithmen und Formale Sprachen Algorithmen und formale Sprachen Formale Sprachen und Algorithmen Formale Sprachen und formale Algorithmen (formale (Sprachen und Algorithmen)) ((formale Sprachen) und
Algorithmen und Formale Sprachen Algorithmen und formale Sprachen Formale Sprachen und Algorithmen Formale Sprachen und formale Algorithmen (formale (Sprachen und Algorithmen)) ((formale Sprachen) und
(10) x 1[FRAU(x 1) RENNT(x 1)] Keine Frau rennt.
![(10) x 1[FRAU(x 1) RENNT(x 1)] Keine Frau rennt. (10) x 1[FRAU(x 1) RENNT(x 1)] Keine Frau rennt.](/thumbs/50/26484398.jpg) Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin, GK Semantik SS 2009, F.Sode Basierend auf Seminarunterlagen von Prof. Manfred Krifka Quantoren in der Prädikatenlogik (auch
Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin, GK Semantik SS 2009, F.Sode Basierend auf Seminarunterlagen von Prof. Manfred Krifka Quantoren in der Prädikatenlogik (auch
Schließende Statistik: Hypothesentests (Forts.)
 Mathematik II für Biologen 15. Mai 2015 Testablauf (Wdh.) Definition Äquivalente Definition Interpretation verschiedener e Fehler 2. Art und Macht des Tests Allgemein im Beispiel 1 Nullhypothese H 0 k
Mathematik II für Biologen 15. Mai 2015 Testablauf (Wdh.) Definition Äquivalente Definition Interpretation verschiedener e Fehler 2. Art und Macht des Tests Allgemein im Beispiel 1 Nullhypothese H 0 k
2.4 Hypothesentests Grundprinzipien statistischer Hypothesentests. Hypothese:
 2.4.1 Grundprinzipien statistischer Hypothesentests Hypothese: Behauptung einer Tatsache, deren Überprüfung noch aussteht (Leutner in: Endruweit, Trommsdorff: Wörterbuch der Soziologie, 1989). Statistischer
2.4.1 Grundprinzipien statistischer Hypothesentests Hypothese: Behauptung einer Tatsache, deren Überprüfung noch aussteht (Leutner in: Endruweit, Trommsdorff: Wörterbuch der Soziologie, 1989). Statistischer
Syntax 6: Rektion und Bindung Zwischen dem Kopf und seinen Argumenten besteht ein Abhängigkeitsverhältnis:
 Einführung in die Sprachwissenschaft Jan Eden Syntax 6: Rektion und Bindung Zwischen dem Kopf und seinen Argumenten besteht ein Abhängigkeitsverhältnis: (1) a. Er bezichtigt seinen Kompagnon des Mordes.
Einführung in die Sprachwissenschaft Jan Eden Syntax 6: Rektion und Bindung Zwischen dem Kopf und seinen Argumenten besteht ein Abhängigkeitsverhältnis: (1) a. Er bezichtigt seinen Kompagnon des Mordes.
COMPACT TASCHENBUCH GRAMMATIK SPANISCH A2001 8426. Herwig Krenn Wilfried Zeuch Compact Verlag
 COMPACT TASCHENBUCH GRAMMATIK SPANISCH A2001 8426 Herwig Krenn Wilfried Zeuch Compact Verlag Benutzerhinweise 9 Das Nomen/Substantiv 11 Das Geschlecht des Nomens 11 Die Endung des Nomens und das grammatische
COMPACT TASCHENBUCH GRAMMATIK SPANISCH A2001 8426 Herwig Krenn Wilfried Zeuch Compact Verlag Benutzerhinweise 9 Das Nomen/Substantiv 11 Das Geschlecht des Nomens 11 Die Endung des Nomens und das grammatische
Morphologische Grundmerkmale prototypischer Adjektive: 1.) deklinierbar. 2.) freies Genus (Unterschied zu Nomen)
 2.) Adjektive: Morphologische Grundmerkmale prototypischer Adjektive: 1.) deklinierbar 2.) komparierbar 2.) freies Genus (Unterschied zu Nomen) Randtypen I: nur deklinierbare, nicht komparierbare Adjektive
2.) Adjektive: Morphologische Grundmerkmale prototypischer Adjektive: 1.) deklinierbar 2.) komparierbar 2.) freies Genus (Unterschied zu Nomen) Randtypen I: nur deklinierbare, nicht komparierbare Adjektive
Diese Grammatikalitätsverteilung lässt sich durch eine einfache Restriktion erfassen: (4) Eine wh-phrase muss sich am linken Satzrand befinden.
 Proseminar: wh-konstruktionen im Deutschen WS 2003/04 Jan Bruners Handout 2: wh-bewegung im GB-Modell Positionsrestriktionen für wh-phrasen Wir haben in der letzten Sitzung die Positionsrestriktionen für
Proseminar: wh-konstruktionen im Deutschen WS 2003/04 Jan Bruners Handout 2: wh-bewegung im GB-Modell Positionsrestriktionen für wh-phrasen Wir haben in der letzten Sitzung die Positionsrestriktionen für
Kontextfreie Sprachen
 Kontextfreie Sprachen Bei regulären (=Typ 3-) Grammatikregeln stehen maximal ein Terminal- und ein Nichtterminalsymbol auf der rechten Seite. Dadurch läßt sich lediglich die Abfolge der Terminalzeichen
Kontextfreie Sprachen Bei regulären (=Typ 3-) Grammatikregeln stehen maximal ein Terminal- und ein Nichtterminalsymbol auf der rechten Seite. Dadurch läßt sich lediglich die Abfolge der Terminalzeichen
Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
nhalt اكهر س Vorwort 13
 nhalt اكهر س Vorwort 13 ا ف ل/ 1 Das V e r b 1.01 Das Verb und seine Zeiten 16 1.02 Konjugation der schwachen Ver^^ 1.03 Konjugation der starken Verben im Präsens 26 1.04 Gebrauch des Präsens 28 1.05 Das
nhalt اكهر س Vorwort 13 ا ف ل/ 1 Das V e r b 1.01 Das Verb und seine Zeiten 16 1.02 Konjugation der schwachen Ver^^ 1.03 Konjugation der starken Verben im Präsens 26 1.04 Gebrauch des Präsens 28 1.05 Das
Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.)
 Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.) 1. Damit bringt von Aue zum Ausdruck, dass. Das ist falsch! von Aue ist kein Nachname (sondern
Was ich nie wieder in einer Arbeit lesen will! (Ganz gleich, ob in einer Hausarbeit oder kleineren Ausarbeitung.) 1. Damit bringt von Aue zum Ausdruck, dass. Das ist falsch! von Aue ist kein Nachname (sondern
R. Brinkmann Seite
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 24.2.214 Grundlagen zum Hypothesentest Einführung: Wer Entscheidungen zu treffen hat, weiß oft erst im nachhinein ob seine Entscheidung richtig war. Die Unsicherheit
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 24.2.214 Grundlagen zum Hypothesentest Einführung: Wer Entscheidungen zu treffen hat, weiß oft erst im nachhinein ob seine Entscheidung richtig war. Die Unsicherheit
Einführung in die Computerlinguistik
 Einführung in die Computerlinguistik Syntax II WS 2011/2012 Manfred Pinkal Geschachtelte Strukturen in natürlicher Sprache [ der an computerlinguistischen Fragestellungen interessierte Student im ersten
Einführung in die Computerlinguistik Syntax II WS 2011/2012 Manfred Pinkal Geschachtelte Strukturen in natürlicher Sprache [ der an computerlinguistischen Fragestellungen interessierte Student im ersten
Morphologie. 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln
 Morphologie 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln Morphologie Flexion Deklination Flexion der Nomina: Deklination Hund Hund-es Hund-e Hund-en (Stamm + Suffix) Mann Mann-es Männ-er
Morphologie 1. Flexion und Derivation 2. Analyse mittels lexikalischer Regeln Morphologie Flexion Deklination Flexion der Nomina: Deklination Hund Hund-es Hund-e Hund-en (Stamm + Suffix) Mann Mann-es Männ-er
Seminarmaterial zu den Einheiten 2, 4 und 14 Version vom Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten
 Seminarmaterial zu den Einheiten 2, 4 und 14 Version vom 02.03.2015 Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten zusammengestellt von Matthias Granzow-Emden Die Seminarmaterialien werden sukzessive ergänzt.
Seminarmaterial zu den Einheiten 2, 4 und 14 Version vom 02.03.2015 Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten zusammengestellt von Matthias Granzow-Emden Die Seminarmaterialien werden sukzessive ergänzt.
Tests einzelner linearer Hypothesen I
 4 Multiple lineare Regression Tests einzelner linearer Hypothesen 4.5 Tests einzelner linearer Hypothesen I Neben Tests für einzelne Regressionsparameter sind auch Tests (und Konfidenzintervalle) für Linearkombinationen
4 Multiple lineare Regression Tests einzelner linearer Hypothesen 4.5 Tests einzelner linearer Hypothesen I Neben Tests für einzelne Regressionsparameter sind auch Tests (und Konfidenzintervalle) für Linearkombinationen
Syntaktische Bäume. Syntaktische Bäume: Prinzipien. Köpfe in Syntax vs. Morphologie CP! C S VP! V CP PP! P NP. S! NP VP VP! V (NP) PP* NP!
 Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Syntax nfos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Syntaktische Bäume
Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Syntax nfos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Syntaktische Bäume
Kapitel VIII - Tests zum Niveau α
 Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VIII - Tests zum Niveau α Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh Testsituationen
Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) Lehrstuhl für Ökonometrie und Statistik Kapitel VIII - Tests zum Niveau α Induktive Statistik Prof. Dr. W.-D. Heller Hartwig Senska Carlo Siebenschuh Testsituationen
Schuljahr 2015/16. Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer
 Gemeinschaftliche Organisation des Arbeitens und Lernens in einer Schulklasse Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer Begleitung der schulischen Entwicklung und Interesse am Schulleben
Gemeinschaftliche Organisation des Arbeitens und Lernens in einer Schulklasse Kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Lehrer Begleitung der schulischen Entwicklung und Interesse am Schulleben
Ablaufschema beim Testen
 Ablaufschema beim Testen Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Starten Sie die : Flashanimation ' Animation Ablaufschema Testen ' siehe Online-Version
Ablaufschema beim Testen Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 Schritt 9 Starten Sie die : Flashanimation ' Animation Ablaufschema Testen ' siehe Online-Version
Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2001 Seite 1
 Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2001 Seite 1 Aufgabe 1: Von den Patienten einer Klinik geben 70% an, Masern gehabt zu haben, und 60% erinnerten sich an eine Windpockeninfektion. An mindestens einer
Biomathematik für Mediziner, Klausur SS 2001 Seite 1 Aufgabe 1: Von den Patienten einer Klinik geben 70% an, Masern gehabt zu haben, und 60% erinnerten sich an eine Windpockeninfektion. An mindestens einer
Kompositionalität & DSM
 & DSM 7. Dezember 2011 Mitchell & Lapata (2008) I Evaluation verschiedener Kompositionsmodi: additiv gewichtet additiv (Kintsch, 2001) multiplikativ gemischt p = u + v Vektoraddition p = α u + β v Vektoraddition
& DSM 7. Dezember 2011 Mitchell & Lapata (2008) I Evaluation verschiedener Kompositionsmodi: additiv gewichtet additiv (Kintsch, 2001) multiplikativ gemischt p = u + v Vektoraddition p = α u + β v Vektoraddition
