ENGLISCH ALS AMTSSPRACHE?
|
|
|
- Frida Anneliese Lorentz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Das weltweite Netz der deutschen Sprache Nr. 70 (II/ 2016) 1,80 [D] ENGLISCH ALS AMTSSPRACHE? Die Militärverordnung Nr. 3 von 1945 erklärte Englisch zur Amtssprache auch in Deutschland. Zunächst nur für das Militär. 60 Jahre später erweiterte der Ministerpräsident eines großen deutschen Bundeslandes diesen Anspruch auf den Rest. Englisch wird die Arbeitssprache. Das ließ Günther Oettinger im Jahr 2005 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen seine Wähler wissen. Deutsch bleibt die Sprache der Familie und der Freizeit, gestand der Landesvater zu, die Sprache, in der man Privates liest. Weniger weit geht ein prominentes deutsches Mitglied des Europaparlaments: Er sorge sich um die Attraktivität des Standorts für qualifizierte ausländische Arbeitskräfte, so der Vizepräsident dieses Hohen Hauses, der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, deshalb muss Englisch in Deutschland Verwaltungssprache werden, mittelfristig vielleicht sogar Amtssprache. Hier wird den Bürgern die eigene Sprache auch im Amtsverkehr zumindest zugestanden. Aber die Tendenz ist klar: Deutsch als Sprache der Kultur, der Wissenschaft, des geistigen Austauschs allgemein ist in Gefahr, die eigene Sprache wird von vielen ihrer Sprecher als überflüssig oder gar als Hindernis gesehen. Immer mehr deutsche Firmen geben Deutsch als Unternehmenssprache auf, immer mehr Universitäten und noch mehr Fachhochschulen glauben, durch Vermeiden von Deutsch in der Lehre die Qualität des Angebots zu steigern. So kommentiert etwa ein aus deutschen Steuergeldern bezahlter Wirtschaftsprofessor den Widerstand eines Kollegen gegen die Einführung von Englisch als Unterrichtssprache an seiner Fakultät wie folgt: Was soll das, Herr Kollege X? Die deutsche Sprache brauchen wir nicht mehr. Ich bin dafür, alles in englischer Sprache zu machen. Goethe, Schiller und die anderen Schreiberlinge kann man auch auf Englisch lesen Raus aus der Provinz, rein in die globalisierte Welt. Natürlich ist dieser Standpunkt bewusst überspitzt. Aber im Grunde denken immer mehr Angehörige der sich gerne so genannt sehenden deutschen Elite ebenso. Eigentlich sei er ja ein Amerikaner mit deutschem Pass, verkündete stolz ein inzwischen wegen Untreue im Gefängnis einsitzender Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Medienkonzerns. Wie viel Einfluss haben diese Amerikaner mit deutschem Pass? Welchen Schaden bewirken sie in Sprache und Kultur? Neben dem neuen Spitzenthema Genderwahn wenden sich die aktuellen Sprachnachrichten deshalb auch der flächendeckenden Verdrängung des Deutschen durch das Englische in Deutschland selber zu. ENGLISCH ALS VERSTÄNDNISBREMSE. Oliver Baer zeigt auf, warum eine Verkehrssprache Englisch mehr schadet als nutzt. 4 EIN LEBEN FÜR DAS BUCH. Die Paul-Raabe-Vorlesung in Weimar ehrt den kürzlich verstorbenen großen Kulturwissenschaftler und Weltbibliothekar (FAZ).. 8 GRENZEN DER GENDERISIERUNG. Peter Eisenberg weist nach, dass bei gewissen Substantiven die männliche Form nicht zu vermeiden ist. 10 SCHIFFFAHRT UND KEIN ENDE. Das Elend mit der Rechtschreibreform. 27 Dörte Hansen: Ihr Erfolgsroman Altes Land ist Gegenstand unserer Rubrik Schönes Deutsch Seite 16/17 Jil Sander: Vor 20 Jahren gab die Hamburger Damenschneiderin jenes legendäre FAZ-Interview, das als Geburtshelfer des VDS gesehen werden kann. Seite 18
2 AKTUELL Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 2 Zu Katharina Thalbach und Gregor Gysi nach Kassel Katharina Thalbach bekommt den Jacob- Grimm-Preis Deutsche Sprache 2016 des VDS und der Eberhard-Schöck-Stiftung. Am 8. Oktober erhält die Theaterregisseurin und Schauspielerin Katharina Thalbach in Kassel den mit Euro dotierten Jacob- Grimm-Preis Deutsche Sprache. Frau Thalbach mache durch ihr Wirken auf der Bühne deutlich, dass die Kraft der Sprache Gefühle und Stimmungen erzeugen kann, begründete der Sprachwissenschaftler und Jurysprecher Helmut Glück die Entscheidung. Ein Beleg für diese Wirkung von Sprache sind auch die zahlreichen und überaus erfolgreichen Hörspiele, in denen sie als Sprecherin die unterschiedlichsten Charaktere darstellt. Weiterer Ausdruck dieses Bewusstseins seien auch ihre Interpretationen der klassischen Literatur, aber auch ihr Engagement beim Festspiel der deutschen Sprache. Zu den bisherigen Jacob-Grimm-Preisträgern gehören u. a. Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Nora Gomringer, Frank Schirrmacher, Günter de Bruyn, Loriot, Ulrich Tukur, Dieter Nuhr und Prinz Asfa-Wossen Asserate. Die Laudatio auf Katharina Thalbach hält Gregor Gysi. Auch er hat bedeutende Vorgänger als Lobredner, etwa Bundestagspräsident Norbert Lammert, Robert Gernhardt oder Petra Roth. Der Jacob-Grimm-Preis ist Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache. Den mit Euro dotierten Initiativpreis Deutsche Sprache bekommt dieses Jahr das Internationale Mundartarchiv Ludwig Soumagne in Dormagen in Würdigung seines Einsatzes für die deutschen Dialekte. Der undotierte Institutionenpreis Deutsche Sprache geht an das Projekt DeutschSommer der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt und dessen Einsatz, die Sprachkompetenz von Kindern mit Migrationshintergrund während der Sommerferien zu verbessern. SN Postbank bleibt bei Deutsch Ein beachtliches Netzgewitter hat dieser Tage die Postbank auf sich gezogen. Ein englischer Kunde, der zwei Wochen auf seine Bankkarte gewartet hatte, schrieb die Postbank bei Twitter auf Englisch an. Doch anstatt auf seine Beschwerde einzugehen, antwortete das Unternehmen mit der Bitte, das Anliegen bitte sehr auf Deutsch zu formulieren. Dieser vom Kunden in die Öffentlichkeit getragene Disput zog zahlreiche Kommentare nach sich. Neben der politisch korrekten Variante, die Postbank habe sich der Anglisierung anzupassen, auch ihre Netzseite sei schließlich auf Englisch abrufbar und das tägliche Bankgeschäft sei längst von englischen Begriffen geprägt, waren darunter auch Beiträge der Art: Wie würde es einem deutschen Kunden einer englischen Bank ergehen, der das Gleiche spiegelbildlich will? Letztendlich blieb die Postbank bei ihrem Standpunkt, da sie ausschließlich innerhalb Deutschlands tätig sei. Zudem sei man aus juristischen Gründen verpflichtet, Anfragen in der Unternehmenssprache Deutsch zu beantworten. SN DER VORSITZENDE MEINT Liebe Sprachfreunde, Fuzzy is dead. Mit diesem Anzeigentext betrauerte kürzlich ein liebender Mitbürger in meiner lokalen Tageszeitung seinen gerade verstorbenen Hund. Nun, vielleicht kam Fuzzy aus England und wollte in seiner Muttersprache begraben werden. Das glaube ich aber eher nicht. Kolonialstaaten pflegen im Lauf der Zeit die Sprache ihres Mutterlandes anzunehmen. Die deutsche Sprache leidet unter einer extremem Illoyalität vieler ihrer Sprecher. Das hat einer der Helden meiner Jugend, die große Mainzer Fastnachts-ikone Herbert Bonewitz, einmal gesagt. Die halbe Republik saß damals vor den frisch gekauften ersten Fernsehern (oder dem des Nachbarn) und begeisterte sich an Mainz wie es singt und lacht. Und dann zog ich im Alter von elf mit meinen Eltern und Brüdern selbst nach Mainz und fing beim Rosenmontagszug die von Herbert Bonewitz hoch vom Wagen der Gonsbachlerchen herabgeworfenen Kamellen auf. Heute sammle ich eher seine Einsichten als Kabarettist und Journalist. Die sind nicht immer lustig. Speziell die zu Kolonien und deren Sprachgebaren erklärt wohl besser Fuzzys Abschiedstext. Denn weit stärker als alle anderen mir bekannten europäischen Sprachen leidet die deutsche unter einer extremen Illoyalität vieler ihrer Sprecher, unter einem republikweiten Bestreben, sich in der Lebensführung, in der Wahl der Vorbilder und in der Wahl der Sprache (und sei es auch nur die Anzeige für den verstorbenen Hund) dem angelsächsischen Kulturkreis anzupassen. Dazu scheint auch keine Militärverordnung Nr. 3 mehr nötig, die Menschen machen es von selbst. Nicht ohne Grund spricht die Londoner Times in einem viel beachteten Artikel des Jahres 1960 von der typisch deutschen linguistic submissiveness. Der ideologisch gewiss unverdächtige ehemalige Feuilletonchef der Hamburger Zeit, Dieter E. Zimmer, hat diesen Mangel an kulturellem Selbstbehauptungswillen einmal in einem Internationalen Servilitätsindex festzuhalten gesucht. Dazu hat er die 100 häufigsten englischen EDV-Begriffe daraufhin abgeklopft, wie viele davon in verschiedenen europäischen Ländern in die jeweilige Landessprache übertragen worden sind. Es siegte Finnland vor Frankreich, hier liegen 86 % bzw. 84 % des EDV-Jargons in Finnisch bzw. in Französisch vor. Mit großem Abstand am servilsten unter allen betrachteten Nationen war Deutschland, hier traut man sich bei weniger als Foto: Jürgen Huhn der Hälfte aller Ausdrücke, eine deutsche Entsprechung vorzuschlagen. Logiciel für software, materiel für hardware, das sind Geistesblitze, wie sie einer großen Kulturnation wie Frankreich anstehen. Warum blitzt es nicht auch bei uns? Ihr nachdenklicher 1. Vorsitzender
3 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 3 IM GESPRÄCH Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Glück Sprache will auch mal gelobt werden SN: Herr Glück, Sie sind seit Anbeginn Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache. Was waren denn in dieser Zeit Ihre erfreulichsten und Ihre unerfreulichsten Erlebnisse? Glück: Es gab viele erfreuliche, aber auch einige unerfreuliche Erlebnisse. Den Unerfreulichkeits-Rekord hält der seinerzeitige Innenminister Otto Schily. Er hatte zugesagt, die Laudatio auf den damaligen Hauptpreisträger Paul Kirchhof zu halten, der als ehemaliger Verfassungsrichter für seine vorbildliche Behandlung des Deutschen im Rechtswesen geehrt wurde. Zur Bundestagswahl 2005 wurde er nun von Frau Merkel als Finanzminister vorgesehen, woraufhin uns der SPD-Mann Schily wenige Wochen vor der Preisverleihung wissen ließ, er halte die Laudatio nicht. Das war die Schröder-Geschichte mit dem Professor aus Heidelberg. Und wir saßen in der Bredouille und hatten keinen Laudator. Zugleich war das aber auch ein sehr erfreuliches Erlebnis, weil nämlich Ottos Bruder Konrad, der damals für die FDP im Bundestag saß, sofort bereit war, seinen Bruder zu vertreten. Die Kulturpreis-Abende in Kassel sind immer Sternstunden. Am bewegendsten für mich war die Preisverleihung im Herbst 2004, als mein Lieblingsdichter Robert Gernhardt die Laudatio auf den großen Loriot hielt die beiden trafen sich damals zum ersten Mal persönlich und wurden sofort Freunde. SN: Der Kulturpreis ist ja dreigeteilt, am meisten Aufsehen erregt wohl immer der mit Euro KULTURPREIS DEUTSCHE SPRACHE dotierte Jacob-Grimm-Preis. Die bisherigen Preisträger kamen aus so unterschiedlichen Lagern wie die Schriftsteller bzw. Schriftstellerinnen Rolf Hochhuth, Cornelia Funke, Peter Härtling oder Günther der Bruyn, die Präsidentengattin Ludmila Putina, Unterhaltungskünstler wie Loriot und Dieter Nuhr, oder auch Vertreter des Poetry Slam (Nora Gomringer), des Journalismus und der Wissenschaften. Glauben Sie, dass dergleichen Preise etwas bewirken können und wenn ja, was? Die Flüchtlingskrise hat sehr klar gezeigt, dass Deutsch als Fremd- und Zweitsprache völlig unterbelichtet ist. Glück: Dergleichen Preise können durchaus etwas bewirken und zwar alleine dadurch, dass sie loben. Sie zeichnen aus, sie stellen fest, dass es Verdienste gibt. Für wen? Für die deutsche Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist eine gemeinsame Initiative der Eberhard-Schöck-Stiftung (Baden-Baden) und des Vereins Deutsche Sprache (Dortmund). Er ist dreigeteilt und wird seit dem Jahr 2001 jedes Jahr im Oktober in Kassel vergeben, der Stadt, in der die Brüder Grimm ihre Arbeiten zur deutschen Grammatik und zum deutschen Wörterbuch begannen. Er soll dem Erhalt und der kreativen Entwicklung der deutschen Sprache dienen und steht in der Tradition der deutschen Aufklärung und der Brüder Grimm, deren Sprachkritik und Sprachforschung das Deutsche allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen wollte. Die Jury besteht neben ihrem Sprecher Prof. Dr. Helmut Glück (Bamberg) aus Dr. Holger Klatte (VDS-Geschäftsführung, Dortmund), Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg), Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund), Dr. Anke Sauter (Frankfurt/M.), Dipl.-Ing. Eberhard Schöck (Baden-Baden) und Prof. Dr. Waltraud Wende (Berlin). Sprache, für gutes, vorbildliches, musterhaftes Deutsch. Wir haben hier viel zu viel Gemecker und Geschimpfe. Dass wir ein paar sprachbezogene Preise haben, ist sehr positiv. Die Literatur hat hunderte von Preisen, die deutsche Sprache nicht sehr viele. Dass man eben nicht nur schimpft auf die Entwicklung, sondern auch sagen kann, das und das sind erfreuliche Erscheinungen, ist ein Pfund, mit dem wir wuchern sollten. Alle unsere bisherigen Preisträger haben Mustergültiges geleistet, so verschieden ihre Wirkungskreise auch waren. SN: Herr Glück, Sie waren bis zu Ihrer Emeritierung Professor für Sprachwissenschaft an der Universität Bamberg. Ist die Germanistenausbildung noch auf der Höhe der Zeit und wo sehen Sie mögliche Defizite? Glück: Die Frage muss man insofern differenziert beantworten, als es die Germanistenausbildung nicht gibt. Ich kann jetzt nicht im Detail darlegen, wo die Unterschiede zwischen den Bundesländern liegen und weshalb mir die bayerische Germanistenausbildung vergleichsweise gut gefällt. Die Flüchtlingskrise der letzten Monate hat sehr klar gezeigt, dass Deutsch als Fremd- und Zweitsprache völlig unterbelichtet ist und in der Deutschlehrerausbildung ins Zentrum geraten muss. Wir werden so oder so mit den Migrantenkindern Probleme kriegen (nein: die haben Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Glück, *1949, ist einer der angesehensten deutschen Germanisten und Herausgeber des Metzler Lexikons Sprache, das im Herbst 2016 in fünfter Auflage erscheinen wird. Rund 700 Artikel darin hat er selbst verfasst. Weiterhin gibt er die Reihe Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart (FGG) heraus. Seit 1991 war Helmut Glück Professor für Deutsche Sprachwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Bamberg und seit dem Jahr 2000 ist er Vorsitzender der Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache. Für dieses Gespräch traf er sich mit der VDS-Mitarbeiterin Steffi Wichert am Rande einer Jury-Sitzung in Kassel am 29. April. wir schon), aber diese Probleme kann man mildern, wenn man jetzt sofort dafür sorgt, dass jeder künftige Deutschlehrer in diesem Bereich Qualifikationen erwirbt, und zwar sprachliche Qualifikationen, nicht nur sozialpädagogische. Wo man die Professoren hernehmen soll, die diese Ausbildung anbieten können, ist eine andere Frage. SN: Anders als viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen äußern Sie sich auch öffentlich und dezidiert zu Fragen der Sprachpolitik, etwa dem Verdrängen des Deutschen durch das Englische an deutschen Universitäten. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Glück: Wir werden sie nicht aufhalten können. Wir können allerdings dafür sorgen, dass in deutscher Sprache Forschungsergebnisse erarbeitet und publiziert werden, die von so hoher Qualität sind, dass sie auch anderswo wahrgenommen werden müssen. In manchen Fächern ist das schließlich noch so, z. B. in der Germanistik, einem Fach, in dem deutschsprachige Forschung immer noch führend ist. Dann muss dafür gesorgt werden, dass die Fachterminologien auf Deutsch verfügbar bleiben, wie das in meinem Fach u. a. durch das Metzler Lexikon Sprache geschieht. Schließlich sollte ein europäischer Zitierindex eingerichtet werden, der die Sprachen Europas halbwegs gleichberechtigt behandelt und nicht nur das Englische berücksichtigt SN: Herr Glück, wir danken Ihnen für das Gespräch.
4 SPRACHE UND POLITIK Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 4 Sprache sollte auch etwas nützen Englisch für alle ist eine Sackgasse // Von Oliver Baer Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei, so Kurt Tucholskys trockenes Urteil über großstädtisches Geschwätz. Aber seien wir gerecht: Schon in der Muttersprache gelingt gute Verständigung nur mühsam. Derweil verbreitet Facebook die Illusion, ein Smiley hätte einen kommunikativen Nutzwert. In solchem Gelärme kann man zum Trend erklären, was auch ohne Alkohol im Kopf Geschwätz bleibt: Englisch als Amtssprache. Foto: Bexx Brown-Spinelli - flickr.com Wer wäre mal so nett, den Trend zum Englischen zu bitten, dass er einen Augenblick innehält! Der Trend möge kurz Atem holen, damit wir uns auf Wolf Schneiders Definition besinnen: Information heißt nicht: Ich will etwas mitteilen, nicht einmal: Ich will mich bemühen, etwas verständlich mitzuteilen, sondern: Ich bin verstanden worden. Recht hat Schneider, denn was nützt es, wenn einer sein Maul aufmacht, aber nicht einmal einen Widerspruch provoziert: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich sehe das anders! Nötig wäre, dass das Gesprochene und Geschriebene einen Sinn ergibt, den es zu verstehen lohnt und, dass da eine Bereitschaft zum Zuhören besteht. Und diesen Mangel an Verständigung nun auf Englisch zelebrieren? Nehmen wir spaßeshalber die wichtigste Voraussetzung als gegeben an: Dass alle Betroffenen ausgezeichnetes Englisch beherrschten. Das müssen wir annehmen, denn eine Art Kiezenglisch reicht vielleicht zum Rappen, aber nicht zum Regieren, Verwalten, Organisieren und Erledigen. Nehmen wir es an, trotzdem würde Englisch als zweite Amtssprache mehr schaden als nützen. Den Grund versteht, wer schon im Wörterbuch die peinliche Entdeckung macht, dass er sich nicht entscheiden kann, welche Übersetzung in seinem Falle zutrifft. Selbst die pfiffigste Software wird an den Feinheiten scheitern. Es ist nun mal so: Oft besitzen anscheinend identische Begriffe im Deutschen und Englischen stark abweichende Bedeutungen. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit bilden das europäische Koordinatensystem, dennoch ist nicht gesichert, dass jeder dieser Begriffe in den Landessprachen der EU genauso interpretiert wird wie im Deutschen. Wir haben zwar einen gemeinsamen Kern übereinstimmender Bedeutungen, aber oftmals sind gerade die Nebenbedeutungen in Nuancen anders, und das EU-Kommission bricht Sprachenrecht kann in der Verständigung zu Problemen führen, so Rosemarie Lühr, Professorin für Indogermanistik in Jena. Rückgrat der Verständigung ist die Landessprache Bleiben wir bei Deutsch und Englisch. Nicht nur die Rechtsordnungen unterscheiden sich fundamental. Schon bevor die Sache dem Richter vorliegt, verstehen ein Brite und ein Deutscher nicht dasselbe unter anscheinend identischen Begriffen. Etwa beim Begriff der Gerechtigkeit. Im Englischen stehe mit justice vor allem die Gerechtigkeit im justiziellen Sinne vertreten durch den Staat und seine Institutionen im Fokus, erklärt Rosemarie Lühr. Doch wenn wir Deutschen von Gerechtigkeit sprechen, meinen wir eher Aspekte, die sich mit fairness oder equality übersetzen lassen. Liebe Leser, diesen himmelweiten Unterschied mit einem Achselzucken abzutun, wäre kein Leichtsinn, das wäre Blödheit. Die Europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly hat eine Beschwerde des VDS gegen die diskriminierende symbolische Außen darstellung der Europäi schen Kommission zurück gewiesen. Diese hatte im Jahr 2012 die frühere sprachneutrale Be schriftung ihres Pressesaales aufgegeben, um sich der europäischen Öffentlichkeit fortan nur noch als European Commission und Commission européenne vorzustellen. Die Entscheidung der Bürgerbeauftragten ist mehr als merkwürdig, sagt der VDS- Beauftragte für europäische Sprachenpolitik, Dr. Dietrich Voslamber, denn die Europäische Kommission verletzt mit ihrer neuen Außendarstellung nicht nur europäisches Recht, sie stößt auch unzäh lige EU-Bürger vor den Kopf, die durch die stetig zunehmenden Fernsehbilder aus dem Presse saal der Kommission ihre eigene kulturelle Identität missachtet sehen. Dies trägt vor allem in Deutschland sicher nicht dazu bei, die gegenwärtig bestehende Kluft zwischen den Institutio nen der EU und ihren Bürgern zu verringern. Der VDS hatte entweder eine Beschriftung in 24 Sprachen gefordert, wie es im Europaparlament üblich ist, oder wenigstens Deutsch als die zahlenstärkste Mutter sprache und zweitstärkste Fremdsprache der EU hinzuzunehmen. SN Da möchte sich der Bürger, dem keiner die Kenntnis solcher Feinheiten abfordern darf, an einem Geländer festhalten, und das ist nun mal die Muttersprache. Intuitiv verlässt er sich darauf, dass die Muttersprache auch Landessprache ist. Zwar haben wir in Deutschland auch Minderheitensprachen, offizielle wie inoffizielle. Sie sollen zu ihrem Recht kommen, aber das Rückgrat der Verständigung im Lande muss die Landessprache sein. Sie hat zumal dort zu gelten, wo es kompliziert wird: auf Ämtern, vor Gericht, im beruflichen Alltag, im Verbraucherschutz, um nur einige Bereiche zu nennen, wo wir die Menge der Missverständnisse nicht noch vermehren möchten, indem wir Englisch, ausgerechnet Englisch zur zweiten Amtssprache erklären. Warum ausgerechnet Englisch nicht? Das ist doch die Weltsprache? Eben deswegen. Die Weltsprache ist nicht Englisch, sondern schlechtes Englisch. Das mag genügen, wo es nicht anders geht. Im eigenen Lande muss sich der Bürger zuhause fühlen können. Hier können wir voneinander verlangen, dass sich jeder auf die Bedingung besinnt: Information heißt: Ich bin verstanden worden. Sonst war sie überflüssig. Falls die Menge der überflüssigen Texte und Reden weiter zunimmt, hätten wir ein Problem. Wir haben es bereits. Die etablierte Politik führt keinen Dialog mit den Wählern, die Reaktion ist an den Wahlergebnissen abzulesen. In dieser Lage Englisch als Amtssprache zu fordern, ist ein Ablenkungsmanöver ohne den geringsten Nutzwert, aber mit hohem Schadens potenzial.
5 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 5 SPRACHE UND POLITIK Der Verein Deutsche Sprache hat einen Wissenschaftlichen Beirat, geleitet von Prof. Dr. Roland Duhamel, emeritierter Ordinarius für Deutsche Literatur an der Universität Antwerpen. Dem Beirat gehören derzeit an: Prof. Dr. Christoph Barmeyer (Universität Passau), Prof. Dr. Bolesław Andrzejewski (Universität Posen/Poznań), PD Dr. phil. Uwe Hollmach (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Prof. Dr. Barbara Kaltz (Université de Provence, Aix-en-Provence), Prof. Dr. Heinrich P. Kelz (Sprachlernzentrum Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Prof. Dr. Gerhard Meiser (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Prof. Dr. Horst Haider Munske (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Wolfgang Sauer (stv. Vorsitzender, Leibniz-Universität Hannover), Prof. Dr. Hans-Joachim Solms (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Dr. Franz Stark (Bayerischer Rundfunk, München), Prof. Dr. Dieter Stellmacher (Universität Göttingen). Hier ein Auszug der Gründungserklärung, in der Gestalt von acht Thesen zur deutschen Sprache, so wie im Jahr 1999 verabschiedet. ACHT THESEN ZUM ZUSTAND DER DEUTSCHEN SPRACHE Die Deutschen befinden sich gegenüber anderen Nationen in einer besonderen Lage. Der für alle Völker selbstverständliche Sprachpatriotismus ist in Deutschland und Österreich angesichts ihrer jüngsten Geschichte belastet. Trotzdem macht es die aktuelle Gefährdung der deutschen Sprache als Kulturgut notwendig, jetzt für ihre Verteidigung einzutreten. THESE 1 Der äußere Einfluss auf Wortschatz und Struktur der deutschen Sprache war noch nie so groß wie am Ende des 2. Jahrtausends: Die Anglisierung des Deutschen betrifft mittlerweile alle sozialen Schichten der Sprachgemeinschaft. Sie äußert sich in einer Vielzahl von Entlehnungen und unangepassten Übernahmen, die weit über den Wortschatz hinausreichen. THESE 2 Die Anglisierung des Deutschen ist das Resultat der politisch-wirtschaftlichen Dominanz der USA Sie erfasst nicht nur partikuläre Wissenschafts-, Berufs- oder Konversationssprachen, sondern die Sprache als Ganzes. Die sprachlichen Auswirkungen des Internet bzw. der über das Internet zugänglichen Datenbestände sind noch unübersehbar. In Deutschland trifft Prof. Dr. Roland Duhamel war von 1977 bis 2012 Präsident des Belgischen Germanisten- und Deutschlehrerverbandes (BGDV) und ist seit 2012 Ehrenpräsident; seit 1985 Ordinarius für deutsche Literaturgeschichte und DaF- Fachdidaktik an der Universität Antwerpen; zahlreiche Publikationen zur deutschen Literatur, Ästhetik, Kulturphilosophie, Philosophie, Didaktik und Sprachpolitik sowie zur allgemeinen Literaturwissenschaft und Semiotik. diese politisch-kulturelle Hegemonie auf eine verbreitete Bereitschaft zur Anpassung und einen gravierenden Mangel an Sprachloyalität. THESE 3 Die Sprachmacht ist heute in hohem Maße an Werbeagenturen, Journalisten und Prominente gefallen. Deren Verfügung über die Massenmedien bringt Sprachmacht mit sich, namentlich die Möglichkeit, sprachliche Vorbilder aufzubauen bzw. zu demontieren. Große Teile der Medien und der Politik interessieren sich aber nicht für die Sprache, sondern allenfalls für die Effekte, die sich mit Sprache erzielen lassen im Dienst von Umsatz, Quote oder Wählerstimmen. Die Definitionsmacht darüber, was gutes Deutsch ist, wie Regeln, Normen und Sprachrichtigkeit beschaffen sind, muss diesen Menschen bestritten werden. THESE 4 Die Sprache wird nicht demokratisiert, sondern demontiert. Die Sprache sollte möglichst wenig Verstehenshindernisse aufweisen und für möglichst viele Sprachteilhaber kommunikativ beherrschbar sein, auch wenn komplexe Zusammenhänge oft komplexe sprachliche Ausdrucksformen verlangen. Durch die grassierende Anglomanie werden ohne Not ältere Menschen und viele Ostdeutsche, die kein Schulenglisch können, sprachlich ausgegrenzt. Schließlich hat sie dazu beigetragen, dass sprachliche Leitbilder, wie sie der Deutschunterricht vermitteln soll, außer Kraft gesetzt wurden und dass die Maßstäbe sprachlicher Ästhetik und stilistischer Angemessenheit verlorenzugehen drohen. THESE 5 Das Deutsche ist in einigen Fachgebieten als Kommunikationsmittel ungebräuchlich geworden und droht unbrauchbar zu werden. Es ist in Gefahr, seinen Status als Wissenschafts- und Kultursprache zu verlieren. In vielen Bereichen der Forschung, der Technik und der Wirtschaft ist versäumt worden, geeignete deutsche Terminologien zu entwickeln und sie ständig der Entwicklung anzupassen. In vielen Wissenschaften wird nicht oder kaum mehr auf Deutsch publiziert. So müssen die Forscher das Englische verwenden, um in ihrem Fach arbeiten zu können. Das ist eine bedrohliche Entwicklung für die Wissenschaften in den deutschsprachigen Ländern: die Muttersprache als Instrument und Medium des Denkens wird unbrauchbar. THESE 6 Die Sprachwissenschaft und die sprachpflegenden Institutionen haben diese Entwicklung ignoriert und sich so aus ihrer Verantwortung für unsere Sprache gestohlen. In der Sprachwissenschaft gilt die unbestrittene methodische Leitlinie, dass die zentrale Aufgabe die kontrollierbare Dokumentation, Beschreibung und Analyse der Sprache ist. Dieser Leitlinie widerspricht es nicht, wenn dokumentier-, beschreib- und analysierbare Sprachentwicklungen nach soziolinguistischen, sprachsoziologischen und sprachpolitischen Gesichtspunkten gewichtet und bewertet werden. Empirische und deskriptive Objektivität dürfen nicht als Ausrede für szientifischen oder sprachpolitischen Nihilismus dienen. Die deutsche Sprache ist nicht nur Gegenstand der germanistischen Linguistik, sondern muss auch Gegenstand ihrer sprachpolitischen Sorge und ihres kulturpolitischen Interesses sein. THESE 7 Es besteht dringender Bedarf an professioneller Planung der Entwicklung und Verwendung der Sprache (Sprachplanung). Die Anglisierung des Deutschen ist keine naturgesetzliche Entwicklung, die man nur beobachten und registrieren könnte. Es ist eine Entwicklung, die sprachliche, kulturelle und politische Gleichgültigkeit und schlechter Geschmack erst möglich gemacht haben. Man kann sie bekämpfen: Sprachentwicklungen sind in bestimmtem Umfang lenkbar. Sie sind sowohl im Hinblick auf die Sprache selbst (sog. Korpusplanung) als auch im Hinblick auf die Sprachverwendung (sog. Statusplanung) steuerbar. Dies erfordert politischen Willen und professionelle Planung. THESE 8 Die Verteidigung einer guten, flexiblen und anspruchsvollen Sprache ist keine Deutschtümelei, sondern das Bekenntnis zu einem kulturellen Erbe, und sie dient der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Deutschen für spätere Generationen.
6 SPRACHE UND POLITIK Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 6 Regionale Sprachen schützen! Jean-Marie Woehrling von der René Schickele-Gesellschaft und Pierre Klein vom Verband zweisprachiges Elsass führten in die Problematik ein. Anschließend sprach Claudine Brohy (Universität Fribourg/Freiburg, Schweiz) als Vertreterin des Europarats (abwechselnd in französischer, deutscher und englischer Sprache), gefolgt von P. Sture Ureland (Universität Mannheim), der die Eurolinguistic Association vertrat. Vincenzo Merolle (Universität Rom) hielt auf Englisch einen Vortrag über das Lateinische als lingua franca in Zwei große Kämpfer für die sprachliche Vielfalt Europas: Jean-Marie Woehrling (l.) und Pierre Klein. Europa und sprach über sein Projekt eines europäischen Wörterbuchs (The European Dictionary; Band I: A C liegt seit 2013 vor). Im Vordergrund der Diskussionen am zweiten Tag des Kolloquiums stand erwartungsgemäß die Lage des Elsässischen bzw. Hochdeutschen als Regionalsprache in Frankreich. Aber auch Fallstudien zu anderen Minderheitensprachen (Irisch, Neunorwegisch, Nordsamisch, Rumantsch Grischun und Kalmückisch) wurden präsentiert. In der abschließenden Podiumsdiskussion, bei der es wiederum Am 16. und 17. März 2016 fanden die Rencontres de Strasbourg des langues régionales ou minoritaires/straßburger Begegnungen der Regionalsprachen Europas zum Thema Erhaltung und Schutz der Regionalsprachen Europas statt. Getagt wurde im Elsässischen Kulturzentrum und im Europarat; die Organisatoren waren die Fédération Alsace bilingue/verband zweisprachiges Elsass, der Verein Culture et bilinguisme d'alsace et de Moselle/René-Schickele-Gesellschaft und die Eurolinguistic Association (Mannheim). Die Tagung war mehrsprachig und wurde vom Europarat gefördert. überwiegend um das Elsässische ging, standen insbesondere die bestehenden Maßnahmen zur Förderung von Regionalsprachen und der Unterricht des Deutschen bzw. Elsässischen im öffentlichen Schulwesen Frankreichs im Mittelpunkt. Weshalb sind manche Strategien erfolgreich, andere dagegen nicht? Hier komme, so der Konsens, dem Schulwesen und den Medien eine zentrale Rolle zu. So gibt es etwa in der Schweiz für die sehr kleine Minderheit von Sprechern des Rätoromanischen eigene öffentlich finanzierte Rundfunksender und Fernsehprogramme. Auch sei anzustreben, den heute vielfach auf Schule und Familie beschränkten Geltungsbereich der Minderheiten- und Regionalsprachen auf den gesamten Bereich des kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Lebens auszudehnen. Aber alle staatlichen Maßnahmen zu Gunsten von Regional- und Minderheitensprachen könnten nur dann erfolgreich sein, wenn die jeweiligen Sprachgemeinschaften sie auch mittrügen und aktiv unterstützten. Barbara Kaltz Wirtschaft will mehr Deutsch Andrée Munchenbach auf der VDS-Veranstaltung in Offenburg. Kurz nach der Tagung der Wissenschaftler in Straßburg ergriff eine betroffene Politikerin in Offenburg das Wort. Auf Einladung der VDS- Regionalgruppe Ortenau unter der Leitung von Erich Lienhart sprach die Präsidentin der elsässischen Regionalbewegung Unser Land-Le Parti Alsacien, Andrée Munchenbach, über regionale Identität. Die Elsässer seien in einer ähnlichen Lage wie die Bretonen, die Basken oder die Okzitaner in einem zentralisierten Staat, der die Vielfalt seiner Volksgruppen nicht angemessen schätze. Die Wertschätzung und Förderung der regionalen Eigenschaften, insbesondere der regionalen Sprachen, so Frau Munchenbach, rechtfertige sich besonders im Elsass, die lokale und grenzüberschreitende Wirtschaft verlange geradezu nach Deutsch. SN Gericht stärkt Deutsch Das Berliner Kammergericht hat kürzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Internet-Dienstes WhatsApp für ungültig erklärt, weil diese nur auf Englisch vorlagen. Man könne, entschied das Kammergericht, einem deutschsprachigen Kunden allenfalls ein schlichtes Alltagsenglisch zumuten, nicht jedoch ein langes Regelwerk mit juristischen Fachausdrücken in englischer Sprache. Solche AGB seien für den Konsumenten intransparent und Freepik deshalb unwirksam. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände. Die Verbraucherschützer werten das Urteil schon jetzt als wichtiges Signal an andere international handelnde Unternehmen. SN Deutsch-Olympiade in Polen In Kozalin (dt. Köslin) fand am 21. April das Finale der 5. Baltischen Deutsch-Olympiade. In diesem Finale traten die 40 besten der ursprünglich 600 Teilnehmer gegeneinander an und hatten einen Test in deutscher Grammatik, Lexik, Idomatik und Lese verständnis zu bestehen. VDS-Vorstandsmitglied Kurt Gawlitta und der polnische Regionalleiter Bolesław Andrzejewski zeichneten schließlich die drei Gewinner aus: zwei Schülerinnen aus Szczecin (Stettin) sowie einen Schüler aus Świdwin (Schivelbein).
7 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 7 SPRACHE UND KULTUR Von den Nachbarn lernen Von Bolesław Andrzejewski Als Nachbarn sind hier Deutsche und Polen gemeint. Ihre gemeinsame Geschichte zählt über tausend Jahre, sie ist reich an regen Kontakten. Sehr fruchtbringende Beziehungen gab es (und gibt es) insbesondere in der Philosophie. Diese, oft Tochter der Zeit genannt, ist bei den Deutschen und Polen unterschiedlich, man kritisiert sich gegenseitig konstruktiv. Die deutsche Denkweise neigte meistens zum Rationalismus, schon bei Leibniz, wo die Vernunft der Platz der angeborenen Ideen ist, noch stärker bei Kant, mit der Vernunft als methodischer und naturschaffender Kraft, besonders aber bei Hegel, bei dem der reine Gedanke den Höhepunkt erreicht und zum Absoluten, zum Schöpfer der Welt wird. Die polnische Mentalität war dagegen eher praktisch, ein wenig auch anti-rational. Der Praktizismus ist mit der politischen Lage zu verbinden, beginnend schon im Mittelalter. Seit dem XIII. Jahrhundert hatten im Norden von Polen die Kreuzritter ihren Sitz, und diese wurden mit der Zeit zur großen Bedrohung für unsere politische Unabhängigkeit. Ende des XVIII. Jahrhunderts kam es zu den drei Teilungen unter die Nachbar-Mächte, infolge derer Polen seine politische (und auch soziale) Freiheit verloren hat. Die polnischen Intellektuellen waren daher tief in die sozialen, politischen, juristischen und ethischen Probleme verwickelt. So wurde die Praxis und die Tat zum Aufruf des polnischen Gemüts. Aus diesen Gründen war die deutsche Denkweise, besonders die von Hegel, mit seinem radikalen Rationalismus, im Polen des XIX. Jahrhunderts wenig akzeptabel. Fremd war bei uns die Hegelsche Theorie des Staates, auch seine Vergötterung des Gedankens, während die Polen Gott als lebendige und handelnde Person auffassen. Andererseits jedoch wurde der Hegelianismus enthusiastisch begrüßt, und zwar durch seine Historiosophie, in der die Dialektik und die Idee der ständigen Entwicklung den wichtigsten Punkt ausmachte. Nach dem gescheiterten Januar-Aufstand (1864), dann nach dem Scheitern des Positivismus verstärkte sich die Theoretisierung der polnischen Praxis. Man wandte sich nun dem methodischen Rationalismus von Kant zu, zwecks gründlicher Ausbildung des Volkes und in der Hoffnung, die Wahrheit über die Weltverhältnisse zu finden. Die polnische Philosophie wurde somit zu einer Synthese, d. h. zur Praxis zusammen mit der Theorie, bezeichnet heute als polnischer Humanismus. Zur Zeit genießt in Polen auch die deutsche Romantik und Neuromantik viel Aufmerksamkeit. Es geht um die Weltauffassung als Identität aller ihrer Teile. Die Schellingianische (preökologische) Idee taugt sehr zu einer neuen Theorie des Menschen als homo universus. Der Mensch wird in seine Umgebung (wieder)verflochten, sehr wichtig in der Zeit der Kommerzialisierung und Technokratisierung allen Lebens. So lernen wir Polen in der Philosophie viel von den Deutschen, aber umgekehrt können auch die Polen den Deutschen neue Denkhorizonte eröffnen. Der Autor ist Ordentlicher Professor an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen und an der Technischen Universität in Koszalin und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des VDS. Er ist Verfasser oder Herausgeber von 27 Büchern und ca. 170 wissenschaftlichen Artikeln aus den Bereichen Germanistik, Philosophie und Kommunikationstheorie. ANZEIGE ADAWIS in der Wissenschaft Deutsch WISSENSCHAFT MUSS MEHRSPRACHIG SEIN DEUTSCH IM INLAND ALS WISSENSCHAFTSSPRACHE ERHALTEN Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland setzen zunehmend das Englische als ausschließliche Sprache von Forschung und Lehre durch. Der Arbeitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache (ADAWIS) e. V. hält dies für falsch. Er setzt sich stattdessen für Konzepte einer kontextabhängigen Mehrsprachigkeit ein, die der jeweiligen Landessprache eine verbindlichverbindende Rolle zuweisen. WARUM? Jede Sprache, die der Wissenschaft verloren geht, geht dem Menschen als Instrument der Erkenntnis verlo ren. Wissenschaftliches Arbeiten leitet an zu Toleranz, gedanklicher Offenheit, Die sogenannte exakte Wissenschaft kann niemals und unter keinen Um ständen die Anknüpfung an das, was man die natürliche Sprache oder die Umgangssprache nennt, entbehren. Carl Friedrich von Weizsäcker Neugier und interkulturellem Austausch. Kontextbezogene Konzepte von Mehrsprachigkeit, wie sie der ADAWIS verlangt, unterstützen diesen Prozess. Mit English only bliebe unsere Weltsicht auf denjenigen Kulturkrei s beschränkt, für den diese Sprache steht. English only in Forschung und Lehre schließt Gastakademiker von gesellschaftlicher Teilhabe aus. Gerade wenn sie unsere Landessprache nicht auch als Fach sprache lernen, verlassen sie unser Land wieder, obwohl wir sie vorbehaltlos gesellschaftlich integrieren sollten und am Arbeitsmarkt dringend benötigen. Unsere Landessprache verbindet alle gesellschaftlichen Bereiche und verklammert natur-, geistes- und sozialwissenschaft liche Erkenntnisse. Als Wissenssprache aller Bürger ermöglicht sie die Schaffung von Orientierungs wissen im öffentlichen Diskurs gesellschaftlich relevanter wissenschaftlicher Fragen. Dieser Diskurs bedarf dement sprechend landessprachlicher Terminologien. Der ADAWIS ( ist eine europaweite Vereinigung, die um die Wissenschaftstauglichkeit der deutschen Sprache und anderer Einzelsprachen fürchtet. Der ADAWIS kooperiert mit Kulturinstitutionen, Wissenschaftsorganisa tionen und der Politik sowie ähnlichen Initiativen in anderen Ländern. Kontakt: ADAWIS e.v., Postfach , D Berlin. E-Post: info@adawis.de
8 SPRACHE UND KULTUR Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 8 Geräuschlos unberechenbare Zinsen spendend Zu Ehren von Paul Raabe Deutschlands bekanntestem Bibliothekar // von Prof. Dr. Günter Schmitz In einem Aufsatz über Goethe als Bibliotheksreformer zitiert Paul Raabe einen Tagebucheintrag, den Goethe nach dem Besuch der vielbewunderten Göttinger Universitätsbibliothek niederschrieb: Man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Capitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet. Diese Bedeutung der Bibliotheken für das kulturelle Gedächtnis hat Paul Raabe wie kein anderer in unserer Zeit ins Bewusstsein gerufen. Schon zu Lebzeiten als bekanntester Bibliothekar Deutschlands, gar als General- oder Weltbibliothekar gerühmt, war er aber weit mehr als nur ein großer Bibliothekar, er war zugleich ein herausragender Buch-, Bibliotheks-, Literatur-, Kulturwissenschaftler, glänzender Biograph, Autobiograph und (Wissenschafts-) Publizist, unvergleichlicher Wissenschaftsorganisator, Menschenfänger und Geldbeschaffer. Nicht zuletzt war er ein leidenschaftlicher Kulturpolitiker, der sich besonders auch um die ostdeutschen Kulturstätten, allen voran Weimar und Halle, verdient gemacht hat. So hat es seinen guten Sinn, wenn in Weimar zu seinen Ehren jährlich eine Paul-Raabe-Vorlesung stattfindet, die jeweils eines seiner großen Themen aus heutiger Sicht behandeln soll. Sie ist von Patricia Conring (auch aktiv im VDS) gestiftet worden die während dreier Jahrzehnte an verschiedenen Projekten mit Paul Raabe zusammengearbeitet hat und mit ihm in regem Gedankenaustausch stand und wird in Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung Weimar ausgerichtet. In der zweiten Paul-Raabe-Vorlesung, am 2. Juli 2016 um Uhr im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, spricht Prof. Dr. Ulrich Raulff, der Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach (eine von Raabes früheren Wirkungsstätten), über Das Literaturarchiv und seine Sammlungen in Vergangenheit und Gegenwart. Paul Raabe wurde 1927 in Oldenburg geboren, erlebte dort als Flakhelfer noch die Kriegsschrecken, wurde Diplombibliothekar an der Landesbibliothek, studierte dann Germanistik und Geschichte in Hamburg Hätte in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert: Paul Raabe ( 2013), hier mit Patricia Conring vor dem Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. und promovierte 1957 über Hölderlins Briefe. Schon seit 1949 schrieb er, nicht selten anhand eigener Bibliotheksfunde, Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge über Literatur und Kunst und entdeckte auch viele noch ungedruckte Goethebriefe, die er dann sehr viel später (1990), um viele weitere vermehrt, in drei Nachtragsbänden zur Weimarer Ausgabe meisterhaft ediert hat. Wolfenbüttel: Symbol einer modernen Gelehrtenrepublik Foto: privat 1958 wurde Raabe Bibliothekar am Schiller-Nationalmuseum und Deutschen Literaturarchiv in Marbach und dort zum großen Wiederentdecker des literarischen Expressionismus in seiner ganzen Vielfalt. Dies gelang ihm vor allem durch eine mit Ludwig Greve erarbeitete große Ausstellung samt Katalog von 1960, die um die Welt ging, und weiterhin durch Bibliographien, Handbücher, Darstellungen, Quellensammlungen, Anthologien, Editionen oder Neudrucke, z. B. von Werken Bechers, Benns, Kafkas, Klabunds, oder auch von Zeitschriften wie der Aktion wurde Raabe Bibliotheksdirektor in Wolfenbüttel und übernahm damit eine wegen ihrer unvergleichlichen Altbestände berühmte Bibliothek, die aber wegen der (damaligen) Abgelegenheit des Ortes (spöttisch Bibliosibirsk genannt) und einer veralteten Bestandserschließung kaum noch angemessen genutzt wurde. Raabe verwandelte sie zu einer weltweit nachgefragten Forschungsund Studienstätte. So wurde für viele Gäste aus vielen Ländern Wolfenbüttel zum Symbol einer modernen Gelehrtenrepublik (P.R). In Raabes 24-jähriger Amtszeit wuchs die Zahl der Mitarbeiter von 30 auf über 200, die der Bibliotheksgebäude von 2 auf 8, fast ausschließlich durch Nutzung denkmalgerecht sanierter Altbauten. Denn dieser weltoffene, vielsprachige Neuerer Raabe war zugleich auch ein von unprätentiöser Heimatverbundenheit geprägter Bewahrer regionaler und nationaler Kulturtraditionen. In Weimar war Raabe maßgeblich an der Gründung der Klassik Stiftung beteiligt, hier schrieb er schon 1989 die inzwischen zum unentbehrlichen Cicerone gewordenen Spaziergänge durch Goethes Weimar, die er selbst seine Liebeserklärung an Weimar nannte. Ungleich größer noch, existentieller, war Raabes Wirken in Halle/ Saale. Nachdem er dort seit 1987 die dem Verfall preisgegebenen Franckeschen Stiftungen, die große, einst weltweit ausstrahlende pietistische Schulstadt des Theologen und Pädagogen August Hermann Francke ( ) kennengelernt hatte, sah er sich in die Pflicht genommen, ein einzigartiges Kulturdenkmal, das europäische Dimensionen hat wiederaufbauen zu helfen: Er wurde 1990 Präsident einer neugegründeten Gesellschaft der Freunde und ging nach seiner Pensionierung 1992 für acht Jahre als ehrenamtlicher Direktor der Stiftungen nach Halle. Und hier wurde der Lessing-Verehrer und Weimaraner Raabe nun in den Fußstapfen Franckes, dessen Frömmigkeit und Lebensleistung er tiefen Respekt zollte, zum gefeierten Retter der Stiftungen, die er mit seiner unwiderstehlichen Kreativität, Tat- und Überzeugungskraft zu neuem Leben erweckt hat. In seinen letzten Lebensjahren sah der überzeugte Kulturpatriot Raabe allerdings selbst in Weimar untrügliche Anzeichen dafür, dass seine Landsleute ihrer eigenen Nationalkultur mit zunehmender Gleichgültigkeit, ja Missachtung begegneten. In einem großen Essay in der Zeitung des Deutschen Kulturrats von 2008 forderte er daher mit Nachdruck die Verankerung der Nationalkultur und ihrer Förderung im Grundgesetz: Da wir Deutschen mit einem gebrochenen Rückgrat leben, ein natürliches, den europäischen, insbesondere den osteuropäischen Staaten selbstverständliches nationales Selbstbewusstsein eingebüßt haben, hüten wir uns bisher zum Schaden unserer Kultur, auch von nationalen Kulturaufgaben und von einer deutschen Nationalkultur zu sprechen. ( ) Damit geben wir heute im Konzert der europäischen Staaten, die sich alle als Nationalstaaten verstehen, zu deren Verwunderung unsere kulturelle Identität auf. ( ) Es ist verhängnisvoll, dass sich die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat, also länderübergreifend, nicht eindeutig zu ihrer Rolle als nationaler Kulturstaat, auch im Interesse seiner Bürger und seiner zu Deutschen gewordenen Einwanderer, bekennt. Am 5. Juli 2013 ist Paul Raabe in Wolfenbüttel gestorben.
9 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 9 SPRACHE UND KULTUR SPRACHPANSCHER DES JAHRES 2016 ZDF und FDP führen Kandidatenliste an Bis zum 26. August 2016 wählen die Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache e. V. wieder den Sprachpanscher des Jahres; auf ihrer diesjährigen Delegiertenversammlung in Bremerhaven haben sie eine Kandidatenliste mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen und seinem Intendanten Thomas Bellut sowie der FDP mit ihrem Vorsitzenden Christian Lindner an der Spitze verabschiedet. Offenbar hält das ZDF die deutsche Sprache als Medium der modernen Kommunikation nicht mehr für tauglich. Auf die Beschwerde eines Zuschauers, er wisse mit der neuen ZDF- Sendung I can do that eine Promi-Challenge mit vielen showacts wenig anzufangen, antwortete die Zuschauerredaktion, die deutsche Übersetzung Ich kann das sei dem ZDF zu hölzern. Die FDP ziert die VDS-Kandidatenliste wegen des Wunsches vieler Funktionsträger, das Englische als Amtssprache in Deutschland einzuführen. Das hätte es unter Guido Westerwelle nicht gegeben, kommentierte der VDS-Vorsitzende Walter Krämer, selbst FDP-Mitglied. Bekanntlich hatte Wester welle einmal einen auf einer Pressekonferenz auf Englisch Auskunft begehrenden Journalisten beschieden, dass in Deutschland Deutsch gesprochen werde. Weitere Kandidaten sind der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche (für ihn ist die neue E-Klasse ein Master piece of Intelligence ), die Deutsche Post AG und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In ihrer durchaus lobenswerten Kampagne Null Alkohol Voll Power wirbt sie damit, dass die Hitze beim Dancen nüchtern viel intensiver zu spüren sei. Zu den bisher von den VDS- Mitgliedern Gewählten zählen die Bahnchefs Hartmut Mehdorn und Johannes Ludewig, die Politiker Günther Oettinger und Klaus Wowereit ( Be Berlin ), Ex-Postchef Klaus Zumwinkel, Telekom-Chef René Obermann und Obermanns Vorvorgänger Ron Sommer, der den Reigen der Sprachpanscher im Jahr 1998 eröffnet hatte. Aber auch der Duden wurde schon gewählt. Und der Sieger des Jahres 2015 war der Präsident der TU München, Professor Wolfgang Herrmann, wegen seiner Pläne, die deutsche Sprache an dieser höheren Bildungsanstalt sozusagen zu verbieten. Palim palim Sprachpreis für Didi Hallervorden Schreibtalente an Hamburgs Schulen Sprachprägend: Dieter Didi Hallervorden. Foto: Agentur Neidig Dieter Hallervorden hat Ende Mai für seinen prägenden Einfluss auf die deutsche Sprache den Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für deutsche Sprache bekommen. Er spiele mit der Sprache und habe es geschafft, kreative Wortschöpfungen deutschlandweit populär zu machen, so die Begründung. In seiner Dankesrede plädierte VDS-Mitglied Hallervorden für eine Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz und mehr Maßnahmen gegen Anglizismen. Weitere Preise erhielten der Moderator Peter Klöppel, der Sänger Andreas Bourani und die Sportjournalistin Dorothee Torebko. SN Die mit dem VDS verbundene Hamburger Guntram und Irene Rinke Stiftung förderte zum zweiten Mal das Projekt KLASSEnSÄTZE Schüler von 39 Hamburger Schulen nahmen an dem Schreibwettbewerb zum Thema unterwegs teil. Die Gewinner: Leila Rowoldt, Erik Ruben Bredlow, Celina Ehrmann, Julius Bleck (v. l. n. r.). Foto: KLASSEnSÄTZE
10 SPRACHE UND GESCHLECHT Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 10 HIER ENDET DAS GENDERN Von Peter Eisenberg Wie zu erwarten, wurde Flüchtlinge zum Wort des Jahres 2015 gewählt. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) schreibt dazu: Das Substantiv steht nicht nur für das beherrschende Thema des Jahres, sondern ist auch sprachlich interessant. Gebildet aus dem Verb flüchten und dem Ableitungssuffix -ling ( Person, die durch eine Eigenschaft oder ein Merkmal charakterisiert ist ), klingt Flüchtling für sprachsensible Ohren tendenziell abschätzig. Analoge Bildungen sind negativ konnotiert, andere haben eine deutlich passive Komponente. Beide Zuschreibungen passen zwar ins Bild eines irgendwie problematischen Wortes, sind aber für Flüchtlinge durch nichts begründet. Aller Wahrscheinlichkeit nach treffen sie nicht zu. Das Wort ist alt und, wie Sprachwissenschaftler sagen, lexikalisiert im Sinne von nicht mehr transparent. Diese Eigenschaft teilt es mit zahlreichen anderen Wörtern wie Findling, Liebling, Zwilling, Stichling, Sämling, Frühling, die keineswegs negativ konnotiert sind. Die passive Komponente tritt bei Ableitungen von bestimmten transitiven Verben auf wie bei prüfen Prüfling, säugen Säugling, impfen Impfling. Das Verb flüchten gehört nicht zu dieser Gruppe. Unter den über 300 Wörtern mit der Endung ling findet jeder, was er gerade braucht. Interessant ist, dass Flüchtlinge sich bei genauerem Hinsehen als politisch inkorrekt erweist. Es handelt sich meist um Personenbezeichnungen im Maskulinum, die von der Bedeutung her eigentlich einem Femininum zugänglich sein sollten wie bei Denker Denkerin oder Dieb Diebin. Aber die Form Flüchtlinginnen gibt es im Standarddeutschen nicht. Es kann sie auch nicht geben, ihre Bildung ist ausgeschlossen. Der Grund für das zunächst rätselhafte Verhalten des Suffixes ling ist systematischer Natur. Die Wortbildungssuffixe des Deutschen sind an eine feste Reihenfolge gebunden, die semantisch begründet ist. Von links nach rechts folgt sie der sog. Belebtheitshierarchie, der ein am Sprachlichen orientierter, gut fundierter Begriff von Belebtheit zugrunde liegt. Für unseren Fall besagt sie, dass das belebteste Element am weitesten links steht und Belebtheit nach rechts abnimmt. Das führt beispielsweise dazu, dass Abstraktheitssuffixe niemals links von solchen stehen, die Personenbezeichnungen bilden. Die Hierarchie ist von allergrößtem Interesse für viele grammatische Phänomene in vielen Sprachen, im Deutschen beispielsweise auch für die Grundreihenfolge von Satzgliedern wie in weil der Student seiner Universität schwere Vorwürfe macht. Einem Verbstamm folgt in der Wortbildung als belebtestes Element unmittelbar das Suffix er zur Bildung von Nomina agentis wie Denker, Fahrer, Angler. Nach der Hierarchie folgen in (Movierung: Denkerin), schaft (Kollektivum: Denkerinnenschaft), danach das vielseitig verwendbare Diminutivsuffix chen und schließlich das Pluralsuffix. Es kommt vor, dass in einer solchen Hierarchie zwei Suffixe sozusagen parallel geschaltet sind und dann nur alternativ auftreten, niemals aber gemeinsam, egal in welcher Reihenfolge. Das gilt für in und ling. Beide bilden im Gegenwartsdeutschen Personenbezeichnungen, das eine Feminina, das andere Maskulina. Das System sieht sie als miteinander unverträglich an. Das zu begründen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Aber schon die Sichtung von Vorkommen der Suffixfolge lingin wie in Flüchtlingin zeigt, dass bei solchen Formen fast durchweg mit der grammatischen Norm gespielt wird. Formen wie Anlernlingin, Aufdringlingin, Fieslingin, Häftlingin, Nervlingin sind mir wiederholt in Seminararbeiten über Jugendsprache begegnet, aber auch in literarischen Texten kommen Bildungen dieser Art vor. Dazu einige Beispiele. Das Grimmsche Wörterbuch bringt aus dem Werk von Friedrich Leopold Stolberg zum Stichwort Fremdling folgenden Beleg (Bd. 4, 130): und willkommen ist die kühne fremdling auch Die Sprache wird nicht akzeptiert, wie sie ist, sondern sie gilt als manipulierbarer Gegenstand mit unklaren Grenzen dieser Manipulierbarkeit. oft unter den reigen der himmlischen. Die Grimms fügen dem hinzu deutscher klingt fremdlingin. Im Text von Stolberg soll mit die fremdling ein Bezug auf die muse hergestellt werden. Der Dichter ist zu einer Regelverletzung bereit, die von den Grimms gemildert, aber nicht beseitigt werden soll. Nur so kann ihre Formulierung deutscher klingt verstanden werden. Bei Jean Paul, dessen Wortschatz ja durch einen besonders kreativen Umgang mit Wortbildungsregularitäten gekennzeichnet ist, findet sich mehrfach die Fremdlingin, beispielsweise in der Vierten biographischen Belustigung. Der Tod aus dem Jahr Fremdlingin steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu Emigrantin. Es sieht ganz danach aus, als handele es sich um eine Analogiebildung. Auch die Flüchtlingin kommt vor (z. B. Titan, 104. Zykel, 1802): Der Kurfürst sagte:,er wisse doch nichts dieser schönen Halbkugel ähnlicheres als eine viel kleinere, die er im Herkulanum in Asche ausgedrückt gefunden, vom Busen einer schönen Flüchtlingin. Der Richter lachte In einem Leserbrief (FAZ vom 22. Dezember 2015, 6) zitiert Claus Plantiko (Bonn) aus Friedrich Hölderlins Brod und Wein die (hier in der Fassung des Leserbriefs wiedergegebene) Passage Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf, / Sieh! Und das Ebenbild unserer Erde, der Mond, / Kommet geheim nun auch, die schwärmerische, die Nacht kommt, / voll von Sternen, und wohl wenig bekümmert um uns / Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen / Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf. Der Schreiber möchte ins Bewusstsein heben, wie meisterhaft Hölderlin hier systemwidrig die verfremdende Wirkung des auch 1801 ungewohnten Wortes nutzt, um die Fremdheit der Nacht zu verdeutlichen. Rüdiger Harnisch (Passau) schließlich verdanke ich einen Hinweis auf Max Frischs Andorra (1961), wo es heißt: Ich bin Gastwirt. Man kann eine Fremdlingin nicht von der Schwelle weisen. Jemand lacht, die Zeitung lesend. Das Lachen, so ergibt sich, ist der Verwendung des eigenartigen Wortes geschuldet. Aus dem Vorkommen von lingin-bildungen zu schließen, sie seien letztlich doch grammatisch, würde die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Unbedingt von Interesse ist natürlich, war-
11 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 11 SPRACHE UND GESCHLECHT GeGe GiGi GaGa um gerade Fremdlingin immer wieder verwendet wird. Systematische Erhebungen würden möglicherweise ein anderes Bild ergeben und zu Überraschungen führen. Wir lassen die Frage vorläufig dahingestellt und kommen zu dem Schluss, dass es Fälle gibt, in denen das Sprachsystem die vielleicht verbreitetste Form des Genderns nicht zulässt. Das sollte jeder, der auf diesem Gebiet tätig wird, wissen und akzeptieren. Als Ausweg steht dann nur die Propagierung eines Wortes mit anderer Struktur zur Verfügung. Für Flüchtlinge ist bereits Geflüchtete im Schwange. Die GfdS schreibt: Neuerdings ist öfters [sic] alternativ von Geflüchteten die Rede. Ob sich dieser Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Geflüchtete ist dem Gendern zugänglich, zeigt aber auch, wo das sprachliche Kernproblem dieser wie der meisten anderen willkürlichen Normsetzungen liegt: Die beiden Wörter bedeuten nicht dasselbe. Auf Lesbos landen tausende von Flüchtlingen, ihre Bezeichnung als Geflüchtete ist zumindest zweifelhaft. Man stelle sich einmal vor, dass Wörter wie Flüchtlingskinder, Flüchtlingsunterkünfte, Bootsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge mechanisch ersetzt würden durch Geflüchtetenkinder, Geflüchtetenunterkünfte, Bootsgeflüchtete, Wirtschaftsgeflüchtete. Und auch umgekehrt wird ein aus der Adventsfeier Geflüchteter nicht zum Flüchtling. Das Deutsche ist so bildungsmächtig, dass man sich durchaus andere Wörter als Ersatzkandidaten vorstellen kann, etwa Vertriebene, Geflohene, Zwangsemigranten, Entheimatete und viele weitere, von denen eins schöner ist als das andere. Aber es bleibt dabei: Sie alle bedeuten etwas anderes als Flüchtlinge. Der etablierten Genderei sind solche Erwägungen ziemlich gleichgültig. Natürlich ist ein Denkender nicht dasselbe wie ein Denker, ein Dichtender nicht dasselbe wie ein Dichter. Aber ein Studierender soll (bis auf die Genderbarkeit) dasselbe sein wie ein Student, ein Auszubildender dasselbe wie ein Lehrling. Von außen erzwungene Wortersetzungen mögen im Einzelfall erfolgreich sein, nur beruht jede von ihnen auf Missachtung sprachlicher Gegebenheiten. Das Deutsche hat aus sehr guten Gründen seine Partizipien neben den verschiedenen Typen von Wortbildungen per Suffix. Gerade auf den Feinheiten der strukturellen Unterschiede beruht seine differenzierte Ausdruckskraft. Sogar ein unschuldiges Wort wie Flüchtling wird so zum Ansatz für Sprachkritik. Was einen Sprachwissenschaftler am etablierten Gendern selbst dann beunruhigt, wenn er die sprachliche Sichtbarmachung von Frauen freudig begrüßt, ist Dreierlei. Erstens: Die Sprache wird nicht akzeptiert, wie sie ist, sondern sie gilt als manipulierbarer Gegenstand mit unklaren Grenzen dieser Manipulierbarkeit. Zweitens: Die Kenntnis des Gegenstandes, an dem man Veränderungen vornimmt, geht nicht sehr weit. Drittens: In vielen Fällen stigmatisiert man Wörter, ohne dass es brauchbare Alternativen gäbe. Haben wir denn nichts aus dem Desaster der Orthographiereform gelernt, die im Kern ja auch nichts anderes als ein unüberlegter Eingriff ins Sprachsystem war? Eine Kurzfassung dieses Textes erschien am 16. Dezember 2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf ihrer diesjährigen Delegiertenversammlung in Bremerhaven haben die Mitglieder des VDS folgende Erklärung verabschiedet: Schluss mit der ideologischpolitischen Bevormundung von Sprache Die in Hunderten von Jahren entwickelte deutsche Sprache gerät zusehends in Gefahr, zum Objekt ideologisch motivierter Manipulationen zu werden. Wie in der Zeit der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts werden auch heute Versuche unternommen, unsere Sprache zur Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele zu verändern, diesmal im Sinne einer behaupteten Politischen Korrektheit, der Geschlechtergerechtigkeit oder des Gender Mainstreaming. Dazu gehören die systematische Missachtung der Unterschiede zwischen biologischem und grammatischem Geschlecht und das Bestreben, der Sprache eine Geschlechtsneutralisierung aufzuzwingen. Das verkrampfte Vermeiden von grammatisch männlichen Begriffen, die als genus collectivum seit Jahrtausenden in allen indoeuropäischen Sprachen alle Menschen mitmeinen, verkrüppelt die Sprache, zerstört ihren Rhythmus, raubt ihr Schönheit, Eleganz und Verständlichkeit. Die Sprache sinkt herab zum Werkzeug von Ideologen, die selbst vor dem Umschreiben klassischer Literatur nicht Halt machen. Die in Bremerhaven versammelten Delegierten des VDS fordern daher in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Bundestages vom ( Die Sprache gehört dem Volk ) alle Freunde der deutschen Sprache in Kultur und Wissenschaft, in Wirtschaft und Gesellschaft und in allen politischen Gremien auf, sich diesem Missbrauch und dieser Misshandlung unserer Sprache entschieden zu widersetzen. Wir betrachten die aufgezwungenen, angeblich geschlechtergerechten Ausdrucksformen als eine Art von Sprachpolizei, als eine Bevormundung, die mit unseren im Grundgesetz gewährleisteten Rechten auf freie Entfaltung der Persönlichkeit unvereinbar ist. Das gleiche Recht eines jeden Mitglieds der deutschen Sprachgemeinschaft auf den freien Gebrauch unserer Sprache ist unverzichtbar. Bremerhaven, den 28. Mai 2016
12 DEUTSCH IM WANDEL Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 12 BAERENTATZE Blödsinn von Böhmermann Nichts gegen derbe Sprache, nichts gegen anzügliche Texte, nichts gegen schmähende Gedichte, alles zu seiner Zeit an seinem Platz! Aber mir kocht die Frage hoch, ob zur Kunst alles zählt, was uns so einfällt, wenn der Tag lang ist? Bis auf die eine Begründung sonst fällt mir keine ein, dass wir alle die Freiheit einfordern, unsere Meinung zu äußern, und sei es künstlerisch, o Graus. Nur diesen Wunsch hat Böhmermanns Text mit der Ausübung von Kunst gemeinsam, sonst nichts. Schon gar nichts mit Kunst zu schaffen hat der Präsident unseres NATO-Partners Türkei. Er treibt sich auf jeder Baustelle herum, wo ihn eine Kamera beim Absondern von Phrasen abbilden kann. Merke: Ob sich jemand beleidigt fühlt, zu Recht oder nicht, mag mit allerlei zu tun haben, nur nichts mit der Kunst. Frühzeitig erfuhren wir: Das war nett, mein Junge und es reimt auch so schön, Dipl.-Ing. Oliver Baer ist Publizist. Sein Buch Von Babylon nach Globylon erschien 2011 im IFB Verlag Deutsche Sprache. Jan Böhmermann Foto: Jonas Rogowski (Wikimedia) aber weißt du, es dichtet nicht. Ab wann ein Text dichtet? Da tut sich eine Grauzone auf. Aber nur weil etwas grau daherkommt, erklär ich nicht alles Graue zur Kunst. Böhmermanns Schmähtext ist geschmacklos. Schon die Mohammedkarikaturen enttäuschten mich: Als Satire waren sie beinahe gelungen. Beinahe. Oder muss ich nun jeden Furz, sobald ihn ein Satiriker lässt, als grundgesetzlich schützenswert zur Kenntnis nehmen? Da stelle ich andere Ansprüche, und ich weiß, wovon ich rede; mir ist selber schon so manche Satire missraten. Hinsetzen und neu schreiben! Kein Fuchteln mit der Kunstkeule wird den Text retten! Selbst auf einem Meinungsknopf lässt sich Satire tiefer, bissiger, giftiger rüberbringen als in den Reimen des Böhmermanns. Auf der Bühne wie angesengt zu schreien ist kein Ersatz für das Sprechen, und schon gar nicht wird Kunst daraus, wenn kein Wort zu verstehen ist. Es gälte denn das Motto: Die Sprache ist der Tod des Theaters (O-Ton aus einer deutschen Theaterprobe). Oder aus dem Blickwinkel des Geldes: Wenn Beyoncé 250 Millionen Dollar schwer ist, mag davon eine Million zur Kunst gehören, weiß der Geier, nehmen wir es mal an, aber die übrigen 249 sind Anmache, Sex und Geschäft. Nichts dagegen, alles paletti, aber Kunst? Sonst müssten wir mit den wenigen gelungenen, den wirklich schätzenswerten Grafitti sämtliche Klosettschmierereien auf diesem Planeten zur Kunst zählen. Böhmermanns Verse sind plakativ, nicht satirisch. Zur Satire gehört Können, das erkenne ich hier nicht. Zur Satire gehört Sprache, um die muss man sich bemühen. Sprache ist kein Lebewesen, gegen Missbrauch kann sie sich nicht wehren. Verantwortung für ihren Gebrauch trägt jeder. Da darf er gern auch mal scheitern, aber seid so nett: Probiert es wenigstens und erklärt nicht gleich jeden Reim zum Gedicht und nicht jede Beleidigung zur Kunst. Oliver Baer Retkowski in Bad Berleburg Bekannt für sprachkritischen Karikaturen: Friedrich Retkowski In Zusammenarbeit mit der VDS-Regionalgruppe Siegerland und ihrem Leiter Jürgen Franke stellte die Volksbank Wittgenstein in Bad Berleburg im April die Denglisch-Zeichnungen des bekannten Karikaturisten Friedrich Retkowski aus. Retkowskis Karikaturen sind bereits in Schulbüchern zu finden, um den Schülern Anregungen zur Auseinandersetzung mit der Sprachentwicklung zu geben. SN Mit dem VDS ins Ausland Die in den Sprachnachrichten (4/2015) ausgeschriebenen Querdenker-Stipendien in Höhe von je 500 Euro kommen Projekten in Russland und Tschechien zugute. Die erste Stipendiatin ist Susanne Catherine Otto von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie führt eine Befragung zum Thema Akademisches Schreiben in der Fremdsprache Deutsch unter tschechischen Studenten durch. Otto will den Stellenwert des Deutschen als Fremdsprache beim Studium an einer tschechischen Universität und die Einstellungen der Studenten beim Schreiben in der Fremdsprache bewerten. Das zweite Stipendium bekommt Katherina Kluge von der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg. Die Studentin der Sprechwissenschaften reist für ihre Abschlussarbeit ins russische Woronesch. Dort befragt sie Kinder, die zweisprachig mit Russisch und Deutsch aufwachsen, und stellt einen Vergleich mit einsprachigen Kindern an. Die Stipendien wurden vom VDS und dem Internetportal Sprachreisenvergleich.de ausgeschrieben. Sie wenden sich an junge Menschen, die Kontakt mit Deutschsprachigen im Ausland suchen. Regionalleiter Gerd Lenz übergab das Stipendium an Susanne Catherine Otto auf einer VDS- Versammlung. Otto stellt ihre Studienarbeit anschließend in einem Referat vor. Foto: VDS München
13 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 13 DEUTSCH IN ALLER WELT Die Deutschen sind Urlaubsweltmeister. Überall, wo sie Ferien machen und Geld ausgeben, steht auch ihre Sprache hoch im Kurs. Es gibt dort für angehende Hotelangestellte Deutschkurse oder deutschsprachige Tourismus-Studiengänge und für die Ferien gäste spezielle Zeitungen oder Zeitschriften auf Deutsch. Von den über deutschsprachigen Publikationen außerhalb des deutschen Sprachraums richten sich mehr als 180 hauptsächlich an deutsche Urlauber, wie die Internationale Medienhilfe (IMH) in einer Untersuchung ermittelt hat. Hinzu kommen noch etwa 35 Radioprogramme und zwei kleinere Fernsehangebote für deutschsprachige Reisende. Neben diesen Spezialmedien existieren viele weitere in deutscher Sprache, die eher allgemein berichten, aber auch Beiträge und Rubriken für Touristen anbieten. Björn Akstinat, Leiter der IMH: Die meisten Urlaubermedien, nämlich rund 100 Publikationen und Rundfunkprogramme, gibt es verständlicherweise in Spanien. Danach folgen mit weitem Abstand die Tschechische Republik, Polen, Thailand, Italien, Portugal, die Vereinigten Staaten und die Türkei. Aber auch Länder wie Island, Namibia, Zypern und die Dominikanische Republik bieten deutschsprachige Touristenmedien. Sogar in Tunesien wird eine regelmäßige Radiosendung extra für die Gäste aus dem Norden ausgestrahlt. Die bekanntesten Auslandszeitungen sind zweifellos das 1971 gegründete Mallorca- Magazin und die im Jahr 2000 entstandene Mallorca-Zeitung. Zu den etablierten und traditionsreichen Medien gehört auch die Griechenland-Zeitung aus Athen. Das Wochenblatt hat seine Ursprünge im Jahr Im amerikanischen Florida hat Das Angebot an Zeitungen und Zeitschriften für Touristen aus Deutschland wird seit Jahren größer. In vielen Ländern gibt es zudem Radio- und Fernsehprogramme in deutscher Sprache. IMH Über 200 Medien für deutsche Urlauber man die Auswahl zwischen der Zeitschrift Florida Sun, die man auch an Kiosken in Deutschland kaufen kann, und der neuen Zeitung The SunState Post. Gerade erst gegründet wurde das Magazin Schottland aus Edinburgh. Gründerin ist Nicola de Paoli, eine frühere Mitarbeiterin der Financial Times Deutschland Wer wissen will, welche Publikation oder welches Rundfunkprogramm in der Nähe seines Urlaubsortes erscheint bzw. ausgestrahlt wird, der kann kostenlos nachfragen: hilfe.org>. IMH Deutsch-französische Freundschaft Véronique Minon, Deutschlehrerin am Gymnasium Jeanne d Arc im wunderschönen südfranzösischen Carcasonne (Urlauber auf der Fahrt zwischen Atlantik und Mittelmeer sehen es von der Autobahn und halten es ob seiner unwirklichen Aura oft für eine Attrappe à la Disneyland), hat dort mit Unterstützung ihres Schulleiters und ihrer Schüler eine Woche lang die deutsch-französische Freundschaft vorgelebt. Mit Plakaten und Bildern feierten sie die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags zwischen Konrad Adenauer und Charles De Gaulle am 22. Januar 1963, das daraus entstandene Deutsch-Französische Jugendwerk und viele andere Austauschprogramme, wie etwa ihr eigenes mit dem Marien-Gymnasium in Kaufbeuren in Bayern. Und an einem Tag in der Woche gab es in der Schulmensa auch deutsches Essen. Mit dabei waren auch unsere VDS-Vertreter in Südfrankreich, Elke und Rolf Massin. Letztere organisierten außerdem einen Schreibwettbewerb, bei dem die Glücksfee Philippine die Gewinner zog (Foto re.). Fotos: VDS Frankreich Deutsch eingeführt Der Leiter einer Grundschule in Südfrankreich schreibt: Ich habe die Ehre Ihnen mitzuteilen, daß ich in der Abschlußklasse meiner Schule das Fach Deutsch eingeführt habe. Deutsch ist eine ganz wichtige Sprache. Mit meiner Maßnahme, die die Académie von Montpellier genehmigt hat, hoffe ich zu erreichen, daß im nächsten Schuljahr ab Klasse 6 des weiterführenden Collège das Unterrichtsfach Deutsch angeboten wird. Das ist auch im Sinne der Schulreform der französischen Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem. Christophe Barrau, Directeur de l Ecole élementaire de Nissanlez-Ensérune (Département Hérault)
14 DEUTSCH IM WANDEL Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 14 Nichtsdesto was? Das ist eine Kolumne von Gloria Nsimba, 1988 in Angola geboren, wuchs sie in Deutschland auf, studierte Linguistik, ist Mutter zweier Kinder und arbeitet im Institut für Betriebslinguistik. Von Heinz Schuler Es muss in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein, dass ein eloquenter Witzbold die Synonyme trotzdem und nichtsdestoweniger verschmolzen und damit viel Anklang gefunden hat. Zunächst noch in der beabsichtigten ironischen Weise gebraucht, hat diese sprachliche Missgeburt in den folgenden Jahrzehnten an ignoranter Ernsthaftigkeit gewonnen und nicht nur die Umgangssprache erobert, sondern zunehmend auch die mediale Öffentlichkeit (mit glücklicher Ausnahme weniger Zeitungen, vor und hinter denen sprachbewusste Köpfe stecken). Jüngere Leser können ihre etymologische Unkenntnis der Gnade ihrer späten Geburt anlasten und sich sogar auf den Duden, den Sprachpanscher des Jahres 2013, berufen, der auch diesen Ausdruck unter seine vielen Sprachsünden einreiht (und ihn zwar im Rechtschreib-, nicht aber im Synonymwörterbuch mit dem Zusatz ugs. versehen hat). Man wird wohl nicht überrascht sein, wenn sich Fußballer im Interview auf diese Weise unartikulieren (und damit ihre Bewunderer ebenso infizieren wie mit ihren Tätowierungen); von Rundfunkreportern und Fernsehmoderatoren wünscht man sich hingegen, dass sie aus der Vielfalt der Alternativen sprachkritischer auswählen. Immerhin stellt unsere Sprache neben den Ursprungsausdrücken trotzdem und nichtsdestoweniger beispielsweise noch gleichwohl, dennoch und ungeachtet dessen zur Verfügung. Unnötig zu sagen, dass die Kategorie ehemals scherzhaft gemeinter Verballhornungen, die es zu ernstgemeinter Nutzung bringen, weiterhin Zuwachs bekommt: Schlicht und ergreifend beispielsweise steht nichtsdestotrotz doch in keinster Weise nach! HIER SPRICHT GLORIA GENERATION XYZ Jede neue Generation trägt durch ihre eigenen Denk-, Verhaltens- und Arbeitsweisen dazu bei, dass die bestehende Kultur maßgeblich verändert wird. Die alten Generationen müssen sich dann ob bewusst oder unbewusst, ob freiwillig oder gezwungenermaßen mit den Neuen auseinandersetzen. Ob sie die neuen Denkmuster am Ende nachvollziehen können oder nicht, ist dabei gar nicht mal so wichtig. Oder? Bis vor Kurzem wäre das zumindest meine naive Behauptung gewesen. Jede Generation macht doch eh so ihr eigenes Ding. Bei den zwischen 1943 und 1960 geborenen Menschen spricht man (in der westlichen Welt) von geburtenstarken Jahrgängen, den sogenannten Babyboomern (danke für diesen Beitrag, leider sind wir mittlerweile ins andere Extrem verfallen). Obwohl es nur wenig Studien über ihr Lebensgefühl und ihre Werte gibt, weiß man heute, dass die Arbeit größtenteils den Lebensmittelpunkt dargestellt hat. Nicht umsonst haben sie den Begriff Workaholic geprägt. Sie sind von allen Generationen immer noch am meisten vertreten. Die Mitglieder der darauffolgenden Generation X (geboren zwischen 1960 und 1980) sind eher individualistisch, sehr gut ausgebildet und im Beruf sehr zielstrebig. Dennoch steht hier die Arbeit nicht an erster Stelle, sondern dient als Mittel zum Zweck, um sich materiell abzusichern. Meine Generation, die Generation Y (Im Englischen auch liebevoll Generation WHY ) oder Millenialen, stellt die bisher am besten erforschte dar. Geboren zwischen 1980 und 2000 sind wir in der realen sowie in der virtuellen Welt exzellent vernetzt. Das Internet bestimmt den Alltag. Selbstverwirklichung ist den Mitgliedern dieser Generation unheimlich wichtig. Die Arbeit muss einen Sinn ergeben und Abwechslung bieten. Deshalb werden Milleniale auch als Meister der Projektarbeit bezeichnet. Das bedeutet abwechslungsreiche, spannende Arbeit mit Ablaufdatum. Sie weisen zudem sehr spezialisiertes Wissen auf. Die Generation Z hat es in sich Außerdem trennen sie Arbeit und Privatleben nicht unbedingt: Privates während der Arbeitszeit zu klären, aber auch in der Freizeit zu arbeiten, ist für Milleniale größtenteils selbstverständlich. An dieser Stelle könnte ich eigentlich aufhören, wenn da nicht noch die [Trommelwirbel] Generation Z wäre. Diese jungen Leute wachsen noch im Schatten der Millenialen auf und sind noch sehr jung. Dennoch wäre es für den VDS äußerst unklug davon auszugehen, dass man sie mit vorhergehenden Generationen vergleichen könnte. Im Wettstreit um neue Aktive könnte es für uns böse enden. Deshalb sollte man schon jetzt ein wenig Zeit investieren und sich mit den einen oder anderen Merkmalen dieser Generation befassen. Denn die hat es ganz schön in sich! Nicht umsonst wird sie auch als igeneration bezeichnet. Das Wortspiel muss ich wohl nicht weiter ausführen Zwischen 1995 und 2002 ist diese Generation zur Welt gekommen. Geshared, geliked und getweeted, doch nicht begegnet! Diese Aussage aus dem Netz beschreibt das Hauptmerkmal der Generation Z ziemlich treffend. Die digitale Welt wird hier vom Arbeits- zum Lebensraum, in der kommuniziert wird, ohne sich zu treffen. Diese Generation ist schon von Anfang an mit den digitalen Medien groß geworden und kann nicht mehr zwischen den klassischen und den neuen Medien unterscheiden. Vor allem, weil alle Medienarten mittlerweile digital zugänglich sind. Dieser Generation ist außerdem das klassische Autoritätsverständnis völlig fremd. Sie möchte weder bevormundet noch eingeschränkt werden. Für das Resultat steht sie dann selbst gerade, und solange die Projekte spannend sind, bleibt sie auch bei der Sache. Sie hat eine individualistische Sichtweise auf das Leben und die Arbeit und interessiert sich, ganz krass gesagt, nicht für andere Personen (außer der engen Familie und Freunde), Politiker, Unternehmen und Autoritäten. Worauf muss man sich also gefasst machen? Zum Einen binden sich die Mitglieder dieser Generation nicht gerne für eine lange Zeit. Alle Vereine leiden unter diesem Phänomen. Des Weiteren ist es wichtig, sich als Verein attraktiv in den digitalen Netzwerken zu repräsentieren, um wahrgenommen zu werden. Da hat der VDS noch Nachholbedarf.
15 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 15 SCHÖNES DEUTSCH»SCHNEIDERS ECKE«Schlimmes Deutsch mit Dudens Segen Sprachpapst und VDS-Mitglied Wolf Schneider. Foto: Peter Just Zum Beispiel verteidigt diese Grammatik einen Satz, der buchstäblich mit den Wörtern Der die das beginnt: Der Leser müsse sich nur die Struktur des Satzes Schritt für Schritt klar machen. Der Leser! Der Schreiber hat offenbar keine Pflichten, wenn nur die Grammatik stimmt und wäre es auch auf diese unsinnige, diese schamlose Weise. Nämlich: Der die das Recht auf Steuererhöhungen betreffenden Fragen bearbeitenden Kommission steht die alleinige Entscheidung zu. Auftrag an den Leser also: Entwirre die beiden Ketten von vorangestellten Attributen arbeite! Laut Duden so: Schritt 1, die betreffenden Fragen bearbeitenden (Attribut zu Kommission). Schritt 2, das Recht auf Steuererhöhungen betreffenden (Attribut zu Fragen). Alles klar? Und nicht die Spur eines Appells an den hochnäsigen Verfasser dieses unsäglichen Satzgebildes, dergleichen niemals hinzubasteln, hinzusudeln sondern ein gnädiger Hinweis an die geprügelten Weniger bekannt als Dudens Deutsche Rechtschreibung ist Dudens Deutsche Grammatik. Kein Unglück: Sie enthält sowieso die größeren Ärgernisse. Leser: Grammatikkenntnisse erleichtern das Verstehen komplizierter Sätze. Der Grammatik als solcher wird da ein Hochaltar errichtet und der Urzweck der Sprache auf den Müll geworfen: die Kommunikation! Wer hier wirklich etwas hätte mitteilen wollen, der hätte ja schreiben können: Die alleinige Entscheidung steht der Kommission zu, die all jene Fragen bearbeitet, die das Recht auf Steuererhöhungen betreffen. Lob der Privat-Grammatik Solche Muster aber, Beispiele also, Ermutigungen sie liefert der Duden nicht. Er druckt auch weitere übel verschachtelte Sätze ab (wenn er, wenn der, indem er ), als Muster für fachsprachliche Texte, wie sie dort eben üblich seien. Nicht die Spur einer Anleitung, wie man sie vermeiden könnte; wie also man sie zertrümmern müsste. Bis 1971 hatte die Duden- Redaktion ein gutes Gewissen, wenn sie das in der Sprache Übliche zwar zuweilen registrierte, sich primär aber als Verkünder von Normen verstand. Seit 1971 normiert sie zwar noch die Rechtschreibung, aber nicht mehr Grammatik und Stilistik. Da spielte vermutlich der antiautoritäre Geist von 1968 mit, wie er sich am drastischsten 1972 in den Hessischen Rahmenrichtlinien für das Fach Deutsch manifestierte: Die unreflektierte Einübung in die Normen der Hochsprache erschwere den meisten Schülern die Wahrnehmung und Versprachlichung ihrer Sozial-Erfahrungen und Interessen. Kommt er oder käme er nur? Das traf sich mit der Denkrichtung, die in der akademischen Linguistik ohnehin dominiert: Sie will nicht präskriptiv (vorschreibend) agieren, sondern deskriptiv (beschreibend); jede Art von Sprachpflege wird als unwissenschaftlich abqualifiziert. (Also wäre auch der Rang der Lutherbibel wissenschaftlich nicht zu würdigen und das spräche sehr für die Lutherbibel.) Entgegen ihrem erklärten Ziel jedoch entscheidet die Duden-Redaktion auch weiter über die Entwicklung des Deutschen kräftig mit, wenn sie darauf verzichtet, in Grammatik und Stilistik noch Normen zu setzen: Kommentarlos wird das Übliche registriert. So verweist der Duden darauf, dass der Konjunktiv II (er hätte, er wäre) immer häufiger statt des Konjunktivs I (er habe, er sei) verwendet werde. Die Redaktion kommentiert das sogar aber nicht mit dem Hinweis falsch, oft auch missverständlich, sondern: habe werde als gehoben oder gar als geziert empfunden. (Missverständlich: Er käme bedeutet ja das Gegenteil von er komme: Er sagte, er komme heißt: er kommt; er sagte, er käme dagegen: er kommt nicht; er käme ja gern, wenn nicht leider ) Auch Eisberge kochen nur mit Wasser Unter mausern bringt der Duden das Beispiel Der Abriss hat sich zu einem Lehrbuch gemausert und unterlässt jeden Hinweis, dass der Vogel, der sich mausert, sich zu gar nichts mausert, er bleibt ein Vogel; der Duden billigt also eine Katachrese, eine entgleiste Metapher von der Art Auch Eisberge kochen nur mit Wasser. Indem nun der Duden in Grammatik und Stilistik jede Normierung verweigert, setzt er eine Abwärtsspirale in Gang: Denn seine Benutzer suchen wie eh und je die Norm in ihm sie nehmen also das registrierte Übliche als das Richtige wahr, selbst wenn es falsch, dubios oder bescheuert ist. dpa hat daraus schon 1985 in einer Dienstanweisung die Konsequenz gezogen: Auf den Duden kann man sich nicht immer berufen. Wenn dpa einen Fehler mehrmals macht, der durch die Wiedergabe in den Zeitungen potenziert wird, erscheint er alsbald auch im Duden. Die Zeit schrieb im selben Jahr: Wenn etwas nur lange genug unkorrekt gebraucht wird, ist unsere Große Hure Duden zur Stelle und kassiert es als korrekt. Gebessert hat sich seitdem nichts. Quelle: Sprüche Holprig oder lieblich Eine Sprache mit vielen Konsonanten ist wie ein Kartoffelacker. Eine mit vielen Vokalen wie eine Blumenwiese. Enrico Caruso ( ), italienischer Opernsänger Aufbewahrt Die Sprache ist der Vorrat aller in einem Land möglichen Lebensqualitäten. Martin Walser, *1927 Wenig geeignet Sprache ist ein unvollkommenes Werkzeug. Die Probleme des Lebens sprengen alle Formulierungen. Antoine de Saint-Exupéry ( ) Humor Die Deutschen finden alles komisch. Sie liegen an erster Stelle der Humorliga. Richard Wiseman, *1966, britischer Psychologe Paradox In keiner Sprache kann man sich so schwer verständigen wie in der Sprache. Karl Kraus ( ) Werkzeug Sprache ist gleichsam der Leib des Denkens. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Gefahr Die großen Dinge haben einen tödlichen Feind: die großen Worte. Hans Krailsheimer ( ), deutscher Schriftsteller Großartig Viele Deutsche sind einfach großartig: ihr Glaube an den Frieden, ihre Tüchtigkeit, ihr Einfalls- und Erfindungsreichtum. Michael Moore, *1954, US-Regisseur Foto: David Shankbone Wahrer Zweck Die Menschen scheinen die Sprache nicht empfangen zu haben, um die Gedanken zu verbergen, sondern um zu verbergen, dass sie keine Gedanken haben. Søren Kierkegaard ( ), dänischer Philosoph Auswahl: Gerd Schrammen
16 SCHÖNES DEUTSCH Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 16 FLUCHT UND UNGEWISSE ANKUNFT Foto: Walter Rademacher/Wikipedia Sie alle fliehen von irgendwo. Die ostpreußische Gutsherrin Hildegard von Kamcke vor den näher rückenden Russen. Deren Nichte Anne vor der neuen Geliebten ihres Freundes. Die sonntäglichen Besucher des Bauerndorfs aus dem Leerlauf ihres Großstadtlebens. Und irgendwo kommen sie an. Aber kein freudiger Empfang wird ihnen zuteil, sondern ruppige Ablehnung. Von mi gift dat nix, erklärt die Bäuerin in dem Dorf an der Elbe, bei der Hildegard unterkommt. Mit der kleinen Tochter schläft sie in der Gesindekammer und stiehlt Milch frisch von der Kuh und Äpfel, um nicht zu verhungern. Anne wird von einem einheimischen Bauern unwirsch zurechtgewiesen, als sie ihren Wagen an der falschen Stelle parkt. Die Erzieherinnen im Kindergarten rümpfen die Nase über die Kopfläuse ihres Sohns Leon. Vera, das Kind aus dem Osten, wird in der Schule als Polackenbalg beschimpft. Mit Fausthieben, hervorragenden Leistungen und später als Zahnärztin verschafft sie sich Respekt. Aber sie bleibt eine Fremde unter den Dorfbewohnern. Das Bauernhaus, das Vera erbt, ist die erzählerische Mitte von Dörte Hansens Roman Altes Land. Hier laufen die Handlungen zusammen und finden die Figuren zueinander. Aber das alte Haus mit dem Schilfdach und den verwitterten Fensterrahmen hat wenig Anheimelndes. Es ist kein Hafen des Friedens für die Gestrandeten. Dit Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nennt't ook noch sien, steht über dem Eingang. Es gewährt seinen Bewohnern nur einen vorübergehenden Aufenthalt. Drinnen ist es kalt und ungemütlich. Die Dielen und Balken knacken und knarren. Das Dach ist undicht. Nach einer Sturmflut steht auch mal das Wasser des großen Flusses in Küche und Stube. Ein Zuhause mit Abstrichen. Und die Menschen, die es beherbergt, werden heimgesucht von schrecklichen Erinnerungen, die unausrottbar lebendig sind. Sie überwuchern alles, was das alte Haus an Geborgenheit geben könnte. Karl, der Sohn der Besitzerin, wacht schreiend auf aus nächtlichen Alpträumen und liegt weinend im Bett. Er flieht immer wieder vor Soldaten der Roten Armee. Vera kann die Schrecken der Flucht nicht vergessen, die ins Eis einbrechenden Fuhrwerke, die Todesschreie der Pferde. Die Toten im Straßengraben und die mit schiefen Hälsen, die an den Bäumen hingen. Und den Kinderwagen mit dem erfrorenen Bruder, den die Mutter einfach stehenließ und weiter ging. Aber die alten Häuser mit vernachlässigten Gärten und verkrüppelten Bäumen, auf denen untergegangene Apfelsorten wachsen, locken Stadtbewohner an. Schickimicki-Frauen aus Hamburg und zweitklassige Journalisten. Sie ernähren sich von Tofuwürstchen und schwärmen von selbstgemachtem Holunderblütengelee. Dörte Hansen führt manchen spöttischen Seitenhieb gegen diese Leute, die Vollwertmütter aus dem Stadtteil Ottensen, die sich von ihren Kindern mit dem Vornamen anreden lassen. Anne ist gern aus diesem Milieu geflohen. Kinder, die Clara- Feline oder Nepomuk heißen, hat sie in der musikalischen Früherziehung betreut. Die Kleinen sabbern mit Lust in ihre Flöten und hämmern auf Xylophone. Weil sie am Keybord unterfordert sind, werden sie auf Harfe oder Flügelhorn umgeschult. Auf dem Land ist manches besser als in der großen Stadt mit all ihrem verkrampften Firlefanz. Das ist die diskrete Botschaft der munteren und doch ernsten Geschichte über Menschen in der Elbmarsch und im nahen Hamburg. Aber das Dorf und seine kernigen Bewohner, die in Gummistiefeln auf dem Traktor sitzen und Pflanzenschutzbrühe sprühen, sind keine heitere Idylle. Es gibt gegenseitige Hilfe zum Beispiel bei der Herstellung von Rehwurst, freundliche Nachbarschaft, gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen, eine gewisse Unbefangenheit im Umgang der Menschen miteinander. Aber auch Engstirnigkeit und Häme. Nackt in der Elbe baden, ein Kopfsprung in Unterwäsche von der Lühebrücke oder am Strand sitzen und rauchen das geht zu weit! De kriggt keen af, sagen die Bauern über Vera. Eine alte Bäuerin pendelt irgendwann an einem Strick im Dachboden. Nach dem Schützenfest saniert eine Zahnärztin ein bißchen schadenfroh, so scheint es die zerschlagenen Zähne der Dorfburschen. Ein dahinsiechender Greis wird später an einer kräftigen Dosis Gift sterben, das der Tierarzt stiftet und gewöhnlich gebraucht wird, um verletzte Pferde einzuschläfern. Erlösung von unerträglichem Leid? Der alte Mann hat nicht darum gebeten. Freundliche Tötung? Aber das ist schon zu streng gefragt. Der Text läßt sich auf solche Überlegungen nicht ein. Auf dem Land gedeiht der Mensch besser als in der Stadt. Aber das alte Bauernhaus, das Dorf, die Blumen an den Zäunen, die blühenden Apfel- und Kirschbäume und der nahe Fluß sind keine heile Welt. Hüte Dich, lieber Leser, vor dieser Illusion. Das ist die andere diskrete Botschaft von Dörte Hansens Erfolgsroman Altes Land. Gerd Schrammen Von mi gift dat nix Vom Fachwerk der Fassade war die Farbe abgeblättert, und die rohen Eichenständer steckten wie graue Knochen in den Mauern. Die Inschrift am Giebel war verwittert, aber Vera wusste, was da stand: Dit Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nennt't ook noch sien. Es war der erste plattdeutsche Satz, den sie gelernt hatte, als sie an der Hand ihrer Mutter auf diesen Altländer Hof gekommen war. Der zweite plattdeutsche Satz kam von Ida Eckhoff persönlich und war eine gute Einstimmung gewesen auf die gemeinsamen Jahre, die noch kommen sollten:»woveel koomt denn noch vun jau Polacken?«Ihr ganzes Haus war voll von Flüchtlingen, es reichte. Hildegard von Kamcke hatte keinerlei Talent für die Opferrolle. Den verlausten Kopf erhoben, dreihundert Jahre ostpreußischen Familienstammbaum im Rücken, war sie in die eiskalte Gesindekammer neben der Diele gezogen, die Ida Eckhoff ihnen als Unterkunft zugewiesen hatte. Sie hatte das Kind auf die Strohmatratze gesetzt, ihren Rucksack abgestellt und Ida mit ruhiger Stimme und der korrekten Artikulation einer Sängerin den Krieg erklärt:»meine Tochter bräuchte dann bitte etwas zu essen. «Und Ida Eckhoff, Altländer Bäuerin in sechster Generation, Witwe und Mutter eines verwundeten Frontsoldaten, hatte sofort zurückgefeuert:»von mi gift dat nix!«vera war gerade fünf geworden, sie saß frierend auf dem schmalen Bett, die feuchten Wollstrümpfe kratzten, der Ärmel ihres Mantels war getränkt vom Rotz, der ihr unaufhörlich aus der Nase lief. Als es dunkel wurde und im Haus alles ruhig war, schlich Hildegard durch die Diele nach draußen. Sie kam zurück mit einem Apfel in jeder Manteltasche und einem Becher kuhwarmer Milch. Als Vera ausgetrunken hatte, wischte Hildegard den Becher mit ihrem Mantelsaum aus und stellte ihn leise zurück in die Diele, bevor sie sich zu ihrer Tochter auf die Strohmatratze legte. Zwei Jahre später kam Karl Eckhoff heim aus russischer Gefangenschaft, das rechte Bein steif wie ein Knüppel, die Wangen so hohl, als hätte er sie nach innen gesogen, und Hildegard von Kamcke musste ihre Milch noch immer stehlen. Van mi gift dat nix. Ida Eckhoff war ein Mensch, der Wort hielt, aber sie wusste, dass die Person jede Nacht in ihren Kuhstall ging. Irgendwann stellte sie neben den Becher in der Diele eine Kanne. Es musste beim nächtlichen Melken nicht auch noch die Hälfte danebengehen. Sie zog den Schlüssel für das Obstlager abends nicht mehr ab, und manchmal gab sie dem Kind ein Ei, wenn es mit dem viel zu großen Besen die Diele gefegt oder ihr beim Bohnenschneiden Land der dunklen Wälder vorgesungen hatte.
17 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 17 SCHÖNES DEUTSCH Ausgeliebt Bis sie die Kleiderkisten und Bücherkartons, ihr Fahrrad, Leons Laufrad, die große Spielzeugtonne und ihre Zimmerlinde in den gemieteten Transporter geschafft hatte, war es früher Nachmittag. Es hupte draußen auf der Straße, zweimal kurz, und Christoph ging. Sprang auf von seinem Küchenstuhl und rannte fast den Flur entlang, er zog dann vorsichtig die Tür ins Schloss, um Leon nicht zu wecken. Anne hatte keine Ahnung, wie eine Fiat-Hupe klang, sie ging auch nicht zum Fenster, sie wollte gar nicht sehen, wie er ins Auto stieg, wollte vor allem nicht gesehen werden. Die Verlassene am Fenster, was für ein jämmerliches Bild. Die letzten langen Tage miteinander hatten sich angefühlt wie die Proben für ein neues Theaterstück. Das ausgeliebte Paar in seiner alten Wohnung. Die Rollen waren verteilt, aber die Texte saßen noch nicht. Unbeholfen spielten sie den alten Klassiker vom Lieben und Verlassen. Der Betrüger, die Betrogene, das Kofferpacken, das Bilderabnehmen, das Schreien, das Flüstern, das Weinen, die roten Augen, die blassen Gesichter. Ein Drama aus Fertigteilen, dachte Anne, größer haben wir es nicht. Sie war jetzt froh, dass es zu Ende war. Dass sie rauskam aus dieser Wohnung, aus der Stadt, weg von dem verdreckten Taubentunnel, nie wieder mit nervösen Müttern auf dem Spielplatz sitzen, den Mann in seinen weißen Hemden nicht mehr sehen. Sie würde über Felder gehen. Das Weite suchen. Vera Eckhoff wusste nicht viel von ihrer Nichte, aber sie erkannte einen Flüchtling, wenn sie einen sah. Die Frau, die da mit zusammengeschnürtem Gesicht ihre paar Kartons aus dem gemieteten Transporter holte, suchte eindeutig mehr als eine neue Erfahrung und etwas frische Luft für ihren Sohn. Da draußen auf dem Kopfsteinpflaster standen zwei Unbehauste. Und ein Tier in einer Plastikbox, die der kleine Junge gerade zur Dielentür zerrte. Anne hatte ihren Sohn eingepackt wie eine Made. Der Kleine konnte sich kaum bewegen in seinem dicken Schneeanzug, die Arme standen ihm seitwärts vom Körper ab, und die Beine scheuerten beim Gehen aneinander. Vera wusste plötzlich wieder, wie sich das anfühlte: in fünf Lagen Kleidung verpackt vor diesem Haus zu stehen, das keine Fremden mochte. Weggejagt oder weggerannt, Bollerwagen oder Kleintransporter, das machte keinen großen Unterschied. Als sie durch die Diele ging, um die große Tür zu öffnen, sah sie Ida Eckhoff vor sich. Ihr wütendes Gesicht am Tag, als die Polacken kamen. Großstadt-Elsen Dirk zum Felde hatte die Schnauze voll von Idioten in teuren Gummistiefeln, die unbedingt aufs Land ziehen mussten. Es kamen immer nur die Ausgemusterten, die es in der Stadt nicht geschafft hatten. Akademiker und Kreative der Güteklasse B, zu angeschlagen für das Großstadtsortiment. Gesellschaftliche Ladenhüter, die auf dem Bauernmarkt noch einmal durchstarten wollten. Am Anfang, als die Ersten kamen und er noch nicht ahnen konnte, dass eine ganze Invasionswelle folgen sollte, hatte er noch hin und wieder klargestellt, dass er selbst mal studiert und in WGs gewohnt hatte. Dass er nicht der Depp mit dem Diplom von der Baumschule war, für den sie ihn und alle anderen Alteingesessenen hier offenbar hielten. Es hatte eine Weile gedauert, bis er kapiert hatte, warum sie das nicht hören wollten. Weil er ihnen das Panorama versaute. Ein diplomierter Agrarwissenschaftler, der mit moderner Landtechnik einen Altländer Obsthof bewirtschaftete, der Pflanzenschutzmittel auf seine Apfelbäume sprühte und sie einfach absägte, wenn sie nicht mehr trugen das war wie eine vierspurige Autobahn in einem Heimatfilm. Er passte nicht ins Bild. Er störte sie. Und sie störten ihn! Die verpeilten Kreativen, die aus den Städten in die Dörfer strömten, um sich zu erden, und dann tigerten sie mit ihren Golden Retrievern durch die Obstfelder und lungerten vor verfallenden Resthöfen und Landarbeiterkaten herum, und wenn dann noch Frühling war und sich irgendwo in einem verstrüppten Garten ein altersschwacher Apfelbaum zu seiner letzten Blüte aufraffte, dann gab es keinen Weg zurück. Dann hatten sie Blut geleckt und setzten sich wie die Zecken hier fest. Diese verspannten Großstadt-Elsen mit ihren Sinnkrisen quengelten um marode Reetdachhäuser wie ihre Töchter früher um ein Pony. Es war so süß! Sie mussten es haben! Sie würden sich auch immer darum kümmern! Und dann fingen sie an, die Backstein-Ruinen für ein Schweinegeld aufzumöbeln und ihre Bauerngärten anzulegen und in den alten Ställen Keramikwerkstätten einzurichten. Und wenn sie dann noch immer nicht kuriert waren, kauften sie Schafe und fingen an, ihren eigenen Käse zu machen, und alle, ausnahmslos alle diese neuen Landmenschen kochten, wie unter einem heimlichen Zwang, Gelee aus alten Apfelsorten. Und dann kam er, Dirk zum Felde, mit seinem Traktor und dem Sprühwagentank voll Funguran, um seine hochgezüchteten Apfelbäume gegen Pilzbefall zu spritzen, und fuhr ihnen mitten durch ihr Freilichtmuseum. Sie war ein Moos Dann saß sie draußen auf der Bank, bis die Mückenschwärme aus den Gräben kamen, sie trank den Wein, der von der letzten Nacht noch übrig war. Es war noch hell, als sie sich in die Küche setzte. Sie sah den Mond aufgehen vor ihrem Küchenfenster. Traute dem Frieden fast. Wollte das Knacken erst nicht hören. Sie rief die Hunde zu sich. Ein alter Balken oder ein Knochen, der brach oder gebrochen wurde. Ein Huschen über ihrem Kopf. Ein Tier oder ein Wind und müde Tänzer, die über den Boden schlurften mit ihren schweren Füßen. Und eine Stille, die bis hundert zählte. Ein Flattern vor der Küchentür, ein Flüstern aus den Mauern. Oder ein Atmen. Schwere Stühle, die geschoben wurden über rohe Böden. Ein Chor aus alten Stimmen sang sich leise ein. Man durfte nicht alleine sein in diesen Häusern, sie waren dafür nicht gebaut. De no mi kummt, es kam niemand nach ihr, sie fiel. Unter den alten Stimmen lag eine Stille, die noch älter war, alt und dunkel wie das Meer oder das All, das Fallen hörte nicht mehr auf, ein Fallen aus der Welt, wie losgelassen, es hielt sie keiner mehr. Unmöglich, Karl zu finden in dem tiefen Schwarz, er war hinabgesunken auf den Grund, wenn es ihn gab, den Grund, wenn nicht das Sinken einfach weiterging. Etwas rollte, etwas Kleines, eine Kugel, eine Spule. Oder ein Silberknopf von einer alten Tracht. Oder sie selbst, die nur ein Spielzeug war, ein kleiner Kreisel, den das Haus in seinen dicken Wänden drehte. Ein Kind, das weinte. Oder Katzen, die draußen wimmerten, Nachtvögel, die schrien, Vera konnte nicht mehr aus der Küche gehen, nicht in die Diele, wo ein Spalier aus bösen Stimmen stand. Wo die Soldaten gingen, mit denen Karl marschiert war, jahrzehntelang in seinen Nächten, er hatte sie ihr alle dagelassen. Und Ida tanzte schlafend über ihr, und all die anderen, die sie nicht kannte, die hier geatmet hatten und gestorben waren. Dit Huus is mien un doch nich mien sie konnte hier nicht weg. Sie war ein Moos, das nur an diesen Mauern hielt. Das hier nicht wachsen konnte oder blühen, aber doch bleiben. Sie war ein Flüchtling, einmal fast erfroren, nie wieder warmgeworden. Ein Haus gefunden, irgendeins, und dort geblieben, um nur nicht wieder in den Schnee zu müssen. Die Elbe war gefroren in ihrem zweiten Winter hier im Alten Land, die Kinder gingen auf das Eis, Hinni Lührs mit seinen Brüdern, Hans zum Felde und die dicken Pape-Schwestern.»Vera, komm mit.«dem Eis war nicht zu trauen, sie hatte es zerbrechen sehen und Menschen, die versanken. Manche waren stumm unter das Eis geglitten, sie hatten kein Geräusch gemacht, als hätte man den Menschen das Schreien unterwegs schon abgewöhnt, am schlimmsten schrien die Pferde. Alles konnte man vergessen, wenn man es wirklich wollte, auch Vera Eckhoff konnte das. Vergaß das Knirschen der Schuhe im tiefen Schnee, das Dröhnen der Flieger, die Köpfe der Piloten, die man sehen konnte, wenn sie über das Eis geflogen kamen. Vergaß, wie rot und hell die Dörfer brannten, vergaß die Vogelscheuchen mit den schiefen Hälsen, die in den Bäumen hingen, all die verdrehten, stillen Körper in den Straßengräben. Vergaß den kleinen Bruder in seinem kalten Kinderwagen, sogar die Puppe, ihre Puppe, die bei ihm lag auf seinem weißen Kissen, die Vera nicht mehr holen durfte, als sie den Kinderwagen stehen ließen, weil Hildegard sie einfach weiterzog. Einfach weg von ihrer weichen Puppe mit den echten Haaren, das Christkind hatte sie gerade erst gebracht. Alles konnte man vergessen, nur wie die Pferde schrien, das vergaß man nicht. Dörte Hansen: Altes Land. München (Knaus) S. ISBN ,99 Euro
18 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) DENGLISCH 18 Fear Buchstaben an der Berliner Schaubühne Vor kurzem hörte ich von einem Stück namens Vier an der Schaubühne in Berlin. Ich geriet ins Grübeln, zog den Spielplan zu Rate und wurde fündig beim Stück Fear von Falk Richter. Es beschäftigt sich mit der Flüchtlingsproblematik und damit, wie die Deutschen auf sie reagieren. In einem Radio-Interview vom Februar d. J. zeigte sich Richter davon überzeugt, dass die meisten Deutschen den Flüchtlingen offen und hilfsbereit entgegenkommen und glücklicherweise nur relativ wenige doch immer noch viel zu viele es für nötig halten, stattdessen ihre Unterkünfte auszuräuchern. Richter möchte mit seinem Stück aber wohl nicht nur die überwältigende Mehrheit der Deutschen, sondern hoffentlich auch deren brandschatzende Minderheit erreichen. Warum verpasste er seinem Stück Das Leben als giving-story Der 22. März 1996 gilt vielen als die eigentliche Geburtsstunde des VDS. An diesem Tag erschien das Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es enthielt ein legendäres Interview mit der Hamburger Damenschneiderin Jil Sander, hier auszugsweise nochmals nachgedruckt. trotzdem einen derart un- und missverständlichen englischen Titel? Nur ein verständlicher und pointiert formulierter Titel regt doch potenzielle Besucher an, sich das Stück, für das er werben soll, genauer anzuschauen. Den Titel Fear versteht spontan weder die freundliche Bevölkerungsmehrheit und erst recht nicht ihre brandschatzende Minderheit. Es ist grotesk und es erschwert die Rezeption dieses hochaktuellen Stückes, dass sein Titel in einem deutschsprachigen Willkommens- und Rezeptionsumfeld auf Englisch daherkommt. Will Richter tatsächlich, dass ich mich meinen Bekannten immer erst umständlich erkläre etwa so: Also, liebe Leute, es geht in diesem Stück nicht um die Zahl vier, sondern um fear. Das ist ein englisches Wort, das nur so ähnlich klingt. Ich weiß nicht, ob damit Furcht oder Angst oder was auch immer gemeint sein könnte. Ich weiß nicht einmal, ob es ein deutschsprachiges Stück ist.? Eine ähnliche Betrachtung ließe sich auch mit Blick auf die mehrheitlich englischen Titel der anderen Stücke Richters anstellen. An wen also könnte sich Richters Stück Fear richten? Womöglich nur an eine elitäre Gruppe selbst ernannter Weltbürger, die das Englische ausreichend gut beherrschen, um sich Fear sinngetreu (als Angst und/ oder Furcht?) in eine deutschsprachige Konnotation zu übertragen? Jedenfalls scheint ihn die Motivationsstruktur der xenophoben Brandschatzer, die ihm angeblich Sorgen bereiten, kaum zu interessieren. Als abschreckende Akteure auf der Bühne sind sie ihm Argument genug. Mindestens einen nennt er sogar persönlich, was dieser (erfolglos) juristisch anfocht. Fazit: Der Autor Richter hat offenbar eine zu allem entschlossene Minderheit von Deutschen, die ihm zu Recht Sorge bereiten, als mögliches Publikum schon vergessen und entsorgt. Fear ließe dann befürchten, was viel zu viele Sorgenträger längst zu wissen glauben: Hier (z. B. auf der Bühne) stehen die eindeutig Bösen am Pranger, dort (z. B. im Publikum) sitzen die eindeutig Guten zu Gericht. Richters Fear hätte dann die aktuelle Aufmerksamkeit nicht nur völlig zu Unrecht erhalten, sondern wäre sogar schädlich, weil er mutwillig polarisiert sofort erkennbar an seiner weltbürgersüchtigen englischen Titelei. Hermann H. Dieter Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Das Stück Fear von Falk Richter läuft derzeit an der Berliner Schaubühne. Es geht darin um die Angst vor Fremden, Angst davor, von Politik und Medien belogen zu werden, eigene Privilegien zu verlieren. Ob es sich aber um ein deutschsprachiges Stück handelt, verrät der Titel nicht. Foto: Arno Declair
19 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 19 BÜCHER Der Anglizismen-Index 2016 Jede lebende Sprache entwickelt sich ständig weiter und wird dabei von anderen Sprachen beeinflusst. Die deutsche Sprache ist da keine Ausnahme. Bedingt durch die Globalisierung und den immer engeren Kontakt mit anderen Ländern hat der deutsche Wortschatz hinsichtlich verschiedener Lebensbereiche in den letzten Jahrzehnten eine schnelle Entwicklung genommen. Die deutsche Sprache besitzt eine spezielle Eigenschaft. Sie verfügt über eine Genauigkeit, wie sie sonst nur sehr wenige andere Sprachen vorweisen können. Deutsche Wörter sind aussagekräftig, meistens selbsterklärend und sogar ohne Kontext verständlich. Warum soll man das nicht nutzen und mit einem Wort sagen, was man sonst mit einer ganzen Phrase sagen würde? Warum soll man nicht Ruheraum statt chill-out room sagen? Oder Mobilbuchung statt touch & travel? Hier hilft der Index. Im Mai wurde die neue Ausgabe des Anglizismen-Indexes veröffentlicht. Verantwortlich dafür sind der Verein Deutsche Sprache, der Sprachkreis Deutsch in Bern und der Verein Muttersprache in Wien. Der Index listet fast alle englischen Wörter in der deutschen Sprache auf, die über eine nennenswerte Verbreitung verfügen. Für die meisten Wörter bietet er passende deutsche Alternativen an. Gibt es kein passendes deutsches Wort, wird der Begriff einfach nur erklärt. Der Index hat das Ziel, seine Benutzer anzuregen, statt Anglizismen deutsche Wendungen zu benutzen. Dabei beabsichtigen die Herausgeber auch die deutsche Sprache als Kulturgut zu beschützen, in dem sie den Gebrauch überflüssiger Anglizismen zu hemmen versuchen. Insgesamt enthält der Anglizismen-Index Wörter oder Wortbestandteile aus dem Englischen. Aber nicht alle eingetragenen Wörter werden kritisch betrachtet. Viele Anglizismen werden sogar als Bereicherung für die deutsche Sprache angesehen. Diese Veröffentlichung ist eine nützliche Hilfe für diejenigen, die in ihren Texten englische Ausdrücke vermeiden möchten und sich um gutes Deutsch bemühen. Im letzten Teil des Buches finden sich darüber hinaus auch einige wertvolle Artikel zum Themenkreis Anglizismen in der deutschen Sprache. Holger Klatte zeigt anschaulich, wie leicht und wie gut es sich mit dem Index arbeiten lässt. Heinz- Günter Schmitz zeigt die Schwachstellen des deutschen Sprachbewusstseins auf und erklärt so, wie es überhaupt zu vielen Anglizismen kommen konnte. Franz Stark diskutiert sachlich das Verhältnis der etablierten Sprachwissenschaft zum Anglizismenphänomen. Carolina Hidalgo (Lima) Der Anglizismen-Index. Ausgabe Herausgeber: Verein Deutsche Sprache, Dortmund, Sprachkreis Deutsch, Bern, Verein Muttersprache, Wien. Paderborn: IFB Verlag Deutsche Sprache 2016., 310 Seiten, 16,00 Euro. ISBN ANZEIGE SCHÖNE BÜCHER Markus Schröder Sie haben vier Ohren! Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 67 Seiten, 8,65 Euro, ISBN Dieses Buch richtet sich an alle, die wissen möchten, woran es liegt, dass wir manchmal nicht mehr wissen, warum und worüber wir eigentlich streiten oder wieso unsere Verständigung plötzlich so schwierig wurde. Sie werden erfahren, dass Sie zwei Ohren mehr besitzen als Sie bisher glaubten, und dass diese Mutation dazu beiträgt, uns immer wieder gegenseitig misszuverstehen. Karl Otto Edel Die deutsche Sprache in der Wissenschaft Wandel, Wirkung und Macht 523 Seiten, 39,90 Euro, ISBN Wenn jemand den Vorschlag machte, die Gebäude der Humboldt-Universität in Berlin abzureißen, ginge ein Sturm der Entrüstung durch das Land. Wenn aber viele Beamte daran arbeiten, den wertvollsten Inhalt dieser Gebäude zu zerstören, hält sich die Empörung in Grenzen. Tatsächlich ist die deutsche Wissenschaftssprache massiv unter Druck geraten. Ohne Not und Gegenleistung lässt es Deutschland zu, dass die deutsche Sprache als Trägerin epochaler Erkenntnisse durch ein billiges Globisch abgelöst wird, das weltweit nur Kopfschütteln auslöst. Was passiert da eigentlich? Auf was verzichten wir denn da? Was heißt eigentlich Deutsch als Wissenschaftssprache? Professor Edel gibt in seinem Werk umfassende fundierte Antworten. Das Buch lässt uns teilhaben am mitreißenden Aufstieg der deutschen Wissenschaftssprache sowie an den zahlreichen Auseinandersetzungen um ihre Stellung. Wir lernen, dass wir etwas ganz Großes verlieren können. (Deutsche Sprachwelt) Edelsteine 107 Sternstunden deutscher Sprache vom Nibelungenlied bis Einstein, von Mozart bis Loriot Herausgegeben von Max Behland, Walter Krämer und Reiner Pogarell 671 Seiten, 25,00 Euro, ISBN Eine ungeheure Fülle großer Texte in deutscher Sprache. Anregend kommentiert und verständlich erklärt. Ein Lesevergnügen mit garantierten Aha- Erlebnissen. 107 Begegnungen u. a. mit einem gotischen Bischof, einer Magdeburger Nonne, einem Arzt aus der Schweiz, einem Weimarer Minister, zwei Göttinger Wissenschaftlern, einigen Komponisten, den Erfindern des Automobils und des Elektrorechners, einem Staatsgründer aus Wien, zwei Psychotherapeuten, einem Rundfunkreporter, der in 90 Minuten ein Land veränderte, einem Bielefelder Liedermacher und einem Knollennasenzeichner. So kann man sich auch durch Epochen, Erfindungen und Befindlichkeiten blättern. Man liest mit dem «Abrogans» das erste Wörterbuch der deutschen Sprache und in «Notkers Brief an den Bischof Hugo von Sitten» den Ausdruck «unsere Sprache» und freut sich, dass nicht Latein, sondern das Alemannische gemeint ist. Das Blättern wird auch zur Reise in die Sprach- und Stilgeschichte. Und begleitet von immer grösserem Staunen über das, was mit Sprache möglich ist. Denn tatsächlich erlebt man «die deutsche Sprache in ihrer ganzen Pracht und Schlichtheit, in ihrer Vielfalt und Genauigkeit, in ihrer Schönheit und ihrem Witz», wie das Vorwort verspricht. (St. Galler Tagblatt) Edelsteine überzeugt durch die bunte Auswahl und die hohe Qualität der Begleittexte. Es ist ein Buch nicht nur für Germanisten, sondern ein Werk, das einem breiten Publikum sehr zu empfehlen ist. (Der Nordschleswiger) Zu bestellen beim IFB VERLAG DEUTSCHE SPRACHE Schulze-Delitzsch-Straße 40, Paderborn; Telefon
20 BÜCHER Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 20 Streitfall Leichte Sprache Das Lesen und Schreiben sind Erfolge der Kultur, nicht der Biologie. Das Thema Leichte Sprache ist geeignet, auch ansonsten friedliche Sprachfreunde heftigst gegeneinander aufzubringen. Vielleicht nicht ganz so heftig wie der Genderwahn, aber immerhin. Gemeint ist damit ein nur wenige Jahre altes Konzept, Dokumente so zu konstruieren, dass sie auch von Bürgern mit Leseschwierigkeiten verstanden werden (aus dem Vorwort). So hat etwa der Verein Deutsche Sprache zusammen mit der Eberhard-Schöck- Stiftung dem Kasseler Verein Mensch zuerst e.v. den Initiativpreis Deutsche Sprache des Jahres 2009 verliehen. Und zwar für den Einsatz für leichte Sprache in der Öffentlichkeit. Mensch zuerst e.v. möchte Menschen mit Lernschwierigkeiten die Teilhabe am öffentlichen Leben erleichtern und verhindern, dass sie aus sprachlichen Gründen sozial ausgegrenzt werden. Die Jury erblickt darin einen sub stantiellen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache, nämlich im Hinblick auf ihre Verständlichkeit. Auf der anderen Seite hatte eine in leichter Sprache verfasste Wahlbenachrichtigung des Landes Bremen im Jahr 2015 zu einem wahren Entrüstungssturm geführt. Beide Reaktionen sind verständlich. Menschen in leichter Sprache anzureden, die ansonsten überhaupt nichts verstehen würden, ist etwas völlig anderes, als diese leichte Sprache so wie in Bremen quasi zum Standard zu erklären. Umso wichtiger erscheint daher die Klärung der Frage, wodurch sich leichte Sprache definiert, wem sie hilft, wem nicht, wie sie funktioniert und vor allem auch: wie sie nicht funktioniert. Das alles findet der Leser hier auf 251 Seiten von einem anerkannten Experten äußerst benutzerfreundlich ausgeführt, inklusive einer ausführlichen Würdigung der inzwischen doch recht umfangreichen einschlägigen Literatur. Und das Allerschönste: das Buch kostet nichts, es kann, einen Rechner und einen Netzanschluss vorausgesetzt, von der Netzseite de/texte/es.html heruntergeladen werden. Walter Krämer Andreas Baumert: Leichte Sprache Einfache Sprache. Literaturrecherche Interpretation Entwicklung. Hannover S., URN urn:nbn:de:bsz:960-opus Der Wortsammler Wenn das Kastenbrot zum Brotkasten, die Soldatenkinder zu Kindersoldaten und die Schocktherapie zum Therapieschock wird, haben wir es mit einer ganzen Reihe an Wortbildungen zu tun. Wortbildungen gehören zur deutschen Sprache wie der Kaffeefilter zum Filterkaffee, sie bilden eine zentrale Form der Lexik ganz nach dem Motto: Wortschatzerweiterung durch Komposita. Die zusammengesetzten Wörter bilden Spiegelpaare 330 dieser Spiegelpaare hat Kaspar Snell in seinem Werk Wortzauber Zauberwort zusammengetragen. Die meisten Spiegelpaare sind aus Substantiven zusammengesetzte Substantive (Mädchenfreuden Freudenmädchen). Hier und da finden sich Adjektive (haftkrank krankhaft) und Mischpaare (Rotwein weinrot). Die Spiegelwörter sind jeweils in Kreisform dargestellt, somit wird die Gleichwertigkeit der Worthälften ausgedrückt, da nicht vorgegeben wird, welches der Doppelwörter zuerst gelesen werden soll. Die Lektüre verleitet dazu, nach unentdeckten Spiegelpaaren zu suchen. Nasanin Ates Wortzauber Zauberwort. Die 333 schönsten Spiegelpaare der deutschen Sprache. Logo Verlag, 112 S., 12 Euro. ISBN ANZEIGE Tractatus absolutus Selbstaufklärung des Denkens 2. Auflage 896 Seiten 29,00 ISBN Aus der Erfahrung, daß sich alles von ihm Gedachte immer mer wieder zerdenken ließ, hat der Verfasser r einen Standpunkt gewonnen ( Ist etwas zu sagen? An sich ist nichts zu sagen ), von dem aus diese zunächst anstößige Erfahrung verständlich ist und alles bisherige Denken zunächst nur das eigene Denken des Verfassers, dann aber auch das aller Anderen als naiv erscheint. Jetzt 15 Dieser Standpunkt ist zugleich eine neue und vielleicht letzte Stufe eines historischen Weges, der mit der frühgriechischen Philosophie (Vorsokratik) beginnt. Während der Kern des Tractatus sozusagen ungegenständlich ist, werden in den weiteren Verzweigungen alle klassischen Gegenstände des Denkens Raum, Existenz, Begriff, Welt, Ding, subjektivobjektiv, Ich, Moral u. a. in der gehörigen Ordnung entwickelt und dargestellt. Warnung! Ein Leser, der an Wortgebilde wie kognitive Relevanz, taxonomische Interdependenz oder auch basic relations gewöhnt ist, wird bald an Entzugserscheinungen leiden. Bücher von Johannes Dornseiff Sprache, wohin? Bemerkungen eines Sprachteilnehmers 2. Auflage 288 Seiten 12,90 ISBN Die Sprache hat, vor allem in den letzten Jahrzehnten, schlimme Entwicklungen genommen, die man weitgehend als Schwächung oder als Verschmutzung bezeichnen kann; ersteres vor allem in der Grammatik (z. B. Viele würden die Gefahr leider noch unterschätzen), letzteres vor allem im Wortgebrauch (z. B. schwul oder die Menschen bei den Reformen mitnehmen). [Zur Wortschatzverschlechterung gehört auch die Fremdwörterei, die graecolateinische und mehr noch die englische.] Der Verfasser stellt den verdorbenen Sprachgebrauch an den Pranger und zeigt zugleich, daß man sich davon freihalten kann; darüber hinaus, daß auch Sprachbereicherung möglich ist. Im Anhang wird die Rechtschreib reform zerpflückt. Verbesserungen: [da würden sie noch heute wohnen] : da wohnten sie noch heute [bräuchte] : brauchte [nichtsdestotrotz] : nichtsdestoweniger Das hatte ich [echt] nicht erwartet. : wirklich [blauäugig] : naiv kamen drei [Menschen] ums Leben : Personen Wir müssen diesen [Menschen] helfen. : Leuten [Ängste] : Angst, Befürchtungen Wir [danken für Ihr Verständnis]: bitten um Verständnis (Nachsicht) Herz[probleme] : Herzbeschwerden [Bürgerinnen und Bürger] : 1. Bürger und Bürgerinnen 2. Bürger [Recycling] : 1. Rezyklierung 2. Rückverwertung [Ticket] : Karte, Fahrkarte, Eintrittskarte [Job] : Stelle, Arbeit, Beruf, Amt es [macht] keinen Sinn : hat [Nutzer] : Benutzer [ethisch] : moralisch [maximal] : höchstens [authentisch] : echt [Region] : Gegend Neubildungen: querab (= senkrecht zur Bewegungsrichtung), Stehbleibfehler (versehentlich nicht mitgetilgt), Bestuch (= sich bestechen lassen), sich anherzen, Hindernisse und Fördernisse, Multikulti und Rassamassa Recht und Rache Der Rechtsanspruch auf Wiederverletzung 256 Seiten 14,00 ISBN Nachdem er die Fundamente gefühltes / zu fühlendes Recht und gerechter / be- rechtigter Anspruch gelegt hat, geht der Verfasser den letzteren Schritt für Schritt durch, vom Rechtsanspruch auf den gleichen Anteil bis zum Rechtsanspruch auf Wiederverletzung. Jetzt 10 Hier erörtert und widerlegt er zunächst den Ausgleich durch gleiche Wiederverletzung, dann die Einwände gegen die Wiederverletzung überhaupt ( unvernünftig, unmoralisch ). Im Anhang geht es um konkretere Themen wie Strafunmündigkeit, Selbstjustiz, Resozialisierung und Todesstrafe. Der Grundgedanke dieser Schrift ist, daß Recht und Rache zusammenhängen und daß dies nicht gegen das Recht, sondern für die Rache spricht. Auszüge aus diesen Büchern unter
21 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 21 VDS-INTERN VDS-Mitglieder einmal anders Eberhard Görner Für gutes Deutsch in der Schule In der Liste der prominenten Vereinsmitglieder auf den VDS-Netzseiten findet sich Eberhard Görner zwischen Volkhard Germer, dem Ex-Oberbürgermeister von Weimar, und dem bekannten Kirchenmusiker und Kantor der Dresdner Frauenkirche Matthias Grünert. Überhaupt auf diese Liste gekommen ist der Buch- und Drehbuchautor, Dramaturg, Dokumentarfilmer, Hochschullehrer, Publizist und medialer Multikönner Görner, weil ihn die meisten weit besser kennen als sie wissen: Eberhard Görner war der wichtigste Macher hinter der DDR-Kultkrimiserie Polizeiruf 110, die ja bis heute im ersten Programm der ARD erfolgreich weiterlebt. In Heft 4/2014 rezensierten die Sprachnachrichten Görners vorletztes Buch Veronika, der Lenz ist da, eine Biografie des Wiener Komponisten Walter Jurmann, der vor den Nazis nach den USA flüchten musste und vielen älteren Vereinsmitgliedern außer durch obigen Gassenhauer auch durch zahlreiche Filmmusiken in Erinnerung ist. Weitere neuere Bücher mit fünfstelligen Verkaufszahlen sind Ein Himmel aus Stein ( 2005), Der Narr und sein König (2009), Die Kavaliersreise August des Starken (2012) oder Abenteuer Afrika (2014). Aktuell ist Görner zusammen mit dem aus DEFA-Indianerfilmen bekannten Schauspieler Gojko Mitic auf Lesetour für sein letztes Buch, den historischen Roman In Gottes eigenem Land. Heinrich Melchior Mühlenberg der Vater des amerikanischen Luthertums. Dieser Prediger, im Jahr 1742 von den Franckeschen Stiftungen nach Britisch-Nordamerika entsandt, ist Sprachfreunden auch bekannt als der Urheber des vermeintlich nur mit einer Stimme gescheiterten Antrags, Deutsch als Landessprache in den USA zu etablieren. Für das kommende Lutherjahr ist von den Landesbühnen Sachsen eine auf diesem Buch basierende deutsch-amerikanische Theaterproduktion geplant. Sein Eintreten für den VDS begründet Görner gerne mit folgendem Zitat von Ohne die deutsche Sprache wäre die Welt ärmer. Foto: privat Goethe: Jede Sprache ist für den Menschen eine Brücke zu Gott! War der Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache selbst. Darum müsse die Sprache, auch unsere deutsche, behütet und geschützt werden, denn sie ist Ausdruck einer hohen Kultur, ohne die unsere Welt ärmer wäre. Walter Krämer 8. Wettbewerb Werbewerke Zum achten Mal fand in Nürnberg die Aktion Anstoß Ein Buch für jeden Schulanfänger statt. Die Stadtbibliothek verschenkte Erstlesebücher an Erstklässler in Nürnberg. Dieses Jahr bekamen sie das Buch Ein schönes Geheimnis von Manfred Mai und Martin Lenz. Mit der Aktion soll die Leselust der Kinder gefördert und ein Zugang zu Bildung und Wissen durch Lesen und Vorlesen geschaffen werden. Gemeinsam mit der Manfred-Lochner-Stiftung hat der VDS das Projekt in diesem Jahr ermöglicht. Regionalleiterin Annette Scheil (oberes Bild rechts) vertrat den VDS bei der Buchübergabe und half beim Packen der Lesepakete für die Nürnberger Schulen. Werbung, die anspricht und nicht anstrengt sucht die Regionalgruppe 56 des VDS wieder mit ihrem Wettbewerb Werbewerke. Teilnehmer können bis zum (Einsendeschluss) Fotos von Werbeplakaten, Ladenschildern, Faltblätter oder Zeitungsanzeigen einsenden, die in originellem und aussagekräftigem Deutsch gehalten sind. Sprachrüffel gibt es für Firmen, die mit unnötigem Denglisch auffallen. Die besten Einsendungen beider Kategorien werden mit Geldpreisen von bis zu 400 Euro prämiert. Bilder zur Teilnahme am Wettbewerb Werbewerke und Begründungen bitte mit dem Betreff Wettbewerb Werbewerke schicken an: <borck@ obere-meerbach.de>.
22 VDS-INTERN Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 22 Sprache und Politik in Bremerhaven Das letzte Wochenende des Monats Mai hatte es in sich: Unwetter, Erdbeben, Stürme, Hagelschauer; in einem Dorf in der Pfalz schlug während eines Fußballspiels ein Blitz ins Feld, anderswo rissen Flutwellen Menschen in den Tod. Aber in Bremerhaven schien die Sonne. Und wie es der Zufall wollte, feierte man gerade an diesem Wochenende das Bremerhavener SeeStadtFest. So hatten die rund 150 Delegierten und Gäste der diesjährigen VDS-Delegiertenversammlung neben dem von Wolfgang Hildebrandt hervorragend organisierten Ausflug in die Künstlerkolonie Worpswede mit anschließendem Krabbenpulen ein weiteres kostenloses Rahmenprogramm. Zwischen Feuerwerk und Livemusik und eingestimmt Psychotherapeut und Neurologe Dr. Bernd-Hartwig Gravenhorst bei seiner Rede im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven. Fotos: VDS durch einen glänzenden Festvortag von Dr. Bernd-Hartwig Gravenhorst zu den psychologischen Grundlagen der deutschen lingustic submissiveness, beschlossen sie die Kandidatenliste für den Sprachpanscher 2016 (siehe Seite 9) und formulierten eine Bremerhavener Erklärung zum Genderwahn (siehe Seite 11). Verschiedene Arbeitsgruppentreffen und das Weiterbildungsprogramm der VDS-Akademie rundeten die Tagung ab. Nach dem vierten Wirbel drehen, Regionalleiter Wolfgang Hildebrandt erklärt, wie man an das Fleisch der Nordseekrabbe kommt. Die Bildungsfahrt führte dieses Jahr in das Künstlerdorf Worpswede und zum Hermann-Allmers-Haus in Rechtenfleth. Die Arbeitsgruppe der ausländischen Delegierten: (stehend v. l.): Gero Greb (Schweiz), Prof. Maria Druschinina (Russland), Prof. Roland Duhamel (Belgien), Prof. Juris Kastins (Lettland), Jan Capek (Tschechien), Wladimir Stawski (Weissrussland), Aboubakr Sadji (Algerien), Prof. Dr. Walter Krämer, Prof. Boleslaw Andrzejewski (Polen), Manfred Schroeder (AG-Leiter). Sitzend (v. l.): Lana Teutschbein (Ukraine), Hayford Anyidoho (Ghana), Laura Stame (Italien), Regula Heinzelmann (Schweiz).
23 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 23 VDS-INTERN Deutsche Musik hat ein neues Zuhause Die Radioprofis Karsten Zierdt, Matthias Lutz, Heinz Gruss und Tom Hoppe ziehen mit dem Internetsender DMR in die VDS-Geschäftsstelle in Dortmund ein. Foto: VDS Seit Mai zu hören unter Deutschsprachige Musik fristet bei den Radiosendern in Deutschland, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, nach wie vor ein Schattendasein, und daran wird sich in geraumer Zeit auch nicht viel ändern. Deshalb hat der VDS gemeinsam mit der Firma Radioprofis aus Witten an der Ruhr einen eigenen Internet-Radiosender gestartet: DMR Deutsches Musik Radio. Zu empfangen weltweit im Internet unter oder über die kostenlose Anwendung im Apple App Store oder im Google Play Store. DMR bietet 24 Stunden am Tag, an allen sieben Tagen der Woche, ausschließlich die beste deutsche Musik! Egal ob Schlager, Pop-Schlager, Rock oder Pop; ob klassisch oder aktuell. Dazu gibt es stündlich Nachrichten aus aller Welt und das Deutschland-Wetter, nützliche Informationen, Sportnachrichten und gute Unterhaltung, aber auch viele interessante Neuigkeiten und wissenswerte Fakten rund um die deutsche Sprache und Kultur. Für die Konzeption und Realisation des neuen Senders haben die Sprachfreunde des VDS die Radioprofis engagiert: Matthias Lutz, Karsten Zierdt, Heinz Gruss und Tom Hoppe. Sie alle können auf eine lange und erfolgreiche Zeit vor und hinter dem Radio-Mikrofon zurückblicken, ob als Moderator, Autor, Programmchef oder Produzent. Die Zusammenarbeit zwischen dem VDS und den Radioprofis ergab sich zufällig durch eine WDR-Fernsehsendung zum Thema deutsche Musik im Radio. Einer der Studio- Zuschauer des live gesendeten Forums, bei dem u. a. Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), und WDR-Hörfunkchefin Valerie Weber Rede und Antwort standen, war Radio profi Matthias Lutz. Sein Wortbeitrag zu der mangelnden Präsenz deutschsprachiger Musik im (öffentlichrechtlichen) Radio begeisterte das VDS-Vorstandsmitglied Heiner Schäferhoff, der die Live- Sendung zu Hause vorm Fernseher verfolgte, so sehr, dass er direkt am nächsten Tag mit Lutz Kontakt aufnahm und das Projekt DMR in Angriff nahm. SN Der VDS und die Volksbank in Saerbeck tun Gutes im Münsterland Seit mehr als zehn Jahren fördert die Volksbank Saerbeck die VDS-Region 48 (Münster und Umland). Auch für 2016 stellte die Volksbank 500,00 Euro zur Verfügung, so dass der Gesamtbetrag an Spenden in diesem Zeitraum über Euro beträgt. Auf unserem Foto (v. l. n. r.): Albert Topphoff (VB), Simone Lamski, Erwin Girnth, Ludger Kordt, Reinhildis Hegemann, Günter W. Denz (alle VDS-Regionalleitung), Ansgar Heilker (VB). Foto: Volksbank Saerbeck Dr. Helmut Routschek Anfang April 2016 starb unser Vereinsfreund, der Schriftsteller Dr. Helmut Routschek alias Alexander Kröger. Der 81-Jährige erlag in Heidenau bei Dresden den Spätfolgen eines tragischen Autounfalls vom Januar In der DDR war er mit einer Auflage von 1,6 Millionen Exemplaren einer der meistgelesenen Autoren und auch international bekannt. Nach 1990 Helmut Routschek, hier beim Treffen mit der VDS-Gruppe, Juni kamen weitere Titel hinzu. Er veröffentlichte mehr als 30 Bücher, darunter wissenschaftlich-phantastische Romane sowie Kurzgeschichten und Anekdoten. Viele Jahre lang wirkte er als Vorsitzender des Brandenburger Landesverbandes deutscher Schriftsteller. Beim Schreiben achtete der Cottbuser Autor auf den sorgsamen Gebrauch der deutschen Sprache. In seiner Vereinsarbeit diskutierte er mit den Mitgliedern der Sprachgruppe Cottbus darüber, wie die vom Englischen bedrängte Muttersprache gestärkt werden kann. Text und Foto: Peter Jähnel
24 LESERBRIEFE Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 24 Höchstes Lob Es drängt mich, Ihnen mein höchstes Lob auszusprechen, ganz besonders für die aktuelle Nr. 69 der Sprachnachrichten. Als Vereinsmitglied lese ich regelmäßig Ihre Zeitung. Dieses Mal ist sie besonders informativ. Die einzelnen Themen werden unideologisch abgehandelt. Und die Beiträge sind erfrischend geschrieben und interessant zu lesen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und die hervorragenden Sprachnachrichten! Florian Schließmann, Nürnberg Nagel auf den Kopf Gratulation zum Wort des Vorsitzenden in den neuesten Sprachnachrichten (SN 69, S. 2)! Damit haben Sie mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Verschleiern von Informationen in den Medien ist mir auch schon lange ein Dorn im Schuh. Auch die Beiträge von Prof. von der Oelsnitz über Sprache als Werkzeug der Desinformation (S. 5) und von Dr. Reiner Pogarell über die Vornamenswahl bei Immigrantenkindern (S. 6) fand ich ausgezeichnet. Wäre es möglich, diese Beiträge in elektronischer Form zu erhalten? Ich würde sie gern einigen Freunden zur Lektüre zukommen lassen, natürlich nicht ohne gebührenden Verweis auf die Sprachnachrichten. Dr. Karl-Heinz Tödter, Eschborn Mutierender VDS? Austreten aus dem VDS!, dachte ich, als ich in der letzten Ausgabe u.a. Worte wie Wahrheits-Verschleierungsrhetorik, Völkerwanderung, Genderwahn und Sprachimperialismus lesen musste. Mit meinem Vereinsbeitritt verfolgte ich seinerzeit das Ziel, den Sprachwandel mitgestalten zu können und freilich auch für die deutsche Sprache und gegen unnütze Anglizismen oder unnötige Fremdwörter eine Lanze zu brechen. Nun erscheint mir der Verein zu einer nationalkonservativen und AfD-nahen Fruchtbringenden Gesellschaft zu mutieren. Was diese Republik braucht ist ein Verein, der mit seinem Einsatz den Rechtspopulisten und Nationalisten im Kampf für die deutsche Sprache das Wasser abgräbt und ihnen nicht in die Hände spielt. Georg S. A. J. Fries, Bamberg Tapfer bleiben Ich möchte Danke sagen, dass Sie als eine der wenigen Zeitungen in diesem Lande mutig und fähig genug sind, die Probleme der heutigen Politik klar zu benennen. Ich las Ihre Beiträge über verschleiernde Begriffe, über Genderwahn (von Walter Krämer) und über Pressefreiheit (SN 69, S. 1, 2 und 5), und Wir freuen uns über Kritik und Lob (über Letzteres natürlich mehr). Leider können wir nicht alle Leserbriefe abdrucken, müssen oft auch kürzen. Dafür bitten wir um Verständnis. Schreiben Sie bitte an leserpost@vds-ev.de. ich wußte, dass es gut war, in den Verein Deutsche Sprache eingetreten zu sein. In den Sprachnachrichten stoße ich nur selten auf jenes unsäglich ignorante Schönfärberdeutsch, das sogar schon den SPIE- GEL erreicht hat. Die Stimmung im Lande ist prickelnd. Bleiben Sie tapfer! Jörg Wenzel, Saalfeld Besser keine Kampfbegriffe In der Buchbesprechung (in SN 69, S. 24) verwenden Sie das Wort Lügenmedien. Der Begriff hätte m. E. in den Sprachnachrichten nur einen Platz, wenn seine Verwendung heutzutage untersucht und dargestellt würde. Es geht um eine starke moralisierende Abwertung von Medien, die Sie nicht mögen. Es handelt sich faktisch um Medien, die politisch, ideell oder ideologisch irgendeine Meinung vertreten, bei Ihnen sind es die weitgehend linksgestrickten, aber es gibt natürlich auch rechtsgestrickte und zwischendrin gestrickte; dass die Meinungsmedien nach ihrer Fasson deuten und predigen, muss man ihnen im Land der angestrebten und grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit zugestehen. Wie ich auch den Sprachnachrichten manche Beiträge zugestehe, deren Meinung ich nicht teile, weil sie mir zu einseitig sind. Die Sprachnachrichten sind insofern gewiss ein Stück Meinungsmedium, aber deswegen würde ich nicht gleich den rechtsradikal infizierten Kampfbegriff Lügenpresse dafür verwenden. Im Übrigen Danke für das sehr interessante Interview mit Roland Günter. Alfred Schröcker, Wunstorf Migranten oder Flüchtlinge? Der Aussage in Sprechen Denken Politik (SN 69, S. 1) kann man grundsätzlich zustimmen. Es ist in der Tat sinnvoller, von Migranten statt von Flüchtlingen zu sprechen. Wenn der Verfasser aber die aktuelle Einwanderungswelle in unser Land mit der Auswanderung deutscher Landsleute im 19. Jahrhundert in die USA vergleicht und dann resümiert, daß wir dieselben Vorteile haben könnten wie sie die USA seinerzeit dank der deutschen Einwanderung, dann übersieht er die erheblichen Unterschiede zwischen diesen beiden Vorgängen. Die USA waren damals ein nahezu menschenleeres Land, das auch heute noch mit einer mittleren Einwohnerdichte von nur 30 Einwohnern pro Quadratkilometer relativ dünn besiedelt ist. In Deutschland beträgt die Dichte mehr als das Siebenfache. Und es wanderten vor allem landlose Jungbauern aus, die in den weiten Ebenen der Neuen Welt Land quasi geschenkt erhielten und somit ihren Beruf weiter ausüben konnten. Diese Zuwanderung erfolgte nach und nach und nicht sturzwellenartig wie zur Zeit bei uns. Der Verfasser bezeichnet die Gruppe der Befürworter einer unkontrollierten Zuwanderung als Gutmenschen und diejenigen, die diese Art der Zuwanderung kritisch sehen als Blut-und- Boden-Romantiker. Beides eher Kampagnenbegriffe. Aber sie verdeutlichen ein in der öffentlichen Diskussion kaum beachtetes Grundproblem. Stehen doch hier auf der einen Seite Vertreter eines schrankenlosen Internationalismus, der die Aufgabe der nationalen Identität zu Gunsten einer Art globalen Weltgemeinschaft fordert und in einer extremen Weise gar von Deutschland als einem Stück Scheiße spricht. Auf der anderen Seite Menschen, die nicht bereit sind, ihre nationale Identität aufzugeben. Dieter Dziobaka, Hamburg Übers Ziel hinaus Vorherrschende Sichtweisen gegen den Strich zu bürsten ist meist begrüßenswert; im vorliegenden Fall finde ich, dass Walter Krämer an zwei Punkten über das Ziel hinausgeschossen ist (SN 69, S. 2) : Einmal, wenn er die Aufnahme Hunderttausender von Flüchtlingen als regierungsamtlich angeordnetes Großexperiment bezeichnet. Da blendet er die Tatsache der vielen hundert Menschen aus, die vor unser aller Fernseh-Augen auf dem Mittelmeer oder schon an Land ums Leben gekommen sind. Sie sind ein Hauptgrund der verbreiteten Willkommenskultur, und nicht die Anordnung eines Großexperiments. Zweitens: Einen Obrigkeitsstaat haben wir anders als zur Goethezeit nicht, auch wenn sich in vielen Massenmedien phasenweise vorherrschende Denkrichtungen abzeichnen. Dies hat viele Wurzeln. Hier aber raunend eine Verschwörungsvermutung anklingen zu lassen, stößt ins Horn eines populistischen Deutungsschemas, wie es die AfD gerade propagiert. Michael Kootz, Kassel Giftknochen und Besserwisser Ich weiß auch nicht, was subkutan bedeutet (SN 68, S. 28). Kommt in meinem täglichen Sprachgebrauch nicht vor. Ich müsste das Wort also im Duden nachschauen, was ja keineswegs ehrenrührig ist. Ich finde die Sprachnachrichten jedenfalls prima und freue mich immer, wenn sie kommen. Besonders die Leserbriefe lese ich immer mit Vergnügen. Aber was es unter den Einsendern da für Giftknochen, Giftnudeln, Besserwisser und Klugscheißer gibt! Kann man sich nicht auch ohne Verbissenheit für den richtigen Sprachgebrauch und die Schönheit und den Reichtum unserer deutschen Sprache einsetzen? Detlef Leisterer, Erbach Weiter so Den Machern der Sprachnachrichten vielen herzlichen Dank für die zutreffenden Artikel zum Erhalt der deutschen Sprache. Weiter so! Bodo Pindur, Bad Soden Fuzzi-Stil? Missfallen regt sich in mir bei der Ankündigung von Walter Krämer, keine Zeitungen mehr zu lesen (SN 69, S. 2). Der Ausdruck Lügenpresse erscheint zwar nicht wörtlich, doch schwingt er unverkennbar zwischen den Zeilen mit. Kritik muss sein. Doch das ist Fuzzi -Stil. Ich habe Ähnliches leider auch in früheren Ausgaben der Sprachnachrichten beobachtet und kann das nicht gutheißen. Darum werde ich die nächste Ausgabe mit geschärfter Aufmerksamkeit studieren und gegebenenfalls bei der übernächsten Ausgabe mich Herrn Krämer anschließen und seine Zeitung nicht mehr lesen. Josef Peil, Mastershausen Geistige Heimat im VDS Zuerst Unverständnis, dann eigene Analyse, danach Ablehnung, schließlich Abscheu So ungefähr lässt sich meine Stellung zum Genderismus beschreiben (SN 69, S. 2, 8 und 9). Natürlich ist heute klar, dass diese Sprachformungsversuche reine Ideologie sind. Wer die Sprachformer des Dritten Reiches meisterhaft dokumentiert in Lingua Tertii Imperii von Otto Klemperer und des DDR-Sozialismus kennt, auch einmal Orwells 1984 gelesen hat, kann nicht anders als aktiv dagegen vorzugehen. Das heißt: im Alltag auch die Sprachregelungen einfach nicht benutzen. Ich fühle mich vom VDS in dieser Haltung unterstützt und bestärkt und freue mich, als Verehrerin der deutschen Sprache und Kultur, bei Ihnen eine geistige Heimat gefunden zu haben. Steffi B. Focke, Titisee-Neustadt
25 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 25 LESERBRIEFE Ungleichverhältnis Schon seit Langem bin ich Mitglied des VDS, und ich bin froh, dass es diesen Verein zum Erhalt der deutschen Sprache gibt. Auch die Sprachnachrichten lese ich immer mit Interesse und gebe sie auch weiter. Was mich allerdings stört, ist dass die Gendersprache in den Sprachnachrichten häufig, oft nur scheinbar, mit Nadelstichen angegriffen wird. Jetzt haben Sie in dem letzten Heft Nr. 69 (1/2016) die Gendersprache zum Schwerpunktthema gemacht und das leider nicht neutral sondern aggressiv ( Genderwahn, Sprachverhunzung mit wenig wissenschaftlichem Gehalt ). Die entsprechenden Artikel und der Leserbrief sind natürlich von Männern verfasst. Ich würde mir einen sachlichen Diskurs wünschen, in dem kompetente Fachleute, sowohl Frauen als auch Männer zu Wort kommen, in dem tatsächlich die linguistischen und sozialen Hintergründe beleuchtet werden. Nur als Beispiel zum Thema Gleichberechtigung/Gleichstellung: Ich habe mir die Mühe gemacht, den Anteil der Autoren und Beiträge des Heftes aufzulisten: Es sind ca. 40 männliche und 4 weibliche. Bei den Leserbriefen stammen 11 bzw. 12 von Männern, 3 bzw. 4 von Frauen, bei den allgemeinen Leserbriefen stammen 5 von Männern, keiner von einer Frau. Friederike Fillmann, Ottweiler Erläuterung bitte Die neueste Ausgabe der Sprachnachrichten fand ich wieder sehr interessant. Nur den Artikel Deutsch als nichttarifäres Handelshindernis habe ich nicht verstanden (SN 69, S. 17). Insbesondere der Satz: unter dem Druck eines schrankenlosen Marktes fürchten wir die Abwertung unserer Sprachen zu nichttarifären Handelshindernissen, ist für mich unverständlich. Daher bitte ich um Erläuterung. Wenn dieser Artikel mehr sein soll als die allgemeine Angstmache vor TTIP (3 Millionen Unterschriften), müssten Sie mir schon konkret sagen, worin ihre Furcht vor der Abwertung unserer Sprachen begründet ist. Welche Formulierung in den Entwürfen zu TIPP gibt Ihnen Anlass zu dieser Furcht? Wenn es eine solche Formulierung in diesen Entwürfen geben sollte, müsste sie natürlich geändert werden oder ganz gestrichen. Ich benötige eine Verständnishilfe. Ludger Schultealbert, Nottuln Brennender Rest In der letzten Ausgabe las ich einen Artikel über einen Werbeslogan von Bayer mit dem Titel Science for a better life (SN 69, S. 20). Die Mitarbeiter wurden nach dem Sinn dieses Slogans befragt mit dem desaströsen Ergebnis, dass nur etwa jeder 3. etwas damit anfangen konnte und der Rest keine Ahnung hatte oder den Ausdruck falsch übersetzte. Ich persönlich begeistere mich immer wieder aufs Neue für die deutsche Sprache und finde es unerhört, dass diese auf so vielfältige Art und Weise herabgesetzt und mit unnötigen Anglizismen durchtränkt wird. Angezündet von den Medien, die diesen Wandel vorantreiben und schließlich geworfen von denen, die sich gegen eine bessere Sprache wehren. Somit bleibt nur ein brennender Haufen übrig, den es gilt, am Leben zu erhalten. Chris Saß, Wolfsburg Blitzgescheit Ihr Rätsel der deutschen Lieder in der neuen Ausgabe ist ein echter Gutelaunemacher (SN 69, S. 30). Unterwegs in der S-Bahn musste ich mehrmals vor mich hinlachen. Ein lebenswichtiges Organ auf dem Weg zu einem Wiener Psychotherapeuten das ist klasse. Ebenso die Version vom Heideröschen unwiderstehlich komisch. Und irgendwo" als Antwort auf die Frage, wo es auf der Welt ein kleines bisschen Glück gäbe genial, darauf muss man erst mal kommen! Noch nie hat mich ein Rätsel so in seinen Bann gezogen. Meinen verbindlichsten und herzlichen Dank an Reiner Pogarell für seine blitzgescheite Sprachgewandtheit. Erhard Bohr, Berlin Wie Worte werden Wegen des Nennleistungswandels fällt einem zu Welt nicht mehr Menschenalter, sondern eher Seinsraum ein (SN 69, S. 27). Wie bitte? Warum Fast Science ausgerechnet in Ihrer Zeitung? Und wem hilft die Kenntnis, daß sich das umgangssprachlich eindeutige antisemitisch sprachwissenschaftlich auch auf Araber bezieht? Die etymologische Erwähnung zu Mitleid und Erbarmen ist genauso verschwurbelt wie der letzte Satz des Interviews: Woher weiß der Sprecher, daß das, was er zu Allgemeine Briefe an den VDS Namen hinzudenkt, im Sinne der Nennleistung trefflich sei? Wenn das Buch dieses Autors sprachlich genauso daherkommt wie dieses Interview, kann es wohl kaum Interesse bei Jugendlichen wecken. Helmut Berghaus, Kleve Erinnerung an Götz Urban Am Tag nach der Rückkehr von der Beerdigung am 11. März 2016 in Wiesbaden lese ich in Ihren Sprachnachrichten den Nachruf über meinen lieben Peiner Mit abiturienten Götz Urban (SN 69, S. 21). Er verstarb am 17. Februar im Alter von nicht 87, sondern gut 77 Jahren während eines Besuches in Clausthal-Zellerfeld. Götz war geistig überaus rege, was sich in vielen Beiträgen, nicht nur bei Ihnen, sondern besonders in den Posener Nachrichten zeigte. Seine Familie stammte aus Posen. Götz hatte Latein, Englisch, evangelische Religion und Gemeinschaftskunde studiert, verbrachte viele Jahre an der Deutschen Schule in Madrid und unterrichtete als Gymnasiallehrer bis zu seinem Ruhestand 2002 im Raum Wiesbaden-Frankfurt. Seine Urne ruht nunmehr auf dem Nordfriedhof Wiesbaden, in einer Reihe mit dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer Helmut Schön. Prof. Dr. Hans Oelke, Peine Stil und Stiel In dem Beitrag über Karl Johaentges und seine australische Frau Jackie ist Ihnen ein Fehler zum zitierten Lieblingswort Pfanne unterlaufen (SN 69 S. 21). Die pan with a long handle hat einen langen Stiel. Wie der Besen oder die Axt. Stil ist die eigentümliche Art eines Künstlers zu schreiben, zu malen oder Musik zu machen. Korrektes Deutsch bedarf auch der Pflege durch den VDS. Bernhard Olbricht, Gescher Esperanto 1 Als VDS-Mitglied der ersten Stunde und Esperanto- Fachmann andererseits begrüße ich eine Meldung zu meiner Lieblingsfremdsprache. Leider hielten Sie anscheinend einen abfälligen Kommentar zu der Kunstsprache für unverzichtbar. Zu den Tabus der Sprachwissenschaft gehört, sich nicht wertend über eine Sprache zu äußern, schon gar nicht ihren Wert an der Sprecherzahl zu messen, und das auch noch, wenn man selbst offenbar keinerlei praktische Erfahrung damit hat. Kommunikativ ziehe ich ein lupenreines Esperanto dem üblichen Fremdsprech vor, mit dem die Ethnosprachen misshandelt werden. Aber das ist schon wieder subjektiv. Dr. phil. Rudolf-Josef Fischer, früherer Lehr-beauftragter für Esperanto an der Universität Münster Esperanto 2 In Ihrem Infobrief der 12. Woche schreiben Sie: Die innere Struktur der Kunstsprache leuchtet rasch ein, weniger jedoch der kommunikative Nutzen angesichts der lebendigen Sprachen mit ihren zahlreichen Sprechern und ihren differenzierten Kulturleistungen. Das hört sich ja an, als wäre Esperanto keine lebendige Sprache, als hätte es nicht zahlreiche Sprecher und keine differenzierte Kulturleistung. Ich bin ziemlich verwundert über diese Aussage, da ich seit über 35 Jahren Esperanto spreche, in dieser Zeit zahlreiche Sprecher kennengelernt habe und auch viele kulturelle Veranstaltungen besucht habe, die nach meinem Verständnis durchaus eine differenzierte Kulturleistung darstellen. Mir kommen Ihre Aussagen zu Esperanto daher ziemlich seltsam vor. Alfred Schubert, Weilheim in Oberbayern Scheußlich Nach meinem Wissen kommt der Wortgräuel nichtsdestotrotz aus der lateinischen Sprache: Aus der geläufigen Wendung nihilo minus tamen (um nichts weniger), der meist ein quam (als) folgte, machte ein studentischer Witzbold nihilotrotzquam. Offenbar verstand der noch ein wenig Latein. Diese Wortprägung wurde dann ob unmittelbar oder nicht, weiß ich nicht zu dem scheußlichen nichtsdestotrotz. Daß dies seinen Weg in den Duden gefunden hat, war mir nicht bekannt, da ich dieses Werk seit längerer Zeit nicht mehr benutze. Dr. Georg Thamm, Freiburg i. Br. Die Rhetorik der Pegida Über Ihren letzten Infobrief bin ich verärgert. Mit solchen Verallgemeinerungen über Pegida will ich nichts zu tun haben. Wohlgemerkt mit Verallgemeinerungen! Dass ein vor Gericht angängiges Verfahren gegen einen Einzelnen zudem noch nicht gesichert, wie Sie ja auch sprachlich durchscheinen lassen auf eine ganze Gruppe übertragen wird na ja Ich kenne das so zur Genüge, dass das schon ausreicht, um meine Warnlampen leuchten zu lassen: Extrem schlechter manipulativer Stil. Dr. Christine Wolbrandt, Wenzendorf
26 SN-RÄTSEL Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 26 Rätsel der germanischen Sprachen In diesem Rätsel geht es um unsere engen sprachlichen Verwandten, die germanischen Sprachen lebende und verstorbene, große und kleine. Finden Sie die zwanzig gesuchten Wörter, indem Sie die folgenden Fragen beantworten. Tragen Sie die Lösungen in die entsprechenden Kästchen ein. Bitte verwenden Sie Umlaute und ß wie normale Buchstaben. Damit Ihnen die Antwort etwas leichter fällt, haben wir jeweils einen Buchstaben vorgegeben. 1. Staatssprache in zwei europäischen Staaten. In einem allerdings etwas bedrängt durch eine Sprache, die mit dem Ungarischen verwandt ist. Jedoch mit Ausnahme einer Inselgruppe, dort hat die Sprache einen unangefochten Status. 2. In keinem Land hat sie es zur Staatssprache gebracht. Trotzdem ist es eine Weltsprache. Immer noch. Entstanden einst in deutschen Gettos, von dort aus nach Osteuropa und dann in alle Welt getragen. Geschrieben von rechts nach links. 3. Den Einwohnern der Stadt Trier fällt es gelegentlich schwer, diese Sprache nicht als Dialekt zu bezeichnen. Doch einer der wichtigsten Europapolitiker singt inbrünstig seine Nationalhymne in dem auch von Sauer die Rede ist in diesem Idiom. 4. Einst verbreitet in ganz Europa, von der Krim bis ins heutige Portugal. Hinterließ überall sprachliche Spuren und der deutschen Sprachgeschichte ein wunderbares Vater Unser. Zwar gibt es noch ein Land mit dem Namen dieser Sprache, aber es ist nur eine Insel. 5. Wahrscheinlich die einzige Sprache, die ihren Namen aus einem Mangel an Rasierapparaten ableitet. Von Pannonien im heutigen Ungarn wanderten die Sprecher nach Norditalien aus, herrschten dort eine gute Weile und brachten einige Wörter in das spätere Italienisch ein. So das Wort Pizzo ( = Bissen). Um nach Christus gab es diese Sprache nicht mehr, die Pizza dagegen ist beliebt wie nie. 6. Diese Sprache erlaubt es sich, in zwei offiziellen Varianten aufzutreten. Das kann sie sich auch leisten, denn sie ist in ihrem sehr wohlhabenden Heimatland geliebt und geschützt. Wenn man die Sprache einfach nur bei ihrem hier gesuchten allgemeinen Namen nennt, meint man meist die Variante, die man mit Buchsprache übersetzen könnte. 7. Zu einer richtigen eigenständigen Kultursprache hat es diese Sprache nie gebracht, aber sie ist namentlich enorm präsent. Drei deutsche Bundesländer, drei britische Königreiche und eine Grafschaft tragen den Namen der dort heute oder damals gesprochenen Mundart. Auch hat sie eine eigene Schweiz. 8. Amtssprache in zwei europäischen und vier überseeischen Staaten. In Deutschland selten beim richtigen Namen genannt. Im Englischen heißt sie Deutsch, was die Engländer aber nicht wissen. 9. Eine der wenigen Sprachen, deren Sprecher meist fest davon überzeugt sind, nur einen Dialekt zu sprechen. Daher geben sich nur wenige davon etwas Mühe, sie zu pflegen. So wurde aus einer überregionalen Handels- und Verkehrssprache ein Stückchen plattes regionales Brauchtum. 10. Gesprochen von einigen zehntausend Menschen auf einigen Inseln, auf denen es sehr windig ist. Erfreut sich aber innerstaatlicher Anerkennung, sogar auf Google kann in dieser Sprache gesucht werden. 11. Im Jahr 1066 begann durch eine Invasion eine politische Entwicklung, die den Wortschatz dieser Sprache mehrheitlich romanisch machte. Doch sie bleibt eine germanische Sprache, weil es darin unmöglich ist, einen Satz ohne ein germanisches Wort zu bilden. Dagegen ist es gut möglich, Sätze ohne ein romanisches Wort zu bilden. 12. Gesprochen in religiös geprägten Sprachinseln in zwei amerikanischen Staaten. In der Eigenbezeichnung trägt die Sprache den Zusatz Deitsch, im Englischen Dutch. 13. Heute ist die Sprache anerkannt und geschützt in zwei Staaten, in denen sie aber nur kleine Minder J B V A Ä R Y Ä E F W Z W Ö Ä Eines der Lösungsworte enthält einen Planeten. Das ist das Lösungswort: Y S Schicken Sie das Lösungswort mit Ihrer vollständigen Anschrift bis zum 15. August 2016 per Karte, Brief oder E-Post an: IFB Verlag Deutsche Sprache, Stichwort: Sommer Winter 2016, Schulze-Delitzsch-Straße 40, Paderborn; info@ifb-verlag.de H Das gibt es zu gewinnen: 1. und 2. Platz: Je ein Buch Edelsteine 107 Sternstunden deutscher Sprache mit persönlicher Widmung des Herausgebers Walter Krämer Platz: Je ein Buch Wort- Spielereien von Hermann Josef Roth. Ä E heiten bildet. Es gibt einen westlichen, östlichen und nördlichen Zweig, wobei der östliche westlicher als der nördliche liegt. Der nördliche liegt östlicher als der östliche. Früher lebten ihre Sprecher auf Warden, heute nur in Orten, die so heißen. 14. Einmalig in Europa. Ein Land mit nur einer Sprache, die sonst in keinem anderen Land gesprochen wird und in dem sonst keine andere Sprache eine Rolle spielt. Sehr reich an alter und neuer Literatur. In der alten Literatur wird von der wahrscheinlich ersten europäischen Amerika-Entdeckung um das Jahr 1000 herum berichtet. 15. Offizielle, aber nicht so weit verbreitete Variante der bereits genannten Sprache aus einem sehr reichen Land. Gesucht wird hier der Originalname. 16. Offizielle Sprache auf der größten Insel der Welt und auch etwas auf der Insel Sylt. Darüber hinaus beheimatet auf zahlreichen weiteren Inseln. 17. Gehört zu den elf Nationalsprachen einer der wenigen stabilen afrikanischen Demokratien. 18. Gehört ebenfalls zu den elf Nationalsprachen der erwähnten afrikanischen Demokratie, ebenso zu den ebenfalls elf Sprachen einer weiteren stabilen afrikanischen Demokratie. 19. Gesprochen einst auf dem Gebiet der späteren Staaten Deutschland, Frankreich und Italien. Die Sprecher hatten einen König mit dem Namen Gundahar, so wird uns in alten Mären erzählt. Römer und Hunnen machten gemeinsam diese Sprachgemeinschaft nieder. 20. Im Jahr 533 nach Christus wurde das nordafrikanische Karthago zum zweiten Mal von den Römern zerstört. Das war das Ende eines Volkes und und damit einer Sprache, die nach einer langen Wanderungszeit von Mitteleuropa bis nach Nordafrika und Iberien getragen wurde. Irgendwie haben sich die Sprecher dieser Sprache nicht so richtig beliebt gemacht, denn wenn heute irgendwo eine Bushaltestelle verwüstet oder mit Graffitis verunstaltetet wird, werden sie sofort mit einem -ismus erwähnt. Niemals in einem guten Zusammenhang. Die Sprache heißt
27 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 27 ZWISCHENRUF Die Rubrik ZWISCHENRUF gibt VDS-Mitgliedern Raum für Meinungen und Kommentare zum aktuellen Vereins- und Sprachgeschehen, die sich nicht unmittelbar auf Artikel in den Sprachnachrichten beziehen und deshalb für die Sparte Leserbriefe ungeeignet, aber dennoch von Interesse sind. Beiträge schreiben darf jedermann. Über die Aufnahme entscheidet die SN-Redaktion. Sie behält sich auch vor, Texte zu kürzen. Ein Zwischenruf sollte nicht länger als 2000 Zeichen sein. Schifffahrt und anderer Unsinn Von Gerd Schrammen Seit ihrer Einführung hat die neue Rechtschreibung Prügel bezogen. Der Sprachwissenschaftler Theodor Ickler nannte sie einen Schildbürgerstreich. Sein Kollege Peter Eisenberg erklärte, das Regelwerk gehöre auf den Müll. Heute wird nur noch leise gestritten. Und es herrscht fröhliches Durcheinander. Rad fah ren neben radfahren, recht haben und Recht haben, Photo und Foto. Das sind nur die harmlosen Beispiele. Ich habe den Unfug nicht mitgemacht. Von der Schreibung, die ich in der einstigen Volksschule lernte das erste Jahr noch Sütterlin mochte ich nicht lassen. So bleibe ich bei daß, auch weil das Nebeneinander von das und dass die Schwierigkeit nicht aufhebt, zwischen dem Relativpronomen und der Konjunktion zu unterscheiden. Und selbstständig kommt bei mir nicht auf den Monitor und nicht aufs Papier. Das vorgesetzte selb ist ein Adjektiv. Es bedeutet bereits selbst und taucht in Ausdrücken wie selbdritt oder derselbe Preis auf. Es kann gesteigert werden in selber und Lösung und Gewinner aus der Sprachnachrichten Nr. 69 Lösungen: 1. Drafi Deutscher, 2. Paul Gerhardt, 3. Lohengrin, 4. Forelle, 5. Hannes Wader, 6. Anita, 7. Gedanken, 8. Heideröslein, 9. Stephan Remmler, 10. Stille Nacht, 11. Komm lieber Mai, 12. Zauberflöte, 13. Kraftwerk, 14. Kraft, 15. Ode an die Freude, 16. Guten Abend, 17. Atemlos, 18. Helgoland, 19. Frohlocket, 20. Irgendwo. Unsere Gewinner: Platz: Edeltraud Fox (Ludwigshafen), Klaus Kriese (Haltern am See), Platz: Steffen Böttcher (Wassertrüdingen), Carola Haug (Heilbronn), Frank Kuppe (Itzehoe), Angela Laudi (Hamburg), Veronika Niemann (Buchholz/Nordheide), Gerhard Hohmann (Oberursel), Ernst Meinhardt (Berlin), Dr. Jürgen Thurm (Zachenberg) selbst Die Bedeutung ändert sich nicht. Ein Unding war die Einführung von Dreifachkonsonanten wie in Schifffahrt, Betttuch, Stalllaterne oder Stilllegung. Sie sind häßlich und überflüssig. Diese Zusammenballung von gleichen Buchstaben mißachtet eine tiefsitzende Schreibgewohnheit. Im Deutschen werden nur Doppelkonsonaten geschrieben. Ausnahmen waren Wörter wie Sauerstoffflasche, fetttriefend oder farbstofffrei, denen nach dem letzten der drei gleichen Konsonanten ein weiterer Konsonant folgt. Wir schreiben Doppelkonsonanten, aber wir sprechen sie nicht. Wir tun es nur in der sogenannten Überlautung, etwa in lärmender Umgebung oder wenn der Lehrer einen Text diktiert. Die Italiener und Araber sagen auch im Alltag il car-ro (carro: der Karren) und al kabbūt (kabbūt: die Motorhaube). Im Deutschen wird bei Miete, Mitte oder enttäuschend; bei Stiel oder still nur ein t oder l gesprochen. Auch die Schirmmütze hat nur ein m. Das ändert sich nicht bei Dreifachkonsonaten. Ob schief, Schiff oder Schifffahrt; halt, Halle oder Stalllaterne: Wir sprechen nur ein f oder l. Die häßlichen und ohne jede Not zusätzlich eingeführten Dreierkonsonanten können wir vermeiden und gleichzeitig dem zweiten Wort in der Zusammensetzung die Spitze erhalten. Wir setzen einen Bindestrich: Fett- Tropfen, Stall-Laterne, ähnlich See-Igel oder Zoo-Ordnung. Möglich wäre auch die sogenannte Binnenmajuskel. Wir kennen sie aus BahnCard, McDonalds oder LehrerInnen in feministischer Schreibung. Im 17. Jahrhundert wurde sie oft genutzt. Beispiele: HauptSprache, LobRede, ErzBischof. Heute würden wir schreiben SchiffFahrt oder StillLeben. Ich hätte mich damit anfreunden können. Aber der Bindestrich bleibt die bessere Lösung. Die beiden Teile der Zusammensetzung sind deutlicher erkennbar. Das freut den Leser. Auf ihn kommt es an, wenn wir schreiben. Ich will etwas für die deutsche Sprache tun und trete dem Verein Deutsche Sprache e. V. bei: Name und Vorname Anschrift Ich bitte um Lastschrifteinzug des Jahresbeitrags von 30 Euro von meinem Konto IBAN bei Unterschrift Der VDS ist mit Bescheid des Finanzamtes Dortmund-Hörde vom als gemeinnützig anerkannt (Steuer-Nr. 315/5791/1057). Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. per Post oder Fax an: Verein Deutsche Sprache e. V., Postfach , Dortmund; Fax
28 28 Sprachnachrichten Nr. 70 (II/2016) 28 SPRACHBILDER Bernd Zeller Schlagzeile des Jahres gesucht Zum sechsten Mal kürt eine Jury von bekannten Sprachwissenschaftlern und VDS-Mitgliedern die Schlagzeile des Jahres. Schicken Sie bitte Vorschläge formlos an die Vereinszentrale (elektronisch, mit gelber Post oder per Fax). Einsendeschluss ist der 19. November Einsender, deren Vorschläge unter die ersten zehn gelangen, erhalten ein Exemplar der Edelsteine deutscher Sprache. Die Entscheidung der Jury wird in der Ausgabe 4/2016 der Sprachnachrichten bekanntgegeben. Die ausgezeichneten Überschriften der vergangenen Jahre waren: Der Mann, der die Mauer niederstammelte (2015), Fluchhafen Berlin (2014), Yes, we scan! (2013), Politik. Macht. Einsam., Brüderle bei Ehrlichkeit ertappt (2011), Krieger, denk mal! (2010). SN VDS im digitalen Netz Der VDS ist auch bei Facebook unterwegs. Besuchen Sie uns dort einmal. Einfach den QR-Code einlesen und Gefällt mir anklicken. facebook.com/vdsdortmund Gänsehaut in der Westfalenhalle Seit Jahren unterstützt der VDS Klasse! Wir singen eine Aktion, die das Singen von Kindern in Schule, Freizeit und Familie dauerhaft und nachhaltig fördert. Durch die Teilnahme im Chor an einem großen Abschlussliederfest von tausenden anderen Kindern, erfahren die Schulkinder einen enormen Motivations- und Selbstvertrauensschub. Zu den Höhepunkten dieses Jahres zählte zweifellos das Liederfest in der Dortmunder Westfalenhalle am 21. Mai. Auf dem Bild singen Kinder und Eltern Der Mond ist aufgegangen. Foto: Wichert IMPRESSUM Die nächste Ausgabe erscheint im September 2016; Redaktionsschluss: 29. Juli Herausgeber: Verein Deutsche Sprache e. V. (VDS) Postfach , Dortmund Telefon / , Fax / Leserbriefe an <leserpost@vds-ev.de> Andere Nachrichten an <info@vds-ev.de> Druck: Lensing Druck GmbH & Co. KG, Dortmund Auflage: Exemplare Redaktion: Prof. Dr. Walter Krämer, Dr. Reiner Pogarell, Dr. Gerd Schrammen Alle namentlich gekennzeichneten Artikel stehen nicht unbedingt für die Meinung der Redaktion oder des VDS. Gesamtprojektleitung: Heiner Schäferhoff (V. i. S. d. P.), Allee 18, Holzwickede; <heiner.c.schaeferhoff@t-online.de> Gestaltung und Satz: Druckpunkt Hoppe, Schkeuditz <sprachnachrichten@druckpunkt-hoppe.de> Dieser Ausgabe liegt ein Werbeblatt des Tectum- Verlags und der Wahlzettel für den Sprachpanscher des Jahres bei. Die Sprachnachrichten gibt es auch an Kiosken und Bahnhofsbuchhandlungen. Die Redaktion kann keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilddateien übernehmen. Bitte schicken Sie uns nur Berichte von überregionalem Interesse und bitte in digitaler Form. Wir behalten uns vor, Texte redaktionell zu bearbeiten, vor allem zu kürzen.
Die Pomoren-Universität Archangelsk ist neues VDS-Mitglied
 Deutsch eiskalt! Die Pomoren-Universität Archangelsk ist neues VDS-Mitglied Nahe des Polarkreises am Weißen Meer sprechen und lernen hunderte Studenten Deutsch: im nordrussischen Archangelsk, zu deutsch
Deutsch eiskalt! Die Pomoren-Universität Archangelsk ist neues VDS-Mitglied Nahe des Polarkreises am Weißen Meer sprechen und lernen hunderte Studenten Deutsch: im nordrussischen Archangelsk, zu deutsch
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) wissenschaftssprachlicher Strukturen
 Bauhaus-Universität Weimar Sprachenzentrum Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) Prüfungsteil: Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher
Bauhaus-Universität Weimar Sprachenzentrum Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) Prüfungsteil: Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes und wissenschaftssprachlicher
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei
 der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
für das Thema und vor allem für Ihren herausragenden, zumeist ehrenamtlichen Einsatz.
 Sperrfrist: 14. Oktober 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einführung des
Sperrfrist: 14. Oktober 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einführung des
Präsident der Bayerischen Landesärztekammer
 Grußwort Dr. Hartmut Stöckle 80 Jahre von Dr. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer am 11. Februar 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Lieber Hartmut, liebe Frau Stöckle, lieber
Grußwort Dr. Hartmut Stöckle 80 Jahre von Dr. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer am 11. Februar 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Lieber Hartmut, liebe Frau Stöckle, lieber
Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT.
 Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT. Thesenpapier zur Interdisziplinären Zukunftskreissitzung Politik und Wirtschaft / Medien und Kommunikation, 30.04.2012 Thesen in Zusammenarbeit
Europäische Öffentlichkeit. EUROPA VERDIENT ÖFFENTLICHKEIT. Thesenpapier zur Interdisziplinären Zukunftskreissitzung Politik und Wirtschaft / Medien und Kommunikation, 30.04.2012 Thesen in Zusammenarbeit
Es ist mir eine große Freude, heute das Zentrum für Israel-Studien an der Ludwig- Maximilians-Universität München mit Ihnen feierlich zu eröffnen.
 Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
 1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
1 Schwarz: UE Politisches System / Rikkyo University 2014 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lesen Sie den Text auf der folgenden Seite und ergänzen Sie das Diagramm! 2 Schwarz: UE Politisches
Tag der Franken am 07. Juli 3013 Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags
 Es gilt das gesprochene Wort! Tag der Franken am 07. Juli 3013 Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin [Merk-Erbe], sehr geehrter Herr
Es gilt das gesprochene Wort! Tag der Franken am 07. Juli 3013 Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin [Merk-Erbe], sehr geehrter Herr
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Video-Thema Manuskript & Glossar
 DEUTSCHLAND UND DIE TÜRKEI In den 1960er Jahren kamen viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Eigentlich sollten sie nur für zwei Jahre im Land sein, doch viele von ihnen blieben. Ihre Familien
DEUTSCHLAND UND DIE TÜRKEI In den 1960er Jahren kamen viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Eigentlich sollten sie nur für zwei Jahre im Land sein, doch viele von ihnen blieben. Ihre Familien
Es gilt das gesprochene Wort.
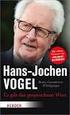 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Teilnahme an der Veranstaltung Verteilung der Flugblätter der Weißen Rose Ausstellungseröffnung Ich
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Teilnahme an der Veranstaltung Verteilung der Flugblätter der Weißen Rose Ausstellungseröffnung Ich
Fremdwörter in der Jugendsprache
 Miwako Oda Fremdwörter in der Jugendsprache 1.Thema In letzter Zeit ändern sich Moden sehr schnell. Unter Jugendlichen kann man das deutlich erkennen: Musik, Kleidung, Frisur, Fernsehschauspieler und so
Miwako Oda Fremdwörter in der Jugendsprache 1.Thema In letzter Zeit ändern sich Moden sehr schnell. Unter Jugendlichen kann man das deutlich erkennen: Musik, Kleidung, Frisur, Fernsehschauspieler und so
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
nicht mehr vorhandene Katholizität auch nicht von Animositäten frei. Es war ja damals um 1970 herum eine Situation eingetreten, in der sein Stern im
 nicht mehr vorhandene Katholizität auch nicht von Animositäten frei. Es war ja damals um 1970 herum eine Situation eingetreten, in der sein Stern im Sinken, der der nachfolgenden Generation junger Theologen
nicht mehr vorhandene Katholizität auch nicht von Animositäten frei. Es war ja damals um 1970 herum eine Situation eingetreten, in der sein Stern im Sinken, der der nachfolgenden Generation junger Theologen
Es gilt das gesprochene Wort!
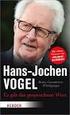 Es gilt das gesprochene Wort! Griechisch-Bayerischer Kulturpreis für Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm am 22.6.2015 in München Laudatio von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
Es gilt das gesprochene Wort! Griechisch-Bayerischer Kulturpreis für Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm am 22.6.2015 in München Laudatio von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
2. Art. 37 der Verfassung des Landes Sachsen Anhalt ( Kulturelle und ethnische Minderheiten )
 Identitäten, Nationalitäten und Staatsangehörigkeiten in einer weltoffenen Gesellschaft 1 I. Verfassungsrechtliche Grundlagen 1. Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
Identitäten, Nationalitäten und Staatsangehörigkeiten in einer weltoffenen Gesellschaft 1 I. Verfassungsrechtliche Grundlagen 1. Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes,
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich-
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN.
 MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN. Bundespräsidentenwahl 2016: Van der Bellen präsentiert Wahlkampagne. Der Verein "Gemeinsam für Van der Bellen Unabhängige Initiative für die Bundespräsidentschaftswahl 2016"
MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN. Bundespräsidentenwahl 2016: Van der Bellen präsentiert Wahlkampagne. Der Verein "Gemeinsam für Van der Bellen Unabhängige Initiative für die Bundespräsidentschaftswahl 2016"
"Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik
 Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen?
 Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
- es gilt das gesprochene Wort! -
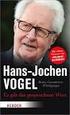 1 Grußwort von Herrn Minister Uwe Schünemann aus Anlass der Verabschiedung des Landesleiters des Malteser Hilfsdienstes e.v., Herrn Dr.h.c. Walter Remmers, und Einführung seines Nachfolgers, Herrn Michael
1 Grußwort von Herrn Minister Uwe Schünemann aus Anlass der Verabschiedung des Landesleiters des Malteser Hilfsdienstes e.v., Herrn Dr.h.c. Walter Remmers, und Einführung seines Nachfolgers, Herrn Michael
Rede des SPD-Parteivorsitzenden. Sigmar Gabriel
 Rede des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel zur Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2017 - Es gilt das gesprochene Wort - 2017 ist ein Jahr der Weichenstellungen in Europa und in
Rede des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel zur Nominierung des SPD-Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2017 - Es gilt das gesprochene Wort - 2017 ist ein Jahr der Weichenstellungen in Europa und in
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland
 Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland Berlin 2000 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut Inhalt Einführung 9 Hinweise 10 Literatur 10 Aufbau und Inhalt 11 Abkürzungen 12 Nachlassverzeichnis 15
Verzeichnis der Musiknachlässe in Deutschland Berlin 2000 Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut Inhalt Einführung 9 Hinweise 10 Literatur 10 Aufbau und Inhalt 11 Abkürzungen 12 Nachlassverzeichnis 15
Zu Beginn würden wir gerne Deine Meinung über Deutschlands Rolle in der Flüchtlingskrise hören.
 Seite 1 Zu Beginn würden wir gerne Deine Meinung über Deutschlands Rolle in der Flüchtlingskrise hören. 1. Bist Du mit der Entscheidung der Bundesregierung einverstanden, die Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen?
Seite 1 Zu Beginn würden wir gerne Deine Meinung über Deutschlands Rolle in der Flüchtlingskrise hören. 1. Bist Du mit der Entscheidung der Bundesregierung einverstanden, die Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen?
Video-Thema Begleitmaterialien
 DIE DEUTSCHE SPRACHE IM ELSASS Das Elsass ist gleichermaßen von der deutschen wie der französischen Kultur bestimmt. Es gehörte in der Geschichte wechselnd zu einem der beiden Länder. Früher hat man hier
DIE DEUTSCHE SPRACHE IM ELSASS Das Elsass ist gleichermaßen von der deutschen wie der französischen Kultur bestimmt. Es gehörte in der Geschichte wechselnd zu einem der beiden Länder. Früher hat man hier
EINLADUNG. »Goethe-Preis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus 2008« zur feierlichen Verleihung des
 EINLADUNG zur feierlichen Verleihung des»goethe-preis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus 2008«der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kooperation mit der FAZIT-STIFTUNG 30. Januar
EINLADUNG zur feierlichen Verleihung des»goethe-preis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus 2008«der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kooperation mit der FAZIT-STIFTUNG 30. Januar
Rahmenvereinbarung. zwischen. dem Senat der Freien Hansestadt Bremen. und
 Rahmenvereinbarung zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.v. (Bremer Sinti Verein e.v. und Bremerhavener Sinti Verein e.v.) Präambel
Rahmenvereinbarung zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.v. (Bremer Sinti Verein e.v. und Bremerhavener Sinti Verein e.v.) Präambel
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Deutschland verdrängt die Wahrheit!
 Deutschland verdrängt die Wahrheit! Juristisches Vergessen? Der NS-Mord an Sinti und Roma Die juristische Behandlung der NS-Morde an Sinti und Roma und deren Wirkungen So lautet der Titel der Tagung, die
Deutschland verdrängt die Wahrheit! Juristisches Vergessen? Der NS-Mord an Sinti und Roma Die juristische Behandlung der NS-Morde an Sinti und Roma und deren Wirkungen So lautet der Titel der Tagung, die
PHILOSOPHISCHER FAKULTÄTENTAG
 HOCHSCHULPOLITISCHE VERTRETUNG DER GEISTES-, KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN AN DEN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN Plenarversammlungen des Philosophischen Fakultätentages seit 1950 und Verzeichnis der Vorsitzenden
HOCHSCHULPOLITISCHE VERTRETUNG DER GEISTES-, KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN AN DEN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN Plenarversammlungen des Philosophischen Fakultätentages seit 1950 und Verzeichnis der Vorsitzenden
Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
 Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Verleihung der 4. Martin Warnke-Medaille an Prof. Dr. Michael Hagner 23. April 2014, 19:30, Warburg-Haus
65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee Wierling, , 19:00 Uhr, FZH
 Seite 1 von 6 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN 65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee
Seite 1 von 6 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN 65. Geburtstag der Vizepräsidentin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, Frau Prof. Dr. Dorothee
Hochschulbildung nach Bologna
 Politik Thorsten Häußler Hochschulbildung nach Bologna Das Ende der humboldtschen Universitätsidee? Essay Universität der Bundeswehr München Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften Institut für
Politik Thorsten Häußler Hochschulbildung nach Bologna Das Ende der humboldtschen Universitätsidee? Essay Universität der Bundeswehr München Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften Institut für
Arbeitsblatt - Thema Landeskunde Schule
 Aufgabe 1 Welche deutschen Dichter und Schriftsteller kennt ihr? Welche Bücher haben sie geschrieben? Aufgabe 2 Seht euch die folgenden Bilder an. Kennt ihr diese deutschen Schriftsteller? Ordnet die Namen
Aufgabe 1 Welche deutschen Dichter und Schriftsteller kennt ihr? Welche Bücher haben sie geschrieben? Aufgabe 2 Seht euch die folgenden Bilder an. Kennt ihr diese deutschen Schriftsteller? Ordnet die Namen
Dankesrede zum 80. Geburtstag von Prof. Horst Naujoks. Sehr geehrter Jubilar, sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender der IFS,
 1 Dankesrede zum 80. Geburtstag von Prof. Horst Naujoks Sehr geehrter Jubilar, sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender der IFS, Frau Pfreundschuh hat eben Ihre Vita nachvollzogen. Die Rede von Frau Pfreundschuh
1 Dankesrede zum 80. Geburtstag von Prof. Horst Naujoks Sehr geehrter Jubilar, sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender der IFS, Frau Pfreundschuh hat eben Ihre Vita nachvollzogen. Die Rede von Frau Pfreundschuh
Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther"
 Germanistik Thorsten Kade Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Das Naturverständnis innerhalb der Epochen
Germanistik Thorsten Kade Naturverständnis und Naturdarstellung in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Das Naturverständnis innerhalb der Epochen
LITERATUR II. Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 LITERATUR II Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Themenkreis 5 STURM UND DRANG Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte (1983, 204) In
LITERATUR II Lehrstuhl für Germanistik, Päd. Fakultät der Karls-Universität in Prag PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. Themenkreis 5 STURM UND DRANG Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte (1983, 204) In
Das Forschungsranking
 Centrum für Hochschulentwicklung Das Forschungsranking deutscher Universitäten Analysen und Daten im Detail Jura Dr. Sonja Berghoff Dipl.-Soz. Gero Federkeil Dipl.-Kff. Petra Giebisch Dipl.-Psych. Cort-Denis
Centrum für Hochschulentwicklung Das Forschungsranking deutscher Universitäten Analysen und Daten im Detail Jura Dr. Sonja Berghoff Dipl.-Soz. Gero Federkeil Dipl.-Kff. Petra Giebisch Dipl.-Psych. Cort-Denis
The bilingual tour. Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor
 The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer. anlässlich des Empfanges der. Theodor-Körner-Preisträger. am Montag, dem 24.
 - 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
- 1 - Worte von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer anlässlich des Empfanges der Theodor-Körner-Preisträger am Montag, dem 24. April 2006 Meine Damen und Herren! Tradition ist Schlamperei, meinte einst Gustav
Mehr Miteinander. Ottweiler / Neunkirchen, 19. Januar
 Mehr Miteinander In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an eine öffentliche Verwaltung entscheidend verändert. Gefordert ist ein neues Verständnis von Miteinander, von Bürgern
Mehr Miteinander In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an eine öffentliche Verwaltung entscheidend verändert. Gefordert ist ein neues Verständnis von Miteinander, von Bürgern
Sonntag, 30. August Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg
 1 Sonntag, 30. August 2015 Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, chers amis de Vierzon, zunächst ein herzliches Dankeschön,
1 Sonntag, 30. August 2015 Würdigung der Städtepartnerschaft durch die Stadt Rendsburg Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, chers amis de Vierzon, zunächst ein herzliches Dankeschön,
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
 Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Dr. Philipp Rösler anlässlich der Jahreskonferenz der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft [Rede in Auszügen] Datum: 14.12.2012 Ort: axica, Berlin
Ansprache zum 25. Geburtstag der Freien Waldorfschule am Bodensee in Überlingen-Rengoldshausen Seite 1
 Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Ein Land mit einem einzigen Begriff abzustempeln ist ziemlich gefährlich
 1 Ein Land mit einem einzigen Begriff abzustempeln ist ziemlich gefährlich Ein Interview der Kinderreporter des Bösen Wolfes mit Jerzy Margański, Botschafter der Republik Polen in Deutschland Können Sie
1 Ein Land mit einem einzigen Begriff abzustempeln ist ziemlich gefährlich Ein Interview der Kinderreporter des Bösen Wolfes mit Jerzy Margański, Botschafter der Republik Polen in Deutschland Können Sie
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 103-2 vom 3. Oktober 2008 Rede des Präsidenten des Bundesrates und Ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg, Ole von Beust, beim Festakt zum Tag der Deutschen
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 103-2 vom 3. Oktober 2008 Rede des Präsidenten des Bundesrates und Ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg, Ole von Beust, beim Festakt zum Tag der Deutschen
1 / 12 ICH UND DIE FREMDSPRACHEN. Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse (Luxemburg) Februar - März 2007
 1 / 12 Projet soutenu par la Direction générale de l Education et de la Culture, dans le cadre du Programme Socrates ICH UND DIE FREMDSPRACHEN Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
1 / 12 Projet soutenu par la Direction générale de l Education et de la Culture, dans le cadre du Programme Socrates ICH UND DIE FREMDSPRACHEN Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
Die Antworten auf den wachsenden Rechtspopulismus im Alpenraum
 Politik Oliver Neumann Die Antworten auf den wachsenden Rechtspopulismus im Alpenraum Ein Vergleich der Reaktionen in den Parteienwettbewerben der Schweiz und Österreichs auf die zunehmend restriktive
Politik Oliver Neumann Die Antworten auf den wachsenden Rechtspopulismus im Alpenraum Ein Vergleich der Reaktionen in den Parteienwettbewerben der Schweiz und Österreichs auf die zunehmend restriktive
Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt
 Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Verbindung nach oben Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt Hier sind vier Bilder. Sie zeigen, was Christ sein
Kontakt: Anna Feuersänger 0711 1656-340 Feuersaenger.A@diakonie-wue.de 1. Verbindung nach oben Arbeitsblatt 7: Verbindung nach oben zum 10. Textabschnitt Hier sind vier Bilder. Sie zeigen, was Christ sein
I. Der Auftakt der Romantik
 I. Der Auftakt der Romantik Das Zeitalter der Romantik Jugend, Lebenskraft, ein großzügiges Bekenntnis zur Kunst, übertriebene Leidenschaften. Begleitet von Erregung, Irrtümern und Übertreibung eine an
I. Der Auftakt der Romantik Das Zeitalter der Romantik Jugend, Lebenskraft, ein großzügiges Bekenntnis zur Kunst, übertriebene Leidenschaften. Begleitet von Erregung, Irrtümern und Übertreibung eine an
MITARBEITERMOTIVATION:
 MITARBEITERMOTIVATION: EMOTIONEN SIND ENTSCHEIDEND Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_111512_wp WARUM EMOTIONEN
MITARBEITERMOTIVATION: EMOTIONEN SIND ENTSCHEIDEND Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_111512_wp WARUM EMOTIONEN
Letzte Bücher aus der DDR Premieren & Bestseller 1989/90
 I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince"
 Sprachen Hannah Zanker Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince" Facharbeit (Schule) 1 Maristenkolleg Mindelheim Kollegstufenjahrgang 2009/2011 Facharbeit aus
Sprachen Hannah Zanker Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince" Facharbeit (Schule) 1 Maristenkolleg Mindelheim Kollegstufenjahrgang 2009/2011 Facharbeit aus
Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern?
 Germanistik Mian Fu Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern? Essay Universität Tübingen Philosophische Fakultät Deutsches Seminar Sommersemester 2011 HS Mehrsprachigkeit
Germanistik Mian Fu Inwiefern kann Kinderliteratur den Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern fördern? Essay Universität Tübingen Philosophische Fakultät Deutsches Seminar Sommersemester 2011 HS Mehrsprachigkeit
ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 SEKUNDARSCHULE. Deutsch. Schuljahrgang 6
 ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 5 SEKUNDARSCHULE Deutsch Schuljahrgang 6 10 Arbeitszeit: 45 Minuten 15 20 25 Name, Vorname: 30 Klasse: Seite 1 von 5 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben
ZENTRALE KLASSENARBEIT 2009 5 SEKUNDARSCHULE Deutsch Schuljahrgang 6 10 Arbeitszeit: 45 Minuten 15 20 25 Name, Vorname: 30 Klasse: Seite 1 von 5 Lies den Text gründlich! Bearbeite anschließend alle Aufgaben
Der Fall Gurlitt Kunstgeschichte daraus gelernt?
 Der Fall Gurlitt Kunstgeschichte daraus gelernt? Bonn, 4. Juli 2014 Der Fall Gurlitt daraus gelernt? Podiumsdiskussion Bonn, den 4. Juli 2014, 19:00 Uhr Kein anderes Thema hat in vergleichbarer der letzten
Der Fall Gurlitt Kunstgeschichte daraus gelernt? Bonn, 4. Juli 2014 Der Fall Gurlitt daraus gelernt? Podiumsdiskussion Bonn, den 4. Juli 2014, 19:00 Uhr Kein anderes Thema hat in vergleichbarer der letzten
Europa macht Schule. Ein Programm zur Förderung der europäischen Begegnung
 Europa macht Schule Ein Programm zur Förderung der europäischen Begegnung Europa macht Schule wird... Durchgeführt von Gefördert vom Koordiniert vom Unterstützt durch 2 Die Idee des Programms Gaststudierende
Europa macht Schule Ein Programm zur Förderung der europäischen Begegnung Europa macht Schule wird... Durchgeführt von Gefördert vom Koordiniert vom Unterstützt durch 2 Die Idee des Programms Gaststudierende
Goethe-Medienpreis für hochschul- und wissenschaftspolitischen Journalismus. Statut
 Goethe-Medienpreis für hochschul- und wissenschaftspolitischen Statut 1 Präambel Wissenschafts- und hochschulpolitischer Journalismus ist eine noch vergleichsweise junge Sparte des Medienschaffens. Diesen
Goethe-Medienpreis für hochschul- und wissenschaftspolitischen Statut 1 Präambel Wissenschafts- und hochschulpolitischer Journalismus ist eine noch vergleichsweise junge Sparte des Medienschaffens. Diesen
kultur- und sozialwissenschaften
 Helga Grebing Überarbeitung und Aktualisierung: Heike Dieckwisch Debatte um den Deutschen Sonderweg Kurseinheit 2: Preußen-Deutschland die verspätete Nation? kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist
Helga Grebing Überarbeitung und Aktualisierung: Heike Dieckwisch Debatte um den Deutschen Sonderweg Kurseinheit 2: Preußen-Deutschland die verspätete Nation? kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist
PR ist Pflicht. Jan R. Krause Prof. Dipl.-Ing BDA DWB AMM Architektur Media Management Hochschule Bochum
 PR ist Pflicht Jan R. Krause Prof. Dipl.-Ing BDA DWB AMM Architektur Media Management Hochschule Bochum Unter Journalisten auch Kulturredakteuren gibt es eine Verunsicherung, was die Bedeutung und Bewertung
PR ist Pflicht Jan R. Krause Prof. Dipl.-Ing BDA DWB AMM Architektur Media Management Hochschule Bochum Unter Journalisten auch Kulturredakteuren gibt es eine Verunsicherung, was die Bedeutung und Bewertung
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Leitbild
 Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
1. Wo bin ich? Inventur.
 Wo stehen Sie? Seite 9 Was sind Sie sich wert? Seite 12 Wer raubt Ihre Energie? Seite 15 Sie wissen schon, wohin Sie wollen? Wunderbar. Nein, noch nicht? Großartig. Das Schöne am Selbstcoaching ist, dass
Wo stehen Sie? Seite 9 Was sind Sie sich wert? Seite 12 Wer raubt Ihre Energie? Seite 15 Sie wissen schon, wohin Sie wollen? Wunderbar. Nein, noch nicht? Großartig. Das Schöne am Selbstcoaching ist, dass
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren,
 Es gilt das gesprochene Wort! Eröffnung der Ausstellung Entwicklungsland Bayern am 1. Februar 2012 im Maximilianeum Rede von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Liebe Kolleginnen
Es gilt das gesprochene Wort! Eröffnung der Ausstellung Entwicklungsland Bayern am 1. Februar 2012 im Maximilianeum Rede von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Liebe Kolleginnen
Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge)
 Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Bildungswissenschaft Seminar: Bildung des Bürgers Dozent: Dr. Gerstner
Friedrich Nietzsche Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Universitätsvorträge) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut für Bildungswissenschaft Seminar: Bildung des Bürgers Dozent: Dr. Gerstner
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
1 de 3 01/09/ :51
 Fassenacht erobert Europa - Merkurist.de https://merkurist.de/mainz/kultur/fassenacht-erobert-europa_3n 1 de 3 01/09/2015 10:51 Fassenacht erobert Europa - Merkurist.de https://merkurist.de/mainz/kultur/fassenacht-erobert-europa_3n
Fassenacht erobert Europa - Merkurist.de https://merkurist.de/mainz/kultur/fassenacht-erobert-europa_3n 1 de 3 01/09/2015 10:51 Fassenacht erobert Europa - Merkurist.de https://merkurist.de/mainz/kultur/fassenacht-erobert-europa_3n
Geisteswissenschaft. Carolin Wiechert. Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.
 Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Dauerausstellung
 Sperrfrist: 14. Oktober 2014, 20.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der
Sperrfrist: 14. Oktober 2014, 20.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der
Predigt über Lukas 10,38-42 am in Altdorf (Pfarrer Bernd Rexer)
 1 Predigt über Lukas 10,38-42 am 6.3.2011 in Altdorf (Pfarrer Bernd Rexer) Liebe Gemeinde, eine interessante Frage ist das: Was werden Menschen an meinem 70.Geburtstag über mich sagen? Was würde ich gerne
1 Predigt über Lukas 10,38-42 am 6.3.2011 in Altdorf (Pfarrer Bernd Rexer) Liebe Gemeinde, eine interessante Frage ist das: Was werden Menschen an meinem 70.Geburtstag über mich sagen? Was würde ich gerne
Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien
 Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Englisch Florian Schumacher Faschismus und Anti-Faschismus in Großbritannien Studienarbeit Inhaltsverzeichnis I. Der Faschismus in Großbritannien vor 1936... 2 1. Die Ausgangssituation Anfang der zwanziger
Es ist heute modern geworden, in allen Bereichen und auf allen. möglichen und unmöglichen Gebieten rankings zu
 Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Gustav Klimt und die Kunstschau 1908 am Dienstag, dem 30. September im Belvedere Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist heute modern
Rede von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer zur Eröffnung der Ausstellung Gustav Klimt und die Kunstschau 1908 am Dienstag, dem 30. September im Belvedere Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist heute modern
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation
 Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Leibniz. (G.W.F. Hegel)
 Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
Leibniz 3. Der einzige Gedanke den die Philosophie mitbringt, ist aber der einfache Gedanke der Vernunft, dass die Vernunft die Welt beherrsche, dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen
Sehr geehrter Herr Knoll, sehr geehrte Frau Professorin Dr. Mandel, meine sehr verehrten Damen und Herren,
 1 Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung der Folgeveranstaltung Be Berlin - be diverse Best-Practise-Beispiele am Dienstag, dem 25. Mai 2010 um 18.00 Uhr Hertie-School of Governance,
1 Grußwort von Kulturstaatssekretär André Schmitz zur Eröffnung der Folgeveranstaltung Be Berlin - be diverse Best-Practise-Beispiele am Dienstag, dem 25. Mai 2010 um 18.00 Uhr Hertie-School of Governance,
Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse
 Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse E.Meessen/U.Minnich Die Realschule Am Stadtpark bietet das Fach Praktische Philosophie für die 5. und 6. Klasse an. Alle Kinder, die nicht am herkömmlichen
Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse E.Meessen/U.Minnich Die Realschule Am Stadtpark bietet das Fach Praktische Philosophie für die 5. und 6. Klasse an. Alle Kinder, die nicht am herkömmlichen
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Ja zur Einbürgerung Einbürgerungskampagne starten!
 Bürgerbüro DR. PANTAZIS MdL Schloßstraße 8 / 2. Etage 38100 Braunschweig Bürgerbüro DR. PANTAZIS MdL Volksfreundhaus Schloßstraße 8 / 2. Etage 38100 Braunschweig Fon: +49 531 4827 3220 Fax: +49 531 4827
Bürgerbüro DR. PANTAZIS MdL Schloßstraße 8 / 2. Etage 38100 Braunschweig Bürgerbüro DR. PANTAZIS MdL Volksfreundhaus Schloßstraße 8 / 2. Etage 38100 Braunschweig Fon: +49 531 4827 3220 Fax: +49 531 4827
Englisch über alles!" A Heute weiß doch jeder, dass Englisch die Sprache der Zukunft
 Inhaltsverzeichnis Englisch über alles!" A Heute weiß doch jeder, dass Englisch die Sprache der Zukunft ist!" 1 Eine einheitliche Weltsprache ist der Schlüssel zu Völkerverständigung und Weltfrieden. Diese
Inhaltsverzeichnis Englisch über alles!" A Heute weiß doch jeder, dass Englisch die Sprache der Zukunft ist!" 1 Eine einheitliche Weltsprache ist der Schlüssel zu Völkerverständigung und Weltfrieden. Diese
Die Herausforderung der Heiligkeit Gottes
 Der menschliche Geist kann enorme Mühsal ertragen, wenn er in seiner Situation einen Sinn erkennen kann. Aber das Fehlen von Sinn macht die Lage unerträglich. 1 Daraufhin rief David erneut alle besonders
Der menschliche Geist kann enorme Mühsal ertragen, wenn er in seiner Situation einen Sinn erkennen kann. Aber das Fehlen von Sinn macht die Lage unerträglich. 1 Daraufhin rief David erneut alle besonders
Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus!
 Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich habe die Wahl mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen. Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die diese Funktion
Hochverehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich habe die Wahl mit großer Freude und Dankbarkeit angenommen. Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die diese Funktion
"Im 21. Jahrhundert sind formalisierte CSR-Richtlinien für Unternehmen einfach unabdingbar"
 Friedrichshafen, 24.05.2011 "Im 21. Jahrhundert sind formalisierte CSR-Richtlinien für Unternehmen einfach unabdingbar" Friedrichshafen - Im Vorfeld der 18. OutDoor in Friedrichshafen (14.-17. Juli 2011)
Friedrichshafen, 24.05.2011 "Im 21. Jahrhundert sind formalisierte CSR-Richtlinien für Unternehmen einfach unabdingbar" Friedrichshafen - Im Vorfeld der 18. OutDoor in Friedrichshafen (14.-17. Juli 2011)
Rede zum Thema Patriotismus, Mitgliederehrung CDU Steinwenden am
 Rede zum Thema Patriotismus, Mitgliederehrung CDU Steinwenden am 20.10.2005 Wir kommen zu einem sehr persönlichen Teil des heutigen Abends. Es ist für mich eine besondere Ehre, ein Grußwort für lang gediente
Rede zum Thema Patriotismus, Mitgliederehrung CDU Steinwenden am 20.10.2005 Wir kommen zu einem sehr persönlichen Teil des heutigen Abends. Es ist für mich eine besondere Ehre, ein Grußwort für lang gediente
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Sperrfrist: Uhr. Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort
 Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Sperrfrist: 16.00 Uhr Rede des Präsidenten des Nationalrates im Reichsratssitzungssaal am 14. Jänner 2005 Es gilt das gesprochene Wort Meine Damen und Herren! Wir haben Sie zu einer Veranstaltung ins Hohe
Zehntes Kolloquium Luftverkehr an der Technischen Universität Darmstadt
 Zehntes Kolloquium Luftverkehr an der Technischen Universität Darmstadt August Euler-Luftfahrtpreis Verleihung Neue Märkte und Technologietrends im Luftverkehr WS 2002/2003 Herausgeber: Arbeitskreis Luftverkehr
Zehntes Kolloquium Luftverkehr an der Technischen Universität Darmstadt August Euler-Luftfahrtpreis Verleihung Neue Märkte und Technologietrends im Luftverkehr WS 2002/2003 Herausgeber: Arbeitskreis Luftverkehr
FACHBEREICH 2. FREMDSPRACHE. "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt" Ludwig Wittgenstein,Tractatus
 FACHBEREICH 2. FREMDSPRACHE An der IGS Garbsen wird eine zweite Fremdsprache als Wahlpflichtunterricht ab dem 6. Jahrgang mit vier Wochenstunden für Schülerinnen und Schüler angeboten. Es besteht die Möglichkeit,
FACHBEREICH 2. FREMDSPRACHE An der IGS Garbsen wird eine zweite Fremdsprache als Wahlpflichtunterricht ab dem 6. Jahrgang mit vier Wochenstunden für Schülerinnen und Schüler angeboten. Es besteht die Möglichkeit,
150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von
 150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von 1863-2013 Vier Generationen von Numismatikern, Kunsthistorikern und Archäologen haben dazu beigetragen, «Cahn» zu einem der führenden Namen im Kunsthandel zu machen.
150 Jahre CAHN - die Firmengeschichte von 1863-2013 Vier Generationen von Numismatikern, Kunsthistorikern und Archäologen haben dazu beigetragen, «Cahn» zu einem der führenden Namen im Kunsthandel zu machen.
Eine Auswahl von newsticker Artikeln mit Übungen
 Eine Auswahl von newsticker Artikeln mit Übungen April 2007 Inhalt ADOLF-GRIMME-PREIS Am Freitag ist die Gala 6 EIN KLEINER EISBÄR Viele Besucher 8 EIN SMARTER PREIS Wie Wissen Spaß macht 10 AUS DER WELT
Eine Auswahl von newsticker Artikeln mit Übungen April 2007 Inhalt ADOLF-GRIMME-PREIS Am Freitag ist die Gala 6 EIN KLEINER EISBÄR Viele Besucher 8 EIN SMARTER PREIS Wie Wissen Spaß macht 10 AUS DER WELT
Geisteswissenschaft. Karin Luther
 Geisteswissenschaft Karin Luther Was bedeutet Resilienz und kann es SozialarbeiterInnen ein Handlungsmodell bieten, welches sich in Verbindung mit der Lebensweltorientierung bringen lässt? Betrachtung
Geisteswissenschaft Karin Luther Was bedeutet Resilienz und kann es SozialarbeiterInnen ein Handlungsmodell bieten, welches sich in Verbindung mit der Lebensweltorientierung bringen lässt? Betrachtung
Begrüßungs-/Eröffnungsrede. des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern. Serhat Sarikaya
 1 Entwurf Begrüßungs-/Eröffnungsrede des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern Serhat Sarikaya anlässlich der Ehrung der Mitglieder des SPD Stadtverbands Sundern am 24. September 2016 Ehrengast: Bundeskanzler
1 Entwurf Begrüßungs-/Eröffnungsrede des Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Sundern Serhat Sarikaya anlässlich der Ehrung der Mitglieder des SPD Stadtverbands Sundern am 24. September 2016 Ehrengast: Bundeskanzler
INHALT. Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11
 INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
INHALT Geleitwort... 7 Hans-Gert Roloff Manfred Lemmer zum Gedenken...11 Irene Roch-Lemmer Zur Übergabe des Silberbechers an die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle am 27. November 2009... 31 Irene
Aus dem Vorstand. Liebe Mitglieder des MPW! 25 Jahre MPW - ein heißer Abend in der Amber Suite im Berliner Ullsteinhaus. Nr. 4/2015.
 Aus dem Vorstand Nr. 4/2015 Juli 2015 Liebe Mitglieder des MPW! Wir wünschen Ihnen allen für die jetzt begonnene Sommer- und damit auch Hauptferienzeit erholsame Tage und Stunden, gutes Wetter und viele
Aus dem Vorstand Nr. 4/2015 Juli 2015 Liebe Mitglieder des MPW! Wir wünschen Ihnen allen für die jetzt begonnene Sommer- und damit auch Hauptferienzeit erholsame Tage und Stunden, gutes Wetter und viele
Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr
 Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Dr. Reinhard Brandl Mitglied des Deutschen Bundestages Rede im Deutschen Bundestag am 13. Februar 2014 Wir stehen langfristig zu dieser Unterstützung Rede zum ISAF-Einsatz der Bundeswehr Plenarprotokoll
Thomas-Akademie Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch EINLADUNG
 Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
B e h ö r d e f ü r W i s s e n s c h a f t u n d F o r s c h u n g DIE SENATORIN
 Seite 1 von 8 Freie und Hansestadt Hamburg B e h ö r d e f ü r W i s s e n s c h a f t u n d F o r s c h u n g DIE SENATORIN Eröffnung der Mediale Hamburg 18.9.2014, 11:30 Uhr, Universität Hamburg, Audimax
Seite 1 von 8 Freie und Hansestadt Hamburg B e h ö r d e f ü r W i s s e n s c h a f t u n d F o r s c h u n g DIE SENATORIN Eröffnung der Mediale Hamburg 18.9.2014, 11:30 Uhr, Universität Hamburg, Audimax
Kinderrechte und Glück
 Kinderrechte gibt es noch gar nicht so lange. Früher, als euer Urgroßvater noch ein Kind war, wurden Kinder als Eigentum ihrer Eltern betrachtet, genauer gesagt, als Eigentum ihres Vaters. Er hat zum Beispiel
Kinderrechte gibt es noch gar nicht so lange. Früher, als euer Urgroßvater noch ein Kind war, wurden Kinder als Eigentum ihrer Eltern betrachtet, genauer gesagt, als Eigentum ihres Vaters. Er hat zum Beispiel
In Zusammenarbeit mit:
 Programm veranstaltungsreihe Deutsch 3.0 In Zusammenarbeit mit: DEUTSCH 3.0 eine spannende Reise in die Zukunft unserer Sprache. Jetzt. ZUKUNFT ERKUNDEN: Unsere Sprache im Spannungsfeld unserer sozialen,
Programm veranstaltungsreihe Deutsch 3.0 In Zusammenarbeit mit: DEUTSCH 3.0 eine spannende Reise in die Zukunft unserer Sprache. Jetzt. ZUKUNFT ERKUNDEN: Unsere Sprache im Spannungsfeld unserer sozialen,
