Zusammenfassung Biologie II/B Universität Köln 2005
|
|
|
- Cornelius Kneller
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zusammenfassung Biologie II/B Universität Köln 2005 Autor: Denis Meuthen Bei Verbesserungsvorschlägen, Fragen und sonstigem Kontaktinteresse wenden Sie sich über an mich. Ich übernehme keine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit.
2 Fungi-Pilze Allgemein: - Pilz = Geflecht aus Pilzfäden(Hyphen), viele Hyphen=Mycel -Proteinbildung im gesamten Mycel, u.a. auch Enzyme -Hyphen können septiert oder unseptiert(coenocytisch=mehrkernig) auftreten -Kerne von Hyphen sind haploid -Zellwand aus Chitin vorhanden -Ernährung: heterotroph (Enzymfreisetzung durch Hyphen auf die Nahrungsquelle) -umfangreiche Generationswechsel mit sexueller und asexueller Vermehrung vorhanden Chytridiomycetes: Generationswechsel: Männliche/weibliche Gametangien/Gameten aus reifem Gametophyt (Anisogamie) befruchten einander Zygote Sporophyt, dann 2 Wege: entweder: aus den asexuellen dünnwandigen Sporangien Zoosporen, die zu neuen Sporophyten werden oder: durch Meiose der ausdauernden sexuellen Sporangien -> haploide Zoosporen, die wieder zum Gametophyten werden. Eigenschaften: -begeißelte Zellen mit Schubgeißel (ophistokont) -vorwiegend aquatisch lebend, teilweise parasitär -Allomyces=isomorpher Generationswechsel, andere Chytridiomyceten= heteromorpher Generationswechsel Zygomycetes: Generationswechsel: Isocystogamie Aus den coenocytischen Hyphen wachsen Ausläufer (Stolonen) 2 Stolone berühren sich (ein + Stolon und ein Stolon) haploide Zellkerne verschmelzen miteinander bilden Zygosporangium Coenozygotie (Ruhephase nach Verschmelzung) daraus entstehen Sporangiophoren (Sporangienträger) mit Sporangien Endosporen leiten asexuelle Phase ein Eigenschaften: -leben parasitisch auf lebenden oder toten Organismen -siphonale Zellen (schlauchförmige und vielkernige Zellen ohne Zellwände) Ascomycetes: Generationswechsel: Im Ascokarp(=Fruchtkörper) der Ascomyceten befinden sich sterile, haploide Hyphen und dikaryotische ascogene Hyphen. Letztere bilden Haken, deren Spitzen 2 genetisch unterschiedliche Zellkerne enthalten Meiotische Teilungen der Zellkerne Bildung der haploiden Ascosporen in Haken Ascosporen leiten die asexuelle Phase ein (Vermehrung durch Sporen(=Konidien)) Durch Plasmogamie verwachsen ein Ascogon (männlicher Gametophyt) und ein Antheridium(weiblicher Gametophyt) über eine Trichogyne( Kanälchen ) zusammen und tauschen ihre Zellkerne aus. Entwicklung von ascogenen diploiden Hyphen Bildung eines neuen Ascokarp Eigenschaften: -grosse biologische Diversität -meist saprotroph(=parasiten an toten Organismen), selten parasitisch auf lebenden Organismen -Konidien als externe Sporenbildung im Gegensatz zur inneren Sporenbildung der Zygomyceten
3 Basidiomycetes: Generationswechsel: Tertiäres dikaryotisches Mycel im Basidiokarp(Fruchtkörper) bildet wie Ascomyceten Haken Meiotische Teilungen der Zellkerne (Dikaryophyse) Bildung der Basidiosporen, die durch Abschnürungen (Basidien) von ihrer Mutterzelle getrennt werden. Keimen der Sporen monokaryotisches primäres Mycel entsteht. Durch Plasmogamie verwachsen beide Mycelarten und tauschen Zellkerne aus dadurch entstehendes dikaryotisches sekundäres Mycel bildet neues Basidiokarp (teritäres Mycel) aus. Eigenschaften: -umfassen zwei Drittel der lebenden Biomasse des Bodens(leben oft im Mycorrhiza mit Bäumen) -Erkennung durch eine Hypheneigenart: sie liegen septiert vor, die Septen sind perforiert. Die Septenporen heissen Doliporus, auf beiden Seiten der Doliporiae befinden sich Kappen, Parenthosomen genannt. -Teilung der Spitzenzellen des sekundäres Mycels durch Schnallenbildung (Sinn: Bei jeder Zellteilung muss in jeder Tochterzelle ein Kern jeder Art vorhanden sein.)ergebnis: Paarkernmycel. -Schlauchpilze, Schleimpilze, Ständerpilze als grobe Einteilung Phycophyta-Algen Allgemein: -einfach gebaute eukaryontische Pflanzen -hauptsächlich zur Photosynthese befähigte Pflanzen -vielfältige verschiedene Organisationsstufen -hohe biologische Diversität (10% aller Pflanzenarten sind Algenarten), sehr häufiges Auftreten in fast jedem Lebensraum -Blütezeit der Algen vor ca. 2 Mrd. Jahren bis heute, vorhanden aber schon seit 4 Mrd. Jahren. Algen, die durch primäre Endocytobiose entstanden sind Cyanobakterien (Blaualgen): -besitzen Gasvesikel zum Auftrieb im Wasser -Phycobilisomen auf der Thyklaoidmembran vorhanden (Proteinkomplex als Lichtsammelantenne für Photosynthese) -Allophycocyanin als Photosynthesefarbstoff, eine Wellenlänge von 630 nm (Blaulicht) ist ideal. -Zwischen Heterocysten(vergrößerte Zellen zur Fixierung von Stickstoff zwecks Umwandlung in Ammonium) und vegetativen Zellen ist ein Stoffluss vorhanden. CH2O fließt von den vegetativen Zellen zu den Heterocysten, während umgekehrt ein Austausch von Glutamin erfolgt. -gram-negative Zellwand mit 2 Membranen vorhanden, ausserhalb liegt eine einhüllende Scheide vor. Glaucocystophyceae: -nonadale, capsale, coccale Organisationen -pflanzt sich ungeschlechtlich fort -enthalten ein Plastid, dass von einer Peptidoglucan-Zellwand umgeben ist (Hinweis auf symbiontisch lebende Bakterie) -sind begeißelt, haben 2 ungleiche Flagellen, Flagellen bestehen nicht aus Mikrotubuli -Phycobilisomen vorhanden (Proteinkomplex als Lichtsammelantenne für Photosynthese) -Bei der Mitose liegt eine eine offene Mitosepindel vor -Mitochondrien besitzen flache Cristae -Sie besitzen ein flaches Lakunensystem (Alveolae)
4 Rhodophyceae (Rotalgen): -hauptsächlich marin lebend -besitzen Rhodoplasten, die aus Phycobilisomen, Thklaoiden und einer Chromatophorenmembran bestehen -keine Geißeln, keine Centriolen(=Mikrotubuli) vorhanden -extraplastidäre Stärke - Fähigkeit zur Bildung von Pyrenoiden verlorengegangen Generationswechsel: Im Perikarp ist ein Karposporophyt enthalten, der Karposporangien produziert und freilässt. Auskeimen der Karposporen Entwicklung eines Tetrasporophyten Tetrasporangien werden frei und bilden sowohl männliche als auch weibliche Gametophyten. Spermatangien des männlichen Gametophytes befruchten das Ei im Karpogon des weiblichen Gametophyten über eine Trichogyne Aus dem Zygotenkern entwickelt sich anschliessend wieder der Karposporophyt Unterklassen: Cyanidiophyceae: -einzellig -ungeschlechtliche Fortpflanzung, geschlechtliche unbekannt -keine Pyrenoide -leben in heissen, sauren Schwefelquellen Bangiophyceae: -einkernige Zellen -axialer, sternförmiger Rhodoplast -interkalare Zellteilungen -keine Tüpfelverbindungen -kein Karposporophyt, sondern direkt das Karpogon bildet Karposporen Florideophyceae: -mehrkernige Rotalge Viridiplantae: -besitzen Chloroplasten -in der Geißelübergangsregion liegt eine sternförmige Struktur vor -besitzen Plectenchyme (blattartige Zellen) Unterklassen: Chlorophyta Streptophyta (u.a. Landpflanzen) Algen, die durch sekundäre Endocytobiose entstanden sind -besitzen komplexe Plastiden -besitzen einen Nucleomorph (ehemaliger Nucleus des Endosymbionten) Heterokontae: Chrysophycae (Goldalgen): -Chlorophyll a und c vorhanden -akzessorisches Pigment Fucoxanthin für goldene Farbe verantwortlich -enthalten 1 bis 2 grosse Chloroplasten -einige Arten haben Zellwände aus Cellulose, andere wieder gar keine Zellwand -Synura ist beweglich und koloniebildend, ihre Zellen sind von Kieselschuppen bedeckt. Diese Schuppen werden in Vesikeln gebildet und nach außen transportiert -Fortpflanzung hauptsächlich ungeschlechtlich, einige Arten über Zoosporen, andere wenige pflanzen sich auch geschlechtlich fort
5 Bacillariophyceae (Kieselalgen): -einzellig, selten koloniebildend -sehr häufig vorkommend (25% der Biomasse der Erde) -unbegeißelt -besitzen eine zweiteilige Hülle = Frustulum, überlappende Hälften = Valven -Unterscheidung durch Symmetrie: Pennales (bilateralsymmetrisch) und Centrales (radiärsymmetrisch) -Chloroplasten enthalten Chlorophyll a und c nebst Fucoxanthin -Reservestoff: Laminaran wird in Vakuolen gespeichert -hauptsächlich photoautotroph lebend, einige heterotroph. -Mittelleiste wird Raphe genannt Generationswechsel: -hauptsächlich ungeschlechtlich durch Zweiteilung -jede Tochterzelle bekommt eine der Schalenhälften der Mutterzelle jede Generation wird etwas kleiner -geschlechtlicher Zyklus (Oogamie):, beide Tochterzellen unterziehen sich der Meiose und bilden sowohl Spermien als auch Eizellen. Die begeißelten Spermien werden durch Zerstörung der männlichen Alge freigesetzt, während das weibliche Gegenstück die Eizelle im Algenkörper behält und auf die Befruchtung durch die Spermie wartet. Es entsteht eine Zygote die sich wieder ungeschlechtlich fortpflanzt -Bei pennalen Algen sind beide Gameten unbegeißelt, es liegt Isogamie vor. Phaeophycae (Braunalgen): -fast ausschliesslich marin lebend -Vegetationskörper= Thallus -Chloroplasten enthalten Chlorophyll a und c nebst Carotinoiden wie z.b. Fucoxanthin -Reservestoff: Laminaran wird in Vakuolen gespeichert Generationswechsel: Im reifen Sporophyt sind pluricoläre( diploide Zoosporen) und unicoläre( haploide Zoosporen) Sporangien vorhanden. Die diploiden Zoosporen bilden neue Sporophyten, während die haploiden begeißelten Zooporen männlich als auch weiblich sein können männliche und weibliche begeißelte Zoosporen bilden männliche und weibliche Gametophyten, die Spermien und Oogonien bilden. Befruchtung bringt das Oogonium in den Zygotenstadius Entwicklung des Sporophyten Xanthophycae (Gelbgrünalgen): -heterokont (=2 ungleich lange Geißeln) -Chromatophoren enthalten Chlorophyll a, c und Xanthophylle, aber kein Fucoxanthin. -Reservesubstanzen: Öl und Polysaccharide, keine Stärke -Vermehrung ungeschlechtlich, Vaucheria geschlechtlich über Oogamie. Euglenophyceae: -begeißelte Protisten (heterokont begeißelt) -Chloroplasten enthalten Chlorophyll a und c nebst diverse Carotinoiden -meist farblos und heterotroph -Augenfleck und Stigma=Lichtsinnessinn -kontraktile Vakuole für Wasserhaushalt -Reservesubstanz: Paramylon(=Polysaccharid), keine Stärke -in Plastiden proteinreich) Region(=Enzymlocus), auch Pyrenoid genannt. -Fortpflanzung asexuell durch Mitose
6 Algen, die durch tertiäre Endocytobiose entstanden sind Dinophytae (Dinoflagellaten): -besitzen 2 Furchen, in denen 2 Geißeln schlagen (Querfurche und Längsfurche) -Chromosomen bleiben spiralisiert -asexuelle Fortpflanzung: Tochterzellen bekommen einen Teil der Hülle und eine Geißel, Rest wird regeneriert -viele heterokonte Arten -bei den photoautotroph lebenden Arten nebst Chlorophyll a und c auch das Carotinoid Peridin -viele Arten bilden steife Celluloseplatten an der Aussenseite, auch Theca genannt. -Reservestubstanz: extraplastidäre Stärke -photoautotrophe Arten leben als Symbointen in Wasserlebewesen (Pflanzen und Tiere), verlieren da ihren Cellulosepanzer = Zooxanthellen -können Cyten ausbilden als Dauerstandium Lichenes-Flechten -Flechten sind Doppelorganismen, es lebt ein Pilz (Mykobiont) mit einer Alge (Photobiont, Phycobiont, Cyanobiont) in Symbiose. -Mykobionten sind meist Ascomyceten, der Rest Basidiomyceten, Cyanobionten Cyanobakterien. -Phycobionten, die nur in autotrophen Flechten vorkommen, sind Grünalgen (Chlorophyceae) -Fortpflanzung vegetativ über Soredien (Hyphenknäul, das eine Alge umschliesst), die unter der Flechtenkruste gebildet werden und dann aus der Flechtenkruste brechen -kann sehr schnell austrocknen, dadurch wird ein Leben unter harten Umweltbedingungen ermöglicht -Photosynthese nur, wenn sie mit Wasser benetzt sind, daher sehr langsames Wachstum und hohes Alter (bis >4500 Jahre) -es gibt homöomere Flechtenarten, in denen die Algenzellen gleichmässig im Thallus verteilt sind und heteromere Flechten, in denen der Thallus einseitig mit Algenzellen ausgefüllt ist. -Es gibt 3 Hauptgruppen: Laubflechten, Bartflechten, Krustenflechten, Strauchflechten Pteridophyta-Farnpflanzen Allgemein: -es liegt Heterosporie oder Isosporie vor -Antheridien sind die männlichen Gametangien, Archegonien die weiblichen. Lycopodiae (Bärlappe): -isospor (Sporen bilden zwittrige Gametophyten) Antheridien bilden Spermatozoide aus, die frei werden und die auf derselben Pflanze liegenden Archegonien befruchten aus dem Embryo entsteht ein Sporophyt innerhalb des Gametophyten, der Gametophyt verbleibt als Anhängsel des Sporophyten im Sporophytenstand(Blüten) bilden sich Sporangien, die Sporen ausreifen lassen. Selaginallaceae (Moosfarne): -heterospor (Bildung unterschiedlich grosser Sporen die zu männlichen und weiblichen Gametophyten heranwachsen) Mikrosporen werden zu einem Mikrogametophyt(Mikroprothallium), der Spermatozioden bildet der aus der Megasporenwand herausragende Megagametophyt mit Archegonien wird befruchtet, es entsteht ein junger Sporophyt im Megagametopyhten(innerhalb der Megasporenwand. Sporophyt bildet Sporophyllstände, die 2 verschiedene Sporangien enthalten: Mikrosporangien und Megasporangien, die die männlichen und weiblichen Sporen bilden. Equisetopsidae (Schachtelhalme): -isospor Antheridium bildet Spermatozoiden, diese befruchten die Archegonien auf dem zwittrigen Gametophyten junger Sporophyt bildet sich am Gametophyt anheftend es entsteht ein Sporophyt, der einen Sporophyllstand ausbildet auf diesem werden in den Sporangiophoren die Sporen gebildet, die in Hapterenform auftreten.
7 Pteriopsidae (Farne): -isospor Antheridium bildet Spermatozoiden, diese befruchten die Archegonien auf dem zwittrigen Gametophyten junger Sporophyt bildet sich am Gametophyt anheftend der ausgewachsene Sporophyt besitzt Wedel (=Megaphylle), die im Jungstadium schneckenförmig eingerollt sind An den Wedelspitzen bilden sich Sori, die Sporangien enthalten Sporangien bilden Sporen Bryophyta-Moose Allgemein: -Moose=Zwischenstadium zwischen Algen und höheren Pflanzen -kein Xylem oder Phloem -keine echten Wurzeln, nur Rhizoide zur Substratbefestigung -unvollkommenes Abschlussgewebe -Gametophyt ist die beherrschende Generation, der Sporophyt bleibt klein und mit dem Gametophyten verbunden, insofern ist er unselbstständig -besitzen Chloroplasten und Grana -Asymmetrische Geißeln -Praghmoplast (bei Mitose ausgebildeter Mikrotubuliapparat) -echte Gewebe -mehrzellige Gametangien -Zygote und Embryo auf Mutterpflanze: Gonotrophia -vielzelliger diploider Sporophyt -vielzellige Sporangien -Sporenwände aus Sporopollenin -heterophasischer-heteromorpher Geschlechtwechsel Hepatophyta (Lebermoose): Marchantiales (Thallose Lebermoose): -Gametotyp besteht aus einem Thallus und Rhizoiden -heteromorph -Gametangien sietzen auf speziellen Gametangiophoren, männliche in scheibenförmigen Antheridiophoren, weibliche in schirmförmigen Ständen, Archegoniophoren. Durch Regentropfen befruchtet der männliche Gametophyt durch Spermatozoiden den weiblichen Gametophyten, der darauf einen Embryo und einen Gametophyten ausbildet, der aber auf dem Archegonienstand des weiblichen Gametophyten verbleibt. Die Sporen werden anschliessend wieder ausgeschüttet und bilden neue weibliche und männliche Gametophyten. Jungermanniales (Beblätterte Lebermoose): -Archegonien stehen auf der Spitze der Pflanze (akrogyn) -Beblätterung: 2 seitliche Reihen von großen und eine weitere Reihe von kleinen Blättern bzw mehrlappige symmetrische Beblätterung liegt vor. -Sporen werden auf einem langen, kurzlebigen, zarten Stiel, der Seta, gebildet Anthocerotophyta (Hornmoose): -Gametophyten denen der Lebermoose ähnlich -Zellen besitzen nur einen grossen Chloroplasten -Sporophyten besitzen Stomata (Spaltöffnungen) Bryophyta (Laubmoose): -Stammmorphologie: Zentralstrang=Hadrom. Wasserleitende Zellen =Hydroiden Nährstoffleitende Zellen=Leptoiden, Stomata auf dem Gametophyten vorhanden. -kein Lignin
8 Spaghnales (Torfmoose): -sehr resistent gegenüber Austrocknung -sehr hohe Wasseraufnahmekapazität -können das 20fache ihres Trockengewichtes an Wasser speichern -Wände der Hyalocyten und des Stämmchens sind von vielen Poren zur Wasseraufnahme durchbrochen Bryidae (Laubmoose) -können aufrecht und wenig verzweigt wachsen, Sporophyten sind endständig(=akrokarp) -können nederliegend und strak verzweigt auftreten, Sporophyten wachsen seitlich (=pleurokarp), z.b. Epiphyten -Sporen keimen aus und werden zu männlichen und weiblichen Protonemata, die die Gametophyten ausknospen Es entstehen männliche und weibliche Gametophyten, die Archegonien und Antheridien ausbilden. Nach der Befruchtung bildet sich auf der Mutterpflanze eine Kalyptra mit einer Kapsel, dem Sporangium an der Spitze. Wird nach der Reifung der Kapseldeckel entfernt, werden die Sporen ausgeschüttet. Spermatophytina-Samenpflanzen Allgemein: -Generationswechsel ist versteckt, zeigt Homologien zu heterosporen Farnen -Samenpflanzen gehören wie Farne zu den Kormophyten (Wurzel, Sprossachse, Blätter) -Same statt Megaspore-werden in Samenanlangen gebildet, die in/auf Sporophyllen(=Blüten) sind. -Blüte=Kurzspross mit abgewandelten Blättern, ursprünglich eine Stauchung der Sprossachse -Gametophyten enthalten nur noch wenige Zellen, Sporophyt als dominante Generation, der weibliche Gametophyt verbleibt auf dem Sporophyten. -Embryonen sind bipolar (Wurzel und Sprssachse) -Sporophyt differenziert sich zunehmend Gymnospermae-Nacktsamer Allgemein: -Samenanlage(Archegonium) ist für Pollen(enthalten männliche Gametophyten) frei zugänglich -meistens Bäume -Antheridien fehlen Ginkgoopsida(Ginkgoartige): -bildet Spermatozoiden aus -bildet keine Früchte, sonden freie Samenanlagen -Blattnervatur ist dichotom verzweigt, zurückzuführen auf die Telomtheorie (Differenzierung der Blätter) Coniferopsida(Nadelhölzer, Nadelblättrige): -heteromorpher=antithetischer=heterophasischer Generationswechsel mit diploiden und haploiden Pflanzen -Blätter (Nadeln) befinden sich an Kurztrieben -Weiblicher Gametophyt befindet sich auf dem Jahreszuwachs in Gestalt von Zapfen, die männlichen Gametophyten auf den Verästelungen in Blütenstandform -weibliche Zapfen benötigen 2 Jahre bzw. Zapfengenerationen zur Entwicklung -diesjährige Zapfen besitzen ~32 Kerne, letztjährige hingegen bis zu 2000 Kernen freie Kernteilungen des Embryosacks, Zellwände werden nachträglich ausgebildet -Archegnoium: Aus dem Prothallium bricht ein Pollenschlauch, der von den Intine umgeben ist -im Hals der Archegonien teilt sich die spermatogene Zelle in 2 Spermazellen, eine befruchtet die Eizelle, die andere stirbt ab. -Der reife Samen wird in der dritten Zapfengeneration entlassen Cycadopsida(Palmfarne) Gnetopsida(Lianen, Rutensträucher)
9 Angiospermae-Bedecktsamer Allgemein: -Samenanlagen sind vom Fruchtknoten umhüllt -doppelte Befruchtung: ein Spermatozoid verschmilzt mit der Eizelle, das andere wandert in die Mitte des Embryosacks und verschmilzt mit den Polkernen, diese werden anschliessend zum Nährgewebe=Endosperm -die befruchtete Eizelle wandert in die Mitte des Embryosacks, ernährt sich von den Polkernen und entwickelt sich in: Suspensior, Plumula, Hypophse -Das Megasporangium=Nucellus ist die Zellschicht um den Embryosack und ist haploid, alles andere innerhalb des Embryosackes ausser den Polkernen ist diploid. -keine begeißelten Stadien -weitere Reduktion der Gametophyten -ursprünglich zwittrige Blüten -Pollenschläuche wachsen über Narbe ein -Einteilung in Dicotyledonae und Monocotyledonae (nach der Anzahl der Keimblätter) -Fruchtknoten kann oberständig, mittelständig und unterständig vorliegen -Eizelle im Pollensack ist von zwei Synergiden begleitet, am anderen Ende befinden sich drei Antipoden Blütenblätter: -Kelchblätter=Sepalen (Sepalenbreich=Calyx) Abk:K -Kronenblätter=Petalen (Petalenbereich=Corolla) Abk:C -Falls Kelch und Kronenblätter nicht unterscheidbar, werden die Blätter Periost genannt Abk:O -Staubblätter=Stamen Abk: A, bestehen aus Staubblätterm=Antheren und Staubfaden=Filament Fruchtblätter=Carpellen, können verwachsen Abk:G -Androceum=männlicher Blütenbereich -Gynoceum=weiblicher Blütenbereich -Stempel=Pistill enthält Fruchtknoten(=Ovar), hat einen Griffel und eine Narbe Monocotyledonae: -besitzen ein Keimblatt -keine Nebenblätter -meist Blattscheiden -meist wird die Hauptwurzel durch Seitenwurzeln ersetzt Dicotyledonae: -besitzen zwei Keimblätter -besitzen Nebenblätter -besitzen eine zentrale Hauptwurzel -selten Blattscheiden
10 Anatomie der Samenpflanzen Bau des Blattes -Das Blatt ist ein Grundorgan des Kormus -Alle Blattorgane sind homolog, sie entstehen aus einem Organtyp, dem Phyllom -Funktion: Photosynthese und Transpiration -enthält Stomata (Schließzellen) -Im Spross-Apikalmeristem entstehen neue Blätter -Blattprimordien=Blattanlagen -Zellteilungs- und Streckungsvorgänge laufen nicht gleichmässig ab, sondern innerhalb meristematisch aktiver Zonen -Das Blatt besteht aus Unterblattanlage=abaxial (Blattgrund, evt.2 Nebenblätter=Stipeln) und einer Oberblattanlage=adaxial(Blattspreite und Blattstiel) Blattfolge=Keimblätter(Kotyledonen), Niederblätter(vereinfachte Gestalt am Stängelgrund, oft keine Blattspreite), Laubblätter(Assilimitationsorgane), Hochblätter(vereinfachte Gestalt in Blütenstandsregion) Blütenblätter -Nadelblätter enthalten Harzkanäle in ihrer Blattepidermis, die stark cutinisiert ist. Ausprägungen der Blattspreite: Bei einem einfachen Blatt ist die Blattspreite ungeteilt. Bei zusammengesetzten Blättern gibt es mehrere Differentationen: -gefiedert (pinnat)=blättchen sitzen an einer langgestreckten Fiederspindel, der Rhachis -handförmig(digitat)=blättchen gehen alle von einem Punkt aus -fußförmig(pedat)=blätter sitzen auf einer transversal gestreckten Rhachis Es gibt überdies noch verschiedene Blattstellungen: -wechselständig=pro Knoten(Nodium) ein Blatt, wenn sie sich 180 gegenüber stehen, werden sie zweizeilig genannt -schraubig=blätter folgen in unterschiedlichen Winkeln aufeinander -wirtelig=mehr als 2 Blätter pro Nodium Blattnervatur: Die Blattspreite wird von Blattrippen/Blattnerven durchzogen, Dies sind die Leitbündel, wobei sich das Xylem adaxial und das Phloem abaxial befindet. Es gibt verschiedene Nervaturarten: -Gabel- oder Fächernervatur z,b. Gingko -Parallelnervatur, z.b. Zea mays oder andere Monokotyle -Netznervatur=tritt bei den meisten Dikotylen auf, häufigster Nervaturtyp Blattmetamorphosen: -Phyllodien=Blattspreite zurückgebildet, Verdunstungsschutz, z.b. Akazie -Blattdornen=selbe Fuktion wie Phyllodien und auch noch Fraßschutz z.b. Kakteen -Blattranken=Blattspreite zu Rankorganen umgewandelt, dient dem Kletternm z.b. Erbse -Blattsukkulenz=Blätter speichern Wasser, das Gewebe ist zu Wasserspeicherungsgewebe umgewandelt, z.b. Agaven -Zwiebel=Blattgrund, Laubblätter oder Niederblätter sind fleischig ausgebildet, speichern Wasser und Assimilate, um Zeiträume zu überdauern, z.b.allium cepa(küchenzwiebel), Narzisse
11 Bau der Wurzel -Funktion: Verankerung, Absorption, Stoffspeicherung, Stofftransport -monokotyle Pflanzen bilden ein kurzlebiges homorhizes (gleichmäßig wachsendes) Wurzelsystem -dikotyle Pflanzen besitzen ein allorhizes (mit einer dicken Pfahlwurzel) Wurzelsystem -An der Wurzelspitze befindet sich eine Kalyptra. Funktion: Schutz des Apikalmeristems, erleichtert Durchdringen des Erdreiches durch Schleimabsonderung und enthält Statolithen mit Stärkekörnern, die eine positiv geotrope Ausrichtung der Wurzel ermöglichen. -Die Wurzel wächst nach unten weiter, differenziert sich aber erst mit zunehmendem Alter zur fertigen Wurzel, aber nur die jungen Seitenwurzeln/Rhizoblasten, die immer wieder neu wachsen müssen, können ihren Funktionen: Wasser und Nährsalze absorbieren nachgehen. Das ist die Aufgabe der Rhizodermis, die im Vergleich zur Epidermis keine Cutinauflagerung und keine Stomata enthält, da sie keine Schutzfunktion erfüllen muss. Einige Rhizodermiszellen bilden such zu Rhizoblasten aus (kleine seitenwurzelartige Ausstülpungen, die der Oberflächenvergrößerung dienen). Seitenwurzeln können allerdings erst im ausdifferenzierten Bereich entstehen. -Unter der Rhizodermis befindet sich das Parenchym. Hier gibt es den apoplasmatischen und symplasmatischen Raum.. Der Wassertransport erfolgt durch Interzellulare&Zellwände=apoplasmatischer Raum, oder durch die Zellen selbst=symplasmatischer Raum. Der apoplasmatische raum wird durch das Endoderm begrenzt, da die Endodermiszellen von einer Schicht aus Cutin und Suberin umhüllt sind, dem Casparyschen Streifen, der eine Weitergabe des Wassers durch den apoplasmatischen Raum unmöglich macht. Der Zentralzylinder besteht nun aus den Elementen Xylem=Tracheen(Wasserleitung), Phloem=Siebröhren(Nährstoffleitung), Perizykel=Pericambium(Seitenwurzelbildungszone) und dem Kambium (Bildung von Phloem und Xylem. -Sekundäres Dickenwachstum an der Wurzel tritt bei dikotylen Pflanzen auf. Der Vorgang ist homolog zu dem sekundären Dickenwachstum der Sprossachse. -Wurzelmetamorphosen: Luftwurzeln(Orchideen), Rübe(Zuckerrübe, Möhre), Knolle(Dahlie), Haftwurzeln (Efeu), Stelzwurzeln(Mangroven) Bau der Sprossachse -besteht aus Parenchym, Phloem, Kambium, Xylem (von außen nach innen), einige Pflanzen besitzen noch Kollenchym und Sklerenchym als Festigungsgewebe. -Phloem, Kambium und Xylem bilden zusammen die Leitbündel -Die Siebplatten des Phloems enthalten Kallose, Tracheen und Sklerenchym enthalten Lignineinlagerungen in ihren verdickten Zellwänden -Es gibt 6 Leitbündeltypen: -radial: ein X-förmiger Xylemstrang wird in den Zwischenräumen des X mit Phloem ausgefüllt -konzentrisch: entweder mit einem ringförmigen Xylemstrang und einem Phloemteil in der Mitte (konzentrisch mit Ausßenxylem, tritt bei manchen Monokotylen wie Maiglöcken auf) oder mit einem ringförmigen Phloemstrang und Xylem in der Mitte (Gefäßstränge von einem markförmigen Siebstrang umgeben, tritt bei Farnen, Pteriopsida auf) -kollaterales Leitbündel: besitzt 3 Unterformen: geschlossen kollateral (Xylem und Phloem in Ellipsenform unregelmäßig verteilt, kein Kambium, also kein sekundäres Dickenwachstum, tritt bei den meisten Monokotylen auf), offen kollateral (Mehrere Leitbündel befinden sich kreisförmig angeordnet um die Mitte, Kambium zwischen Xylem und Phloem vorhanden, tritt bei den meisten Dikotylen auf) und bikollateral (Phloem befindet sich außen und innen, Xylem in der Mitte der Ellipse und das Kambium grenzt das Phloem beiderseits zum Xylem ab, tritt bei Cucurbitae, den Kürbisartigen auf) -Stoma (Mehrzahl Stomata), Spaltöffnung: Funktion ist die Transpriration und CO2-Aufnahme, es gibt 4 Stomatatypen: Mnium-, Gramineen-, Helleborus- und Amaryllideen-Typ Der grundlegende Aufbau ist immer gleich: in der Epidermis, vermehrt in der abaxialen(unteren) Blattseite, befinden sich 2 chloroplastenhaltige bohnenförmige Schließzellen und 4 Nebenzellen, die einen Spalt(=Torus) umgeben. Durch Turgordruckänderung werden die Schließzellen auseinandergeschoben bzw zusammengezogen, um CO2-Aufnahme zu ermöglichen bzw. H2O-Abgabe zu verhindern. Der Gramineen-Typ hat als Eigenart hantelförmige Schließzellen, die anderen Typen unterscheiden sich nur in der Zellwanddicke bestimmter Gegenden (Bauchwand, Rückwand etc.) Sprossachsenmetamorphosen: Rhizome(unterirgdisch wachsende Sprossabschnitte zur Stoffspeicherung), z.b. Spargel Spross-Sukkulenz(verdickte Sprossachse zur Wasserspeicherung) z.b. Madasgaskarpalme Stolone(kriechende Sprossabschnitte zwecks Vermehrung), z.b. Erdbeere Haustorien(Sprossabschnitte von Parasiten zwecks Eindringen in das Gewebe der Wirte),z.b. Mistel Phyllokladien(übernehmen Photosynthese anstatt von Blättern), z.b, Mäusedorn Stacheln(zwecks Fraßabwehr), z.b. Weißdorn
12 Sekundäres Dickenwachstum -tritt nur bei Dikotylen und Gymnospermen auf, da die Monokotylen ihr Kambium in der Sprosswachstumsphase (=primäres Dickenwachstum)verbrauchen! -Funktion:Stamm als Tragestütze der immer größer werdenden Krone, der Spross und die Wurzel müssen der Blattmasse angepasst sein. -unter dem primären Dickenwachstum versteht man die Apikalmeristemvergrößerung, also die Differenzierung und das Wachstum der unverholzten Sprossachse. -Das Zentrum des sekundären Dickenwachstums ist das Kambium, auch als laterales Meristem bezeichnet -Das Kambium ist nur eine Lage dick und teilt sich abwechselnd nach innen und nach außen. Innen entsteht dadurch das sekundäre Xylem=Holz und außen das sekundäre Phloem=Bast. Vor Beginn des sekundären Dickenwachstum beschränkt das Kambium sich auf die Leitbündel, später wird interfascikuläres Kambium induziert, das zwischen den Kambien der Leitbündel verläuft, um ein gleichmäßiges Dickenwachstum nach allen Seiten zu ermöglichen. -Markstrahlen haben die Funktion des transversalen Nährstoffs- und Wasserspeichers. Die primären Markstrahlen reichen vom Mark bis in die Rinde und rücken beim Dickenwachstum auseinander. -Holz besteht aus Holzparenchym(=lebende Zellen) und den toten Holzzellen(=Tracheen), die ähnlich des Xylems aufgebaut sind, aber über viel dickere Zellwände verfügen. Es gibt Frühholz, das im Frühling jedes Jahres gebildet wird, das über dünne Zellwände und über ein großes Lumen verfügt und Spätholz, das dicke Zellwände und ein kleines Lumen besitzt. Der Übergang von Frühholz zu Spätholz ist gleichmäßig, während der Spätholz-Frühholz Übergang abrupt ist. Dies ist auch der Grund für die Sichtbarkeit von Jahressringen im Holz eines Baumes. Im sekundären Phloem(=Bast) gibt es ähnliche jahreszeitliche Unterschiede, die dementsprechend Hart-(wie Spätholz) und Weichbast(wie Frühholz) genannt werden. -Im Angiospermen- und Gymnospermenholz gibt es Unterschiede. Gymnospermenholz ist homoxyl, hat viele Tracheiden, die gleichzeitig Stoffweiterleitung und Festigung dienen. Wenig Parenchym ist vorhanden und als besondere Eigenschaft liegen Harzkanäle zwecks Wundverschluss vor. Angiospermenholz dagegen ist herteoxyl, hat seperates Leit- und Festigungsgewebe(=Fasern). Die Markstrahlen sind stärker ausgeprägt als bei den Gymnospermen. -Das Abschlussgewebe nach außen beim sekundären Dickenwachstum ist das abgestorbene Periderm(=Kork), dass aus den 3 Schichten Phellogen, Phelloderm und Phellem (von innen nach außen) besteht. Das Phellogen ist ein Kambium was im späteren Verlauf der Pflanze aus der Epidermis gebildet wird und verhält sich dementsprechend homolog zum eigentlichen fascikulären und interfascikulären Kambium.
13 Kleines Fachvokabular: Phylogenese=Stammesentwicklung der Lebewesen Kladistik=phylogenische Systematik Plesiomorphie= ein Begriff der Kladistik. Es bezeichnet in der Systematik der Phylogenese Merkmale, die bereits vor der jeweils betrachteten Stammlinie entstanden sind. Der Gegenbegriff ist Apomorphie. Homoplasie= eine Ähnlichkeit, die ihre Ursache nicht in gemeinsamer Abstammung hat Monophylie= die Gruppe hat eine gemeinsame Stammform und umfasst auch alle Untergruppen, die sich von dieser Stammform herleiten sowie die Stammform selbst, jedoch keine anderen Gruppen. Paraphylie= die Gruppe (das Taxon) hat zwar eine gemeinsame Stammform, enthält aber nicht alle Gruppen eines Monophylums Glomeromycota= Arbuskuläre Mykorrhizapilze Karyogamie= Als Karyogamie bezeichnet man die Verschmelzung zweier verschiedengeschlechtlicher Zellkerne zum Zygotenkern während der Befruchtung. (diploid+diploid) Somatogamie= Mit Somatogamie bezeichnet man in der Biologie einen Sexualvorgang, bei dem normale Zellen zweier Individuen miteinander verschmelzen.(haploid+haploid=diploid) Homothallisch/heterothallisch= sexuelle Vorgänge können in einem Mycel stattfinden(=homo), hetero= nur zwischen verschiedenen genetisch kompatiblen Myceln. Hymenium=Fruchtschicht der Pilze Kleistothecium=Fruchtkörper, auch Perithecium genannt. Phragmobasidie=Unterteilung einer Basidie in mehrere Segmente, das einzellige Gegenstück ist die Holobasidie. Gymnokarp=Basidien liegen immer offen an der Hülle des Hymeniums Velum=häutige Hülle junger Pilze Anulus= die Reste der Hülle (Velum) als ringförmiger Hautlappen am Stiel von Fruchtkörpern Stromatholithen=von Algen gebildeten kuppelförmige, geschichtete Kalkmatten. Carboxysom=Polkörperchen (einer Eizelle) Auxiliarzelle=Produkt der Befruchtung bei Rhodophyta Gonimoblast=diploider Karposporophyt Mastigonemen= bei beheearten Geißeln der Name der Häärchen Alveolatae=Stamm der Dinoflagellaten Cingulum=Querflagellum bei Dinophyta Sulcus=Längsflagellum bei Dinophyta Pusule=röhrenförmiges Membransystem bei den Dinoflagellaten Paramylon=Photosyntheseprodukt von Euglena (keine Stärke!) Cytostom=Zellmund Pyknidien= Asexuelle, kugelförmige (flaschenförmige) Fruchtkörper, in denen Konidien gebildet werden. Rhizine=Befestigungsorgane auf dem Untergrund bei Flechten Haustorium=Organ zur Nährstoffaufnahme bei Schmarotzern Amphigastrium=Unterblatt der Lebermoose Elateren= hygroskopisch verformbare Fortsätze, die der Sporenausbreitung durch eine Schleuderbewegung dienen. Arillus(-anlage)=meist fleischiger Samenmantel=dient der Verbreitung durch Tiere, nur bei Gymnospermen vorhanden Kormus= Pflanzenkörper (Blatt, Stängel, Wurzel) Plumula=Sprossknospe Radicula=Primärwurzel Testa=Samenschale Scutellum=Keimblatt Perisperm=Samen der aus Nucellusgewebe gebildet wird Anastomosen=Verwachsung von Ästen und Zweigen /Leitbündeln Interkostalfelder=Aufhellungen zwischen Blattnerven Apoplasmatischer/symplasmatischer Raum= tritt nur in Wurzeln auf. Wassertransport erfolgt durch Interzellulare&Zellwände=apoplasmatischer Raum, oder durch die Zellen selbst=symplasmatischer Raum. Der Apoplasmatische raum wird durch das Endoderm begrenzt, da die Endodermiszellen von einer Schicht aus Cutin und Suberin umhüllt sind, dem Casparyschen Streifen, der eine Weitergabe des Wassers durch den apoplasmatischen Raum unmöglich macht. Amphigastrien=Auf Pflanzenunterseite der Lebermoose(Marchantiales, Jungermanniales) vorzufinden, sogenannte Unterblätter Mikropyle=kanalförmige Öfnnung im Integument des Fruchtknotens bei Angiospermen
14 Perianth=Blütenhülle=Sepalen&Petalen Pollenschlauchzelle=vegetative Zelle, der Pollenschlauch ist die Verbindung zwischen Megasporangium und der Pollenzelle(Mikrogamete), er dient der Befruchtung Sarkotesta=äussere weiche Samenschale Sklerotesta=innere harte Samenschale Funiculus=Samenstrang=Samenstielchen=Strang zwischen Samenanlage und Fruchtblatt bei Angiospermen Strobilus=konusartiger Körper bei Lycopodiae und Selaginallaceae, besteht aus Sporophyllen Transfusionsgewebe=Stofftransport zwischen Leitbahnen und Mesophyll(Parenchym), nur in Nadeln der Gymnospermen vorhanden. Gynoceum=Blütennarbe Androceum=Gesamtheit der Stamen(Staubblätter) Konnektiv= Mittelband =Fortsetzung des Staubfadens im Staubkörper (Anthere) Rezeptakel/Konzeptakel=angeschwollene Thallusspitzen=Rezeptakel, enthalten Gruben mit Sexualorganen=Konzeptakel. Tritt nur bei Phaeopyceae, bei Fucus spec. auf. Akrospore=Vermehrungsorgan bei Glaucocystophycaem aber auch =Basidiospore Cyanellen=endosymbiontisches Cyanobakterium, tritt z.b. bei Glaucocysophyceae auf Heterocysten=Zellen zur Stickstofffixierung in Cyanobacteria, befinden sich an deren Enden Spermatogene Fäden=spermienbildende Fäden Plectenchym=Pseudoparenchym=Fruchtkörper aus verklebten Hyphen bei allen Pilzen Periderm=sekundäres Abschlussgewebe, besteht aus: Phellem, Phelloderm, Phellogen (von außen nach innen) Perithecium=kugelförmige Körper, aus denen Sporen quellen, tritt nur bei Ascomyceten auf Columella=steriles Gewebe in sporenbildender Region der Sporenkörper, nur bei Ascomyceten Apokarp/synkarp=unverwachsene Blätter=akrokarp, verwachsene Blätter=synkarp Zygomorph=monosymmetrisch Wirtel= Organkreis, z.b. alle Petalen, alle Sepalen, alle Stamen etc. Fascikuläres/interfascikuläres Kambium=Fascikuläres Kambium tritt nur in den Leitbahnen auf, bei Dicotylen mit sekundärem Dickenwachstum bildet sich später ein interfascikuläres Kambium zwischen den Kambien der Leitbahnen, das anschliessend für die Bildung von sekundärem Xylem=Holz und sekundärem Phloem=Bast verantwortlich ist. Karyopse=Fruchtform Aleuron=proteinhaltiges Speichergewebe um das Endosperm herum Achäne=flugfähige Nuss der Korbblütler, besteht auf Fruchtschale und Samenschale. Beispiel: Löwenzahn Tapetum=innerste Wand des Mikrosporangiums,n enthält mehrkernige Zellen und dient der Versorgung der Mikrosporen Fruchttypen=Nuss(Erdbeere, Walnuss), Achäne(Löwenzahn), Beere(Gurke,Johannisbeere), Steinfrucht(Kirsche, Pfirsich), Balg Blattprimordien=neue Blattanlagen Blattfolge=Keimblätter, Niederblätter(an unterirdischen Sprossen), Laubblätter, Hochblätter(direkt bei Blüten) Blütenblätter Assimilat=von Pflanzen gespeicherte Energie, z.b. Photosyntheseprodukte. Die zugehörigen Assimilat- Leitbahnen sind auch als Phloem bekannt und führen Richtung Wurzeln. Suberin=befindet sich in den Zellwänden des sekundären Xylems=Holz Haustorium= Wurzel von Schmarotzern oder von Moosen, die Organeismen durch Enzymfreisetzung zerstört und aufnimmt. Endosperm=Nährgewebe für Embryo bei Pflanzen Mesophyll=Parenchym eines Blattes Megasporangium=festes fleischiges Blatt, auch Nucellus genannt=nährgewebe=perisperm, tritt nur bei Angiospermen auf. Mikrosporangium der Farne ist homolog zu dem Pollensack der Angiospermen=enthält Spermatozoiden Mikrospore=Pollenzelle= männliche Spore, kann zum männlichen Gametophyt werden Megaspore=Embryosackzelle= weibliche Spore, kann zum weiblichen Gametophyt werden Mikrosporophyll=Staubblatt=Organ das die Mikrosporangien produziert Megasporophyll=Fruchtblatt=Organ das die Megasporangien produziert Mikroprothallium=produziert Mikrogameten, darum auch Mikrogametangium (Antheridium) genannt, tritt nur bei Angiospermen auf Megaprothallium=Embyrosack, versorgt und schützt die Eizelle Mikrogameten=Spermatozoide Mikrogametopyht=Ergebnis des Mikrogameten= männliche Pflanze Magagametophyt=Megaprothallium Sporangiophor=Träger der Sporen Sporogon=Seta&Sporenkapsel=diploider Sporophyt=Sporophyt bei Moosen
Folien mit Abbildungen aus den Vorlesungen. Biodiversität der Pflanzen und Grundlagen der Anatomie und Morphologie der Pflanzen
 Folien mit Abbildungen aus den Vorlesungen Biodiversität der Pflanzen und Grundlagen der Anatomie und Morphologie der Pflanzen Mitochondrien Aktinfilamentbündel Zellwand Chloroplasten Vakuole Tonoplast
Folien mit Abbildungen aus den Vorlesungen Biodiversität der Pflanzen und Grundlagen der Anatomie und Morphologie der Pflanzen Mitochondrien Aktinfilamentbündel Zellwand Chloroplasten Vakuole Tonoplast
4. Plastiden und die Vakuole sind pflanzentypische Organellen. Charakterisieren Sie beide hinsichtlich des Aufbaus und der Funktion.
 Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Gesamtheit der Pflanzen wird nach ihrer Morphologie in drei große Organisationsstufen eingeteilt:
 Morphologie Gesamtheit der Pflanzen wird nach ihrer Morphologie in drei große Organisationsstufen eingeteilt: 1.) Protophyten = einzellige Pflanzen: z.b. Blaualgen, Bakterien (alle Zellen sind gleich,
Morphologie Gesamtheit der Pflanzen wird nach ihrer Morphologie in drei große Organisationsstufen eingeteilt: 1.) Protophyten = einzellige Pflanzen: z.b. Blaualgen, Bakterien (alle Zellen sind gleich,
Glossar Generationswechsel der Landpflanzen Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Glossar Generationswechsel der Landpflanzen Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Androeceum: Gesamtheit aller Staubblätter in einer Blüte bei Angiospermen; Angiospermen (= Bedecktsamer,
1 Glossar Generationswechsel der Landpflanzen Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Androeceum: Gesamtheit aller Staubblätter in einer Blüte bei Angiospermen; Angiospermen (= Bedecktsamer,
4. Plastiden und die Vakuole sind pflanzentypische Organellen. Charakterisieren Sie beide hinsichtlich des Aufbaus und der Funktion.
 Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Fortpflanzung. !ungeschlechtlich = vegetativ; ausschließlich über mitotische Zellteilungen Nachteil: keine Variation zwischen den Generationen
 Fortpflanzung!ungeschlechtlich = vegetativ; ausschließlich über mitotische Zellteilungen Nachteil: keine Variation zwischen den Generationen! sexuell, generativ; Verschmelzung zweier spezialisierter Zellen
Fortpflanzung!ungeschlechtlich = vegetativ; ausschließlich über mitotische Zellteilungen Nachteil: keine Variation zwischen den Generationen! sexuell, generativ; Verschmelzung zweier spezialisierter Zellen
Kapitel 03.03: Moose, Farne und Schachtelhalme
 1 Frauenhaarmoos 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Moose - Pioniere und Wasserspeicher...3 Der Generationswechsel bei Moosen...4 Die geschlechtliche Generation...5 Prothallus eines Lebermooses:... 6 Die ungeschlechtliche
1 Frauenhaarmoos 2 Inhalt...1 Inhalt... 2 Moose - Pioniere und Wasserspeicher...3 Der Generationswechsel bei Moosen...4 Die geschlechtliche Generation...5 Prothallus eines Lebermooses:... 6 Die ungeschlechtliche
Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum)
 Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum) Böhlmann, 1994 Die Systematik (Spezielle Botanik) Die Systematik hat die Aufgabe, die Vielfalt der lebenden oder fossilen Organismen (Organisationsformen) überschaubar
Gliederung der Pflanzenwelt (Stammbaum) Böhlmann, 1994 Die Systematik (Spezielle Botanik) Die Systematik hat die Aufgabe, die Vielfalt der lebenden oder fossilen Organismen (Organisationsformen) überschaubar
Überblick des Pflanzenreiches
 die pflanzliche Zelle: Spezifische Elemente Entstehung: die Endosymbiontentheorie klassische Botanik: Beschreibung der Vielfalt Ansätze zur Ordnung: Carl von Linne Arbeitsgebiete der modernen Botanik Arbeitsgebiete
die pflanzliche Zelle: Spezifische Elemente Entstehung: die Endosymbiontentheorie klassische Botanik: Beschreibung der Vielfalt Ansätze zur Ordnung: Carl von Linne Arbeitsgebiete der modernen Botanik Arbeitsgebiete
Pflanzenanatomisches Praktikum I
 Pflanzenanatomisches Praktikum I Zur Einführung in die Anatomie der Samenpflanzen von Wolfram Braune Alfred Leman Hans Taubert 8., durchgesehene und erweiterte Auflage Mit 119 Abbildungen Inhalt Erster
Pflanzenanatomisches Praktikum I Zur Einführung in die Anatomie der Samenpflanzen von Wolfram Braune Alfred Leman Hans Taubert 8., durchgesehene und erweiterte Auflage Mit 119 Abbildungen Inhalt Erster
Inhaltsverzeichnis. Vorwort... 1 Die Technik des Mikroskopierens... 1. 2 Die pflanzliche Zelle... 18. 1.1 Aufbau des Mikroskops und Strahlengang...
 VII Vorwort... V 1 Die Technik des Mikroskopierens... 1 1.1 Aufbau des Mikroskops und Strahlengang... 1 1.1.1 Okular... 1 1.1.2 Objektive... 2 1.1.3 Kondensor... 2 1.1.4 Strahlengang... 3 1.2 Handhabung
VII Vorwort... V 1 Die Technik des Mikroskopierens... 1 1.1 Aufbau des Mikroskops und Strahlengang... 1 1.1.1 Okular... 1 1.1.2 Objektive... 2 1.1.3 Kondensor... 2 1.1.4 Strahlengang... 3 1.2 Handhabung
Pflanzen. 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle
 Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
Systematik des Pflanzenreichs
 Systematik des Pflanzenreichs - teilt Pflanzen in ein sinnvolles System ein Protophyten Thallophyten Kormophyten Bakterien Blaualgen Algen, Pilze, Flechten Moose Farne Samenpflanzen Erläuterungen: Protophyten
Systematik des Pflanzenreichs - teilt Pflanzen in ein sinnvolles System ein Protophyten Thallophyten Kormophyten Bakterien Blaualgen Algen, Pilze, Flechten Moose Farne Samenpflanzen Erläuterungen: Protophyten
Fortpflanzung bei Pflanzen
 Fortpflanzungsformen: Vegetativ: ohne Änderung der Kernphase (haploid/diploid) keine Rekombination, identische Reduplikation Ziel: Massenvermehrung Sexuell: mit Änderung der Kernphase (Fusion von Gameten)
Fortpflanzungsformen: Vegetativ: ohne Änderung der Kernphase (haploid/diploid) keine Rekombination, identische Reduplikation Ziel: Massenvermehrung Sexuell: mit Änderung der Kernphase (Fusion von Gameten)
Welche zwei Membranen begrenzen das Cytopasma von der Zellwand und der Vakuole?
 Vorlesung & Übung 1 Was unterscheidet eine pflanzliche Zelle von einer tierischen Zelle? Welche zwei Membranen begrenzen das Cytopasma von der Zellwand und der Vakuole? Was ist das Plasmalemma? Was ist
Vorlesung & Übung 1 Was unterscheidet eine pflanzliche Zelle von einer tierischen Zelle? Welche zwei Membranen begrenzen das Cytopasma von der Zellwand und der Vakuole? Was ist das Plasmalemma? Was ist
Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Der von freiem Wasser unabhängige Gymnospermen-Generationswechsel erlaubt erstmals die Besiedelung
1 Generationswechsel Angiospermen (Bedecktsamer) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Der von freiem Wasser unabhängige Gymnospermen-Generationswechsel erlaubt erstmals die Besiedelung
4 Die Wurzel. 4.1 Primärer Bau
 4 Die Wurzel Die Wurzel dient typischerweise der Verankerung im Boden sowie der Wasser- und Nährsalzaufnahme. Da die Wurzeln vor allem durch Zugkräfte stark beansprucht werden und zudem biegsam sein müssen,
4 Die Wurzel Die Wurzel dient typischerweise der Verankerung im Boden sowie der Wasser- und Nährsalzaufnahme. Da die Wurzeln vor allem durch Zugkräfte stark beansprucht werden und zudem biegsam sein müssen,
Generationswechsel Polypodiales (Farne i.e.s.) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Polypodiales (Farne i.e.s.) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Im Unterschied zu den Moosen haben die Farne einen anderen Evolutionsweg beschritten. Der Generationswechsel
1 Generationswechsel Polypodiales (Farne i.e.s.) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Im Unterschied zu den Moosen haben die Farne einen anderen Evolutionsweg beschritten. Der Generationswechsel
Prokaryota. Abteilung Cyanophyta (Blaualgen, Cyanobakterien)
 Kurs 12: Algen 1 Prokaryota Abteilung Cyanophyta (Blaualgen, Cyanobakterien) 2 eukaryot. / prokaryot. Zelle 3 Abteilung Cyanophyta (Blaualgen, Cyanobakterien) Photosynthesepigmente: Chlorophyll a, Carotinoide,
Kurs 12: Algen 1 Prokaryota Abteilung Cyanophyta (Blaualgen, Cyanobakterien) 2 eukaryot. / prokaryot. Zelle 3 Abteilung Cyanophyta (Blaualgen, Cyanobakterien) Photosynthesepigmente: Chlorophyll a, Carotinoide,
Funktionen der Sprossachse. Transport Festigkeit, Skelett für Blätter Speicherung
 Die Sprossachse Funktionen der Sprossachse Transport Festigkeit, Skelett für Blätter Speicherung Aufbau der Sprossachse terminales Scheitelmeristem Nodi: Ansatzstellen der Blätter Internodien: zwischen
Die Sprossachse Funktionen der Sprossachse Transport Festigkeit, Skelett für Blätter Speicherung Aufbau der Sprossachse terminales Scheitelmeristem Nodi: Ansatzstellen der Blätter Internodien: zwischen
Sprossachse Wachstum
 Sprossachse Wachstum Achse mit Knospen Akrotoner Wuchs bei Bäumen Basitoner Wuchs bei Sträuchern Sprossachse Verzweigung dichotom = durch Längsteilung der Scheitelmeristemzelle (z.b. Kakteen)!!!!!!! exogen
Sprossachse Wachstum Achse mit Knospen Akrotoner Wuchs bei Bäumen Basitoner Wuchs bei Sträuchern Sprossachse Verzweigung dichotom = durch Längsteilung der Scheitelmeristemzelle (z.b. Kakteen)!!!!!!! exogen
Organisationsformen, Anatomie und Morphologie von Pflanzen
 Hauptvorlesung Biologie II Organisationsformen, Anatomie und Morphologie von Pflanzen Professor Dr. Donat-Peter Häder zusammengefasst von Susanne Duncker aus ihrer Mitschrift aus der Vorlesung unter Zuhilfenahme
Hauptvorlesung Biologie II Organisationsformen, Anatomie und Morphologie von Pflanzen Professor Dr. Donat-Peter Häder zusammengefasst von Susanne Duncker aus ihrer Mitschrift aus der Vorlesung unter Zuhilfenahme
Nenne die Funktionen einer Blüte, eines Blattes, der Sprossachse und der Wurzel.
 Bauplan Samenpflanze (1) Nenne die Funktionen einer Blüte, eines Blattes, der Sprossachse und der Wurzel. Blüte: geschlechtliche Fortpflanzung Schutz der Blütenorgane bei attraktiven Blüten Anlockung von
Bauplan Samenpflanze (1) Nenne die Funktionen einer Blüte, eines Blattes, der Sprossachse und der Wurzel. Blüte: geschlechtliche Fortpflanzung Schutz der Blütenorgane bei attraktiven Blüten Anlockung von
Biologie. I. Grundlegende Begriffe im Überblick:
 I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
Borke. Bast (die Rinde) Kambium. Splintholz (Weichholz) Kernholz
 Um über die verschiedenen Holzarten nähere Informationen zu erhalten ist es von Nöten, erst einmal das Grundwissen über den Aufbau des Holzes zu haben. Ein Baumstamm setzt sich aus folgenden Schichten
Um über die verschiedenen Holzarten nähere Informationen zu erhalten ist es von Nöten, erst einmal das Grundwissen über den Aufbau des Holzes zu haben. Ein Baumstamm setzt sich aus folgenden Schichten
GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE. N. Amrhein
 GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE N. Amrhein KAPITEL 10: POTOSYNTESE 1. Begründen Sie weshalb die Gleichung 6 CO 2 + 6 2 O C 6 12 +6 O 2 für die Photosynthese inkorrekt ist! Wie lautet die korrekte Gleichung? Damit
GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE N. Amrhein KAPITEL 10: POTOSYNTESE 1. Begründen Sie weshalb die Gleichung 6 CO 2 + 6 2 O C 6 12 +6 O 2 für die Photosynthese inkorrekt ist! Wie lautet die korrekte Gleichung? Damit
Pflanzen kultivieren
 III PFLANZEN KULTIVIEREN Pflanzen kultivieren III/KAP 2.1 Die Pflanzenzelle III/KAP 1.2 Die Sprossachse 1 Bau der Pflanze Eigentlich sehen die meisten Pflanzen gleich aus sie haben alle eine Wurzel, einen
III PFLANZEN KULTIVIEREN Pflanzen kultivieren III/KAP 2.1 Die Pflanzenzelle III/KAP 1.2 Die Sprossachse 1 Bau der Pflanze Eigentlich sehen die meisten Pflanzen gleich aus sie haben alle eine Wurzel, einen
Generationswechsel Lycopodiopsida (Bärlappe) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Lycopodiopsida (Bärlappe) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Gegenüber einer Selbstbefruchtung bei haplomodifikatorischer Geschlechtsbestimmung sind die Bedingungen
1 Generationswechsel Lycopodiopsida (Bärlappe) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Gegenüber einer Selbstbefruchtung bei haplomodifikatorischer Geschlechtsbestimmung sind die Bedingungen
GRUNDWISSEN BIOLOGIE DER 6. JAHRGANGSSTUFE
 Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Auszug aus dem Lehrplan: Sie verstehen wichtige Beziehungen zwischen Körperbau und Lebensweise bei Wirbeltieren. Sie können die Verwandtschaft der Wirbeltiere anhand ausgewählter e nachvollziehen. Sie
Pflanzliche Zellwand - Schichtung
 Pflanzliche Zellwand - Schichtung Pflanzliche Zellwand - Inkrustierung vs. Akkrustierung Inkrustierung = Einlagerung Funktion und Eigenschaft von Lignin: Druckfestigkeit der Zellwand lipophil => eingeschränkter
Pflanzliche Zellwand - Schichtung Pflanzliche Zellwand - Inkrustierung vs. Akkrustierung Inkrustierung = Einlagerung Funktion und Eigenschaft von Lignin: Druckfestigkeit der Zellwand lipophil => eingeschränkter
Inhalt. Erster Teil: Technik
 Inhalt Erster : Technik 1. Das Mikroskop..................................... 15 1.1. Aufbau und Wirkungsweise........................ 15 1.2. Auflösungsvermögen............................ 16 1.3. Vergrößerung................................
Inhalt Erster : Technik 1. Das Mikroskop..................................... 15 1.1. Aufbau und Wirkungsweise........................ 15 1.2. Auflösungsvermögen............................ 16 1.3. Vergrößerung................................
Info: Blütenpflanzen. Narbe. Blütenkronblatt. Griffel. Staubblatt. Fruchtknoten. Kelchblatt
 Info: Blütenpflanzen Pflanzen sind viel unauffälliger als Tiere und Menschen und finden dadurch oft wenig Beachtung. Doch wer sich mit ihnen näher beschäftigt, erkennt schnell, welche große Bedeutung sie
Info: Blütenpflanzen Pflanzen sind viel unauffälliger als Tiere und Menschen und finden dadurch oft wenig Beachtung. Doch wer sich mit ihnen näher beschäftigt, erkennt schnell, welche große Bedeutung sie
Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um einen Blütenbestandteil?
 Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um einen Blütenbestandteil? Calyx Corolla Kalyptra Gynoeceum Androeceum Antwort 1: A Antwort 2: B Antwort 3: C Antwort 4: D Antwort 5: E Welche
Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich nicht um einen Blütenbestandteil? Calyx Corolla Kalyptra Gynoeceum Androeceum Antwort 1: A Antwort 2: B Antwort 3: C Antwort 4: D Antwort 5: E Welche
Wurzel: Sekundäres Dickenwachstum
 Wurzel: Sekundäres Dickenwachstum!ausgehend von geschlossenem Kambiumring = faszikuläres Kambium + Zellen des Perizykel!nur bei Gymnospermae oder Dicotyledoneae! Wurzel: Sekundäres Dickenwachstum!ähnlich
Wurzel: Sekundäres Dickenwachstum!ausgehend von geschlossenem Kambiumring = faszikuläres Kambium + Zellen des Perizykel!nur bei Gymnospermae oder Dicotyledoneae! Wurzel: Sekundäres Dickenwachstum!ähnlich
Lerntext Pflanzen 1. Was sind Pflanzen?
 Was sind Pflanzen? Lerntext Pflanzen 1 Pleurotus_ostreatus Ausschnitt eines Photos von Tobi Kellner, das er unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 zur Verfügung stellte Der Körper eines Pilzes ist ein Fadengeflecht
Was sind Pflanzen? Lerntext Pflanzen 1 Pleurotus_ostreatus Ausschnitt eines Photos von Tobi Kellner, das er unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 zur Verfügung stellte Der Körper eines Pilzes ist ein Fadengeflecht
Botanisches Grundpraktikum zur Phylogenie und Anatomie
 Dietrich Böhlmann Botanisches Grundpraktikum zur Phylogenie und Anatomie Quelle & Meyer Verlag Wiesbaden Themen und Objektverzeichnis Die Überschriften kennzeichnen die Grobgliederung des Praktikums und
Dietrich Böhlmann Botanisches Grundpraktikum zur Phylogenie und Anatomie Quelle & Meyer Verlag Wiesbaden Themen und Objektverzeichnis Die Überschriften kennzeichnen die Grobgliederung des Praktikums und
DOWNLOAD. Vertretungsstunde Biologie 6. 5./6. Klasse: Vielfalt der Blütenpflanzen. Tina Konz/Michaela Seim. Downloadauszug aus dem Originaltitel:
 DOWNLOAD Tina Konz/Michaela Seim Vertretungsstunde Biologie 6 5./6. Klasse: auszug aus dem Originaltitel: Aufbau einer Blütenpflanze Der Bauplan einer Blütenpflanze Blüte Blatt Sprossachse Knospe Seitenspross
DOWNLOAD Tina Konz/Michaela Seim Vertretungsstunde Biologie 6 5./6. Klasse: auszug aus dem Originaltitel: Aufbau einer Blütenpflanze Der Bauplan einer Blütenpflanze Blüte Blatt Sprossachse Knospe Seitenspross
154 4 Organisationsformen der Pflanzen
 154 4 Organisationsformen der Pflanzen 4.4 Organisationsformen der Thallophyten Mit dem Sammelbegriff Thallus wird jeder mehr- oder vielzellige, in einzelnen Fällen auch polyenergide Vegetationskörper
154 4 Organisationsformen der Pflanzen 4.4 Organisationsformen der Thallophyten Mit dem Sammelbegriff Thallus wird jeder mehr- oder vielzellige, in einzelnen Fällen auch polyenergide Vegetationskörper
Fragen. Lichtenstein, Botanik. 1.
 Fragen. l. Welcher physiologische Prozeß führt den Pflanzen die meiste Lebensenergie zu 2. Was ist die Atmung für ein Prozeß und was wissen Sie darüber 3. Was verstehen Sie unter Assimilation 4. Woher
Fragen. l. Welcher physiologische Prozeß führt den Pflanzen die meiste Lebensenergie zu 2. Was ist die Atmung für ein Prozeß und was wissen Sie darüber 3. Was verstehen Sie unter Assimilation 4. Woher
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
3 Domänen und 5 Reiche
 3 Domänen und 5 Reiche Eukarya Bacteria Pflanzen Tiere Pilze Protisten Archaea Prokaryota Biodiversität und Domänenkonzept Pflanzen b Grünalgen Tiere Rotalgen Phototrophe EUCARYA Aerobe Pilze Anaerob e
3 Domänen und 5 Reiche Eukarya Bacteria Pflanzen Tiere Pilze Protisten Archaea Prokaryota Biodiversität und Domänenkonzept Pflanzen b Grünalgen Tiere Rotalgen Phototrophe EUCARYA Aerobe Pilze Anaerob e
Gewebetypen Festigungsgewebe Kollenchym
 Gewebetypen Festigungsgewebe Kollenchym Festigungselement krautiger Pflanzen Verdickung der Zellwand (lokal) => Platten-/ Kantenkollenchym lebende Zelle prosenchymatische Zellen Gewebetypen Festigungsgewebe
Gewebetypen Festigungsgewebe Kollenchym Festigungselement krautiger Pflanzen Verdickung der Zellwand (lokal) => Platten-/ Kantenkollenchym lebende Zelle prosenchymatische Zellen Gewebetypen Festigungsgewebe
Angewandte Grundlagen der Botanik im Pflanzenbau
 Angewandte Grundlagen der Botanik im Pflanzenbau Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2012/13 Mit weiterführenden Links aus dem Internet: Uni Hamburg (Botanik online),
Angewandte Grundlagen der Botanik im Pflanzenbau Unterrichtsleitfaden an der Technikerschule für Agrarwirtschaft Triesdorf 2012/13 Mit weiterführenden Links aus dem Internet: Uni Hamburg (Botanik online),
Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile höherer Pflanzen (Kormophyten):
 Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile höherer Pflanzen (Kormophyten): 3. Primäre & sekundäre Meristeme, sekundäres Dickenwachstum, sekundäre Abschlussgewebe Hendrik Küpper, 2.Semester-Praktikum
Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile höherer Pflanzen (Kormophyten): 3. Primäre & sekundäre Meristeme, sekundäres Dickenwachstum, sekundäre Abschlussgewebe Hendrik Küpper, 2.Semester-Praktikum
PRISMA Biologie, Naturphänomene und Technik 5 6
 W-711076 passgenau zum Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg PRISMA Biologie, Naturphänomene und Technik 5 6 Differenzierende Ausgabe, Arbeitsblätter mit CD-ROM Teildruck Die Verkaufsauflage erscheint W-711076
W-711076 passgenau zum Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg PRISMA Biologie, Naturphänomene und Technik 5 6 Differenzierende Ausgabe, Arbeitsblätter mit CD-ROM Teildruck Die Verkaufsauflage erscheint W-711076
Zusammenfassung Pflanzenökologie (Systematik)
 Zusammenfassung Pflanzenökologie (Systematik) Grundlagen Die zwei wichtigsten Artkonzepte Biologisches Artkonzept Morphologisches Artkonzept Vier Typen der reproduktiven Isolation, die zur Artbildung führen
Zusammenfassung Pflanzenökologie (Systematik) Grundlagen Die zwei wichtigsten Artkonzepte Biologisches Artkonzept Morphologisches Artkonzept Vier Typen der reproduktiven Isolation, die zur Artbildung führen
Biologie. Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich?
 Biologie Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich? Wiederholung Merkmal des Lebens Aufbau aus Zellen Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Man kann grob drei verschiedene Zelltypen unterscheiden?
Biologie Was ist das? Was tut man da? Womit beschäftigt man sich? Wiederholung Merkmal des Lebens Aufbau aus Zellen Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Man kann grob drei verschiedene Zelltypen unterscheiden?
Generationswechsel Gymnospermen mit Spermatozoidbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Gymnospermen mit Spermatozoidbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Am Beispiel der Palmfarne, den Cycadeen, soll nachfolgend der Generationswechsel von
1 Generationswechsel Gymnospermen mit Spermatozoidbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Am Beispiel der Palmfarne, den Cycadeen, soll nachfolgend der Generationswechsel von
Skript zum Kernblock Forstbotanik und Baumphysiologie I (404 a) Forstbotanischer Teil I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
 Skript zum Kernblock Forstbotanik und Baumphysiologie I (404 a) Forstbotanischer Teil I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1. Bau der Zelle 1 1.1 Protoplast 1 1.1.1 Cytoplasma 1 1.1.2 Selfassembly Systeme
Skript zum Kernblock Forstbotanik und Baumphysiologie I (404 a) Forstbotanischer Teil I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1. Bau der Zelle 1 1.1 Protoplast 1 1.1.1 Cytoplasma 1 1.1.2 Selfassembly Systeme
Wieviele Pflanzenarten kommen bei uns etwa vor? A B C Wieviele Tierarten gibt es bei uns etwa? A B 1.
 Wieviele Pflanzenarten kommen bei uns etwa vor? A 400000 B 10000 C 4000 Wieviele Tierarten gibt es bei uns etwa? A 40000 B 1.5 Mio C 10000 1 2 a)zu welchem Merkmal des Lebens zählt man die Tatsache, dass
Wieviele Pflanzenarten kommen bei uns etwa vor? A 400000 B 10000 C 4000 Wieviele Tierarten gibt es bei uns etwa? A 40000 B 1.5 Mio C 10000 1 2 a)zu welchem Merkmal des Lebens zählt man die Tatsache, dass
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8
 Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
11. Kurstag - Angiospermenholz und Rinde
 11. Kurstag - Angiospermenholz und Rinde Bitte die letzte Seite beachten! 1. Unterschied: Gymnospermen- zu Angiospermenholz (Nadelholz) (Laubholz) 2. Holzbau der Angiospermen 1. Bast 3. Rinde 2. Periderm
11. Kurstag - Angiospermenholz und Rinde Bitte die letzte Seite beachten! 1. Unterschied: Gymnospermen- zu Angiospermenholz (Nadelholz) (Laubholz) 2. Holzbau der Angiospermen 1. Bast 3. Rinde 2. Periderm
Übungsaufgaben zum Thema Ökosystem Wald
 Übungsaufgaben zum Thema Ökosystem Wald I Waldformen und Bäume des Waldes 1. Die Zusammensetzung und die Verbreitung verschiedener Waldformen hängen vom Klima und den Bodenverhältnissen ab. a) Beschreibe
Übungsaufgaben zum Thema Ökosystem Wald I Waldformen und Bäume des Waldes 1. Die Zusammensetzung und die Verbreitung verschiedener Waldformen hängen vom Klima und den Bodenverhältnissen ab. a) Beschreibe
A. Phloem B. Xylem C. Endodermis D. Perizykel E. Kambium
 Die Abbildung zeigt einen Querschnitt durch die Wurzel von Acorus calamus. Welcher der Begriffe ist zu den Ziffern der Bezugspfeile richtig zugeordnet? A. Phloem B. Xylem C. Endodermis D. Perizykel E.
Die Abbildung zeigt einen Querschnitt durch die Wurzel von Acorus calamus. Welcher der Begriffe ist zu den Ziffern der Bezugspfeile richtig zugeordnet? A. Phloem B. Xylem C. Endodermis D. Perizykel E.
1. Teil Seit wann gibt es Bäume? Die Bäume in den Erdzeitaltern - Bäume und Wälder von der letzten Eiszeit bis heute.
 Inhalt Vorwort 11 1. Teil Seit wann gibt es Bäume? Die Bäume in den Erdzeitaltern - Bäume und Wälder von der letzten Eiszeit bis heute. 13 2. Teil Entwicklung der äußeren Gestalt I. Samen und Embryo II.
Inhalt Vorwort 11 1. Teil Seit wann gibt es Bäume? Die Bäume in den Erdzeitaltern - Bäume und Wälder von der letzten Eiszeit bis heute. 13 2. Teil Entwicklung der äußeren Gestalt I. Samen und Embryo II.
Stützorgane. Photosyntheseorgane. Transportorgane. Lebewesen. Fortpflanzungsorgane. Zellen
 Arbeitsheft Pflanzenkunde Inhalt Jakob 1 Inhaltsverzeichnis: Seite: 1 Grundbauplan (Tulpe) 2 2 Bau einer Pflanzenzelle 3 3 Stütz- und Transportorgane (Tulpe) 4 4 Fotosyntheseorgane (Kirschbaum) 4.1 Gesamtgleichung
Arbeitsheft Pflanzenkunde Inhalt Jakob 1 Inhaltsverzeichnis: Seite: 1 Grundbauplan (Tulpe) 2 2 Bau einer Pflanzenzelle 3 3 Stütz- und Transportorgane (Tulpe) 4 4 Fotosyntheseorgane (Kirschbaum) 4.1 Gesamtgleichung
aus: Wanner, Mikroskopischbotanisches Praktikum (ISBN ) 2010 Georg Thieme Verlag KG
 13 158 Die Sprossachse Die Sprossachse bringt die Blätter zum Licht, versorgt sie mit Wasser und Nährstoffen und transportiert die Assimilate bis zu den Wurzeln. Um diese Funktion zu erfüllen, sind etliche
13 158 Die Sprossachse Die Sprossachse bringt die Blätter zum Licht, versorgt sie mit Wasser und Nährstoffen und transportiert die Assimilate bis zu den Wurzeln. Um diese Funktion zu erfüllen, sind etliche
In den grünen Pflanzenteilen, genauer gesagt in bestimmten Organellen der Pflanzenzellen, den
 A 7 Fotosynthese Stellen sie die Wort- und die Symbolgleichung für den Vorgang der Fotosynthese in grünen Pflanzen auf. Wortgleichung: Symbolgleichung: Vervollständigen Sie den Text. In den grünen Pflanzenteilen,
A 7 Fotosynthese Stellen sie die Wort- und die Symbolgleichung für den Vorgang der Fotosynthese in grünen Pflanzen auf. Wortgleichung: Symbolgleichung: Vervollständigen Sie den Text. In den grünen Pflanzenteilen,
Vorlesung: Baupläne und Systematik der Pflanzen
 Professor Dr. R. Mues, Botanik Vorlesung: Baupläne und Systematik der Pflanzen Gliederung Stichworte I Baupläne der Pflanzen 1. Einführung in die Botanik 2. Die Zelle 2.1 Zellformen, Zellgrößen, Bauplan
Professor Dr. R. Mues, Botanik Vorlesung: Baupläne und Systematik der Pflanzen Gliederung Stichworte I Baupläne der Pflanzen 1. Einführung in die Botanik 2. Die Zelle 2.1 Zellformen, Zellgrößen, Bauplan
Botanik GHR. 15 Stoffklassen in Höheren Pflanzen: Beispiele, Kompartimentierung, Lebensmitteltechnische
 Zytologie 1 Aufbau der pflanzlichen Zellwand Zellwand: Aufbau, Zusammensetzung, Funktion Zellwand: Aufbau, Bestandteile, Zellulosesynthese (siehe Physiologie) F11/1/1 H09/1/1 H08/1/3 F08/3/1 H10/2/3 2
Zytologie 1 Aufbau der pflanzlichen Zellwand Zellwand: Aufbau, Zusammensetzung, Funktion Zellwand: Aufbau, Bestandteile, Zellulosesynthese (siehe Physiologie) F11/1/1 H09/1/1 H08/1/3 F08/3/1 H10/2/3 2
1 34 I Botanik 1 Morphologie
 1 4 I Botanik 1 Morphologie Ein Beispiel für die Ausbildung von Urnenblättern ist Dischidia vidalii, eine epiphytische Schlingpflanze aus dem tropischen Asien. a) Erklären Sie, wie sich die Pflanze an
1 4 I Botanik 1 Morphologie Ein Beispiel für die Ausbildung von Urnenblättern ist Dischidia vidalii, eine epiphytische Schlingpflanze aus dem tropischen Asien. a) Erklären Sie, wie sich die Pflanze an
Bio A 15/04_Online-Ergänzung
 Bio A 15/04_Online-Ergänzung Charakteristika verschiedener Zelltypen DITTMAR GRAF Online-Ergänzung MNU 68/3 (15.5.2015) Seiten 1 7, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 DITTMAR GRAF Charakteristika
Bio A 15/04_Online-Ergänzung Charakteristika verschiedener Zelltypen DITTMAR GRAF Online-Ergänzung MNU 68/3 (15.5.2015) Seiten 1 7, ISSN 0025-5866, Verlag Klaus Seeberger, Neuss 1 DITTMAR GRAF Charakteristika
Bau und Funktion der Pflanzen - Wiederholungsfragen
 1 Bau und Funktion der Pflanzen - Wiederholungsfragen 1. EINLEITUNG Welche Rolle spielen Pflanzen in unserem täglichen Leben? Warum ist die Zusammensetzung unserer heutigen Atmosphäre ursächlich mit der
1 Bau und Funktion der Pflanzen - Wiederholungsfragen 1. EINLEITUNG Welche Rolle spielen Pflanzen in unserem täglichen Leben? Warum ist die Zusammensetzung unserer heutigen Atmosphäre ursächlich mit der
Unter Botanik verstehen wir das Studium von Pflanzen, das heißt ihre Morphologie,
 g g g Botanik verstehen In diesem Kapitel Von der Zelle zur Pflanze Wie Pflanzen funktionieren Pflanzen und Menschen 1 Unter Botanik verstehen wir das Studium von Pflanzen, das heißt ihre Morphologie,
g g g Botanik verstehen In diesem Kapitel Von der Zelle zur Pflanze Wie Pflanzen funktionieren Pflanzen und Menschen 1 Unter Botanik verstehen wir das Studium von Pflanzen, das heißt ihre Morphologie,
Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung
 Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung Auslösen der Blütenbildung Identität des Apikalmeristems Befruchtung und Embryogenese Copyright Hinweis: Das Copyright der in dieser Vorlesung genannten Lehrbücher
Pflanzenphysiologie 6: Blüten und Befruchtung Auslösen der Blütenbildung Identität des Apikalmeristems Befruchtung und Embryogenese Copyright Hinweis: Das Copyright der in dieser Vorlesung genannten Lehrbücher
Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn
 Einführung in die Grundlagen der Genetik Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Molekularbiologische Grundlagen Die Zelle ist die grundlegende, strukturelle und funktionelle
Einführung in die Grundlagen der Genetik Ausbildung zum Bienenwirtschaftsmeister Mai 2012 Christian Boigenzahn Molekularbiologische Grundlagen Die Zelle ist die grundlegende, strukturelle und funktionelle
Kapitel II Eigenschaften des Untersuchungsmaterials Fixierung und Konservierungsmethoden
 3 INHALTSÜBERSICHT Erster Teil Allgemeine Untersuchungsmethoden Zur Einführung 1 Kapitel I Instrumentarium und Material A. Das Instrumentarium 2-3 Größere Instrumente 2 Kleinere Utensilien 3 B. Die Beschaffung
3 INHALTSÜBERSICHT Erster Teil Allgemeine Untersuchungsmethoden Zur Einführung 1 Kapitel I Instrumentarium und Material A. Das Instrumentarium 2-3 Größere Instrumente 2 Kleinere Utensilien 3 B. Die Beschaffung
Eine Frucht für die Götter
 Eine Frucht für die Götter Ratet Kinder, wer ich bin, hänge hoch im Baume drin, hab rote Bäckchen, nen Stiel hab ich auch und einen dicken, runden Bauch. Es war einmal vor langer Zeit. Da schuf Gott Himmel
Eine Frucht für die Götter Ratet Kinder, wer ich bin, hänge hoch im Baume drin, hab rote Bäckchen, nen Stiel hab ich auch und einen dicken, runden Bauch. Es war einmal vor langer Zeit. Da schuf Gott Himmel
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium. 8. Klasse. Biologie
 Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Grundwissenkarten Hans-Carossa-Gymnasium 8. Klasse Biologie Es sind insgesamt 12 Karten für die 8. Klasse erarbeitet. davon : Karten ausschneiden : Es ist auf der linken Blattseite die Vorderseite mit
Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel
 Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel Glibbermonster, Giftzwerge und weiße Riesen - Die spannende Welt der Pilze Prof. Dr. Ewald Langer Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Sie werden zu den
Skript zur Kinderuni Vorlesung der Universität Kassel Glibbermonster, Giftzwerge und weiße Riesen - Die spannende Welt der Pilze Prof. Dr. Ewald Langer Pilze sind merkwürdige Lebewesen. Sie werden zu den
Bestäubung und Befruchtung. Michele Notari
 Michele Notari Vorstellung Vorgänge innerhalb der sexuellen Fortpflanzung von Blütenpflanzen Strategien zur Uebertragung von Gameten und Vorgang der Verschmelzung der Gameten 2 Lernziele Sie kennen die
Michele Notari Vorstellung Vorgänge innerhalb der sexuellen Fortpflanzung von Blütenpflanzen Strategien zur Uebertragung von Gameten und Vorgang der Verschmelzung der Gameten 2 Lernziele Sie kennen die
Modul č. 12. Odborná němčina pro 2. ročník
 Modul č. 12 Odborná němčina pro 2. ročník Thema 5: Holzkunde - Terminologie Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 5: Holzkunde Terminologie Holz Borke, Rinde
Modul č. 12 Odborná němčina pro 2. ročník Thema 5: Holzkunde - Terminologie Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588 Autor modulu: Mgr. Hana Nováková Thema 5: Holzkunde Terminologie Holz Borke, Rinde
Seminar zur Anatomie und Morphologie der Pflanzen
 Seminar zur Anatomie und Morphologie der Pflanzen Übungen Allgemeine Pflanzenwissenschaften 1. Organisatorisches 2. Kursinhalt 3. Literatur 4. Programm des ersten Kurstages 1. Organisatorisches: Seminar:
Seminar zur Anatomie und Morphologie der Pflanzen Übungen Allgemeine Pflanzenwissenschaften 1. Organisatorisches 2. Kursinhalt 3. Literatur 4. Programm des ersten Kurstages 1. Organisatorisches: Seminar:
Ginkgo biloba Ginkgo, Fächerblattbaum (Ginkgoaceae), ein lebendes Fossil aus China
 Ginkgo biloba Ginkgo, Fächerblattbaum (Ginkgoaceae), ein lebendes Fossil aus China VEIT MARTIN DÖRKEN 1 Einleitung Zweifelsohne gehört der Ginkgo auch in Mitteleuropa zu den bekanntesten fremdländischen
Ginkgo biloba Ginkgo, Fächerblattbaum (Ginkgoaceae), ein lebendes Fossil aus China VEIT MARTIN DÖRKEN 1 Einleitung Zweifelsohne gehört der Ginkgo auch in Mitteleuropa zu den bekanntesten fremdländischen
Generationswechsel Gymnospermen mit Pollenschlauchbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Generationswechsel Gymnospermen mit Pollenschlauchbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Außer den Cycadeen und Ginkgoaceen haben alle rezenten Gymnospermen eine Pollenschlauchbefruchtung.
1 Generationswechsel Gymnospermen mit Pollenschlauchbefruchtung Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie Außer den Cycadeen und Ginkgoaceen haben alle rezenten Gymnospermen eine Pollenschlauchbefruchtung.
Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile. 1. Blätter
 Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile höherer Pflanzen (Kormophyten): 1. Blätter Hendrik Küpper, 2.Semester-Praktikum 2011 SEM-Bilder: Blätter von Berkheya coddii (links) und Thlaspi goesingense
Mikroskopische Anatomie der vegetativen Teile höherer Pflanzen (Kormophyten): 1. Blätter Hendrik Küpper, 2.Semester-Praktikum 2011 SEM-Bilder: Blätter von Berkheya coddii (links) und Thlaspi goesingense
6 Vielfalt der Pflanzen
 6 Vielfalt der Pflanzen Natura 7/8 6 Vielfalt der Pflanzen Lösungen zu den Aufgaben Schulbuch, S. 136 137 6.1 Das Wiesenschaumkraut ein Kreuzblütler 1 Erläutere anhand der Blütenformel die kennzeichnenden
6 Vielfalt der Pflanzen Natura 7/8 6 Vielfalt der Pflanzen Lösungen zu den Aufgaben Schulbuch, S. 136 137 6.1 Das Wiesenschaumkraut ein Kreuzblütler 1 Erläutere anhand der Blütenformel die kennzeichnenden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Geheimnis der Flechtensymbiose. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Geheimnis der Flechtensymbiose Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Das Geheimnis der Flechtensymbiose Einzelmaterial
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Geheimnis der Flechtensymbiose Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Das Geheimnis der Flechtensymbiose Einzelmaterial
Pflanzliche Vollschmarotzer
 Pflanzliche Vollschmarotzer Pflanzliche Schmarotzer gehören zu der Klasse der Parasiten. Sie haben ihre autotrophe (unabhängig in ihrer Ernährung von anderen Lebewesen) Lebensweise aufgegeben und ernähren
Pflanzliche Vollschmarotzer Pflanzliche Schmarotzer gehören zu der Klasse der Parasiten. Sie haben ihre autotrophe (unabhängig in ihrer Ernährung von anderen Lebewesen) Lebensweise aufgegeben und ernähren
Reiche: Protozoa: Plasmodiophoramycota Chromista: Oomycota Fungi: Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Mitosporische Pilze Plantae
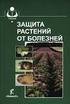 Reiche: Protozoa: Plasmodiophoramycota Chromista: Oomycota Fungi: Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Mitosporische Pilze Plantae Animalia Protozoen Taxonomische Position Reich: Protozoa
Reiche: Protozoa: Plasmodiophoramycota Chromista: Oomycota Fungi: Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Mitosporische Pilze Plantae Animalia Protozoen Taxonomische Position Reich: Protozoa
Lehrveranstaltung: Baupläne und Systematik der Pflanzen, Wintersemester 2005/2006
 Professor Dr. Rüdiger Mues Botanik, Universität des Saarlandes Lehrveranstaltung: Baupläne und Systematik der Pflanzen, Wintersemester 2005/2006 1. Vorlesung, Donnerstag, 20.10.2005, 10.00 c.t., Großer
Professor Dr. Rüdiger Mues Botanik, Universität des Saarlandes Lehrveranstaltung: Baupläne und Systematik der Pflanzen, Wintersemester 2005/2006 1. Vorlesung, Donnerstag, 20.10.2005, 10.00 c.t., Großer
Botanik und Allgemeine Biologie : further readings Blatt
 BLATT ANATOMIE In den meisten Fällen ist das Blatt ein bifaciales Blatt (facies (lat.) = Fläche). Zu den Ausnahmen (Sonderfälle wie äquifaciale Blätter = Nadelblatt der Kiefer oder unifaciale Blätter =
BLATT ANATOMIE In den meisten Fällen ist das Blatt ein bifaciales Blatt (facies (lat.) = Fläche). Zu den Ausnahmen (Sonderfälle wie äquifaciale Blätter = Nadelblatt der Kiefer oder unifaciale Blätter =
Botanik der Nutzpflanzen
 Botanik der Nutzpflanzen Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 9.Apotom Kurs 11 Kurs 12 Wozu Botanik der Nutzpflanzen? Pflanzliche Zellen. Was nutzen wir (1)? Pflanzliche
Botanik der Nutzpflanzen Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 9.Apotom Kurs 11 Kurs 12 Wozu Botanik der Nutzpflanzen? Pflanzliche Zellen. Was nutzen wir (1)? Pflanzliche
Vorlesung Biodiversität: t: Evolution der Algen Evolution der Algen und Plastiden Teil 5: Viridiplantae
 Vorlesung 63052 Biodiversität: t: Evolution der Algen Evolution der Algen und Plastiden Teil 5: Viridiplantae Thomas Friedl Abteilung Experimentelle Phykologie und Sammlung von Algenkulturen Albrecht-von
Vorlesung 63052 Biodiversität: t: Evolution der Algen Evolution der Algen und Plastiden Teil 5: Viridiplantae Thomas Friedl Abteilung Experimentelle Phykologie und Sammlung von Algenkulturen Albrecht-von
Botanik. Aus dem Amerikanischen von Micaela Krieger-Hauwede und Karen Lippert. Deutsche Bearbeitung von Renate Scheibe. Mit iiber 390 Abbildungen
 Murray W. Nabors Botanik Aus dem Amerikanischen von Micaela Krieger-Hauwede und Karen Lippert Deutsche Bearbeitung von Renate Scheibe Mit iiber 390 Abbildungen PEARSON Studium ein Imprint von Pearson Education
Murray W. Nabors Botanik Aus dem Amerikanischen von Micaela Krieger-Hauwede und Karen Lippert Deutsche Bearbeitung von Renate Scheibe Mit iiber 390 Abbildungen PEARSON Studium ein Imprint von Pearson Education
IWIllllllllllllllllll Biologie: Grundlagen und Zellbiologie. Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen
 Naturwissenschaften Biologie: Grundlagen und Zellbiologie Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen Markus Bütikofer unter Mitarbeit von Zensi Hopf und Guido Rutz W^ ;;;^! ;»*'* '^'*..
Naturwissenschaften Biologie: Grundlagen und Zellbiologie Lerntext, Aufgaben mit Lösungen, Glossar und Zusammenfassungen Markus Bütikofer unter Mitarbeit von Zensi Hopf und Guido Rutz W^ ;;;^! ;»*'* '^'*..
Merkmale des Lebens. - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel
 Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Merkmale des Lebens - Aufbau aus Zellen - Wachstum - Vermehrung - Reaktion auf Reize - Bewegung aus eigener Kraft - Stoffwechsel Alle Lebewesen bestehen aus Zellen Fragen zum Text: - Was sah Hooke genau?
Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler
 Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler http://worgtsone.scienceontheweb.net/worgtsone/ - mailto: worgtsone @ hush.com Tue Dec 1 17:34:40 CET 2009 13. Oktober 2011 Inhaltsverzeichnis
Biologie für Hauptschule lt. hess. Lehrplan f. Nichtschüler http://worgtsone.scienceontheweb.net/worgtsone/ - mailto: worgtsone @ hush.com Tue Dec 1 17:34:40 CET 2009 13. Oktober 2011 Inhaltsverzeichnis
ohne mit eukaryontische Pflanzen Pilze Tiere zusammenschliessen unterschiedliche Aufgaben Vielzeller
 Merkmale des Lebens 1. Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. 2. Alle Lebewesen bewegen sich aus eigener Kraft. 3. Alle Lebewesen haben einen Stoffwechsel. 4. Alle Lebewesen wachsen. 5. Alle Lebewesen
Merkmale des Lebens 1. Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. 2. Alle Lebewesen bewegen sich aus eigener Kraft. 3. Alle Lebewesen haben einen Stoffwechsel. 4. Alle Lebewesen wachsen. 5. Alle Lebewesen
weisst du die lösung... körperteile des baumes...
 weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
 In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: Sie kennen die Bedeutung der Bakterien und grundlegende Unterschiede zwischen Pro- und Eucyte. Sie können einfache Objekte mikroskopisch
Wie werden Keimzellen gebildet?
 Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Wie werden Keimzellen gebildet? Keimzellen (Samenzellen und Eizelle) werden über eine neue Kernteilungsform erzeugt: die MEIOSE ( Reifeteilung I und II) Eizelle mit Zellkern Samenzellen mit Erbmaterial
Vorlesungsinhalt. Bau der Pflanzenzelle. Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem
 Vorlesungsinhalt Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem Bau der Pflanzenzelle Anatomie, Entwicklung und Funktion der Pflanzenorgane - Gewebe - Primärer Pflanzenkörper
Vorlesungsinhalt Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem Bau der Pflanzenzelle Anatomie, Entwicklung und Funktion der Pflanzenorgane - Gewebe - Primärer Pflanzenkörper
