Bilingualer Sprachunterricht und Sprachvarietäten
|
|
|
- Viktor Siegel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bilingualer Sprachunterricht und Sprachvarietäten Friederiki Batsalia Στο: «γλώσσης χάριν», Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ Περίληψη Γλώσσα, επικοινωνία και κοινωνία είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένα. Κατά συνέπεια, οι γλωσσικές ποικιλίες είναι συνδεδεμένες όχι μόνο με συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, αλλά και με συγκεκριμένους κοινωνικούς ρόλους. Στην περίπτωση των δίγλωσσων ατόμων, τα οποία κινούνται μεν στους δύο κόσμους που ορίζονται από τις δύο τους γλώσσες, οι κοινωνικοί όμως ρόλοι που αναλαμβάνουν δεν πραγματώνονται πάντα ισομερώς μέσω των δύο αυτών γλωσσών. Προκειμένου συνεπώς το γλωσσικό μάθημα, αποβλέποντας στη διεύρυνση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων δίγλωσσων ατόμων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την παράμετρο εάν πρόκειται για πρώτη ή για δεύτερη γλώσσα, αλλά και τους κοινωνικούς ρόλους στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν οι διδασκόμενοι, εστιάζοντας την προσοχή του και στις σχετικές γλωσσικές ποικιλίες. Jeder, der sich mit der Vermittlung von Wissen beschäftigt, stellt sich, bzw. sollte sich die Frage stellen, inwieweit das, was er zu vermitteln sucht, auch den Bedürfnissen der Lerner entspricht. Dies bedeutet somit für den Sprachunterricht, dass Lehrpläne und Lehrziele sowie methodisches Vorgehen und Lehrmaterial nicht nur in Einklang mit einer entsprechenden Lerntheorie zu stehen haben, sondern dass darüber hinausgehend überdacht und theoretisch begründet sein sollte, welche Sprach- und welche Sprechfertigkeiten der jeweiligen Lernergruppe zu vermitteln sind, um deren Bedürfnissen und Erwartungen entgegenzukommen. Wird nun die Tatsache berücksichtigt, dass in unserer heutigen Gesellschaft Bilingualismus ein weit verbreitetes Phänomen ist, so verwundert nicht, dass sich methodische und didaktische Überlegungen zum Sprachunterricht vermehrt mit den besonderen Anforderungen des gesteuerten Zweitspracherwerbs zuwenden (Baker: 1993, Corder: 1967 und 1983, Cummins & Swain: 1986, Fishman: 1971 und 2002, 1
2 Felix: 1981, Grosjean: 1982, Lambert: 1974, Oksaar: 1983, Romaine: 1995, Skutnabb-Kangas: 1984). Bilingualismus ist nur augenscheinlich ein leicht bestimmbarer Begriff: Je nach theoretischem Ansatz, bzw. wissenschaftlichem Forschungsinteresse werden so divergierende Inhalte beschrieben, die unter diesem Begriff zu verstehen sind (Weinreich 1979: 1, Bloomfield 1933: 55-56, Macnamara 1967: 59, Haugen 1969: 6-7), dass Skuttnabb-Kangas (1984: 81) zugestimmt werden kann, jeder Definitionsversuch habe subjektiven Gehalt. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch in der Erkenntnis, dass Bilingualismus ein höchst komplexes Phänomen ist, dessen Erforschung den Einbezug vielfältiger Faktoren bedingt und jeder einzelne Fall von Bilingualität eine besondere Form, eine spezifische Ausprägung des allgemeinen Phänomens darstellt. Da allgemein davon ausgegangen wird, dass Sprach- und Sprechfertigkeit messbare Größen sind, sollte auch Bilingualität quantitativ erfassbar sein, etwa im Bereich der kommunikativen Fähigkeit während der mündlichen Sprachproduktion (Romaine 1995: 13). Wenngleich es zahlreiche Methoden gibt, die den Anspruch erheben, die Sprachkompetenz bilingualer Sprecher zu erfassen, sind auf diesen Verfahren basierenden Untersuchungsergebnissen mit Vorsicht zu begegnen (Romaine 1995: 19, Skuttnab-Kangas 1984: 217), und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die erhobenen Sprachdaten entweder an der jeweiligen Sprachnorm gemessen oder mit Sprachmaterial monolingualer Sprecher verglichen werden und gleichzeitig oftmals bestimmte Unterrichts-, bzw. Lernziele verfolgen oder zumindest berücksichtigen. Diese und ähnliche Vorgehensweisen ermöglichen jedoch nicht, die sprachliche Handlungsfähigkeit bilingualer Sprecher zu bewerten, die in unterschiedlichen Kontexten entweder mit der einen oder aber mit der anderen Sprache an sozialen Interaktionsprozessen mehr oder weniger erfolgreich teilnehmen. Unterschiedliche soziale Kontexte sind jedoch weitgehend mit unterschiedlichen Sprachmustern verbunden (Batsalia: 2003: 14-15), und somit stellt sich für den Sprachunterricht bilingualer Schüler die Frage, inwieweit Sprachnorm und Sprachvarietät Größen sind, die maßgeblich deren sprachliche Handlungskompetenz bestimmen und somit u.a. über Schulerfolg entscheiden. Ansatzweise soll daher im Folgenden skizziert werden, wie diese Begriffe in einen kommunikativ-pragmatischen Ansatz eingebettet werden und für den Erst- bzw. den 2
3 Zweitsprachunterricht 1 fruchtbar gemacht werden können. Hierfür wird zunächst der enge Zusammenhang zwischen Sprache, Kommunikation und Gesellschaft angeführt, um daran anschließend und aufbauend auf der Erkenntnis, dass die sprachliche Handlungsbreite mit der sozialen Handlungsbreite verbunden ist, die Bedeutung hervorzuheben, die der Beherrschung von Sprachvarietäten in beiden Sprachen beizumessen ist. Einer der ersten Versuche, sowohl das Verhältnis zwischen Sprache und Denken, als auch die Beziehungen zwischen Sprache und Gesellschaft aufzudecken, verdanken wir W. v. Humboldt. Die Sprachphilosophie Humboldts prägte Begriffe wie Weltansicht der Sprache und innere Sprachform und führte zu weitreichenden Einsichten, wie etwa der Unterscheidung zwischen Sprache als ergon und Sprache als energeia, sowie zur Feststellung, dass es im Wesen der Sprache liegt, von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch zu machen. Leo Weisgerber, der sich auf Humboldt beruft, versteht Sprachinhalte als eine sprachlich-geistige Zwischenwelt, die in einer für jede Sprache charakteristische Form gegliedert ist. Dieser Auffassung ist jedoch entgegenzuhalten, dass derartige Unterschiede nicht auf Differenzierungen der Sprachen selbst zurückzuführen sind, sondern in den Unterschieden im gesellschaftlichen Entwicklungsstand und in den historisch-sozialen Bedingungen zu suchen sind (Albrecht 1972: 106 ff). Weiterhin ist wie Helbig (1988: 54) anführt zu berücksichtigen, dass die Auseinandersetzung mit dem engen Verhältnis zwischen Sprache, Kommunikation und Gesellschaft nicht die Tatsache verkennen darf, dass Sprache kein Weltbild schaffen, sondern nur bewahren und überliefern kann. Daher sind die verschiedenen Weltbilder nicht als Erzeugnis von Sprache, sondern als Erzeugnis menschlichen Handelns und Denkens anzusehen, welches von den historisch-gesellschaftlichen Erfahrungen der jeweiligen Kommunikationsgemeinschaft geprägt ist. In diesem Zusammenhang und in Anlehnung an die Sprechakttheorie so wie diese von J. L. Austin (1962) und J. R. Searle (1969, 1971) formuliert worden ist gehen wir in Übereinstimmung mit Wunderlich (1976) davon aus, dass sprachliche Handlungen als soziale Interaktionsprozesse anzusehen sind: Sprache ist eine Form sozialen Handelns und somit nicht aus der konkreten gesellschaftlich-historischen 1 Wir gehen in Übereinstimmung mit Σελλά-Μάζη (2001: 53) davon aus, dass der ideale bilinguale Sprecher, d.h. derjenige, der in jeder kommunikativen Situation beide Sprachen wie ein monolingualer Sprecher verwendet, einen äußerst seltenen Einzelfall darstellt. 3
4 Situation herauslösbar. Dieser Ansatz impliziert, dass einem jeden Sprechakt ein gesellschaftlicher Aspekt inhärent ist, da wie Maas & Wunderlich (1972: 77-78) betonen Kommunikation auf Befriedigung menschlicher Bedürfnisse abzielt. Der soziale Aspekt von Kommunikation wird gleichzeitig noch dadurch verstärkt, dass sich ein jeder Sprecher beim Vollzug eines Sprechaktes am vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftig erwarteten Verhalten des Hörers orientiert. Auf Grund dieses vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftig erwarteten Verhaltens der Hörerseite wird über Sprache ein Kontakt zwischen Sprecher und Hörer hergestellt. Eine derartige Kontaktaufnahme aber leitet ihrerseits gleichzeitig die Aufnahme einer sozialen Beziehung ein, die im weiteren Kommunikationsverlauf gefestigt werden, aber auch Veränderungen unterliegen und sogar abgebrochen werden kann. Im Rahmen der zwischenmenschlichen Interaktion stellt somit der Vollzug einer sprachlichen Handlung zugleich den Vollzug einer sozialen Handlung dar, wobei die Befriedigung sozialer Bedürfnisse als übergeordnete Sprecherintention angesehen werden darf. 2 In diesem Zusammenhang ist weiterhin zu berücksichtigen, dass wie allgemein anerkannt soziale Formationen kein einheitliches Gefüge darstellen. Jede Gesellschaft weist einen mehr oder weniger gravierenden Grad an Heterogenität auf. Diese Heterogenität jedoch bildet gleichzeitig das konstitutive Merkmal einer jeden gesellschaftlichen Ordnung und garantiert deren Bestehen. So wie die einzelnen Mitglieder einer jeden Sprachgemeinschaft keine einheitliche, homogene soziale Gruppe bilden, so variiert auch ihr Sprachverhalten. Dies impliziert, dass jede Sprachgemeinschaft eine Vielzahl von Kommunikationsgemeinschaften aufweist und zwar entsprechend der jeweiligen gesellschaftlichen Strukturen. Daher ist mit jeder Kommunikationsgemeinschaft auch eine bestimmte Sprachvariation verbunden, die ihrerseits sowohl eine bestimmte kommunikative Funktion übernimmt als auch eine bestimmte kommunikative Wirkung ausübt. 3 Die Verwendung einer bestimmten Sprachvariation ist daher als einer jener Faktoren anzusehen, die Gruppenidentität herstellen und stabilisieren. Zwar lässt sich, wie bereits angeführt, die Gruppenzugehörigkeit auf gemeinsame gesellschaftliche Bedürfnisse und Interessen zurückführen, das Bewusstsein aber bezüglich der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit konstituiert sich auch im gemeinsamen Sprachkode und wird somit auch in und durch 2 Vgl. ausführlicher Batsalia, 1997: 73 ff 3 Vgl. ausführlicher Batsalia, 2003: 60 ff 4
5 dessen Gebrauch manifestiert. Folglich übernimmt die mit einer Kommunikationsgemeinschaft verbundene Sprachvarietät auch die Funktion der Systembewahrung. Heterogenität, Differenziertheit und Variation sind somit unabdingbare konstitutive Bestandteile von Kommunikation und spiegeln die konkreten Tätigkeitsbeziehungen wider, die auf historisch-soziale und auf situativ gebundene Differenzierungen der jeweiligen Gesellschaft zurückzuführen sind. Da unsere modernen Gesellschaften sowohl horizontal als auch vertikal gegliedert sind, muss eine jede Sprachgemeinschaft eine Vielzahl kommunikativer Aufgaben bewältigen. Diese soziale Handlungsbreite ist als Rahmen der sprachlichen Handlungsbreite anzusehen. Modifikation der sozialen Handlungsbreite führt zwangsläufig zu Modifikation im Sprachgebrauch. Da weiterhin nicht jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaft jede der in dieser Gemeinschaft möglichen sozialen Handlungen vollziehen kann bzw. darf, steht die sprachliche Handlungsbreite in Einklang mit der sozialen Handlungsbreite. Je nach Aufgaben- und Handlungsbereich wird die allen Mitgliedern zur Verfügung stehende Sprache unterschiedlich und daher differenziert verwendet. Somit spiegelt sich die sozial bedingte Differenzierung in sprachlichen Erscheinungen wider und verfestigt sich zugleich in und über Sprache. Diese in einer jeden Gesellschaft bestehenden vielfältigen und zugleich unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedürfnisse und Aufgaben führen ihrerseits zur Formation sozialer Gruppen mit unterschiedlichen sozialen Merkmalen. 4 Diese sozialen Gruppen übernehmen ihrerseits soziale Funktionen, die mit entsprechenden Sprachvarianten korrelieren, so dass eindeutig davon ausgegangen werden darf, dass zwischen Sprache und Gesellschaft keine direkte Beziehung besteht. Die Beziehung zwischen sprache und Gesellschaft wird erst über und in Kommunikation hergestellt (Hartung et al. 1974: 53-56). Folglich ist dem Begriff Kommunikationsgemeinschaft eine besondere Bedeutung beizumessen: Unter Sprachgemeinschaft ist die Anzahl jener Menschen zu verstehen, die eine bestimmte Sprache verwenden; mit Kommunikationsgemeinschaft hingegen ist jene Gruppe von Personen zu bezeichnen, die im Rahmen eines gesellschaftlich determinierten Systems von 4 Vgl. ausführlicher Möhn & Pelka 1984: 11f 5
6 kommunikativen Beziehungen miteinander in ihrem sprachlichen Handeln verbunden sind. Bilinguale Sprecher agieren ebenso wie monolinguale Sprecher in verschiedenen Kommunikationsgemeinschaften. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass sie in beiden Sprachgemeinschaften an den gleichen Kommunikationsgemeinschaften partizipieren. Charakteristisch hierfür sind die Kommunikationsgemeinschaften Familie und Schule bzw. Beruf : Im familiären Kreis wird meist eine der beiden Sprachen präferiert, im Schul- und Berufsalltag weitgehend die Sprache des Wohnsitzes verwendet. Selbstredend können sich Bilinguale in beiden Sprachen über Inhalte, die diese Kommunikationsgemeinschaften betreffen, verständigen. Das soziale Leben jedoch, das mit einer dieser Kommunikationsgemeinschaften verbunden ist, erfolgt aber nicht gleichermaßen in und über beide Sprachen. Daher darf davon ausgegangen werden, die soziale und folglich auch die sprachliche Handlungsbreite bilingualer Sprecher ist sprachgebunden. Die mit einer jeden Kommunikationsgemeinschaft verbundene Sprachvarietät wird somit nicht in beiden Sprachen weder gleichermaßen verwendet, noch in erhält sie den gleichen Stellenwert Es ist nämlich zu unterscheiden zwischen der Bedeutung, die einer Sprachvarietät zukommt, wenn mit dieser in sozialen Kontexten gehandelt wird, d.h. wenn diese Handlungsinstrument darstellt und zwischen der Bedeutung, die einer Varietät beizumessen ist, wenn diese Beschreibungsinstrument darstellt. Daher ist erklärbar, dass bilinguale Sprecher die eine oder die andere Sprache bevorzugen, bzw. dass die eine oder die andere Sprache manchmal sogar dominiert, wenn sich der kommunikative Rahmen ändert, in dem sprachliche Handlungen vollzogen werden. Sprachen sind daher nicht nur als Beschreibungsinstrumente, sondern gleichzeitig auch als Handlungsinstrumente anzusehen. Der Vollzug einer sprachlichen Handlung ist eine bewusste zweck- und zielorientierte Tätigkeit, die innerhalb eines konkreten sozialen Kontextes stattfindet. Hierin manifestiert sich der gesellschaftliche Aspekt von Sprache. Der jeweilige Sprecher als sozialer Rollenträger und die konkreten sozialen Bedingungen, unter denen Kommunikation stattfindet, stehen somit in einem sich wechselseitig determinierendem Verhältnis zu den Differenzierungen und den Variationen eines jeden Sprachsystems. Daher ist Helbig (1988: 46) zuzustimmen, dass die entscheidende Frage in Bezug auf die Wechselbeziehung zwischen Sprache, Kommunikation und Gesellschaft jene sprachlichen Differenzierungen betrifft, die mit den in einer bestimmten Wirklichkeit handelnden Menschen verbunden sind. 6
7 Bilingualen Sprechern ist somit im Erst- bzw. Zweitsprachunterricht jene Sprachkompetenz zu vermitteln, die davon ausgeht, dass diesen Personen in beiden Sprachen eine sprachliche Handlungsbreite vermittelt wird, die deren sozialer Handlungsbreite entspricht. Zu erforschen wäre demnach zuerst, welche ihrer sozialen Aktivitäten primär über welche der beiden Sprachen erfolgt bzw. angesichts ihrer erwünschten gesellschaftlichen Aktionskompetenz erfolgen sollte: Möglicherweise haben Bilinguale aufgrund von äußeren Umständen die Gewohnheit angenommen, in bestimmten Situationen die eine, in anderen dagegen die andere Sprache zu verwenden. Es wäre jedoch zu fragen, ob man nicht auch untersuchen müsste, ob sie vielleicht in einer der beiden Sprachen bestimmte Sachen, die sie eigentlich ausdrücken können müssten, eben nicht ausdrücken können und sich daher in den entsprechenden Situationen sprachlich verweigern. Hierauf sollte gezielt in einem Sprachunterricht eingegangen werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Deutschunterricht für in Deutschland lebende Kinder ausländischer Arbeitnehmer beispielsweise anders zu konzipieren ist als der Deutschunterricht für im Ausland lebende Kinder aus Mischehen. Es ist nicht so sehr eine Frage, ob es sich um Erstoder um Zweitsprachunterricht handelt, sondern es ist zu berücksichtigen, über welche Sprache die jeweilige soziale Rolle ausgeübt wird. Ein bilingualer Jugendlicher sollte daher beispielsweise in beiden Sprachen seine Position als Mitschüler wahrnehmen können, als Anhänger jedoch einer Fußballmannschaft braucht er sich aber nicht unbedingt in beiden Sprachen als sprachlich kompetenter Fan auszuweisen. In diesem Zusammenhang ist selbstredend auch auf die Korrelation von Sprachnormen mit sozialen Normen hinzuweisen. Diese Normen unterliegen einem für jede Sprache und für jede Gesellschaft charakteristischen und zugleich verbindlichen System, welches auf den jeweils geltenden sozialen Wert- und Normvorstellungen beruht. Diese sozial bedingten Faktoren aber bewirken, dass unterschiedliche Sprachakte in konkreten kommunikativen Situationen von den Gesprächspartnern geäußert bzw. vermieden werden. Das partnertaktische Programm, also z.b. welcher der beiden Kommunikationspartner als dominant angesehen wird, ist wie auch Oksaar (1971: 282) anführt nicht auf linguistische, sondern auf soziale Faktoren zurückzuführen. Beim Übergang nun von einer Sprache zu einer anderen bewegt sich der bilinguale Sprecher gleichzeitig von einer Sprachgemeinschaft zu einer anderen. Daher sind 7
8 eventuell unterschiedliche Normen sowohl in Hinblick auf das Sprachsystem, als auch in Hinblick auf die Sprachverwendung zu berücksichtigen. Vordergründig als richtig empfundene Entscheidungen können nämlich durchaus sowohl situativ als auch kommunikativ inadäquat sein und daher den kommunikativ Erfolg gefährden. Dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Gesellschaft ist folglich im Sprachunterricht, der sich an bilinguale Sprecher wendet, eingehend zu berücksichtigen. Dies impliziert, dass auch Sprachvarietäten zum Unterrichtsgegenstand erhoben und deren Funktionalität und deren kommunikative Wirkung aufgedeckt werden müssen. Literaturverzeichnis Baker, C. 1993: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters. Batsalia, F. 1997: Der semiotische Rhombus. Ein handlungstheoretisches Konzept zu einer konfrontativen Pragmatik. Athen: Praxis. 2003: Sprachvarietäten. Athen: Praxis. Bloomfield, L. 1933: Language. New York: Holt. Corder, S. 1967: The Significance of Learner s Errors. In International Review of Applied Linguistics 5: : A Role for the Mother Tongue. In S. Gass & L. Selinker (eds.), Language Transfer in Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House, Cummins, J. & M. Swain 1986: Bilingualism in Education. London: Longman. Fishman, J. A. 1971: Advances in the Sociology of Language. The Hague: Mouton. (ed.) 2002: Bilingualism and schooling in the United States. The Hague: Mouton. Felix, S. 1981: The Effect of Formal Instruction on Second Learning Acquisition. In Language Learning 31/1: Grosjean, F. 1982: Life with Two Languages: an Introduction to Bilingualism. Cambridge: CUP. Haugen, E. 1969: The Norwegian Language in America: a Study in Bilingual Behavior. Vol. I, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Romaine, S. 1995: Bilingualism. Oxford: Blackwell. Σελλά-Μάζη, Ε. 2001: Διγλωσσία και κοινωνία. Η ελληνική Πραγματικότητα. Αθήνα: 8
9 Προσκήνιο. Skutnabb-Kangas, T. 1984: Bilingualism or not? the Education of Minorities. Clevedon: Multilingual Matters. 9
Pädagogik. meike scheel. Zweisprachigkeit. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung. Examensarbeit
 Pädagogik meike scheel Zweisprachigkeit Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung Examensarbeit Zweisprachigkeit: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung
Pädagogik meike scheel Zweisprachigkeit Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung Examensarbeit Zweisprachigkeit: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bilingualer Erziehung
Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων:
 Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εξέταση που θα διενεργηθεί για την Γερμανική Γλώσσα θα είναι του Επιπέδου B2 του Κοινού
Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εξέταση που θα διενεργηθεί για την Γερμανική Γλώσσα θα είναι του Επιπέδου B2 του Κοινού
Kulturwissenschaft als Linguistik? Linguistik als Kulturwissenschaft
 Kulturwissenschaft als Linguistik? Linguistik als Kulturwissenschaft Wilhelm von Humboldt (1767 1835) Die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher Innigkeit der
Kulturwissenschaft als Linguistik? Linguistik als Kulturwissenschaft Wilhelm von Humboldt (1767 1835) Die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher Innigkeit der
Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η εξέταση που θα διενεργηθεί για την Γερμανική Γλώσσα θα είναι
Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στα πλαίσια των κατατακτήριων εξετάσεων: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η εξέταση που θα διενεργηθεί για την Γερμανική Γλώσσα θα είναι
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
FACHSPRACHE. Einführung
 FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;
FACHSPRACHE Einführung FACHTEXT Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit;
Mehrsprachigkeit & mehrsprachiges Lernen
 Mehrsprachigkeit & mehrsprachiges Lernen Sprachenkolloquium Bodenseeraum PH Feldkirch, 30. November 2011 Mag. Kathrin Oberhofer Forschungsgruppe / Universität Innsbruck Leitung A.o.Univ. Prof. Dr. Ulrike
Mehrsprachigkeit & mehrsprachiges Lernen Sprachenkolloquium Bodenseeraum PH Feldkirch, 30. November 2011 Mag. Kathrin Oberhofer Forschungsgruppe / Universität Innsbruck Leitung A.o.Univ. Prof. Dr. Ulrike
Syntaktischer Transfer beim Erwerb einer Drittsprache anhand der Lernersituation L1 Deutsch, L2 Englisch, L3 Niederländisch
 Syntaktischer Transfer beim Erwerb einer Drittsprache anhand der Lernersituation L1 Deutsch, L2 Englisch, L3 Niederländisch 52. StuTS 21.- 25.11.2012 Ausgangsüberlegung (1) *Kan ik even bellen wanner ik
Syntaktischer Transfer beim Erwerb einer Drittsprache anhand der Lernersituation L1 Deutsch, L2 Englisch, L3 Niederländisch 52. StuTS 21.- 25.11.2012 Ausgangsüberlegung (1) *Kan ik even bellen wanner ik
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN
 FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
FERTIGKEITEN UND PROZEDURALES WISSEN S-1.+ Sprachliche Elemente / kulturelle Phänomene in mehr oder weniger vertrauten Sprachen / Kulturen beobachten / analysieren können S-2 + Sprachliche Elemente / kulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Unterricht im Deutschintensivkurs
 Unterricht im Deutschintensivkurs Geschichte der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer anderen Familiensprache Ziele des DaZ-Unterrichts Aufgaben des DaZ-Unterrichts Fachdidaktische und methodische
Unterricht im Deutschintensivkurs Geschichte der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit einer anderen Familiensprache Ziele des DaZ-Unterrichts Aufgaben des DaZ-Unterrichts Fachdidaktische und methodische
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse
 Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Familiäre Prädiktoren bilingualer Sprachkenntnisse Masterthesis in der AE Entwicklungspsychologie: Jana Baumann Betreuung: Frau Prof. Dr. Leyendecker Überblick 1. 2. 1. Deskriptive Beobachtungen 2. Hypothese
Bilingualismus in der frühen Kindheit Diplom.de
 Kirstin Kannwischer Bilingualismus in der frühen Kindheit Diplom.de I Inhaltsverzeichnis EINLEITUNG 1 1. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM BILINGUALISMUS 5 1.1 Definition der Zweisprachigkeit 5 1.1.1 Der
Kirstin Kannwischer Bilingualismus in der frühen Kindheit Diplom.de I Inhaltsverzeichnis EINLEITUNG 1 1. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM BILINGUALISMUS 5 1.1 Definition der Zweisprachigkeit 5 1.1.1 Der
EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR
 Name: Matrikel-Nr. SS 2015 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 13.Juli 2015 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 100 BE Die folgenden Fragen sind in der Regel stichpunktartig zu beantworten.
Name: Matrikel-Nr. SS 2015 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 13.Juli 2015 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 100 BE Die folgenden Fragen sind in der Regel stichpunktartig zu beantworten.
Wirtschaft und Sprache
 forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Übersicht über das Verfahren und die Vorgaben für die Vergabe des Exzellenzlabels CertiLingua an Schulen in Nordrhein-Westfalen
 Übersicht über das Verfahren und die Vorgaben für die Vergabe des Exzellenzlabels CertiLingua an Schulen in Nordrhein-Westfalen Anerkennung als CertiLingua Schule Das Exzellenzlabel CertiLingua kann nur
Übersicht über das Verfahren und die Vorgaben für die Vergabe des Exzellenzlabels CertiLingua an Schulen in Nordrhein-Westfalen Anerkennung als CertiLingua Schule Das Exzellenzlabel CertiLingua kann nur
ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN IM BEREICH SPRACHE UND MEHRSPRACHIGKEIT
 ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN IM BEREICH SPRACHE UND MEHRSPRACHIGKEIT Artemis Alexiadou Universität Stuttgart Netzwerk Sprache zu den Themen Sprachbildung/ Sprachförderung/Mehrsprachigkeit 20 November 2014
ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN IM BEREICH SPRACHE UND MEHRSPRACHIGKEIT Artemis Alexiadou Universität Stuttgart Netzwerk Sprache zu den Themen Sprachbildung/ Sprachförderung/Mehrsprachigkeit 20 November 2014
Mehrsprachigkeitsdidaktik
 Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Mehrsprachigkeitsdidaktik Einleitende Bemerkungen Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nyböle Hochschule Östfold, Norwegen www.hiof.no Sprache oder Dialekt? manchmal ist es schwierig, zwischen Einzelsprache und
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Was der Volksmund in einem Sprichwort verpackt...
 Sprichwörterforschung 24 Was der Volksmund in einem Sprichwort verpackt... Moderne Aspekte des Sprichwortgebrauchs - anhand von Beispielen aus dem Internet von Gulnas Umurova 1. Auflage Was der Volksmund
Sprichwörterforschung 24 Was der Volksmund in einem Sprichwort verpackt... Moderne Aspekte des Sprichwortgebrauchs - anhand von Beispielen aus dem Internet von Gulnas Umurova 1. Auflage Was der Volksmund
Donald Davidson ( )
 Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien
 Pädagogik Andrea Albrecht Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien Examensarbeit 1. EINLEITUNG... 5 2. ZWEISPRACHIGKEIT EIN ÜBERBLICK... 7 2.1 Definitionen von Zweisprachigkeit...
Pädagogik Andrea Albrecht Zweisprachigkeit in der Familie - Eine Sammlung von Fallstudien Examensarbeit 1. EINLEITUNG... 5 2. ZWEISPRACHIGKEIT EIN ÜBERBLICK... 7 2.1 Definitionen von Zweisprachigkeit...
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler
 Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Christian Atzendorf Tutorium Einführung in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Didaktik und Methodik
 Didaktik und Methodik Zur Bestimmung der Termini und Gegenstandsbereiche Was ist Didaktik? Welche Bereiche sind der Didaktik zugehörig? Was ist Methodik? Wie lässt sich Methodik greifbar machen? Didaktik
Didaktik und Methodik Zur Bestimmung der Termini und Gegenstandsbereiche Was ist Didaktik? Welche Bereiche sind der Didaktik zugehörig? Was ist Methodik? Wie lässt sich Methodik greifbar machen? Didaktik
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Erweiterungsstudium Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Schwerpunktübersicht: 1. Zweitspracherwerbsforschung / Hypothesen / Neurolinguistik 2. Fehler
1. Schuleingangsphase
 Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
Selbständiges Lernen in der Schuleingangsphase und in den 3./4. Klassen 1. Schuleingangsphase Wochenplanarbeit Laut Lehrplan ist es Aufgabe der Lehrkräfte, in der Schuleingangsphase (1./2.) alle Kinder
Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Kulturwissenschaft - Methoden II - Vorlesung: BA, Kulturwissenschaften-Einführung // GS, Typ C Montag, 11:15-12:45 Uhr, Ort: GD Hs8 19.11.2007 Verstehend-historiographische
Individualisierung bei Max Weber. Steffi Sager und Ulrike Wöhl
 Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
Individualisierung bei Max Weber Steffi Sager und Ulrike Wöhl Gliederung 1. Einleitung 2. Das soziale Handeln 3. Werthaftigkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns 4. Die Orientierung am Anderen 5. Zusammenwirken
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Griechisches Staatszertifikat Deutsch
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung M A I 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung M A I 2
George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole
 George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) 1863-1931 Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole Persönlichkeit und soziales Handeln sind durch Symbole
George Herbert Mead (US-amerikanischer Philosoph und Sozialpsychologe) 1863-1931 Mensch bildet sich und erschließt sich seine Welt mittels Symbole Persönlichkeit und soziales Handeln sind durch Symbole
Einleitung. Definitionen von Korpuslinguistik und das Repräsentativitätsmerkmal
 Definitionen von Korpuslinguistik und das Repräsentativitätsmerkmal Einleitung 1. Einleitung 2. Definitionen von Korpuslinguistik 2.1 Entstehung 2.1.1 : korpusbasiert vs. korpusgestützt 2.1.2 Generative
Definitionen von Korpuslinguistik und das Repräsentativitätsmerkmal Einleitung 1. Einleitung 2. Definitionen von Korpuslinguistik 2.1 Entstehung 2.1.1 : korpusbasiert vs. korpusgestützt 2.1.2 Generative
Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit
 Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die
Germanistik Antje Schmidt Arthur Schnitzlers "Der grüne Kakadu". Schein und Wirklichkeit Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik II Seminar: Die Gattung Komödie Der grüne Kakadu die
Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"
 Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
2.1 Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Hochschulstudiums
 Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Studiums 19 Arbeit an der Bachelor- oder Masterarbeit erworben werden. Die Studierenden müssen schon während des Studiums schrittweise an die entsprechenden
Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Studiums 19 Arbeit an der Bachelor- oder Masterarbeit erworben werden. Die Studierenden müssen schon während des Studiums schrittweise an die entsprechenden
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das Aachener Sprachtelefon - Linguistische Sprachberatung an der RWTH. Frank Schilden, M.A.
 Das Aachener Sprachtelefon - Linguistische Sprachberatung an der RWTH Frank Schilden, M.A. Gliederung 1. Das Aachener Sprachtelefon 2. Faktoren linguistischer Sprachberatung - Sprache - Beratung - Linguistik
Das Aachener Sprachtelefon - Linguistische Sprachberatung an der RWTH Frank Schilden, M.A. Gliederung 1. Das Aachener Sprachtelefon 2. Faktoren linguistischer Sprachberatung - Sprache - Beratung - Linguistik
Offener Unterricht Das Kind soll als Subjekt erkannt und respektiert werden.
 Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden und heilpädagogisch praktiziert
 8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
Kunst- und Kulturgeschichte
 Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung. thomas fritz lernraum.
 Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
Mehrsprachigkeit Normalität, Ressource, Herausforderung Blicke aus der Perspektive (auch) der Basisbildung thomas fritz lernraum.wien oktober 2012 was bedeutet Mehrsprachigkeit? Individuum Gesellschaft
Sozialisationsmodelle
 Sozialisationsmodelle 16 Def. von Sozialisation von Hurrelmann (1986, S. 14): Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird mit Sozialisation der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen
Sozialisationsmodelle 16 Def. von Sozialisation von Hurrelmann (1986, S. 14): Im heute allgemein vorherrschenden Verständnis wird mit Sozialisation der Prozeß der Entstehung und Entwicklung der menschlichen
Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch -
 Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch - Workshop Oberbayerischer Schulentwicklungstag am 12.12.2015 Ilona Peters Ilona Peters Beraterin Migration LH München
Sprachliche Voraussetzungen für einen guten Schulstart schaffen - Vorkurs Deutsch - Workshop Oberbayerischer Schulentwicklungstag am 12.12.2015 Ilona Peters Ilona Peters Beraterin Migration LH München
Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts
 Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts Ziele und Aufgaben des Unterrichts Fachdidaktische und methodische Prinzipien Kompetenzbereiche des Spracherwerbs DaZ-Lehrer ist man nicht nur
Einführung in die Didaktik und Methodik des DaZ-Unterrichts Ziele und Aufgaben des Unterrichts Fachdidaktische und methodische Prinzipien Kompetenzbereiche des Spracherwerbs DaZ-Lehrer ist man nicht nur
Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe. Gabriele Kniffka
 Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe Gabriele Kniffka Ausgangslage 1. Deutlicher Anstieg der Zahlen neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Jahr 2015 (vgl. von
Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe Gabriele Kniffka Ausgangslage 1. Deutlicher Anstieg der Zahlen neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Jahr 2015 (vgl. von
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
ENTWICKLUNGSLOGISCHE DIDAKTIK. Nach Georg Feuser
 ENTWICKLUNGSLOGISCHE DIDAKTIK Nach Georg Feuser GLIEDERUNG Wer ist Georg Feuser? Was ist entwicklungslogische Didaktik? Allgemeine Pädagogik Die Dreidimensionalität Die Zone der nächsten Entwicklung Die
ENTWICKLUNGSLOGISCHE DIDAKTIK Nach Georg Feuser GLIEDERUNG Wer ist Georg Feuser? Was ist entwicklungslogische Didaktik? Allgemeine Pädagogik Die Dreidimensionalität Die Zone der nächsten Entwicklung Die
Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter
 Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
Dr. phil. Vera Bamler, Technische Universität Dresden Entdeckungen im Alltag! Bildungsarbeit mit Mädchen und Jungen im Kindesalter Wie Natur Wissen Schafft Ansätze mathematischer und naturwissenschaftlicher
Griechisches Staatszertifikat Deutsch
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung
Wilhelm von Humboldt
 1 Wilhelm von Humboldt "Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Tätigkeit nämlich steht der Mensch, der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur stärken und
1 Wilhelm von Humboldt "Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Tätigkeit nämlich steht der Mensch, der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur stärken und
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie
 Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Der Begriff Lesen in der PISA-Studie Ziel der PISA-Studie war, Leseleistungen in unterschiedlichen Ländern empirisch überprüfen und vergleichen zu können. Dieser Ansatz bedeutet, dass im Vergleich zum
Handelnde Verfahren der Texterschließung von Gedichten in einer 4. Klasse
 Germanistik Kristin Jankowsky Handelnde Verfahren der Texterschließung von Gedichten in einer 4. Klasse Examensarbeit Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG...2 2. GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG...4 2.1 BEGRÜNDUNG...4
Germanistik Kristin Jankowsky Handelnde Verfahren der Texterschließung von Gedichten in einer 4. Klasse Examensarbeit Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG...2 2. GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG...4 2.1 BEGRÜNDUNG...4
DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.
 Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Verhalten Soziales Verhalten Handeln Soziales
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Verhalten Soziales Verhalten Handeln Soziales
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
KARL MANNHEIM S «IDEOLOGIE UND UTOPIE»
 KARL MANNHEIM S «IDEOLOGIE UND UTOPIE» Agenda Historischer Kontext Der Begriff des Denkens I/II Der Begriff des Denkens II/II Ideologie und Utopie I/II Zwei Arten des Ideologiebegriffs Konsequenzen dieser
KARL MANNHEIM S «IDEOLOGIE UND UTOPIE» Agenda Historischer Kontext Der Begriff des Denkens I/II Der Begriff des Denkens II/II Ideologie und Utopie I/II Zwei Arten des Ideologiebegriffs Konsequenzen dieser
Bewegtes Lernen im Mathematikunterricht einer 3. Klasse
 Naturwissenschaft Tanja Steiner Bewegtes Lernen im Mathematikunterricht einer 3. Klasse Die SuS erweitern und festigen ihre Einmaleinskenntnisse in der Turnhalle unter Nutzung und Erweiterung ihrer Bewegungspotentiale
Naturwissenschaft Tanja Steiner Bewegtes Lernen im Mathematikunterricht einer 3. Klasse Die SuS erweitern und festigen ihre Einmaleinskenntnisse in der Turnhalle unter Nutzung und Erweiterung ihrer Bewegungspotentiale
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz. 2. Entwicklung und Progression in Lehrwerken
 Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Rezeptive und produktive Grammatik im Lehrwerk Berliner Platz Adrian Kissmann 1. Rezeptive und produktive Grammatik Obwohl die Begriffe rezeptive und produktive Grammatik modern klingen, wurden sie schon
Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen
 Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse
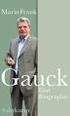 Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Der organisationstheoretische Ansatz der Außenpolitikanalyse These: Die organisatorische Vermittlung außenpolitischer Entscheidungen ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Außenpolitik von Bedeutung
Zappelphilipp, Meckerliese
 Zappelphilipp, Meckerliese Zum Umgang mit Kindern in schwierigen Situationen Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Es gibt Tage, da bin ich froh, dass ich Marvin in den Trainingsraum schicken kann.
Zappelphilipp, Meckerliese Zum Umgang mit Kindern in schwierigen Situationen Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose. Es gibt Tage, da bin ich froh, dass ich Marvin in den Trainingsraum schicken kann.
KRANKHEIT, WÜRDE UND SELBSTACHTUNG
 KRANKHEIT, WÜRDE UND SELBSTACHTUNG AEM-JAHRESTAGUNG 2016 23.9.2016 NELE RÖTTGER, UNIVERSITÄT BIELEFELD Können Krankheiten, das Sterben oder Folgen des Alterns die Würde eines Menschen verletzen? SO MÖCHTE
KRANKHEIT, WÜRDE UND SELBSTACHTUNG AEM-JAHRESTAGUNG 2016 23.9.2016 NELE RÖTTGER, UNIVERSITÄT BIELEFELD Können Krankheiten, das Sterben oder Folgen des Alterns die Würde eines Menschen verletzen? SO MÖCHTE
Du + Ich = Freundschaft
 Elterncoaching Du + Ich = Freundschaft Was wäre ein Leben ohne Freunde? Wahrscheinlich ziemlich einsam, traurig und langweilig. Freunde sind für einen da, hören zu, wenn man Probleme hat, akzeptieren einen
Elterncoaching Du + Ich = Freundschaft Was wäre ein Leben ohne Freunde? Wahrscheinlich ziemlich einsam, traurig und langweilig. Freunde sind für einen da, hören zu, wenn man Probleme hat, akzeptieren einen
Leistungsbewertung in der Berliner Schule
 Leistungsbewertung in der Berliner Schule Was ist Leistung? Leistung beschreibt (außer in der Physik) eine gewünschte Qualität menschlichen Handelns im Sport im beruflichen Zusammenhang in der Organisation
Leistungsbewertung in der Berliner Schule Was ist Leistung? Leistung beschreibt (außer in der Physik) eine gewünschte Qualität menschlichen Handelns im Sport im beruflichen Zusammenhang in der Organisation
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit
 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur 5. Sitzung Deutsch als Zweitsprache/Mehrsprachigkeit 1 Deutsch als Zweitsprache 2 Übersicht/Verlauf der Vorlesung Deutsche Sprache was ist
Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus biologischer Sicht. Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sek. I
 Naturwissenschaft Nina Stohlmann Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus biologischer Sicht. Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sek. I Examensarbeit Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus
Naturwissenschaft Nina Stohlmann Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus biologischer Sicht. Konsequenzen für den Biologieunterricht in der Sek. I Examensarbeit Säuglings- und Kleinkindentwicklung aus
Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können. Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer:
 Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay
Warum Utilitaristen keine Fragen beantworten können Andreas Müller Humboldt-Universität zu Berlin Matrikelnummer: 503924 Email: yalu@gmx.com 06. Dezember 2006 Einleitung Die Frage, die ich in diesem Essay
Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie
 Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie Steffen Hintze Mathematisches Institut der Universität Leipzig - Abteilung Didaktik 26.04.2016 Hintze (Universität Leipzig) Kopfgeometrie 26.04.2016 1 / 7 zum Begriff
Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie Steffen Hintze Mathematisches Institut der Universität Leipzig - Abteilung Didaktik 26.04.2016 Hintze (Universität Leipzig) Kopfgeometrie 26.04.2016 1 / 7 zum Begriff
Das Menschenbild und Krankheitsverständnis in den Konzepten der Validation und des Dementia Care Mapping
 Medizin Susanne Claus Das Menschenbild und Krankheitsverständnis in den Konzepten der Validation und des Dementia Care Mapping Diplomarbeit Das Menschenbild und Krankheitsverständnis in den Konzepten
Medizin Susanne Claus Das Menschenbild und Krankheitsverständnis in den Konzepten der Validation und des Dementia Care Mapping Diplomarbeit Das Menschenbild und Krankheitsverständnis in den Konzepten
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Herzlich Willkommen!
 Herzlich Willkommen! Das Rad neu erfinden? NMG Aufgaben aus mehreren Perspektiven Dr. Hartmut Moos-Gollnisch Dr. Patric Brugger Ablauf Begrüssung und Input (10 ) -> Plenum Kulturwissenschaftliche/ naturwissenschaftliche
Herzlich Willkommen! Das Rad neu erfinden? NMG Aufgaben aus mehreren Perspektiven Dr. Hartmut Moos-Gollnisch Dr. Patric Brugger Ablauf Begrüssung und Input (10 ) -> Plenum Kulturwissenschaftliche/ naturwissenschaftliche
Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5
 Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Protokoll zur Seminarsitzung am zum Thema Die Nachtvögel von Haugenr
 Protokoll zur Seminarsitzung am 24.04.2012 zum Thema Die Nachtvögel von Haugenr Name: Jeanna Margarian Mart.Nr.: 030935910 E-Mail: janna.margarian2@hotmail.de Seminar: Modernisierungstendenzen der KJL
Protokoll zur Seminarsitzung am 24.04.2012 zum Thema Die Nachtvögel von Haugenr Name: Jeanna Margarian Mart.Nr.: 030935910 E-Mail: janna.margarian2@hotmail.de Seminar: Modernisierungstendenzen der KJL
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003
 Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Jahresbericht über die Tätigkeiten des Ausschusses für Betrugsbekämpfung der Europäischen Zentralbank für den Zeitraum von März 2002 Januar 2003 INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 3 2. Feststellungen
Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland
 Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Medien Andrea Harings Funktionaler Analphabetismus in der Bundesrepublik Deutschland Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Analphabetismus... 2 2.1 Begriffsbestimmung... 2 2.2 Ausmaß...
Ein kenianisches Lernerkorpus. Einflüsse der Muttersprachen und des Englischen auf den Spracherwerb bei kenianischen Deutschlernern
 Ein kenianisches Lernerkorpus Einflüsse der Muttersprachen und des Englischen auf den Spracherwerb bei kenianischen Deutschlernern Gliederung Begriffsbestimmung Second Language Acquisition vs. Mulitilingual
Ein kenianisches Lernerkorpus Einflüsse der Muttersprachen und des Englischen auf den Spracherwerb bei kenianischen Deutschlernern Gliederung Begriffsbestimmung Second Language Acquisition vs. Mulitilingual
AVS - M 01. Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ Verantwortlich:
 AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden in diesem Basismodul vertraut
AVS - M 01 1. Name des Moduls: Basismodul I: Grundlagen und Methoden der AVS Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft/ 3. Inhalte / Lehrziele Die Studierenden werden in diesem Basismodul vertraut
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung
 Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Belastungs-Beanpruchungs-Konzept und Gefährdungsbeurteilung von Wolfgang Laurig Die Begriffe "Belastung" und "Beanspruchung" Eine erste Verwendung der beiden Worte Belastung" und Beanspruchung" mit Hinweisen
Information und Produktion. Rolland Brunec Seminar Wissen
 Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Information und Produktion Rolland Brunec Seminar Wissen Einführung Informationssystem Einfluss des Internets auf Organisation Wissens-Ko-Produktion Informationssystem (IS) Soziotechnisches System Dient
Kindergarten 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse. 1. über sich selbst und ihre Familie sprechen und zeichnen
 5.1 Die Gemeinschaft entwickeln und feiern Kindergarten 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Reaktionen teilen und vergleichen 1. Geschichten über sich selbst und ihre Familien darstellen und zeichnen 1. über
5.1 Die Gemeinschaft entwickeln und feiern Kindergarten 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Reaktionen teilen und vergleichen 1. Geschichten über sich selbst und ihre Familien darstellen und zeichnen 1. über
Udo Ohm, Universität Bielefeld. Bildungssprachliche Fähigkeiten und berufliches Handeln
 Bildungssprachliche Fähigkeiten und berufliches Handeln Überblick Sprachliche Vermittlung fachlicher Inhalte Schule und Ausbildung als semiotische Lehrzeit Bildungssprache (BICS vs. CALP) Beispiel: Lesekompetenz
Bildungssprachliche Fähigkeiten und berufliches Handeln Überblick Sprachliche Vermittlung fachlicher Inhalte Schule und Ausbildung als semiotische Lehrzeit Bildungssprache (BICS vs. CALP) Beispiel: Lesekompetenz
Das Verhältnis von Bild und Sprache in französischer Reklame: eine multimediale Textanalyse
 Sprachen Philipp Rott Das Verhältnis von Bild und Sprache in französischer Reklame: eine multimediale Textanalyse Studienarbeit Das Verhältnis von Bild und Sprache in französischer Reklame: eine multimediale
Sprachen Philipp Rott Das Verhältnis von Bild und Sprache in französischer Reklame: eine multimediale Textanalyse Studienarbeit Das Verhältnis von Bild und Sprache in französischer Reklame: eine multimediale
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement
 Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Mitbestimmt geht s mir besser! Seite 1 Leitlinien für Gender und Diversity im Gesundheitsmanagement Beteiligung: Marginalisierten Gruppen eine Stimme geben!
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer. Studiensemester bzw
 Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Modulhandbuch Lehramt Englisch an Gymnasien und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEdE GYMGeM1 Workload 330 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur 1.2 Vertiefung Ling 2: Sprachgebrauch
Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion
 Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements
 Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie 2. Qualitätsmanagementsystem 3. Normenfamilie ISO 9000 4. Grundprinzipien des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie
Anliegen und Normung des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie 2. Qualitätsmanagementsystem 3. Normenfamilie ISO 9000 4. Grundprinzipien des Qualitätsmanagements 1. Qualität und Qualitätsphilosophie
KLASSE 9. In aller Munde - Sprachge Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von Wörtern
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch - Sekundarstufe I Orientiert am Kemlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe KLASSE 9 Ein Blau, ein Rot - Gedichte er- stehen -
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch - Sekundarstufe I Orientiert am Kemlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe KLASSE 9 Ein Blau, ein Rot - Gedichte er- stehen -
Differenzierung im Sportunterricht
 Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE
 STAATSINSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND BILDUNGSFORSCHUNG Dr. Renate Köhler-Krauß Arabellastr. 1, 81925 München E-Mail: r.koehler-krauss@isb.bayern.de DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE AN BAYERISCHEN SCHULEN FÜR
STAATSINSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK UND BILDUNGSFORSCHUNG Dr. Renate Köhler-Krauß Arabellastr. 1, 81925 München E-Mail: r.koehler-krauss@isb.bayern.de DEUTSCHE GEBÄRDENSPRACHE AN BAYERISCHEN SCHULEN FÜR
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ)
 Studienmodul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ) Ziele - Aufbau - Inhalte Warum gibt es das DSSZ Modul? 1. Deutschland ist ein Einwanderungsland. 83 Prozent der Lehrer/innen
Studienmodul Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte (DSSZ) Ziele - Aufbau - Inhalte Warum gibt es das DSSZ Modul? 1. Deutschland ist ein Einwanderungsland. 83 Prozent der Lehrer/innen
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
SONDERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM BACHTELEN GRENCHEN L E I T B I L D
 SONDERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM BACHTELEN GRENCHEN L E I T B I L D Leitbild I. Aufgabe II. Kinder und Jugendliche III. Eltern und familiäre Bezugspersonen IV. Sonderpädagogisches Zentrum Bachtelen und Öffentlichkeit
SONDERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM BACHTELEN GRENCHEN L E I T B I L D Leitbild I. Aufgabe II. Kinder und Jugendliche III. Eltern und familiäre Bezugspersonen IV. Sonderpädagogisches Zentrum Bachtelen und Öffentlichkeit
I. Aufklärung Befreiung
 I. Aufklärung Befreiung Kritik, Zeit, Geschichte Nikolas Kompridis 1. Fast dreißig Jahre sind seit der folgenden, erstaunlich weitsichtigen Zeitdiagnose von Habermas vergangen:»heute sieht es so aus,
I. Aufklärung Befreiung Kritik, Zeit, Geschichte Nikolas Kompridis 1. Fast dreißig Jahre sind seit der folgenden, erstaunlich weitsichtigen Zeitdiagnose von Habermas vergangen:»heute sieht es so aus,
