Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Das männliche wie auch das weibliche Geschlecht sind
|
|
|
- Benedict Voss
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Das männliche wie auch das weibliche Geschlecht sind aber gleichermassen gemeint.
2 Abstract Ziel Die Reduktion von Wundinfekten, sowie eine optimale Wundheilung und somit eine Verringerung der postoperativen Komplikationen, liegt sowohl im Interesse der Patienten 1, wie auch in dem der involvierten Disziplinen. Sauerstoff, das weitaus am meisten genutzte Medikament in der Allgemeinanästhesie, soll genau diese positiven Effekte auf die Wunden haben, welche durch die Operation entstanden sind. Demzufolge steht die zentrale Fragestellung, mit welcher intraoperativen Sauerstoffkonzentration das beste Outcome in Bezug auf die Gewebeoxygenierung erzielt werden kann, im Fokus dieser Arbeit. Methodik Seit einigen Jahren werden immer wieder Studien zu diesem Thema erarbeitet, wobei die Auswirkungen der prä-, intra- und postoperativen Sauerstoffkonzentration untersucht wurden. Während im Hauptteil der Fokus auf den Studien liegt, kann eine Verbindung zur Theorie vom ersten Abschnitt hergestellt werden, wobei vor allem der Sauerstoffpartialdruck im Zentrum steht. Die Diskussionen im Hauptteil basieren hauptsächlich auf der optimalen Menge der Sauerstoffkonzentration. In den Studien wurden Patientengruppen untersucht, welche entweder mit einer Sauerstoffkonzentration von 30% oder 80% beatmet wurden. Immer wieder konnten die Autoren der Studien evidenzbasierte Aussagen bezüglich der positiven Auswirkungen von hohen Sauerstoffkonzentrationen im Bereich von 80% machen. Ergebnisse Die meisten Autoren der Studien befürworten eine hohe Sauerstoffkonzentration und sehen die positiven Aspekte von Sauerstoff als dominierend. Im Gegensatz zu den negativen Auswirkungen von Sauerstoff, wie beispielsweise die Atelektasen. Schlussfolgerungen Bei Allgemeinanästhesien sollten immer höhere FiO 2 Werte angestrebt werden. So sind Fraction of inspired oxygen (FiO 2 ) von 80% zu favorisieren. Jedoch finden sich in der Literatur keine abschliessende Antworten bezüglich anzustrebenden Sauerstoffkonzentrationen, da hier schlicht und einfach Studien und Untersuchungen fehlen, die einen konkreten Wert empfehlen. 1 Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Das männliche wie auch das weibliche Geschlecht sind aber gleichermassen gemeint.
3 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Themenwahl und Motivation Fragestellung Ziel meiner Diplomarbeit Eingrenzungen Die Atmung Pulmonaler Gasaustausch Arterieller Sauerstoffpartialdruck (p a O 2 ) Alveolärer po Alveolo-arterieller Sauerstoffpartialdruck Sauerstofftransport am Hämoglobin FiO FiO 2 während der Einleitung (Präoxygenierung) FiO 2 während der Ausleitung Intraoperativer FiO Outcomes von Sauerstoff Gewebeoxygenierung Wundinfektion und Wundheilung Sauerstofftoxizität / Nebenwirkungen von Sauerstoff Diskussion Schlussfolgerung Reflexion Danksagung Literatur- und Quellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Anhang Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 3
4 1. Einleitung 1.1 Themenwahl und Motivation Seit ich mit meiner Weiterbildung zur diplomierten Expertin Anästhesiepflege Nachdiplomstudium (NDS) Höhere Fachschule (HF) angefangen habe, bedeutete die Gabe von Sauerstoff (O 2 ) immer eine gewisse Sicherheit, um die Oxygenation des Organismus aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Sauerstoff wird zu 100% bei der Präoxygenierung verwendet. Patienten erhalten Sauerstoff nach der Extubation, sofern die Sättigung unter 94% liegt und somit keine suffiziente Oxygenierung aufweist. Teilweise erhalten die Patienten bereits während der Vorbereitungsphase Sauerstoff und vor allem bekommen sie intraoperativ während der Narkose dieses lebenswichtige Gas. Somit ist Sauerstoff, das aus meiner Sicht am meisten gebrauchte Medikament in der Anästhesie. Demzufolge stellte ich mir die Frage, welche positiven Aspekte Sauerstoff noch aufweist. Gibt es weitere und wenn ja wie viel Sauerstoff wird für ein positives Outcome benötigt? Durch die Auseinandersetzung mit diesen ungeklärten Fragen, liess mich der Bezug zwischen der Wundheilung und der Gabe von Sauerstoff aufhorchen. Die Wundheilung spielt während des Spitalaufenthaltes eine wichtige Rolle. Komplikationen werden verringert, Schmerzen vermindert, die Länge der Spitalaufenthalte reduziert und Kosten gespart. Können wir mit Hilfe eines beständigen intraoperativen FiO 2 die Infektionsanfälligkeit und die Wundheilung positiv beeinflussen? Ich erlebe immer wieder, wie die FiO 2 Einstellung am Respirator, vor allem intraoperativ, bei vielen Teammitgliedern variiert und ich meine eingestellte Grenze von 60% FiO 2 nicht vollumfänglich begründen kann. Am Luzerner Kantonsspital Luzern (LUKS) gibt es auch kein einheitliches Schema hinsichtlich des anzustrebenden FiO 2 intraoperativ. In mehreren Gesprächen im Arbeitsalltag habe ich dieses Thema mit Arbeitskollegen kontrovers diskutiert. Aufgrund dessen stellte ich mir viele, bis heute ungeklärte Fragen, die ich mit dieser Arbeit beantworten möchte. In meiner Diplomarbeit setze ich mich aus diesen Gründen mit dem Thema Hyperoxydative Ventilation während der Narkose auseinander. In unserer Atemluft befinden sich lediglich 21% Sauerstoff. Während einer Vollnarkose beatmen wir die Patienten aber mit einer bis zu 3 bis 5 Mal höheren Konzentration. Ist dies noch physiologisch? Aus diesen Gründen möchte ich erfahren, welches Outcome ich mit einem kontinuierlichen intraoperativen FiO 2 erzielen kann und wie hoch die Sauerstoffkonzentration gewählt werden sollte, sowohl für den Narkoseverlauf, wie auch für die postoperative Phase. Den Fokus werde ich dabei immer auf die Gewebeoxygenierung, die Infektionsrate, sowie die Wundheilung richten. Gleichzeitig möchte ich erfahren, ob es auch negative Folgen haben kann, dem Körper zu viel Sauerstoff zu zuführen. Hier spreche ich vor allem die O 2 -Toxizität an. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 4
5 Aus diesen Gründen bin ich motiviert, dieses Thema zu erarbeiten, um meine Einstellungen am Respirator evidenzbasiert begründen zu können. Zudem möchte ich das Wissen erlangen, erklären zu können, wie sich die Hyperoxydation auf den Organismus und die damit verbundene postoperative Wundheilung auswirkt. 1.2 Fragestellung Welcher intraoperative FiO 2 führt zum besten Outcome in Bezug auf die Gewebeoxygenierung? 1.3 Ziel meiner Diplomarbeit Im Rahmen der Diplomarbeit möchte ich darlegen, welche Auswirkungen bezüglich der Gewebeoxygenierung und der Wundheilung ein erhöhtes FiO 2 auf den Organismus hat. Zudem will ich mit meiner Arbeit ein evidenzbasiertes Schema zur intraoperativen O 2 -Gabe erarbeiten, wie ich in Zukunft mit dem Thema intraoperativer FiO 2 umgehen soll. Die Teammitglieder werden durch mein neu erlangtes Wissen im Alltag unterstützt und meine Aussagen kann ich ihnen nachweislich vermitteln. 1.4 Eingrenzungen Ich werden die Vorgaben bezüglich der Sauerstoffkonzentration, welche ich vom Luzerner Kantonsspital Luzern kenne, hinterfragen und diese Methode mit der Literatur vergleichen und kritisch evaluieren. Die Arbeit basiert auf der intraoperativen Sauerstoffkonzentration bei Allgemeinanästhesien (AA) bei Erwachsenen. Während der Vorbereitung und der Ausleitung einer Allgemeinanästhesie haben wir klare Vorgaben, bezügliche den FiO 2 Einstellungen am Respirator und diese weichen auch nicht von den Vorgaben in den Standard Operating Procedures (SOP) ab. Diese beiden Phasen der AA werde ich nur kurz erwähnen. Zudem werde ich auch keine Unterschiede zwischen gesunden und lungenkranken Patienten machen. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 5
6 2. Die Atmung Die Atmung ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Körpers, ohne diese wir nicht überleben können. Unsere Sauerstoffvorräte sind ohne kontinuierliche Zufuhr bereits nach wenigen Minuten aufgebraucht. Deshalb ist es unumgänglich, dass wir während der Narkose diese lebenserhaltende Aufgabe aufrechterhalten und möglichst gut den physiologischen Prinzipien gleichsetzen (Burkhard, 2009). Hypoxische Ereignisse gehören laut Larsen (2013) zu den häufigsten Narkosezwischenfällen, welche durch verfügbares Wissen, die Aufmerksamkeit aber auch durch Erfahrung durchaus reduziert werden können. Ungefähr 1/5 (21%) unserer Einatmungsluft besteht aus O 2. Der grösste Anteil nimmt Stickstoff (N 2 ) mit 78% ein. Hinzukommen Argon, Kohlendioxid und weitere Edelgase, welche lediglich noch 1% ausmachen (Larsen, 2013). Der Verbrauch von Sauerstoff in Ruhe beträgt circa 3-4 ml/kg. Dieser Faktor kann bei physischer wie auch psychischer Belastung bis zu einem zehnfachen gesteigert werden, um so den erhöhten Bedarf an Sauerstoff zu decken. Der Kompensationsmechanismus in diesem Falle ist eine erhöhte Ventilation aber auch ein gesteigertes Herzminutenvolumen. Damit der Sauerstoff überhaupt aus der Einatmungsluft zu den Alveolen gelangen kann, braucht es gewisse physikalische Grundprinzipien (Pape, Kurtz & Silbernagl, 2014). Zum besseren Verständnis werden in den folgenden Kapiteln die wichtigsten physiologischen Prozesse kurz beleuchtet. 2.1 Pulmonaler Gasaustausch Der pulmonale Gasaustausch erfolgt nach dem Prinzip der Diffusion. Das bedeutet der Gasstrom wandert so lange vom Ort der höheren zur niedrigeren Konzentration, bis es zum Konzentrationsausgleich kommt (Larsen, 2013). Zum Gasaustausch können lediglich die Bereiche beitragen, welche sowohl ausreichend perfundiert, wie auch genügend ventiliert sind. Fällt einer oder sogar beide dieser Faktoren aus, kommt es schnell zu einem beeinträchtigten Gasaustausch (Silbernagl & Despopoulos, 2007). Durch das Wissen über die Physiologie des Menschen und die kontinuierliche Überwachung der Patienten während der Narkose, wird sowohl eine stabile Beatmung und Aufrechterhaltung der Ventilation, wie auch eine konstante Perfusion des Organismus und Erhaltung der Herzkreislauffunktion gewährleistet. Zudem wird die Sauerstoffzufuhr durch eine beständige intraoperative Applikation gewährleistet und den Bedarf an O 2 gedeckt (Burkhard, 2009). Damit der zugeführte Sauerstoff den Weg von den Atemorganen bis ins Blut überhaupt passieren kann, braucht es ein Partialdruckgefälle, welches stetig abnimmt (Larsen, 2013). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 6
7 2.2 Arterieller Sauerstoffpartialdruck (p a O 2 ) Sauerstoff, wie auch Kohlenstoffdioxid haben unterschiedliche Partialdrücke und liegen im Körper somit in verschiedenen physikalisch gelösten Mengen vor. Lediglich 1-2 % des gesamten O 2 sind physikalisch gelöst und können somit in die Zellen diffundieren. Deshalb lässt sich sagen, dass der Sauerstoffpartialdruck (po 2 ) ansteigt, je mehr Gas im Blut gelöst ist oder dass der po 2 mit der im Blut gelösten Gasmenge korreliert. Der Partialdruck des Sauerstoffes in der Umgebungsluft, kurz po 2, beträgt in Meereshöhe 159 Millimeter Quecksilbersäule (mmhg) oder 21.1 Kilopascal (kpa) (Larsen, 2013). Im Anhang befindet sich die Berechnung des Sauerstoffpartialdruckes nach dem Boyle Gesetz. 2.3 Alveolärer po 2 Bei zunehmenden Sauerstoffverbrauch wird parallel dazu die alveoläre Ventilation gesteigert, sodass der alveoläre po 2 (p A O 2 ) im Normbereich bleibt. Normwert für den p A O 2 ist 105 mmhg. Wird das Sauerstoffangebot durch Anhebung der inspiratorischen Konzentration erhöht, steigt ebenfalls der p A O 2. Der alveoläre po 2 ist abhängig von folgenden Faktoren: Barometerdruck (verändert sich zum Beispiel in grosser Höhe), O 2 Verbrauch und inspiratorischer Sauerstoffkonzentration (Larsen, 2013). Die untenstehende Abbildung 1 stellt dar, welche Werte die Gasdrücke im Atemsystem aufweisen. Die Bezeichnungen sind in mmhg angegeben. Darin ist vor allem das Gefälle der Partialdrücke in der Einatmungsluft gut ersichtlich. In der Einatmungsluft beträgt der po mmhg, nach dem Passieren der Alveolarmembran beträgt der Wert des Partialdrucks bereits 40 mmhg (Bosshard, 2004). Abb.1: Pulmonaler Gasaustausch und Sauerstofftransport im Blut (Bosshard, 2004, Seite 1). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 7
8 2.4 Alveolo-arterieller Sauerstoffpartialdruck Diese auf der Abbildung 1 ersichtliche Abnahme des Partialdruckes, lässt sich mit der Vermengung des Endproduktes aus dem oxydativen Stoffwechsels, dem Kohlestoffdioxid (CO 2 ), erklären. Aufgrund des po 2 -Gefälles zwischen Alveolarraum und dem gemischtvenösen Blut diffundiert der Sauerstoff so lange, bis ein Gleichgewicht zwischen dem alveolären und dem lungenkapillären po 2 entstanden ist (Silbernagl & Despopoulos, 2007). Ist der Gasaustausch erfolgt, besteht zwischen den Alveolen und dem Blut eine Partialdruckdifferenz. Diese beträgt unter Raumluft circa 15 mmhg. Stellen wir am Respirator nun einen FiO 2 von 100% ein, wird die Differenz von 15 mmhg auf mmhg erhöht. Werden Stoffe im Körper nicht verstoffwechselt, wie zum Beispiel Wasserstoff oder Edelgase, benötigen sie auch keine Partialdruckdifferenz. Sobald der Sauerstoff über die Alveolarmembran ins Blut gelangt ist, bindet er sich entweder chemisch ans Hämoglobin (Hb) oder bleibt in physikalisch gelöster Form bestehen (Larsen, 2013). 2.5 Sauerstofftransport am Hämoglobin Das Hämoglobin ist ein Protein mit 4 Untereinheiten, welche je einer Häm-Gruppe angehört. Der Sauerstoff kann nun durch dieses Häm reversibel an das Porphyrin und das Eisen gebunden werden (Silbernagl & Despopoulos, 2007). Im Körper ist nur ein geringer Teil des Sauerstoffes physikalisch gelöst (1-2% des gesamten O 2 ), der grössere Teil bindet sich chemisch an das Hämoglobin (Hb). Aus Hb und O 2 wird somit HbO 2. Hämoglobin kann Sauerstoff aufnehmen, für diesen Vorgang wird keine Druckdifferenz benötigt, wie dies in anderen Bereichen des Körpers der Fall ist (Larsen, 2013). Der Partialdruck des Sauerstoffs im venösen Blut beträgt circa 40 mmhg, während der Kontaktzeit von lediglich 0,1-0,3 Sekunden steigt dieser Wert auf bis zu mmhg an. Am Ende haben wir durch physiologische Veränderungen einen arteriellen po 2 zwischen mmhg (Pape, Kurtz & Silbernagl, 2014). Folglich lässt sich sagen, dass die Konzentration des Hämoglobins einen positiven Einfluss auf das Angebot des Sauerstoffes an das Gewebe und die Zellen hat (Larsen, 2013). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 8
9 3. FiO 2 Fraction of inspired oxygen bezeichnet den inspiratorischen Sauerstoffanteil, welcher vom Patienten eingeatmet wird. Bei einem Sauerstoffanteil von 21% beträgt der FiO 2 0,2 und kann somit der Raumluft gleichgesetzt werden. Er wird in Prozent- oder Dezimalzahl dargestellt. Der FiO 2 spielt von der Intubation bis zur Extubation eine zentrale Rolle und gilt als aussagekräftiger Wert, um die Sauerstoffzufuhr während der Narkose kontrollieren und gewährleisten zu können (Larsen, 2013). Der Fokus dieser Arbeit liegt hauptsächlich bei dem intraoperativen FiO 2, daher werden die Phasen der In- und Extubation nur kurz erwähnt, da sie ebenfalls eine zentrale Rolle während der Allgemeinanästhesie spielen. In den nächsten Zeilen werden die 3 wichtigsten Phasen einer Allgemeinanästhesie genauer unter die Lupe genommen, damit ein Bezug zur Fragestellung gemacht werden kann. 3.1 FiO 2 während der Einleitung (Präoxygenierung) In den Standard operating procedures des Luzerner Kantonsspitals Luzern (2014) wird die Präoxygenierung mit 100% Sauerstoff, sowie die Gabe der Induktionsdosis ab einer Fraction of exspiration oxygen (FeO 2 ) von über 80% vorgeschrieben (Klinik für Anästhesie, Rettungsmedizin und Schmerztherapie des Luzerner Kantonsspitals Luzern kurz KLIFAiRS, 2014). Über eine dichtsitzende Maske atmet der Patient während der Einleitung reinen Sauerstoff ein, dadurch wird der Stickstoff denitrogenisiert. Eine optimale Präoxygenierung kann die Apnoetoleranz eines lungengesunden Erwachsenen auf bis zu 10 Minuten verlängern und uns so wertvolle Sicherheitszeit verschaffen, ohne dass der Patient hypoxisch wird (Roewer & Thiel, 2013). 3.2 FiO 2 während der Ausleitung Während der Ausleitungsphase einer Allgemeinanästhesie bestehen am LUKS ebenfalls klare Leitlinien zur Einstellungen des FiO 2 Wertes am Respirator, welche in einem Schema in den SOP`s abgelegt sind. Einen FiO 2 von 80% gibt uns, wie bei der Einleitung, eine optimale Sauerstoffreserve, um den Patienten nach der Extubation mit genügender Oxygenation an die nachkommende Station abgeben zu können (KLIFAiRS, 2014). Wie auch Fischer (2008) in seiner Studie erkannte, senkt die Zufuhr von Sauerstoff nach der Narkose das Risiko kardialer Komplikationen, welche durch Hypoxämie oder Tachykardie ausgelöst werden können. Zudem bietet die Gabe von O 2 dem Organismus eine gewisse Sauerstoffreserve für die Zeit zwischen der Ausleitung und dem Weg in den Aufwachraum oder die folgende Bettenstation. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 9
10 3.3 Intraoperativer FiO 2 Während der Intubation verschafft genügend Sauerstoff im Organismus eine Sicherheitsspanne bei Apnoephasen und Zeit bei schwierigen Intubationen oder kritischen Ereignissen. In der Ausleitungsphase gewährleistet eine ausreichende Menge an O 2 eine gute Oxygenation des Organismus für die postoperative Zeit (Roewer & Thiel, 2013). Die intraoperative Phase ist jedoch oftmals die längste Zeit einer Narkose. Daher werden vor allem in diesem Bereich der Allgemeinanästhesie die positiven Aspekte von Sauerstoff in Bezug auf die Gewebeoxygenierung und die Wundheilung aufzeigt und diese mit einem konstanten FiO 2 hervorgehoben. Sauerstoff ist ein kostengünstiges, effizientes und gut steuerbares Medikament und sollte aufgrund der vielen positiven Eigenschaften intraoperativ in einer möglichst hohen Konzentration von 80% genutzt werden. Zudem können hypoxische Ereignisse durch die Sauerstoffreserve verzögert und abgeschwächt werden. Experimente an Tieren zeigten, dass die Erhöhung der Sauerstoffkonzentration von 40% auf 100% eine optimale Oxygenation des Gewebes zur Folge hatte, dies auch bei einem niedrigen Gehalt an Hämoglobin im Körper. Dies ist am ehesten auf die optimale Nutzung des physikalisch gelösten O 2 zurückzuführen (Danzeisen & Priebe, 2005). Greif verglich in seiner Studie von 2005 ebenfalls die Gabe von Sauerstoffkonzentrationen in den Bereichen des FiO 2 von 30% und 80%. Er kam zum Ergebnis, dass ein FiO 2 von 80% die bestmöglichste Konzentration sei, um den optimalsten Outcome bezüglich Infektionen und der Wundheilung zu erreichen. Vor allem die ersten Stunden nach einer bakteriellen Kontamination sind ausschlaggebend für die Entstehung von Wundinfektionen. Deshalb sei eine konstant hohe Sauerstoffgabe unerlässlich, um diesen Infektionen vorzubeugen. In einer Untersuchung mit 300 Patienten erhielt die eine Gruppe einen FiO 2 von 30% und die andere 80%. Da die Gruppe welche 80% FiO 2 erhielt, ein 40% tieferes Risiko aufzeigte eine Wundinfektion zu erleiden, wurde am Ende dieser Studie ebenfalls empfohlen eine möglichst hohe intraoperative Sauerstoffkonzentration von 80% anzustreben (Fischer, 2007). Franzke und Jähne schrieben im Jahr 2013 über die Wichtigkeit von Sauerstoff in Bezug auf die Anastomoseninsuffizienzen nach Gastrektomie. Die Infektionsrate konnte auch hier durch erhöhte Sauerstoffkonzentrationen gesenkt werden (5,8%), während die mit geringeren Konzentrationen versorgte Gruppe mit einem Resultat von 12,9% abschloss. Sie wollten dessen ungeachtet keine genaue Empfehlung dafür machen, wie hoch der intraoperative Sauerstoff gewählt werden sollte. Trotzdem sprachen sie sich einer vermehrten Gabe von Sauerstoff zu, genaue Werte dazu gaben sie in ihrer Studie aber nicht an (Franzke und Jähne, 2013). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 10
11 4. Outcomes von Sauerstoff 4.1 Gewebeoxygenierung Der subkutane Gewebepartialdruck und die Infektionsentstehung stehen eng im Zusammenhang miteinander. Aufgrund dieser Erkenntnisse entstand bereits 2005 die Aussage, dass eine gute Gewebeoxygenierung die Infektionsentstehung mindern oder gar vermeiden kann. In dieser Studie wurde untersucht wie viel Sauerstoff intraoperativ benötigt wird, um einen optimalen Sauerstoffpartialdruck zu erreichen und in diesem Zusammenhang einen positiven Wundheilungsverlauf zu gewähren. Arterielle Sauerstoffpartialdrücke von mmhg führten während und nach der Operation zu einem subkutanen Sauerstoffpartialdruck (PscO 2 ) zwischen mmhg. Ein PscO 2 von unter 40 mmhg erhöhte das postoperative Infektionsrisiko. Wobei sich ein PscO 2 von über 60 mmhg positiv auf die Gewebeoxygenierung und somit auf die Wundheilung auswirkt. Sie untersuchten zudem den FiO 2, welcher intraoperativ angestrebt werden soll, um diese Sauerstoffpartialdrücke der Subkutis zu erreichen und eine positives Outcome bezüglich der Oxygenation des Gewebes zu erzielen. Sie kamen zum Entschluss, dass möglichst hohe Werte an FiO 2 zugeführt werden sollten, um den PscO 2 in einen für den Körper und die Wunden schützenden Abschnitt zu bringen (Danzeisen & Priebe, 2005). Der Sauerstoffanteil ist stark abhängig vom Blutfluss im betroffenen Gebiet, sowie dem arteriellen Sauerstoffgehalt. Denn diese Faktoren beeinflussen den Anteil von Sauerstoff im Gewebe. Genügend hohe O 2 -Mengen sind für eine optimale Gewebeoxygenierung unerlässlich. Durch eine Minderperfusion oder eine Gefässverletzung, werden die betroffenen Gebiete zu wenig bis gar nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Ebenfalls wird für den Wundheilungsprozess den Verbrauch an Sauerstoff gesteigert und es kommt somit zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoff Angebot und Verbrauch. Hinter dieser unausgeglichenen Balance birgt sich auch die Gefahr der Hypoxie. Um diesen postoperativen Gefahren vorzubeugen, sind gewisse Faktoren notwendig, damit die Sauerstoffkonzentration im Wundbereich überhaupt genügend hoch ist. Dabei steht vor allem ein ausreichend hoher arterieller Sauerstoffgehalt, eine optimale Hb-Konzentration sowie eine entsprechende lokale Perfusion im Vordergrund (Greif, 2005). Die Gabe eines intraoperativen FiO 2 von 80% versus 30% hatte eine deutliche Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks in der Subkutis (PsqO 2 ) zu Folge. Auch Greif (2005) kam zum Ergebnis, dass ein subkutaner Sauerstoffpartialdruck von unter 40 mmhg die Entstehung von Infektionen begünstigt, er stützte somit die Aussage von Danzeisen und Priebe. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 11
12 Auf der Abbildung 2 ist eindrücklich zu sehen, wie sich die Hypoxie auf den Sauerstoffpartialdruck der Subkutis auswirkt. Je höher der FiO 2, desto besser der Partialdruck. Während der Gabe eines FiO 2 von 80% lässt sich schon ab der ersten Operationsstunde eine deutliche Erhöhung des PsqO 2 erkennen. Nach circa 2 Stunden haben sich die Werte der beiden Gruppen deutlich verändert. Während die Gruppe mit der höheren Sauerstoffkonzentration deutlich aufsteigende PsqO 2 Werte aufzeigt, fallen die der Gruppe 30% unverkennbar ab. Erst circa 3 Stunden postoperativ treffen die beiden Gruppen wieder aufeinander (Greif, 2005). Aufgrund seiner Erkenntnisse aus der Studie, kam er zu folgender Aussage: Die Häufigkeit von Infektionen korreliert mit dem Partialdruck des Sauerstoffs im Gewebe (Greif, 2005, S.1). Abb. 2: Outcome-Verbesserung durch FiO 2 1,0: Realität oder Mythos? (Greif, 2005, Seite 2). In einer Studie aus dem Jahr 2007 wies der Autor ebenfalls auf die Wichtigkeit von Sauerstoff in Bezug auf die Widerstandkraft des Gewebes und die Immunabwehr hin. Je höher der Sauerstoffpartialdruck in der Wunde, desto besser die Abwehr gegenüber Infektionen. Substanzen der Immunabwehr, wie Granulozyten, können erst vollumfänglich funktionieren, wenn das betroffene Gewebe genügend oxygeniert wird. Zudem wird darüber berichtet, wie wichtig Sauerstoff in Bezug auf die Kollagensynthese des Gewebes ist. Durch ausreichende Sauerstoffmengen, kann das Bindegewebe gestärkt werden und somit optimal funktionieren (Fischer, 2007). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 12
13 Hachenberg, Sentürk, Jannasch und Lippert kamen 2010 desgleichen zum Ergebnis, dass der Sauerstoffpartialdruck eng in Verbindung mit der Wundheilung steht. Sobald der Wert des subkutanen Sauerstoffpartialdruckes unter 40 mmhg fällt, wird die Gewebeoxygenierung negativ beeinflusst und die Stoffe der Immunabwehr können nur eingeschränkt bis gar nicht mehr funktionieren. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, empfehlen auch sie die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff perioperativ (Hachenberg et al., 2010). 4.2 Wundinfektion und Wundheilung Nach einem operativen Eingriff bleiben immer grössere oder kleinere Wunden zurück, weshalb eine schnelle und komplikationsfreie Wundheilung nach einer Operation angestrebt wird. Die Rate der an einer Wundheilungsstörung betroffenen Patienten nach kolonchirurgischen Eingriffen beträgt 10-30%. Für die Entstehung postoperativer Wunden, sind die ersten Stunden die entscheidendsten. Durch die Manipulation einzelner Gebiete, kommt es zu einer verminderten Sauerstoffversorgung. Die Studien bezüglich Wundinfektion stehen vor allem in Verbindung mit Patienten nach kolorektalen Eingriffen (Fischer, 2007). In der Studie von 2006 wurden insgesamt 291 Patienten nach einer Darmoperation untersucht. Die eine Gruppe wurde mit einem FiO 2 von 30% beatmet, während die andere Gruppe eine Sauerstoffzufuhr von 80% erhielt. Der Fokus lag vor allem auf der Entstehung der Wundinfekte innerhalb von 2 Wochen. Die beiden Gruppen wurden sowohl intraoperativ, wie auch 6 Stunden postoperativ mit einer kontinuierlichen Sauerstoffzufuhr überwacht. Die Gruppe, welche mit einem FiO 2 von 80% beatmet wurde, zeigte deutlich weniger Wundinfekte auf, als dies in der anderen Gruppe der Fall war. Die Rate sank von 24,4% auf 14,9%. Zudem erkannte der Autor, dass weder das Alter, noch das Geschlecht oder das Körpergewicht in dieser Studie eine Rolle spielte. Bezüglich Heilungsverlauf oder Hospitalisationsdauer konnten am Ende der Studie jedoch keine Aussagen gemacht werden (Meier, 2006). Mit diesen Aussagen und Erkenntnissen kam er somit auf dasselbe Resultat wie die bereits erläuterte Studie von Greif (2005), welcher ebenfalls aufzeigte, dass bei einem tieferen intraoperativen FiO 2 mehr postoperative Wundinfekte entstehen wurde eine Studie von Danzeisen und Priebe herausgegeben, welche ebenfalls 2 Gruppen mit unterschiedlichen FiO 2 beatmen liessen. Die erste Gruppe mit 30% und die zweite mit 80%. Die Infektionen traten bei der Gruppe mit der tieferen Sauerstoffkonzentration in 11,2% auf, in der anderen Gruppe bei 5,2%. Die subkutanen Sauerstoffpartialdruckwerte betrugen in der ersten Gruppe 60 mmhg und in der zweiten Gruppe 110 mmhg. Aus diesem Grund befürworteten sie in ihrer Studie das Anstreben einer erhöhten Sauerstoffkonzentration, um die Wundheilung zu verbessern. Danzeisen und Priebe (2005) verglichen in derselben Untersuchung eine weitere Studie von Pryor, Fahey, Lien und Goldstein aus dem Jahr 2004, welche genau das Gegenteil aufzeigten. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 13
14 Die Voraussetzungen waren dieselben und die Gruppen wurden ebenfalls eingeteilt in 35% und 80% FiO 2. Am Ende gingen die Befunde deutlich auseinander und die höhere Sauerstoffkonzentration wurde mit einem schlechteren Outcome beschrieben. Die Infektionsrate stieg bei erhöhter Sauerstoffgabe auf 25%, während die der 35% FiO 2 am Ende der Untersuchung bei 11,3% lag. Danzeisen und Priebe erklärten sich diese unterschiedlichen Ergebnisse so: Bei der Arbeit von Pryor et al. von 2004 war die Studie weniger gut kontrolliert. Es gab einige Einschränkungen in der Untersuchung und es nahmen deutlich weniger Patienten teil. 165 Männer und Frauen wurden in der Studie von 2004 untersucht, gegensätzlich waren es 500 Patienten in der Studie von Einige Jahre später kam ein weiterer Autor erneut zur Erkenntnis, dass ein erhöhter FiO 2 die Wundheilung optimal beeinflusst und ein positiver Aspekt zur Wundheilung aufzeigt. Seine Studie bestand aus 300 Patienten mit kolorektalen Eingriffen, die eine Gruppe erhielt 30% Sauerstoff appliziert, während die Gegengruppe 80% Sauerstoff bekam. Das Risiko einer Wundinfektion, war in der ersten Gruppe, mit der tieferen Sauerstoffkonzentration 40% höher als in der zweiten Gruppe. Optimal sei auch, die Sauerstoffgabe bei dieser Eingriffsart 2 Stunden postoperativ weiterzuführen, um den bestmöglichsten Ertrag zu erhalten (Fischer, 2007). In einer weiteren randomisierten Studie wurden 500 Patienten während abdominalen Operationen und 2 Stunden postoperativ untersucht. Auch hier wurde die eine Gruppe mit 80% Sauerstoff versorgt, während die zweite Gruppe 30% O 2 erhielt. In mehreren Stichproben erkannte man, dass in der Gruppe, welche 80% O 2 bekam, ein deutlich vermindertes Risiko für Wundinfektionen herrschte. Lediglich 5,2% hatten ein Risiko für Wundinfektionen, während die zweite Gruppe mit 11,2% deutlich schlechter abschnitt. Sie konnten in ihren Untersuchungen jedoch nicht darlegen, dass bei der 80%igen Sauerstoffgruppe der Spitalaufenthalt verlängert gewesen wäre. Zudem verglichen sie in ihrer Arbeit zudem eine Studie aus Dänemark, welche zwischen 2006 und 2008 durchgeführt worden ist und insgesamt 1400 Patienten miteinschloss (Hachenberg et al., 2010). Hier standen die Ergebnisse bezüglich Wundinfektionen fast gleichauf. In der 30% Gruppe 20,1% in der 80% Gruppe 19,1% (Meyhoff et al., 2009). Hachenberg et al. (2010) gingen nicht weiter auf diese Ergebnisse der Studie ein, sie äusserten sich lediglich dazu, dass die erhöhte Gabe von 80% Sauerstoff überlegt eingesetzt werden sollte, da es für gewisse Patienten zu schädlichen Auswirkungen kommen kann. Franzke und Jähne (2013) beschrieben ebenfalls, dass sie mit 80% Sauerstoff ein besseres Outcome erreichten, im Gegensatz zu der Gruppe, welche mit 30% O 2 beatmet wurde. Sie untersuchten insgesamt 171 weibliche und männliche Patienten, während und nach einer abdominellen Operation (Gastrektomie). Bei einem FiO 2 von 80% lag die Rate der Anastomoseninsuffizienten bei 49% weniger als bei einem FiO 2 von 30%. Insgesamt starben während dieser Studie 12 Patienten, 4 an den Folgen der Anastomoseninsuffizienz. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 14
15 Davon waren drei Patienten aus der Gruppe der 30% Sauerstoffkonzentration. Trotz dieser Erkenntnisse wollten sie keine Empfehlungen zur Gabe der intraoperativen Sauerstoffmenge machen. Laut ihnen bedarf dieses Thema noch weiteren Studien und Untersuchungen (Franzke und Jähne, 2013) wurde bei insgesamt 3001 Patienten die Auswirkung von Sauerstoff auf die Wundinfekte in einer randomisierten Metaanalyse erforscht. In der hyperoxydativ beatmeten Gruppe lag die Infektionsrate bei 9%, während die Rate bei der Gruppe, welche mit 30% beatmet wurden mit 12% deutlich höher lag. Zudem konnte das Infektionsrisiko in der 80% Gruppe mit 25,3% deutlich reduziert werden. Weiter fanden sie heraus, dass vor allem die Patienten nach einem kolorektalen Eingriff von höheren Sauerstoffkonzentrationen profitieren können (Quadan, Akça, Mahid, Hornung & Polk, 2009). In einer weiteren umfangreichen Studie wurden insgesamt 7001 Patienten mit kolorektalen, abdominalen und gynäkologischen Eingriffen untersucht. Die Analysen reichten von 14 Tage bis 30 Tage postoperativ. Sie verglichen mehrere Studien miteinander und kamen zum Ergebnis, dass die Wundheilung und das Infektionsrisiko mit einer Beatmung von 80% FiO 2 von 14,1% auf 11,4% reduziert werden konnte. Bei kolorektalen Eingriffen fiel das Resultat wie folgt aus: Die Rate der Wundentstehung und Infektanfälligkeit sank von 19,3% auf 15,2% (Hovaguimian et al., 2013). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 15
16 5. Sauerstofftoxizität / Nebenwirkungen von Sauerstoff Bei einem Überschuss an Sauerstoff entstehen freie Radikale, welche dem Körper normalerweise zur Entgiftung und Immunabwehr dienen. Kommen diese im Organismus jedoch in zu hohen Mengen vor, ist der Körper nicht mehr im Stande diese Radikale zu verarbeiten. Sie beginnen den Körperzellen zu schaden und sind beteiligt an der Entstehung von Krebs, Arteriosklerose sowie neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer (Marian, 2009). Fischer erkannte in seiner Studie von 2007, dass erst ab einer Zeit von über 24 Stunden Behandlung mit 95% Sauerstoff Schäden am Organismus und negative körperliche Auswirkungen nachzuweisen sind. Aufgrund dessen sagt er aus, dass die Gabe von 80% Sauerstoff bis 24 Stunden ohne Bedenken verabreicht werden kann. Trotzdem ist die Bildung von Atelektasen, welche durch die erhöhte Gabe von Sauerstoff entsteht, nicht zu vernachlässigen. Während der Narkose sollten diese Atelektasen unbedingt therapiert werden, um allfällige Komplikationen postoperativ zu verhindern. Werden die von Atelektasen betroffenen Lungenregionen wieder eröffnet, sollte der FiO 2 zwischen 40-60% gewählt werden, um die positive Auswirkung des Recruitmentmanövers möglichst lange anhalten zu lassen. Gegenwärtig erwähnt er aber auch die positiven Auswirkungen, welche nach Sauerstofftherapien über längere Zeit erkannt wurden, wie beispielsweise verbesserte Überlebenschancen. Ebenfalls spricht er zudem das Auftreten von Zellschäden bei einem tiefen FiO 2 um 0,28 während einer Stunde an. Der Oxydative Stress war bei dem Experiment erhöht und somit kommt es zu einer vermehrten Freisetzung von Sauerstoffradikalen (Fischer, 2007). Meier (2006) konnte bereits ein Jahr zuvor nachweisen, dass die Bildung von Atelektasen in Bezug auf die vielen positiven Aspekte von Sauerstoff, eine bedeutungslose Rolle spielt und somit bei gesunden erwachsenen Patienten vernachlässigbar sei. Er fand heraus, dass bei der Beatmung mit einem FiO 2 von 30% und einem FiO 2 von 80% das Auftreten von Atelektasen fast kein Unterschied macht und somit ausser Acht gelassen werden kann. Interessant ist auch die Feststellung, dass ein FiO 2 von 40% nach Eröffnung der Atelektasen eine acht Mal längere Wirkung zeigt (40 Minuten), als mit einem FiO 2 von 100% (5 Minuten). Somit lässt sich sagen, dass es besser ist, nach dem Recruitmentmänover den FiO 2 niedriger zu halten, als direkt auf 100% zu erhöhen. Bis zu 50% aller Patienten erleiden postoperativ Atelektasen nach einer abdominellen Operation. 2 Stunden nach der Narkose sind bei 80% der Patienten Atelektasen nachzuweisen, wie Fischer (2007) in seiner Studie schrieb. Er kam durch seine Erkenntnisse zu folgender Aussage: Je grösser die atelektatische Fläche, desto ausgeprägter waren die Verschlechterungen des pao 2 (Fischer, 2007, S. 6). Im Gegensatz zu dieser Aussage schrieb Fischer (2007) aber auch Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 16
17 davon, dass ein FiO 2 von 80% für bis zu 24 Stunden als sicher angesehen werden kann und die Gefährdung der Sauerstoffnebenwirkungen, wie beispielsweise die Toxizität, ohne Bedenken vernachlässigt werden können. Die während der Denitrogenisierung aufgetretenen Atelektasen können als physiologisch angesehen werden und sind klinisch mit grosser Wahrscheinlichkeit als bedeutungslos zu betrachten. Zudem tritt die häufig diskutierte Sauerstofftoxizität während Vollnarkosen bis zu 12 Stunden gar nicht erst auf (Greif, 2005). Akça et al. schrieben bereits 1999 über postoperativ durchgeführte Computertomografien (CT) bei Patienten, welche intraoperativ mit einem FiO 2 von 80% beatmet wurden. Überraschenderweise wurden keine bedeutsame Atelektasen Zunahme erfasst. Einzig bei spontanatmenden Patienten, welche einen FiO 2 von 1,0 erhielten, wurden bei den CT- Aufnahmen Atelektasen sichtbar, ein sinkendes Tidalvolumen und eine Entwicklung des arteriovenösen Shuntvolumen erkennbar. Diese negativen Reaktionen der erhöhten O 2 Zufuhr können aber mit einer optimalen Einstellung am Respirator oftmals verbessert oder sogar behoben werden (Akça et al., 1999). Auch laut Danzeisen und Priebe (2005) entsteht eine bedenkliche Toxizität der Lunge erst nach Zufuhr von hohen Sauerstoffkonzentrationen während einigen Tagen. Die perioperative Gabe über mehrere Stunden sei laut ihrer Studie von 2005 ohne bedenkliche Nebenwirkungen und sei für die Immunabwehr der Lunge eventuell sogar von Vorteil. Auf diese Hypothese gingen sie nicht weiter ein. Zu diesem Thema äusserte sich auch Laux wie folgt dazu: Das Maß für die inspiratorische O 2 -Konzentration ist die ausreichende Oxygenierung. Die Sorge um mögliche Schäden durch hohe inspiratorische O 2 -Konzentrationen ist zweitrangig (Laux, 2012, S. 585). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 17
18 6. Diskussion In 2 Punkten waren sich die Autoren der verschiedenen Studien einig. Einerseits, dass die Infektionsvorbeugung sowie die Wundheilung ein zentraler Punkt ist um Komplikationen postoperativ zu verringern und Kosten in den Spitälern zu sparen. Anderseits, dass der Sauerstoff ein kostengünstiges und gut steuerbares Medikament ist. Sie konnten jedoch bezüglich des ersten Punktes keine einheitliche Aussage diesbezüglich machen, ob die Aufenthaltstage im Spital durch eine erhöhte Sauerstoffkonzentration intraoperativ verkürzt werden konnten. Meier (2006) konnte zudem aufzeigen, dass weder das Alter, noch das Geschlecht oder das Gewicht das Resultat beeinflussten und somit zu einem schlechteren Outcome führten. Die Untersuchungen liefen immer in 2 Gruppen ab, die eine Gruppe erhielt einen FiO 2 zwischen 30 und 35% während die zweite Gruppe eine deutlich höhere Sauerstoffkonzentration von 80% bekam. Während sich die Mehrheit der Autoren einig waren, dass die Gruppe des 80%igen FiO 2 besser abschnitt, wiederlegten Pryor et al., 2004 sowie Meyhoff et al., 2009 interessanterweise die Resultate der anderen Studien. Diese zeigten in ihren Untersuchungen auf, dass eine erhöhte Gabe von Sauerstoff (ebenfalls 80%) ein schlechteres Outcome aufweist als umgekehrt. Die Studie aus dem Jahr 2004 musste sogar abgebrochen werden, da die Patienten der Gruppe FiO 2 80% zu viele Komplikationen aufwiesen. Danzeisen und Priebe (2004), welche gegenteilig eine erhöhte Gabe von 80% Sauerstoff erwiesen, begründeten das Resultat von Pryor et al., (2004) folgendermassen: Die Studie wurde weniger gut kontrolliert, als die andere Studie, zudem gab es Einschränkungen, auf welche die Autoren nicht näher hinweisen wollten. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass viel weniger Patienten in dieser Untersuchung teilnahmen. Bereits 2005 erkannten 2 Autoren unterschiedlicher Studien, dass ein zu tiefer Sauerstoffpartialdruck die Entstehung von Wunden begünstigt und daher verhindert werden sollte. Sie kamen allesamt zum Ergebnis, dass ein Sauerstoffpartialdruck von unter 40 mmhg postoperativ zur Entstehung von Infektionen beiträgt und deshalb zu einem schlechteren Outcome bezüglich Wundheilung führt (Greif, 2005; Danzeisen und Priebe, 2005). Greif (2005) kam mit seiner Studie zudem zum Resultat, dass ein FiO 2 von 80% nötig sei, um den Partialdruck des Sauerstoffes in einen für die Wundheilung prophylaktischen Bereich zu bringen. Auf der Abbildung 2 ist deutlich ersichtlich, dass eine erhöhte Sauerstoffgabe von 80% intraoperativ bereits zu einem postoperativ besseren Partialdruck für sicherlich 2 bis 3 Stunden führt. Die zusätzliche Gabe von Sauerstoff nach einer Operation würde den Partialdruck zusätzlich für eine längere Zeit erhöhen und kann somit gut fortgesetzt werden. Danzeisen und Priebe (2005) zeigte den Zusammenhang zwischen dem intraoperativen Sauerstoff und den Sauerstoffpartialdrücken deutlich auf: Einen FiO 2 Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 18
19 von 30% führte zu einem PscO 2 von 60 mmhg. Während der Sauerstoffpartialdruck bei einem FiO 2 von 80% auf 110 mmhg ansteigt. Somit zeigten sie deutlich auf, dass eine erhöhte Sauerstoffkonzentration den Partialdruck parallel ansteigen lässt und die Wundheilung positiv beeinflusst. 2 Jahre später führte eine Untersuchung desgleichen zum Resultat, dass die Immunabwehr durch eine zu tiefe Sauerstoffkonzentration nicht mehr vollumfänglich funktioniert und die Kollagensythese und die Beweglichkeit des Gewebes deutlich eingeschränkt wird (Fischer, 2007). Nicht überraschend kamen auch Hachenberg et al., 2010 auf dasselbe Schlussergebnis wie bereits Greif so wie auch Danzeisen und Priebe im Jahr 2005 aufzeigten. Sie bestätigten mit ihrer Studie 5 Jahre später, dass ein zu tiefer PsqO 2 unter 40 mmhg negative Einflüsse auf die Gewebeoxygenation und somit auf die Wundheilung hat. Interessanterweise empfahlen sie die Sauerstoffgabe postoperativ weiterzuführen, um optimale Bedingungen zu schaffen. Die postoperative Gabe von Sauerstoff empfahl auch Fischer (2007) in seiner Studie. Er befürwortete diese Gabe für 2 Stunden nach kolorektalen Eingriffen. Beide äusserten sich aber nicht zu der Menge der postoperativen Sauerstoffgabe. Die Resultate der obenstehenden Studien lassen sich nun optimal mit dem Theorieteil der ersten Seiten verknüpfen. Je mehr Sauerstoff im Körper vorhanden ist, desto mehr kommt in gelösten Mengen im Blut vor und kann ins Gewebe diffundieren und dort eine bestmögliche Oxygenierung des Gebietes gewährleisten. Meier (2006) legte seinen Fokus vor allem auf Patienten während und nach Darmoperationen. Seine Analyse erfolgte sowohl intraoperativ, wie auch 2 Wochen postoperativ. Die Patienten seiner Untersuchung erhielten für 6 Stunden postoperativ eine kontinuierliche Sauerstoffgabe. Auch hier zeigte die Gruppe, welche mit einem FiO 2 von 80% beatmet wurde, eine deutliche Reduktion der Wundinfekte. In der Studie von Franzke und Jähne im Jahr 2013 drehte sich der Inhalt der Studie um Patienten während und nach Gastrektomie. Die Anastomoseninsuffizienz konnte mit einem höheren FiO 2 um 49% gesenkt werden. Trotz dieser deutlichen Ergebnisse, wollten sie keine einheitlichen Empfehlungen zur O 2 -Konzentration machen, befürworteten aber eine erhöhte Sauerstoffkonzentration. Hovaguimian et al., (2013) untersuchten mit 7001 wohl am meisten Patienten. Sie verglichen verschiedene Studien aus den vergangenen Jahren miteinander. Auch ihr Fokus lag auf kolorektalen und abdominalen Eingriffen. Zusätzlich zu den anderen Studien untersuchten sie auch gynäkologische Eingriffe. Sie kamen ebenfalls zum Ergebnis, dass eine erhöhte Sauerstoffkonzentration von 80% das Infektionsrisiko deutlich senken konnte. Während der Fokus dieser Studien auf der Entstehung und Vermeidung von Infektionen und Wunden lag, äusserten sich die Autoren in ihren Studien auch immer wieder zum Sauerstoff und seinen Nebenwirkungen. Sie waren sich auch hier einig, dass eine erhöhte Gabe von Sauerstoff zur Atelektasenbildung führt und dies eine ungewollte Reaktion auf die Denitrogenisierung ist. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 19
20 Die Sauerstofftoxizität und die Nebenwirkungen von Sauerstoff waren nebst der Wundheilung und Infektionsentstehung ein bedeutendes Thema in den Studien. Greif äusserte sich 2005 in seiner Studie dazu, dass die Gabe von hohen Sauerstoffkonzentrationen bis 12 Stunden ohne Bedenken gegeben werden kann, da die O 2 - Toxizität bis dahin gar nicht erst vorhanden sei. Fischer (2007) erkannte 2 Jahre später auch, dass die Gabe von 80% Sauerstoff sogar bis 24 Stunden eine bedeutungslose Rolle spielt. Wird der perioperative Zeitraum mit der Aufenthaltszeit im Aufwachraum gerechnet, ist es gut möglich, dass diese Zeit 12 Stunden erreicht und Sauerstoff somit toxisch wirken könnte. Deshalb ist die Gabe von Sauerstoff postoperativ mit Vorsicht anzuwenden. Zusätzlich zu der Sauerstofftoxizität ist das Auftreten von Atelektasen bei der Gabe von O 2 nicht zu vermeiden, deshalb wird auch das Recruitmentmanöver angewendet, um die durch das Auswaschen des Stickstoffes entstandenen Atelektasen zu eröffnen. Ebenfalls versuchen wir in der Ausleitungsphase die Atelektasen durch eine erhöhte Positive End Exspiratory Pressure (PEEP) Gabe während der Extubation zu eröffnen. Abschliessend zu diesem Thema äusserten sich die Autoren auch dazu, dass es wichtiger sei, die Oxygenierung aufrecht zu erhalten und zu verbessern, als die Toxizität zu beheben. Sie befürworteten deshalb eine hohe Sauerstoffkonzentration, mit dem Wissen, dass Atelektasen enstehen, diese aber vernachlässigbar seien und mit einem erhöhten PEEP oftmals auch reduziert werden können. Zudem kann hier die Überleitung zur Sauerstoffdissoziationskurve gemacht werden. Wird die obenstehende Aussage von Fischer (2007) bezüglich der Atelektasen und die damit verbundene Veränderung des pao 2 angeschaut, kann gesagt werden, dass eher eine Rechtsverschiebung in der Sauerstoffdissoziationskurve angestrebt werden sollte. Die dadurch entstandene Azidose trägt dazu bei, dass eine optimale Gewebeversorgung mit Sauerstoff erreicht werden kann. Eine sogenannte Linksverschiebung in der Kurve bedeutet eine gute Sauerstoffaufnahme am Hämoglobin aber eine schlechte O 2 -Abgabe an das Gewebe. Bei der Verschiebung der Kurve nach rechts erfolgt genau da Gegenteil. Das heisst, das Hb kann Sauerstoff schlecht aufnehmen, kann aber die Zellen gut mit O 2 versorgen, da die Abgabe gut ist (Pape et. al. 2014). Der Anteil an Hämoglobin im Blut ist ein wichtiger Faktor dafür, wie viel Sauerstoff ans Gewebe abgegeben werden kann und hat somit einen Einfluss auf die Wundheilung. Ist das Hb tief, so kann weniger Sauerstoff gebunden werden als bei einem hohen Anteil an Hb. Denn wie bereits im Theorieteil erwähnt, bindet sich der grössere Anteil an Sauerstoff chemisch ans Hämoglobin. Während der Nachforschung wurde festgestellt, dass Sauerstoff nicht nur für die Wundheilung positive Auswirkungen hat, sondern auch auf einige weitere Aspekte, welche eine erhöhte Gabe von Sauerstoff durchaus befürworten. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 20
21 In der Recherche der Studien wurde zudem das Thema postoperative Nausea und Vomitus (PONV) sehr kontrovers diskutiert. Die PONV ist, neben den Schmerzen, eine der häufigsten Komplikation, welche Patienten postoperativ erleiden. Laut Ellecosta und Huber (2012), liegt das PONV Risiko nach einer Vollnarkose bei 20-30%. Vielfach dreht sich die Angst der Patienten bereits präoperativ um diese unangenehmen und teils auch vermeidbaren Nebenwirkungen einer Narkose. Doch nicht nur für den Patienten hat die PONV wesentliche Folgen, auch für das Spital kann eine PONV gravierende Auswirkungen haben: Spitalaufenthalte werden verlängert, Kosten erhöht, zusätzliche Medikamente benötigt, Komplikationen und Schmerzen entstehen (Kranke, P. & Eberhart, L. 2012). Auch bei dieser Studie wurden die Patienten mit 30% sowie mit 80% FiO 2 beatmet. Die Fragestellung lautete: Wie wirkt sich die Sauerstoffkonzentration auf die postoperative Nausea und Vomitus während anderen Operationen aus. Aus diesem Grund wurden Operationen an der Schilddrüse, an den Augen sowie an den Brüsten überprüft. Fischer (2007) kam zur Erkenntnis, dass lediglich bei kolorektalen Operationen die intraoperative Sauerstoffzufuhr positive Auswirkungen auf die PONV hat, das Risiko konnte um die Hälfte reduziert werden. Er bestätigte somit die Erkenntnisse, die bereits Meier (2006) ein Jahr zuvor in seiner Studie herausfand. Er fand aber auch heraus und wiederlegte mit dieser Aussage, die bereits bestehenden Studien. Er verglich 2007 die Wirksamkeit zwischen Ondansetron und dem intraoperativen FiO 2 von 80%. Diesen Vergleich machte er bei gynäkologischen Laparoskopien. Er kam zur Erkenntnis, dass es keine Evidenz gibt, welche zeigt, dass Ondansetron eine bessere Wirkung auf die PONV hat als einen intraoperativen FiO 2 von 80% (Fischer, 2007). Es ist bis jetzt noch sehr umstritten, welche definitiven Auswirkungen Sauerstoff wirklich auf die PONV hat. Orhan-Sungur, Kranke, Sessler und Apfel (2008) widersprachen den vergangenen Studien und deren Ergebnissen. Sie äusserten in ihrer Studie von 2008, dass Sauerstoff nicht länger als wirksame Methode gegen PONV angesehen werden darf und soll. Eine erhöhte Sauerstoffgabe hat auch positive Einflüsse, sowohl bei kardial vorbelasteten Patienten, wie auch beim herzgesunden Klientel. Zusätzlicher Sauerstoff konnte, nicht nur intraoperativ, sondern auch postoperativ zu einer verbesserten Herzfrequenz und arteriellen Sauerststoffsättigung beitragen. Die häufig entstandenen Tachykardien und Hypoxämie, ohne begründetes Auftreten wie zum Beispiel Schmerzen, können reduziert oder normalisiert werden (Fischer, 2007). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 21
22 7. Schlussfolgerung Aus den gewonnen Erkenntnissen der gelesenen und überprüften Studien, kann abschliessend gesagt werden, dass ein FiO 2 von 100% während der Einleitung durchaus Sinn macht. Es verlängert die Apnoetoleranzzeit und gibt somit im Arbeitsalltag eine Sicherheit im Falle von schwierigen Intubationen. Ebenfalls ist ein FiO 2 von 80% während der Ausleitung sinnvoll. Obwohl es die Atelektasen-Entstehung fördert, wirkt es sich auch positiv auf die postoperative Phase des Patienten aus. Die Wundheilung wird positiv beeinflusst, die Gewebeoxygenation bleibt erhalten und kardialen Komplikationen wird vorgebeugt. Während der intraoperativen Phase wird in den Studien mehrheitlich davon gesprochen, dass eine hohe Sauerstoffkonzentration um 80% anzustreben ist. In den Studien wurden grösstenteils Patienten während und nach abdominalen Eingriffen untersucht. Aufgrund der hohen Datenlage bezüglich 80% FiO 2 und der verbesserten Wundheilung, sowie der verringerten Infektanfälligkeit wird für Operationen am Abdomen eine intraoperative Sauerstoffkonzentration von 80% empfohlen. Auch sollte die postoperative Sauerstoffgabe grosszügig gewählt werden, vor allem während der Zeit im Aufwachraum. Bei Anastomoseneingriffen wird ebenfalls ein intraoperativer FiO 2 von 80% vorgeschlagen, auch hier überzeugen die Resultate der Studie, welche eine Verbesserung der Insuffizienz der Anastomosen durch eine erhöhte Sauerstoffgabe aufzeigt. Obwohl die Datenlage bezüglich anderer Eingriffsarten rar oder gar nicht vorhanden ist, befürworten die Resultate der Studien im Allgemeinen während der Narkose eine hohe Konzentration des inspiratorischen Sauerstoffes anzustreben. Die Begründungen, dass Sauerstoff ein kostengünstiges und gut steuerbares Medikament ist, haben grundsätzlich überzeugt und zeigen nicht nur in Bezug auf die Wundheilung und die Infektanfälligkeit positive Aspekte auf. Auch für die Herztätigkeit weist Sauerstoff einige zusagende Wirkungen auf. Obwohl viel O 2 zu unvermeidbaren Atelektasen führt, kann mit Hilfe des Recruitmentmänovers diese Nebenwirkung von Sauerstoff zu einem grossen Teil eliminiert werden. Somit können die befürwortenden Seiten von O 2 hervorgehoben und angewendet werden. Zudem ist die Datenlage überzeugend, dass die Sauerstofftoxizität erst ab einer Dauer von Stunden auftritt. Da es in den seltensten Fällen vorkommt, dass die Patienten derart lange bei uns im Operationssaal verweilen, wird diese Nebenwirkung von Sauerstoff als zweitrangig erachtet und vorwiegend die vielen Vorteile und positiven Outcomes von O 2 im Vordergrund angesehen und angestrebt. Abschliessend kann gesagt werden, dass eine hohe Sauerstoffkonzentration um 80% durchaus positive Aspekte bezüglich der Infektanfälligkeit und der Wundheilung aufweist. Es macht somit durchaus Sinn, eine höhere und vor allem konstante perioperative Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 22
23 Sauerstoffkonzentration anzustreben. Für ein eindeutig umsetzbares Schema im Alltag bedarf es aber noch weiteren Untersuchungen und Studien. Die Datenlage ist bis anhin zu extrem auf die FiO 2 Werte 30% und 80% fixiert. Ebenfalls kann gesagt werden, dass eine erhöhte Gabe von Sauerstoff erst ab 12 Stunden toxische Nebenwirkungen aufzeigt und die positiven Eigenschaften von Sauerstoff deutlich überwiegen. Hinzugefügt können diese nicht vermeidbaren Folgen von O 2 bis zu 12 Stunden als bedeutungslos angesehen werden. 8. Reflexion Zukünftig werde ich darauf achten, die Sauerstoffkonzentration am Respirator, vor allem bei abdominellen Eingriffen, im Bereich eines FiO 2 von 80% zu halten. Bei anderweitigen Eingriffen werde ich ebenfalls versuchen eine konstante Sauerstoffkonzentration um 80% anzustreben. Schwierig war für mich, dass die Gruppen in den Studien entweder mit einem FiO 2 von % oder 80% beatmet wurden. Diese Spannbreite ist extrem gross und ebenfalls auch die daraus resultierenden Ergebnisse. Spannend wäre zu wissen, wie sich ein FiO 2 von beispielsweise 50% auf die Wundheilung und die Infektionsanfälligkeit auswirkt. Hierzu fehlen bis anhin jedoch noch die benötigten Studien. Aus diesem Grund hinterfragte ich die am LUKS gängige FiO 2 Einstellung von 60%. Aus meiner Sicht ist diese Menge an Sauerstoff sicherlich adäquat hinsichtlich der Prophylaxe bezüglich der Wundheilung und der Infekt Vorbeugung. Trotzdem empfehle ich in Zukunft, die intraoperative Sauerstoffkonzentration sicherlich über 60% eher im Bereich von 80% zu halten. Die vielen positiven Eigenschaften von Sauerstoff waren eine interessante Erkenntnis für mich. Ebenfalls, dass die Toxizität erst ab einer gewissen Zeit zwischen Stunden auftritt. Dies kann ich in der Praxis als Argument einsetzen, sofern die von mir eingestellte hohe Sauerstoffkonzentration während einer Operation hinterfragt wird. In meiner Arbeit konnte ich aufzeigen, welche Auswirkungen Sauerstoff auf den Körper hat. Ich werde in Zukunft mehr darauf achten, in wie weit der Patient von einer postoperativen Sauerstoffgabe profitieren würde. Das Recruitmentmanöver wende ich nun gezielter an, da mir bewusst ist, dass ich aufgrund hoher Sauerstoffkonzentrationen auch vermehrt Atelektasen hervorrufe. Die zweite Zielsetzung, ein evidenzbasiertes Schema für die Praxis zu erarbeiten, konnte aufgrund fehlender Daten von anderen FiO 2 Werten nicht erreicht werden. Ich bin jedoch bereit dazu, evidenzbasierte Aussagen machen zu können, bezüglich meiner eingestellten Werte am Respirator. Da in den meisten Studien die Wundheilung und die Infektionsanfälligkeit im Vordergrund standen, musste ich meine ursprüngliche Fragestellung, in welcher auch die PONV eine grosse Rolle spielte, umschreiben und neu verfassen. Das Thema wurde aus meiner Sicht zu kontrovers diskutiert, so dass ich zu wenige Daten für meine Arbeit fand. Dies war jedoch auch interessant, denn so erhielt ich eine neue Sichtweise auf meine Arbeit. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 23
24 Ich bin der Meinung, dass ich geeignete Antworten auf meine ausgebesserte Fragestellung gefunden habe. Ich konnte jedoch nicht aufzeigen, dass es eine einheitliche Konzentration des Sauerstoffes intraoperativ gibt, denn mehrheitlich wurden Patienten während und nach abdominellen Eingriffen untersucht. Obwohl die Arbeit mit viel Zeit und Elan verbunden war, bin ich stolz darauf, dieses Thema erarbeitet zu haben. Ich freue mich bereits darauf, meine gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in der Praxis meinen Arbeitskollegen zu präsentieren und darüber zu diskutieren. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 24
25 9. Danksagung Einen grossen Dank geht an meinen Mentor, Sven von Niederhäusern, für die tolle Begleitung und die Hilfestellung während der ganzen Diplomarbeitszeit. Er konnte mich immer wieder motivieren und mir hilfreiche Tipps und Hilfestellungen geben. Ebenfalls danke ich all meinen Arbeitskollegen, die immer ein offenes Ohr für meine Fragen und Unklarheiten haben und mich mit ihrer Erfahrung und Professionalität weiterbringen. Zudem danke ich meinen Freunden und meiner Familie, welche mich immer wieder unterstützten und motivierten. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 25
26 10. Literatur- und Quellenverzeichnis Akça, O., Podolsky, A., Eisenhuber, E., Panzer, O., Hetz, H., Lampl, K., Lackner, F., Wittman, K., Grabenwoeger, F., Kurz, A., Schultz, A.-M., Negishi, C., Sessler, D. (1999). Comparable Postoperative Pulmonary Atelectasis in Patients Given 30% or 80% Oxygen during and 2 Hours after Colon Resection. Anesthesiology, 91(4), Bosshard, B. (2004). Pulmonaler Gasaustausch und Sauerstofftransport im Blut. [Zugriff auf Burkhard, P. (2009). Chirurgie für Pflegeberufe. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. Danzeisen, O. & Priebe, H.-J. (2005). Routinemässige Verwendung hoher inspiratorischer Sauerstoffkonzentrationen Pro. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. Ellecosta, E., Huber, S., Mantovan F. ( ). Verabreichung von Sauerstoff und intravenöse Flüssigkeitszufuhr zur Vorbeugung postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV). [Zugriff auf Fischer, L. (2007). Intraoperative Beatmung FiO2 bei Narkoseeinleitung, Eingriff und postoperativ. Münster: Thieme. Franzske, T. & Jähne, J. (2013). Perioperative Sauerstoffgabe. Berlin: Springer-Verlag. Greif, R. (2005). Outcome-Verbesserung durch FIO 2 1,0: Realität oder Mythos?. Stuttgart: George Thieme Verlag KG. Hachenberg, T., Sentürk, M., Jannasch, O. & Lippert, H. (2010). Postoperative Wundinfektionen. Heidelberg: Springer-Verlag. Hovaguimian, F., Lysakowski C,. Elia, N., Tramèr, M. & Phil, D. (2013). Effect of Intraoperative High Inspired Oxygen Fraction on Surgical Site Infection, Postoperative Nausea and Vomiting, and Pulmonary Function. Anesthesiology, 119(2), Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 26
27 Kranke, P. & Eberhart, L. (2012). Übelkeit und Erbrechen in der postoperativen Phase (PONV). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH. Larsen, R. (2013). Anästhesie. (10. Auflage). München: Urban & Fischer. Laux, G. (2012). Lungenphysiologie und Beatmung in Narkose. [Zugriff auf Marian, B. (2009). Krankheit, Krankeitsursache -und bilder. (3. Auflage). Austria: Facultas Verlags- und Buchhandels AG. Meier, J. (2006). Sauerstoff. Frankfurt: Springer. Meyhoff, C., Wetterslev, J., Jorgensen, L., Henneberg, S., Hogdall. C., Lundvall, L., Svendsen, P., Mollerup, H., Lunn, T., Bundgaard, L., Bugge, L., Hansen, E., Riber, C., Gocht-Jense, P., Walker, L., Bendtsen, A., Johansson, G., Skovgaard, N., Helto, K., Poukinski, A., Korshin, A., Walli, A., Bulut, M., Carlsson, P., Rodt, S., Lundbech, L., Rask, H., Buch, N., Perdawid, S., Reza, J., Jensen, K., Carlsen, C., Rasmussen, L. (2009). Effect of High Perioperative Oxygen Fraction on Surgical Site Infection and Pulmonary Complications After Abdominal Surgery. JAMA, 302(14), Orhan-Sungur, M., Kranke, P., Sessler, D. & Apfel. C. (2008). Does Supplemental Oxygen Reduce Postoperative Nausea and Vomiting? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Anesth Analg., 106(6), Pape, H., Kurtz, A. & Silbernagl, S. (2014). Physiologie. (7. Auflage). Stuttgart: Thieme. Pryor, k., Fahey, T., Lien, C. & Goldstein, P. (2004). Surgical Site Infection and the Routine Use of Perioperative Hyperoxia ina a General Surgical Population. JAMA, 291(1), Quadan, M., Akça, O., Mahid, S., Hornung, C. & Polk, H. (2009). Perioperative Supplement Oxygen Therapy and Surgical Site Infection. Arch Surg., 144(4), Roewer, N. & Thiel, H. (2013). Taschenatlas Anästhesie. (5. Auflage). Stuttgart: Thieme. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 27
28 Silbernagl, S. & Despopoulos, A. (2007). Taschenatlas Physiologie. (7. Auflage). Stuttgart: Thieme. Standard operating procedures am LUKS. ( ) Checkliste Monitoring und Beatmung. [Zugriff auf Abbildungsverzeichnis Titelblatt: Shaff, A. (2017). A woman blowing on a dandelion muted colors vintage toned. [Zugriff auf blowing-on-dandelion-muted-colors ?src=9nmkgbw1g9dl9osiyycu6q- 4-12] Abb. 1: Bosshard, B. (2004). Pulmonaler Gasaustausch und Sauerstofftransport im Blut. [Zugriff auf Abb. 2: Greif, R. (2005). Outcome-Verbesserung durch FIO 2 1,0: Realität oder Mythos?. Stuttgart: George Thieme Verlag KG. Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 28
29 12. Anhang I. Abkürzungsverzeichnis AA: Allgemeinanästhesie CO 2 : Kohlenstoffdioxid CT: Computertomografie FeO 2 : Fraction of exspired oxygen (Exspiratorischer Sauerstoffanteil) FiO 2 : Fraction of inspired oxygen (Inspiratorischer Sauerstoffanteil) Hb: Hämoglobin HbO 2 : Sauerstoff chemisch am Hämoglobin gebunden/oxyhämoglobin KLIFAiRS: Klinik für Anästhesie, Rettungsmedizin und Schmerztherapie des Luzerner Kantonsspitals Luzern kpa: Kilopascal LUKS: Luzerner Kantonsspital mmhg: Millimeter Quecksilbersäule N 2 : Stickstoff O 2 : Sauerstoff p a O 2 : Arterieller Partialdruck p A O 2 : Alveolärer Partialdruck PEEP: Positive EndExspiratory Pressure P H2O : Wasserstoff Partialdruck po 2 : Sauerstoff Partialdruck PONV: Postoperative Nausea und Vomitus PsqO 2 : Subkutaner Sauerstoffpartialdruck SOP: Standard Operating Procedures Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 29
30 II. Berechnung des Sauerstoffpartialdruckes: Sobald die Luft in die Atemwege gelangt, wird sie mit Wasserdampf angereichert und die Einatmungsluft somit befeuchtet. Aufgrund dieser Beimischung muss der Wasserstoffpartialdruck (P H2O ) ebenfalls subtrahiert werden (Silbernagl & Despopoulos, 2007). Um den inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck berechnen zu können, benötigt es folgende Formel nach dem Boyle-Gesetz: (Atmosphärendruck Wasserdampfdruck bei 37 C) x O 2 -Konzentration in mmhg: (760 47) x 0,2094 = 149 mmhg in kpa: (101,3 6,3) x 0,2094 = 19,9 kpa (Larsen, 2013). Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 30
31 Tabitha Sidler Hyperoxydative Ventilation während der Narkose 31
Kardiopulmonale Homöostase
 Kapitel 2 Kardiopulmonale Homöostase Primäre Funktion des Blutes im Rahmen der Atmung Transport von O 2 aus der Lunge zum peripheren Gewebe, CO 2 aus der Peripherie zu den Lungen, H + vom Gewebe zu den
Kapitel 2 Kardiopulmonale Homöostase Primäre Funktion des Blutes im Rahmen der Atmung Transport von O 2 aus der Lunge zum peripheren Gewebe, CO 2 aus der Peripherie zu den Lungen, H + vom Gewebe zu den
Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung
 A Druck A Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung Synonyme nalveolo-arterielle Sauerstoffdruckdifferenz nalveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz naad - (vereinfacht)
A Druck A Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung Synonyme nalveolo-arterielle Sauerstoffdruckdifferenz nalveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz naad - (vereinfacht)
Physiologie der Atmung. Cem Ekmekcioglu
 Physiologie der Atmung Cem Ekmekcioglu Übersicht über den Transportweg des Sauerstoffes beim Menschen Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen, 27.Auflage, Kap.25, Springer (1997) Klinke, Pape, Silbernagl,
Physiologie der Atmung Cem Ekmekcioglu Übersicht über den Transportweg des Sauerstoffes beim Menschen Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen, 27.Auflage, Kap.25, Springer (1997) Klinke, Pape, Silbernagl,
Atemgastransport im Blut
 Atemgastransport im Blut Institut für MTA-Ausbildung am Klinikum Osnabrück Fachgebiet Anatomie/Physiologie/Krankheitslehre - Dr. U. Krämer 1. Physikalische Löslichkeit der Atemgase Sauerstoff und Kohlendioxid
Atemgastransport im Blut Institut für MTA-Ausbildung am Klinikum Osnabrück Fachgebiet Anatomie/Physiologie/Krankheitslehre - Dr. U. Krämer 1. Physikalische Löslichkeit der Atemgase Sauerstoff und Kohlendioxid
Die Atmung. Die Atmung des Menschen. Die Atmung des Menschen
 Die Atmung Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper zur lebenserhaltenden Energiegewinnung
Die Atmung Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper zur lebenserhaltenden Energiegewinnung
Sicherung des Atemweges während der Anästhesie... Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit dafür... Präoxygenierung wie lange ist erforderlich?
 Schmidt: Praktische Lungenphysiologie Atemweg_Dresden, Seite 1 1 2 Sicherung des Atemweges während der Anästhesie... http://atemweg.uniklinikum-dresden.de Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit dafür...
Schmidt: Praktische Lungenphysiologie Atemweg_Dresden, Seite 1 1 2 Sicherung des Atemweges während der Anästhesie... http://atemweg.uniklinikum-dresden.de Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit dafür...
Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen
 Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen Definition von kardiovaskulär Kardiovaskulär bedeutet Herz ( kardio ) und Gefäße ( vaskulär ) betreffend. Da Herz und Gefäße ein System
Auswirkungen von Ausdauersport auf kardiovaskuläre Veränderungen Definition von kardiovaskulär Kardiovaskulär bedeutet Herz ( kardio ) und Gefäße ( vaskulär ) betreffend. Da Herz und Gefäße ein System
Transfusionsmedizinisches Seminar Für Ärzte in der Weiterbildung zum Facharzt für Transfusionsmedizin 12. Mai 2011, Bielefeld. Fremdblut-Transfusion
 Transfusionsmedizinisches Seminar Für Ärzte in der Weiterbildung zum Facharzt für Transfusionsmedizin 12. Mai 2011, Bielefeld Erythrozytentransfusion - Kritische Indikationsstellung Prof. Dr. O. Habler
Transfusionsmedizinisches Seminar Für Ärzte in der Weiterbildung zum Facharzt für Transfusionsmedizin 12. Mai 2011, Bielefeld Erythrozytentransfusion - Kritische Indikationsstellung Prof. Dr. O. Habler
Stand der Bearbeitung: AUSBILDUNG ZUM ATEMSCHUTZGERÄTETRÄGER
 Stand der Bearbeitung: 08.01.2016 AUSBILDUNG ZUM ATEMSCHUTZGERÄTETRÄGER ATMUNG DES MENSCHEN ATMUNG DES MENSCHEN - NOTWENDIGKEIT UND BEDEUTUNG DES ATEMSCHUTZES - PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ATMUNG - LUFTVERBRAUCH
Stand der Bearbeitung: 08.01.2016 AUSBILDUNG ZUM ATEMSCHUTZGERÄTETRÄGER ATMUNG DES MENSCHEN ATMUNG DES MENSCHEN - NOTWENDIGKEIT UND BEDEUTUNG DES ATEMSCHUTZES - PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ATMUNG - LUFTVERBRAUCH
Physiologie der Atmung
 Beatmungstherapie Grundlagen der maschinellen Beatmung Ambulanter Pflegedienst Holzminden Nordstr. 23 37603 Holzminden 1 Physiologie der Atmung Ventilation (Belüftung der Alveolen) Inspiration (aktiv)
Beatmungstherapie Grundlagen der maschinellen Beatmung Ambulanter Pflegedienst Holzminden Nordstr. 23 37603 Holzminden 1 Physiologie der Atmung Ventilation (Belüftung der Alveolen) Inspiration (aktiv)
BIORACING Ergänzungsfuttermittel
 BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
Kursus für Klinische Hämotherapie
 Kursus für Klinische Hämotherapie 27. September 2011, Hannover Kritische Indikation zur Transfusion von Erythrozyten bei massivem Blutverlust Prof. Dr. O. Habler Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin
Kursus für Klinische Hämotherapie 27. September 2011, Hannover Kritische Indikation zur Transfusion von Erythrozyten bei massivem Blutverlust Prof. Dr. O. Habler Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin
Grundlagen der Atmung DIE WEITERGABE SOWIE VERÄNDERUNG DER UNTERLAGEN IST VERBOTEN!!!
 DIE WEITERGABE SOWIE VERÄNDERUNG DER UNTERLAGEN IST VERBOTEN!!! 1 Ausbildungshilfen für die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträgern durch die Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände
DIE WEITERGABE SOWIE VERÄNDERUNG DER UNTERLAGEN IST VERBOTEN!!! 1 Ausbildungshilfen für die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträgern durch die Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände
Atmung II Atemgastransport Pathophysiologie
 Atmung II Atemgastransport Pathophysiologie Einführung Äußere und Innere Atmung Atemgastransport Normwerte Atemgastransport Das Blut Eine wesentliche Aufgabe des Blutes ist der Atemgastransport : Das Blut
Atmung II Atemgastransport Pathophysiologie Einführung Äußere und Innere Atmung Atemgastransport Normwerte Atemgastransport Das Blut Eine wesentliche Aufgabe des Blutes ist der Atemgastransport : Das Blut
Zusammenfassung. 5 Zusammenfassung
 5 Zusammenfassung Die Diskussion über den optimalen Operationszeitpunkt der frakturierten Hüfte wird seit langem kontrovers geführt. Ziel dieser Arbeit war zu überprüfen, ob die in Deutschland derzeit
5 Zusammenfassung Die Diskussion über den optimalen Operationszeitpunkt der frakturierten Hüfte wird seit langem kontrovers geführt. Ziel dieser Arbeit war zu überprüfen, ob die in Deutschland derzeit
UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DIE PATIENTENSICHERHEIT
 UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DIE PATIENTENSICHERHEIT Im Gleichgewicht bleiben Ein gesunder Körper ist im Gleichgewicht. Wenn wir krank sind, bemüht sich der Körper, diese Balance wiederherzustellen. Doch manchmal
UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DIE PATIENTENSICHERHEIT Im Gleichgewicht bleiben Ein gesunder Körper ist im Gleichgewicht. Wenn wir krank sind, bemüht sich der Körper, diese Balance wiederherzustellen. Doch manchmal
Lokale Goldbehandlung Behandlung von Gelenkschmerzen bei Patienten mit degenerativen Gelenkserkrankungen
 GOLDIN Lokale Goldbehandlung Behandlung von Gelenkschmerzen bei Patienten mit degenerativen Gelenkserkrankungen Einleitung Eine wirksame Schmerztherapie degenerativer Gelenkserkrankungen beim Menschen
GOLDIN Lokale Goldbehandlung Behandlung von Gelenkschmerzen bei Patienten mit degenerativen Gelenkserkrankungen Einleitung Eine wirksame Schmerztherapie degenerativer Gelenkserkrankungen beim Menschen
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Das oxygen window Tauchmedizinische Fortbildungen. Was ist das eigentlich? Dr.med. Stefan Wiese
 Das oxygen window Tauchmedizinische Fortbildungen Was ist das eigentlich? www.baromedizin.de Dr.med. Stefan Wiese intensive care Eindhoven, Netherlands vakanter Partialdruck Oxygen window window partial
Das oxygen window Tauchmedizinische Fortbildungen Was ist das eigentlich? www.baromedizin.de Dr.med. Stefan Wiese intensive care Eindhoven, Netherlands vakanter Partialdruck Oxygen window window partial
M 4a 1: Fragen stellen
 M 4a 1: Fragen stellen Wozu? (Sinn, Zweck) Wo? (Ort) Bei Bewegung entsteht mehr Kohlenstoffdioxid. Wodurch? (Ursache) Wie viel? (Menge) Wie? (Art und Weise) M 4a 2: Je mehr man sich bewegt, desto mehr
M 4a 1: Fragen stellen Wozu? (Sinn, Zweck) Wo? (Ort) Bei Bewegung entsteht mehr Kohlenstoffdioxid. Wodurch? (Ursache) Wie viel? (Menge) Wie? (Art und Weise) M 4a 2: Je mehr man sich bewegt, desto mehr
Ein Wirkstoff ist ein Stoff der Krankheiten heilen oder lindern kann. Er kann natürlicher oder künstlicher Herkunft sein.
 Buch S. 83 Aufgabe 1 Ein Wirkstoff ist ein Stoff der Krankheiten heilen oder lindern kann. Er kann natürlicher oder künstlicher Herkunft sein. Buch S. 83 Aufgabe 2 Suche nach Wirkstoff Testen der Wirksamkeit
Buch S. 83 Aufgabe 1 Ein Wirkstoff ist ein Stoff der Krankheiten heilen oder lindern kann. Er kann natürlicher oder künstlicher Herkunft sein. Buch S. 83 Aufgabe 2 Suche nach Wirkstoff Testen der Wirksamkeit
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN
 NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasse
 Hämoglobin Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasseraustausch im Kapillarbereich Durch die
Hämoglobin Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasseraustausch im Kapillarbereich Durch die
XII. Befunde der Heidelberger Krebsstudien
 ... XII. Befunde der Heidelberger Krebsstudien ZURÜCK ZUR FRAGE: BEEINFLUSSEN PSYCHOSOZIALE FAKTOREN DEN KRANKHEITSVERLAUF BEI KREBSPATIENTEN? Im Jahre 1985 publizierten B. R. Cassileth et al. im New England
... XII. Befunde der Heidelberger Krebsstudien ZURÜCK ZUR FRAGE: BEEINFLUSSEN PSYCHOSOZIALE FAKTOREN DEN KRANKHEITSVERLAUF BEI KREBSPATIENTEN? Im Jahre 1985 publizierten B. R. Cassileth et al. im New England
Forschungsthema: Hypertone Kochsalzlösung Von Peter Bye, MD
 Forschungsthema: Hypertone Kochsalzlösung Von Peter Bye, MD Über hypertone Kochsalzlösung Hypertone Kochsalzlösung (HS) ist einfach eine starke Salzwasserlösung. Die Konzentration beträgt normalerweise
Forschungsthema: Hypertone Kochsalzlösung Von Peter Bye, MD Über hypertone Kochsalzlösung Hypertone Kochsalzlösung (HS) ist einfach eine starke Salzwasserlösung. Die Konzentration beträgt normalerweise
Präoxygenierung von Neugeborenen Sicht einer Neonatologin. Evelyn Kattner Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover
 Präoxygenierung von Neugeborenen Sicht einer Neonatologin Evelyn Kattner Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover Sauerstoff des Neugeborenen Freund? des Neugeborenen Feind? Umfrage unter britischen Anästhesisten
Präoxygenierung von Neugeborenen Sicht einer Neonatologin Evelyn Kattner Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover Sauerstoff des Neugeborenen Freund? des Neugeborenen Feind? Umfrage unter britischen Anästhesisten
DAS STRESSPROFIL. Ist auch Ihre Gesundheit gefährdet?
 DAS STRESSPROFIL Ist auch Ihre Gesundheit gefährdet? WAS IST STRESS? Stress ist die Bezeichnung für eine körperliche und psychische Reaktion auf eine erhöhte Beanspruchung. Stress beginnt bei jedem unterschiedlich,
DAS STRESSPROFIL Ist auch Ihre Gesundheit gefährdet? WAS IST STRESS? Stress ist die Bezeichnung für eine körperliche und psychische Reaktion auf eine erhöhte Beanspruchung. Stress beginnt bei jedem unterschiedlich,
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase. Kohlendioxid
 Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Anästhesiebeatmung von Säuglingen und Kindern. Michael U. Fischer Freiburg
 Anästhesiebeatmung von Säuglingen und Kindern Freiburg Kernkompetenzen Anästhesie Anästhesie Beatmung Applikation von Anästhetika Atemwegssicherung Patientengruppen unter Anästhesie krank ICU-Beatmung
Anästhesiebeatmung von Säuglingen und Kindern Freiburg Kernkompetenzen Anästhesie Anästhesie Beatmung Applikation von Anästhetika Atemwegssicherung Patientengruppen unter Anästhesie krank ICU-Beatmung
ellen Probiotic Tampon
 Wissenswertes zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden für die Frau ellen Probiotic Tampon Der gesunde Tampon Probiotic Tampon ellen der erste probiotische Tampon ellen unterstützt die Vaginalflora auf natürliche
Wissenswertes zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden für die Frau ellen Probiotic Tampon Der gesunde Tampon Probiotic Tampon ellen der erste probiotische Tampon ellen unterstützt die Vaginalflora auf natürliche
ellen Probiotic Tampon
 Wissenswertes zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden für die Frau ellen Probiotic Tampon Der gesunde Tampon Probiotic Tampon ellen der erste probiotische Tampon ellen unterstützt die Vaginalflora auf natürliche
Wissenswertes zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden für die Frau ellen Probiotic Tampon Der gesunde Tampon Probiotic Tampon ellen der erste probiotische Tampon ellen unterstützt die Vaginalflora auf natürliche
Ablauf einer Narkose in Bildern
 Ablauf einer Narkose in Bildern Hier möchten wir Ihnen den typischen Ablauf einer Narkose aus Patientensicht darstellen. Wenn Sie schon einmal eine Narkose bekommen haben, wird Ihnen sicherlich einiges
Ablauf einer Narkose in Bildern Hier möchten wir Ihnen den typischen Ablauf einer Narkose aus Patientensicht darstellen. Wenn Sie schon einmal eine Narkose bekommen haben, wird Ihnen sicherlich einiges
Herz und Kreislauf Teil 1
 24. TOGGENBURGER ANÄSTHESIE REPETITORIUM Herz und Kreislauf Teil 1 Aufgaben des Kreislaufs Salome Machaidze Miodrag Filipovic miodrag.filipovic@kssg.ch Anästhesiologie & Intensivmedizin Unter Verwendung
24. TOGGENBURGER ANÄSTHESIE REPETITORIUM Herz und Kreislauf Teil 1 Aufgaben des Kreislaufs Salome Machaidze Miodrag Filipovic miodrag.filipovic@kssg.ch Anästhesiologie & Intensivmedizin Unter Verwendung
Pressemitteilung. Neue Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie bestätigt: Entsäuerung mit Basica Direkt bringt mehr Energie
 Pressemitteilung Neue Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie bestätigt: Entsäuerung mit Basica Direkt bringt mehr Energie In der heutigen Zeit muss man leistungsfähig sein für alle Anforderungen, die
Pressemitteilung Neue Placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie bestätigt: Entsäuerung mit Basica Direkt bringt mehr Energie In der heutigen Zeit muss man leistungsfähig sein für alle Anforderungen, die
Die Atmung des Menschen
 Eine Powerpoint Presentation von: Erwin Haigis Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper K mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper
Eine Powerpoint Presentation von: Erwin Haigis Die Atmung ist ein lebenswichtiger Vorgang. Dabei wird der Körper K mit Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft versorgt. Den Sauerstoff benötigt der Körper
Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin
 Abteilung für, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin Dr. Peter Rensmann Weiterbildungscurriculum 1. Weiterbildungsjahr, Phase 1 (1.-3. Monat) Einführung in die Anästhesiologie unter Aufsicht
Abteilung für, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin Dr. Peter Rensmann Weiterbildungscurriculum 1. Weiterbildungsjahr, Phase 1 (1.-3. Monat) Einführung in die Anästhesiologie unter Aufsicht
Gesund Glücklich - Sein
 Gute Gründe, täglich UMH Wasser zu trinken Ohne Wasser gibt es kein Leben auf dieser Welt. Relative Wasserknappheit unterdrückt zunächst einige Funktionen des Körpers und bringt sie schließlich zum Erliegen.
Gute Gründe, täglich UMH Wasser zu trinken Ohne Wasser gibt es kein Leben auf dieser Welt. Relative Wasserknappheit unterdrückt zunächst einige Funktionen des Körpers und bringt sie schließlich zum Erliegen.
Evidenz der lungenprotektiven Beatmung in der Anästhesie. SIGA/FSIA Frühlingskongress. 18. April 2009 Kultur- und Kongresszentrum Luzern
 Evidenz der lungenprotektiven Beatmung in der Anästhesie SIGA/FSIA Frühlingskongress 18. April 2009 Kultur- und Kongresszentrum 2 Hintergrund I Atemzugsvolumina über die Jahre kontinuierlich reduziert
Evidenz der lungenprotektiven Beatmung in der Anästhesie SIGA/FSIA Frühlingskongress 18. April 2009 Kultur- und Kongresszentrum 2 Hintergrund I Atemzugsvolumina über die Jahre kontinuierlich reduziert
Laser in situ keratomileusis ohne und unter Verwendung persönlicher Nomogramme
 Laser in situ keratomileusis ohne und unter Verwendung persönlicher Nomogramme Auswertung von Zweimonats-Daten Dr. med. Dominik J. Annen, Vedis Augenlaser Zentrum Winterthur Matthias Wottke, Carl Zeiss
Laser in situ keratomileusis ohne und unter Verwendung persönlicher Nomogramme Auswertung von Zweimonats-Daten Dr. med. Dominik J. Annen, Vedis Augenlaser Zentrum Winterthur Matthias Wottke, Carl Zeiss
Machen Sie Ihre Gesundheit zur Herzensangelegenheit: Vorbeugung bei Patienten mit Vorhofflimmern.
 Machen Sie Ihre Gesundheit zur Herzensangelegenheit: Vorbeugung bei Patienten mit Vorhofflimmern. Liebe Leserin, lieber Leser, Sie haben diese Broschüre aufgeschlagen vielleicht weil Ihr Arzt bei Ihnen
Machen Sie Ihre Gesundheit zur Herzensangelegenheit: Vorbeugung bei Patienten mit Vorhofflimmern. Liebe Leserin, lieber Leser, Sie haben diese Broschüre aufgeschlagen vielleicht weil Ihr Arzt bei Ihnen
Der richtige Cuffdruck bei Larynxmasken
 Der richtige Cuffdruck bei Larynxmasken Dichtigkeit, Größe, Material Produziert von Ambu A/S & Ambu Deutschland GmbH Verfasst von Dr. Frank Samsøe Jensen, M.D., PhD. ATEMWEGSMANAGEMENT Die getesteten
Der richtige Cuffdruck bei Larynxmasken Dichtigkeit, Größe, Material Produziert von Ambu A/S & Ambu Deutschland GmbH Verfasst von Dr. Frank Samsøe Jensen, M.D., PhD. ATEMWEGSMANAGEMENT Die getesteten
5.5. α-toxin Zeit [min] Zeit [min] Kontrolle α-tox α-tox+adm ADM ADM $ $
![5.5. α-toxin Zeit [min] Zeit [min] Kontrolle α-tox α-tox+adm ADM ADM $ $ 5.5. α-toxin Zeit [min] Zeit [min] Kontrolle α-tox α-tox+adm ADM ADM $ $](/thumbs/72/66328153.jpg) 5. Ergebnisse 5.1. Mittlerer arterieller Blutdruck und Gefäßwiderstand des Ileumpräparats Bei flusskonstanter Perfusion stand der Blutgefässwiderstand des Ileumsegmentes in direkter Korrelation mit den
5. Ergebnisse 5.1. Mittlerer arterieller Blutdruck und Gefäßwiderstand des Ileumpräparats Bei flusskonstanter Perfusion stand der Blutgefässwiderstand des Ileumsegmentes in direkter Korrelation mit den
Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie. Patienteninformation
 Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie Patienteninformation Ein kurzer Überblick Zentraler Aufwachraum Forschung Die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie des Inselspitals
Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie Patienteninformation Ein kurzer Überblick Zentraler Aufwachraum Forschung Die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie des Inselspitals
Erythrozytensubstitution M.Neuss Quelle: UptoDate 14.1 (4.2006)
 Erythrozytensubstitution 2006 M.Neuss Quelle: UptoDate 14.1 (4.2006) Physiologie Sauerstoffangebot DO 2 = kardialer Output * O 2 -Gehalt O 2 -Gehalt gelöst Hämoglobin-gebunden DO 2 = kardialer Output *
Erythrozytensubstitution 2006 M.Neuss Quelle: UptoDate 14.1 (4.2006) Physiologie Sauerstoffangebot DO 2 = kardialer Output * O 2 -Gehalt O 2 -Gehalt gelöst Hämoglobin-gebunden DO 2 = kardialer Output *
Kurzfristige Lösung: Erhöhung der Sauerstoff-Konzentration %
 PO 2 zu niedrig Kurzfristige Lösung: Erhöhung der SauerstoffKonzentration 60100% Optimierung der Beatmung Tidalvolumen ok => ca 500 ml/atemzug? Falls nicht => Inspirationsdruck bis Tidalvolumen Grenze
PO 2 zu niedrig Kurzfristige Lösung: Erhöhung der SauerstoffKonzentration 60100% Optimierung der Beatmung Tidalvolumen ok => ca 500 ml/atemzug? Falls nicht => Inspirationsdruck bis Tidalvolumen Grenze
Tabelle 1: Altersverteilung der Patienten (n = 42) in Jahren
 3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG e.v. German Cardiac Society
 Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene
 3 Ergebnisse 3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene 3.1.1 Altersabhängige Genexpression der AGE-Rezeptoren Es wurde untersucht, ob es am menschlichen alternden Herzen
3 Ergebnisse 3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene 3.1.1 Altersabhängige Genexpression der AGE-Rezeptoren Es wurde untersucht, ob es am menschlichen alternden Herzen
Stofftransport. Kapitel 1: Aufgabe des Blutes 2.1 Der Stofftransport/Zellatmung / Seiten Bezug
 Stufe 3 2.1 / Das Blut Lehrerinformation 1/5 Bezug Kapitel 1: Aufgabe des Blutes 2.1 Der /Zellatmung / Seiten 12 13 Arbeitsauftrag Die Schüler beantworten die Fragen auf den Arbeitsblättern. Material Arbeitsblätter
Stufe 3 2.1 / Das Blut Lehrerinformation 1/5 Bezug Kapitel 1: Aufgabe des Blutes 2.1 Der /Zellatmung / Seiten 12 13 Arbeitsauftrag Die Schüler beantworten die Fragen auf den Arbeitsblättern. Material Arbeitsblätter
Das Atemtrainergerät SMART BREATHE. Gesundheitsschule
 Das Atemtrainergerät SMART BREATHE Wir leben heute in einer sehr technogener Welt, wo der Mensch sich anpassen muss. Einer dieser Methoden ist die Atmung. Beim aufgeregten Zustand oder Schmerzen atmen
Das Atemtrainergerät SMART BREATHE Wir leben heute in einer sehr technogener Welt, wo der Mensch sich anpassen muss. Einer dieser Methoden ist die Atmung. Beim aufgeregten Zustand oder Schmerzen atmen
BEMER-Technologie :: Wirkung auf die Mirkrozirkulation
 BEMER-Technologie :: Wirkung auf die Mirkrozirkulation Auf Basis jahrelanger Arbeit hat die BEMER-Forschung bahnbrechende Erkenntnisse zur Biorhythmik lokaler und übergeordneter Regulationsvorgänge der
BEMER-Technologie :: Wirkung auf die Mirkrozirkulation Auf Basis jahrelanger Arbeit hat die BEMER-Forschung bahnbrechende Erkenntnisse zur Biorhythmik lokaler und übergeordneter Regulationsvorgänge der
Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern, Diagrammen und Statistiken
 Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Kombinierte Allgemein- und Epiduralanästhesie
 Kombinierte Allgemein- und Epiduralanästhesie Summation von Komplikationen oder Synergie? Thomas Hachenberg Klinik für Anaesthesiologie und Intensivtherapie thomas.hachenberg@med.ovgu.de Lucas Cranach
Kombinierte Allgemein- und Epiduralanästhesie Summation von Komplikationen oder Synergie? Thomas Hachenberg Klinik für Anaesthesiologie und Intensivtherapie thomas.hachenberg@med.ovgu.de Lucas Cranach
^Realistische Gewichtsabnahme
 ^Realistische Gewichtsabnahme Wieviel und in welcher Zeit - die wichtigsten Faktoren! Voraussetzung ist, dass keine zu berücksichtigenden Erkrankungen vorliegen. Abhängig davon ob mehr (>6-8Kg) Gewicht
^Realistische Gewichtsabnahme Wieviel und in welcher Zeit - die wichtigsten Faktoren! Voraussetzung ist, dass keine zu berücksichtigenden Erkrankungen vorliegen. Abhängig davon ob mehr (>6-8Kg) Gewicht
Die Mikroimmuntherapie
 M E D I Z I N I S C H E MeGeMIT G E S E L L S C H A F T Die Mikroimmuntherapie Unterstützung und Regulierung des Immunsystems Die Mikroimmuntherapie: Das Immunsystem im Gleichgewicht Das Immunsystem ist
M E D I Z I N I S C H E MeGeMIT G E S E L L S C H A F T Die Mikroimmuntherapie Unterstützung und Regulierung des Immunsystems Die Mikroimmuntherapie: Das Immunsystem im Gleichgewicht Das Immunsystem ist
Modul 22: Physiologie der künstlichen Beatmung
 Modul 22: Physiologie der künstlichen Beatmung Stichworte: Atemvolumina - Atemkapazitäten Atemfrequenz - Compliance Atemwegswiderstand obstruktive/restriktive Ventilationsstörungen Druckverhältnisse während
Modul 22: Physiologie der künstlichen Beatmung Stichworte: Atemvolumina - Atemkapazitäten Atemfrequenz - Compliance Atemwegswiderstand obstruktive/restriktive Ventilationsstörungen Druckverhältnisse während
Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen
 Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen Autorin Monika Urfer-Schumacher Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abstract 4 Eigenständigkeitserklärung 5 Begriffsklärungen 6 1
Handbuch für das Erstellen einer Diplomarbeit an Höheren Fachschulen Autorin Monika Urfer-Schumacher Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abstract 4 Eigenständigkeitserklärung 5 Begriffsklärungen 6 1
M 1.1: Checkup beim Taucharzt Die Blutdruckmessung
 M 1.1: Checkup beim Taucharzt Die Blutdruckmessung Der Tauchsport verlangt geistige Wachsamkeit und körperliche Fitness. Der Arzt untersucht bei der Tauchtauglichkeitsuntersuchung neben dem Allgemeinzustand
M 1.1: Checkup beim Taucharzt Die Blutdruckmessung Der Tauchsport verlangt geistige Wachsamkeit und körperliche Fitness. Der Arzt untersucht bei der Tauchtauglichkeitsuntersuchung neben dem Allgemeinzustand
Sauerstoffdiffusionskapazität
 372 7 Intensivmedizin Bei einer pulmonalen Insuffizienz ist diese AaD wesentlich höher und ein guter Gradmesser für deren Ausmaß ( S. 374). Zur Beurteilung der Oxygenierungsfunktion der Lunge wird oft
372 7 Intensivmedizin Bei einer pulmonalen Insuffizienz ist diese AaD wesentlich höher und ein guter Gradmesser für deren Ausmaß ( S. 374). Zur Beurteilung der Oxygenierungsfunktion der Lunge wird oft
1. Inhaltsverzeichnis. 2. Abbildungsverzeichnis
 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis... 1 2. Abbildungsverzeichnis... 1 3. Einleitung... 2 4. Beschreibung der Datenquelle...2 5. Allgemeine Auswertungen...3 6. Detaillierte Auswertungen... 7 Zusammenhang
1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis... 1 2. Abbildungsverzeichnis... 1 3. Einleitung... 2 4. Beschreibung der Datenquelle...2 5. Allgemeine Auswertungen...3 6. Detaillierte Auswertungen... 7 Zusammenhang
Ein-Lungen-Anästhesie PEEP und Beatmungsformen. Dr. L. Fischler, Klinik für Anästhesie/ IPS, Kantonsspital Bruderholz
 Ein-Lungen-Anästhesie PEEP und Beatmungsformen Dr. L. Fischler, Klinik für Anästhesie/ IPS, Kantonsspital Bruderholz 1 Inhalt! Physiologie Einlungenventilation! Präoperative Beurteilung! Management des
Ein-Lungen-Anästhesie PEEP und Beatmungsformen Dr. L. Fischler, Klinik für Anästhesie/ IPS, Kantonsspital Bruderholz 1 Inhalt! Physiologie Einlungenventilation! Präoperative Beurteilung! Management des
Atmungsphysiologie II.
 Atmungsphysiologie II. 29. Gasaustausch in der Lunge. 30. Sauerstofftransport im Blut. 31. Kohlendioxidtransport im Blut. prof. Gyula Sáry Gasaustausch in der Lunge Gasdiffusion findet durch die Kapillarmembrane
Atmungsphysiologie II. 29. Gasaustausch in der Lunge. 30. Sauerstofftransport im Blut. 31. Kohlendioxidtransport im Blut. prof. Gyula Sáry Gasaustausch in der Lunge Gasdiffusion findet durch die Kapillarmembrane
Auch heute wird noch diskutiert, ob Fluor zu den
 Spurenelement. Die höchsten Konzentrationen an Kupfer liegen in Leber und Gehirn sowie Herz und Nieren vor. Auf Knochen und Muskulatur entfallen rund 20 und 40 Prozent des Gesamtgehalts. Nur ein sehr kleiner
Spurenelement. Die höchsten Konzentrationen an Kupfer liegen in Leber und Gehirn sowie Herz und Nieren vor. Auf Knochen und Muskulatur entfallen rund 20 und 40 Prozent des Gesamtgehalts. Nur ein sehr kleiner
patienteninfo Schützen Sie Ihre Gesundheit.
 patienteninfo Schützen Sie Ihre Gesundheit. :: die revolutionäre bemer-therapie für prävention und genesung. : : gesundheit Was uns am Herzen liegt. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Sorge um Ihre Gesundheit
patienteninfo Schützen Sie Ihre Gesundheit. :: die revolutionäre bemer-therapie für prävention und genesung. : : gesundheit Was uns am Herzen liegt. Im Zentrum unserer Arbeit steht die Sorge um Ihre Gesundheit
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
 Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die Behandlung der Parkinson-Erkrankung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Dazu gehört zunächst eine Aufklärung
Die sanfte Wahl. Linde: Living healthcare
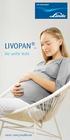 LIVOPAN. Die sanfte Wahl. Linde: Living healthcare 02 Was werdende Mütter wissen sollten. 03 Was ist LIVOPAN? LIVOPAN ist ein Medikament zum Einatmen. Eingesetzt wird es bei leichten bis mittelstarken
LIVOPAN. Die sanfte Wahl. Linde: Living healthcare 02 Was werdende Mütter wissen sollten. 03 Was ist LIVOPAN? LIVOPAN ist ein Medikament zum Einatmen. Eingesetzt wird es bei leichten bis mittelstarken
Botulinumtoxin bei Hyperhidrose
 Botulinumtoxin bei Hyperhidrose EVIDENZ KOMPAKT Stand: 17.10.2017 EVIDENZ KOMPAKT Botulinumtoxin bei Hyperhidrose Stand: 17.10.2017 Autoren Dr. Dawid Pieper, MPH Institut für Forschung in der Operativen
Botulinumtoxin bei Hyperhidrose EVIDENZ KOMPAKT Stand: 17.10.2017 EVIDENZ KOMPAKT Botulinumtoxin bei Hyperhidrose Stand: 17.10.2017 Autoren Dr. Dawid Pieper, MPH Institut für Forschung in der Operativen
ABGA. Notfallpflegekongress 2008 Solothurn. Notfallpflege am Stadtspital Triemli Zürich
 ABGA Notfallpflegekongress 2008 Solothurn H. Zahner,, Fachschule für f r Intensiv- und Notfallpflege am Stadtspital Triemli Zürich Werte des pulmonalen Gasaustausches PaO 2 Sauerstoffpartialdruck im arteriellen
ABGA Notfallpflegekongress 2008 Solothurn H. Zahner,, Fachschule für f r Intensiv- und Notfallpflege am Stadtspital Triemli Zürich Werte des pulmonalen Gasaustausches PaO 2 Sauerstoffpartialdruck im arteriellen
[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]
![[ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ] [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM ]](/thumbs/54/33253451.jpg) 2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
2012 Hannah Klingener, Natalja Böhm Otto-Hahn-Gymnasium und Katharina Schwander [ PROTOKOLL: TAGESPERIODIK DES MEERFELDER MAARES VOM 16.08.2012] Biologie, LK MSS 13, Herr Kohlhepp S e i t e 1 Inhaltsverzeichnis
Perioperative Hypertonie Was ist zu beachten?
 Perioperative Hypertonie Was ist zu beachten? FORTGESCHRITTENENKURS SAALFELDEN 2017 PD. OÄ. DR. SABINE PERL UNIVERSITÄTSKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN GRAZ, ABTEILUNG FÜR KARDIOLOGIE Intraoperative Veränderungen
Perioperative Hypertonie Was ist zu beachten? FORTGESCHRITTENENKURS SAALFELDEN 2017 PD. OÄ. DR. SABINE PERL UNIVERSITÄTSKLINIK FÜR INNERE MEDIZIN GRAZ, ABTEILUNG FÜR KARDIOLOGIE Intraoperative Veränderungen
Pneumologische Funktionsdiagnostik. 6. Diffusionsmessung
 Pneumologische Funktionsdiagnostik 6. Diffusionsmessung Inhalt 6.1 physiologische Grundlagen 6.2 Indikationen 6.3 Prinzip 6.4 Durchführung 6.5 Interpretation der Parameter 6.6 Qualitätskriterien Abbildung
Pneumologische Funktionsdiagnostik 6. Diffusionsmessung Inhalt 6.1 physiologische Grundlagen 6.2 Indikationen 6.3 Prinzip 6.4 Durchführung 6.5 Interpretation der Parameter 6.6 Qualitätskriterien Abbildung
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie
 Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Der Heißbrand bei Fohlen
 BADEN- WÜRTTEMBERG Der Heißbrand bei Fohlen MLR-14-99 MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM Bedeutung des Brandes Pferde können sowohl durch den Schenkelbrand als auch durch das Einpflanzen von Respondern gekennzeichnet
BADEN- WÜRTTEMBERG Der Heißbrand bei Fohlen MLR-14-99 MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM Bedeutung des Brandes Pferde können sowohl durch den Schenkelbrand als auch durch das Einpflanzen von Respondern gekennzeichnet
Physiologische Grundlagen der Ausdauer
 Lisa Maria Hirschfelder Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 340 Physiologische Grundlagen der Ausdauer Leistungssport - Ausdauer-Grundlagen Skript Physiologische
Lisa Maria Hirschfelder Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen e-fellows.net (Hrsg.) Band 340 Physiologische Grundlagen der Ausdauer Leistungssport - Ausdauer-Grundlagen Skript Physiologische
Springertätigkeit durch Anästhesiepflegepersonal
 Springertätigkeit durch Anästhesiepflegepersonal Wem nützt es? Wo liegen die Nachteile? Wolfgang Zeipert Welche Aufgaben hat der Springer? Vorbereitung des OP-Instrumentariums unsteriler Arm des Instrumentierenden
Springertätigkeit durch Anästhesiepflegepersonal Wem nützt es? Wo liegen die Nachteile? Wolfgang Zeipert Welche Aufgaben hat der Springer? Vorbereitung des OP-Instrumentariums unsteriler Arm des Instrumentierenden
Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege. Verfasserin: Frick Jacqueline. Betreuungsperson: Hipp Gerhard
 Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege Verfasserin: Frick Jacqueline Betreuungsperson: Hipp Gerhard Sulz, 06. März. 2008 5. Anhang 5.1. Fragebogen Im Rahmen meiner Ausbildung an der Krankenpflegeschule
Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege Verfasserin: Frick Jacqueline Betreuungsperson: Hipp Gerhard Sulz, 06. März. 2008 5. Anhang 5.1. Fragebogen Im Rahmen meiner Ausbildung an der Krankenpflegeschule
Taucherkrankheit - SCUBA (1)
 Taucherkrankheit - SCUBA (1) Der Luftdruck an der Wasseroberfläche beträgt 1 bar, sofern sich das Tauchgewässer in Meereshöhe oder in einer Höhe bis 250 m darüber befindet. Die Druckzunahme im Wasser ist
Taucherkrankheit - SCUBA (1) Der Luftdruck an der Wasseroberfläche beträgt 1 bar, sofern sich das Tauchgewässer in Meereshöhe oder in einer Höhe bis 250 m darüber befindet. Die Druckzunahme im Wasser ist
ultraprotektive Beatmung?
 ultraprotektive Beatmung? traditionelles Tidalvolumen ARDSNet-Tidalvolumen lowest Tidalvolumen: noch protektiver? praktisch möglich? Nebeneffekte? Die Lunge besteht aus verschiedenen Komponenten (Fibrinnetz,
ultraprotektive Beatmung? traditionelles Tidalvolumen ARDSNet-Tidalvolumen lowest Tidalvolumen: noch protektiver? praktisch möglich? Nebeneffekte? Die Lunge besteht aus verschiedenen Komponenten (Fibrinnetz,
Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen.
 Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien
 Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien Ein Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johannes Drach Medizinische Universität Wien Univ. Klinik für Innere Medizin I Klinische Abteilung
Welt Lymphom Tag Seminar für Patienten und Angehörige 15. September 2007 Wien Ein Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johannes Drach Medizinische Universität Wien Univ. Klinik für Innere Medizin I Klinische Abteilung
Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung
 Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung alveolo-arterielle Sauerstoffdruckdifferenz alveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz AaDO 2 - (vereinfacht) AaDO 2 - (Schätzwert)
Alveolo-arterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz, vereinfachte Berechnung alveolo-arterielle Sauerstoffdruckdifferenz alveolo-arterielle Sauerstoffdifferenz AaDO 2 - (vereinfacht) AaDO 2 - (Schätzwert)
ANÄSTHESIE UND SCHWER GENERALISIERTE SOWIE INTERMEDIÄRE REZESSIV DYSTROPHE EB
 ANÄSTHESIE UND SCHWER GENERALISIERTE SOWIE INTERMEDIÄRE REZESSIV DYSTROPHE EB Dieser Abschnitt liefert Hinweise, was im Falle einer Anästhesie für EB-Betroffene zu beachten ist. Das Wichtigste in Kürze
ANÄSTHESIE UND SCHWER GENERALISIERTE SOWIE INTERMEDIÄRE REZESSIV DYSTROPHE EB Dieser Abschnitt liefert Hinweise, was im Falle einer Anästhesie für EB-Betroffene zu beachten ist. Das Wichtigste in Kürze
Gingivitis / Stomatitis
 Gingivitis / Stomatitis Informationen für den Katzenhalter Entzündungen im Maulbereich bei Katzen Ursachen der Zahnfleischentzündung Was bedeutet eigentlich Gingivitis / Stomatitis? Katzen leiden häufig
Gingivitis / Stomatitis Informationen für den Katzenhalter Entzündungen im Maulbereich bei Katzen Ursachen der Zahnfleischentzündung Was bedeutet eigentlich Gingivitis / Stomatitis? Katzen leiden häufig
ESSENTIAL. mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml
 ESSENTIAL mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 MANCHE MENSCHEN BLEIBEN GESÜNDER; LEBEN LÄNGER UND ALTERN LANGSAMER; DA SIE IN IHRER ERNÄHRUNG NÄHRSTOFFMÄNGEL VERMEIDEN: EQ Essential ist die
ESSENTIAL mit Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 MANCHE MENSCHEN BLEIBEN GESÜNDER; LEBEN LÄNGER UND ALTERN LANGSAMER; DA SIE IN IHRER ERNÄHRUNG NÄHRSTOFFMÄNGEL VERMEIDEN: EQ Essential ist die
PATIENTENAUFKLÄRUNG UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur Basistherapie mit Abatacept
 PATIENTENAUFKLÄRUNG UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur Basistherapie mit Abatacept Sehr geehrte Patientin! Sehr geehrter Patient! Sie leiden an einer chronischen Polyarthritis (Rheumatoiden Arthritis). Ihr
PATIENTENAUFKLÄRUNG UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur Basistherapie mit Abatacept Sehr geehrte Patientin! Sehr geehrter Patient! Sie leiden an einer chronischen Polyarthritis (Rheumatoiden Arthritis). Ihr
Ernährungstherapie. Krebs. Informationsbroschüre der Diätologie
 Ernährungstherapie bei Krebs Informationsbroschüre der Diätologie 02 Ernährungstherapie in der Onkologie Welche Rolle spielt die Ernährung bei Krebserkrankungen? Je nach Tumorart spielt die Ernährung eine
Ernährungstherapie bei Krebs Informationsbroschüre der Diätologie 02 Ernährungstherapie in der Onkologie Welche Rolle spielt die Ernährung bei Krebserkrankungen? Je nach Tumorart spielt die Ernährung eine
Entstehung und Ursachen einer Übersäuerung
 Entstehung und Ursachen einer Übersäuerung Übersäuerung im Körper normal ph 7,4 (Normbereich ph 7,35 7,45) übersäuert ph 7,35-7,40 (Normbereich zum Sauren verschoben) Verminderte Pufferkapazität im Blut
Entstehung und Ursachen einer Übersäuerung Übersäuerung im Körper normal ph 7,4 (Normbereich ph 7,35 7,45) übersäuert ph 7,35-7,40 (Normbereich zum Sauren verschoben) Verminderte Pufferkapazität im Blut
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Freie Radikale und Antioxidantien... 2
 Contents Freie Radikale und Antioxidantien... 2 Freie Radikale und Antioxidantien... 2 Freie Radikale stärken das Immunsystem... 2 Der Organismus produziert Antioxidantien im Stoffwechsel... 3 Selen, Kupfer,
Contents Freie Radikale und Antioxidantien... 2 Freie Radikale und Antioxidantien... 2 Freie Radikale stärken das Immunsystem... 2 Der Organismus produziert Antioxidantien im Stoffwechsel... 3 Selen, Kupfer,
Die Welt des Trimix vom Helium im Körper bis zum Sauerstoff-Fenster. Dr. med. Jochen Steinbrenner Vorsitzender der Spitalleitung
 Die Welt des Trimix vom Helium im Körper bis zum Sauerstoff-Fenster Dr. med. Jochen Steinbrenner Vorsitzender der Spitalleitung Programm Helium Trimix Gasgemische Isobare Gegendiffusion Sauerstoff-Fenster
Die Welt des Trimix vom Helium im Körper bis zum Sauerstoff-Fenster Dr. med. Jochen Steinbrenner Vorsitzender der Spitalleitung Programm Helium Trimix Gasgemische Isobare Gegendiffusion Sauerstoff-Fenster
Workshop Beatmung IPPV, SIMV, PCV, CPAP, DU, NIV, PEEP, PIP
 Workshop Beatmung IPPV, SIMV, PCV, CPAP, DU, NIV, PEEP, PIP M. Roessler Universitätsmedizin Göttingen Robert-Koch-Straße 40 37075 Göttingen Atmungskette Atemmechanik Ventilation Perfusion Diffusion Atmungskette
Workshop Beatmung IPPV, SIMV, PCV, CPAP, DU, NIV, PEEP, PIP M. Roessler Universitätsmedizin Göttingen Robert-Koch-Straße 40 37075 Göttingen Atmungskette Atemmechanik Ventilation Perfusion Diffusion Atmungskette
Einweisung auf das Medizinprodukt: Teil 3: Beatmungsfunktionen. Detlev Krohne LRA
 Einweisung auf das Medizinprodukt: Teil 3: Beatmungsfunktionen Detlev Krohne LRA Beatmungsmodus - Notfallmodi Für die Notfallbeatmung stehen drei Modi mit voreingestellten Beatmungsparametern zur Verfügung.
Einweisung auf das Medizinprodukt: Teil 3: Beatmungsfunktionen Detlev Krohne LRA Beatmungsmodus - Notfallmodi Für die Notfallbeatmung stehen drei Modi mit voreingestellten Beatmungsparametern zur Verfügung.
Physikalische Aspekte der Respiration
 Physikalische Aspekte der Respiration Christoph Hitzenberger Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik Themenübersicht Physik der Gase o Ideale Gasgleichung o Atmosphärische Luft o Partialdruck Strömungsmechanik
Physikalische Aspekte der Respiration Christoph Hitzenberger Zentrum für Biomedizinische Technik und Physik Themenübersicht Physik der Gase o Ideale Gasgleichung o Atmosphärische Luft o Partialdruck Strömungsmechanik
4. ERGEBNISSE. 4.1 Demographische und klinische Daten Patienten
 4. ERGEBNISSE 4.1 Demographische und klinische Daten 4.1.1 Patienten Die vorliegende Untersuchung erfaßt 251 von 265 befragten Patienten (Rücklaufquote 95%), die sich innerhalb des Untersuchungszeitraumes
4. ERGEBNISSE 4.1 Demographische und klinische Daten 4.1.1 Patienten Die vorliegende Untersuchung erfaßt 251 von 265 befragten Patienten (Rücklaufquote 95%), die sich innerhalb des Untersuchungszeitraumes
Verwirrtheit nach Operationen
 Spezielle Narkoseüberwachung durch Anästhesisten kann vorbeugen Verwirrtheit nach Operationen Berlin (18. September 2013) Orientierungslosigkeit, Angst und Halluzinationen sind Anzeichen von Verwirrtheitszuständen,
Spezielle Narkoseüberwachung durch Anästhesisten kann vorbeugen Verwirrtheit nach Operationen Berlin (18. September 2013) Orientierungslosigkeit, Angst und Halluzinationen sind Anzeichen von Verwirrtheitszuständen,
