Newsletter 1 / 2015 EDITORIAL
|
|
|
- Hartmut Bach
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Newsletter 1 / 2015 EDITORIAL Ausserhalb der Unterrichtsräume sprechen Schülerinnen und Schüler kaum über Inhalte eher geht es um Noten, Prüfungsstress oder Lerntaktiken, Zeugnisse und Diplome. Dass die für jegliche Bildung zentralen Lerngegenstände bereits beim Verlassen des Unterrichtszimmers aus dem Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind, sollte alarmieren. Es ist also Zeit für eine Kampagne mit dem Schlachtruf: Rettet die Inhalte! Und der Anklang an Martin Wagenscheins Ruf Rettet die Phänomene! ist natürlich beabsichtigt. Inhalte meint mehr als schulisch zurechtgestutzen Stoff. Inhalte haben zum Beispiel eine geschichtliche und kulturelle Dimension, die immer mitgedacht und -geliefert werden muss, wenn man vertieftes Verstehen anstrebt. Inhalte sind dann auch Kulturtechniken, Denk- und Forschungsformen und also (historisch entwickelte) Methoden. Und sie gehören dazu wie die Kulturschaffenden und Wissenschaftler, die sie erfunden und erforscht und in ihren Werken hinterlassen haben. Einige solcher Bildungsinhalte kommen in diesem Newsletter zur Sprache. Der Wissenschaftshistoriker E.P. Fischer sichtet in seinem Plädoyer für eine alternative Geschichte der Naturwissenschaften z.b. Dutzende von spannenden Themen (S. 3). Im Fokus dieser Nummer stehen sodann die Ergebnisse zweier lehrkunstdidaktischer Dissertationen. Marc Eyer (S. 4/5) kommt zum Schluss, dass das genetische Lehren in den Naturwissenschaften besser gelinge, wenn der Unterricht die Kulturgenese des Unterrichtsgegenstandes zur Grundlinie der Gestaltung macht. Der zweite Fokus-Beitrag von Mario Gerwig (S. 6/7) zeigt an den Sätzen, die Euklid von Alexandria vor über 2000 Jahren in seinen Elementen bewies, wie das für die Mathematik charakteristische und zentrale Beweisen im Unterricht angemessen umgesetzt werden kann. Beide Dissertationen erscheinen im Verlauf des Jahres im Druck. In weiteren Beiträgen bezeichnet Willi Eugster die Riemeck- Vorlesungen zur Geschichte der Pädagogik als geistreiches und informatives Schwergewicht (S. 9) und Susanne Wildhirt reflektiert kritisch den Bildungskongress in Bregenz des Archivs der Zukunft (S. 11). Wir sind nach wie vor interessiert an euren Bemerkungen, Reaktionen, Likes und Dislikes, diesmal auch an euren Antworten auf das Rätsel (S.12). Schickt eure Rück-mail-dungen wie üblich an newsletter@lehrkunst.ch. Liebe Grüsse von Stephan, Michael, Mario und Susanne!
2 Inhalt Editorial Seite 1 Lehrkunstblitze Der Pilot fliegt weiter von Michael Jänichen Seite 2 Wagenschein fortgeschrieben von Stephan Schmidlin Seite 3 IM FOCUS Der neue genetische Dreischritt von Marc Eyer Seite 4 Keine Produkte ohne Prozesse von Mario Gerwig Seite 6 Lehrstücklabor Was heisst sich Einschreiben in ein Werk? von Stephan Schmidlin Seite 8 Aus den Quellen 500-jährige Geistesarbeit von Willi Eugster Seite 9 Die unerschöpflichen Quellen des Ursprünglichen von Susanne Wildhirt Seite 10 TREFFPUNKT Orte und Horizonte - Bildung braucht Gesellschaft von Susanne Wildhirt Seite 11 Rätsel, Cartoon & IMPRESSUM Seite 12 LehRkunst- Blitze Der Pilot fliegt weiter v o n M i c h a e l J ä n i c h e n Auch im Studienjahr 2014/15 fand das Wahlmodul Lehrkunst und Unterrichtscoaching am Institut für Vorschul- und Primarschulstufe IVP der PH Bern mit Christoph Berchtold, Elisabeth Ruch und Michael Jänichen statt. Eine Evaluation. 10 Studierende sowie 9 Praktikumslehrerinnen und -lehrer waren dabei, unter letzteren auch vier, die zum zweiten Mal teilgenommen haben. An zwei Samstagen, einem Sternen-Abend und vier Dienstagabendterminen wurden beide Ansätze eingeführt. Die letzte gemeinsame Sitzung diente einer Evaluation, deren Ergebnisse hier wiedergegeben werden. Insgesamt wurde das Modul als lehrreich und anregend beschrieben. Die Lehrstückentwicklung profitierte, weil ein paar schlummernde Lehrstückansätze für die Praktika gewählt wurden. Neben Faradays Kerze und dem Heimatlichen Sternhimmel kamen auch die Miniatur Schneekristalle (einmal mit Bentley, einmal mit Kepler) und Lernen lernen mit Ebbinghaus zum Zug und wurden für den Primar schulunterricht im Praktikum variiert. Eine Studentin wagte sich an eine Neuentwicklung: Cooks Entdeckung Australiens. Gegenwärtig wird der Versuch in einer sechsten Klasse in Steffisburg inszeniert und als Bachelorarbeit ausgearbeitet. Die Lehrstückvielfalt weckte Interesse und erweiterte den Horizont gerade auch bei den Wiederholungstäterinnen und -tätern. Andere verloren in der Fülle allerdings den Überblick. Wir werden im nächsten Jahr weniger neue Lehrstücke einführen und diese besser verankern. Eine zweite Erweiterung war der Beizug von externen Impulsgeberinnen: Susanne Wildhirt von der PH Luzern präsentierte Aesops Fabeln und Dr. Nathalie Glauser stellte ihr MINT-Förderungsprojekt je desto ( vor, in dem Kindergartenkinder auf spielerische Weise an die Entdeckung des Fallgesetzes herangeführt werden. Als dritte Neuerung präsentierten am letzten gemeinsamen Samstag alle Studierenden eine Lehrstücksequenz. Es beeindruckte, mit wie viel Einsatz die meist szenischen Appetithappen serviert wurden. Im nächsten Jahr werden diese inspirierenden Einblicke schon früher platziert. Das Format des Moduls hat auch Tücken, da Studierende und unterschiedlich im Lehrstückunterricht erfahrene Lehrerinnen und Lehrer mit divergierenden Bedürfnissen und Vorstellungen gleichzeitig im Modul sind. Eine nützliche Entscheidung war in diesem Jahr, drei wesentliche Lehrstückkomponenten (die orientierende Sogfrage, die originäre Vorlage und das Denkbild) inhaltlich ins Zentrum zu rücken. Insgesamt wurde diese begleitete gemeinsame Unterrichtsvorbereitung über die Generationen hinweg als sehr nützlich empfunden. Damit die Seite des fachspezifischen Unterrichtscoachings im nächsten Jahr stärker zur Geltung kommt, wird Elisabeth Ruch im nächsten Jahr stärker mit Videobeispielen arbeiten, die dieses wertvolle Konzept akzentuieren. Unschön war in diesem Studienjahr, dass die Praktikumsplätze zweier Lehrerinnen nicht besetzt werden konnten, weil kurz vor Start des Moduls noch zwei Studentinnen abgesprungen sind und niemand nachrücken konnte. Hier hoffen wir, im nächsten Jahr mehr Verbindlichkeit bei den Zuteilungen zu schaffen. 2
3 LehRkunst- Blitze Ernst Peter Fischer: Die Verzauberung der Welt. Eine andere Geschichte der Naturwissenschaften, München: Siedler 2014, WAGENSCHEIN fortgeschrieben v o n S t e p h a n S c h m i d l i n Unter dem romantischen Titel Die Verzauberung der Welt legte der Wissenschaftspublizist Ernst Peter Fischer 2014 eine andere Geschichte der Naturwissenschaften vor. Darin plädiert er in 9 Kapiteln und 9 Exkursen für ein neues Verstehen der naturwissenschaftlichen Phänomene, wie es auch Martin Wagenschein vertreten hat und wie es die Lehrkunst in den Lehrstücken zugrunde legt. Im Nachwort, das er mit einer (genetischen) Bildungsdefinition von Johann Comenius einleitet ( Indem wir etwas fertigen, fertigen wir uns ), fasst Fischer seine Intentionen so zusammen: In diesem Buch sind wir davon ausgegangen, dass die Naturwissenschaften die Welt romantisieren können. Wenn man sich diese ihnen inhärente Tendenz klargemacht hat, wird man ihnen, so ist zu hoffen, mehr Wissbegierde und Sympathie entgegenbringen. Ohne Staunen geht es nicht man könnte das Staunen aber auch durch viele andere Wörter ersetzen: Bildung, Wissen, Denken, Träume. Man könnte sogar zu Spielen oder Gegenpart greifen. (S. 306) Das Staunen war bekanntlich auch ein Zentralbegriff beim Physiker und Mathematiker Martin Wagenschein, eine seiner Textsammlungen trägt den Titel zäh am Staunen. Das Staunen über alle Phänomene als ständiger Antrieb zum Verstehenwollen, die immer wieder neu aktivierte kindliche Neugier und Fantasie, das Fragen, das spielerische Experimentieren mit allen Mitteln, das Grenzenlose Fischer ortet diese philosophische Haltung kulturhistorisch zu Recht in der Romantik und verweist bei der zentralen Forderung der Romantisierung der Welt nach Novalis ( dem Endlichen einen unendlichen Schein geben) auf Rüdiger Safranskis grundlegende Geschichte der Romantik von Fischer zeigt das Doppelgesicht der Phänomene auch am Mond, der noch in den heutigen Vulgärformen als Inbegriff der Romantik gilt. Der Mond zum Beispiel ist sowohl berechenbares Objekt am Himmel (zu dem man sogar hinfliegen kann) als auch Quelle des freundlichen Lichts, das Busch und Tal mit Nebelglanz erfüllt, wie es das Poetische weiss. (S. 307) Das ist genau der Gedanke, den auch Wagenschein in seinem Aufsatz Die beiden Monde von 1979 entwickelt. Auch Fischer spricht von zwei Arten der Faszination, der wissenschaftlichen und der romantischen, die allen offen stehen sollten. Auf die naiven grundlegenden Fragen zu den Phänomenen wie Was ist der Mond, warum ist der Himmel blau, was ist Gras? gebe es sicher immer mehr als eine Antwort. Und diese Antworten erforderten Phantasie und Einfallsreichtum sowohl seitens der Wissenschaft als auch seitens der Poesie samt ihren jeweiligen unterschiedlichen Darstellungsformen. Wie auch Wagenschein, der uns schon 1964 einlud, Galilei zu lesen, beruft sich Fischer in seiner anderen Geschichte der Naturwissenschaften konsequent auf die grössten Denker der Philosophie (angefangen bei Aristoteles), auf die Spitzenforscherinnen und -forscher in den Naturwissenschaften (an der Spitze: Einstein), aber auch auf die hervorragenden Kunstschaffenden (von Shakespeare bis Picasso), die alle ihren Rang dadurch behaupten, dass sie ins Unendliche hinauszudenken wagen und keinerlei Denk- oder Sprachschranken akzeptieren. Von ihnen und mit ihnen sollten wir lernen. Das könnte man als didaktisches Auctor-Prinzip bezeichnen, wie es sich in der Lehrkunst bei der ordinären Vorlage findet. Ein besonderes Anliegen ist für Fischer, die grossen Wissenschaftler zu Stars zu machen, wie es sie in den Künsten gibt (Musterbeispiel im 20. Jahrhundert: wiederum Picasso), so dass auch sie als ganze Menschen mit ihrer Biographie und ihrem Schaffen vor uns treten und nicht nur mit einer Erfindung oder einer Formel assoziiert werden. Eine Folge der Re-Romantisierung oder Wieder- Verzauberung der Welt ist nach Fischer ein neues Zusammenwirken von Wissenschaft und Künsten bei der Vermittlung von Wissenschaft. Nicht Resignation sei angesagt ob der Überkomplexität moderner naturwissenschaftlicher Forschung, sondern ein anderes Narrativ, wie man heute sagen würde: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man nicht schweigen, davon kann man erzählen, empfiehlt Fischer und verweist als Beispiel auf Michael Frayns Theaterstück Copenhagen, wo ein Stück Wissenschaftsgeschichte fesselnd dramatisiert ist. In der Tat hat auch die Lehrkunst bereits dieses Drama um Niels Bohr und Werner Heisenberg als ideale (von vornherein fächerübergreifende) Lehrstück-Vorlage für den Unterricht an Mittelschulen entdeckt. Im Exkurs zum siebten Kapitel kommt Fischer explizit auf die didaktische und institutionelle Umsetzung der Wissenschaftsvermittlung zu sprechen. Er schlägt einen neuen Studiengang Wissenschaftsgestaltung vor, der profunde Kenntnisse der Wissenschaften mit den Fähigkeiten der Gestaltung bzw. Formbildung verbindet. Wissenschaftsgestaltung müsse aber interdisziplinär und interinstitutionell angeboten werden, in Zusammenarbeit von Unis, Schulen und solchen Museen, die sich vermehrt an die Präsentation von Wissenschaft wagen, ohne damit lediglich technisches Gerät zu meinen. (S. 230) Absolventen des neuen Studiengangs Wissenschaftsgestaltung könnten einen neuen Beruf ausüben, den des Wissenschaftskritikers, der die Wissenschaften so liebe wie ein Literaturkritiker die Literatur. Immerhin: Zwei Vorbilder für diesen neuen Beruf haben wir schon. Sie heissen Fischer und Wagenschein. 3
4 Der neue genetische Dreischritt von Marc Eyer Als Newton unter dem Apfelbaum sass und ihm der überreife Apfel auf seinen Kopf fiel, soll ihm ein Licht aufgegangen sein: Na klar! Wie ein Magnet zieht die Erde den Apfel an! Massen ziehen sich an. Man nennt diese Anziehungskraft Gravitation. Newton wird seither als Entdecker dieses Naturgesetzes genannt. Diese Gesetzmässigkeit lässt sich in der Sprache der Mathematik fassen, wie alle Naturgesetze. Denn das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben ( ), wie Galileo Galilei es 1623 formulierte. 1 IM FOCUS ARISTOTE- LISCH- GALILEISCH- MODERN Aristotelik im Alltag: Was bringt das Wasser in den Mund Saugen oder Drücken? Galileis Satz könnte dem Konzept des naturwissenschaftlichen Unterrichts an einem Gymnasium entstammen. Für manche Studierende ist sowohl die Tatsache, dass sich Massen anziehen, wie auch der dazugehörige Formalismus zwar lernbar, aber wenig intuitiv, zwingend und nachvollziehbar. Nun gilt es halt mit guter Methodik und Didaktik, die oft gleichbedeutend ist mit brillanter Überredungskunst, den Studierenden zu plausibilisieren, dass das tatsächlich so ist! Meist beugen sie sich schliesslich den Bemühungen von uns Lehrerinnen und Lehrern, entweder weil ihnen die Argumente ausgegangen sind, weil ihre Argumente bei uns kein Gehör gefunden haben oder weil die Inhalte so weit weg von ihrem Alltag liegen, dass gar keine Fragen und Einwände auftauchen. Physik ist halt nicht einfach. Wir verlangen von unseren Studierenden, dass sie uns die wissenschaftlichen Konzepte und Paradigmen ohne weiteres abnicken. Doch: Den Entdeckungen und Entwicklungen der im Unterricht gelehrten Paradigmen, ja der ganzen klassischen naturwissenschaftlichen Methodik liegen Revolutionen im Weltverständnis zu Grunde. Die aristotelische Lehre galt über 1500 Jahre als das Mass aller Dinge in der Naturphilosophie. Ihr Erfolg lag darin, dass deren Grundlage die menschliche An- schauung der Welt war. Erst im 16. Jahrhundert hat Galileo Galilei den Kampf gegen den Stillstand im Weltverständnis aufgenommen, die alten Strukturen durchbrochen und dabei ein Weltbild geopfert: weg vom Dogma der Gesamtschau hin zu Reduktion, Abstraktion, zur Analyse und zur Verallgemeinerung. Die moderne Form des Naturgesetzes wurde geschaffen und deren mathematische Struktur wurde entdeckt. Es liegt auf der Hand, dass Kinder die Welt auch heute noch aristotelisch entdecken. Für uns alle gilt erst einmal: Wahr ist, was ich unmittelbar sehe, greife, höre, schmecke. Die egozentrische Wahrnehmung der Welt ist der Ausgangspunkt unseres Forschens. Diesem Umstand wird im Gymnasiallunterricht oft nicht Rechnung getragen, auch wenn es gerade dort am wichtigsten wäre. Das klassische naturwissenschaftliche Verständnis ( Galileik ) kann nämlich nur erfasst werden, wenn der Weg dahin klar ist. Die Studierenden müssen die Gelegenheit erhalten, ihre egozentrische (anthropozentrische, aristotelische) Sichtweise zur erkennen, zu reflektieren, zu hinterfragen und ausgehend davon die Revolution zum klassischen (galileischen) naturwissenschaftlichen Denken mitzumachen am besten gemeinsam mit Galilei! 4
5 Wissenschaftsdiskurs live im Unterricht: Aristoteles und Galilei im Fachgespräch. Ähnlich gravierend ist es, das Vergehen im gymnasialen Physikunterricht zu verschweigen, dass die galileische Betrachtung der Welt nur eine Zwischenstation zum modernen Verständnis der Welt ist. Die allgemeine Relativitätstheorie lässt die Gravitation abermals in einem neuen Licht erscheinen, sie ist nunmehr nichts anderes als eine Konsequenz der Raumkrümmung. Die moderne Betrachtung der Welt schafft eine noch gründlichere, eine universelle Verallgemeinerung der Beschreibung der Welt allerdings erneut auf Kosten der Anschaulichkeit. Wir sind halt immer noch Menschen und haben nur beschränkt die kognitiven Fähigkeiten, unseren Standpunkt zu verlassen. Das Fazit aus diesen Überlegungen für den Gymnasialunterricht in den Naturwissenschaften sieht so aus: Die Lehrgegenstände in den Naturwissenschaften brauchen eine kulturgenetische Dimension. Woher kommen die Paradigmen, die wir lehren (z. B. Luftdruck, Fallbewegung, Temperaturbegriff) und wie sieht eine universell verallgemeinerte Betrachtung dieser Paradigmen aus? Grob kann diese Übersicht aus Sicht des Physikers in drei Epochen mit zwei Weltbild-Revolutionen über zwei Abstraktionsstufen geschehen: Von der Aristotelik (anthropozentrische Anschauung der Welt, ptolemäisches Weltbild) zur Galileik (naturwissenschaftliche Klassik, Übergang zum neuen Paradigma: Galilei schlägt vor, mit Experimenten die Naturgesetze zu entdecken!" heliozentrisches Weltbild) zur Moderne (universelle Verallgemeinerung, Relativität und Vereinheitlichung mit der Quantentheorie zu einer Weltbeschreibung). Dies soll nicht nur zum Zweck einer kulturhistorischen Einordnung der Naturwissenschaften geschehen auch wenn das zur Klärung der Frage nach dem Bildungsgehalt der Naturwissenschaften Grund genug wäre, sondern soll hauptsächlich aus didaktischen Überlegungen erfolgen. Um Studierenden einen Zugang und ein tieferes Verständnis für die wissenschaftlichen Bilder zu vermitteln, müssen sie sich zuerst mit ihren Präkonzepten auseinandersetzen und sich ihrer Weltanschauung bewusst werden. Erst dann kann es gelingen, in die naturwissenschaftliche Abstraktion vorzudringen und von dort den Weg auch wieder zurück in den Alltag zu finden. Das ist zwingend nötig, sonst wird der Naturwissenschaftsunterricht als horssol -Didaktik bodenlos, entkoppelt sich vom Weltverständnis unserer Studierenden, verabschiedet sich von der Alltagsrelevanz und damit von der allgemeinen Bildung. Wenn nur mehr Ressourcen für die Naturwissenschaften freigesetzt werden, aber ihre Didaktik nicht überdacht wird, kann die von der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz EDK beabsichtigte MINT-Förderung zur Ausbildung von naturwissenschaftlichen Fachkräften nicht erreicht werden! Drei Wissenschaftsparadigmen Aristotelik Galileik Moderne Dogma der Anschauung, Anthropozentrik Der Stein fällt, weil er unten hingehört. Globale Verallgemeinerung, mathematische Abstraktion Der Stein wird von der Erde angezogen, Gravitationsgesetz! Universelle Verallgemeinerung, endgültiger Verlust der Anschaulichkeit Der Stein bewegt sich gleichförmig durch die gekrümmte Raum-Zeit. 1 Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben und ihre Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es ganz unmöglich ist auch nur einen Satz zu verstehen, ohne die man sich in einem dunklen Labyrinth verliert. (Galileo Galilei: II Saggiatore (1623) Edition Nazionale, Bd. 6, Florenz 1896, S. 232) 5
6 IM FOCUS Eine didaktische Hintertreppe zum Beweisen in der Mathematik Keine Produkte ohne Prozesse von Mario Gerwig Für eine Lehrkraft gibt es mindestens zwei Aufstiege zur Stufe des guten Unterrichts. Der übliche Weg über die Vordertreppe ist der heutzutage vorherrschende. Dieser Weg ist mit Wegweisern und Hinweisen versehen, führt durch Kompetenzkataloge, Bildungsstandards und Kriterienraster hindurch, berücksichtigt methodische Alternativen und pädagogisch-psychologische Analysen so reichhaltig, dass man ständig Gefahr läuft, das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Es gibt jedoch auch noch einen zweiten, selten benutzten Weg, sozusagen über die Hintertreppe. Die ist häufig nicht aufgeräumt oder geputzt, manchmal nicht einmal beleuchtet, kahl und vernachlässigt. Die Hintertreppe ist aber ein Königsweg: Er führt über die Inhalte und ihre Kulturgenese. Dieser Zugang ist direkt, natürlich, einleuchtend. Er führt ohne Umwege zu einer direkten Begegnung mit der Sache und darüber zur Bildung. Dieser Weg über die Hintertreppe ist nicht unbedingt schmucklos, aber ohne Ablenkung. Er ist auf Zentrales konzentriert und ermöglicht eine echte, genetische und dramaturgische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Fall. Zuweilen führt er deshalb umso eher zum Ziel. Zum Beispiel im Mathematikunterricht bei der wichtigen Thematik des Beweisens. Die Vordertreppe führt über ausgewählte, schöne, nachvollziehbare Beweise. Beweise, welche die Eleganz der Mathematik erkennen lassen, bei denen einem an der entscheidenden Stelle etwas Geniales einfallen muss. Beweise dieser Art sind schön anzusehen, man kann sie nachvollziehen, man kann zustimmen aber das Beweisen lernt man mit ihnen nicht. Vielmehr läuft man Gefahr, bei den ausgewählten Beweisprodukten hängen zu bleiben und nicht bis zur zentralen Tätigkeit des Beweisens vorzudringen. Der Weg über die Hintertreppe ist da schlichter: Hier steht das Beweisen, die Tätigkeit, im Mittelpunkt. Natürlich trifft man auch hier auf Beweis-Produkte Euklid und seine Elemente etwa sind absolut 6
7 Wenn dann die Oberstufe ihre hohen Gedankengänge auf unverstandene, nur einmal da gewesene, gewusste und gelernte Vorratskenntnisse der Unterstufe aufbaut, so bedeutet das, Stahlkonstruktion auf Stroh gründen, statt auf dem Granit des Selbstverständlichen (Wagenschein 2002, 54). unverzichtbar, möchte man authentisch das Beweisen thematisieren aber hier spielt vor allem der Prozess des Beweisens die entscheidende Rolle. Keine Produkte ohne Prozesse! Konkret: Die Möglichkeit, Aussagen ein für allemal beweisen zu können, ist ein Alleinstellungsmerkmal der Mathematik. Das Entdecken und Hervorbringen unumstößlicher Wahrheiten ist das inhaltliche Charakteristikum der Mathematik, und Beweisen ist einer ihrer zentralen Begriffe. Doch dessen angemessene unterrichtliche Umsetzung stellt eines der mathematikdidaktischen Zentralprobleme dar, weil meist eine Vielzahl formaldeduktiver Beweise die Entdeckung des Beweisprozesses von Beginn an und systematisch verhindert. Denn in den fertigen Beweisprodukten sind die dem Beweisprozess zugrundeliegenden, fundamentalen Leitideen nicht mehr erkennbar. So entsteht eine paradoxe Situation: Das Charakteristikum der Wissenschaft Mathematik das Beweisen führt im Unterricht ein Schattendasein. Die Lehrstück-Trilogie zum Beweisen (Gerwig 2014) versucht, diese paradoxe Situation aufzulösen. Dazu wurden alle drei Euklid-Exempel Wagenscheins Entdeckung der Axiomatik am Sechseck, Satz des Pythagoras, Nichtabbrechen der Primzahlfolge kumulativ zu Lehrstücken weiterentwickelt, mehrfach unterrichtlich inszeniert, reflektiert, evaluiert, kollegial diskutiert, optimiert und publiziert. Auf das erste Lehrstück der Trilogie, die Entdeckung der Axiomatik, möchte ich hier etwas genauer eingehen. Es zeigt, wie im Unterricht das, was es mit dem Beweisen auf sich hat, wie von selbst auftauchen und sich die individuelle Erkenntnis im dramatischen Ringen mit der Sache selbst bilden kann. Beweise sind kulturgenetisch das Ergebnis eines langen Suchens, Nachdenkens, Probierens, Forschens. Wenn auch der Weg zu einem fertigen Beweis in aller Regel mitsamt seinen Irrwegen verschüttet ist, so ist eine Individualgenese dennoch möglich. Besonders dazu geeignet scheinen Initialprobleme der Geometrie, wie sie Wagenschein (2008, 129) nennt. Sie können allein mit gesundem Menschenverstand, wachem Geist und nahezu ohne Vorkenntnisse ehrlich und klar begründet werden. Wagenschein (vgl. ebd., ) zeigt dies an einem prägnanten Phänomen: Warum lässt sich der Radius eines beliebigen Kreises genau sechsmal auf dem Rand abtragen? Ein vorzügliches, reizvolles und herausforderndes geometrisches Initialproblem, an welchem SchülerInnen das Begründen lernen, dem Beweisen als einem Grundprinzip der Mathematik begegnen und am Schluss mit einem tiefen Einblick in die euklidische Axiomatik belohnt werden. Dazu führen sie, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen und Untersuchungen, das zunächst sonderbar erscheinende Phänomen des genau sechsmal in der Peripherie herumgespannten Kreisradius mithilfe logischer und völlig einsichtiger Begründungen zurück auf die unbestreitbare, einfache Tatsache der Dreiecksverschiebung ein Vorgehen, welches in eindrücklicher Weise dem axiomatischen Verfahren Euklids entspricht, und schließlich von selbst zu dessen folgenreichen Ausdifferenzierungen führt. Das rund zwölf Unterrichtsstunden umfassende Lehrstück sorgt für echtes Verständnis, es beliefert nicht die Berge an Vorratswissen, welche viele Schüler im Laufe ihrer Schulkarriere anhäufen. Wenn dann die Oberstufe ihre hohen Gedankengänge auf unverstandene, nur einmal da gewesene, gewusste und gelernte Vorratskenntnisse der Unterstufe aufbaut, so bedeutet das, Stahlkonstruktion auf Stroh gründen, statt auf dem Granit des Selbstverständlichen (Wagenschein 2002, 54). Die Beweistrilogie ist granitbildend. In ihr wird außerordentlich vertieftes und sachgemäßes Wissen erworben. Die anschauliche Vorstellung der Geometrie wird präzisiert, indem der geometrische Idealisierungsprozess bewusst wahrgenommen und in seiner Bedeutung verfolgt wird. Es werden scharfsinnige geometrische Begriffsbildungen durchlaufen, die Bedeutung und Notwendigkeit des Beweisens wird, wandelnd in den Spuren Euklids, genetisch entwickelt. Man wagt erste Schritte ins Reich der Axiomatik, verschiedene Beweismethoden werden entdeckt, verglichen und erprobt, so dass im Zuge der gesamten Untersuchung echtes, folgerichtiges, zielbewusstes und ideenreiches mathematisches Denken praktiziert wird. Dabei sind die Beobachtungen und Erkenntnisse niemals abgespalten von den Phänomenen. Daher sind sie keineswegs wirklichkeitsfremd, sondern stets angeschlossen an die Wirklichkeit. Sie werden nicht zur Kenntnis genommen, sondern es werden jeweils die Gründe eingesehen und es wird verstanden, warum etwas so ist, wie es ist, so dass sich das Beweisen tatsächlich einwurzeln kann (vgl. Wagenschein 2008, 78f). Die Beschäftigung mit Mathematik und mit dem, was Mathematik für die Menschheit bedeutet, führt uns zur Entdeckung von Antlitzen Antlitzen unserer selbst; und verwirklicht damit im wahrsten Sinne des Wortes humanistische Bildung (Wittenberg 1963, 49). Lernen wird zur Bildung vertieft, die drei Lehrstücke zum Beweisen können massive Bildungspfeiler sein! Eine Beobachtung kann man auf offensichtlich wahre Grundaussagen zurückführen. Wer das erfahren, wer dieses Vorgehen verstanden und ein-, zweimal mitgemacht hat, der ist bereit und fähig, später auch ohne Missverständnisse andere Beweise verstehend nachzuvollziehen. Literatur: Gerwig, Mario (2014): Beweisen verstehen. Bildung durch Lehrkunst im Mathematikunterricht. Inaugural-Dissertation. Marburg. Erscheint 2015 bei Springer-Spektrum. Wagenschein, Martin (2002):...zäh am Staunen. Pädagogische Beiträge zum Bestehen der Wissensgesellschaft. Zusammengestellt und herausgegeben von Horst Rumpf. Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung. Seelze-Velber. Wagenschein, Martin (2008): Verstehen lehren. Verstehen lehren. Genetisch Sokratisch Exemplarisch. Beltz. Weinheim und Basel. [Erstausgabe: 1968] Wittenberg, Alexander Israel (1963): Bildung und Mathematik. Mathematik als exemplarisches Gymnasialfach. Ernst Klett Verlag. Stuttgart. 7
8 Lehr- Stück- Labor Was heisst sich Einschreiben in ein Werk? v o n S t e p h a n S c h m i d l i n Neulich bei der Kurz-Behandlung von Goethes Werther : Die Klasse erhielt die Aufgabe, auf zwei Briefe Werthers aus der Sicht des Adressaten und Herausgebers der Werther-Briefe, also Wilhelms, zu antworten. Die Aufgabe war freiwillig genau die Hälfte der Klasse machte trotzdem mit. Die Resultate bestätigten: Genau so ist die Individualgenese bei einem Werther-Lehrstück anzusetzen. Aber lehrreich ist diese Einsicht darüber hinaus. Der Effekt des Auftrags war verblüffend. Sofort waren meine Studierenden mit der Aufgabe konfrontiert, ihre Position zu klären: Schrieben Sie Werther in der Rolle des historischen Freundes oder von hier und heute aus über zwei Jahrhunderte zurück? Es gab beides. Jonathan etwa nahm den damaligen Briefstil auf: Ach, Werther, was schwadroniere ich wieder! Es warst seit jeher Du, der solcherlei Dinge besser zu umschreiben vermochte. Lass mich auf andere Begebenheiten zu sprechen kommen. Dieser Graf C. scheint ein bewundernswerter Mann zu sein. Wie du schreibst, merkte er bei den ersten Worten, dass Ihr Euch verstundet. Eine grosse Seele, die sich einer grossen Seele öffnet, so dünkt mich. Alfred hingegen grüsste den Brieffreund als Wilhelm aus dem Emmental und machte deutlich, dass seine dezidierte Ständekritik aus einem heutigen Bewusstsein geschrieben ist. Wie auch immer: Alle, die den Test mitmachten (die Lehrkraft inklusive), spürten, dass sie so und nur so die Seite wechseln, also von einer unbeteiligten Aussensicht ins Innere dieses Phänomens Goethes Werther gelangen konnten. Ich denke, dass im Werther -Lehrstück mindestens drei solche Briefinterventionen angesetzt werden Um Effi Briest zu verstehen, müssen wir zunächst dieses Kind in seiner noch halb-magischen Kinderwelt auf dem Spielplatz seiner behüteten Jugend sehen und dazu auf eigene Eindrücke, Bilder und Szenen aus der je persönlichen Geschichte zurückgreifen. sollten, im ersten Buch nach dem 16. Juni, nachdem Werther Lotte getroffen hat, zu Beginn des zweiten Teils nach Werthers Flucht das war unsere Stelle und dann sicher noch im November des Folgejahrs, wo es gilt, einen Verzweifelten vor dem letzten Schritt, dem Selbstmord, zu bewahren. Spätestens hier spitzt sich unser Einschreiben ins Werk extrem zu: Bleiben wir in Wilhelms Beistands-Rolle und versuchen das Unmögliche oder nehmen wir uns wieder heraus im Wissen um den Ausgang und die Nachwirkung der Geschichte bzw. um deren Fiktionalität? Die Lösung mag so oder anders aussehen; wenn wir uns dem Dilemma stellen, sind wir bereits involviert und haben uns ins Werk eingeschrieben. Solches sich Einschreiben sieht bei jedem Lehrstück wieder etwas anders aus. Während uns Goethe in seinem Werther mit dem Alter Ego Wilhelm (der lebte in Goethes Prosawerk bekanntlich bis in die Wanderjahre weiter) eine Rollenofferte macht und uns so die Tür in seinen Briefroman hinein öffnet, ist es im Lehrstück Spaziergang mit Robert Walser (vgl. die Methode selbst, das ambulante Schreiben Walsers, das wir, selbst spazierengehend, übernehmen können, um uns in sein Werk einzuschreiben. Und wieder anders bei Fontanes bekanntestem Roman, Effi Briest, wo uns der Autor versichert, dass die ersten beiden Kapitel mit der Schilderung des Paradiesgärtleins des Kindes Effi die wichtigsten seien bzw. die Vertreibungsszene und der vergebliche Rückruf der Gespielinnen ( Effi, komm. ) genetisch am Anfang gestanden hätten (vgl. Newsletter Nr. 1/2011). Hier kann das sich Einschreiben gleich zu Beginn erfolgen; meine beiden Klassen haben den (freiwilligen) Auftrag, ihre persönliche Paradiesgärtlein-Reminiszenz aufzuschreiben und den andern vorzutragen, gerne gemacht, sonst hätte ich nicht rund drei Dutzend Texte erhalten. Ein Einstieg, der zieht, wie der Praxistest beweist es gibt darunter einige poetische Perlen. Sich einschreiben: Generell lässt sich diese didaktische Bewegung leicht erklären. Sie ist Teil der reproduktiven Rezeption eines Werks und als solche nichts anderes als eine besonders aktivierte Interpretation. Wollen wir zum Verständnis eines Phänomens oder Lehrgegenstands gelangen, der uns vorerst noch verschlossen und rätselhaft vorkommt, so geht dies nie anders als übers Vergleichen, das Vergleichen mit eigenen Erfahrungen, Bildern und Erzählungen natürlich. Um Effi Briest zu verstehen, müssen wir zunächst dieses Kind in seiner noch halb-magischen Kinderwelt auf dem Spielplatz seiner behüteten Jugend sehen und dazu auf eigene Eindrücke, Bilder und Szenen aus der je persönlichen Geschichte zurückgreifen. Statt diese aber beim (flüchtigen) Lesen im Halbbewusstsein stehen und eventuell wieder verschwinden zu lassen, sorgt der Gestaltungsauftrag ( Schreibe deine eigene Erinnerung auf!) dafür, dass wir Fontanes Szenerie und Szene bewusst mit unseren Folien kontrastieren und so seine Effi in unserem Erinnerungsschatz vertiefen. Auch und nicht zuletzt, weil wir auch unsere Erfahrung ästhetisch aufbereitet haben. Sich einschreiben: Bei andern Lehrstücken gibt es die gleiche Bewegung, aber der Begriff wird vielleicht immer metaphorischer und müsste unter Umständen angepasst werden. Bei Literaturlehrstücken mit einer Dramen-Vorlage (etwa Brechts Leben des Galilei oder Büchners Danton ) ist es sinnvoll, von sich Einspielen zu sprechen, weil wir das Klassenzimmer zur Bühne machen, bei den naturwissenschaftlichen Stücken (etwa Die Kerze nach Faraday ) hat sich der Begriff Mitspielen etabliert. Theodor Schulze hat den Begriff vom improvisationsoffenen Mitspielstück vorgeschlagen, der wahrscheinlich das Gros der Lehrstücke trifft, aber das, was je spezifisch an individueller Aneignung darin passiert, wieder verwischt. Hat jemand eine bessere Umschreibung? 8
9 AUS DEN QUELLEN Renate Riemeck: Klassiker der Pädagogik von Comenius bis Reichwein. Marburger Sommervorlesungen mit Quellentexten. Hrsg. H.C. Berg, B. Hildebrand, F. Stübig, H. Stübig, Marburg: Tectum 2014, 39.55/SFr jährige GEISTESARBEIT v o n W i l l i E u g s t e r In meinen Händen halte ich ein richtiges Buch, fest gebunden, mit stabilem Karton umgeben. Es wiegt 1,4 Kilogramm. Eine Konserve. Darin ist nicht weniger und nicht mehr fünfhundertjährige Geistesarbeit der Menschheit eingebracht. Na ja, nicht ganz! Auch die Fäuste haben tüchtig Spuren hinterlassen. In der kirchlichen Inquisition erreicht die christliche Dogmatik ihren Höhepunkt. Es ist der Beginn vom Abschied. Der Florentiner Gelehrte Pico della Mirandola wagte die häretischen Worte zu sprechen und wurde nicht einmal hingerichtet: Gott habe den Menschen weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen geschaffen. Warum? Damit der er wie ein Former und Bildner seiner selbst nach eigenem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt ausbilden kann, die er bevorzugt. Wie sagte es Sartre: Die Existenz ist ein Entwurf. Das ist allerdings fünfhundert Jahre später. Davon ist in diesem 1,4 Kilogramm wiegenden Buch nicht mehr die Rede. Klassiker der Pädagogik von Erasmus bis Martin Buber. Eine Aufzeichnung von Vorlesungen in Marburg der Jahre 1981, 1982 und Ich kenne kein Beispiel, zu dem ich sagen könnte, dass ich so leicht und so fliessend eine ebenso geistreiche und informative Darstellung eines wichtigen Bereichs unserer kulturellen Entwicklung gelesen hätte wie bei Riemeck. Auf dem Buchdeckel finden sich zwei Abbildungen (vgl. Cover-Bild). Ein vielleicht dreissigjähriger Pädagoge sitzt umringt von interessierten Mädchen und Buben vor einem Getreidefeld und untersucht einen Halm. Die Mädchen artig gekleidet und die Haare zu Zöpfen gebunden. Ein Knabe darf mit freiem Oberkörper dasitzen. Der Lehrer ist Reichwein. Das Bild ist wohl Ende der zwanziger, Anfang der dreissiger Jahre entstanden. Eine wunderschöne Idylle. Was wurde aus diesen jungen Menschen? Der aufkommende Nationalsozialismus muss schon spürbar gewesen sein. Das zweite Bild zeigt Amos Comenius in langem Umhang und dicker Mütze, der mit dem Zeigefinger in die Richtung eines Buben weist. Es ist die Geste einer Belehrung. Der Meister unterrichtet den Zögling. Die Begegnung ist vor der Stadt in die Landschaft gesetzt. Die Sonne strahlt von der Ecke rechts oben am Hinterkopf des Lehrers vorbei zum Knaben. Der Lehrer ist der Vermittler des Wissens, doch er tut dies im Bewusstsein um eine universale Lenkung. Die beiden Bilder symbolisieren den Ausgangspunkt und das vorläufige Ende. Die Darstellungen der in diesem Buch angeführten Pädagogen zusammen mit den ausgewählten Quellentexten zeichnen ein umfassendes Bild der Aufklärung mit ihren Implikationen für die Pädagogik. In den wenigen Zeilen, welche diesem Text zugestanden sind, macht es kaum Sinn, den Inhalt zusammenfassen zu wollen. Ich beschränke mich daher auf die Darstellung weniger subjektiver Eindrücke und Einsichten. Die Aufklärung leistete die Reformation der kirchlichen und der weltlichen Herrschaftsverhältnisse. Damit verbunden ist auch das Menschenbild. Wenn der Mensch also sein Leben nach seinem Willen gestalten soll, stellt sich die Frage, was er dazu benötigt. Welches sind die Inhalte, in denen der heranwachsende Mensch unterrichtet werden soll und wie soll dies angestellt werden? Die frommen Pietisten, welche ja bereits im reformierten Glauben lebten, erzogen ihre Kinder zu Demut und Untertänigkeit im Glauben. Damit stützten sie, ohne dies zu wollen, die alten Herrschaftsstrukturen. Wichtiger und schwieriger ist die Frage nach der grundlegenden Orientierung des Menschen. Wenn also Gott als allwisssende und fordernde Instanz wegfällt, wenn das diesseitige Leben kein jenseitiges mehr kennt, woran soll man sich dann halten? Kann es eine diesseitige Orientierung überhaupt geben? Zumeist lässt sich bei den beschriebenen Pädagogen viele haben Theologie studiert eine starke Orientierung am Glauben oder an einer idealistischen Weltvorstellung ausmachen. Ohne Spiritualität kann man keine Pädagogik betreiben, meint Rudolf Steiner. Riemeck stellt zu Beginn der Ausführungen über Rousseau die Antworten der Philosophen, welche in den Begriffen Empirismus, Rationalismus, Deismus und Eudämonismus erfasst sind. Heute wissen wir, dass alle diese Ismen keine verlässlichen Führer sind. Viele unserer Zeitgenossen denken, dass die durch die Aufklärung gewonnene Freiheit in neue Zwänge geführt habe: Erfolgszwang, Selbstdarstellungszwang, Gesundheitswahn, Gier usw. Riemeck zitiert Martin Buber: Aber der Gegenpol von Zwang ist nicht Freiheit, sondern Verbundenheit. Wie lässt sich die Idee Bubers ins politische Geschehen des 21. Jahrhunderts übertragen? Die Menschen leben in Gemeinschaften. Das geht nicht ohne Verbindlichkeiten. Die Regeln müssen immer wieder neu ausgehandelt werden. Ganz verschiedene Lösungen existieren nebeneinander. Dies muss ausgehalten werden. Es gibt dazu keine Alternative. Das ist der Urgedanke einer liberalen Einstellung. So kann es auch nicht die Schule geben! Die Wirtschaftsredaktorin der Zeitschrift Die Zeit, Kerstin Bund, tingelt derzeit durch das deutschsprachige Europa und stellt ihr Buch über die Generation der nach 1980 Geborenen mit dem Titel Glück schlägt Geld vor. Die Geschichte der pädagogischen Klassiker endet bei Riemeck Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte geht weiter. 9
10 Die unerschöpflichen Quellen des Ursprünglichen. v o n S u s a n n e W i l d h i r t Eine Entdeckungsgeschichte des Zahlenraums. Martin Wagenschein schreibt 1968 (Verstehen lehren, S. 52f): Niemand weiß, ob wir in fünfzig Jahren das wäre bald...in unseren Breiten überhaupt noch kopfschütteln oder lächeln werden. Wenn ja, dann gewiss auch über eine Schule, die glaubte, durch Anhäufung von halbverstandener und verabsolutierter Wissensergebnisse irgend etwas retten zu können. Mut zur Lücke?, sagten wir anfangs, leicht missverständlich. Wir meinten: Mut zur Gründlichkeit, Mut zum Ursprünglichen. An die Stelle des Idols der breiten und statischen Vollständigkeit, die uns ängstlich Vorratskammern füllen lässt, suchen wir offenbar etwas Neues, einen entschlossenen Durchbruch zu den Quellen. Nicht Vollständigkeit der letzten Ergebnisse, sondern die Unerschöpflichkeit des Ursprünglichen. Die Stoffhuberei der Lehrpläne in der Wagenscheinära ist längst ersetzt durch Kompetenzen, Teilkompetenzen, Kompetenzaspekte und -niveaus. Unübersichtlich ist der Haufen dessen immer noch, was in der Schule geschehen soll. Neben der Welt der Phänomene existiert die Wissenschaftswelt die Welt der Zeichen, Symbole und komplexen Theorien. Doch längst sind wir in der Wagenschein noch unbekannten dritten Welt der Virtualität angekommen. Was ist gemeint mit der Unerschöpflichkeit des Ursprünglichen? Es ist die Frage danach, wie Ursprüngliches schöpferisch werden kann. Wagenschein hat Geschichten gesammelt, Geschichten von Kindern auf dem Wege zur Physik. Ich begann, Bildungserlebnisse zu sammeln auch eigene. Ein Beispiel: Ich war viereinhalb Jahre alt, als ich auf eindrückliche Weise Mathematik erleben durfte. In unserer Nachbarschaft wohnte der Mathematikstudent Michael. Daraufhin befragt, was Mathematik denn sei, antwortete er eines Abends beim Nachhausegehen ich erinnere genau den Wortlaut: Deine Schwester geht doch schon zur Schule. Dort hat sie Rechnen. Klar, dachte ich, und sah vor mir die Hefte mit den vorgegebenen Karos und der Ansammlung von Zahlen und Zeichen. Ja, meinte ich oberschlau, ich kann auch schon zählen. Er: Also los. Wir setzten uns auf die Treppenstufen vor dem Haus. Ich begann zu zählen. Zunächst: Achtzehn, Neunzehn, Zwanzig. Michael nickte. Ein und Zwanzig? (wieder Nicken, aufmerksames Zuhören bis Neunundneunzig). Dann: Hun-dert? Wieder nickte er. Hundert -Eins? Er nickte, ich zählte weiter bis Hundertneunundneunzig, während die Sonne unterging. Schließlich kam ich an bei Neunhundertneunundneunzig, mein Mund war längst trocken. Es klang wie ein Punkt. Doch er half, den Kopf seitlich auf den Arm gestützt, weiter: Tausend. Ich blickte ihn groß an, das Wort hatte ich schon gehört. Aber er schwieg, schaute erwartungsvoll. Ich also: Tausend und Eiiins? Er nickte, und als ich weiterfuhr mit: Tausendundzwei, Tausendunddrei,, bildete sich der verrückte Verdacht in mir, dies alles höre niemals auf, wir würden die ganze Nacht so sitzen, ich würde immer weiterzählen, Michael würde immerzu nicken. Mir schauderte! Irgendwo bei Tausenddreihundertetwas beendete Michael meine allererste Mathematiklektion mit den Worten: Siehst du, das studiere ich. Mit dem sicheren Gefühl, dass die Zahlen niemals enden würden, trollte ich mich nach Hause ich war fasziniert! Dies war mein erstes echtes Bildungserlebnis, das ich erinnere. Es folgte kein weiteres in Mathematik während meiner Schulzeit und selten eines in anderen Fachgebieten. Jenes wurde aus meinem Alltag herausgehoben, weil Zeit und Raum war für meine Frage und Michaels noch bessere Antwort. Er gab keine kindgemäss formulierte Definition. Stattdessen ein Lächeln, das mich herausforderte und weiterdenken ließ, das anknüpfte an meinem eigenen kleinen Erleben und meinem noch kleineren Verständnis. Es ließ mich baden im Phänomen, machte mir Mut, dranzubleiben. So führte er mich aufmerksam und vertrauensvoll zur schwindelerregenden Entdeckung des Nichtabbrechens der Folge natürlicher Zahlen. Mein Gott, ich hab den Zahlenraum entdeckt. Denke ich heute an das Ereignis, so ist im Ausnahmezustand dieser Stunde mein Interesse für Bildung entstanden, das später zum Beruf werden sollte. Kindern und Jugendlichen sollte es ermöglicht werden, in der Schule immer einmal wieder in rund Stunden ein Bildungsereignis zu erleben, das unter die Haut geht. Wagenschein schreibt (Verstehen lehren, S. 41f): Aufregend ist diese Erfahrung, nicht nur interessant. Heimisch werden muss man in einer Sache, bis sie sich so offenbart; leuchtend wird diese Erfahrung dann, (...) sie erhellt, und zwar plötzlich wie jedes entscheidendes geistige Geschehen, sofern ihm die Geduld vorausging (...). Es füllt einen größeren Raum, nicht des Faches, sondern in unserem Denken, ja im Raume unseres Lebens. Wir haben hier also den seltenen und schon übergeordneten Fall, dass das Ganze der geistigen Welt und das Ganze der Person von einer solchen fundamentalen Erfahrung ergriffen wurde. Das ist die Auslösung eines Bildungs -Prozesses. Denke ich heute an das Ereignis, so ist im Ausnahmezustand dieser Stunde oder gar Stunden mein Interesse für Bildung entstanden, das später zum Beruf werden sollte. Kindern und Jugendlichen sollte es ermöglicht werden, in der Schule immer einmal wieder in rund (!) Stunden ein Bildungsereignis zu erleben, das unter die Haut geht. Aus den unerschöpflichen Quellen des Ursprünglichen schöpft die Lehrkunstdidaktik ihre Themen, die sie in Aufgaben verwandelt, die aus der Quelle selber stammen. AUS DEN QUELLEN Wagenschein, Martin (2008): Verstehen lehren. Genetisch Sokratisch Exemplarisch. Beltz. Weinheim und Basel. [Erstausgabe: 1968] Wagenschein, Martin (2010) Kinder auf dem Wege zur Physik. Beltz. Weinheim und Basel. (Erstausgabe:
11 Ein (Selbst-)kritischer Rückblick auf den Kongress in Bregenz vom bis Reinhard Kahl und das Archiv der Zukunft (AdZ) hatten ins Festspielhaus nach Bregenz eingeladen. Über 1000 Besucher folgten dem Ruf, um in 116 Vorträgen, Beibooten, Exkursionen, Foren und Workshops frische Kraft zu schöpfen.ein Markt der Möglichkeiten Kirchentagsstimmung! Dieser Kongress tanzte und wir tanzten mit zur kunterbunten Musik des hervorragenden BourbonStreetOrchestra aus Mainz. Dem samstagabendlichen Fest ging ein allerdings anstrengender und vollgestopfter Tag voraus. Die Lehrkunst war mit einem siebenstimmigen Vortrag, einem reich frequentierten Büchertisch und fünf Workshops auf dem Kongress erschienen. Unser Vortrag trug den Titel: Lehrkunst Durch Verstehen zur Bildung mit Wagenschein. Immerhin hatte Reinhard Kahl uns gebeten, Wagenschein auf dem Kongress zu repräsentieren. Es lockten aber weitere 13 Parallelangebote, keine leichte Aufgabe. Arithmetisch betrachtet hätten rund 80 Zuhörer anwesend sein sollen. Im kommentierten, 80-seitigen Programmheft findet sich der Vortrag allerdings unter der Überschrift: Gruppe Lehrkunst Lehrstückunterricht. Das klingt reichlich unattraktiv! Die Ankündigung wirkt in manchen Passagen ein bisschen ideologieverdächtig, wenn man beispielsweise liest, die Lehrkunst stünde für guten Unterricht. Aha! Diesen Erläuterungstext hatten wir allerdings selbst eingereicht. Hierin besteht Verbesserungspotenzial: schmissigere, angemessenere Titel, früheres Versenden der Beiträge, keine elitären Behauptungen. Ich zählte dennoch 24 Zuhörer, die anschliessend ausgiebig klatschten. Der Vortrag selbst war inhaltlich bereichernd und die Rückmeldungen dementsprechend ermutigend gut. Das Material zum Vortrag kann man auf der Homepage lehrkunst.ch nachlesen. Direkt anschliessend ging es weiter mit Faradays Kerze parallel zu Mario Gerwigs Beweisen verstehen und weiteren 16 Angeboten. Mit 30 Anwesenden solle ich rechnen, hiess es im Vorfeld, wir seien ja nicht allzu sehr bekannt. Aber eben: Neun! 9! darunter sechs Lehrerinnen und Lehrer! Die Teilnehmer/-innen waren jedoch voll dabei, und der Workshop war wirklich schön. Weil ich anschliessend ein paar Unterlagen verschickt habe, erfuhr ich kurz vor Weihnachten mehr: Alle sechs haben Die Kerze im Winter in ihren Unterricht gebracht. Eigentlich sollte man stolz sein. Anschliessend war Walsers Spaziergang dran. Stephan Schmidlin hatte recht regen Zulauf, blieb aber der Sollmarke (60:18) deutlich fern. Zuletzt traten Hans Aeschlimann und Werner Meier mit dem Alpstein (18 Teilnehmer) neben Hans Christoph Berg mit Marc Eyer an, die immerhin 30 Personen gewinnen konnten. Kahl und sein Filmteam schauten irgendwann auch einmal hier beim Barometer mit Wagenschein im Gespräch mit den Klassikern vorbei. Das Thema zog vermutlich wegen der Klassiker. Wir spielten nicht auf der Haupttribüne, nicht auf der Hinterbühne, auch nicht auf der Seitenbühne 1 oder 2, sondern nur auf der Seebühne und ihren Nachbarn. Jürgen Oelkers, letztes Mal noch auf der prominenten Hinterbühne, hatte es nicht mehr zum Hauptvortrag ge- Treff- Punkt Orte und Horizonte Bildung braucht Gesellschaft v o n S u s a n n e W i l d h i r t Drei Eindrücke aus Bregenz: Orchesters, Vortrag, Büchertisch schafft der Hentig-Skandal und seine von-hentig- Schimpfe sind ja auch nicht mehr so zeitgemäss. Peter Hübner erging es ebenso. Ort ihrer Verbannung: Vorarlbergmuseum, Vortragssaal 2. Die Lehrkunst hingegen hatte keinen Grund zum Meckern, sondern war dieses Mal sehr gut dran: kurze Wege, zentrale Lage und ein exponierter Büchertisch ganz vorn am Treppenaufgang. Eigentlich kamen alle bei uns vorbei. Wir haben, im Gegensatz zu David Precht, so viele Bücher verkauft wie nie zuvor. Bislang sind rund 50 Rückmeldungen zum Kongress auf der Homepage des AdZ nachzulesen. Michael Jänichen und ich haben uns verhalten geäussert. Bei den meisten Rückmeldungen überwiegt das dicke Lob, an dem auch unsere Bregenzer Trouvaille Ernst Peter Fischer (s. Lehrkunstblitze S.3) nicht spart. Die Veranstalter haben den Kongress selbstkritisch und professionell ausgewertet. Beispielsweise kommt man zum berechtigten Schluss, die Vertretungen der Bildungspolitik zukünftig stärker einzubeziehen. Die bildungspolitische Verantwortliche der Stadt Bregenz wusste im Vorfeld gar nichts vom Kongress. Sie wäre gern gekommen. Stattdessen las sie in der darauffolgenden Woche einen unsäglichen Artikel in der Tageszeitung taz. Die Lehrkunst muss, um ansschlussfähig zu sein, zukünftig genauer klären, was Schülerinnen und Schüler in den Lehrstücken alles lernen können. Das AdZ muss den sachlichen Dialog nach Aussen stärker suchen, sonst degeneriert der Kongress zum Fundi-Treff. 11
12 Rätsel Verfassen Sie eine Kürzestgeschichte, in der die drei Lösungsworte enthalten sind. Die Gewinner erhalten eine Lehrkunstpublikation. 1. Neuerdings bezeichnet Willi Eugster Lehrstücke als kleines Ein Gewordenes als Werdendes entdecken bezeichnet eine Lehrweise. 3. Wissen ist Macht ersetzt Martin Wagenschein durch eine andere Formel. Sie lautet... Cartoon IMPRESSUM Erscheint mehrmals jährlich, An-/Abmeldung unter Herausgeber Michael Jänichen, Florastrasse 24, CH-3005 Bern Redaktion Mario Gerwig, Michael Jänichen, Stephan Schmidlin, Susanne Wildhirt Schlussredaktion Michael Jänichen, Susanne Wildhirt Graphik Einsendeschluss: an Comic Dorthe Landschulz Kontakt Lehrkunstdidaktik ist Unterricht in Gestalt von Lehrstücken. Lehrstücke sind durchkomponierte, mehrfach erprobte, immer wieder variierte und weiterentwickelteunterrichts einheiten zu «Sternstunden der Menschheit» oder «epochenübergreifenden Menschheitsthemen». Im Lehrstückunterricht sollen die SchülerInnen nachvollziehen, wie Wissenschaftler/-innen oder Kulturpersönlichkeiten in ihrer Zeit neue Erkenntnisse gewonnen und wesentliche Entdeckungen gemacht haben. Lehrkunstdidaktik konzentriert sich auf die Verdichtung schulischer Lernprozesse zu Bildungsprozessen. Lehrstückunterricht orientiert sich an einertraditionslinie, die von Comenius «Didactica Magna» über Diesterweg, Willmann und Reichwein zum eigen tlichen Vater der Lehrkunstdidaktik führt, zu Martin Wagenschein. In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Lehrkunstdidaktik unter der Ägide von Hans Christoph Berg mit Wolfgang Klafki und Theodor Schulze weiterentwickelt, ist heute weit verbreitet und kommt von der Primarschule bis zur Sekundarstufe 2 zum Zug. Der Verein Lehrkunst.ch engagiert sich für die Entwicklung und Verbreitung von Lehrstückunterricht. Methodentrias Wesentlich für die Lehrkunstdidaktik ist die auf Wagenschein basierende Methodentrias «exemplarisch genetisch dramaturgisch»: Exemplarisch Eine Sternstunde der Menschheit kennenlernen Die Lernenden erklettern einen Erkenntnisgipfel unter behutsamer Führung und erfahren dabei das Gebirge und das Klettern, Inhalt samt Methode. Genetisch Ein Gewordenes als Werdendes entdecken Die Lernenden nehmen den Ge genstand im eigenen Lern prozess wahr als Werdegang des menschheitlichen und individuellen Wissens: vom ersten Staunen bis zur eigenen Erkenntnis. Dramaturgisch Die Dramatik eines Bildungsprozesses erleben Die Lernenden ringen um die Erschliessung des Lerngegenstands und der Gegenstand ringt mit den Lernenden um seine heutige Erschliessbarkeit. Die Bücher zur Lehrkunst erscheinen im /
Studienseminar Koblenz. Wagenschein
 Studienseminar Koblenz Wagenschein Fragen zu und an Wagenschein Würden Sie wie Wagenschein unterrichten wollen / können / dürfen? Ist das guter Unterricht? Ist das ein Modell für guten Unterricht? Was
Studienseminar Koblenz Wagenschein Fragen zu und an Wagenschein Würden Sie wie Wagenschein unterrichten wollen / können / dürfen? Ist das guter Unterricht? Ist das ein Modell für guten Unterricht? Was
Datum: Erasmus+ Name: There s something new under the sun. Lösungsblatt. Die Astronomie: Die Wissenschaft der Himmelskörper und des Weltalls.
 Lösungsblatt Weißt du noch was Astronomie bedeutet? Wenn nicht, schlage in deinen Arbeitsblättern zum Thema Weltall nach und erkläre: Die Astronomie: Die Wissenschaft der Himmelskörper und des Weltalls.
Lösungsblatt Weißt du noch was Astronomie bedeutet? Wenn nicht, schlage in deinen Arbeitsblättern zum Thema Weltall nach und erkläre: Die Astronomie: Die Wissenschaft der Himmelskörper und des Weltalls.
Fachwegleitung Mathematik
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Mathematik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung 6
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Mathematik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung 6
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Soviel fürs erste, Pater Kassian. Lieber Pater Kassian Ich bin ganz Ihrer Meinung. Dass es eine Welt gibt und in dieser
 Pater Kassian, woher kommt dieser Glaube? Ein Email-Gespräch aus dem Jahr 2007 mit dem damals 78 Jahre alten Pater Kassian Etter aus dem Kloster Einsiedeln Sehr geehrter Pater Kassian Das Leben ist flüchtig,
Pater Kassian, woher kommt dieser Glaube? Ein Email-Gespräch aus dem Jahr 2007 mit dem damals 78 Jahre alten Pater Kassian Etter aus dem Kloster Einsiedeln Sehr geehrter Pater Kassian Das Leben ist flüchtig,
IIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIII
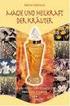 S SO TREFFEN SIE IHREN CHUTZENGEL Begegnung mit dem inneren Lehrer J ÖRG A NDRÉ Z IMMERMANN IIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIII INHALT Vorwort.............................. 9 1. KAPITEL Drei Methoden,
S SO TREFFEN SIE IHREN CHUTZENGEL Begegnung mit dem inneren Lehrer J ÖRG A NDRÉ Z IMMERMANN IIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIII INHALT Vorwort.............................. 9 1. KAPITEL Drei Methoden,
KAPITEL 1 WARUM LIEBE?
 KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
KAPITEL 1 WARUM LIEBE? Warum kann man aus Liebe leiden? Lässt uns die Liebe leiden oder leiden wir aus Liebe? Wenn man dem Glauben schenkt, was die Menschen über ihr Gefühlsleben offenbaren, gibt es offensichtlich
LehrplanPLUS Gymnasium Katholische Religionslehre Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Grundwissen/grundlegende Kompetenzen
 Gymnasium Katholische Religionslehre Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Im katholischen Religionsunterricht treten die jungen Menschen von ihren unterschiedlichen Lebenswelten her in reflektierten
Gymnasium Katholische Religionslehre Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Im katholischen Religionsunterricht treten die jungen Menschen von ihren unterschiedlichen Lebenswelten her in reflektierten
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit
 Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Als ich vier Jahre alt war, trat mein Vater, der Astronaut, seine große Reise. in eine ferne, unbekannte Welt an. Er landete auf dem Mond und war
 Als ich vier Jahre alt war, trat mein Vater, der Astronaut, seine große Reise in eine ferne, unbekannte Welt an. Er landete auf dem Mond und war von dessen Anblick dermaßen überwältigt, dass er sich augenblicklich
Als ich vier Jahre alt war, trat mein Vater, der Astronaut, seine große Reise in eine ferne, unbekannte Welt an. Er landete auf dem Mond und war von dessen Anblick dermaßen überwältigt, dass er sich augenblicklich
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Identität als Kinder Gottes Christian Hagen
 1 Liebe Gemeinde, Das Thema Angst begegnet uns immer wieder. Es stellt sich die Frage bei vielen: Wie sollten wir uns nicht fürchten vor dem, was vor uns liegt? Es gibt doch allen Grund, Angst zu haben
1 Liebe Gemeinde, Das Thema Angst begegnet uns immer wieder. Es stellt sich die Frage bei vielen: Wie sollten wir uns nicht fürchten vor dem, was vor uns liegt? Es gibt doch allen Grund, Angst zu haben
Didaktik der Geometrie und Stochastik. Michael Bürker, Uni Freiburg SS 12 D1. Allgemeine Didaktik
 Didaktik der Geometrie und Stochastik Michael Bürker, Uni Freiburg SS 12 D1. Allgemeine Didaktik 1 1.1 Literatur Lehrplan Bildungsstandards von BW Hans Schupp: Figuren und Abbildungen div Verlag Franzbecker
Didaktik der Geometrie und Stochastik Michael Bürker, Uni Freiburg SS 12 D1. Allgemeine Didaktik 1 1.1 Literatur Lehrplan Bildungsstandards von BW Hans Schupp: Figuren und Abbildungen div Verlag Franzbecker
Es gibt viele Gründe, dumm zu sein 13. /01 der Kluge sieht die Dinge, wie sie sind. Der Dumme sieht, wie sie sein könnten. 16
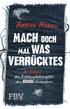 Inhalt Vorwort von Guido Corbetta 9 Es gibt viele Gründe, dumm zu sein 13 /01 der Kluge sieht die Dinge, wie sie sind. Der Dumme sieht, wie sie sein könnten. 16 /02 der Kluge kritisiert. Der Dumme lässt
Inhalt Vorwort von Guido Corbetta 9 Es gibt viele Gründe, dumm zu sein 13 /01 der Kluge sieht die Dinge, wie sie sind. Der Dumme sieht, wie sie sein könnten. 16 /02 der Kluge kritisiert. Der Dumme lässt
Es gilt das gesprochene Wort.
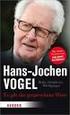 Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
KINDER, WAS FÜR EIN LEBEN!
 Das letzte Jahr der VOR SCHULE in AWO-Kitas in Hamburg KINDER, WAS FÜR EIN LEBEN! Kinder stark für die Schule, stark für das Leben Vorrangiges Ziel der AWO-Kitas ist es, für die Kinder einen erfolgreichen
Das letzte Jahr der VOR SCHULE in AWO-Kitas in Hamburg KINDER, WAS FÜR EIN LEBEN! Kinder stark für die Schule, stark für das Leben Vorrangiges Ziel der AWO-Kitas ist es, für die Kinder einen erfolgreichen
Musterlösung zur 3. Hausaufgabe - Unterrichtsanalyse -
 1) Vorkenntnisse: Musterlösung zur 3. Hausaufgabe - Unterrichtsanalyse - Im Rahmen der aktuellen Einheit wurden die folgenden Themen im Unterricht behandelt. Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal;
1) Vorkenntnisse: Musterlösung zur 3. Hausaufgabe - Unterrichtsanalyse - Im Rahmen der aktuellen Einheit wurden die folgenden Themen im Unterricht behandelt. Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal;
Walter Pohl gestorben am 21. Februar 2015
 In stillem Gedenken an Walter Pohl gestorben am 21. Februar 2015 Hope schrieb am 28. Januar 2017 um 20.26 Uhr Das Sichtbare ist vergangen, es bleibt nur die Liebe und die Erinnerung. Du fehlst... *umarm*
In stillem Gedenken an Walter Pohl gestorben am 21. Februar 2015 Hope schrieb am 28. Januar 2017 um 20.26 Uhr Das Sichtbare ist vergangen, es bleibt nur die Liebe und die Erinnerung. Du fehlst... *umarm*
Unterricht ist Kommunikation. Der Schüler entscheidet, was gelehrt wurde.
 Martin Kramer: Unterricht ist Kommunikation. Der Schüler entscheidet, was gelehrt wurde. Ein kommunikationspsychologischer Ansatz: Der Lehrer ist nicht dazu da, Wissen zu vermitteln. Seine Aufgabe besteht
Martin Kramer: Unterricht ist Kommunikation. Der Schüler entscheidet, was gelehrt wurde. Ein kommunikationspsychologischer Ansatz: Der Lehrer ist nicht dazu da, Wissen zu vermitteln. Seine Aufgabe besteht
Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung?
 8 Grundsätzliches zu Beweisen Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung? ˆ Mathematik besteht nicht (nur) aus dem Anwenden auswendig gelernter Schemata. Stattdessen
8 Grundsätzliches zu Beweisen Frage 8.3. Wozu dienen Beweise im Rahmen einer mathematischen (Lehramts-)Ausbildung? ˆ Mathematik besteht nicht (nur) aus dem Anwenden auswendig gelernter Schemata. Stattdessen
Zaubern im Mathematikunterricht
 Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences. 29. September 2016 HSD. Physik. Donec quis nunc. Quelle: Wikipedia
 Physik Donec quis nunc Quelle: Wikipedia Wie lerne ich erfolgreich? Gruppenarbeit Lernerfolg überprüfen Gegenseitig,aus dem Kopf erklären Arbeitsbelastung einteilen Schwere Fächer zuerst Wie lerne ich
Physik Donec quis nunc Quelle: Wikipedia Wie lerne ich erfolgreich? Gruppenarbeit Lernerfolg überprüfen Gegenseitig,aus dem Kopf erklären Arbeitsbelastung einteilen Schwere Fächer zuerst Wie lerne ich
Vereinfachte ZEITLEISTE DER ASTRONOMISCHEN ENTDECKUNGEN (rechte Spalte: Meilensteine der Technik, des Wissens oder der Politik)
 Vereinfachte ZEITLEISTE DER ASTRONOMISCHEN ENTDECKUNGEN (rechte Spalte: Meilensteine der Technik, des Wissens oder der Politik) Die Geschichte der Astronomie begann Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung.
Vereinfachte ZEITLEISTE DER ASTRONOMISCHEN ENTDECKUNGEN (rechte Spalte: Meilensteine der Technik, des Wissens oder der Politik) Die Geschichte der Astronomie begann Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung.
Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences. 01. Oktober 2015 HSD. Physik. Quelle: Wikipedia
 Physik Quelle: Wikipedia Wie lerne ich erfolgreich? Gruppenarbeit Lernerfolg überprüfen Gegenseitig,aus dem Kopf erklären Arbeitsbelastung einteilen Schwere Fächer zuerst Lernen Sie nie allein! Selber
Physik Quelle: Wikipedia Wie lerne ich erfolgreich? Gruppenarbeit Lernerfolg überprüfen Gegenseitig,aus dem Kopf erklären Arbeitsbelastung einteilen Schwere Fächer zuerst Lernen Sie nie allein! Selber
Weinfelder. Predigt. Als Christ in der Welt leben. Januar 2015 Nr aus Johannes 17,15-18
 Weinfelder Januar 2015 Nr. 761 Predigt Als Christ in der Welt leben aus Johannes 17,15-18 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 28.12.2014 Johannes 17,15-18 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen,
Weinfelder Januar 2015 Nr. 761 Predigt Als Christ in der Welt leben aus Johannes 17,15-18 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 28.12.2014 Johannes 17,15-18 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen,
Zur Geschichte von Primzahlen
 Zur Geschichte von Primzahlen Arithmetik => Pythagoreer: Zahlen als Weltbild Vorangegangen: Euklids Elemente (VII IX) Grundlegende Sätze über Teilbarkeit und Primzahlen: [VII, 30(gekürzt)]: Wenn eine Primzahl
Zur Geschichte von Primzahlen Arithmetik => Pythagoreer: Zahlen als Weltbild Vorangegangen: Euklids Elemente (VII IX) Grundlegende Sätze über Teilbarkeit und Primzahlen: [VII, 30(gekürzt)]: Wenn eine Primzahl
Julia Bähr und Christian Böhm, die beiden Autoren von Wer ins kalte Wasser springt, muss sich warm anziehen im Interview:
 Julia Bähr und Christian Böhm, die beiden Autoren von Wer ins kalte Wasser springt, muss sich warm anziehen im Interview: Über Liebesromane, Rollenverteilung und das Schreiben an sich Wie sind Sie auf
Julia Bähr und Christian Böhm, die beiden Autoren von Wer ins kalte Wasser springt, muss sich warm anziehen im Interview: Über Liebesromane, Rollenverteilung und das Schreiben an sich Wie sind Sie auf
Bedingungslose Liebe ist,
 Bedingungslose Liebe ist, wie die Sonne, die alle Lebewesen anstrahlt ohne jemals zu urteilen. Bedingungslos ist für den Verstand so wie der kalte Nebel, undurchsichtig, aber unser Herz vollführt diese
Bedingungslose Liebe ist, wie die Sonne, die alle Lebewesen anstrahlt ohne jemals zu urteilen. Bedingungslos ist für den Verstand so wie der kalte Nebel, undurchsichtig, aber unser Herz vollführt diese
Themenvorschläge Philosophie
 Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
MATHEMATIK. Allgemeine Bildungsziele. Richtziele. Grundkenntnisse
 MATHEMATIK Allgemeine Bildungsziele Der Mathematikunterricht vermittelt ein intellektuelles Instrumentarium, das ein vertieftes Verständnis der Mathematik, ihrer Anwendungen und der wissenschaftlichen
MATHEMATIK Allgemeine Bildungsziele Der Mathematikunterricht vermittelt ein intellektuelles Instrumentarium, das ein vertieftes Verständnis der Mathematik, ihrer Anwendungen und der wissenschaftlichen
Leseverstehen: Fichte, Novalis und Caroline Schlegel.
 Ende des 18. Jahrhunderts lebten und wirkten in Jena äußerst interessante Persönlichkeiten. Der exzellente Ruf der Universität zog Dichter und Denker, Philosophen und Naturwissenschaftler in die Stadt.
Ende des 18. Jahrhunderts lebten und wirkten in Jena äußerst interessante Persönlichkeiten. Der exzellente Ruf der Universität zog Dichter und Denker, Philosophen und Naturwissenschaftler in die Stadt.
Religionsunterricht. Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen
 Religionsunterricht Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück Abteilung Schulen und Hochschulen Domhof 2 49074 Osnabrück Tel. 0541 318351 schulabteilung@bistum-os.de
Religionsunterricht Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück Abteilung Schulen und Hochschulen Domhof 2 49074 Osnabrück Tel. 0541 318351 schulabteilung@bistum-os.de
Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse
 Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse E.Meessen/U.Minnich Die Realschule Am Stadtpark bietet das Fach Praktische Philosophie für die 5. und 6. Klasse an. Alle Kinder, die nicht am herkömmlichen
Praktische Philosophie in der 5. und 6. Klasse E.Meessen/U.Minnich Die Realschule Am Stadtpark bietet das Fach Praktische Philosophie für die 5. und 6. Klasse an. Alle Kinder, die nicht am herkömmlichen
Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft
 Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft Ist der Lehrer nicht klug, dann bleiben die Schüler dumm, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Denn Lehren heißt zweimal lernen, einmal, um es
Verleihung der Lehrerpreise der Helmholtz- Gemeinschaft Ist der Lehrer nicht klug, dann bleiben die Schüler dumm, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Denn Lehren heißt zweimal lernen, einmal, um es
Kapitel 1 Einleitung
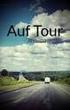 Kapitel 1 Einleitung "Die Selbstdarstellung mit sexuell wirksam eingefügtem Text kann Ihnen ein Leben voller Glück, Liebe und Sex bescheren. So, habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit? Gut. Denn die nachfolgenden
Kapitel 1 Einleitung "Die Selbstdarstellung mit sexuell wirksam eingefügtem Text kann Ihnen ein Leben voller Glück, Liebe und Sex bescheren. So, habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit? Gut. Denn die nachfolgenden
Gottesbeweise Universum Warum sind nicht alle Menschen von der Existenz Gottes überzeugt?
 Gottesbeweise Warum sind nicht alle Menschen von der Existenz Gottes überzeugt? Ich begegne Menschen, die von der Existenz Gottes überzeugt sind. Andere können keinen Gott erkennen. Wer hat Recht? Es müsste
Gottesbeweise Warum sind nicht alle Menschen von der Existenz Gottes überzeugt? Ich begegne Menschen, die von der Existenz Gottes überzeugt sind. Andere können keinen Gott erkennen. Wer hat Recht? Es müsste
Mathematische Bildung als ganzheitlicher Prozess. Jugend verliehen<
 >Damit der Mensch zur Menschenwürde gebildet werden könne, hat ihm Gott die Jahre der Jugend verliehen< Diesen Spruch von Jan Amos Comenius (1592-1670) bestätigt die moderne Hirnforschung nachdrücklich
>Damit der Mensch zur Menschenwürde gebildet werden könne, hat ihm Gott die Jahre der Jugend verliehen< Diesen Spruch von Jan Amos Comenius (1592-1670) bestätigt die moderne Hirnforschung nachdrücklich
Hackenbusch und Spieltheorie
 Hackenbusch und Spieltheorie Was sind Spiele? Definition. Ein Spiel besteht für uns aus zwei Spielern, Positionen oder Stellungen, in welchen sich das Spiel befinden kann (insbesondere eine besondere Startposition)
Hackenbusch und Spieltheorie Was sind Spiele? Definition. Ein Spiel besteht für uns aus zwei Spielern, Positionen oder Stellungen, in welchen sich das Spiel befinden kann (insbesondere eine besondere Startposition)
Bibeltexte erschließen im Religionsunterricht - ein kurzer Überblick
 Geisteswissenschaft Nicole Kandels Bibeltexte erschließen im Religionsunterricht - ein kurzer Überblick Studienarbeit Das Erschließen von Bibeltexten Warum ist die Bibel Bestandteil des Religionsunterrichts?...1
Geisteswissenschaft Nicole Kandels Bibeltexte erschließen im Religionsunterricht - ein kurzer Überblick Studienarbeit Das Erschließen von Bibeltexten Warum ist die Bibel Bestandteil des Religionsunterrichts?...1
Expertin in eigener Sache
 Expertin in eigener Sache Eine Schülerin spürt den Kompetenzen von Lehrer und Lehrerinnen nach von Ingmar Schindler Was muss ein guter Lehrer können? Wie soll er auf Schüler zu gehen? Dies sind häufig
Expertin in eigener Sache Eine Schülerin spürt den Kompetenzen von Lehrer und Lehrerinnen nach von Ingmar Schindler Was muss ein guter Lehrer können? Wie soll er auf Schüler zu gehen? Dies sind häufig
Inhalt. Das Drama Grundlagenkapitel Dramenanalyse Übungskapitel Vorwort
 Inhalt Vorwort Das Drama... 1 Grundlagenkapitel Dramenanalyse... 5 Georg Büchner: Leonce und Lena... 5 Dramenauszug 1... 6 Aufgabenstellung... 8 1 Reflexion des Szeneninhalts, Klärung der Situation...
Inhalt Vorwort Das Drama... 1 Grundlagenkapitel Dramenanalyse... 5 Georg Büchner: Leonce und Lena... 5 Dramenauszug 1... 6 Aufgabenstellung... 8 1 Reflexion des Szeneninhalts, Klärung der Situation...
Ist 1:0=1? Ein Brief - und eine Antwort 1
 Hartmut Spiegel Ist 1:0=1? Ein Brief - und eine Antwort 1 " Sehr geehrter Prof. Dr. Hartmut Spiegel! 28.2.1992 Ich heiße Nicole Richter und bin 11 Jahre. Ich gehe in die 5. Klasse. In der Mathematik finde
Hartmut Spiegel Ist 1:0=1? Ein Brief - und eine Antwort 1 " Sehr geehrter Prof. Dr. Hartmut Spiegel! 28.2.1992 Ich heiße Nicole Richter und bin 11 Jahre. Ich gehe in die 5. Klasse. In der Mathematik finde
Er fand alles grässlich. Alle Menschen fand er grässlich und war sehr unglücklich. Die Mutter wusste eigentlich gar nicht, was sie mit dem Jungen
 Er fand alles grässlich. Alle Menschen fand er grässlich und war sehr unglücklich. Die Mutter wusste eigentlich gar nicht, was sie mit dem Jungen machen sollte.«in Kopenhagen, wo der Vater Ernst als Gesandtschaftsrat
Er fand alles grässlich. Alle Menschen fand er grässlich und war sehr unglücklich. Die Mutter wusste eigentlich gar nicht, was sie mit dem Jungen machen sollte.«in Kopenhagen, wo der Vater Ernst als Gesandtschaftsrat
VIII. Tierisch kultiviert Menschliches Verhalten zwischen
 Vorwort Den Abend des 9. November 1989 verbrachte ich in meinem WG-Zimmer in West-Berlin und lernte Statistik (für Kenner: Ich bemühte mich, den T-Test zu verstehen). Kann man sich etwas Blöderes vorstellen?
Vorwort Den Abend des 9. November 1989 verbrachte ich in meinem WG-Zimmer in West-Berlin und lernte Statistik (für Kenner: Ich bemühte mich, den T-Test zu verstehen). Kann man sich etwas Blöderes vorstellen?
Name des Autors: CSEH GABRIELLA. Titel der Stunde / des Moduls: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER DER VERKÄUFER UND DER ELCH
 Name des Autors: CSEH GABRIELLA Titel der Stunde / des Moduls: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER DER VERKÄUFER UND DER ELCH 1. Inhalte der Stunde kurze Vorstellung des Themas; Begründung zur Wahl der
Name des Autors: CSEH GABRIELLA Titel der Stunde / des Moduls: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER DER VERKÄUFER UND DER ELCH 1. Inhalte der Stunde kurze Vorstellung des Themas; Begründung zur Wahl der
Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt.
 03 Projektpräsentation Focus Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt. meta 01 Medien GmbH office@meta.at meta 01 Medien GmbH Mariahilferstrasse
03 Projektpräsentation Focus Eine gute Präsentation ist die halbe Miete. Wir haben Ihnen ein paar Tipps aus unserer Erfahrung zusammengestellt. meta 01 Medien GmbH office@meta.at meta 01 Medien GmbH Mariahilferstrasse
um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben
 MAJA SCHWEIZER LEBEN. um sterben zu können? STERBEN um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben Maja Schweizer Leben, um sterben zu können?
MAJA SCHWEIZER LEBEN. um sterben zu können? STERBEN um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben Maja Schweizer Leben, um sterben zu können?
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Die Arche Noah. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die Arche Noah Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Die Arche Noah Gottes neuer Bund mit den Menschen Unterrichtseinheit
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die Arche Noah Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Die Arche Noah Gottes neuer Bund mit den Menschen Unterrichtseinheit
Lesung zu Steinhöfels neuem Buch Anders
 Anfang Oktober ist Anders das neue Buch von Andreas Steinhöfel erschienen. Am 7. November 2014 stellte er seine neuste Geschichte im Theater in der Parkaue in Berlin-Lichtenberg vor. Den einleitenden Worten
Anfang Oktober ist Anders das neue Buch von Andreas Steinhöfel erschienen. Am 7. November 2014 stellte er seine neuste Geschichte im Theater in der Parkaue in Berlin-Lichtenberg vor. Den einleitenden Worten
Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren
 Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren Was ändert sich in Ihrem Religionsunterricht mit Einführung des LehrplanPlus?» vieles?» etwas?» nichts? Kompetenz Vermittlungsdidaktik Input wissen
Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren Was ändert sich in Ihrem Religionsunterricht mit Einführung des LehrplanPlus?» vieles?» etwas?» nichts? Kompetenz Vermittlungsdidaktik Input wissen
Station Figurierte Zahlen Teil 3. Arbeitsheft. Teilnehmercode
 Station Figurierte Zahlen Teil 3 Arbeitsheft Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Figurierte Zahlen Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon die alten Griechen haben Zahlen mit Hilfe von Zählsteinen dargestellt:
Station Figurierte Zahlen Teil 3 Arbeitsheft Teilnehmercode Mathematik-Labor Station Figurierte Zahlen Liebe Schülerinnen und Schüler! Schon die alten Griechen haben Zahlen mit Hilfe von Zählsteinen dargestellt:
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II
 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Nach dem Tod das Leben Predigt zu Joh 5,24-29 (Ewigkeitssonntag 2015)
 Nach dem Tod das Leben Predigt zu Joh 5,24-29 (Ewigkeitssonntag 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, erst kommt das Leben, und
Nach dem Tod das Leben Predigt zu Joh 5,24-29 (Ewigkeitssonntag 2015) Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, erst kommt das Leben, und
Roberto Trotta Alles über das All erzählt in 1000 einfachen Wörtern
 Unverkäufliche Leseprobe Roberto Trotta Alles über das All erzählt in 1000 einfachen Wörtern 125 Seiten mit 8 Illustrationen. Gebunden ISBN: 978-3-406-68166-0 Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.chbeck.de/14840787
Unverkäufliche Leseprobe Roberto Trotta Alles über das All erzählt in 1000 einfachen Wörtern 125 Seiten mit 8 Illustrationen. Gebunden ISBN: 978-3-406-68166-0 Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.chbeck.de/14840787
captura - Schule Zukunft Mensch Zitate und Sprüche gesammelt aus den ersten vier Jahren der captura Initiative
 captura - Zitate und Sprüche gesammelt aus den ersten vier Jahren der captura Initiative In dieser Zusammenstellung finden sich einige Zitate und Sprüche, die uns im Laufe unserer Arbeit immer wieder begleitet
captura - Zitate und Sprüche gesammelt aus den ersten vier Jahren der captura Initiative In dieser Zusammenstellung finden sich einige Zitate und Sprüche, die uns im Laufe unserer Arbeit immer wieder begleitet
Die Sehnsucht des kleinen Sterns wurde grösser und grösser und so sagte er zu seiner Mutter: Mama, ich mache mich auf den Weg, um die Farben zu
 Es war einmal ein kleiner Stern. Er war gesund und munter, hatte viele gute Freunde und eine liebe Familie, aber glücklich war er nicht. Ihm fehlte etwas. Nämlich die Farben. Bei ihm zu Hause gab es nur
Es war einmal ein kleiner Stern. Er war gesund und munter, hatte viele gute Freunde und eine liebe Familie, aber glücklich war er nicht. Ihm fehlte etwas. Nämlich die Farben. Bei ihm zu Hause gab es nur
24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN
 24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN x 2 = 0+x 2 = ( a+a)+x 2 = a+(a+x 2 ) = a+(a+x 1 ) = ( a+a)+x 1 = x 1. Daraus folgt dann, wegen x 1 = x 2 die Eindeutigkeit. Im zweiten Fall kann man für a 0 schreiben
24 KAPITEL 2. REELLE UND KOMPLEXE ZAHLEN x 2 = 0+x 2 = ( a+a)+x 2 = a+(a+x 2 ) = a+(a+x 1 ) = ( a+a)+x 1 = x 1. Daraus folgt dann, wegen x 1 = x 2 die Eindeutigkeit. Im zweiten Fall kann man für a 0 schreiben
Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3
 1 Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3 SU-1: Didaktik des Einführung in die grundlegenden Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen der Didaktik des Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den
1 Modulverzeichnis Sachunterricht Anlage 3 SU-1: Didaktik des Einführung in die grundlegenden Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen der Didaktik des Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den
KAPITEL 1. Rapport. * aus Wikipedia. Der Unterschied zwischen einem hochgradig einflussreichen Menschen und einem arbeitslosen Bankkaufmann?
 Tom Big Al Schreiter KAPITEL 1 Rapport Rapport (aus dem Französischen für Beziehung, Verbindung ) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung,
Tom Big Al Schreiter KAPITEL 1 Rapport Rapport (aus dem Französischen für Beziehung, Verbindung ) bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer Aufmerksamkeit getragene Beziehung,
Experimente im Wald Erfahrungs- und Lernbereich Natur Claudia Genser
 Experimente im Wald Erfahrungs- und Lernbereich Natur Claudia Genser Claudia Genser, 2012 1 Experimente im Wald Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen, sondern
Experimente im Wald Erfahrungs- und Lernbereich Natur Claudia Genser Claudia Genser, 2012 1 Experimente im Wald Die Menschen müssen so viel wie möglich ihre Weisheit nicht aus Büchern schöpfen, sondern
MatheBuch. Was zeichnet MatheBuch aus? Leitfaden. Übersichtlicher Aufbau. Schülergerechte Sprache. Innere Differenzierung. Zeitgemäße Arbeitsformen
 Was zeichnet MatheBuch aus? Übersichtlicher Aufbau Jedes Kapitel besteht aus einem Basis- und einem Übungsteil. Im Basisteil wird die Theorie an Hand von durchgerechneten Beispielen entwickelt. Die Theorie
Was zeichnet MatheBuch aus? Übersichtlicher Aufbau Jedes Kapitel besteht aus einem Basis- und einem Übungsteil. Im Basisteil wird die Theorie an Hand von durchgerechneten Beispielen entwickelt. Die Theorie
B.A. Geschichte der Naturwissenschaften Ergänzungsfach
 B.A. Geschichte der Naturwissenschaften Ergänzungsfach Modulbeschreibungen GdN I Geschichte der Naturwissenschaften I Häufigkeit des Angebots (Zyklus) Jedes zweite Studienjahr 1 Vorlesung (2 SWS) 1 Übung
B.A. Geschichte der Naturwissenschaften Ergänzungsfach Modulbeschreibungen GdN I Geschichte der Naturwissenschaften I Häufigkeit des Angebots (Zyklus) Jedes zweite Studienjahr 1 Vorlesung (2 SWS) 1 Übung
Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher. Am Beispiel des Landes Baden-Württemberg
 Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher Am Beispiel des Landes Baden-Württemberg Worum geht s? Jedes Bundesland hat eigene Bildungs- und Lehrpläne.
Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher Am Beispiel des Landes Baden-Württemberg Worum geht s? Jedes Bundesland hat eigene Bildungs- und Lehrpläne.
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
DAVID: und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen.
 Manuskript Deutschland ist auch als das Land der Dichter und Denker bekannt. David und Nina möchten herausfinden, was die Deutschen gerne lesen und wie viel sie lesen. Und sie testen das dichterische Talent
Manuskript Deutschland ist auch als das Land der Dichter und Denker bekannt. David und Nina möchten herausfinden, was die Deutschen gerne lesen und wie viel sie lesen. Und sie testen das dichterische Talent
Mit Kindern über den Glauben reden - Einführung
 Mit Kindern über den Glauben reden - Einführung Auf der Suche nach Antworten auf religiöse Fragen unserer Kinder das ist der rote Faden, der sich durch unsere vier Abende zieht. Unser Kind fragt uns also
Mit Kindern über den Glauben reden - Einführung Auf der Suche nach Antworten auf religiöse Fragen unserer Kinder das ist der rote Faden, der sich durch unsere vier Abende zieht. Unser Kind fragt uns also
I. Der Auftakt der Romantik
 I. Der Auftakt der Romantik Das Zeitalter der Romantik Jugend, Lebenskraft, ein großzügiges Bekenntnis zur Kunst, übertriebene Leidenschaften. Begleitet von Erregung, Irrtümern und Übertreibung eine an
I. Der Auftakt der Romantik Das Zeitalter der Romantik Jugend, Lebenskraft, ein großzügiges Bekenntnis zur Kunst, übertriebene Leidenschaften. Begleitet von Erregung, Irrtümern und Übertreibung eine an
Kritik der Pädagogik Martin Wagenscheins
 Alexander Engelbrecht Kritik der Pädagogik Martin Wagenscheins Eine Reflexion seines Beitrages zur Didaktik LIT Inhaltsverzeichnis 1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit 9 Teil I: Grundlegung: Darstellung
Alexander Engelbrecht Kritik der Pädagogik Martin Wagenscheins Eine Reflexion seines Beitrages zur Didaktik LIT Inhaltsverzeichnis 1. Fragestellung und Aufbau der Arbeit 9 Teil I: Grundlegung: Darstellung
Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen?
 Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
Prof. Dr. Uwe Hericks Institut für Schulpädagogik Wie werden Lehrerinnen und Lehrer professionell und was kann Lehrerbildung dazu beitragen? Vortrag im Rahmen des Studium Generale Bildung im Wandel am
Predigt Lesejahr C LK 5,1-11
 Predigt Lesejahr C LK 5,1-11 Einmal im Jahr darf der Kaplan es wagen, die Predigt in Reimform vorzutragen. Total erkältet, die Nase verstopft, hab ich auf schöne Reime gehofft. Den Heiligen Geist musste
Predigt Lesejahr C LK 5,1-11 Einmal im Jahr darf der Kaplan es wagen, die Predigt in Reimform vorzutragen. Total erkältet, die Nase verstopft, hab ich auf schöne Reime gehofft. Den Heiligen Geist musste
1. Liebe(r) BegleiterIn der energetischen Praxis Wege fürs Leben...!
 Die persönlichen Zeilen... Fokussierung im Herbst Der Weg zu mehr Bewusstsein - die 7. Stufe: das spirituelle Einheitsbewusstsein Macht Lernen dumm? Der Terminkalender Und zum Schluss... 1. Liebe(r) BegleiterIn
Die persönlichen Zeilen... Fokussierung im Herbst Der Weg zu mehr Bewusstsein - die 7. Stufe: das spirituelle Einheitsbewusstsein Macht Lernen dumm? Der Terminkalender Und zum Schluss... 1. Liebe(r) BegleiterIn
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen.
 Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Einige Begriffe und Konzepte aus der Lehre Gurdjieffs.
 Einige Begriffe und Konzepte aus der Lehre Gurdjieffs 1 handelnde Personen Gregor Iwanowitsch Gurdjieff armenischer Philosoph und Tanzlehrer, starb 1949 in Paris, wo er das Institut für die harmonische
Einige Begriffe und Konzepte aus der Lehre Gurdjieffs 1 handelnde Personen Gregor Iwanowitsch Gurdjieff armenischer Philosoph und Tanzlehrer, starb 1949 in Paris, wo er das Institut für die harmonische
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Verlauf Material LEK Glossar Mediothek. Grundkurs Rhetorik Rhetorische Stilmittel kennenlernen und ihre Wirkung verstehen.
 Reihe 19 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Grundkurs Rhetorik Rhetorische Stilmittel kennenlernen und ihre Wirkung verstehen Nach einer Idee von Christine Koch-Hallas, Mannheim Rhetorik ist die
Reihe 19 S 1 Verlauf Material LEK Glossar Mediothek Grundkurs Rhetorik Rhetorische Stilmittel kennenlernen und ihre Wirkung verstehen Nach einer Idee von Christine Koch-Hallas, Mannheim Rhetorik ist die
Wie kam es zu dem Text: Aufgrund der Vermutungen zur Reise zum Mittelpunkt der Erde
 Martin Petsch Wie kam es zu dem Text: Aufgrund der Vermutungen zur Reise zum Mittelpunkt der Erde Das Gewissen der Erde Lebensmut Lebensfreude Gut ist das was man tut. Die welt Spielt eine große Rolle
Martin Petsch Wie kam es zu dem Text: Aufgrund der Vermutungen zur Reise zum Mittelpunkt der Erde Das Gewissen der Erde Lebensmut Lebensfreude Gut ist das was man tut. Die welt Spielt eine große Rolle
2 Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation in der Altenpflege
 2 Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation in der Altenpflege 2.2 Wahrnehmung: Jeder baut sich seine Welt Wahrnehmungsübungen Einzel- oder Paarübung Die Augen werden oft auch Fenster oder Spiegel der
2 Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation in der Altenpflege 2.2 Wahrnehmung: Jeder baut sich seine Welt Wahrnehmungsübungen Einzel- oder Paarübung Die Augen werden oft auch Fenster oder Spiegel der
Glauben Sie an Magie?
 Glauben Sie an Magie? Wer nicht an Magie glaubt, wird sie niemals entdecken. Roald Dahl (1916 1990) Schriftsteller Können Sie sich noch erinnern, wie Sie als Kind das Leben voller Staunen und Ehrfurcht
Glauben Sie an Magie? Wer nicht an Magie glaubt, wird sie niemals entdecken. Roald Dahl (1916 1990) Schriftsteller Können Sie sich noch erinnern, wie Sie als Kind das Leben voller Staunen und Ehrfurcht
Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus
 Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Thomas Christian Kotulla. Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt.
 Thomas Christian Kotulla Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Thomas Christian Kotulla Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Lyrik der Romantik. Reclam Lektüreschlüssel
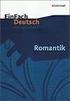 Lyrik der Romantik Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER Lyrik der Romantik Von Markus Köcher und Anna Riman Philipp Reclam jun. Stuttgart Die in diesem Lektüreschlüssel
Lyrik der Romantik Reclam Lektüreschlüssel LEKTÜRESCHLÜSSEL FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER Lyrik der Romantik Von Markus Köcher und Anna Riman Philipp Reclam jun. Stuttgart Die in diesem Lektüreschlüssel
Meine Lebenswünsche und Ziele: Den eigenen Weg finden
 : Den eigenen Weg finden 10 Lernstationen zu Jakobs Traum von der "Himmelsleiter" Sekundarstufe I, 9. Jg. Jutta Kieler-Winter, Neuburg a. d. Donau 1. Stunde - Gemeinsamer Einstieg 1. Folie mit dem Bild
: Den eigenen Weg finden 10 Lernstationen zu Jakobs Traum von der "Himmelsleiter" Sekundarstufe I, 9. Jg. Jutta Kieler-Winter, Neuburg a. d. Donau 1. Stunde - Gemeinsamer Einstieg 1. Folie mit dem Bild
Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts. Hans Dieter Sill, Universität Rostock
 Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts Hans Dieter Sill, Universität Rostock Gliederung 1. Phänomene 2. Ursachen 3. Konsequenzen 2 Phänomene Studenten, Lehrer
Zum Verhältnis der Wissenschaften Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts Hans Dieter Sill, Universität Rostock Gliederung 1. Phänomene 2. Ursachen 3. Konsequenzen 2 Phänomene Studenten, Lehrer
Die Revolution «Thema: Die Geschichte der Zeitmessung»
 Die Revolution «Thema: Die Geschichte der Zeitmessung» Weiteres Material zum Download unter www.zeitversteher.de Die Revolution Gestern, heute, morgen, Man kann die Zeit nicht borgen Text: Gregor Rottschalk
Die Revolution «Thema: Die Geschichte der Zeitmessung» Weiteres Material zum Download unter www.zeitversteher.de Die Revolution Gestern, heute, morgen, Man kann die Zeit nicht borgen Text: Gregor Rottschalk
Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln
 Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Medien Sebastian Posse Der emotionale Charakter einer musikalischen Verführung durch den Rattenfänger von Hameln Eine quellenhistorische Analyse Studienarbeit Sebastian Posse Musikwissenschaftliches Seminar
Abitursrede von 1987 von Lars Baumbusch
 Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Lars O. Baumbusch Max-Planck-Gymnasium - http://www.max-planck-gymnasium.de 77933 Lahr Beim Durchforsten meiner alten Schulunterlagen fiel mir meine Abitursrede von 1987 in die Hände. Mir war damals vom
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Textgebundene Erörterungen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Textgebundene Erörterungen schreiben im Unterricht Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Textgebundene Erörterungen
Kopiervorlage. Titel: Agnes Struktur Sprache Gestaltung. Autor: Peter Stamm. Verfasser: Merten Wolfarth. Klasse: 12.1
 www.klausschenck.de / Deutsch / Literatur / Peter Stamm: Agnes Seite 1 von 16 Kopiervorlage Titel: Agnes Struktur Sprache Gestaltung Autor: Peter Stamm Verfasser: Merten Wolfarth Klasse: 12.1 Schule Wirtschafts
www.klausschenck.de / Deutsch / Literatur / Peter Stamm: Agnes Seite 1 von 16 Kopiervorlage Titel: Agnes Struktur Sprache Gestaltung Autor: Peter Stamm Verfasser: Merten Wolfarth Klasse: 12.1 Schule Wirtschafts
Lernen und Lehren im Diversitätskontext
 Lernen und Lehren im Diversitätskontext WS 2016/17, Termin 3 Christian Kraler Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung School of Education, Universität Innsbruck Christian.Kraler@uibk.ac.at http://homepage.uibk.ac.at/~c62552
Lernen und Lehren im Diversitätskontext WS 2016/17, Termin 3 Christian Kraler Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung School of Education, Universität Innsbruck Christian.Kraler@uibk.ac.at http://homepage.uibk.ac.at/~c62552
Einführung in die Kulturwissenschaften. Einführung. Aufbau der Veranstaltung
 Prof. Dr. H. Schröder Einführung in die Kulturwissenschaften Einführung Aufbau der Veranstaltung Arbeitsweise Literatur und Quellen Kulturwissenschaft an der Viadrina Wissenschaft Verteilung der Themen
Prof. Dr. H. Schröder Einführung in die Kulturwissenschaften Einführung Aufbau der Veranstaltung Arbeitsweise Literatur und Quellen Kulturwissenschaft an der Viadrina Wissenschaft Verteilung der Themen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ZUM
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Andreas Venzke: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de ZUM
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Methoden in Politik/Sozialwissenschaften: 22 echte Praxis-Ideen für produktiveren Unterricht Das komplette Material finden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kreative Methoden in Politik/Sozialwissenschaften: 22 echte Praxis-Ideen für produktiveren Unterricht Das komplette Material finden
Das Geheimnis der Mondprinzessin - Was danach geschah.
 Das Geheimnis der Mondprinzessin - Was danach geschah. von Kitty online unter: http://www.testedich.de/quiz36/quiz/1433087099/das-geheimnis-der-mondprinzessin- Was-danach-geschah Möglich gemacht durch
Das Geheimnis der Mondprinzessin - Was danach geschah. von Kitty online unter: http://www.testedich.de/quiz36/quiz/1433087099/das-geheimnis-der-mondprinzessin- Was-danach-geschah Möglich gemacht durch
ROMANTIK. Sie war in allen Künsten und in der Philosophie präsent. Die Romantik war eine Gegenwelt zur Vernunft, also zur Aufklärung und Klassik
 ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
ROMANTIK Eine gesamteuropäische Geistes- und Kunstepoche, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts andauerte Sie war in allen Künsten und in der Philosophie
FÜREINANDER ein Kunstprojekt
 FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
FÜREINANDER ein Kunstprojekt Konzept für das Kunstprojekt der Initiative Dialog der Generationen von in Zusammenarbeit mit den Deichtorhallen Hamburg unterstützt von der Stiftung Füreinander und der stilwerk
Jürg Schubiger Bilder von Jutta Bauer. Eine ziemlich philosophische Geschichte. Verlagshaus Jacoby
 Jürg Schubiger Bilder von Jutta Bauer Eine ziemlich philosophische Geschichte Verlagshaus Jacoby Stuart Die Erzählung beginnt mit einem kleinen Mädchen, klein oder mittelgroß, etwa eins vierzig. Weitere
Jürg Schubiger Bilder von Jutta Bauer Eine ziemlich philosophische Geschichte Verlagshaus Jacoby Stuart Die Erzählung beginnt mit einem kleinen Mädchen, klein oder mittelgroß, etwa eins vierzig. Weitere
