Nicht erst seit der Aufsehen erregenden Haushaltssperre
|
|
|
- Leander Schubert
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hans Fehr, Michael Tröger Die verdeckten Verteilungswirkungen des bundesdeutschen Finanzausgleichs Was sind die Ursachen der aktuellen kommunalen Finanzkrise? Welche Aufkommensverluste stellen sich bei den Gemeinden bei einer Abschaffung der Gewerbesteuer ein? Üblicherweise werden solche Fragen im Rahmen des primären Finanzausgleichs diskutiert, der die aufkommensstärksten Steuern auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Die indirekten Verteilungswirkungen werden dabei ausgeklammert. Der vorliegende Beitrag erläutert zunächst die zentralen ökonomischen Mechanismen und quantifiziert dann die verdeckten Effekte anhand einiger ausgewählter Maßnahmen der Steuerreform. Nicht erst seit der Aufsehen erregenden Haushaltssperre der Stadt München rückt die Finanzkrise der deutschen Kommunen wieder in den Vordergrund des politischen und wissenschaftlichen Interesses. Die Parteien streiten sich im Wahlkampf heftig über die Ursachen der dramatischen Steuerausfälle und die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zugunsten der Gemeinden. Gleichzeitig legen Institute und Verbände in regelmäßigen Abständen neue Ideen zur Reform der Gemeindefinanzen vor. Im Zentrum steht die Zukunft der Gewerbesteuer. Das Spektrum der Vorschläge hierzu reicht von einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bis hin zu ihrer vollständigen Abschaffung und Ersetzung durch eine kommunale Einkommenund Gewinnsteuer. Bei der gesamten Diskussion fällt auf, dass die zentralen Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen nur unzureichend berücksichtigt werden. Denn die vertikalen Verteilungswirkungen der betrachteten Steuerreformen werden fast immer im Rahmen des so genannten primären Finanzausgleichs untersucht. Wenn etwa die Regierung die finanziellen Auswirkungen der Steuerreform 2000 für die Gemeinden zu quantifizieren versucht, dann prognostiziert sie deren Konsequenzen für die Gemeindeanteile bei der Einkommen- und Gewerbesteuer. Ebenso verweist die Opposition vor allem auf den Rückgang dieser beiden Steuern, wenn sie die Steuerreform des Jahres 2000 für den Einbruch bei den Gemeindeeinnahmen verantwortlich macht. Und schließlich glaubt auch der Prof. Dr. Hans Fehr, 40, ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Universität Würzburg; Michael Tröger, 26, Dipl.-Volkswirt, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Lehrstuhl. Wirtschaftsdienst Bundesfinanzminister, dass die Gemeinden von den Mindereinnahmen bei der Körperschaftsteuer nicht betroffen sind, wenn er mit diesem Argument eine Senkung der jüngst erhöhten Gewerbesteuerumlage ablehnt 2. Nur primärer Finanzausgleich berücksichtigt Selbst die wissenschaftlichen Studien zu den Auswirkungen der Steuerreform 2000 auf die kommunalen Haushalte beschränken sich in der Regel auf diese primäre Steuerverteilung und erwähnen höchstens die indirekten Effekte über den kommunalen Finanzverbund 3. Auch die anstehende Reform der Gewerbesteuer kann zu drastischen vertikalen und horizontalen Aufkommensverschiebungen führen. Umso erstaunlicher ist es, wenn gerade sehr weit reichende Reformvor- Vgl. dazu etwa Bundesministerium der Finanzen: Finanzielle Auswirkungen des Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung sowie der Entschließung des Bundesrates vom 4. Juli 2000 (StSenkG), Bonn. 2 Bundesministerium der Finanzen: Bundespolitik und Kommunalfinanzen, Berlin 2002, S Deutscher Städte- und Gemeindebund: Auswirkungen des Steuersenkungsgesetzes auf die Haushalte der Städte und Gemeinden, Dokumentation 2 Steuer-Reform 2000, Berlin 2000, http: // K. H o f mann, W. Scherf : Die Auswirkungen der Steuerreform 2000 auf die Gemeinden, in: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften 40 (2002), S Eine Ausnahme bildet lediglich H. K a r r enberg: Das verabschiedete Steuersenkungsgesetz und seine Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen, in: Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Nr. 0 (2000), S Er quantifiziert zwar so genannte mittelbare Mindereinnahmen, allerdings erläutert er nicht genauer, wie diese errechnet wurden. 4 So beispielsweise etwa L. S chemmel: Kommunale Steuerautonomie und Gewerbesteuerabbau, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler, Heft 94, Wiesbaden 2002 oder Bundesverband der deutschen Industrie, Verband der Chemischen Industrie: Verfassungskonforme Reform der Gewerbesteuer, Köln 200, http: // 609
2 schläge bei ihren Berechnungen den Finanzausgleich nicht einmal erwähnen 4. Andere Autoren klammern derartige Rückwirkungseffekte durch geschickte Annahmen aus. Allerdings weisen sie auf diese Problematik explizit hin, wenn sie nach Abschaffung der Gewerbesteuer die Hebesätze einer kommunalen Einkommen- und Gewinnsteuer berechnen 5. Natürlich ist durchaus verständlich, warum die oben genannten Beiträge von den Rückwirkungen durch sekundären und kommunalen Finanzausgleich abstrahieren. Der sekundäre Finanzausgleich bewirkt im Wesentlichen eine horizontale Umverteilung zwischen den Bundesländern, lediglich über die Fehlbetragsergänzungszuweisungen wird die Finanzausstattung von Bund und Ländern verändert. Der kommunale Finanzausgleich wird vor allem deshalb nicht berücksichtigt, weil sich die Regelungen bei den einzelnen Ländern zum Teil ganz beträchtlich unterscheiden und das Zusammenwirken von Länderfinanzausgleich und kommunalem Finanzausgleich überaus kompliziert ist. Trotz dieser verständlichen Überlegungen würde man zu gerne wissen, welche quantitative Bedeutung diesen vertikalen und horizontalen Finanzbeziehungen zukommt. Der vorliegende Beitrag versucht diese Frage zu beantworten, indem er die fiskalischen Konsequenzen unterschiedlicher Steuerreformen für die Gebietskörperschaften unter weitestgehender Einbeziehung des Finanzausgleichssystems untersucht. Der folgende Abschnitt skizziert zunächst die fiskalische Verzahnung von Bund, Ländern und Gemeinden und die sich daraus ergebenden föderalen Umverteilungswirkungen. Daran anschließend werden die vertikalen und horizontalen Belastungswirkungen der Steuerreform 2000 sowie einer Abschaffung der Gewerbesteuer quantifiziert. 60 Das deutsche Finanzausgleichssystem 5 C. Fuest, B. Huber: Zur Reform der Gewerbesteuer, Gutachten im Auftrag des Saarlandes, München 200, S Vgl. O.-E. Geske: Der bundesstaatliche Finanzausgleich, München 200; sowie H.-G. H enneke: Öffentliches Finanzwesen, Finanzverfassung: eine systematische Darstellung, Heidelberg 2000 für eine Diskussion des bundesdeutschen Finanzausgleichs; sowie F. Zimmermann: Das System der kommunalen Einnahmen, Köln 988 für eine Beschreibung der Besonderheiten des kommunalen Finanzausgleichs. Der deutsche Bundesstaat ist nach der Verfassung zweistufig aufgebaut. Deshalb stellen die Kommunen keine eigene staatliche Ebene dar, sondern sind aus staatsorganisationsrechtlicher Sicht Bestandteile der Länder. Da der Bund somit bis auf wenige Ausnahmen keine direkten Finanzbeziehungen zu den Kommunen unterhalten darf, werden die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern einerseits und zwischen den Ländern und ihren Kommunen andererseits streng getrennt 6. Die Grundlage für die Verteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden bildet Art. 06 GG. Im so genannten primären (vertikalen) Finanzausgleich wird jede Steuerart entweder direkt einer bestimmten Ebene zugeordnet (Bundes-, Länder- und Gemeindesteuern), oder nach festen Beteiligungsquoten auf alle drei Gebietskörperschaften verteilt (Gemeinschaftssteuern). Letztere betreffen die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer, welche zusammen fast drei Viertel der gesamten Steuererträge ausmachen. Vom Aufkommen der Lohnsteuer (einschließlich veranlagter Einkommensteuer) werden zunächst 5%, bei der Zinsabschlagsteuer 2% an die Gemeinden abgeführt. Den verbleibenden Rest teilen sich Bund und Länder je zur Hälfte. Die Körperschaftsteuer (einschließlich Kapitalertragssteuer) wird vollständig je zur Hälfte zwischen Bund und Ländern geteilt. Die Anteilssätze an der Umsatzsteuer wurden in den vergangenen Jahren durch die Einbeziehung der neuen Länder und durch die Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer häufig geändert. Seit 2000 stehen dem Bund vorab ein Anteil von 5,63% des Umsatzsteueraufkommens zur Stabilisierung der Rentenversicherung zu. Anschließend erhalten die Gemeinden 2,2% als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Den verbleibenden Rest teilen sich wieder Bund und Länder im Verhältnis 50,25: 49,75. Nachdem das Steueraufkommen der Ländergesamtheit zugewiesen wurde, erfolgt im Rahmen des primären (horizontalen) Finanzausgleichs die Aufteilung auf die einzelnen Bundesländer. Auch hier findet ein Mischsystem Anwendung. Die Ländersteuern und der Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer werden nach dem örtlichen Aufkommen, der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird dagegen zu mindestens drei Viertel nach der Einwohnerzahl verteilt. Sekundärer Finanzausgleich Der anschließende so genannte sekundäre (horizontale und vertikale) Finanzausgleich unterscheidet drei Stufen. Im Rahmen des Umsatzsteuervorwegausgleichs werden bis zu einem Viertel des Länderanteils an der Umsatzsteuer als Ergänzungsanteile an Länder vergeben, deren bisherige Steuereinnahmen je Einwohner unter 92% des Länderdurchschnitts liegen. Nach der vollständigen Verteilung des Umsatzsteueraufkommens wird im Rahmen des Länderfinanzaus- Wirtschaftsdienst
3 Tabelle Verbundquoten und Verbundgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2000/200 (in %) Land Fakultativer Steuerverbund Obligatorischer Steuerverbund GewStumlage Kfz-St 2 Grew-St 3 VSt 4 Fehlbetrag Sonder Landessteuern LFA 5 BEZ 6 Nordrhein-Westfalen 23, ,00 a Bayern,54,54 65,00 38,00 -,54 - Baden-Württemberg 23,00 23,00 23,39 55,00-23,00 - Niedersachsen 7,59/7,0-7,59/7,0 b 7,59/7,0 7,59/7,0 Hessen 22,90/23,00 22,90/23,00 22,90/23,00 22,90/23,00 22,90/23,00 22,90/23,00 - Sachsen 26,365/25,799 26,365/25,799 26,365/25,799 26,365/25,799-26,365/25,799 Rheinland-Pfalz 20,25/2,00-20,25/2,00 20,25/2,00 20,25/2,00 Sachsen-Anhalt 24,00 23,0 23,00 23,00 23,00 37,00/26,30 Schleswig-Holstein 9,00/9,78 9,00/9,78 9,00/9,78 9,00/9,78 9,00/9,78 Thüringen 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 40,00 Brandenburg 26,0/25,00 26,0/25,00 26,0/25,00 26,0/25,00 26,0/25,00 26,0/25,00 Mecklenburg-Vorpommern 27,36/26,99-27,36/26,99 27,36/26,99 27,36/26,99 40,00/26,99 Saarland 20,00-20,00 20,00 20,00 Gewerbesteuerumlage. 2 Kraftfahrzeugsteuer. 3 Grunderwerbsteuer. 4 Vermögensteuer. 5 Länderfinanzausgleich. 6 Bundesergänzungszuweisungen. a Effektiver Verbundsatz ist 3,43%, da Gemeinden nur an vier Siebtel der Grunderwerbsteuer beteiligt sind. b Vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer werden allerdings 33,0% abgeführt. Quelle: H. Karrenberg, E. Münstermann: Gemeindefinanzbericht 2000, in: Der Städtetag, 53 Jg., Heft 4; sowie Gemeindefinanzbericht 2002, in: Der Städtetag, 55 Jg., Heft 4, Finanzausgleichsgesetze der Länder. gleichs im engen Sinne die unterschiedliche Finanzausstattung der Bundesländer angeglichen. Länder, deren relative Finanzkraft unter dem Länderdurchschnitt liegt, erhalten danach Ausgleichszuweisungen aus den Ausgleichsbeiträgen der Länder, deren relative Finanzkraft über dem Länderdurchschnitt liegt. Das genaue Verfahren ist im Finanzausgleichsgesetz geregelt. Es lohnt sich aber an dieser Stelle nicht, darauf näher einzugehen. Nach Abschluss des Länderfinanzausgleichs folgen auf der letzten Stufe die Bundesergänzungszuweisungen. Einerseits unterstützt der Bund mit diesen Zahlungen diejenigen Länder, deren Finanzausstattung auch nach Abschluss des Länderfinanzausgleichs noch immer unterdurchschnittlich ist (Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen). Andererseits werden mit diesen Zahlungen spezielle Sonderlasten einzelner Länder gewürdigt (Sonder- Bundesergänzungszuweisungen). Kommunaler Finanzausgleich Damit ist der bundesstaatliche Finanzausgleich abgeschlossen. Wir wenden uns nun dem kommunalen Finanzausgleich zu, dessen verfassungsrechtliche Verankerung sich in Art. 06 Abs. 7 GG findet. Danach verpflichtet das Grundgesetz die Länder, ihren Kommunen im Rahmen eines vertikalen kommunalen Finanzausgleichs einen Anteil am Länderanteil der Wirtschaftsdienst Gemeinschaftssteuern zur Verfügung zu stellen. Diese so genannten obligatorischen Anteile des Steuerverbundes sind einer Manipulation der Länder entzogen, allerdings können die Länder ihren individuellen Anteilssatz (so genannter Verbundsatz) an der Verbundgrundlage festlegen. Tabelle zeigt die aktuellen Verbundsätze der einzelnen Länder. Neben diesen obligatorischen Bestandteilen können die einzelnen Länder in ihrem Ermessen fakultative Anteile in den Steuerverbund einfließen lassen. Das jeweilige Land bestimmt dabei völlig frei über die Art der Landeseinnahmen, den entsprechenden Verbundsatz und eine Ausweitung bzw. Verringerung der fakultativen Bestandteile der Verbundmasse. Die fakultativen Verbundanteile sind daher von Land zu Land nicht miteinander vergleichbar. Wie Tabelle zeigt, fließt in einigen Ländern ein Teil der Gewerbesteuerumlage wieder an die Gemeinden zurück. Manche Länder (Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen) berücksichtigen nur einzelne Landessteuern wie die Kfz-Steuer, die Grunderwerbsteuer oder die Vermögensteuer im fakultativen Steuerverbund, während andere Länder sämtliche Landessteuern mit einbeziehen. Bis auf Nordrhein-Westfalen beteiligen alle Bundesländer ihre Gemeinden an den Ausgleichszuweisungen bzw. beiträgen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Die Bundesländer Nie- 6
4 dersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Saarland schließlich geben einen Anteil aller vom Bund erhaltener Bundesergänzungszuweisungen an ihre Gemeinden weiter, während andere Bundesländer nur die Fehlbetrags- und/oder Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in ihrer Verbundmasse berücksichtigen. Damit sind der bundesstaatliche und der kommunale Finanzausgleich auf zweierlei Weise eng verzahnt. Erstens wird im Rahmen des primären Finanzausgleichs die Höhe des Länderanteils der Gemeinschaftssteuern festgelegt, die dann über die obligatorischen Anteile des Steuerverbundes der kommunalen Ebene zufließen. Zweitens wird in den meisten Ländern über fakultative Anteile des Steuerverbundes ein Teil der im Rahmen des Länderfinanzausgleichs empfangenen Zuweisungen bzw. geleisteten Beiträgen sowie der Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen an die Kommunen weitergeleitet. Deshalb ist es bei der nun folgenden quantitativen Analyse der Verteilungswirkungen so wichtig, das Zusammenwirken von bundesstaatlichem und kommunalem Finanzausgleich genau abzubilden. 62 Vertikale Belastungswirkungen ausgewählter Steuerreformen Ausgangspunkt für die quantitative Erfassung der Umverteilungswirkungen bilden die Steueraufkommen der Jahre 2000 und 200. Unsere Berechnungen wurden mit einem Simulationsmodell zum Länderfinanzausgleich durchgeführt, das im Vergleich zu einer früheren Version um die oben beschriebenen landesindividuellen Steuerverbünde erweitert wurde 7. Um die Bedeutung der obligatorischen und fakultativen Verbundmasse als Teil der kommunalen Finanzausgleichsmasse herauszuarbeiten, vergleicht Tabelle 2 zunächst die vertikalen Finanzbeziehungen in den beiden Betrachtungsjahren. Die Datengrundlage basiert im Wesentlichen auf den offiziellen Abrechnungen zum Länderfinanzausgleich. Bei den Bundessteuern wurden die aktuellen Angaben des Bundesfinanzministeriums verwendet. Da die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin eine Sonderstellung bilden, wurden dort die Verbundquoten auf Null gesetzt 8. Über die Angaben aus Tabelle hinaus 7 Vgl. dazu H. F ehr: Fiskalische und allokative Konsequenzen des neuen Länderfinanzausgleichs, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 8. Jg. (200), Heft 0, S Inzwischen ist das Simulationsmodell zum bundesstaatlichen Finanzausgleich auch im Internet unter verfügbar. 8 Die Besonderheiten des 7 Gemeindefinanzreformgesetz bzgl. Berlin und Hamburg werden daher zusätzlich vernachlässigt. Tabelle 2 Vertikale Finanzbeziehungen 2000 und 200 (in Mrd. DM) Veränderung absolut in % Bund 433,02 49,2-3,9-3,20 davon: Bundessteuern 47,67 55, 7,43 5,0 Anteil ESt 29,30 25,24-4,06-3, Anteil KSt 2 36,27 20,0-6,26-44,8 Anteil USt 3 43,29 4,32 -,97 -,4 GewSt-Umlage 4 2,58 2,97 (2,34) 0,39 (-0,24) 5, (-9,3) Länder 295,55 278,69-6,86-5,70 davon: Landessteuern 37,72 40,05 2,33 6,2 Anteil ESt 29,30 25,24-4,06-3, Anteil KSt 36,27 20,0-6,26-44,8 Anteil USt 26,5 24,77 -,74 -,4 GewSt-Umlage 8,33 7,90-0,43-5,2 (7,52) (-0,8) (-9,7) Fehlbetrags BEZ 5 7,23 6,34-0,89-2,3 Sonst. BEZ 8,86 8,38-0,48-2,6 Gemeinden 78,77 67,53 -,24-6,29 davon: Gemeindesteuern 6 7,30 7,80 0,5 2,9 Anteil ESt 45,3 43,59 -,54-3,4 Anteil USt 5,72 5,64-0,08 -,4 Gewerbesteuer (netto) 4,95 36,77-5,8-2,4 (37,77) (-4,8) (-0,0) OVA 7 55,99 5,58-4,4-7,9 FVA 8 2,68 2,5 (2,) -0,53-4,2 Gesamtsumme 907,34 865,34-42,00-4,63 Anteile an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Zinsabschlag. 2 Anteile an Körperschaftsteuer und nicht veranlagter Steuer vom Ertrag. 3 Umsatzsteuer. 4 Gewerbesteuerumlage. 5 Bundesergänzungszuweisungen. 6 Ohne sonstige Gemeindesteuern. 7 Obligatorische Anteile des Steuerverbundes. 8 Fakultative Anteile des Steuerverbundes. Q u e l l e : Bundesministerium der Finanzen: Finanzbericht 2003, Berlin konnten bei den Berechnungen der Verbundmasse keine weiteren länderspezifischen Regelungen über Verrechnungen, Verbundzeiträume und Korrekturmaßnahmen berücksichtigt werden. Schließlich fließen in die endgültige Finanzausgleichsmasse auch Mittel außerhalb des Steuerverbundes ein, welche hier ausgeblendet wurden. Aus diesen Gründen sind die in Tabelle 2 ausgewiesenen Verbundanteile wesentlich niedriger als die tatsächliche Finanzausgleichsmasse. Das DIW ermittelt etwa in den Jahren 2000 und 9 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Finanz- und Investitionskrise der Gemeinden erzwingt grundlegende Reform der Kommunalfinanzen, in: DIW Wochenbericht Nr. 3, 69 Jg. (2002), S Wirtschaftsdienst
5 200 Zuweisungen der Länder an die Gemeinden in Höhe von etwa 40 Mrd. Euro. Aufgrund der geringen Veränderung kann es sich hier aber nur um eine grobe Abschätzung handeln 9. In Tabelle 2 sind die vertikalen Transfers nur bei den empfangenden Gebietskörperschaften verbucht. Zählt man deshalb die Einnahmen des Bundes zusammen und subtrahiert die bei den Ländern ausgewiesenen Bundesergänzungszuweisungen, so erhält man genau die Summe der ersten Zeile. Ebenso müssen von den Landeseinnahmen die bei den Gemeinden verbuchten obligatorischen und fakultativen Verbundanteile abgezogen werden, um die Gesamteinnahmen der Länder zu erhalten. Tabelle 2 zeigt deutlich, dass die obligatorischen Anteile wesentlich höher sind als die fakultativen Anteile des Steuerverbundes. Selbst bei unserem eher konservativem Vorgehen wird mehr als ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden aus dem kommunalen Steuerverbund erzielt. Steueraufkommen der Gemeinden überproportional gesunken Tabelle 2 gibt aber auch einige erste Hinweise über die Ursachen der aktuellen kommunalen Finanzkrise. Zunächst erkennt man, dass im Jahr 200 das Steueraufkommen der Gemeinden überproportional gegenüber dem Jahr 2000 gesunken ist. Während das gesamte Steueraufkommen um 4,6% gesunken ist, haben die Gemeinden einen Einnahmeverlust in Höhe von 6,3% zu verkraften. Dies liegt im Wesentlichen am Rückgang der Gewerbesteuer (netto) und der obligatorischen Verbundanteile. Bei der Gewerbesteuer fällt auf, dass die Umlage des Bundes gegenüber dem Jahr 2000 sogar angestiegen ist. Dies liegt an der bereits eingangs angesprochenen Erhöhung der Gewerbesteuerumlage im Jahre 200, die den allgemeinen Rückgang der Gewerbesteuer für den Bund überkompensiert hat und die Einnahmeverluste der Länder zumindest abdämpft. Die Gemeinden werden aber umgekehrt doppelt getroffen. Sie erzielen ein geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer und müssen davon noch einen höheren Anteil an Bund und Länder abführen. In Klammern ist die Gewerbesteuerverteilung mit der bisherigen Umlageberechnung angegeben. Die Gemeinden hätten in diesem Falle im Jahr 200 ein zusätzliches Gewerbesteueraufkommen in Höhe von etwa Mrd. DM auf Kosten von Bund und Ländern erhalten. Tabelle 3 Belastungswirkung von Steuerreformen im Jahr 2000 (in Mrd. DM) Reduktion Einkommensteuer Reduktion Abschaffung Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Bund Primärer Finanzausgleich -4,06-6,26-2,58 Fehlbetrags BEZ 2 0,08 0,70 0,48 Länder Primärer Finanzausgleich -4,06-6,26-8,33 Fehlbetrags BEZ 2-0,08-0,70-0,48 OVA 3 0,77 3,2 0,02 FVA 4 0,08 0,47 0,94 Gemeinden Primärer Finanzausgleich -,54 0,00-4,95 OVA 3-0,77-3,2-0,02 FVA 4-0,08-0,47-0,94 Summe -9,66-32,52-52,86 Zur Vereinfachung der Darstellung wurde die Verteilung des Gewerbesteueraufkommens dem primären Finanzausgleich zugeordnet. 2 Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen. 3 Obligatorische Anteile des Steuerverbundes. 4 Fakultative Anteile des Steuerverbundes. Neben dem Absinken der Gewerbesteuereinnahmen verschlechtert aber vor allem die um 4,9 Mrd. DM reduzierte Verbundmasse die kommunale Finanzsituation. Um die genaueren Ursachen für diese Einnahmenverluste zu isolieren, unterstellen wir im Jahre 2000 bei der Einkommen- und der Körperschaftsteuer die verminderten Aufkommen des Jahres 200 und simulieren den sich so ergebenden Finanzausgleich. Die beiden ersten Spalten von Tabelle 3 enthalten die Veränderungen gegenüber dem tatsächlichen Basisjahr Insgesamt ist das Aufkommen aus Einkommensteuer und Körperschaftsteuer im Jahr 200 gegenüber dem Vorjahr um 9,66 Mrd. DM bzw. 32,52 Mrd. DM gesunken. In den Zeilen primärer Finanzausgleich ist noch einmal die bereits aus Tabelle 2 bekannte vertikale Verteilung des Aufkommensverlustes ohne Berücksichtigung des Finanzausgleichssystems wiedergegeben. Dies entspricht auch den eingangs geschilderten Überlegungen des Finanzministeriums, nach dem die Gemeinden von den Mindereinnahmen bei der Körperschaftsteuer nicht betroffen sind 0. Verdeckte Verteilungswirkungen Die veränderten Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen und Verbundanteile zeigen aber auch 0 Vgl. Bundesministerium der Finanzen: Bundespolitik und Kommunalfinanzen, a.a.o., S. 8. Wirtschaftsdienst Allerdings ist hier zu beachten, dass die zu erwartenden höheren Aufkommen bei Einkommen- und Körperschaftsteuer vernachlässigt wurden. 63
6 Tabelle 4 Horizontale Belastungsverteilung der Einkommensteuer-Mindereinnahmen (in Mill. DM) Länder Gemeinden Land PFA USt 2 LFA 3 Fehl-BEZ 4 PFA OVA 5 FVA 6 Nordrhein-Westfalen -32,95 66,3 320, ,20-288,84 0 Bayern -235,6 44,66-376, ,27-22,04-43,44 Baden-Württemberg -70,25 38,49 69, ,52-54,5 39,09 Niedersachsen -47,56 42,09-22,83-2,6-74,43-57,96-6,24 Hessen -5,8 22,24-5, ,68-29,67-34,60 Sachsen -56,67-29,35-27,30 -,5-59,7-49,05-7,20 Rheinland-Pfalz -20,28 4,8 5,58-0,40-79,37-39,58,04 Sachsen-Anhalt 46,39-56,87-40,45-6,8 4,5-26,52-0,87 Schleswig-Holstein -35,92 0,20-2,06-4,84-5,2-23,88 -,3 Thüringen 9,74 -,90-3,40-6,29,38-23,50-8,67 Brandenburg -6,5-0,99-30,23-6,68-4,60-28,32-9,63 Mecklenburg-Vorpommern -94,7 20,08-4,93-4,60-34,95-20,42-2,6 Saarland -64,95 20,26 -,72-2,77-24,02-8,94-0,89 Berlin -279,56 2,44 72,40 -,63-0, Hamburg -245,09 6,26 29,4 0-93, Bremen -24,57 2,44-9,65-2,99-9, Summe -4053, ,3-542,88-773,2-85,32 Primärer Finanzausgleich. 2 Umsatzsteuer. 3 Länderfinanzausgleich. 4 Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen. 5 Obligatorische Anteile des Steuerverbundes. 6 Fakultative Anteile des Steuerverbundes. die verdeckten Verteilungswirkungen des Finanzausgleichssystems, welche in der politischen Diskussion in der Regel vernachlässigt werden. Für die Belastungsverschiebung zwischen Bund und Ländern mag dies noch zulässig sein. Der untere Teil von Tabelle 3 macht jedoch deutlich, dass die Rückwirkungen über das Finanzausgleichssystem für die Gemeinden quantitativ durchaus beachtlich sind. So wird die Belastungswirkung der verminderten Einkommensteuer für die Gemeinden deutlich unterschätzt, wenn die Veränderungen der Steuerverbundanteile vernachlässigt werden. Durch den Rückgang der Körperschaftsteuer verlieren nun auch die Gemeinden Steueraufkommen in Höhe von 3,59 Mrd. DM. Dies entspricht etwa % der gesamten Aufkommensverminderung. Insgesamt zeigt sich, dass die Veränderungen der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer zu einem großen Teil die in Tabelle 2 beobachtete Reduktion der Finanzmasse des kommunalen Finanzausgleichs erklären. Die dritte Spalte in Tabelle 3 zeigt die vertikalen Belastungswirkungen einer Abschaffung der Gewerbesteuer im Jahr 2000, wenn alle Rückwirkungen des Finanzausgleichssystems berücksichtigt werden. Auch hier gibt die Zeile primärer Finanzausgleich zunächst die Angaben aus Tabelle 2 wieder. Bund und Länder würden das jeweilige Aufkommen aus der Gewerbesteuerumlage verlieren, die Gemeinden würden die nach der Umlage verbleibende Gewerbesteuer verlieren. Auch in diesem Falle sind die indirekten Belastungswirkungen durchaus bedeutsam. Nun 64 spart der Bund fast 500 Mill. DM an Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen, während gleichzeitig die Gemeinden durch den Steuerverbund noch fast eine zusätzliche Mrd. DM an die Länder verlieren. Im Gegensatz zu den beiden ersten Simulationen werden nun vor allem die fakultativen Verbundanteile reduziert, weil die Gewerbesteuerumlage im fakultativen Steuerverbund berücksichtigt wird, vgl. Tabelle. Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass sich überhaupt die obligatorischen Verbundanteile um 20 Mill. DM vermindern, obwohl die Gewerbesteuer nicht bei den Gemeinschaftssteuern des obligatorischen Steuerverbundes erfasst wird. Die Abschaffung der Gewerbesteuerumlage verändert jedoch auch die relative Finanzkraft der Länder, was wiederum zu Verschiebungen beim Umsatzsteuervorwegausgleich und damit auch beim obligatorischen Steuerverbund führt. Diese Überlegungen zeigen schon, dass es möglicherweise ganz hilfreich für das Verständnis der einzelnen Wirkungskanäle ist, wenn Länder und Gemeinden disaggregiert betrachtet werden. Der folgende Abschnitt macht eine derartige Analyse. Horizontale Belastungswirkungen Um die Wirkungsweise des Finanzausgleichssystems besser zu verstehen und möglicherweise länderspezifische Besonderheiten zu isolieren, werden nun die Verteilungswirkungen der im letzten Abschnitt betrachteten Steuerreformen für die Landes- und Gemeindehaushalte der einzelnen Bundesländer be- Wirtschaftsdienst
7 Tabelle 5 Horizontale Belastungsverteilung der Körperschaftsteuer-Mindereinnahmen (in Mill. DM) Länder Gemeinden Land PFA USt 2 LFA 3 Fehl-BEZ 4 PFA OVA 5 FVA 6 Nordrhein-Westfalen -645,77 477,45 709, ,0 0 Bayern -264,66 322,4-423, ,59-48,85 Baden-Württemberg -436,00 277,88-732, ,37-68,50 Niedersachsen -747,26-48,63-24,83-55,2 0-26,6-49,25 Hessen -84,77 60,53 45, ,82 95,26 Sachsen -204,47-489,36-24,7-38, ,93-32,88 Rheinland-Pfalz -57,54 06,92-274,67-84,3 0-83,5-72,66 Sachsen-Anhalt -256,26-55,83-74,07-23, ,90-22,34 Schleswig-Holstein -95,70 73,67-203,09-280,3 0-4,8-9,85 Thüringen -245,47-35,56-68,49-2, ,64-20,65 Brandenburg -7,04-287,65-72,74-22, ,63-24,89 Mecklenburg-Vorpommern -29,87 3,49-50,04-5, ,7-7,95 Saarland -25,9-4,5-29,96-9, ,34-7,85 Berlin -888,0 96,39-47,54-39, Hamburg -845,3 45,22 220, Bremen -62,3 7,59-9,76-7, Summe -6263, , ,97-462,39 Primärer Finanzausgleich. 2 Umsatzsteuer. 3 Länderfinanzausgleich. 4 Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen. 5 Obligatorische Anteile des Steuerverbundes. 6 Fakultative Anteile des Steuerverbundes. trachtet. Tabelle 4 zeigt zunächst die Belastungsverteilung der verminderten Einkommensteuer. In der ersten Spalte sind die veränderten Steueraufkommen der einzelnen Bundesländer angegeben. Dabei zeigt sich zunächst, dass vom Steuereinbruch des Jahres 200 nicht alle Bundesländer in gleicher Weise betroffen waren. Einige westliche Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen verzeichneten dramatische Einbrüche, während etwa Bayern und Hessen vergleichsweise wenig Steueraufkommen verlieren. Manche Bundesländer im Osten, wie etwa Sachsen-Anhalt und Thüringen erzielen sogar ein höheres Steueraufkommen als im Jahr Die Einnahmeverschiebungen führen zunächst einmal zu veränderten Zahlungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Geberländer wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg werden dadurch entlastet, andere Geberländer wie Bayern und Hessen werden dadurch noch weitaus stärker belastet. Bei den genannten Ostländern zeigen sich die oft beklagten Fehlanreize des bundesstaatlichen Finanzausgleichs. Zwar haben sie ihr originäres Steueraufkommen verbessert, aber insgesamt verlieren sie aufgrund der drastisch verminderten Zuweisungen. Wirtschaftsdienst Als Nächstes wird die Gemeindeebene der einzelnen Bundesländer betrachtet. Zunächst sollte klar sein, dass der obligatorische Steuerverbund in der Regel die Wirkungen des primären Finanzausgleichs verstärkt. Eine Ausnahme bilden jedoch die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen, weil dort die verminderten Ergänzungszuweisungen des Umsatzsteuervorwegausgleichs dominieren. Bei den fakultativen Verbundwirkungen zeigen sich deutlich die Unterschiede der kommunalen Finanzausgleichssysteme. Während etwa in Nordrhein-Westfalen der fakultative Anteil des Steuerverbundes keine Rolle spielt, sind in anderen Ländern die Wirkungen des fakultativen Steuerverbundes nicht zu unterschätzen. Während sie aber in Bayern und Hessen den Rückgang der Gemeindeeinnahmen noch dramatisch verschärfen, dämpfen sie in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz den Einnahmeverlust aus dem obligatorischen Steuerverbund ab. Die Effekte des fakultativen Steuerverbundes ergeben sich natürlich im Wesentlichen aufgrund der veränderten Ausgleichszuweisungen bzw. -beiträge im Länderfinanzausgleich. Rückgang der Körperschaftsteuer Weiterhin werden die finanziellen Konsequenzen des Rückgangs der Körperschaftsteuer in den einzelnen Bundesländern und deren Gemeinden betrachtet. Tabelle 5 zeigt zunächst, dass alle Bundesländer Aufkommenseinbußen hinnehmen mussten, allerdings wurden Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden- Württemberg und Hessen besonders stark betroffen. Da die finanzstarken Bundesländer überproportional getroffen wurden, sanken die Ergänzungsanteile im Umsatzsteuervorwegausgleich. Im anschließenden Länderfinanzausgleich mü s s en nun jedoch Bayern und Baden-Württemberg höhere Ausgleichsbeiträge leisten, während Nordrhein-West- 65
8 Tabelle 6 Horizontale Belastungsverteilung einer Abschaffung der Gewerbesteuer (in Mill. DM) Länder Gemeinden Land PFA USt 2 LFA 3 Fehl-BEZ 4 PFA OVA 5 FVA 6 Nordrhein-Westfalen -2047,78 70,79 32, ,84 6,28 0 Bayern -504,05 47,80 588, ,22 5,52-05,65 Baden-Württemberg -395,7 4,20 98, ,00 9,48-09,67 Niedersachsen -789,80 22,27 32,33-98,90-357,07 3,92 -,7 Hessen -90,83 23,80 834, ,29 5,45-7,56 Sachsen -74,62-83,60-705,2-64,05-038,98-22,04-205,60 Rheinland-Pfalz -393,00 5,85-8,70-57,94-786,9 3,2-35,77 Sachsen-Anhalt -48,50-46,6-42,85-37,47-567, -,9-5,2 Schleswig-Holstein -258,89 0,92-22,27-43,50-0,28 2,08-2,50 Thüringen -38,23-49,44-396,40-34,42-429,38 -,37-07,88 Brandenburg -66,9-28,92-355,08-36,44-63,54-7,55-9,46 Mecklenburg-Vorpommern -3,05-35,09-277,6-25,0-347,57-9,60-82,70 Saarland -65,8 -,6-98,03-5,48-35,69-2,32-22,7 Berlin -269,97 3,32-485,55-60,56-379, Hamburg -347,78 6,70 365, , Bremen -83,0 2,6 -,33-7,7-430, Summe -8325, , ,80-8,4-946,40 Primärer Finanzausgleich. 2 Umsatzsteuer. 3 Länderfinanzausgleich. 4 Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen. 5 Obligatorische Anteile des Steuerverbundes. 6 Fakultative Anteile des Steuerverbundes. falen und Hessen geringere Ausgleichsbeiträge abführen. Die Konsequenzen für die kommunale Finanzmasse in diesen Ländern zeigen sich in den beiden rechten Spalten der Tabelle. Während in Nordrhein- Westfalen der primäre Aufkommensverlust über den obligatorischen Steuerverbund auf die Gemeinden durchschlägt, dämpfen in Hessen die erhöhten fakultativen Verbundanteile die Verluste der Gemeinden aus dem obligatorischen Steuerverbund ab. In Bayern und Baden-Württemberg dagegen erhöht der fakultative Steuerverbund die Verluste der Gemeinden, weil diese Länder höhere Ausgleichsbeiträge an den Länderfinanzausgleich abführen. Besonders interessant ist auch die Situation in Schleswig-Holstein. Hier werden die primären Aufkommensverluste fast neutralisiert durch erhöhte Ergänzungszuweisungen aus dem Umsatzsteuervorwegausgleich. Allerdings erhält das Land nun wesentlich geringere Ausgleichszuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich und Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen vom Bund. Da die Gemeinden in Schleswig-Holstein an beiden beteiligt sind, werden sie vor allem durch den Rückgang der fakultativen Verbundanteile getroffen, während die obligatorischen Verbundanteile nahezu unverändert bleiben. Die ostdeutschen Bundesländer schließlich geben ein sehr einheitliches Bild ab. Sie sind alle finanzschwache Länder, deren primäre Aufkommensverluste durch den bundesstaatlichen Finanzausgleich noch verstärkt werden. Auf der Gemeindeebene dominieren daher 66 die Effekte des obligatorischen Steuerverbundes. Der fakultative Steuerverbund verstärkt diese lediglich. Rückwirkungseffekte einer Abschaffung der Gewerbesteuer Schließlich werden in Tabelle 6 die Rückwirkungseffekte einer Abschaffung der Gewerbesteuer auf der disaggregierten Länderebene betrachtet. Im Vergleich zur vorangegangenen Simulation fallen sofort zwei Unterschiede auf. Erstens gibt es nun bei den Gemeinden primäre Aufkommenseffekte und zweites dominieren nun die Wirkungen des fakultativen Steuerverbundes die des obligatorischen Steuerverbundes. Die Veränderung der Verbundmasse im obligatorischen Steuerverbund liegt alleine an den veränderten Ergänzungszuweisungen des Umsatzsteuervorwegausgleichs. Die ostdeutschen Bundesländer und das Saarland, welche nun weniger Ergänzungszuweisungen erhalten, geben dies auch im Umfang ihrer landesspezifischen Verbundquote an ihre Gemeinden weiter. Insgesamt fällt auf, dass bei den westdeutschen Bundesländern die Rückwirkungen über den Finanzausgleich relativ gering ausfallen. Manche Länder wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein beteiligen ihre Gemeinden nicht an der Gewerbesteuerumlage, in den anderen Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen heben sich die Wirkungen der Beteiligung an der Gewerbesteuerumlage und der Länderfinanzausgleich-Beiträge nahezu auf. In den ostdeutschen Wirtschaftsdienst
9 Bundesländern gibt es jedoch genau den gegenteiligen Effekt. Hier verlieren die Länder neben der Gewerbesteuerumlage auch noch durch die verminderten Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich. Beides wird über den fakultativen Steuerverbund direkt an die jeweiligen Gemeinden weitergegeben, so dass sich in Ostdeutschland durchaus beträchtliche Rückwirkungen einstellen. Insgesamt hat sich damit gezeigt, dass die aggregierte Betrachtung der vertikalen Verteilungswirkungen in Tabelle 3 des vorangegangenen Abschnitts einerseits die Wirkungsmechanismen des Finanzausgleichssystems nicht deutlich machen kann und gleichzeitig wichtige länderspezifische Unterschiede verdeckt. Zusammenfassung In der aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion über die Ursachen der kommunalen Finanzkrise und die Reform der Gewerbesteuer wird in der Regel der kommunale Finanzausgleich vernachlässigt. Unser Beitrag versucht deshalb die Frage zu beantworten, ob die vertikalen Belastungswirkungen von Steuerreformen durch die alleinige Betrachtung des primären Finanzausgleichs ausreichend abgebildet werden. Aus diesem Grund haben wir zunächst das Zusammenwirken von bundesstaatlichem und kommunalem Finanzausgleich herausgearbeitet, um daran anschließend die Rückwirkungseffekte einiger ausgewählter Steuerreformen zu quantifizieren. Anhand der durch die Steuerreform 2000 hervorgerufenen Mindereinnahmen bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer ließ sich dabei zeigen, dass der primäre Finanzausgleich die tatsächlichen Belastungen der Gemeinden signifikant unterschätzt. Da die Länder einen Teil ihrer Aufkommensverluste bei den Gemeinschaftssteuern über den Steuerverbund an ihre Gemeinden weiterleiten, werden die Kommunen nicht nur bei der Einkommensteuer höher belastet, sondern tragen auch einen beachtlichen Teil der verminderten Körperschaftsteuer. Die Analyse der Aufkommenswirkungen in den einzelnen Bundesländern zeigte, dass obligatorischer und fakultativer Steuerverbund ganz unterschiedlich zusammenwirken, je nachdem welche Stellung ein Bundesland im bundesstaatlichen Finanzausgleich einnimmt und wie die landesspezifischen Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs ausfallen. Insgesamt ist deshalb die aktuelle Finanzkrise der Kommunen in viel stärkerem Maße auf die Steuerreform 2000 zurückzuführen, als dies von der Bundesregierung eingestanden wird. Da sie sich alleine auf die primären Wirtschaftsdienst Verteilungswirkungen beschränkt und die Rückwirkungen des Finanzausgleichssystems vernachlässigt, unterschätzt sie systematisch die den bundesdeutschen Gemeinden auferlegten Belastungen durch die Steuerreform Würde man die verdeckten Verteilungswirkungen berücksichtigen, dann hätten die Gemeinden selbst ohne Erhöhung der Gewerbesteuerumlage einen überproportionalen Anteil an den Mindereinnahmen zu verkraften. Ausblick Bei der derzeit diskutierten Ersetzung der Gewerbesteuer durch eine kommunale Einkommen- und Gewinnsteuer sind die Rückkoppelungseffekte in vertikaler Hinsicht vor allem bei der Gewerbesteuerumlage für Bund und Länder zu beachten. Für die Kommunen als Gesamtheit schlagen sie dagegen quantitativ kaum zu Buche. Dieses Aussage gilt allerdings nicht, wenn die einzelnen Bundesländer betrachtet werden. Hier ergeben sich vor allem in den ostdeutschen Bundesländern signifikante Rückwirkungseffekte auch auf der Gemeindeebene. Deshalb ist zu vermuten, dass die kommunalen Hebesätze auf Einkommen- und Körperschaftsteuer, welche alleine anhand der originären Verteilung der Gewerbesteuer ermittelt werden, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern signifikant unterschätzt werden. Allerdings kann dies nur eine Tendenzaussage sein, weil wir die Konsequenzen der Einkommen- und Körperschaftsteuerzuschläge nicht berücksichtigt haben. Insgesamt sehen wir unsere Simulationen aber nur als einen ersten Versuch, wie bei der künftigen Diskussion der föderalen Verteilungswirkungen von Steuerreformen die verdeckten Wirkungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems einbezogen werden könnten. Natürlich kann man diesen Ansatz auch in vielfältiger Hinsicht erweitern. Bei der Abschaffung der Gewerbesteuer wäre etwa der erwartete Anstieg von Einkommen- und Körperschaftsteuer durch geeignete Annahmen zu quantifizieren und darauf aufbauend die kompensierenden Zuschläge auf der Gemeindeebene im Finanzausgleichssystem zu bestimmen. Natürlich könnte man auch die Gemeindeebene (möglicherweise nur in ausgewählten Bundesländern) weiter disaggregieren, um die Umverteilungsmechanismen des kommunalen Finanzausgleichs genauer abzubilden. Unabhängig davon darf man gespannt sein, inwieweit die im Frühjahr von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen die verdeckten Verteilungswirkungen des bundesdeutschen Finanzausgleichs in ihrem Reformkonzept berücksichtigen wird. 67
Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen (Teil 1)
 und (Teil 1) In absoluten Zahlen*, und Geberländer Empfängerländer -3.797-1.295 Bayern -2.765-1.433 Baden- Württemberg * Ausgleichszuweisungen des s: negativer Wert = Geberland, positiver Wert = Empfängerland;
und (Teil 1) In absoluten Zahlen*, und Geberländer Empfängerländer -3.797-1.295 Bayern -2.765-1.433 Baden- Württemberg * Ausgleichszuweisungen des s: negativer Wert = Geberland, positiver Wert = Empfängerland;
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Steuerhaushalt. Fachserie 14 Reihe 4
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 8. Mai 2014 Artikelnummer: 2140400137004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 8. Mai 2014 Artikelnummer: 2140400137004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Steuerhaushalt. Fachserie 14 Reihe 4
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2012 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 24. April 2013 Artikelnummer: 2140400127004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2012 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 24. April 2013 Artikelnummer: 2140400127004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) ,5
 BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 26.01.2017 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr 2016
BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 26.01.2017 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr 2016
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) ,6
 BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 27.01.2016 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 27.01.2016 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
Steuereinnahmen nach Steuerarten
 Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2007 gemeinschaftliche Steuern: 374,3 Mrd. (69,6%) Zölle (100 v.h.): 4,0 (0,7%) Lohnsteuer: 131,8 Mrd. (24,5%) Gewerbesteuer (100 v.h.): 40,1
Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2007 gemeinschaftliche Steuern: 374,3 Mrd. (69,6%) Zölle (100 v.h.): 4,0 (0,7%) Lohnsteuer: 131,8 Mrd. (24,5%) Gewerbesteuer (100 v.h.): 40,1
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015
 Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015 Stand der Verhandlungen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Bisheriger Zeitplan Beschluss der Bundeskanzlerin
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015 Stand der Verhandlungen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Bisheriger Zeitplan Beschluss der Bundeskanzlerin
PORTAL ZUR HAUSHALTSSTEUERUNG.DE. KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT. Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth
 PORTAL ZUR KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth HAUSHALTSSTEUERUNG.DE 18. August 2013, Trebur Einordnung kommunaler Steuern (netto)
PORTAL ZUR KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth HAUSHALTSSTEUERUNG.DE 18. August 2013, Trebur Einordnung kommunaler Steuern (netto)
Programmierte Steuererhöhung
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Steuerpolitik 30.01.2017 Lesezeit 3 Min Programmierte Steuererhöhung Die Grunderwerbssteuer kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben.
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Steuerpolitik 30.01.2017 Lesezeit 3 Min Programmierte Steuererhöhung Die Grunderwerbssteuer kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben.
Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016
 Bundesrat Drucksache 50/16 29.01.16 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016 A. Problem und Ziel Mit
Bundesrat Drucksache 50/16 29.01.16 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016 A. Problem und Ziel Mit
Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern
 Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern Gewerbliche Unternehmensgründungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Unternehmensgründungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 52.169
Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern Gewerbliche Unternehmensgründungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Unternehmensgründungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 52.169
Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern
 Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern Gewerbeanmeldungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Gewerbeanmeldungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 111.044 109.218 106.566 105.476 109.124
Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern Gewerbeanmeldungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Gewerbeanmeldungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 111.044 109.218 106.566 105.476 109.124
Ergebnis. der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau
 Ergebnis der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau Tabelle 1 - Gesamtübersicht Steuern insgesamt (Mio. ) 673.261,5 705.791,4 732.434 757.368 789.463
Ergebnis der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau Tabelle 1 - Gesamtübersicht Steuern insgesamt (Mio. ) 673.261,5 705.791,4 732.434 757.368 789.463
Gesetz über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer
 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
Länderfinanzausgleich: eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems
 : eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems Simulation der Verteilungswirkungen höherer Steuermittel für die Bundesländer Kurzexpertise FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Platz des Landtags
: eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems Simulation der Verteilungswirkungen höherer Steuermittel für die Bundesländer Kurzexpertise FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Platz des Landtags
1.4.1 Sterblichkeit in Ost- und Westdeutschland
 1.4.1 in Ost- und Westdeutschland Die ist im Osten noch stärker gesunken als im Westen. Die Gesamtsterblichkeit ist in Deutschland zwischen 1990 und 2004 bei Frauen und Männern deutlich zurückgegangen
1.4.1 in Ost- und Westdeutschland Die ist im Osten noch stärker gesunken als im Westen. Die Gesamtsterblichkeit ist in Deutschland zwischen 1990 und 2004 bei Frauen und Männern deutlich zurückgegangen
Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen
 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit:
Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit:
Spielhallenkonzessionen Spielhallenstandorte Geldspielgeräte in Spielhallen
 Alte Bundesländer 1.377 von 1.385 Kommunen Stand: 01.01.2012 13.442 Spielhallenkonzessionen 8.205 Spielhallenstandorte 139.351 Geldspielgeräte in Spielhallen Einwohner pro Spielhallenstandort 2012 Schleswig-
Alte Bundesländer 1.377 von 1.385 Kommunen Stand: 01.01.2012 13.442 Spielhallenkonzessionen 8.205 Spielhallenstandorte 139.351 Geldspielgeräte in Spielhallen Einwohner pro Spielhallenstandort 2012 Schleswig-
Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen
 Finanzpolitik Forschungsstelle Finanzpolitik www.fofi.uni bremen.de Nr. 37 April 2013 Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen Das bundesstaatliche Finanzverteilungs und Finanzumverteilungssystem
Finanzpolitik Forschungsstelle Finanzpolitik www.fofi.uni bremen.de Nr. 37 April 2013 Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen Das bundesstaatliche Finanzverteilungs und Finanzumverteilungssystem
Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland
 Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland A. Steuerverteilung und Finanzausgleich Steuern sind die wichtigste Einnahmeart des Staates. Rund 80 % der
Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland A. Steuerverteilung und Finanzausgleich Steuern sind die wichtigste Einnahmeart des Staates. Rund 80 % der
Finanzielle Leistungen der Länder an ihre Gemeinden
 Dipl.-Volkswirt Otto Dietz Finanzielle Leistungen der Länder an ihre Gemeinden Kommunaler Finanzausgleich und andere Finanzhilfen Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung der finanziellen Leistungen
Dipl.-Volkswirt Otto Dietz Finanzielle Leistungen der Länder an ihre Gemeinden Kommunaler Finanzausgleich und andere Finanzhilfen Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung der finanziellen Leistungen
In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013
 In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013 Martin R. Textor Wie viel Geld wird in der Bundesrepublik Deutschland
In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013 Martin R. Textor Wie viel Geld wird in der Bundesrepublik Deutschland
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
 Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) GemFinRefG Ausfertigungsdatum: 08.09.1969 Vollzitat: "Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) GemFinRefG Ausfertigungsdatum: 08.09.1969 Vollzitat: "Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009
Thüringer Landesamt für Statistik
 Thüringer Landesamt für Statistik Pressemitteilung 035/2011 Erfurt, 31. Januar 2011 Arbeitnehmerentgelt 2009: Steigerung der Lohnkosten kompensiert Beschäftigungsabbau Das in Thüringen geleistete Arbeitnehmerentgelt
Thüringer Landesamt für Statistik Pressemitteilung 035/2011 Erfurt, 31. Januar 2011 Arbeitnehmerentgelt 2009: Steigerung der Lohnkosten kompensiert Beschäftigungsabbau Das in Thüringen geleistete Arbeitnehmerentgelt
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) 570.212.811 551.784.950 3,3
 BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 06.02.2014 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 06.02.2014 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
Finanzen. Gesamtausgaben steigen in Niedersachsen unterdurchschnittlich. Kräftiger Anstieg der Sachinvestitionen in Niedersachsen
 Finanzen Gesamtausgaben steigen in unterdurchschnittlich Die bereinigten Gesamtausgaben haben in mit + 2,7 % langsamer zugenommen als in Deutschland insgesamt (+ 3,6 %). Die höchsten Zuwächse gab es in
Finanzen Gesamtausgaben steigen in unterdurchschnittlich Die bereinigten Gesamtausgaben haben in mit + 2,7 % langsamer zugenommen als in Deutschland insgesamt (+ 3,6 %). Die höchsten Zuwächse gab es in
Kommunalfinanzen in Sachsen-Anhalt - Teil 1: Positionsbestimmung und Besonderheiten -
 Kommunalfinanzen in Sachsen-Anhalt - Teil 1: Positionsbestimmung und Besonderheiten - CDU-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt 29. November 2010 in Magdeburg Prof. Dr. Martin Junkernheinrich Stephan Brand,
Kommunalfinanzen in Sachsen-Anhalt - Teil 1: Positionsbestimmung und Besonderheiten - CDU-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt 29. November 2010 in Magdeburg Prof. Dr. Martin Junkernheinrich Stephan Brand,
Steuereinnahmen nach Steuerarten
 Steuereinnahmen nach Steuerarten Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2012 Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2012 sonstige: 1,1 Mrd. (2,2 %) Gewerbesteuer
Steuereinnahmen nach Steuerarten Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2012 Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2012 sonstige: 1,1 Mrd. (2,2 %) Gewerbesteuer
Über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen!
 Über 5.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen! Im Jahr 2013 sind 5.548 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland durch die Jugendämter in Obhut genommen worden.
Über 5.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen! Im Jahr 2013 sind 5.548 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland durch die Jugendämter in Obhut genommen worden.
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN BADEN- WÜRTTEMBERG HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜ RINGEN
Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN BADEN- WÜRTTEMBERG HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜ RINGEN
Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen -
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2014 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2014 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
econstor Make Your Publication Visible
 econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Brügelmann, Ralph Working Paper Föderalismusreform: Die Unzulänglichkeiten des Finanzausgleichs
econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Brügelmann, Ralph Working Paper Föderalismusreform: Die Unzulänglichkeiten des Finanzausgleichs
Bundesland. Bayern 112,3 190,5. Berlin 69,5 89,5. Brandenburg 29,3 40,3. Bremen 14,1 19,6. Hamburg 38,0 57,5. Hessen 79,8 125,3
 Tab. 1: Entlastung nach Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Jahr 2016 1 Einwohneranteil in % Baden-Württemberg 13,21 480 Bayern 15,63 569 Berlin 4,28 156 Brandenburg 3,03 110 Bremen 0,82 29 Hamburg
Tab. 1: Entlastung nach Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Jahr 2016 1 Einwohneranteil in % Baden-Württemberg 13,21 480 Bayern 15,63 569 Berlin 4,28 156 Brandenburg 3,03 110 Bremen 0,82 29 Hamburg
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen -
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Kommunalfinanzen in Suburbia
 Jürgen Wixforth Kommunalfinanzen in Suburbia Das Beispiel der Regionen Hamburg und Berlin Ja VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 5 Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Jürgen Wixforth Kommunalfinanzen in Suburbia Das Beispiel der Regionen Hamburg und Berlin Ja VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 5 Abbildungsverzeichnis 11 Tabellenverzeichnis
Armutsgefährdungsquoten nach Bundesländern (Teil 1)
 Armutsgefährdungsquoten nach Bundesländern (Teil 1) * um das mittlere Einkommen zu berechnen, wird der Median (Zentralwert) verwendet. Dabei werden hier alle Personen ihrem gewichteten Einkommen nach aufsteigend
Armutsgefährdungsquoten nach Bundesländern (Teil 1) * um das mittlere Einkommen zu berechnen, wird der Median (Zentralwert) verwendet. Dabei werden hier alle Personen ihrem gewichteten Einkommen nach aufsteigend
KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr
 KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr 2010 - Datengrundlage Die folgenden Darstellungen basieren auf den Ergebnissen einer Umfrage, die das niedersächsische Gesundheitsministerium
KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr 2010 - Datengrundlage Die folgenden Darstellungen basieren auf den Ergebnissen einer Umfrage, die das niedersächsische Gesundheitsministerium
Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage
 Bundesrat Drucksache 638/15 18.12.15 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes
Bundesrat Drucksache 638/15 18.12.15 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes
Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025
 Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025 Bevölkerung insgesamt in Tausend 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 Bevölkerungsfortschreibung - Ist-Zahlen Variante
Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025 Bevölkerung insgesamt in Tausend 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 Bevölkerungsfortschreibung - Ist-Zahlen Variante
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN THÜ RINGEN SACHSEN- ANHALT MECKLENBURG-
Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN THÜ RINGEN SACHSEN- ANHALT MECKLENBURG-
10 Schulzeit und Hausaufgaben
 10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
Der bundesstaatliche Finanzausgleich
 Der bundesstaatliche Finanzausgleich - 1 - Der bundesstaatliche Finanzausgleich Im Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland stellen die Länder eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete
Der bundesstaatliche Finanzausgleich - 1 - Der bundesstaatliche Finanzausgleich Im Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland stellen die Länder eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete
Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28.
 Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28. März 2015 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28. März 2015 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
'\/ 16/ des bundesstaatlichen Finanzausgleichs auf dem MPK-Vorschlag aus Dezember 2015 beruht. Das Einigungsmodell wird ausführlich beschrieben.
 Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen Der Minister l.1-\nfff,"\g N0} 1f:PHEiN-WESTFALEN 16. '\/ 16/ 4402 3J. Oktober 2016 Seite 1 von 5 - A11 - Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben KomF 16
Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen Der Minister l.1-\nfff,"\g N0} 1f:PHEiN-WESTFALEN 16. '\/ 16/ 4402 3J. Oktober 2016 Seite 1 von 5 - A11 - Aktenzeichen bei Antwort bitte angeben KomF 16
Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme?
 Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme? Prof. Dr. Günter Dannemann Finanzstaatsrat a.d. Forschungsstelle Finanzpolitik an der Universität Bremen Vortrag beim Rotary Club Verden / Aller 15. Mai 2006
Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme? Prof. Dr. Günter Dannemann Finanzstaatsrat a.d. Forschungsstelle Finanzpolitik an der Universität Bremen Vortrag beim Rotary Club Verden / Aller 15. Mai 2006
Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr?
 Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr? 10. Deutscher Kämmerertag, Berlin Lars Martin Klieve, Beigeordneter und Stadtkämmerer Essen Übersicht - Verschuldung von Bund, Ländern und Kommunen Schuldenstand (1990)
Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr? 10. Deutscher Kämmerertag, Berlin Lars Martin Klieve, Beigeordneter und Stadtkämmerer Essen Übersicht - Verschuldung von Bund, Ländern und Kommunen Schuldenstand (1990)
602 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom
 Seite 1 von 7 602 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 23.1.2014 Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen
Seite 1 von 7 602 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 23.1.2014 Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen
Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht
![Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht](/thumbs/59/43372984.jpg) 1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Periode bzw. Jahr=2002-2012 ; Land Einheit Hauptbestand (auch Plenterwald) Unterstand Oberstand alle Bestandesschichten Baden-Württemberg
1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Periode bzw. Jahr=2002-2012 ; Land Einheit Hauptbestand (auch Plenterwald) Unterstand Oberstand alle Bestandesschichten Baden-Württemberg
Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben?
 Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben? Vortrag auf der Grünen Woche im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung am 22. Januar 2014 in Berlin Dr. Markus Eltges 2020 Dr. Markus Eltges
Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben? Vortrag auf der Grünen Woche im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung am 22. Januar 2014 in Berlin Dr. Markus Eltges 2020 Dr. Markus Eltges
Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte
 Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Dienstag, 17. November 2015, 15:30 Uhr, NRW.Bank, Friedrichstraße 1, 48145 Münster Bernhard Daldrup,
Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Dienstag, 17. November 2015, 15:30 Uhr, NRW.Bank, Friedrichstraße 1, 48145 Münster Bernhard Daldrup,
Veränderungen der Arbeitswelt
 Veränderungen der Arbeitswelt im Auftrage von ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Hannover, April 2013 Anschrift des Verfassers: Matthias Günther,
Veränderungen der Arbeitswelt im Auftrage von ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft und Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Hannover, April 2013 Anschrift des Verfassers: Matthias Günther,
Grunderwerbsteuer: Thüringen erhöht zum auf 6,5 Prozent
 Grunderwerbsteuer: Thüringen erhöht zum 1.1.2017 auf 6,5 Prozent Foto: jogys - Fotolia.com Grundstücke sind teuer und jetzt will auch noch das Finanzamt kräftig von Ihrem Kauf profitieren: mit der Grunderwerbsteuer.
Grunderwerbsteuer: Thüringen erhöht zum 1.1.2017 auf 6,5 Prozent Foto: jogys - Fotolia.com Grundstücke sind teuer und jetzt will auch noch das Finanzamt kräftig von Ihrem Kauf profitieren: mit der Grunderwerbsteuer.
Auswertung. Fachabteilung Entwicklung 1991 bis 2003 Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00%
 Bundesrepublik gesamt Anzahl der Kinderabteilungen Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00% Anzahl der Kinderbetten Kinderheilkunde -32,43% - davon
Bundesrepublik gesamt Anzahl der Kinderabteilungen Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00% Anzahl der Kinderbetten Kinderheilkunde -32,43% - davon
Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs
 Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs Wissenschaftliche Tagung IW Köln und MPI Fairer Föderalismus? Zum Reformbedarf bei Bildung und Finanzen 12. November 2014 Dr. Rolf Kroker Unzufriedenheit
Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs Wissenschaftliche Tagung IW Köln und MPI Fairer Föderalismus? Zum Reformbedarf bei Bildung und Finanzen 12. November 2014 Dr. Rolf Kroker Unzufriedenheit
Zügig nach Deutschland?
 22.05.2012 Zügig nach Deutschland? Ein Jahr uneingeschränkte Freizügigkeit für Migranten aus den EU-8 Ländern Seit dem 1. Mai 2011 gilt für die 2004 beigetretenen Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen,
22.05.2012 Zügig nach Deutschland? Ein Jahr uneingeschränkte Freizügigkeit für Migranten aus den EU-8 Ländern Seit dem 1. Mai 2011 gilt für die 2004 beigetretenen Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Bundesrat. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
 Bundesrat Drucksache 268/16 (neu) 25.05.16 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales AIS - Fz - In Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten
Bundesrat Drucksache 268/16 (neu) 25.05.16 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales AIS - Fz - In Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten
STATISTISCHES LANDESAMT. Statistik nutzen. L II - vj 4/13 Kennziffer: L ISSN:
 STATISTISCHES LANDESAMT 2014 Statistik nutzen 4. Vierteljahr 2013 L II - vj 4/13 Kennziffer: L2023 201344 ISSN: Inhalt Seite Anmerkung......... 3 Zeichenerklärung..... 3 1. Kassenmäßige Ausgaben der Gemeinden
STATISTISCHES LANDESAMT 2014 Statistik nutzen 4. Vierteljahr 2013 L II - vj 4/13 Kennziffer: L2023 201344 ISSN: Inhalt Seite Anmerkung......... 3 Zeichenerklärung..... 3 1. Kassenmäßige Ausgaben der Gemeinden
Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern
 Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern BMNr Kennziffer Einheit Jahr Min/Max Städtevergleiche D-A-01 Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) Euro/EW 1995/2005 D-B-01 Entwicklung
Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern BMNr Kennziffer Einheit Jahr Min/Max Städtevergleiche D-A-01 Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) Euro/EW 1995/2005 D-B-01 Entwicklung
Die Gewerbesteuer in der Diskussion
 Die Gewerbesteuer in der Diskussion Referent: Martin Sielenkämper Sollte die Gewerbesteuer abgeschafft werden? 1 Gliederung 1 Was ist die Gewerbesteuer? 2 Bestandteile der Gewerbesteuer 3 Die aktuelle
Die Gewerbesteuer in der Diskussion Referent: Martin Sielenkämper Sollte die Gewerbesteuer abgeschafft werden? 1 Gliederung 1 Was ist die Gewerbesteuer? 2 Bestandteile der Gewerbesteuer 3 Die aktuelle
B E S C H L U S S. des Bewertungsausschusses nach 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 362. Sitzung am 22. September 2015
 B E S C H L U S S des Bewertungsausschusses nach 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 362. Sitzung am 22. September 2015 zu Empfehlungen zur Vereinbarung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten
B E S C H L U S S des Bewertungsausschusses nach 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 362. Sitzung am 22. September 2015 zu Empfehlungen zur Vereinbarung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten
Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten
 Arbeitskammer des Saarlandes Abteilung Wirtschaftspolitik - Stand: 22.5.2013 AK-Fakten Öffentliche Finanzen im Saarland Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten fakten Das Saarland hat
Arbeitskammer des Saarlandes Abteilung Wirtschaftspolitik - Stand: 22.5.2013 AK-Fakten Öffentliche Finanzen im Saarland Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten fakten Das Saarland hat
Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 1.
 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015
 Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015 nach Wohnort, Wohnungsgröße und Versicherungsbeitrag Mai 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Methodik 3 Hausratversicherung und Einbruchshäufigkeit
Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015 nach Wohnort, Wohnungsgröße und Versicherungsbeitrag Mai 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Methodik 3 Hausratversicherung und Einbruchshäufigkeit
Kirchenmitgliederzahlen am
 zahlen am 31.12.2011 Oktober 2012 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
zahlen am 31.12.2011 Oktober 2012 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
Evangelische Kirche. in Deutschland. Kirchenmitgliederzahlen Stand
 Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2013 April 2015 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet:
Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2013 April 2015 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet:
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78. Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer. Die Schuldenbremse in den Bundesländern
 Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78 Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer Die Schuldenbremse in den Bundesländern Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78 Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer Die Schuldenbremse in den Bundesländern Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft
Meinungen zur Kernenergie
 Meinungen zur Kernenergie Datenbasis: 1.002 Befragte Erhebungszeitraum: 27. bis 29. August 2013 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: DAtF e.v. 1. Einfluss der Energiepolitik auf
Meinungen zur Kernenergie Datenbasis: 1.002 Befragte Erhebungszeitraum: 27. bis 29. August 2013 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: DAtF e.v. 1. Einfluss der Energiepolitik auf
Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich
 1 Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin Die Ergebnisse des Zensus 2011 haben zu der Erkenntnis geführt, dass in Deutschland rund
1 Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin Die Ergebnisse des Zensus 2011 haben zu der Erkenntnis geführt, dass in Deutschland rund
Saisonüblicher Beschäftigungsrückgang in den Wintermonaten
 BAP-Umfrage März 2014 (Welle 64 und 65) IW-Fortschreibung Saisonüblicher Beschäftigungsrückgang in den Wintermonaten Die Zahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland hat sich zwischen September und November
BAP-Umfrage März 2014 (Welle 64 und 65) IW-Fortschreibung Saisonüblicher Beschäftigungsrückgang in den Wintermonaten Die Zahl der Zeitarbeitnehmer in Deutschland hat sich zwischen September und November
Finanzausgleich in Deutschland
 Kapitel 2 Finanzausgleich in Deutschland Der deutsche Föderalismus ist seit langem Gegenstand heftiger wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen. In den letzten Jahren ging es dabei in erster Linie um
Kapitel 2 Finanzausgleich in Deutschland Der deutsche Föderalismus ist seit langem Gegenstand heftiger wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen. In den letzten Jahren ging es dabei in erster Linie um
Papier und Pappe verarbeitende Industrie
 Papier und Pappe verarbeitende Industrie In den ausgewerteten Tarifbereichen arbeiten rund 69.500 Beschäftigte. Zwei von 91 Vergütungsgruppen liegen zwischen 8,50 und 9,99. Alle anderen Gruppen liegen
Papier und Pappe verarbeitende Industrie In den ausgewerteten Tarifbereichen arbeiten rund 69.500 Beschäftigte. Zwei von 91 Vergütungsgruppen liegen zwischen 8,50 und 9,99. Alle anderen Gruppen liegen
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter Stellen und Maßnahmen im stationären Bereich - Stand:
 Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter und im stationären Bereich - Stand: 31.03.2002 - Jahr 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Bundesland Baden-Württemberg 203
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter und im stationären Bereich - Stand: 31.03.2002 - Jahr 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Bundesland Baden-Württemberg 203
Die Schulden der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung?
 Die der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung? Bremen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management Kompetenzzentrum Öffentliche
Die der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung? Bremen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management Kompetenzzentrum Öffentliche
Veränderung des Verhältnis von Zentral- und Gliedstaaten II
 Veränderung des Verhältnis von Zentral- und Gliedstaaten II Grande, Edgar, 2002, Parteiensysteme und Föderalismus, Politische Vierteljahresschrift Sonderheft Föderalismus, 181-212 Jun, Uwe, 2004, 'Reformoptionen
Veränderung des Verhältnis von Zentral- und Gliedstaaten II Grande, Edgar, 2002, Parteiensysteme und Föderalismus, Politische Vierteljahresschrift Sonderheft Föderalismus, 181-212 Jun, Uwe, 2004, 'Reformoptionen
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN BADEN- WÜRTTEMBERG Ku rhesse n- HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜRINGEN
Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN BADEN- WÜRTTEMBERG Ku rhesse n- HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜRINGEN
2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999
 Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
Ermittlung der Bezugsgröße zur Berechnung der Arbeitslosenquoten
 Ermittlung der Bezugsgröße zur Berechnung der Arbeitslosenquoten Dokumentation für das Jahr 2006 Stand: 25.05.2007 Bundesagentur für Arbeit Datenzentrum Statistik Regensburger Straße 104 90478 Nürnberg
Ermittlung der Bezugsgröße zur Berechnung der Arbeitslosenquoten Dokumentation für das Jahr 2006 Stand: 25.05.2007 Bundesagentur für Arbeit Datenzentrum Statistik Regensburger Straße 104 90478 Nürnberg
Kommunalfinanzen - Kassenstatistik 2011
 Kommunalfinanzen - Kassenstatistik 2011 Das Statistische Bundesamt hat die Ergebnisse zur Entwicklung der kommunalen Haushalte im Jahr 2011 vorgelegt. Nach der Kassenstatistik für das Jahr 2011 entwickelte
Kommunalfinanzen - Kassenstatistik 2011 Das Statistische Bundesamt hat die Ergebnisse zur Entwicklung der kommunalen Haushalte im Jahr 2011 vorgelegt. Nach der Kassenstatistik für das Jahr 2011 entwickelte
Schriftliche Kleine Anfrage
 BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/4448 19. Wahlperiode 03.11.09 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Badde (SPD) vom 26.10.09 und Antwort des Senats Betr.: Mehr
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/4448 19. Wahlperiode 03.11.09 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Badde (SPD) vom 26.10.09 und Antwort des Senats Betr.: Mehr
Preisentwicklung Strom & Gas. Januar 2017
 Preisentwicklung Strom & Gas Januar 2017 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Strompreisentwicklung seit Juli 2007 3 Entwicklung Netzentgelte Strom 4 Entwicklung EEG-Umlage 5 Gaspreisentwicklung seit
Preisentwicklung Strom & Gas Januar 2017 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Strompreisentwicklung seit Juli 2007 3 Entwicklung Netzentgelte Strom 4 Entwicklung EEG-Umlage 5 Gaspreisentwicklung seit
Struktur und Verteilung der Steuereinnahmen
 1 von 7 16.11.2009 17:35 Das BMF Monatsbericht digital Monatsbericht digital Monatsbericht Juni 2009 Analysen und Berichte Struktur und Verteilung der Steuereinnahmen Langfristige Trends und aktuelle Entwicklungen
1 von 7 16.11.2009 17:35 Das BMF Monatsbericht digital Monatsbericht digital Monatsbericht Juni 2009 Analysen und Berichte Struktur und Verteilung der Steuereinnahmen Langfristige Trends und aktuelle Entwicklungen
51. Nachtrag. zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung. Knappschaft-Bahn-See
 51. Nachtrag zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vom 01.10.2005 in der Fassung des 50. Satzungsnachtrages
51. Nachtrag zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vom 01.10.2005 in der Fassung des 50. Satzungsnachtrages
Tabelle 1: Zahlungsansprüche auf Bedarfsgemeinschaftsebene (BG-Ebene)
 Tabelle 1: Zahlungsansprüche auf Bedarfsgemeinschaftsebene (BG-Ebene) Deutschland Ausgewählte Berichtsmonate Zahlungsansprüche der BG mit mindestens 1 Monat erwerbstätigen ALG II-Bezieher darunter: abhängig
Tabelle 1: Zahlungsansprüche auf Bedarfsgemeinschaftsebene (BG-Ebene) Deutschland Ausgewählte Berichtsmonate Zahlungsansprüche der BG mit mindestens 1 Monat erwerbstätigen ALG II-Bezieher darunter: abhängig
Papier verarbeitende Industrie
 Papier verarbeitende Industrie In den ausgewerteten Tarifbereichen arbeiten rund 74.400 Beschäftigte. 3 von 91 Vergütungsgruppen liegen zwischen 8 und 8,50. Alle anderen Gruppen liegen darüber, 78 Gruppen
Papier verarbeitende Industrie In den ausgewerteten Tarifbereichen arbeiten rund 74.400 Beschäftigte. 3 von 91 Vergütungsgruppen liegen zwischen 8 und 8,50. Alle anderen Gruppen liegen darüber, 78 Gruppen
Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.
 Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.2015 PV-Meldedaten Jan. Dez. 2014 Bundesverband Solarwirtschaft
Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.2015 PV-Meldedaten Jan. Dez. 2014 Bundesverband Solarwirtschaft
1. Allgemeine Hinweise
 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie Auswirkungen
Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie Auswirkungen
BESCHÄFTIGUNG IN DEUTSCHLAND DURCH WINDENERGIE BUNDESLÄNDERERGEBNISSE
 BESCHÄFTIGUNG IN DEUTSCHLAND DURCH WINDENERGIE BUNDESLÄNDERERGEBNISSE Einzelprofile der Bundesländer 17. März 2017 Philip Ulrich Dr. Ulrike Lehr Analyse und Ausarbeitung im Auftrag von - Bundesverband
BESCHÄFTIGUNG IN DEUTSCHLAND DURCH WINDENERGIE BUNDESLÄNDERERGEBNISSE Einzelprofile der Bundesländer 17. März 2017 Philip Ulrich Dr. Ulrike Lehr Analyse und Ausarbeitung im Auftrag von - Bundesverband
Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014
 Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014 Martin R. Textor Das Statistische Bundesamt stellt eine Unmenge an Daten zur Kindertagesbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung.
Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014 Martin R. Textor Das Statistische Bundesamt stellt eine Unmenge an Daten zur Kindertagesbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung.
Energiepreisentwicklung Strom & Gas. Dezember 2016
 Energiepreisentwicklung Strom & Gas Dezember 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Strompreisentwicklung seit Juli 2007 3 Entwicklung Netzentgelte Strom 4 Entwicklung EEG-Umlage 5 Gaspreisentwicklung
Energiepreisentwicklung Strom & Gas Dezember 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Strompreisentwicklung seit Juli 2007 3 Entwicklung Netzentgelte Strom 4 Entwicklung EEG-Umlage 5 Gaspreisentwicklung
Wirkungen von Hochschulen
 UNIVERSITÄT TRIER FB IV Wirtschafts- und Sozialwissenschaften PbSf im Hauptstudium Phase I (SS 2005) Wirkungen von Hochschulen Thema: Öffentliche Haushalte Veranstalter: Prof. Dr. Harald Spehl Dipl.-Geogr.
UNIVERSITÄT TRIER FB IV Wirtschafts- und Sozialwissenschaften PbSf im Hauptstudium Phase I (SS 2005) Wirkungen von Hochschulen Thema: Öffentliche Haushalte Veranstalter: Prof. Dr. Harald Spehl Dipl.-Geogr.
Ergebnisse für die Länder der Bundesrepublik Deutschland
 Ergebnisse für die Länder der Bundesrepublik Deutschland Bildquelle: S. Hofschläger/PIXELIO 4,2 Prozent aller Studenten in der Bundesrepublik studieren an sächsischen Hochschulen, bei den Ingenieurwissenschaften
Ergebnisse für die Länder der Bundesrepublik Deutschland Bildquelle: S. Hofschläger/PIXELIO 4,2 Prozent aller Studenten in der Bundesrepublik studieren an sächsischen Hochschulen, bei den Ingenieurwissenschaften
Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016
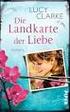 Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Basiswissen Hochschulen/
 Basiswissen Hochschulen Daten zur Hochschulstruktur in Deutschland Autoren: Titel/ Untertitel: Auflage: 5 Stand: 22. September 2009 Institution: Ort: Website: Signatur: n Basiswissen Hochschulen/ Daten
Basiswissen Hochschulen Daten zur Hochschulstruktur in Deutschland Autoren: Titel/ Untertitel: Auflage: 5 Stand: 22. September 2009 Institution: Ort: Website: Signatur: n Basiswissen Hochschulen/ Daten
Die Verschuldung des Landes Thüringen
 Harald Hagn Referat Sonderaufgaben und statistische Analysen Telefon: 03 61 37-8 41 10 E-Mail: Harald.Hagn@statistik.thueringen.de Die Verschuldung des Landes Thüringen Der vorliegende Aufsatz gibt einen
Harald Hagn Referat Sonderaufgaben und statistische Analysen Telefon: 03 61 37-8 41 10 E-Mail: Harald.Hagn@statistik.thueringen.de Die Verschuldung des Landes Thüringen Der vorliegende Aufsatz gibt einen
CHECK24-Autokreditatlas. Analyse der Autokredit-Anfragen aller CHECK24-Kunden seit 2011
 CHECK24-Autokreditatlas Analyse der Autokredit-Anfragen aller CHECK24-Kunden seit 2011 Stand: August 2012 CHECK24 2012 Agenda 1. Methodik 2. Zusammenfassung 3. Kredit, Zinssatz und Einkommen nach Bundesländern
CHECK24-Autokreditatlas Analyse der Autokredit-Anfragen aller CHECK24-Kunden seit 2011 Stand: August 2012 CHECK24 2012 Agenda 1. Methodik 2. Zusammenfassung 3. Kredit, Zinssatz und Einkommen nach Bundesländern
Gesamtfiskalische Kosten der Arbeitslosigkeit im Jahr 2014 in Deutschland
 Aktuelle Daten und Indikatoren Gesamtfiskalische Kosten der Arbeitslosigkeit im Jahr 2014 in Deutschland Februar 2016 Inhalt 1. In aller Kürze...2 2. Staatliche Ausgaben...2 3. Mindereinnahmen der öffentlichen
Aktuelle Daten und Indikatoren Gesamtfiskalische Kosten der Arbeitslosigkeit im Jahr 2014 in Deutschland Februar 2016 Inhalt 1. In aller Kürze...2 2. Staatliche Ausgaben...2 3. Mindereinnahmen der öffentlichen
 Tabelle 1: Verständnis der Bezeichnung "alkoholfreies Bier" Manche Lebensmittel werben mit dem Hinweis, dass ein Stoff nicht in dem Produkt enthalten ist (zum Beispiel "frei von..." oder "ohne..."). Bitte
Tabelle 1: Verständnis der Bezeichnung "alkoholfreies Bier" Manche Lebensmittel werben mit dem Hinweis, dass ein Stoff nicht in dem Produkt enthalten ist (zum Beispiel "frei von..." oder "ohne..."). Bitte
DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT?
 Prof. Dr. Gisela Färber DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT? Vortrag bei der Veranstaltung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Gisela Färber DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT? Vortrag bei der Veranstaltung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz
Bedarf an seniorengerechten Wohnungen in Deutschland
 Bedarf an seniorengerechten Wohnungen in Deutschland Entwicklung der Einwohnerzahl Deutschlands bis 2060 84 Mio. Personen 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Variante1-W1 Variante 2 - W2 64 62 60 2010 2015 2020
Bedarf an seniorengerechten Wohnungen in Deutschland Entwicklung der Einwohnerzahl Deutschlands bis 2060 84 Mio. Personen 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Variante1-W1 Variante 2 - W2 64 62 60 2010 2015 2020
Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland
 Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland 5,0% 5,3% 2,5% 1,9% 3,2% 0,8% 3,4% 1,0% 3,6% 2,6% 1,8% 1,6% 1,6% 0,0% -0,8% -0,2% -2,5% -5,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland 5,0% 5,3% 2,5% 1,9% 3,2% 0,8% 3,4% 1,0% 3,6% 2,6% 1,8% 1,6% 1,6% 0,0% -0,8% -0,2% -2,5% -5,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
