Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs Isländisch - Deutsch
|
|
|
- Jonas Gehrig
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Erla Hallsteinsdóttir Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs Isländisch - Deutsch Abstract In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts am Institut für Fremdsprachenforschung an der Universität in Island vorgestellt. Das Projekt, das von The Icelandic Centre for Research finanziert wird, hat zum Ziel, die bisherige phraseologische Forschung im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Theorien bei der Konzeption einer zweisprachigen computergestützten Phraseologiesammlung kritisch zu durchleuchten und zu ergänzen. Auf der Basis der dabei erzielten Ergebnisse wird exemplarisch eine isländisch-deutsche/deutsch-isländische Phraseologiesammlung erstellt. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich vor allem auf (a) die Möglichkeiten der Darstellung der in der Phraseologiesammlung angebotenen Informationen im Hinblick auf potentielle Benutzergruppen, und (b) die Auswahl und die Bearbeitung der in der Sammlung enthaltenen deutschen und isländischen Phraseologismen auf der Basis von Frequenzuntersuchungen im Korpus. 1. Einleitung Die hier vorgestellten Überlegungen entstanden im Rahmen eines Postdoc-Projekts am Institut für Fremdsprachenforschung (Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum) an der Universität in Island. Die Hauptziele dieses Projekts sind die Aufarbeitung lexikographischer und phraseologischer Theorien im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Theorien bei der Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs und die Umsetzung der Wörterbuchkonzeption in der Praxis in einem zweisprachigen (Isländisch - Deutsch) computergestützten Phraseologiewörterbuch. Ich möchte im Folgenden zwei Aspekte des Projekts diskutieren: (1) die Möglichkeiten der Darstellung der in der Phraseologiesammlung angebotenen Informationen im Hinblick auf potentielle Benutzergruppen, und (2) die Auswahl und die Bearbeitung der in der Sammlung enthaltenen deutschen und isländischen Phraseologismen auf der Basis von Frequenzuntersuchungen im Korpus. Zu Defiziten in der Phraseographie und zur Darstellung der Phraseologie im Wörterbuch gibt es zahlreiche theoretische Überlegungen, Wörterbuchanalysen und Verbesserungsvorschläge (vgl. z.b. Braasch 1988, Burger 1998, Cheon 1998, Kjær 1987, Kühn 1989, Moon 1999, Pilz 1995, Stantcheva 1999, Wotjak 2001, Zöfgen
2 212 Erla Hallsteinsdóttir 1994). Schon vor fast 20 Jahren hat Werner Koller (Koller 1987) seine Überlegungen zum idealen zweisprachigen Phraseologiewörterbuch veröffentlicht. Diese Überlegungen, die allgemein in der Literatur eine breite Zustimmung gefunden haben und vielfach erweitert bzw. ergänzt worden sind, sehen folgende Prinzipien als maßgebend für ein solches Wörterbuch an (vgl. Koller 1987, 111 ff.): (1) Korpusorientiertheit: Orientierung am Phraseologiegebrauch in gesprochenen und geschriebenen Texten. (2) Frequenzorientiertheit: Angaben zur generellen Vorkommensfrequenz. (3) Ökonomie der Beschreibung: Angaben müssen sich an die Benutzergruppen und die möglichen Arten von Benutzung orientieren, sie enthalten u.a. Informationen zur Bedeutung, zu Vorkommensbereichen, zu Gebrauchsbedingungen und zur Syntax. (4) Kontrastive Orientierung: Berücksichtigung sprachenpaarbezogener Relationen und Angaben zur Äquivalenz. Einige von Werner Kollers Überlegungen wurden schon in dem Wörter- und Übungsbuch von Regina Hessky und Stefan Ettinger (Hessky/Ettinger 1997) umgesetzt. Sie fügen jedoch noch weitere Aspekte hinzu, wie ein ideales Phraseologiewörterbuch für Sprachlerner aussehen soll (vgl. Hessky/Ettinger 1997, XV). Der erste Aspekt bezieht sich auf den Zugang zum Wörterbuch. Die Phraseologismen sollen onomasiologisch bzw. ideographisch nach der phraseologischen Bedeutung angeordnet werden. Dies stellt mit der Computertechnik kein Problem mehr dar. Die beiden anderen Aspekte beziehen sich auf den Lernprozess. Etymologische Angaben und Illustrationen sollen als Lernhilfe dienen und ein Übungsteil soll zur Festigung der Phraseologismen im Gedächtnis beitragen. Den Ausgangspunkt für mein Wörterbuchkonzept bildeten Werner Kollers, Regina Hesskys und Stefan Ettingers Überlegungen. Im Laufe der Arbeit sind viele der anderen Gestaltungs- und Verbesserungsvorschläge in die Konzeption eingegangen, z.b. die Überlegungen zur Konzeption einsprachiger phraseologischer Lernerwörterbücher von Mi-Ae Cheon (Cheon 1998, 10-11), die Datenbankkonzeption von Elisabeth Piirainen (Piirainen 2000), die Beschreibungsvorschläge von Wotjak (1992) und Mudersbach (1998), die Konzeption zweisprachiger phraseologischer Wörterbücher von Tatjana Filipenko (Filipenko 2002) sowie Ken Farøs (Farø 2004) Überlegungen zum einsprachigen dänischen Internet-Idiomwörterbuchs, um einige zu nennen. 2. Benutzergruppen und Art des Wörterbuchs Eine grundlegende Frage bei der Wörterbucharbeit ist die Frage danach, welche Informationen in das Wörterbuch aufgenommen und wie sie dargestellt werden
3 Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs 213 sollen. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen zuerst zwei andere Fragen beantwortet werden: (1) Wer soll das Wörterbuch benutzen? (2) In welchen Situationen soll das Wörterbuch benutzt werden? Zu Frage (1): Bei der Bestimmung potentieller Benutzergruppen wird die Frage nach den Zielen eines Wörterbuchs gestellt. Als Wörterbuchziel wird verstanden,... ordbogen dækker det og det område og er beregnet til at give brugere med de og de forudsætninger hjælp i den og den situation til at løse problemer af den og den art. [... dass ein Wörterbuch mit einem bestimmten Inhalt seinen Benutzern, die bestimmte Voraussetzungen mitbringen, als Hilfsmittel bei der Lösung bestimmter Art von Problemen dienen soll.] (Tarp 1998, 123). Als die primäre Benutzergruppe sind hier vorgesehen: isländische Deutschlehrer, Deutschlerner, Studenten und Übersetzer, die deutsche oder isländische Phraseologismen verstehen, verwenden und/oder übersetzen wollen. Zusätzlich kann man mit dem Gedanken spielen, welche Benutzergruppen noch von einem Phraseologiewörterbuch profitieren können. Als eine potentielle sekundäre Benutzergruppe kommen die Benutzer in Frage, die sich einsprachig über die isländische oder die deutsche Phraseologie informieren wollen. Durch meine Erfahrungen mit der phraseologischen Kompetenz jüngerer Sprecher (vgl. Hallsteinsdóttir 2001) gehe ich davon aus, dass sich die Wörterbuchinformationen, die deutsche (bzw. isländische) Muttersprachler und Deutschlerner (bzw. Isländischlerner) brauchen, nicht sehr stark unterscheiden. Daher wären benutzergerechte Informationen für diese unterschiedlichen Benutzergruppen in einem Wörterbuch prinzipiell vereinbar. Zu Frage (2): Häufig werden die Wörterbücher nach der Art der Benutzung in passive und aktive Wörterbücher aufgeteilt. Passive Wörterbücher sollen als Hilfsmittel bei der Rezeption von Texten (also beim Verstehen) verwendet werden und aktive Wörterbücher sollen als Hilfsmittel bei der Produktion von Texten eingesetzt werden (vgl. z.b. Filipenko 2002 zu aktiven Phraseologiewörterbüchern). Bei der genaueren Betrachtung dieser Einteilung fällt auf, dass ein aktives Wörterbuch auch die Informationen enthalten muss, die in einem passiven Wörterbuch vorhanden sind. Es sind in der Regel Informationen zur Bedeutung, ohne die ein aktives Verwenden eines Phraseologismus nicht möglich ist. Daher ist die Unterscheidung in aktive und passive Wörterbücher nur dann relevant, wenn die Auswahl der Informationen aus einem bestimmten Grund wie z.b. Platzmangel im gedruckten Wörterbuch oder Inhaltsvorgaben durch einen Verlag begrenzt werden muss. Die Unterscheidung in aktiv (erkennen, verstehen und verwenden) und passiv (erkennen und verstehen) bleibt jedoch als Maßstab für die Beherrschung von Phraseologismen weiterhin relevant; für die Perspektive der Sprachverwendung (Geläu-
4 214 Erla Hallsteinsdóttir figkeitsgrad), im Bezug auf die Phraseologie beim Fremdsprachenlernen und in der Lexikographie im Zusammenhang mit dem Begriff Wörterbuchfunktion. Eine Wörterbuchfunktion wird definiert nach der Relation zwischen den Bedürfnissen der Wörterbuchbenutzer in bestimmten Benutzungssituationen und dem Wörterbuchinhalt. Die Definition bezieht sich auf das im Wörterbuch vorhandene Angebot an Informationen, das zu einer erfolgreichen Wörterbuchbenutzung in einer bestimmten Benutzungssituation führt (vgl. Tarp 1998, 123). Bei der Auswahl von Informationen gehe ich von folgenden möglichen Benutzungssituationen der primären Benutzergruppe (isländische Deutschlerner) aus, die an die kommunikationsbezogenen Hauptfunktionen von Wörterbüchern Wörterbücher dienen als Hilfsmittel bei der Produktion und der Rezeption von Texten in der Muttersprache oder in einer Fremdsprache und bei der Übersetzung von Texten in die Muttersprache oder in eine Fremdsprache (vgl. Tarp 1998, 123 siehe dazu auch Bergenholtz 1997) und an den phraseologischen Dreischritt (vgl. Kühn 1994, 424 ff.) angelehnt sind: (1) Das Erkennen und das Verstehen von Phraseologismen (Deutsch und Isländisch). (2) Das Verwenden von Phraseologismen (Deutsch und Isländisch). (3) Das Übersetzen von Phraseologismen (ins Isländische, ins Deutsche). In einer zweisprachigen Sprachverarbeitung ist die Grenze zwischen Verstehen, Verwenden und Übersetzen allerdings nicht immer klar und sie ist auch vom theoretischen Übersetzungsverständnis abhängig, d.h. es ist nicht eindeutig, wann die Sprachverarbeitung in einer Fremdsprache auf dem Übersetzen aus der Muttersprache basiert (siehe Hallsteinsdóttir 2001 zum muttersprachlichen Einfluss auf die Phraseologie in der fremdsprachlichen Sprachverarbeitung). Das Wörterbuch soll Informationen enthalten, die es den Benutzern ermöglichen, Phraseologismen zu erkennen und zu verstehen, zu verwenden und zu übersetzen. Dabei soll das Wörterbuch unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Benutzergruppen erfüllen (vgl. zur Polyfunktionalität von Wörterbüchern: Bergenholtz 1997 und Tarp 1998, 123). Die Auswahl und die Strukturierung der Informationen erfolgt danach, in welcher Benutzungssituation sie relevant sind. Danach wird auch der visuelle Aufbau der Datenbankinhalte realisiert.
5 Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs Der Aufbau des Wörterbuchs 3.1. Die Datenbankstruktur Das Wörterbuch wird mit der Datenbanksoftware asksam ( realisiert. Die Datenbank hat eine hierarchisch geordnete Struktur und sie ist modular aufgebaut. Es gibt ein übergeordnetes Modul für metalexikographische Informationen und Zugangsmöglichkeiten (Hypertextmenüs, Suchmöglichkeiten, Begleittexte) sowie ein Modul für jede Sprache (Deutsch und Isländisch). Die Sprachmodule enthalten die Hauptdokumente mit den einzelnen Wörterbucheinträgen sowie Module mit Textbelegen und zusätzlichen, nach Bedarf abrufbaren Informationen. Die Module sind untereinander mit Hyperlinks verbunden. Abbildung 1: Aufbau der Datenbank Eine meiner ersten Feststellungen war, dass viele der Defizite in der Phraseographie auf die eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten im Medium gedrucktes Buch zurückzuführen sind. Daher wurde die Wörterbuchkonzeption von Anfang an für ein elektronisches Wörterbuch gemacht und eine Publikation als gedrucktes Buch ist nicht vorgesehen Die Informationsstruktur in der Datenbank Die Informationsstruktur in der Datenbank wird im Hinblick auf die Bedürfnisse der primären Benutzergruppe aufgebaut. Die Wörterbuchinformationen sowie
6 216 Erla Hallsteinsdóttir deren interne Struktur und Relationen zwischen Informationseinheiten sind daher immer in Relation zu potentiellen Benutzungssituationen Erkennen, Verstehen, Verwenden und Übersetzen zu sehen. Generell kann man sagen, dass sich das Problem des Erkennens eines Phraseologismus als eine lexikalisierte Einheit nur schwer in eine Wörterbuchkonzeption wie die hier beschriebene aufnehmen lässt, denn ein Wörterbuchbenutzer wird eine Wortverbindung wohl erst dann in einem Phraseologiewörterbuch nachschlagen, wenn er vermutet, dass es sich um einen Phraseologismus handelt, ihn also schon identifiziert hat. Eine Überprüfung, ob und in welcher Form ein Wort oder eine Wortkombination in Phraseologismen vorkommt, ist durch eine Suche in der Datenbank möglich. Jeder Phraseologismus wird in einem Hauptdokument im einsprachigen Modul dargestellt. Das Hauptdokument fängt mit einer Nennform an, die als die Minimalform eines Phraseologismus (nominaler Teil bzw. Infinitivform) in der Datenbank hauptsächlich zur eindeutigen Identifizierung des Phraseologismus bei den fertig konstruierten Zugangsmöglichkeiten und bei der Verlinkung von Informationen dient. Dann folgen mögliche Verwendungsformen des Phraseologismus, die als Aussageformen aufgeführt werden. Diese ermöglichen einerseits die Identifizierung der Form eines Phraseologismus und sollen andererseits als Hilfe für die Konstruktion der richtigen Form bei der aktiven Verwendung dienen. Die Aussageformen zeigen mögliche syntaktische Strukturen mit den Stellvertretern jemand und etwas. Grammatische Erläuterungen werden in {} angegeben und semantische Angaben zu einzelnen Aktanten in <> angezeigt. Außerdem gibt es Hinweise auf grammatische und lexikalische Variationsmöglichkeiten sowie auf eine mögliche wörtliche Verwendung der Wortkombination. Zusätzlich können Verwendungsbeispiele durch einen Hyperlink aufgerufen werden. Zu jedem Phraseologismus wurden 100 Belegstellen aus dem Korpus Deutscher Wortschatz ( ausgewertet und in einem eigenen Datenbankmodul verwaltet. In diesem Modul gibt es außerdem Beispiele für Negationsformen und Modifikationen, die durch Hyperlinks mit dem Hauptdokument verbunden sind. Zusätzlich gibt es ein Raster für die Erfassung grammatischer, syntaktischer und semantischer Restriktionen, die für die aktive Verwendung eines Phraseologismus relevant sind. Die Bedeutung des Phraseologismus wird in einer Bedeutungsparaphrase in einfacher, verständlicher Sprache angegeben. Die Bedeutungsangabe bildet einerseits die Grundlage für das Verstehen eines Phraseologismus und andererseits ist eine ausführliche Bedeutungsparaphrase unerlässlich für die richtige Verwendung und
7 Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs 217 für die Übersetzung. In einem zweisprachigen Wörterbuch sollte die Bedeutungsparaphrase in beiden Sprachen vorhanden sein. Weitere Informationen, die sowohl beim Verstehen als auch beim Übersetzen eine Hilfe bieten sollen, sind: (1) Eine «Wort-für-Wort»-Übersetzung einzelner Komponenten. (2) Die Angabe von äquivalenten und kongruenten Phraseologismen (als Hyperlinks zu den entsprechenden Hauptdokumenten in der anderen Sprache) und die Erklärung der Äquivalenzbeziehung (die Angabe der Art der Äquivalenz mit Berücksichtigung der Bedeutung und der Form, die Erklärung eventueller Abweichungen in der Äquivalenz sowie eine deutliche Markierung potentieller falscher Freunde). (3) Wünschenswert wäre außerdem ein Modul mit kontrastiv ausgewerteten Korpusbelegen mit den Phraseologismen (siehe Abbildung 1), um Übersetzungsmöglichkeiten mittels Anwendungssituationen in Texten aufzuzeigen (vgl. Filipenko 2002, 44). Inwieweit die Erklärung der Etymologie eines Phraseologismus beim Verstehen der phraseologischen Bedeutung hilft, ist nicht ganz unumstritten. Hier ist zusätzlich zur Bedeutungsparaphrase eine etymologische Erklärung vorgesehen, eventuell mit Illustrationen, die als Lernhilfe dienen sollen (vgl. Hessky/Ettinger 1997, XV). Für die Verwendung und die Übersetzung eines Phraseologismus sind Kenntnisse seiner pragmatischen Eigenschaften wichtig. Eine Art pragmatischer Kommentar soll die Verwendungsmöglichkeiten des Phraseologismus genauer erläutern. Der Kommentar wird sich an der Funktion des Phraseologismus (nach der Lasswell- Formel) in den Korpusbelegen orientieren. Vorgesehen sind Angaben zu typischen Verwendungssituationen, Gebrauchsrestriktionen und Frequenz in Texten. Zusätzlich zu den für den normalen Benutzer vorgesehenen Informationen ist bei der lexikographischen (Vor-)Arbeit eine Menge an anderen Daten entstanden (Informationen zur Metaphorik, Bedeutungskonzepte, semantische Felder, Frequenzangaben, Korpusbelege). Diese Daten bilden einerseits die Grundlage für einen Teil der lexikographischen Arbeit, z.b. für die Erfassung semantischer Relationen (Antonyme bzw. Synonyme), die Gestaltung der Hypertextmenüs mit semasiologischen und onomasiologischen Zugangsmöglichkeiten und andererseits stehen sie in der Datenbank für weitere wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung. WissenschaftlerInnen bilden also eine weitere potentielle Benutzergruppe, deren Bedürfnisse jedoch bei der Konzeption nicht explizit berücksichtigt wurden. 4. Die Auswahl der Phraseologismen Um Werner Kollers Forderung nach Korpusorientiertheit und Frequenzorientiertheit (Koller 1987) zu erfüllen und um eine solide Basis für die Auswahl der
8 218 Erla Hallsteinsdóttir Phraseologismen für das Wörterbuch zu schaffen, wurden Frequenzuntersuchungen durchgeführt (vgl. ausführliche Darstellung in Hallsteinsdóttir im Druck, vgl. außerdem zu Frequenzuntersuchungen in der Phraseologie anderer Sprachen z.b. Cermák 2003, Colson 2003 und Cowie 2003). Als Ausgangsmaterial für diese Untersuchungen wurden die Phraseologismen aus zwei Wörterbüchern für Deutsch als Fremdsprache (Götz/Haensch/Wellmann 1997 und Kempcke 2000 vgl. Wotjak 2001 zur Phraseologie in Kempcke 2000), zwei phraseologischen Wörterbüchern (Griesbach/Schulz, 2000 und Hessky/Ettinger 1997) sowie eine Liste mit intersubjektiv geläufigen Phraseologismen des Deutschen (vgl. Dobrovol skij 1997) verwendet. Zu ca von den etwa 6000 in den Wörterbüchern vorhandenen Phraseologismen konnten eindeutige Suchformen konstruiert werden. Diese wurden im Korpus Deutscher Wortschatz ( an der Universität in Leipzig auf ihre Häufigkeit überprüft. Um die Frequenzangaben möglichst genau zu machen, wurden in einem ersten Arbeitsschritt vorhandene Variationen von Phraseologismen manuell in einer Frequenzangabe zusammengefasst. Diese sind in den Wörterbüchern teilweise als eigenständige Phraseologismen aufgeführt worden (z.b. Aspektwechsel wie in an der Spitze sein (Belegstellen: 12574), an die Spitze kommen, (jemanden) an die Spitze setzen (Suchform: an die Spitze, Belegstellen: 4051), Belegstellen insgesamt: 16625). In der Auswertung wurden aus methotischen Gründen nur die Phraseologismen verwendet, die ein Substantiv als Komponente haben. Als Grundlage für die Datenbank wurden die 300 Phraseologismen genommen, deren Suchformen in mehr als 1000 Korpusbelegen vorkamen. Zu diesen 300 Phraseologismen kommen im Laufe der lexikographischen Arbeit weitere Phraseologismen hinzu: (1) Bei der Auswertung der Korpusbelege hat sich herausgestellt, dass in vielen Fällen nicht nur die gesuchten Phraseologismen gefunden wurden, sondern auch andere Phraseologismen, die eine ähnliche Form haben (vgl. Hallsteinsdóttir 2001, 210 ff. zur Rolle struktureller Analogie beim Verstehen von Phraseologismen). Diese Phraseologismen wurden ebenfalls in die Datenbank aufgenommen und sie sind in den Hauptdokumenten untereinander mit Hyperlinks verbunden. (2) Synonyme und antonyme Phraseologismen zu den 300 häufigsten Phraseologismen werden zusätzlich aufgenommen, um semantische phraseologische Relationen anzeigen zu können. (3) Es ist davon auszugehen, dass beim Erfassen der deutschen Äquivalente vom Isländischen ausgehend weitere deutsche Phraseologismen aufgenommen werden müssen. Dies führt dazu, dass die endgültige Anzahl der Phraseologismen erst dann feststehen wird, wenn das Wörterbuch abgeschlossen ist.
9 Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs Zusammenfassung und Ausblick Eine Datenbank als Medium für ein Phraseologiewörterbuch ist nicht an die Zweidimensionalität eines gedruckten Buches gebunden, sondern kann auf mehreren Ebenen hierarchisch angeordnet werden. Die Mehrdimensionalität ermöglicht eine Orientierung an unterschiedlichen Bedürfnissen der vorgesehenen Wörterbuchbenutzer, in dem bestimmte Informationen in Modulen ausgelagert werden können. Diese Informationen können, je nach individuellen Bedürfnissen und Benutzungssituationen, durch Hyperlinks abgerufen werden. Bei der Bearbeitung des isländischen Moduls ist noch eine Reihe von Problemen ungelöst. Es gibt kein vergleichbares phraseologisches Ausgangsmaterial, denn es gibt keine Wörterbücher für Isländisch als Fremdsprache und die einsprachigen isländischen Phraseologiewörterbücher sind aufgrund ihrer Konzeption oder der enthaltenen Phraseologismen als Grundlage ungeeignet (z.b. ist Jónsson 2002 mit Phraseologismen viel zu umfangreich). Es gibt noch kein geeignetes Textkorpus für die Frequenzuntersuchungen und es gibt kaum Ergebnisse aus der Phraseologieforschung, auf die man bei der phraseographischen Arbeit zurückgreifen könnte. In der deutschen Phraseologieforschung bestehen nach wie vor Defizite in der Vorarbeit für phraseographische Arbeiten. Es müsste z.b. ein umfangreiches Ausgangskorpus mit Phraseologismen für Geläufigkeits- und Frequenzbestimmungen erfasst werden (als eine Art phraseologisches Maximum). Darauf aufbauend sollte eine umfassende wissenschaftliche Beschreibung jedes «geläufigen» Phraseologismus vorgenommen werden (vgl. Fellbaum et al. in diesem Band und Ein solches einsprachiges Phraseologiekorpus könnte dann (als ein phraseologisches Optimum) als Grundlage für benutzerspezifische ein- und mehrsprachige Wörterbücher dienen. Die meisten Datenbanksysteme, die für Wörterbücher in Frage kommen, ermöglichen die Erstellung von Reports mit ausgewählten Inhalten, die genau auf die Bedürfnisse einzelner Benutzergruppen zugeschnitten werden können. Bei zweisprachigen Wörterbüchern muss dann nur der kontrastive Teil erarbeitet werden.
10 220 Erla Hallsteinsdóttir 5. Literatur Bergenholtz, Henning (1997): Polyfunktionale ordbøger. In: LexicoNordica , Braasch, Anna (1988): Zur lexikographischen Kodifizierung von Phrasemen in einsprachigen deutschen Wörterbüchern aus der Sicht eines ausländischen Wörterbuchbenutzers. In: Karl Hyldgaard-Jensen und Arne Zettersten (Hg.): Symposium on Lexicography IV. Proceedings of the Fourth International Symposium on Lexicography April 20-22, 1988 at the University of Copenhagen. Tübingen, Burger, Harald (1998): Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin. Cermák, František (2003): Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence. In: Harald Burger, Annelies Häcki Buhofer und Gertrud Gréciano (Hg.): Flut von Texten Vielfalt der Kulturen. Baltmannslweiler, Cheon, Mi-Ae (1998): Zur Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs für den Fremdsprachler. Tübingen. Colson, Jean-Pierre (2003): Corpus Linguistics and Phraseological Statistics: a few Hypotheses and Examples. In: Harald Burger, Annelies Häcki Buhofer und Gertrud Gréciano (Hg.): Flut von Texten Vielfalt der Kulturen. Baltmannslweiler, Cowie, Anthony P. (2003): Exploring native-speaker knowledge of phraseology: informant testing or corpus research? In: Harald Burger, Annelies Häcki Buhofer und Gertrud Gréciano (Hg.): Flut von Texten Vielfalt der Kulturen. Baltmannslweiler, Dobrovol skij, Dmitrij (1997): Idiome im mentalen Lexikon: Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung. Trier. Farø, Ken (2004): Idiomer på nettet: Den danske idiomordbog og fraseografien ( idiomordbogen.dk). In: Hermes, Journal of Linguistics no , Filipenko, Tat jana V. (2002): Beschreibung der Idiome in einem zweisprachigen Idiomatik- Wörterbuch (Deutsch-Russisch). In: «Das Wort» Germanistisches Jahrbuch der GUS Götz, Dieter/Haensch, Günther/Wellmann, Hans (Hg.) (1997): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (5. Aufl.). Berlin. Gréciano, Gertrud/Rothkegel, Annely (1995): CONPHRAS - Phraséologie Contrastive / Kontrastive Phraseologie im Rahmen von PROCOPE (Programme de Coopération Scientifique). In: Rupprecht S. Baur und Christoph Chlosta (Hg.): Von der Einwortmetapher zur Satzmetapher. Akten des Westfälischen Arbeitskreises Phraseologie/Parömiologie. Bochum, Griesbach, Heinz/Schulz, Dora (2000): 1000 deutsche Redensarten. Mit Erklärungen und Anwendungsbeispielen. Berlin, München, Wien, Zürich, New York. Hallsteinsdóttir, Erla (in Vorbereitung): A bilingual electronic dictionary of idioms. Erscheint in: Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography (Terminology and Lexicography Research and Practice). Hallsteinsdóttir, Erla (im Druck): Vom Wörterbuch zum Text zum Lexikon. Erscheint im Tagungsband: Zwischen Lexikon und Text lexikalische, textlinguistische und stilistische Aspekte. Interdisziplinäres und internationales Kolloquium aus Anlass des 60. Geburtstages von Irmhild Barz. Leipzig
11 Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs 221 Hallsteinsdóttir, Erla (2003): Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch. In: Harald Burger, Annelies Häcki Buhofer und Gertrud Gréciano (Hg.): Flut von Texten Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. Baltmannsweiler, Hallsteinsdóttir, Erla (2001): Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch. Hamburg. [ Harras, Gisela (1997): Idiome. In: Klaus Peter Konerding und Andrea Lehr (Hg.): Linguistische Theorie und lexikograpische Praxis. Symposiumsvorträge, Heidelberg Tübingen, Hessky, Regina/Ettinger, Stefan (1997): Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Tübingen. Jónsson, Jón Hilmar (2002): Orðaheimur. Íslensk hugtakaorðabók með orða- og orðasambandaskrá. Reykjavík. Kempcke, Günter (unter Mitarbeit von Seelig, Barbara/Wolf, Birgit/Tellenbach, Elke et al) (2000): Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, New York. Kjær, Anne Lise (1987): Zur Darbietung von Phraseologismen in einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen aus der Sicht ausländischer Textproduzenten. In: Jarmo Korhonen (Hg.): Beiträge zur allgemeinen und germanistischen Phraseologieforschung. Internationales Symposium in Oulu Juni Oulu, Koller, Werner (1987): Überlegungen zu einem Phraseologie-Wörterbuch für Fremdsprachenunterricht und Übersetzungspraxis. In: Harald Burger und Robert Zett (Hg.): Aktuelle Probleme der Phraseologie. Bern, Kühn, Peter (1994): Pragmatische Phraseologie: Konsequenzen für die Phraseographie und Phraseodidaktik. In: Barbara Sandig (Hg.): Europhras 92: Tendenzen der Phraseologieforschung. Bochum, Kühn, Peter (1989): Phraseologie und Lexikographie: zur semantischen Kommentierung phraseologischer Einheiten im Wörterbuch. In: Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Wörterbücher in der Diskussion. Vorträge aus dem Heidelberger Lexikographischen Kolloquium. Tübingen, Moon, Rosamund (1999): Needles and haystacks, idioms and corpora: Gaining insights into idioms, using corpus analysis. In: Thomas Herbst und Kerstin Popp (Hg.): The Perfect Learners Dictionary. Tübingen, Mudersbach, Klaus (1998): Ein Vorschlag zur Beschreibung von Phrasemen auf der Basis eines universalen pragmatischen Modells. In: Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Wörterbücher in der Diskussion III. Vorträge aus dem Heidelberger Lexikographischen Kolloquium. Tübingen, Nielsen, Sandro (2002): Lexicographical Basis for an Electronic Bilingual Acconunting Dictionary: Theoretical Considerations. (Auf Dänisch in LexicoNordica , ). [ Piirainen, Elisabeth (2000): Phraseologie der westmünsterländischen Mundart. Teil 1. Semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen. Baltmannsweiler.
12 222 Erla Hallsteinsdóttir Pilz, Klaus Dieter (1995): Duden 11. Redewendungen (...) - Das anhaltende Elend mit den phraseologischen Wörterbüchern (Phraseolexika). In: Rupprecht S. Baur und Christoph Chlosta (Hg.): Von der Einwortmetapher zur Satzmetapher. Akten des Westfälischen Arbeitskreises Phraseologie/Parömiologie. Bochum, Stantcheva, Diana (1999): Zum Stellenwert der Phraseologie im einsprachigen deutschen Bedeutungswörterbuch des 20. Jahrhunderts. In: Linguistik online 3, 2/99. [www. linguistik-online.de] Tarp, Sven (1998): Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret perspektiv. In: Hermes, Journal of Linguistics no , Wotjak, Barbara (2001): Phraseologismen im neuen Lernerwörterbuch - Aspekte der Phraseologiedarstellung im de Gruyter-Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. In: Annelies Häcki Buhofer und Harald Burger (Hg.): Phraseologiae Amor. Aspekte europäischer Phraseologie. Baltmannsweiler, Wotjak, Barbara (1992): Verbale Phraseologismen in System und Text. Tübingen. Zöfgen, Ekkehard (1994): Lernerwörterbücher in Theorie und Praxis. Ein Beitrag zur Metalexikographie mit besonderer Berücksichtigung des Französischen. Tübingen
Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie
 Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie Abgründe und Brücken Festgabe für Regina Hessky Herausgegeben von Rita Brdar-Szabö und Elisabeth Knipf-Komlösi PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften
Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie Abgründe und Brücken Festgabe für Regina Hessky Herausgegeben von Rita Brdar-Szabö und Elisabeth Knipf-Komlösi PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften
Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchungen
 Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchungen Erla Hallsteinsdóttir (Odense)/Monika ajánková (Bratislava)/Uwe Quasthoff
Phraseologisches Optimum für Deutsch als Fremdsprache. Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchungen Erla Hallsteinsdóttir (Odense)/Monika ajánková (Bratislava)/Uwe Quasthoff
Zweisprachige Lernerphraseografie aus funktionaler Sicht
 Erla Hallsteinsdóttir Zweisprachige Lernerphraseografie aus funktionaler Sicht Abstract In this paper I discuss the lexicographic data that foreign language learner need in a bilingual dictionary of phraseology
Erla Hallsteinsdóttir Zweisprachige Lernerphraseografie aus funktionaler Sicht Abstract In this paper I discuss the lexicographic data that foreign language learner need in a bilingual dictionary of phraseology
Universität Hamburg. Institut für Germanistik I Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn
 Universität Hamburg Institut für Germanistik I 07.137 Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn Lexikographie 20.06.2006 Referentin: Yvette Richau Was ist Lexikographie?
Universität Hamburg Institut für Germanistik I 07.137 Seminar 1b: Wort, Name, Begriff Seminarleiter: Prof. Dr. Walther v. Hahn Lexikographie 20.06.2006 Referentin: Yvette Richau Was ist Lexikographie?
Phraseologie. Eine Einfuhrung am Beispiel des Deutschen ERICH SCHMIDT VERLAG. von Harald Burger. 2., überarbeitete Auflage
 Phraseologie Eine Einfuhrung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 2., überarbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Vorwort 9 1. Einführung und Grundbegriffe 11 1.1. Erste Beobachtungen und Grundbegriffe
Phraseologie Eine Einfuhrung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 2., überarbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Vorwort 9 1. Einführung und Grundbegriffe 11 1.1. Erste Beobachtungen und Grundbegriffe
Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen ERICH SCHMIDT VERLAG. von Harald Burger. 3., neu bearbeitete Auflage
 Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 3., neu bearbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 3., neu bearbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. von Harald Burger ERICH SCHMIDT VERLAG. 3., neu bearbeitete Auflage
 Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 3., neu bearbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Vorwort 9 1. Einführung und Grundbegriffe 11 1.1. Erste Beobachtungen und Grundbegriffe
Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger 3., neu bearbeitete Auflage ERICH SCHMIDT VERLAG Vorwort 9 1. Einführung und Grundbegriffe 11 1.1. Erste Beobachtungen und Grundbegriffe
Valenzwörterbuchs deutscher und polnischer Verben
 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie El bieta PAWLIKOWSKA-ASENDRYCH Untersuchungen zum Modell eines didaktisch orientierten Valenzwörterbuchs deutscher und polnischer Verben Cz stochowa 2010 3 Inhaltsverzeichnis
Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie El bieta PAWLIKOWSKA-ASENDRYCH Untersuchungen zum Modell eines didaktisch orientierten Valenzwörterbuchs deutscher und polnischer Verben Cz stochowa 2010 3 Inhaltsverzeichnis
Anleitung zur Verwendung der Bibliographie Katharina Rose & Barbara Schlichtmann
 erstellt von Katharina Rose & Barbara Schlichtmann Anleitung zur Verwendung der Bibliographie Katharina Rose & Barbara Schlichtmann Die vorliegende Bibliographie ist aus dem Seminar Phraseologismen im
erstellt von Katharina Rose & Barbara Schlichtmann Anleitung zur Verwendung der Bibliographie Katharina Rose & Barbara Schlichtmann Die vorliegende Bibliographie ist aus dem Seminar Phraseologismen im
Literatur in Auswahl
 Kristin Bührig Seite -1- Literatur in Auswahl Agricola, E. (1968) Einführung in die Probleme der Redewendungen. In: Agricola, E. (ed.) (1968) Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch.
Kristin Bührig Seite -1- Literatur in Auswahl Agricola, E. (1968) Einführung in die Probleme der Redewendungen. In: Agricola, E. (ed.) (1968) Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch.
I. (= 7), 1995, 410 S., 59,80 DM.
 Jarmo Korhonen: Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen I. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer (= Studien zur Phraseologie und Parömiologie; 7), 1995, 410 S., 59,80 DM. Zu den vielen
Jarmo Korhonen: Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen I. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer (= Studien zur Phraseologie und Parömiologie; 7), 1995, 410 S., 59,80 DM. Zu den vielen
Juristisches Übersetzen Spanisch - Deutsch: Immobilienkaufverträge
 Ina Stengel-Hauptvogel * * Juristisches Übersetzen Spanisch - Deutsch: Immobilienkaufverträge Gunter Narr Verlag Tübingen INHALTSVERZEICHNIS I.Einleitung 1 1.1 Allgemeines 1 1.2 Korpus 2 2. Zielsetzung
Ina Stengel-Hauptvogel * * Juristisches Übersetzen Spanisch - Deutsch: Immobilienkaufverträge Gunter Narr Verlag Tübingen INHALTSVERZEICHNIS I.Einleitung 1 1.1 Allgemeines 1 1.2 Korpus 2 2. Zielsetzung
Kollokationen im Lernerwörterbuch
 Kollokationen im Lernerwörterbuch Anspruch und Wirklichkeit Jupp Möhring Universität Leipzig/ Herder-Institut Vortrag zur IDT 2009 Sektion H6: Phraseologie: Linguistische, kulturkontrastive und didaktische
Kollokationen im Lernerwörterbuch Anspruch und Wirklichkeit Jupp Möhring Universität Leipzig/ Herder-Institut Vortrag zur IDT 2009 Sektion H6: Phraseologie: Linguistische, kulturkontrastive und didaktische
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 36 Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 36 Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen von Harald Burger
BALDAUF, Christa (1997): Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher: Frankfurt am Main: Peter Lang.
 LITERATURVERZEICHNIS BALDAUF, Christa (1997): Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher: Frankfurt am Main: Peter Lang. BALLY, Charles (1909): Traité de stylistique française.
LITERATURVERZEICHNIS BALDAUF, Christa (1997): Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher: Frankfurt am Main: Peter Lang. BALLY, Charles (1909): Traité de stylistique française.
XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Jena-Weimar, 3.-8. August 2009
 TAMÁS KISPÁL (UNIVERSITÄT SZEGED) DIE METAPHORISCHE MOTIVIERTHEIT BEIM ERLERNEN VON IDIOMEN XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Jena-Weimar, 3.-8. August 2009 1 INHALT 1.
TAMÁS KISPÁL (UNIVERSITÄT SZEGED) DIE METAPHORISCHE MOTIVIERTHEIT BEIM ERLERNEN VON IDIOMEN XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Jena-Weimar, 3.-8. August 2009 1 INHALT 1.
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
 Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft lutz.koester@uni-bielefeld.de Dr. Lutz Köster Die Qual der Wahl?! Einsprachige DaF-Lernerwörterbücher Bozen, im Juli 2013 Das Dutzend ist voll seit Langenscheidts
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft lutz.koester@uni-bielefeld.de Dr. Lutz Köster Die Qual der Wahl?! Einsprachige DaF-Lernerwörterbücher Bozen, im Juli 2013 Das Dutzend ist voll seit Langenscheidts
Antje Heine (Leipzig/Helsinki) in Form eines Post-Doc-Stipendiums von der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie der Universität Helsinki finanziert.
 Ansätze zur Darstellung nicht- und schwach idiomatischer verbonominaler Wortverbindungen in der zweisprachigen (Lerner-)Lexikografie Deutsch-Finnisch (Beschreibung eines Forschungsvorhabens) Antje Heine
Ansätze zur Darstellung nicht- und schwach idiomatischer verbonominaler Wortverbindungen in der zweisprachigen (Lerner-)Lexikografie Deutsch-Finnisch (Beschreibung eines Forschungsvorhabens) Antje Heine
Erla Hallsteinsdóttir* Phraseographie
 91 Erla Hallsteinsdóttir* Phraseographie Abstract Multiword expressions i.e. phraseological units like idioms and collocations are one of the most interesting part of every language. In this article, I
91 Erla Hallsteinsdóttir* Phraseographie Abstract Multiword expressions i.e. phraseological units like idioms and collocations are one of the most interesting part of every language. In this article, I
Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations
 Wirtschaft Jörn Krüger Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations Eine theoretische und empirische Analyse Diplomarbeit Bibliografische
Wirtschaft Jörn Krüger Das Internet als Instrument der Unternehmenskommunikation unter besonderer Berücksichtigung der Investor Relations Eine theoretische und empirische Analyse Diplomarbeit Bibliografische
Depressionen nach der Schwangerschaft
 Geisteswissenschaft Friederike Seeger Depressionen nach der Schwangerschaft Wie soziale Beratung zur Prävention postpartaler Depressionen beitragen kann Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Geisteswissenschaft Friederike Seeger Depressionen nach der Schwangerschaft Wie soziale Beratung zur Prävention postpartaler Depressionen beitragen kann Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen
1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Von den Studierenden wird erwartet, dass sie anhand der Lektüre empfohlener Sekundärliteratur über ausgewählte Entwicklungstendenzen
1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Von den Studierenden wird erwartet, dass sie anhand der Lektüre empfohlener Sekundärliteratur über ausgewählte Entwicklungstendenzen
Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Herbstsemester 2011/2012 Assist. Daumantas Katinas
 Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache Herbstsemester 2011/2012 Assist. Daumantas Katinas 7.9.2011 Überblick 15 Lehrveranstaltungen Teilnahmepflicht an 10 Veranstaltungen 1 schriftliche Kontrollarbeit
Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache Herbstsemester 2011/2012 Assist. Daumantas Katinas 7.9.2011 Überblick 15 Lehrveranstaltungen Teilnahmepflicht an 10 Veranstaltungen 1 schriftliche Kontrollarbeit
Regula Schmidlin, Universität Basel (Schweiz) Lexikographische Probleme bei phraseologischen Varianten
 In: Földes, Csaba und Wirrer, Jan (Hgg.) Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Akten der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) und des Westfälischen
In: Földes, Csaba und Wirrer, Jan (Hgg.) Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Akten der Europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) und des Westfälischen
Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung
 Impressum Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung Herausgeberbeirat Zofia Bilut-Homplewicz (Rzeszów), Stojan Bračič (Ljubljana), Uwe Dethloff (Saarbrücken), Una Dirks (Hildesheim), Ewa Drewnowska-Vargáné
Impressum Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung Herausgeberbeirat Zofia Bilut-Homplewicz (Rzeszów), Stojan Bračič (Ljubljana), Uwe Dethloff (Saarbrücken), Una Dirks (Hildesheim), Ewa Drewnowska-Vargáné
Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince"
 Sprachen Hannah Zanker Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince" Facharbeit (Schule) 1 Maristenkolleg Mindelheim Kollegstufenjahrgang 2009/2011 Facharbeit aus
Sprachen Hannah Zanker Das Problem der Übersetzung anhand von Antoine de Saint-Exupérys "Le Petit Prince" Facharbeit (Schule) 1 Maristenkolleg Mindelheim Kollegstufenjahrgang 2009/2011 Facharbeit aus
1. Lexikographie: Gegenstand und Teilbereiche
 PS Sprachgebrauch: Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache Sergios Katsikas 1. Lexikographie: Gegenstand und Teilbereiche Der Terminus Lexikographie wird zur Bezeichnung von zwei Arbeitsfeldern verwendet,
PS Sprachgebrauch: Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache Sergios Katsikas 1. Lexikographie: Gegenstand und Teilbereiche Der Terminus Lexikographie wird zur Bezeichnung von zwei Arbeitsfeldern verwendet,
Gebrauch allg. einspr. Wörterbücher. Legitimation Wörterbuchschreibung
 Nils Burghardt Kühn/Püschel: Gebrauch allg. einspr. Wörterbücher Spezialwörterbücher Legitimation Wörterbuchschreibung Spezialwörterbuch: konkreter Zweck eindeutiger Benutzer Legitimation! Allg. Wörterbuch:
Nils Burghardt Kühn/Püschel: Gebrauch allg. einspr. Wörterbücher Spezialwörterbücher Legitimation Wörterbuchschreibung Spezialwörterbuch: konkreter Zweck eindeutiger Benutzer Legitimation! Allg. Wörterbuch:
Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands
 Wirtschaft Alexander Simon Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands Eine kritische Analyse von Zusammenhängen zwischen der Sparquote und ausgewählten ökonomischen Einflussfaktoren
Wirtschaft Alexander Simon Langfristige Betrachtung der Sparquote der privaten Haushalte Deutschlands Eine kritische Analyse von Zusammenhängen zwischen der Sparquote und ausgewählten ökonomischen Einflussfaktoren
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 5
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 0 Einleitung 11 0.1 Ausgangspunkt und Fragestellung 11 0.2 Aufbau der Arbeit 16 Teill Theoretische Grundlagen 1 Anglizismen im Kontest von Entlehnung 21 1.1 Entlehnung 21 1.1.1
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 0 Einleitung 11 0.1 Ausgangspunkt und Fragestellung 11 0.2 Aufbau der Arbeit 16 Teill Theoretische Grundlagen 1 Anglizismen im Kontest von Entlehnung 21 1.1 Entlehnung 21 1.1.1
Unterrichtsvorschlag 1 Vergleich eines Stichwortes in verschiedenen Typen von Wörterbüchern
 Martina Kášová, Slavomira Tomášiková Stichwörter und Kollokationen, Arbeit mit Hilfstexten Unterrichtsvorschlag 1 Vergleich eines Stichwortes in verschiedenen Typen von Wörterbüchern Zielgruppe: Studierende
Martina Kášová, Slavomira Tomášiková Stichwörter und Kollokationen, Arbeit mit Hilfstexten Unterrichtsvorschlag 1 Vergleich eines Stichwortes in verschiedenen Typen von Wörterbüchern Zielgruppe: Studierende
Arbeiten mit wissenschaftlicher Literatur
 Begleitseminar Entwicklungspsychologie II SS 08 Arbeiten mit wissenschaftlicher Literatur Essay, Paper, Gruppenarbeit, Power-Point Begleitseminar EP II SS 08 Struktur der Sitzung Essay Definition Literaturrecherche
Begleitseminar Entwicklungspsychologie II SS 08 Arbeiten mit wissenschaftlicher Literatur Essay, Paper, Gruppenarbeit, Power-Point Begleitseminar EP II SS 08 Struktur der Sitzung Essay Definition Literaturrecherche
Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel
 Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Andrea Steiger / Kathrin Derungs Der Einfluss von Geschützten Werten und Emotionen auf Reaktionen im Ultimatum Spiel Lizentiatsarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Das Zusammenspiel interpretativer und automatisierbarer Verfahren bei der Aufbereitung und Auswertung mündlicher Daten
 Das Zusammenspiel interpretativer und automatisierbarer Verfahren bei der Aufbereitung und Auswertung mündlicher Daten Ein Fallbeispiel aus der angewandten Wissenschaftssprachforschung Cordula Meißner
Das Zusammenspiel interpretativer und automatisierbarer Verfahren bei der Aufbereitung und Auswertung mündlicher Daten Ein Fallbeispiel aus der angewandten Wissenschaftssprachforschung Cordula Meißner
Erfahrungen im Umgang mit Wörterbüchern
 131 Sprachkultur, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Bemerkungen zu: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Frankfurt a.m.: Peter
131 Sprachkultur, Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Bemerkungen zu: Jürgen Scharnhorst (Hrsg.): Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern. Frankfurt a.m.: Peter
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Präpositionen - Band 15. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Präpositionen - Band 15 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de deutsch üben 15 Sabine Dinsel Präpositionen Max Hueber
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Präpositionen - Band 15 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de deutsch üben 15 Sabine Dinsel Präpositionen Max Hueber
Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus
 Medien Ariane Bartfeld Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Die Vielfalt des Journalismus 3
Medien Ariane Bartfeld Textverständlichkeit. Der Prozess des Verstehens am Beispiel des Wissenschaftsjournalismus Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Die Vielfalt des Journalismus 3
5. Literaturverzeichnis
 5. Literaturverzeichnis ABRAHAM, ULF (1996): StilGestalten. Geschichte und Systematik der Rede vom Stil in der Deutschdidaktik. Tübingen: Niemeyer. ADAMZCIK, KIRSTEN (1995): Textsorten Texttypologie. Eine
5. Literaturverzeichnis ABRAHAM, ULF (1996): StilGestalten. Geschichte und Systematik der Rede vom Stil in der Deutschdidaktik. Tübingen: Niemeyer. ADAMZCIK, KIRSTEN (1995): Textsorten Texttypologie. Eine
Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor?
 Wirtschaft Matthias Schupp Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor? Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Wirtschaft Matthias Schupp Das Spannungsfeld im mittleren Management. Ein möglicher Burnout-Faktor? Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5
 Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
Latein - Klasse 5 (2. Hj.) - Version 2 (Juni 2005) S. 1 von 5 Kerncurriculum
PS Lexikologie. Quiz Einführung Terminologie. PS Lexikologie 1
 Quiz Einführung Terminologie PS Lexikologie 1 Was ist ein Wort? Wieviele Wörter hat der folgende Satz? Katharina hat den Kühlschrank nicht zugemacht. PS Lexikologie 2 Kommt drauf an! Wir unterscheiden
Quiz Einführung Terminologie PS Lexikologie 1 Was ist ein Wort? Wieviele Wörter hat der folgende Satz? Katharina hat den Kühlschrank nicht zugemacht. PS Lexikologie 2 Kommt drauf an! Wir unterscheiden
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb
 Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
Behaviorismus und Nativismus im Erstspracherwerb 13-SQM-04 (Naturwissenschaft für Querdenker) 09.07.2015 Simeon Schüz Gliederung 1. Einleitung 2. Die Behavioristische Hypothese 2.1 Grundlegende Annahmen
MITTEILUNGSBLATT. Studienjahr 2007/2008 Ausgegeben am Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
 MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 2007/2008 Ausgegeben am 16.06.2008 30. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. C U R R I C U L A 208. Curriculum für das Erweiterungscurriculum
MITTEILUNGSBLATT Studienjahr 2007/2008 Ausgegeben am 16.06.2008 30. Stück Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. C U R R I C U L A 208. Curriculum für das Erweiterungscurriculum
Aufsatztraining Deutsch Band 6: Übungsbuch zur gezielten Vorbereitung auf Prüfungen mit Kopiervorlagen. Erich und Hildegard Bulitta.
 Deutsch Erich und Hildegard Bulitta Aufsatztraining Deutsch Band 6: Übungsbuch zur gezielten Vorbereitung auf Prüfungen mit Kopiervorlagen Übungsheft Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Deutsch Erich und Hildegard Bulitta Aufsatztraining Deutsch Band 6: Übungsbuch zur gezielten Vorbereitung auf Prüfungen mit Kopiervorlagen Übungsheft Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wie mehrsprachige Kinder in der Deutschschweiz mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch umgehen
 Zürcher germanistische Studien 63 Wie mehrsprachige Kinder in der Deutschschweiz mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch umgehen Eine empirische Studie Bearbeitet von Carol Suter Tufekovic 1. Auflage 2008.
Zürcher germanistische Studien 63 Wie mehrsprachige Kinder in der Deutschschweiz mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch umgehen Eine empirische Studie Bearbeitet von Carol Suter Tufekovic 1. Auflage 2008.
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Sprache ist nicht nur eine Wortordnung, die die Sätze bildet. Sie ist ein Kommunikationsmittel, um Gedanken und Gefühle zu äußern. Nach der Definition von Bloch
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Sprache ist nicht nur eine Wortordnung, die die Sätze bildet. Sie ist ein Kommunikationsmittel, um Gedanken und Gefühle zu äußern. Nach der Definition von Bloch
Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen
 Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Textsorten. Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World
 Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache Basiswissen kompakt
 Julia Ilovaiskaia, Hueber Verlag Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache Basiswissen kompakt Es ist heute kaum umstritten, dass ein einsprachiges Wörterbuch eine große Hilfe beim Erlernen einer Fremdsprache
Julia Ilovaiskaia, Hueber Verlag Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache Basiswissen kompakt Es ist heute kaum umstritten, dass ein einsprachiges Wörterbuch eine große Hilfe beim Erlernen einer Fremdsprache
Englisch im Alltag Kompendium
 Sprachen Erich und Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz, Grammatik, Satzbaumuster, Idiome u.v.m. Fachbuch Erich Bulitta, Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz,
Sprachen Erich und Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz, Grammatik, Satzbaumuster, Idiome u.v.m. Fachbuch Erich Bulitta, Hildegard Bulitta Englisch im Alltag Kompendium Grundwortschatz,
Dossier: Funktionales Übersetzen
 Universität Leipzig Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie Sommersemester 2013 Modelle und Methoden der Übersetzungswissenschaft bei Prof. Dr. Carsten Sinner Johannes Markert Dossier: Funktionales
Universität Leipzig Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie Sommersemester 2013 Modelle und Methoden der Übersetzungswissenschaft bei Prof. Dr. Carsten Sinner Johannes Markert Dossier: Funktionales
Richtlinien und Hinweise für. Seminararbeiten
 Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Richtlinien und Hinweise für Seminararbeiten Lehrstuhl für VWL (Wirtschaftspolitik, insbes. Industrieökonomik) Ökonomie der Informationsgesellschaft Prof. Dr. Peter Welzel Gliederung Die folgenden Richtlinien
Motivation im Kunstunterricht
 Medien Stefan Spengler Motivation im Kunstunterricht Gestaltung multifunktionaler Turmmodelle innerhalb des Faches Kunsterziehung der Klasse 9 im Hinblick auf Motivationshandlungen am Beispiel der Realisierung
Medien Stefan Spengler Motivation im Kunstunterricht Gestaltung multifunktionaler Turmmodelle innerhalb des Faches Kunsterziehung der Klasse 9 im Hinblick auf Motivationshandlungen am Beispiel der Realisierung
Modelle der Sprachrezeption serial bottleneck :
 Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft SoSe 2008 Seminar: Theorien der Sprachproduktion und -rezeption Dozent: Dr. Hans-Jürgen Eikmeyer Referent: Robert Hild 20.06.2008
Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft SoSe 2008 Seminar: Theorien der Sprachproduktion und -rezeption Dozent: Dr. Hans-Jürgen Eikmeyer Referent: Robert Hild 20.06.2008
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN!
 ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
EINSPRACHIGE (LERNER-)WÖRTERBÜCHER DES DEUTSCHEN IM GERMANISTIK STUDIUM. ERGEBNISSE EINER UMFRAGE
 Linguistica Silesiana 33, 2012 ISSN 0208-4228 Schlesische Universität EINSPRACHIGE (LERNER-)WÖRTERBÜCHER DES DEUTSCHEN IM GERMANISTIK STUDIUM. ERGEBNISSE EINER UMFRAGE MONOLINGUAL (LEARNERS ) DICTIONARIES
Linguistica Silesiana 33, 2012 ISSN 0208-4228 Schlesische Universität EINSPRACHIGE (LERNER-)WÖRTERBÜCHER DES DEUTSCHEN IM GERMANISTIK STUDIUM. ERGEBNISSE EINER UMFRAGE MONOLINGUAL (LEARNERS ) DICTIONARIES
Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie
 Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie Steffen Hintze Mathematisches Institut der Universität Leipzig - Abteilung Didaktik 26.04.2016 Hintze (Universität Leipzig) Kopfgeometrie 26.04.2016 1 / 7 zum Begriff
Didaktik der Geometrie Kopfgeometrie Steffen Hintze Mathematisches Institut der Universität Leipzig - Abteilung Didaktik 26.04.2016 Hintze (Universität Leipzig) Kopfgeometrie 26.04.2016 1 / 7 zum Begriff
5.2 Wörterbücher und Phraseologiesammlungen
 5 Literaturverzeichnis 5.1 Belegmaterial c t magazin für computertechnik. Hannover. Klemperer, Victor (1996): Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum. Tagebücher 1918-1924. (Hrsg. von Walter Nowojski
5 Literaturverzeichnis 5.1 Belegmaterial c t magazin für computertechnik. Hannover. Klemperer, Victor (1996): Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum. Tagebücher 1918-1924. (Hrsg. von Walter Nowojski
Einsatz von Computerprogrammen im Musikunterricht der Realschule am Beispiel von "Band-in-a-Box"
 Pädagogik Barbara Weidler Einsatz von Computerprogrammen im Musikunterricht der Realschule am Beispiel von "Band-in-a-Box" Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Pädagogik Barbara Weidler Einsatz von Computerprogrammen im Musikunterricht der Realschule am Beispiel von "Band-in-a-Box" Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten
 Wirtschaft Anne Keuchel Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Wirtschaft Anne Keuchel Ein Kreisverband des DRK - Gefährdung der Gemeinnützigkeit durch wirtschaftliche Aktivitäten Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Workshop Juni Lernerwörterbücher: Grammatik im Wörterbuch?
 Lernerwörterbücher: Grammatik im Wörterbuch? Workshop Juni 2005 Workshop-Programm Eröffnung des Workshops Lernerwörterbücher - ein deutscher Markt? in Lernerwörterbüchern Vom Be(nutzen) der Lernerwörterbücher
Lernerwörterbücher: Grammatik im Wörterbuch? Workshop Juni 2005 Workshop-Programm Eröffnung des Workshops Lernerwörterbücher - ein deutscher Markt? in Lernerwörterbüchern Vom Be(nutzen) der Lernerwörterbücher
Einführung in die Informatik I (autip)
 Einführung in die Informatik I (autip) Dr. Stefan Lewandowski Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Abteilung Formale Konzepte Universität Stuttgart 24. Oktober 2007 Was Sie bis
Einführung in die Informatik I (autip) Dr. Stefan Lewandowski Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Abteilung Formale Konzepte Universität Stuttgart 24. Oktober 2007 Was Sie bis
Mobbing & Cybermobbing unter Schülern/-innen
 Pädagogik Eva Gasperl Mobbing & Cybermobbing unter Schülern/-innen Empirische Untersuchung an drei Polytechnischen Schulen im Bezirk Salzburg-Umgebung Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
Pädagogik Eva Gasperl Mobbing & Cybermobbing unter Schülern/-innen Empirische Untersuchung an drei Polytechnischen Schulen im Bezirk Salzburg-Umgebung Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen
BERUFSPROFIL FACHPERSON FÜR MEDIZINISCH TECHNISCHE RADIOLOGIE
 Projekt BERUFSPROFIL FACHPERSON FÜR MEDIZINISCH TECHNISCHE RADIOLOGIE Ontologie des Berufs der Fachperson für MTRA Instrument 5 Marion Amez-Droz Lausanne, 15. Juli 2008 Berufsprofil Fachperson für medizinisch
Projekt BERUFSPROFIL FACHPERSON FÜR MEDIZINISCH TECHNISCHE RADIOLOGIE Ontologie des Berufs der Fachperson für MTRA Instrument 5 Marion Amez-Droz Lausanne, 15. Juli 2008 Berufsprofil Fachperson für medizinisch
Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation
 Wirtschaft Stefanie Pipus Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Wirtschaft Stefanie Pipus Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die
Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
 V Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V XI XIII XVI Danksagendes Vorwort 1 1 Einleitung 2 2 Großschreibung: historisch linguistisch didaktisch
V Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V XI XIII XVI Danksagendes Vorwort 1 1 Einleitung 2 2 Großschreibung: historisch linguistisch didaktisch
Die Lebhaftigkeit der Jugendsprache
 Germanistik Kathleen Harm Die Lebhaftigkeit der Jugendsprache Aktuelle Beispiele Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik 1 Wintersemester 2012 / 2013 BA- Studiengang Deutsch Sprache
Germanistik Kathleen Harm Die Lebhaftigkeit der Jugendsprache Aktuelle Beispiele Studienarbeit Universität Hamburg Institut für Germanistik 1 Wintersemester 2012 / 2013 BA- Studiengang Deutsch Sprache
SS2010 BAI2-LBP Gruppe 1 Team 07 Entwurf zu Aufgabe 4. R. C. Ladiges, D. Fast 10. Juni 2010
 SS2010 BAI2-LBP Gruppe 1 Team 07 Entwurf zu Aufgabe 4 R. C. Ladiges, D. Fast 10. Juni 2010 Inhaltsverzeichnis 4 Aufgabe 4 3 4.1 Sich mit dem Programmpaket vertraut machen.................... 3 4.1.1 Aufgabenstellung.................................
SS2010 BAI2-LBP Gruppe 1 Team 07 Entwurf zu Aufgabe 4 R. C. Ladiges, D. Fast 10. Juni 2010 Inhaltsverzeichnis 4 Aufgabe 4 3 4.1 Sich mit dem Programmpaket vertraut machen.................... 3 4.1.1 Aufgabenstellung.................................
Kompetenzen beschreiben: Kompetenzmodelle. Fremdsprachen
 Thementagung Kanton Thurgau Lehrplan 21 Kompetenzen beschreiben: Kompetenzmodelle Fremdsprachen Marlies Keller, PH Zürich Programm 1. Lehrplan 21: Struktur und Kompetenzbereiche Sprachen 2. Kompetenzmodell
Thementagung Kanton Thurgau Lehrplan 21 Kompetenzen beschreiben: Kompetenzmodelle Fremdsprachen Marlies Keller, PH Zürich Programm 1. Lehrplan 21: Struktur und Kompetenzbereiche Sprachen 2. Kompetenzmodell
Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch
 Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert / Foreign Language Pedagogy - content- and learneroriented 27 Narrative Kompetenz in der Fremdsprache Englisch Eine empirische Studie zur Ausprägung
Epistemische Modalität
 Marion Krause Epistemische Modalität Zur Interaktion lexikalischer und prosodischer Marker. Dargestellt am Beispiel des Russischen und des Bosnisch-Kroatisch-Serbischen 2007 Harrassowitz Verlag Wiesbaden
Marion Krause Epistemische Modalität Zur Interaktion lexikalischer und prosodischer Marker. Dargestellt am Beispiel des Russischen und des Bosnisch-Kroatisch-Serbischen 2007 Harrassowitz Verlag Wiesbaden
Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch
 Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
Germanistik Nuran Aksoy Sprachkontrastive Darstellung Deutsch-Türkisch Studienarbeit Freie Universität Berlin Wintersemester 2003/2004 Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften: Fächergruppe deutsche
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Schulcurriculum Gymnasium Korntal-Münchingen
 Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Klasse: 10 Seite 1 Minimalanforderungskatalog; Themen des Schuljahres gegliedert nach Arbeitsbereichen Übergreifende Themen, die dem Motto der jeweiligen Klassenstufe entsprechen und den Stoff des s vertiefen,
Das C-Teile-Management bei KMU
 Wirtschaft Lukas Ohnhaus Das C-Teile-Management bei KMU Identifikation und Analyse der Auswahlkriterien für einen Dienstleister mittels qualitativer Marktstudie Bachelorarbeit Bibliografische Information
Wirtschaft Lukas Ohnhaus Das C-Teile-Management bei KMU Identifikation und Analyse der Auswahlkriterien für einen Dienstleister mittels qualitativer Marktstudie Bachelorarbeit Bibliografische Information
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Auswahlbibliographie
 Dr. Martina Nicklaus Romanistik 4 Wintersemester 2014 Aufbauseminar: Italienische Phraseologie Auswahlbibliographie Bally, Ch.: "Action d'instinct étymologique et analogique dans l'analogie des locutions
Dr. Martina Nicklaus Romanistik 4 Wintersemester 2014 Aufbauseminar: Italienische Phraseologie Auswahlbibliographie Bally, Ch.: "Action d'instinct étymologique et analogique dans l'analogie des locutions
Antje Heine Funktionsverbgefüge in System, Text und korpusbasierter (Lerner-)Lexikographie (Finnische Beiträge zur Germanistik 18).
 Antje Heine. Funktionsverbgefüge in System 61 Antje Heine. 2006. Funktionsverbgefüge in System, Text und korpusbasierter (Lerner-)Lexikographie (Finnische Beiträge zur Germanistik 18). Frankfurt am Main
Antje Heine. Funktionsverbgefüge in System 61 Antje Heine. 2006. Funktionsverbgefüge in System, Text und korpusbasierter (Lerner-)Lexikographie (Finnische Beiträge zur Germanistik 18). Frankfurt am Main
Task-Based Learning und Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht als Antwort auf die Bildungstandards?
 Sprachen Alexej Schlotfeldt Task-Based Learning und Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht als Antwort auf die Bildungstandards? Eine theoretische und praxisorientierte Betrachtung der Konjunktur
Sprachen Alexej Schlotfeldt Task-Based Learning und Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht als Antwort auf die Bildungstandards? Eine theoretische und praxisorientierte Betrachtung der Konjunktur
Ministerium für Schule und Weiterbildung. Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009
 Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009 4. September 2009 Am 12. und 14. Mai 2009 wurden in Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal in den dritten
Ministerium für Schule und Weiterbildung Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, 2009 4. September 2009 Am 12. und 14. Mai 2009 wurden in Nordrhein-Westfalen zum dritten Mal in den dritten
Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz
 Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne
Marie Schröter Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne eigenen Wohnsitz Ein Vergleich zwischen Deutschland und Russland Bachelorarbeit Schröter, Marie: Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche ohne
Was leistet Sprache?
 Was leistet Sprache? Elisabeth Leiss Germanistische Linguistik Münchner Wissenschaftstage 20.-23.10.2007 1 Was tun wir, wenn wir Sprache verwenden? Verwenden wir Sprache nur zur Kommunikation? Überspielen
Was leistet Sprache? Elisabeth Leiss Germanistische Linguistik Münchner Wissenschaftstage 20.-23.10.2007 1 Was tun wir, wenn wir Sprache verwenden? Verwenden wir Sprache nur zur Kommunikation? Überspielen
Professor Dr. Peter Kühn. Aufsätze
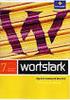 Professor Dr. Peter Kühn Aufsätze Kritik der bisherigen Grundwortschatzlexikographie. In: Zielsprache Deutsch 10: 4 (1979), 34-42. "Aha!" Pragmatik einer Interjektion. In: Deutsche Sprache 7: 4 (1979),
Professor Dr. Peter Kühn Aufsätze Kritik der bisherigen Grundwortschatzlexikographie. In: Zielsprache Deutsch 10: 4 (1979), 34-42. "Aha!" Pragmatik einer Interjektion. In: Deutsche Sprache 7: 4 (1979),
Semantische Klassifikation von Kollokationen auf Grundlage des DWDS- Wortprofils
 Semantische Klassifikation von Kollokationen auf Grundlage des DWDS- Wortprofils Isabel Fuhrmann, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer Zentrum Sprache Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Semantische Klassifikation von Kollokationen auf Grundlage des DWDS- Wortprofils Isabel Fuhrmann, Alexander Geyken, Lothar Lemnitzer Zentrum Sprache Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Kollokationen in der Wissenschaftssprache Deutsch aus der DaF-Perspektive. FaDaF-Tagung März 2013 Bamberg
 Kollokationen in der Wissenschaftssprache FaDaF-Tagung 21.-23. März 2013 Bamberg Tamás Kispál Universität Szeged kispal@lit.u-szeged.hu Beispiele werden dargestellt auf einige Punkte eingehen Die vorliegende
Kollokationen in der Wissenschaftssprache FaDaF-Tagung 21.-23. März 2013 Bamberg Tamás Kispál Universität Szeged kispal@lit.u-szeged.hu Beispiele werden dargestellt auf einige Punkte eingehen Die vorliegende
Inhaltsverzeichnis. Danksagung. Abbildungs Verzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Inhaltsverzeichnis Danksagung Inhaltsverzeichnis Abbildungs Verzeichnis Teil 1 1 1. Fragestellung 3 2. Einleitung : 4 3. Aspekte des Zweitspracherwerbs 9 3.1 Neurophysiologische Aspekte des Zweitspracherwerbs
Phraseologismen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Deutschen und im Russischen. Referentinnen: Daniela Mestermann, Barbara Lürbke
 Phraseologismen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Deutschen und im Russischen Referentinnen: Daniela Mestermann, Barbara Lürbke Gliederung Was sind Phraseologismen Begriffsbestimmung Klassifikation Phraseologismen
Phraseologismen Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Deutschen und im Russischen Referentinnen: Daniela Mestermann, Barbara Lürbke Gliederung Was sind Phraseologismen Begriffsbestimmung Klassifikation Phraseologismen
Einsatz von populärer Musik im Religionsunterricht am Beispiel der Toten Hosen
 Geisteswissenschaft Clemens Gattke Einsatz von populärer Musik im Religionsunterricht am Beispiel der Toten Hosen Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Geisteswissenschaft Clemens Gattke Einsatz von populärer Musik im Religionsunterricht am Beispiel der Toten Hosen Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Anforderungsverarbeitung zur kundenorientierten Planung technischer Anlagen am Beispiel der Intralogistik. Vortragender: Dipl.-Inf.
 sverarbeitung zur kundenorientierten Planung technischer Anlagen am Beispiel der Intralogistik Forderungsgerechte Auslegung von intralogistischen Systemen Vortragender: Dipl.-Inf. Jonas Mathis Universität
sverarbeitung zur kundenorientierten Planung technischer Anlagen am Beispiel der Intralogistik Forderungsgerechte Auslegung von intralogistischen Systemen Vortragender: Dipl.-Inf. Jonas Mathis Universität
Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik
 Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Hans-Rüdiger Fluck Unter Mitarbeit von Jü Jianhua, Wang Fang, Yuan Jie Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik Einführung in die Fachsprachen und die Didaktik/Methodik des fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
Was heisst eigentlich Sprachkompetenz?
 Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
Claudio Nodari Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Bibliographischer Verweis: Nodari, C. (2002): Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom
Einführung in die Übersetzungswissenschaft
 Werner Koller Einführung in die Übersetzungswissenschaft 8., neubearbeitete Auflage Unter Mitarbeit von Kjetil Berg Henjum A. Francke Verlag Tübingen und Basel Inhalt Vorwort zur 8. Auflage 1 Einführung
Werner Koller Einführung in die Übersetzungswissenschaft 8., neubearbeitete Auflage Unter Mitarbeit von Kjetil Berg Henjum A. Francke Verlag Tübingen und Basel Inhalt Vorwort zur 8. Auflage 1 Einführung
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis. Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14.
 Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Sprachliches Wissen: mentales Lexikon, grammatisches Wissen. Gedächtnis Psycholinguistik (2/11; HS 2010/2011) Vilnius, den 14. September 2010 Das Wissen Beim Sprechen, Hören, Schreiben und Verstehen finden
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte
 Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
Anhang I: Lernziele und Kreditpunkte Modul Einführung in die slavische Sprach- und Literaturwissenschaft Veranstaltungen: Einführungsseminar Einführung in die Literaturwissenschaft (2 SWS, 6 ECTS, benotet);
der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress Inger Petersen, Universität Oldenburg
 Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Analyse von Schreibkompetenz in der Zweitsprache Deutsch Vortrag auf dem DGFF-Kongress 2009 02.10.2009 Inger Petersen, Universität Oldenburg Gliederung 1. Das Forschungsprojekt 2. Schreibkompetenz u. Schriftlichkeit
Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM
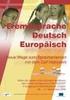 Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM Akten der Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 20. und 21. Juni 2008 Universität Bern herausgegeben von Monika Clalüna Barbara
Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM Akten der Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 20. und 21. Juni 2008 Universität Bern herausgegeben von Monika Clalüna Barbara
der qualitativen Sozialforschung Worum geht es? Methoden - Anwendungsorientiertes Seminar Prof. Dr. Helmut Altenberger, Günes Turan
 Methoden der qualitativen Sozialforschung SS 2009 Dienstag, 16.15 bis 17.45 Uhr Raum: Seminarraum 2 1. Sitzung: 28.04.2009 Worum geht es? - Anwendungsorientiertes Seminar - Empirische Forschungspraxis
Methoden der qualitativen Sozialforschung SS 2009 Dienstag, 16.15 bis 17.45 Uhr Raum: Seminarraum 2 1. Sitzung: 28.04.2009 Worum geht es? - Anwendungsorientiertes Seminar - Empirische Forschungspraxis
