Brienzer Wildbäche. Forstliches Verbauungs- und Aufforstungsprojekt. Geschichte, Ereignisse, Projekte, Erkenntnisse
|
|
|
- Oldwig Otto
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Forstliches Verbauungs- und Aufforstungsprojekt Brienzer Wildbäche Geschichte, Ereignisse, Projekte, Erkenntnisse Abteilung Naturgefahren Schloss Interlaken Interlaken, im Juli 2007 Ueli Ryter
2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Lage, Klima, Geologie 2 2. Naturgefahren Ereignisse Gefahrenpotenzial Siedlungsentwicklung gefährdetes Schadenpotenzial Waldrodungen im Mittelalter Forstliche Gesetzgebung Öffentliches Interesse an Schutzmassnahmen Projekte Wasserbauprojekte Forstliche Projekte Wiederbewaldung Erkenntnisse Ausblick 20 Quellenangaben
3 Die Brienzer Wildbäche sind weit über die Region Brienz hinaus bekannt. Zahlreiche Naturkatastrophen mit zum Teil verheerenden Folgen für die lokale Bevölkerung lösten in der Vergangenheit schweizweit Betroffenheit und Solidarität aus. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt einen groben Ueberblick über wichtige Themen aus der Geschichte der Brienzer Wildbäche. 1. Lage, Klima, Geologie Die Brienzer Wildbäche gehören geografisch zum östlichen Berner Oberland und liegen auf den Gemeindegebieten von Brienz, Schwanden und Hofstetten. Abb1 Landeskarte 1: Der Name ist ein Oberbegriff für 6 Wildbäche mit ihren Einzugsgebieten an den steilen Hangflanken der Südhänge zwischen dem Brienzersee (564 m ü.m.) und dem Brienzergrat (Brienzer Rothorn 2350 m ü.m.). Die Fläche beträgt insgesamt ca. 18 km 2, ohne Mülibach 13.5 km 2. Abb 2 Die Brienzer Wildbäche mit Relief - 2 -
4 Der Brienzersee und der Einfluss des Föhns bewirken ein verhältnismässig mildes Klima, das sich auch in der Vegetation widerspiegelt: in den Wäldern bis 900 m ü.m. sind in Linden-Ahorn- Mischwäldern Sommer- und Winterlinde, Berg- und Spitzahorn, Bergulme und Esche vertreten. Nach oben schliessen der (Weisstannen-) Buchenwald und schliesslich der subalpine Fichtenwald an, der heute im Projektgebiet weitgehend verschwunden ist. Der Brienzergrat liegt im Bereich der Kreide- und Juraformationen der helvetischen Wildhorndecke. Die stabilsten Einheiten befinden sich in den Gebieten mit Malmkalk; in weiten Teilen herrschen jedoch Kieselkalke und kalkig-mergelige Schichten schlechter Qualität vor. Eine wichtige Rolle spielen die Sackungen: Diese enormen Beanspruchungen haben die Stabilität der Gesteine vermindert, sodass die Verwitterung rasch voranschreitet. Abb 3 Die Brienzer Wildbäche, Ansicht vom Gegenhang 2. Naturgefahren Aufgrund der topografischen, geologischen und klimatischen Verhältnisse sind im Gebiet der Brienzer Wildbäche die Voraussetzungen für verschiedene Naturgefahren gegeben. Dies sind insbesondere die Prozesse Wildbach, Murgang, Uebersarung, Lawinen, Steinschlag, Felssturz, Rutschungen und Erosion. In verschiedenen Gebieten überlagern und beeinflussen sich diese Prozesse gegenseitig. So können beispielsweise Lawinen Stämme und Geschiebe in die Wildbachgerinne transportieren, was bei Hochwasser zu Folgeprob-lemen mit Verklausungen führen kann. Dieselbe Problematik entsteht auch, wenn Rutschungen (aus Grabeneinhängen) in die Wildbäche gelangen. 2.1 Ereignisse Das wichtigste Gefahrenpotenzial für den Talbereich stellen die Wildbäche dar. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder zu Verwüstungen und verheerenden Schäden im Tal geführt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Im Jahr 1499 wurde das Dorf Kienholz vernichtet (Lamm- und Schwanderbach). Im Jahr 1797 wurden durch den gleichzeitigen Ausbruch von Lamm-, Schwander- und Glyssibach 37 Häuser zerstört. Bei der Lammbachklatastrophe von 1896 wurden in Kienholz erneut Häuser zerstört. Die gewaltigen Ablagerungen (an der Front 120 m breit und m mächtig) verschütteten die Staatsstrasse, die Bahnlinie sowie grosse Flächen des Kulturlandes. Unter dem Eindruck dieser schrecklichen Katastrophe vertraten viele Bürger von Schwanden die Ansicht, die Gemeinde sei aufzulösen und die Leute seien auf andere Gemeinden zu verteilen
5 Die folgende Darstellung gibt einen Ueberblick über die bekannten Murgänge der vergan-genen 550 Jahre. Jedes Ereignis wurde aufgrund seines Volumens einer Klasse zugeordnet: 7'000 m 3, 20'000 m 3, 70'000 m 3, 200'000 m 3 und 500'000 m 3 (Datengrundlage: Geo 7, Bern 1997, weitergeführt durch die Abteilung Naturgefahren): Abb 4 Chronologie und Ausmass der Ereignisse Abb 5,6 Lammbachkatastrophe von
6 Murgangkatastrophe vom 23. August 2005 In der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 ereignete sich in Brienz eine verheerende Murgangkatastrophe mit zwei Todesopfern und gewaltigen Zerstörungen und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Im Einzugsgebiet der Brienzer Wildbäche betrugen die im August gemessenen Regenmengen bereits in den ersten zwei Wochen rund 220 mm; unmittelbar vor der Murgangkatastrophe regnete es zusätzlich innert 48 Stunden 280 mm! In Brienz selber betrug das 48-Std-Maximum 181 mm (Station Kienholz), was nach Auskunft von MeteoSchweiz gemäss den klassischen Analysemethoden einer Wiederkehrdauer von weit über 300 Jahren entspricht. Abb 7 Regenmesser Gibelegg (1710 m ü.m.): Niederschläge im August 2005 (Summenkurve in mm) Im Auftrag des Tiefbauamtes des Kantons Bern wurden die Murgangereignisse im Glyssibach und Trachtbach in umfangreichen lokalen lösungsorientierten Ereignisanalysen (LLE) durch ein hoch spezialisiertes Team der Büros NDR Consulting Zimmermann (Thun) und Niederer + Pozzi Umwelt AG (Uznach) in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Brienz und Schwanden, den kantonalen Fachstellen, dem Bundesamt für Umwelt und diversen externen Fachleuten untersucht. Die folgenden Ausführungen stammen aus den entsprechenden Berichten. Glyssibach Das Ereignis ist in mehreren Phasen abgelaufen. Bereits vor Mitternacht wurde in der Schale ein intensiver Geschiebetransport beobachtet; um diese Zeit kam es zu einer Verstopfung bei der Brücke der Kantonsstrasse. Das abfliessende Wasser soll meterhoch ( wie eine Fontäne ) hochgespritzt haben. Im Gebiet Baalen (1160 m ü.m.) erfolgte auf einer schräg gestellten Schieferplatte eine Rutschung aus feinkörnigen Verwitterungsprodukten und grossen Blöcken. Die total bewegte Masse betrug 80'000 m 3. Mindestens 20'000 m 3 sind ins Gerinne gelangt und als zähflüssiger Murgang bis zur Sperre 8 geflossen. Unterhalb dieser Sperre muss für eine gewisse Zeit eine Auflandung stattgefunden haben. Nach Mitternacht hat sich aus der Rutschung Baalen eine weitere Masse von 8'000 m 3 als oberflächliche sekundäre Rutschung gelöst und ist ins Gerinne gelangt, wo sie sich direkt zu einem Murgang entwickelt hat. Da der gesamte Schutt im Bachbett - 5 -
7 durch den seit Tagen herrschenden erhöhten Abfluss vollständig gesättigt war, hat die Überlast durch den abfliessenden Murgang zu einer Destabilisierung der Bachsohle geführt (Verflüssigung). Der darauf folgende kontinuierliche Murstrom hat das Bachbett vollständig ausgeräumt und die 7 Betonsperren freigelegt. Die Erosionstiefe betrug 2-8 m, der Erosionsquerschnitt m 2 ; total wurden aus dem Bachbett 35-40'000 m 3 erodiert. Der Murstrom war bei der Glyssenbrücke mit 6-10 m/s ausserordentlich schnell, auf dem Kegel vermutlich etwas langsamer (5-8 m/s). Im Murstrom ist eine Vielzahl von grossen Blöcken transportiert worden. Zwischen und Uhr flossen innert 15 Minuten 70'000 m 3 ab, also 80 m 3 /s; der Spitzenabfluss wird mit m 3 /s angenommen. Gemäss Ohrenzeugen ist um Uhr die Mauer am Schalenkopf mit einem lauten Knall zerborsten; vermutlich hat ein grosser Block, welcher auf dem Murgang geschwommen ist, die Mauer zertrümmert. Dadurch wurde der Weg für den Ausbruch aus der ohnehin zu kleinen Schale freigelegt. Nach Angaben von Zeugen erfolgte die Murgangablagerung auf dem Kegel in drei Schüben innerhalb weniger Minuten; dann war es still. Gemäss groben Abschätzungen wurden auf dem Kegel auf einer Fläche von 65'000 m '000 m 3 sehr feinstoffreiches Material und darin schwimmende Blöcke mit Durchmessern bis 3 m abgelagert; die Kiesfraktion war deutlich untervertreten. Grosse Blöcke wurden bis zur Bahnlinie transportiert; der grösste Block hatte einen Durchmesser von 4-5 m und wurde am Schalenkopf abgelagert. Der Murgang hat ausgesprochen wenig Schwemmholz transportiert. Die Ablagerungen waren relativ unstrukturiert, d.h. es fehlte das für Murgänge typische unruhige Relief mit Levées und Murzungen. Allerdings war die seitliche Abgrenzung des Murgangs scharf, d.h. es ist praktisch kein fluvialer Transport aufgetreten. Nach dem Durchgang des Murgangs und der Erosion der Bachsohle hat der Murgangabfluss schlagartig aufgehört. Die Schäden im Wirkungsgebiet des Murgangs waren ausserordentlich hoch; sie sind auf die grossen Fliessgeschwindigkeiten und die grossen Blöcke zurückzuführen. Abb 8 Murgangablagerung im Siedlungsgebiet auf dem Kegel des Glyssibachs - 6 -
8 Abb 9 Die gewaltigen Zerstörungen und Schäden an Wohnhäusern Abb 10 Die vom Murgang mitgeführten grossen Blöcke wirkten verheerend Abb 11 Das Schadenbild lässt die Dimension des Ereignisses erahnen - 7 -
9 Trachtbach Am Abend des 22. August 2005 sind im Ritzwald 60'000 m 3 grobblockiger Gehängeschutt in Bewegung geraten. Etwa die Hälfte dieser Rutschmasse wälzte sich als dickflüssiger Murgang vor 22 Uhr bis in den Rauenhag; am Rutschfuss wurde weiteres Material erodiert. Im Hinter Ritzgraben wurden auf einer kurzen Distanz 5-10'000 m 3 abgelagert; die Trachtbachschale wurde auf einer Länge von 300 m mit 10'000 m 3 aufgefüllt. Aus den Ablagerungen entwickelte sich ab Uhr ein dünnflüssiger Murgang, der in mehreren Schüben durch die Schale in Richtung See floss. Gemäss Augenzeugen erfolgte der Abfluss sehr schnell, also möglicherweise mit 5-10 m/s. Die Schale wurde vom See her (hoher Seestand) aufgefüllt. Der dritte Schub staute sich an der Brücke der Kantonsstrasse. Mit dem Auffüllen der Schale bis zur Dindlen-Brücke staute sich der Abfluss dann auch dort. Schlamm, Sand und feineres Geschiebe ergossen sich links und rechts von der Schale in den besiedelten Raum. Die beiden Strassen von der Dindlen her dienten als Verteiler für Wasser und Schlamm. Obwohl mit der Rutschung im Ritzwald viele Bäume mitgerissen wurden, kann Holz als primäre Ursache für die Stauungen an den beiden Brücken ausgeschlossen werden. Der mittlere Murgangabfluss wird mit 25 m 3 /s angegeben, der Spitzenabfluss des Murstroms mit m 3 /s. In der Nacht und bis in den Morgen erfolgten weitere kleinere Schübe. Der Abfluss dürfte dann eher fluvialer Natur gewesen sein mit mehrheitlich feinem Material und Schlamm. Dabei dehnte sich die betroffene Fläche allmählich aus. Total wurden im Dorf 76'000 m 2 übersart; die abgelagerte Feststoffkubatur betrug 5-7'000 m 3. Abb 12 Ablagerungsbereich am Trachtbach Abb 13 Aufräumarbeiten an der Dorfstrasse - 8 -
10 Abb 14 Gebäudeschäden in Brienz rot: Häuser mit Schäden gelb: Häuser ohne Schäden Bei der Katastrophe vom 22./23. August 2005 wurden insgesamt 245 Gebäude beschädigt (Glyssibach: 98, Trachtbach: 147); die Schadensumme betrug insgesamt 26.5 Millionen Franken (Glyssibach: 16.4 Mio. / Trachtbach: 10.1 Mio.). Abb 15 Gebäudeschäden am Glyssibach - 9 -
11 2.2 Gefahrenpotenzial Die Gefahrenhinweiskarte des Kantons Bern (1997) stellt die potenziellen Prozessräume verschiedener Naturgefahren dar. Die folgende Ansicht zeigt die Gefährdung durch Murgänge (violett) und Übersarung (blau). Bei der Computersimulation dieser Prozessräume wurden die Schutzbauten nicht berücksichtigt. Abb 16 Gefahrenhinweiskarte BE (1997) violett: Murgang, blau: Übersarung Die Gemeinde Schwanden verfügt seit Dezember 1998 über eine integrale Gefahrenkarte, in Brienz wurde diese im Juli 2005 fertig gestellt. Abb 17 Wassergefahren, Stand vor dem Ereignis vom August
12 3. Siedlungsentwicklung gefährdetes Schadenpotenzial Das Siedlungsgebiet der Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten hat sich seit der Lammbachkatastrophe von 1896 stark ausgebreitet: Abb 18 Siedlungsentwicklung von 1870 (Quelle: Siegfriedkarte) bis 2007 gelb: Stand 1870, orange: Zunahme bis 2007 Heute leben auf den Kegeln der Brienzer Wildbäche rund 3900 Personen. Weitere wichtige Schadenpotenziale sind die Zentralbahn (ca. 60 Züge pro Tag) und die Kantonsstrasse (5 500 Fahrzeuge pro Tag), Schulanlagen, Industrie- und Gewerbebetriebe, touristische Anlagen (z.b. Brienz Rothorn Bahn), landwirtschaftliche Gebäude u.a.m. Abb 19 Schadenpotenzial auf den Kegeln der Brienzer Wildbäche gelb: Wohnhäuser, schwarz: Bahn, rot: Kantonsstrasse
13 Abb 20 Überlagerung Gefahrenkarte 2005 (Wasser) und Wohnhäuser 4. Waldrodungen im Mittelalter Während des Mittelalters wurden in den Einzugsgebieten der Brienzer Wildbäche für die Gewinnung von Alpweiden und Wildheuflächen grosse Waldflächen gerodet. Betroffen war insbesondere der Nadelholzgürtel (Fichte) in den Höhenlagen zwischen 1500 und 1800 m ü.m. Die Wildheuerei sowie die Schaf- und Ziegenweide waren weit verbreitet. Die Waldgrenze wurde von 1950 auf m ü.m. hinuntergedrückt. Das Fehlen des Waldes wirkte sich in der Folge ausgesprochen negativ auf den Wasserabfluss und den Geschiebehaushalt aus; Verwüstungen im Tal durch die Wildbäche waren die spürbare Folge davon. Diese Zusammenhänge wurden von weitsichtigen Hofstettern früh erkannt, sie planten bereits 1599 das Verbot der Holznutzung oben am Berg. Gegen die Bannlegung bildete sich jedoch ein starker Widerstand, und das Schwenten wurde durch ein obrigkeitliches Schiedsgericht wieder erlaubt. 5. Forstliche Gesetzgebung Aufgrund verheerender Hochwasserkatastrophen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ordnete der Bundesrat eine Untersuchung der Wildbäche durch Ing. Culman und der Hochgebirgswaldungen durch Prof. Landolt an; ihre Untersuchungen zeigten kein erfreuliches Bild der damaligen Zustände. Der Bundesrat ermahnte in der Folge die Kantone, dringend die kantonalen Gesetze zu ergänzen, um die Waldverwüstungen zu stoppen. Da diese Ratschläge nicht genügend befolgt wurden, mussten auf nationaler Ebene gesetzliche Bestimmungen erlassen werden. Art. 24 der Bundesverfassung von 1874 gab dem Bund die Kompetenz der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei im Hochgebirge trat das Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge in Kraft, ein ausgesprochenes Schutzgesetz zugunsten des Gebirgswaldes. Damit war nicht nur der Grundstein für die Oberaufsicht, sondern auch für den Einsatz öffentlicher Gelder gelegt
14 6. Öffentliches Interesse an Schutzmassnahmen Das enorme Gefahrenpotenzial der Brienzer Wildbäche und die Zunahme des Schadenpotenzials weckten immer mehr das Bedürfnis zur Eindämmung der hohen Risiken durch Schutzmassnahmen. Nach den verheerenden Schäden der Lammbachkatastrophe von 1896 wäre die lokale Bevölkerung absolut nicht in der Lage gewesen, umfassende Schutzmassnahmen wasserbaulicher und forstlicher Art alleine zu realisieren und zu finanzieren. Das Ereignis löste in der ganzen Schweiz Mitleid und Bedauern aus, so dass eine eidgenössische Hilfsaktion in die Wege geleitet wurde, welche die grosse Not linderte. Bund Dass die Solidarität nicht nur in der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit war, sondern auch auf Bundesebene, zeigt ein Ausschnitt aus der Botschaft des Bundesrates vom 23. Februar 1897 an die Bundesversammlung betreffend Zusicherung eines Bundesbeitrages an die Verbauungen des Lamm- und Schwanderbaches: Es erscheint beinahe müssig, die Frage zu erörtern, ob diese Verbauung im allgemeinen Interesse sei und daher vom Bund subventioniert werden könne. Ohne Verbauung des Lammbaches und des Schwanderbaches wird Kienholz und zum Teil auch Schwanden dem allmählichen Untergang preisgegeben. Die Brünigbahn und Brünigstrasse bleiben in hohem Masse gefährdet und die Kommunikation nach dem oberen Aaretale, Meiringen mit Grimsel- und Sustenübergang, unsicher. Die Vornahme dieser Verbauung ist daher ein Gebot absoluter Notwendigkeit. In der Bundesversammlung fand ein Antrag, den Bewohnern von Schwanden die Auswanderung nahe zu legen und finanziell zu erleichtern, keinen Anklang. Der klare Wille, den Einwohnern von Schwanden ein weiteres Dasein auf ihrer Scholle zu ermöglichen, setze sich durch, und die Bundesversammlung sicherte an die Verbauung beider Bäche Höchstbeiträge zu. Kanton Trotz dieser hohen Bundesbeiträge waren die Gemeinden finanziell zu schwach, um die beabsichtigten grossen Arbeiten durchzuführen. Da trat der Kanton Bern (Staatsforstbehörde) in die Lücke, getreu der hohen forstpolitischen Auffassung, dass der Staat vorab berufen sei, solche grosse Aufforstungs- und Verbauungsarbeiten zu einem guten Ende zu führen. Die erste Aufgabe bestand darin, die zur Aufforstung vorgesehenen Gebiete zu erwerben. Der enorme Wille, diese Aufgabe wahrzunehmen wird dadurch verdeutlicht, dass der Grosse Rat der Regierung das Expropriationsrecht erteilte, um bei den Verhandlungen mit den Grundeigentümern leichteres Spiel zu haben. In der Folge hat der Kanton grosse Teile (690 ha) der oberen Einzugsgebiete der Brienzer Wildbäche aufgekauft und die Bauherrschaft über die forstlichen Projekte übernommen. Ein weiterer Grund für die Motivation des Kantons, sich für die Schutzmassnahmen zu engagieren sei hier auch noch erwähnt: Der Staat bzw. die obrigkeitlichen Beamten und Räte zeigten jeweils erst reges Interesse, wenn die Landsleute der Katastrophe wegen um Steuerherabsetzung baten (gem. Dasen, 1951). Die übergeordneten öffentlichen Interessen von Bund und Kanton können stichwortartig wie folgt gruppiert werden: Schutz von Siedlungsgebieten (Siedlungspolitik), Verkehrswegen (Verbindungswege Bern - Innerschweiz, und Wallis), Infrastruktur (Kommunikation). Die forstlichen Projekte (vgl. folgendes Kapitel) wurden seit 1896 vom Bund zu 2/3 und vom Kanton zu 1/3 finanziert. Die Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten werden erst seit 1998 mit insgesamt 5% an den Kosten beteiligt
15 7. Projekte Seit mehr als hundert Jahren werden in den Brienzer Wildbächen umfangreiche Verbauungsund Aufforstungsarbeiten durchgeführt. Von allem Anfang an wurde erkannt, dass eine umfassende Reduktion des Risikos im Tal nur aus einer Kombination von wasserbaulichen und forstlichen Projekten hervorgehen konnte. Bereits vor der Lammbachkatastrophe von 1896 haben verschiedene einsichtige Männer von Brienz festgestellt, dass es mit dem Bau der 1871 erstellten Schale im Trachtbach nicht getan war, sondern Anpflanzungen von Wald nötig erschienen. Die Zusicherung der Bundesbeiträge von 1897 an die Verbauungen enthielt die Bedingung, dass auch Aufforstungen ausgeführt wurden. Der Grundsatz, dass ein Wildbach nur richtig und dauernd gezähmt werden kann, wenn neben den eigentlichen Verbauungen im Unterlauf auch forstliche Arbeiten im Einzugsgebiet ausgeführt werden, nahm hier grosse Gestalt an (Dasen, 1951). Dieses Miteinander hat sich sehr gut bewährt und wird bis heute konsequent verfolgt. 7.1 Wasserbauprojekte Im Kanton Bern liegt die Zuständigkeit für die Wasserbauprojekte beim Tiefbauamt. Die untenstehende Darstellung zeigt die vorhandenen Bauwerke wie Schalen, Dämme, Sperren und Geschiebesammler (rot). Die ständig bewohnten Häuser sind als gelbe Punkte dargestellt. Abb 21 Wasserbau-Schutzbauten (rot, Stand 2007) 7.2 Forstliche Projekte Wohl in wenigen Fällen ist eine möglichst vollständige Aufforstung des Einzugsgebietes eines Baches und die Bepflanzung der Einzugshänge desselben so wichtig wie im Lammbach. Dieses Zitat stammt aus der Botschaft des Bundesrates (1897) an die Bundesversammlung und unterstreicht die Bedeutung, die den forstlichen Massnahmen in den Einzugsgebieten der Wildbäche schon damals beigemessen wurde
16 Seit mehr als 100 Jahren werden die forstlichen Verbauungs- und Aufforstungsarbeiten im folgenden Projektperimeter systematisch vorangetrieben: Abb 22 Projektperimeter mit Landeskarte 1: Die dreidimensionale Ansicht veranschaulicht die topographischen Verhältnisse in den Einzugsgebieten der fünf Wildbäche: Abb 23 Projektperimeter mit Relief Das Hauptziel der forstlichen Arbeiten besteht darin, durch Verbauungen, Aufforstungen und Begrünungen einerseits den Wasserabfluss zu regulieren (Brechen der Abflussspitzen) und andererseits die Geschiebelieferung in die Gerinne zu vermindern (Reduktion des Geschiebe
17 potenzials). Dadurch wird erreicht, dass die Murgangereignisse in ihrer Grösse und Häufigkeit abnehmen; zudem werden die Schutzwerke des Wasserbaus weniger stark belastet. Das Prinzip des Vorgehens hat sich in den vergangenen 100 Jahren nicht geändert, wohl aber die technischen Hilfsmittel und die Arbeitsverfahren. Das Ablaufschema kann wie folgt charakterisiert werden: Vorbereitung der Aufforstungsflächen Das oberflächliche, lose Gesteinsmaterial wird in Säcken/Körben eingebaut, die im Verbund miteinander zu gut fundierten Mauern zusammengeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass die losen Steine talwärts transportiert werden (durch Schnee oder Wasser). Die Terrassierung reduziert das Schneegleiten und bildet Auffangräume für weiter oben abrollendes Material. Je nach Oberflächenbeschaffenheit müssen zusätzlich Erosionsschutznetze eingebaut werden. Gleitschneeschutz An den meist südexponierten über 28 geneigten Häng en tritt im Winter regelmässig starkes Schneegleiten auf. Dadurch werden junge Pflanzen ausgerissen, die Stämmchen aufgespalten oder gebrochen. Eine unerlässliche Voraussetzung für das erfolgreiche Aufwachsen von Aufforstungen auf solchen Flächen ist der technische Schutz gegen das Schneegleiten. Dieser wird durch den Einbau von Dreibeinböcken aus Edelkastanienholz sichergestellt. Aufforstung Bezüglich Schutzwirkung steht bei den Aufforstungen in den allermeisten Fällen die Befestigung der Bodenoberfläche im Vordergrund (Erosionsschutz, Geschieberückhalt, Wasserregulierung). Die Baumartenwahl ist stark abhängig vom Standort (Höhenlage, Boden). Viele Gebiete liegen im Wirkungsbereich von Staub- und Fliesslawinen, die ihre Einzugsgebiete oberhalb der natürlichen Waldgrenze haben. Auf solchen Flächen dürfen nicht hochstämmige Nadelhölzer wie Fichte gepflanzt werden, da diese durch Lawinen gebrochen oder gar geworfen werden. Tolerant gegenüber Lawinen sind insbesondere Alpenerlen und Legföhren. Abb 24 Teilfläche Kleine Lamm (Lammbach): Steinkörbe, Erosionsschutznetze, Gleitschneeschutz mit Dreibeinböcken, Begrünung und Aufforstung
18 In den durch Bund und Kanton subventionierten forstlichen Projekten der Brienzer Wildbäche wurden bis heute folgende Massnahmen ausgeführt: Fusswege 64.2 km Trockenmauern m 3 Mauern in Steinsäcken m 3 Lawinenverbau (Stahl) 800 m Lawinenverbau (Holz) 5'790 m Entwässerungen 4'670 m Begrünungen 660 Aren Bermen 8'600 m Aufforstungen 8.7 Mio. Pflanzen Dreibeinböcke 4'330 Stk. Gleitschneebrücken 150 m Pfählungen 56'770 Stk. Am Beispiel des Baus von Mauern zeigt sich deutlich, dass insbesondere in den ersten Jahrzehnten unglaubliche Anstrengungen unternommen wurden: Abb 25 Bau von Trockenmauern und Steinkörben Ein ähnliches Bild ergibt die Auswertung der Pflanzungen: Abb 26 Pflanzungen
19 Die in den Abrechnungen ausgewiesenen Kosten belaufen sich auf insgesamt Fr Mio. (nominell); zu heutigen Preisen (indexiert) dürfte die investierte Bausumme gut Fr. 60 Mio. betragen. Die Kosten wurden zu rund 2/3 vom Bund und zu 1/3 vom Kanton getragen, seit 1998 werden die Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten mit insgesamt 5% beteiligt (ca. Fr. 25'000.- pro Jahr). 8. Wiederbewaldung Obwohl der Pflanzenausfall auf gewissen Teilflächen sehr gross oder sogar total war, ist die Zunahme der Bewaldung in den Einzugsgebieten insgesamt äusserst erfreulich. Abb 27 Gibelegg 1905 Abb 28 Gibelegg,
20 Vor 100 Jahren waren knapp 10% der heutigen Projektfläche bewaldet (orange); heute beträgt der Waldanteil rund 40% (grün): Abb 29 Bewaldung im Einzugsgebiet der Brienzer Wildbäche: orange: 1870, grün: Zunahme bis Erkenntnisse Im Bericht Brienzer Wildbäche: Evaluation forstlicher und wasserbaulicher Massnahmen der letzten 100 Jahre kam das Büro Geo 7 (1997, M. Zimmermann, P. Mani, G. Hunziker, W. Balmer, M. Concetti) zu folgenden Schlussfolgerungen: Gut 100 Jahre später präsentiert sich die Lage in den 5 Bächen deutlich anders: Seit 1896 ist keine Katastrophe und auch kein grosses Ereignis mehr aufgetreten. Mit dem Bau der Sperren und den grossflächigen Aufforstungen ist eine Stabilität in die Gerinne und die Flächen zurückgekehrt, die möglicherweise bereits einmal im Mittelalter vorhanden war. Die nach wie vor auftretenden kleineren und mittleren Ereignisse konnten dank technischen Massnahmen im Unterlauf einigermassen gut kontrolliert werden. Heute geht man davon aus, dass Katastrophen wie 1797 und 1896 nicht mehr auftreten können. Die Erhaltung und allenfalls sogar Verbesserung des aktuellen Zustandes bedingt jedoch von allen Beteiligten (Forst und Wasserbau) einen konstanten und hohen Grad an Pflege, Unterhalt und Erneuerung. Trotzdem ereignete sich in Brienz in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 die verheerende Murgangkatastrophe (vgl. Kap. 2.1). Die Ursachen lagen in den lang anhaltenden Rekordniederschlägen, der damit verbundenen vollständigen Wassersättigung des Schutts in den Bachbetten und den zwei grossen Rutschungen, die direkt in die Gerinne des Glyssibach resp. Trachtbachs gelangten. Die unglückliche Kombination dieser Voraussetzungen wurde bei der Ausarbeitung der Wassergefahrenkarten von Schwanden und Brienz als Szenario jenseits von 300 Jahren beurteilt
21 Das Büro IMPULS (2007, K. Zürcher) erarbeitete im Auftrag der Abteilung Naturgefahren eine Unwetteranalyse vom August 2005 im Perimeter des forstlichen Verbauungs- und Aufforstungsprojektes Brienzer Wildbäche. Das Projekt wurde von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (A. Böll) konzeptionell und wissenschaftlich begleitet. In der Studie wurden folgende Schlüsse gezogen: Die lang anhaltenden Niederschläge und die damit verbundene über Tage andauernde vollständige Wassersättigung im Boden stellten für die vorhandenen Schutzbauten einen erheblichen Belastungsfall dar (Erddruck, hydrostatischer Druck und Sickerströmungsdruck). Im forstlichen Projektgebiet sind nur geringe Schäden aufgetreten, nämlich einige kleinflächige, flachgründige Rutschungen im Einzugsgebiet des Schwanderbachs sowie Schäden an einigen Mauern im Gebiet Bälmelti durch massive Erosion im Bereich der Einbindung der Mauern ins gewachsene Terrain (Freilegung) und durch Unterspülung der Fundamente. An den Aufforstungen wurden keine Schäden festgestellt. Betreffend Erosion, bzw. Bodenstabilisierung und Geschiebeverlagerung in der Fläche haben die Mauern und der Vegetationsbewuchs eine grosse Wirkung. Sie leisten über die Jahre hinweg einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung des Geschiebeeintrags in die Gerinne. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hätte im August 2005 ebenfalls mehr Geschiebe in den Gerinneoberläufen bereitgelegen, wodurch die Geschiebefracht im Bereich des Schadenpotenzials erhöht worden wäre. Und schliesslich wäre das Potenzial für Folgeereignisse entsprechend erhöht worden. Die Wirkung der Vegetation auf den Wasserhaushalt ist über das ganze Jahr betrachtet meist beträchtlich. Im Falle eines einzelnen Ereignisses ist sie dagegen stark von der Niederschlagsdauer und -intensität, der Gründigkeit des Bodens und der Intensität der Durchwurzelung abhängig. Aufgrund der Höhenlage und Flachgründigkeit vieler Böden ist nur ein geringer waldbaulicher Einfluss auf den Wasserrückhalt im Hochwasserfall zu erwarten. Die einzelnen Werke und die Anordnung der Verbauungen als Ganzes haben sich grundsätzlich bewährt. Das Ereignis hat deutlich gemacht, dass die Verbauungen und Aufforstungen offenbar praktisch durchwegs fachgerecht gebaut und dank des kontinuierlichen Unterhalts in einem funktionstüchtigen Zustand erhalten worden sind. Dem Unterhalt und der Instandstellung der bestehenden Werke kommt eine zentrale Bedeutung zu, welche mit zunehmendem Alter der Verbauungen noch gesteigert wird. Die Verbauungen und Aufforstungen im Projektgebiet der Brienzer Wildbäche sind ein wesentlicher Teil des Gesamtsystems der Massnahmen, welche zur Reduktion der Schäden durch die Wildbachaktivität beitragen. Dies hat sich auch beim Ereignis im August 2005 gezeigt. 10. Ausblick Die Murgangkatastrophe vom 23. August 2005 hat nach mehr als hundert Jahren relativer Ruhe brutal aufgezeigt, dass in den Brienzer Wildbächen auch weiterhin Grossereignisse auftreten können. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen befürchten, dass mittlere und grosse Ereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden. Das gesamte Wildbachsystem wird dadurch stärker belastet, also auch die Verbauungswerke und Aufforstungen. Die Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der bestehenden Verbauungen und die Pflege der Aufforstungen stellen grosse Herausforderungen dar; in verschiedenen Teilgebieten sind gezielte Erweiterungen notwendig. Diese enorm wichtigen Aufgaben können auch in Zukunft nur sichergestellt werden, wenn Bund und Kanton umfangreiche finanzielle Beiträge leisten, damit die Restkosten für die Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten tragbar bleiben
22 Quellenangaben - E. Dasen (1951): Verbauungen und Aufforstungen der Brienzer Wildbäche. Veröffentlichungen über Verbauungen (Nr. 5) des Eidg. Departementes des Innern. - H. Langenegger, H. Kienholz, W. Gerber (1992): Brienzer Wildbäche. Exkursionsführer zur Interpraevent-Tagung. - M. Zimmermann, P. Mani, G. Hunziker, W. Balmer, M. Concetti (Büro Geo 7, 1997): Evaluation forstlicher und wasserbaulicher Massnahmen der letzten 100 Jahre in den Brienzer Wildbächen (Bericht). - NDR Consulting Zimmermann, Niederer + Pozzi Umwelt AG (2006): Lokale lösungsorientierte Ereignisanalysen (LLE) der Murgangkatastrophe vom 23. August 2005 durch den Glyssibach und Trachtbach. - K. Zürcher, IMPULS, A. Böll, WSL (2007): Unwetteranalyse vom August 2005 im Perimeter des forstlichen Verbauungs- und Aufforstungsprojektes Brienzer Wildbäche (Bericht). - Abteilung Naturgefahren: Diverse eigene (Projekt-)Unterlagen und Auswertungen
Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum Erfolg
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum
Ziele des Bundes bei der. Gefahrenprävention
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Gefahrenprävention Ziele des Bundes bei der Gefahrenprävention Medienkonferenz SVV, Luzern - 22.
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Gefahrenprävention Ziele des Bundes bei der Gefahrenprävention Medienkonferenz SVV, Luzern - 22.
Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat B 164
 Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat B 164 zum Entwurf eines Dekrets über einen Sonderkredit für den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der K 10 in den Gemeinden Malters
Botschaft des Regierungsrates an den Grossen Rat B 164 zum Entwurf eines Dekrets über einen Sonderkredit für den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der K 10 in den Gemeinden Malters
Schulung Gefahrenkarten Thurgau
 Schulung Gefahrenkarten Thurgau Modul 1: Basiswissen Referentin: Martina Zahnd Mai 2014 Inhalt Inhalt Teil 1 1. Überblick Naturgefahren 2. Zum gestern und heute 3. der Gefahrenkartierung 4. Rechtliche
Schulung Gefahrenkarten Thurgau Modul 1: Basiswissen Referentin: Martina Zahnd Mai 2014 Inhalt Inhalt Teil 1 1. Überblick Naturgefahren 2. Zum gestern und heute 3. der Gefahrenkartierung 4. Rechtliche
UNWETTERSCHÄDEN VOM
 Kanton Graubünden Gemeinde Scuol UNWETTERSCHÄDEN VOM 22.-24.07.2015 Weiler Pradella (Val Triazza) -> 22. Juli (19.30 21.00h) und 24. Juli (18.00h) - Vier betroffene Gebäude, an drei entstanden grössere
Kanton Graubünden Gemeinde Scuol UNWETTERSCHÄDEN VOM 22.-24.07.2015 Weiler Pradella (Val Triazza) -> 22. Juli (19.30 21.00h) und 24. Juli (18.00h) - Vier betroffene Gebäude, an drei entstanden grössere
WENN DAS WASSER ZUR KATASTROPHE WIRD
 WENN DAS WASSER ZUR KATASTROPHE WIRD Kinderuni Bern, Christian Rohr source: http://boris.unibe.ch/81872/ downloaded: 31.1.2017 1 Inhalte Was erforscht ein Umwelt- und Klimahistoriker? Welche Ursachen haben
WENN DAS WASSER ZUR KATASTROPHE WIRD Kinderuni Bern, Christian Rohr source: http://boris.unibe.ch/81872/ downloaded: 31.1.2017 1 Inhalte Was erforscht ein Umwelt- und Klimahistoriker? Welche Ursachen haben
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN
 1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
1 NIEDERSCHLAGSMENGEN Im Kanton Solothurn fallen im langjährigen Durchschnitt etwa 1240 mm Niederschläge pro Jahr. Das sind insgesamt rund 980 Mia. Liter Regen und Schnee oder ein 225000 km langer Zug,
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT. 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER. 1. Einleitung
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER 1. Einleitung Eine ausführliche Ereignisdokumentation wird
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 6. Oktober 2014 PFLICHTENHEFT EREIGNISDOKUMENTATION HOCHWASSER 1. Einleitung Eine ausführliche Ereignisdokumentation wird
Veränderungen in der Zukunft Der Kanton handelt
 Veränderungen in der Zukunft Der Kanton handelt Grüöbebach Guttannen Foto: N. Hählen Innertkirchen, 27. Mai 2013 Oberingenieurkreis I Unsere aktuellen Problemstellen nach Innertkirchen Rotlaui Spreitgraben
Veränderungen in der Zukunft Der Kanton handelt Grüöbebach Guttannen Foto: N. Hählen Innertkirchen, 27. Mai 2013 Oberingenieurkreis I Unsere aktuellen Problemstellen nach Innertkirchen Rotlaui Spreitgraben
Risiken (Umgang mit Gefahren)
 Risiken (Umgang mit Gefahren) Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe I und II Fach: Mathematik M2 Lernziele Einführung in die mathematische Grösse ahrscheinlichkeit Einführung in die mathematische Grösse
Risiken (Umgang mit Gefahren) Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe I und II Fach: Mathematik M2 Lernziele Einführung in die mathematische Grösse ahrscheinlichkeit Einführung in die mathematische Grösse
Murgänge Spreitloui und Rotloui, Guttannen. Isabelle Kull Daniel Tobler
 Murgänge Spreitloui und Rotloui, Guttannen Isabelle Kull Daniel Tobler Inhaltsübersicht Spreitgraben 1. Einleitung 2. Rückblick Ereignisse 2009-2011 3. Geschiebeentwicklung 2009-2011 4. Ereignisauslösende
Murgänge Spreitloui und Rotloui, Guttannen Isabelle Kull Daniel Tobler Inhaltsübersicht Spreitgraben 1. Einleitung 2. Rückblick Ereignisse 2009-2011 3. Geschiebeentwicklung 2009-2011 4. Ereignisauslösende
HOCHWASSER 2005 AUS DER SICHT EINER GEMEINDE. 22. August 2005
 HOCHWASSER 2005 AUS DER SICHT EINER GEMEINDE 22. August 2005 Glyssibach ausbaggern Kantonsstrasse Bachtale/Wildbach Erster Kontakt mit Feuerwehr Peter Flück, Gemeindepräsident Brienz: Hochwasser 2005 aus
HOCHWASSER 2005 AUS DER SICHT EINER GEMEINDE 22. August 2005 Glyssibach ausbaggern Kantonsstrasse Bachtale/Wildbach Erster Kontakt mit Feuerwehr Peter Flück, Gemeindepräsident Brienz: Hochwasser 2005 aus
Aushub: Anfall und Entsorgung
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Boden Aushub: Anfall und Entsorgung FSKB-Herbstanlass 2011, 26.10.2011 Grubenbilanz Bauwirtschaft
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Boden Aushub: Anfall und Entsorgung FSKB-Herbstanlass 2011, 26.10.2011 Grubenbilanz Bauwirtschaft
Auswirkungen des KlimawandelsIS
 Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Checkliste für die Planung und Umsetzung von Gebäudeschutzmassnahmen
 Checkliste für die Planung und Umsetzung von Gebäudeschutzmassnahmen Wer beim Planen, Bauen und Renovieren den Schutz vor möglichen Naturgefahren berücksichtigt, kann viel Ärger, Schäden und Kosten sparen
Checkliste für die Planung und Umsetzung von Gebäudeschutzmassnahmen Wer beim Planen, Bauen und Renovieren den Schutz vor möglichen Naturgefahren berücksichtigt, kann viel Ärger, Schäden und Kosten sparen
Merkblatt Gefahrenkarte
 Verkehr und Infrastruktur (vif) Merkblatt Gefahrenkarte Gefahrenkarten zeigen auf, welche Gebiete durch die vier gravitativen Gefahrenprozesse (Wasser, Rutsch, Sturz, und Lawinenprozesse) gefährdet sind
Verkehr und Infrastruktur (vif) Merkblatt Gefahrenkarte Gefahrenkarten zeigen auf, welche Gebiete durch die vier gravitativen Gefahrenprozesse (Wasser, Rutsch, Sturz, und Lawinenprozesse) gefährdet sind
Erfassung von Naturereignissen bei der SBB
 Erfassung von Naturereignissen bei der SBB Ereignismanagement mittels GIS Dr. sc. nat. Andreas Meier SBB Infrastruktur Umwelt Naturrisiken SBB Infrastruktur Umwelt / Andreas Meier SOGI 08.09.2009 1 0 Inhalt
Erfassung von Naturereignissen bei der SBB Ereignismanagement mittels GIS Dr. sc. nat. Andreas Meier SBB Infrastruktur Umwelt Naturrisiken SBB Infrastruktur Umwelt / Andreas Meier SOGI 08.09.2009 1 0 Inhalt
Hochwasser das Ereignis und seine Folgen. Armin Petrascheck Bundesamt für Wasser und Geologie, Schweiz
 Hochwasser 2002 - das Ereignis und seine Folgen Armin Petrascheck Bundesamt für Wasser und Geologie, Schweiz Hödlmayer Rückblick HW 2002 Salzburg Subheadline Arial Regular 25 Pt Steyr Mitterkirchen Langenlois
Hochwasser 2002 - das Ereignis und seine Folgen Armin Petrascheck Bundesamt für Wasser und Geologie, Schweiz Hödlmayer Rückblick HW 2002 Salzburg Subheadline Arial Regular 25 Pt Steyr Mitterkirchen Langenlois
VORSCHAU. zur Vollversion. Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel
 Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel Mit dem Rückgang der Gletscher drohen Naturgefahren Überschwemmungen sind in den Alpen die größte Gefahr. Durch den Temperaturanstieg fällt Schnee bis in große
Lehrer-Begleittext: Gletscher im Klimawandel Mit dem Rückgang der Gletscher drohen Naturgefahren Überschwemmungen sind in den Alpen die größte Gefahr. Durch den Temperaturanstieg fällt Schnee bis in große
Rahmenbericht zur standardisierten Risikoermittlung für Erdgashochdruckanlagen in der Schweiz 12. November 2013
 Rahmenbericht zur standardisierten Risikoermittlung für Erdgashochdruckanlagen in der Schweiz 12. November 2013 Probabilistik Rahmenbericht 2010 suisseplan Ingenieure AG Zürich (Judith Kemmler, David Thurnherr)
Rahmenbericht zur standardisierten Risikoermittlung für Erdgashochdruckanlagen in der Schweiz 12. November 2013 Probabilistik Rahmenbericht 2010 suisseplan Ingenieure AG Zürich (Judith Kemmler, David Thurnherr)
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
RISIKOANALYSE UND RISIKOKARTE HOCHWASSER KANTON ZÜRICH
 RISIKOANALYSE UND RISIKOKARTE HOCHWASSER KANTON ZÜRICH Mirco Heidemann MSc ETH Environ.Sc/DAS ETH in Applied Statistics Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sicherheitsmesse 10. November 2015 RISIKOKARTE HOCHWASSER
RISIKOANALYSE UND RISIKOKARTE HOCHWASSER KANTON ZÜRICH Mirco Heidemann MSc ETH Environ.Sc/DAS ETH in Applied Statistics Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sicherheitsmesse 10. November 2015 RISIKOKARTE HOCHWASSER
Bewertung des Hochwasserrisikos für Gewässer II. Ordnung sowie für die Bereiche mit wild abfließendem Oberflächenwasser in Pirna
 Seite 1 Struppenbach 1 Beschreibung Der Struppenbach entsteht oberhalb von Struppen und verläuft zunächst auf einer Länge von 2.400 m (rd. 60 % der Gesamtlänge) durch die Ortslage Struppen. Im Anschluss
Seite 1 Struppenbach 1 Beschreibung Der Struppenbach entsteht oberhalb von Struppen und verläuft zunächst auf einer Länge von 2.400 m (rd. 60 % der Gesamtlänge) durch die Ortslage Struppen. Im Anschluss
Land- und Forstwirtschaft. Land- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft der Schweiz. Neuchâtel 2015
 07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1500 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2015 Neuchâtel 2015 Forststatistik 2014 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 913
07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1500 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2015 Neuchâtel 2015 Forststatistik 2014 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 913
ENTLASTUNGSLEITUNG HALDENBACH: GEFAHRENKARTE NACH MASSNAHME
 Gefahrenkarte Hochwasser Unteres Reusstal ENTLASTUNGSLEITUNG HALDENBACH: GEFAHRENKARTE NACH MASSNAHME Objekt: Entlastungsleitung Haldenbach in die Sauberwasserleitung Bauherrschaft: Gemeinde Widen 1. Bauvorhaben
Gefahrenkarte Hochwasser Unteres Reusstal ENTLASTUNGSLEITUNG HALDENBACH: GEFAHRENKARTE NACH MASSNAHME Objekt: Entlastungsleitung Haldenbach in die Sauberwasserleitung Bauherrschaft: Gemeinde Widen 1. Bauvorhaben
MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20
 MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20 VORHABENSART 8.5.1: INVESTITIONEN ZUR STÄRKUNG VON RESISTENZ UND ÖKOLOGISCHEM WERT DES WALDES SL-STV DI DR. JOHANNES SCHIMA LINZ, 19. APRIL
MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20 VORHABENSART 8.5.1: INVESTITIONEN ZUR STÄRKUNG VON RESISTENZ UND ÖKOLOGISCHEM WERT DES WALDES SL-STV DI DR. JOHANNES SCHIMA LINZ, 19. APRIL
Die Elementarschadenversicherung
 Die Elementarschadenversicherung I. Zusammenfassung Die Elementarschadenversicherung deckt Schäden an Fahrhabe und Gebäuden, die durch Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, Lawinen, Schneedruck, Felssturz,
Die Elementarschadenversicherung I. Zusammenfassung Die Elementarschadenversicherung deckt Schäden an Fahrhabe und Gebäuden, die durch Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, Hagel, Lawinen, Schneedruck, Felssturz,
Schulung Naturgefahren im Kanton Thurgau
 Schulung Naturgefahren im Kanton Thurgau Modul 3 - Umsetzung M. Zahnd / N. Steingruber, Seite 1 Inhalt Einleitung Integrales Risikomanagement Kantonsaufgaben Gemeindeaufgaben Eigentümer, Bauherrschaft
Schulung Naturgefahren im Kanton Thurgau Modul 3 - Umsetzung M. Zahnd / N. Steingruber, Seite 1 Inhalt Einleitung Integrales Risikomanagement Kantonsaufgaben Gemeindeaufgaben Eigentümer, Bauherrschaft
Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse an der Donau
 Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse an der Donau Hochwasserdialog Donau am 24.09.2015 H. Komischke, Referat 81 Klimawandel was bedeutet das für uns in Zukunft? Anstieg der Lufttemperatur
Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse an der Donau Hochwasserdialog Donau am 24.09.2015 H. Komischke, Referat 81 Klimawandel was bedeutet das für uns in Zukunft? Anstieg der Lufttemperatur
Resilienz. aus der Optik Naturgefahren. Wanda Wicki, Bundesamt für Umwelt BAFU, 26. Februar 2016
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Resilienz aus der Optik Naturgefahren Wanda Wicki, Bundesamt für Umwelt
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Resilienz aus der Optik Naturgefahren Wanda Wicki, Bundesamt für Umwelt
Beschlussesantrag an die Gemeindeversammlung vom 12. Mai 2015
 Geschäft 5 Vollmacht und Objektkredit für das Bauprojekt Rutschung Hintergraben im Gesamtbetrag von Fr. 2'100'000.00, abzüglich Beiträge Dritter 1. Ausgangslage Im Gebiet Hintergraben in der Gemeinde Sarnen,
Geschäft 5 Vollmacht und Objektkredit für das Bauprojekt Rutschung Hintergraben im Gesamtbetrag von Fr. 2'100'000.00, abzüglich Beiträge Dritter 1. Ausgangslage Im Gebiet Hintergraben in der Gemeinde Sarnen,
Waldkataster in spe. Wald und Holzkanton Aargau Marcel Murri, Abteilung Wald
 Waldkataster in spe 25. April 2014 Marcel Murri, Abteilung Wald AfW, Runder Waldtisch 23. Januar 2015 Wald und Holzkanton Aargau 35 % der Kantonsfläche ist Wald. (Durchschnitt Schweiz: 31%, 1995: 29%)
Waldkataster in spe 25. April 2014 Marcel Murri, Abteilung Wald AfW, Runder Waldtisch 23. Januar 2015 Wald und Holzkanton Aargau 35 % der Kantonsfläche ist Wald. (Durchschnitt Schweiz: 31%, 1995: 29%)
Präsentation Bauen und Wassergefahren
 Präsentation Bauen und Wassergefahren Kapitel 4 Gefahrenkarten und regionale Grundlagen Stand November 2013 4. Gefahrenkarten Folie 1 Wissen über Wassergefahren Überflutung durch Hochwasser Gefahrenzonen?
Präsentation Bauen und Wassergefahren Kapitel 4 Gefahrenkarten und regionale Grundlagen Stand November 2013 4. Gefahrenkarten Folie 1 Wissen über Wassergefahren Überflutung durch Hochwasser Gefahrenzonen?
EBP Naturgefahrentag 2007
 EBP Naturgefahrentag 2007 Ökonomische Instrumente im Kreislauf des Risikomanagements von Naturgefahren im Überblick Hans Merz Naturkatastrophen - ein volkswirtschaftlicher Nutzen? 3 Definitionen Ökonomische
EBP Naturgefahrentag 2007 Ökonomische Instrumente im Kreislauf des Risikomanagements von Naturgefahren im Überblick Hans Merz Naturkatastrophen - ein volkswirtschaftlicher Nutzen? 3 Definitionen Ökonomische
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel
 Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms Wald und Klimawandel Tagung «Klimawandel und Wald eine ökonomische Sicht» Zollikofen, HAFL, 29. April 2015 Dr. Peter Brang Leiter des Forschungsprogramms
Hochwasserschutz in der Schweiz: eine Herausforderung!
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Hochwasserschutz und Revitalisierung: Neue Wege für unsere Flüsse Hochwasserschutz in der Schweiz:
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Hochwasserschutz und Revitalisierung: Neue Wege für unsere Flüsse Hochwasserschutz in der Schweiz:
Grundwassermodell. 4.2 Wasserkreislauf. Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf:
 4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
4.2 Wasserkreislauf Einführung: Wir alle kennen den Wasserkreislauf: Regen fällt zu Boden... und landet irgendwann irgendwie wieder in einer Wolke, die einen schon nach ein paar Stunden, die anderen erst
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel
 Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Weihenstephaner Erklärung zu Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und der forstlichen Verbände und Vereine in Bayern Waldtag Bayern Freising-Weihenstephan
Warum gibt es überhaupt Gebirge?
 Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Gebirge Es gibt heute viele hohe Gebirge auf der ganzen Welt. Die bekanntesten sind die Alpen in Europa, die Rocky Mountains in Nordamerika und der Himalaya in Asien. Wie sind diese Gebirge entstanden
Information über Hochwasser und Gefahrenzonenplan aus Sicht der Raumplanung
 Information über Hochwasser und Gefahrenzonenplan aus Sicht der Raumplanung Im Örtlichen Raumordnungsprogramm Flächenwidmungsplan werden beide Plandokumente Gefahrenzonenplan (der Gefahrenzonenplan wurde
Information über Hochwasser und Gefahrenzonenplan aus Sicht der Raumplanung Im Örtlichen Raumordnungsprogramm Flächenwidmungsplan werden beide Plandokumente Gefahrenzonenplan (der Gefahrenzonenplan wurde
Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren
 Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Naturgefahrenkarten: Das Wesentliche in
Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Naturgefahrenkarten: Das Wesentliche in
MURGÄNGE SPREITGRABEN: MURGANGBREMSE IN ZUSAMMENARBEIT MIT NDR ZIMMERMANN, THUN
 MURGÄNGE SPREITGRABEN: MURGANGBREMSE IN ZUSAMMENARBEIT MIT NDR ZIMMERMANN, THUN 1 Ausgangslage: Anrissgebiet 2009/2010! Felsstürze ausgelöst durch auftauenden Permafrost auf ca. 3000 m ü.m.! Freisetzung
MURGÄNGE SPREITGRABEN: MURGANGBREMSE IN ZUSAMMENARBEIT MIT NDR ZIMMERMANN, THUN 1 Ausgangslage: Anrissgebiet 2009/2010! Felsstürze ausgelöst durch auftauenden Permafrost auf ca. 3000 m ü.m.! Freisetzung
Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular B Hochwasser
 Formularblatt B Hochwasser 1/5 Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular B Hochwasser Grau hinterlegte Felder sind durch den Gutachter auszufüllen. 1. Schutzziele Neubau Bestehender Bau Für die Schutzziele
Formularblatt B Hochwasser 1/5 Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular B Hochwasser Grau hinterlegte Felder sind durch den Gutachter auszufüllen. 1. Schutzziele Neubau Bestehender Bau Für die Schutzziele
Verfasser: Dipl.-Ing. Andreas Romey (Leiter Wasserbehörde der Stadt Braunschweig)
 Beitrag für die Mitarbeiterzeitschrift WIR der Stadt Braunschweig Verfasser: Dipl.-Ing. Andreas Romey (Leiter Wasserbehörde der Stadt Braunschweig) Hochwasser Mai 2013 Nach dem Juni 2002 gab es im Mai
Beitrag für die Mitarbeiterzeitschrift WIR der Stadt Braunschweig Verfasser: Dipl.-Ing. Andreas Romey (Leiter Wasserbehörde der Stadt Braunschweig) Hochwasser Mai 2013 Nach dem Juni 2002 gab es im Mai
Gefahrenkarte Hochwasser Umsetzung mit Objektschutz
 Gefahrenkarte Hochwasser Umsetzung mit Objektschutz 1. Naturgefahren 2. Schutzmassnahmen 3. Aufgabenteilung und Zuständigkeiten 4. Staatsaufgabe oder Eigenverantwortung 5. Wo liegen die Grenzen? Beratungsstelle
Gefahrenkarte Hochwasser Umsetzung mit Objektschutz 1. Naturgefahren 2. Schutzmassnahmen 3. Aufgabenteilung und Zuständigkeiten 4. Staatsaufgabe oder Eigenverantwortung 5. Wo liegen die Grenzen? Beratungsstelle
Organisation Mattertal Sommer und Winter
 Organisation Mattertal Sommer und Winter Zermatt 117 Hotels 36 Seilbahnen / mit Cervinia 74 25000 Bett - 30000 pro Tag Matterhorn Gotthardbahn Visp-Täsch, alle Std. ein Zug Täsch-Zermatt, in beiden Richtungen
Organisation Mattertal Sommer und Winter Zermatt 117 Hotels 36 Seilbahnen / mit Cervinia 74 25000 Bett - 30000 pro Tag Matterhorn Gotthardbahn Visp-Täsch, alle Std. ein Zug Täsch-Zermatt, in beiden Richtungen
Ratschläge für Präventionsmassnahmen gegen Elementarschäden
 Ratschläge für Präventionsmassnahmen gegen Elementarschäden Was Sie als (zukünftige) Hausbesitzer wissen müssen und veranlassen können Einleitung Ratschläge für Ihre Sicherheit Im Rahmen der Elementarschadenbearbeitung
Ratschläge für Präventionsmassnahmen gegen Elementarschäden Was Sie als (zukünftige) Hausbesitzer wissen müssen und veranlassen können Einleitung Ratschläge für Ihre Sicherheit Im Rahmen der Elementarschadenbearbeitung
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet
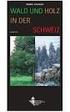 Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Infrastruktur. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Ausgabe DIENSTBEHELF DB 740 Teil 0. Untergrund und Unterbau Allgemeines.
 Untergrund und Unterbau Allgemeines BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DIENSTBEHELF DB 740 Teil 0 Soil and permanent way General Matters Defintions Infrastruktur Untergrund und Unterbau Seite 2 Herausgeber: ÖBB Vivenotgasse
Untergrund und Unterbau Allgemeines BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DIENSTBEHELF DB 740 Teil 0 Soil and permanent way General Matters Defintions Infrastruktur Untergrund und Unterbau Seite 2 Herausgeber: ÖBB Vivenotgasse
Altlastenpolitik der Umwelt zuliebe
 Altlastenpolitik der Umwelt zuliebe Altlasten als Teil der nationalen Umweltpolitik Sicht einer Geologin und Politikerin Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin CVP Kanton Zürich Tagung Altlastentagung «Alte Lasten
Altlastenpolitik der Umwelt zuliebe Altlasten als Teil der nationalen Umweltpolitik Sicht einer Geologin und Politikerin Dr. Kathy Riklin, Nationalrätin CVP Kanton Zürich Tagung Altlastentagung «Alte Lasten
Beiträge an das Lötschental (Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten) und das Goms (Gemeinde Geschinen)
 GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 1535 Beiträge an das Lötschental (Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten) und das Goms (Gemeinde Geschinen) Bericht und Antrag des Stadtrates vom 7. März 2000 Sehr
GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 1535 Beiträge an das Lötschental (Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten) und das Goms (Gemeinde Geschinen) Bericht und Antrag des Stadtrates vom 7. März 2000 Sehr
Massnahmen und Notfallplanung im Urner Talboden
 Hochwasser 2005 Massnahmen und Notfallplanung im Urner Talboden Information an Fachmesse für Sicherheit vom 12.11.2015 Ernst Philipp, Abteilungsleiter Wasserbau, Baudirektion des Kantons Uri 1. Hochwasser
Hochwasser 2005 Massnahmen und Notfallplanung im Urner Talboden Information an Fachmesse für Sicherheit vom 12.11.2015 Ernst Philipp, Abteilungsleiter Wasserbau, Baudirektion des Kantons Uri 1. Hochwasser
Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor
 Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor Daniel Rigling Leiter Gruppe Phytopathologie Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 1 Eingeschleppte Schadorganismen Definition: Neu:
Diagnostik und Forschung im Pflanzenschutzlabor Daniel Rigling Leiter Gruppe Phytopathologie Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL 1 Eingeschleppte Schadorganismen Definition: Neu:
Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123. zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses
 Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123 zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses über die Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der
Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 123 zum Entwurf eines Kantonsratsbeschlusses über die Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau der linksufrigen Zuflüsse zur Kleinen Emme entlang der
Erläuternder Bericht des Sicherheits- und Justizdepartements zu einem Nachtrag zur Verordnung zum Ausländerrecht
 Erläuternder Bericht des Sicherheits- und Justizdepartements zu einem Nachtrag zur Verordnung zum Ausländerrecht 10. Februar 2015 Zusammenfassung... 2 I. Ausgangslage... 2 1. Änderung auf Bundesebene...
Erläuternder Bericht des Sicherheits- und Justizdepartements zu einem Nachtrag zur Verordnung zum Ausländerrecht 10. Februar 2015 Zusammenfassung... 2 I. Ausgangslage... 2 1. Änderung auf Bundesebene...
Gefahren für den Boden
 1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
1 Seht euch die Schnellstraße an. Was fällt euch dabei zum Boden ein? Exkursionseinheit 7 / Seite S 1 Was bedeutet "Flächen verbrauchen"? Spontan denkt man: Flächen kann man doch gar nicht verbrauchen!
Kulturapéro der Stadt Chur im Bündner Kunstmuseum vom 4. November 2016
 Kulturapéro der Stadt Chur im Bündner Kunstmuseum vom 4. November 2016 Grusswort von Martin Jäger, Regierungsrat Liebe Frau Stadträtin, geschätzte Doris Sehr geehrte Damen und Herren der städtischen Kulturkommission
Kulturapéro der Stadt Chur im Bündner Kunstmuseum vom 4. November 2016 Grusswort von Martin Jäger, Regierungsrat Liebe Frau Stadträtin, geschätzte Doris Sehr geehrte Damen und Herren der städtischen Kulturkommission
Gebäudeschäden durch Hagel
 Gebäudeschäden durch Hagel Erkenntnisse aus zwei Ereignisanalysen Markus Imhof Bereichsleiter Naturgefahren Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV Bern Fachmesse für Sicherheit: Risikomanagement
Gebäudeschäden durch Hagel Erkenntnisse aus zwei Ereignisanalysen Markus Imhof Bereichsleiter Naturgefahren Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV Bern Fachmesse für Sicherheit: Risikomanagement
Abstände für Mauern, Einfriedigungen und Pflanzen zu Nachbargrundstücken und zu öffentlichen Strassen
 Gemeinde Egg Bauamt Forchstrasse 145 Postfach 8132 Egg Tel: 043 277 11 20 Fax: 043 277 11 29 Mail: bauamt@egg.ch Abstände für Mauern, Einfriedigungen und Pflanzen zu Nachbargrundstücken und zu öffentlichen
Gemeinde Egg Bauamt Forchstrasse 145 Postfach 8132 Egg Tel: 043 277 11 20 Fax: 043 277 11 29 Mail: bauamt@egg.ch Abstände für Mauern, Einfriedigungen und Pflanzen zu Nachbargrundstücken und zu öffentlichen
Aktuelles zum Wettergeschehen
 Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Land- und Forstwirtschaft. Land- und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft der Schweiz. Neuchâtel, 2014
 07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1400 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2014 Neuchâtel, 2014 Forststatistik 2013 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 778
07 Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft 829-1000 829-1400 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 2014 Neuchâtel, 2014 Forststatistik 2013 1 Schweiz Zürich Bern Holzernte in m 3 4 778
Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage
 Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage Autor: swissgrid ag Erstelldatum: 24. Februar 2012 Version: 1.0 Seite: 1 von 12 Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen
Auswertung von Lastgängen eines Gärtnerei-Betriebes mit eigener Photovoltaik-Anlage Autor: swissgrid ag Erstelldatum: 24. Februar 2012 Version: 1.0 Seite: 1 von 12 Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen
Helvetia Schutzwald Engagement. Baumpass. Jubiläumsedition Helvetia Schutzwald Engagements in der Schweiz. Ihre Schweizer Versicherung.
 Helvetia Schutzwald Engagement Baumpass Jubiläumsedition 2016. Über 100 000 Bäume gepflanzt. Gemeinsam für den Schutzwald. Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden. Sie
Helvetia Schutzwald Engagement Baumpass Jubiläumsedition 2016. Über 100 000 Bäume gepflanzt. Gemeinsam für den Schutzwald. Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden. Sie
Forstwirtschaft der Schweiz. Taschenstatistik 2009
 Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Forstwirtschaft der Schweiz Taschenstatistik 29 Neuchâtel, 29 Forststatistik 28 Schweiz Zürich Bern Luzern Holznutzung Total in m 3 5 262 199 428 645 1 58 791 329 465 Veränderung zum Vorjahr (27) in %
Besonders extreme Wetterlagen werden durch Klimawandel am stärksten zunehmen
 Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Sicherheitsinstitut (A. Götz) Übersicht 2. Sicherheitsinstitut (Piktogramme z.t. Internet)
 1 (A. Götz) Übersicht 2 (Piktogramme z.t. Internet) Risiko und Sicherheit = politische Thematik 3 (Bildquelle Internet) Was bedroht uns in Zukunft? 4 (Abbildungen Internet) Ziel: proaktive Planung (vorausschauend)
1 (A. Götz) Übersicht 2 (Piktogramme z.t. Internet) Risiko und Sicherheit = politische Thematik 3 (Bildquelle Internet) Was bedroht uns in Zukunft? 4 (Abbildungen Internet) Ziel: proaktive Planung (vorausschauend)
Netzwerke und Öffentlichkeitsarbeit
 Netzwerke und Öffentlichkeitsarbeit Ausführungen von J. Trümpler, Kantonsoberförster St.Gallen Schnittstellen und Sektorübergreifende Partnerschaften im Hinblick auf ein nachhaltiges Schutzwaldmanagement
Netzwerke und Öffentlichkeitsarbeit Ausführungen von J. Trümpler, Kantonsoberförster St.Gallen Schnittstellen und Sektorübergreifende Partnerschaften im Hinblick auf ein nachhaltiges Schutzwaldmanagement
Zur Böschungssicherung nach Hochwasserschäden
 1. Das Hochwasser im Müglitztal, August 2002 Die Müglitz ist ein Gewässer I. Ordnung und ein direkter Zufluss zur Elbe. Sie entspringt auf der tschechischen Seite des Erzgebirgskammes in Lysa Hora, fließt
1. Das Hochwasser im Müglitztal, August 2002 Die Müglitz ist ein Gewässer I. Ordnung und ein direkter Zufluss zur Elbe. Sie entspringt auf der tschechischen Seite des Erzgebirgskammes in Lysa Hora, fließt
Erkenntnisse aus Studie Hochwasser Paznaun - HOPWAP
 Erkenntnisse aus Studie Hochwasser Paznaun - HOPWAP ECKPUNKTE >> Intensität der Nutzung: 12% nutzbare Fläche Hochwässer 2002/2005/2009/2013,. Wirkung des Waldes generell Bewertung und Quantifizierung Sachverständigen
Erkenntnisse aus Studie Hochwasser Paznaun - HOPWAP ECKPUNKTE >> Intensität der Nutzung: 12% nutzbare Fläche Hochwässer 2002/2005/2009/2013,. Wirkung des Waldes generell Bewertung und Quantifizierung Sachverständigen
Kantonale Verwaltung Schloss Interlaken
 Kantonale Verwaltung Schloss Interlaken Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli Das Regierungsstatthalteramt Interlaken- Oberhasli ist Ihr Ansprechpartner im Verwaltungskreis Oberland Ost für folgende
Kantonale Verwaltung Schloss Interlaken Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli Das Regierungsstatthalteramt Interlaken- Oberhasli ist Ihr Ansprechpartner im Verwaltungskreis Oberland Ost für folgende
KAT Einsatz GBL Pinzgau Juni 2013 WETTER (Blöschl)
 KAT Einsatz GBL Pinzgau Juni DI. Gebhard Neumayr 2013 Aufgrund eines Ersuchens durch die BH Zell am See unterstützt diee Wildbach- und Lawinenverbauung die BH Zell am See seit 01.06.2013. 1. WETTER (Blöschl)
KAT Einsatz GBL Pinzgau Juni DI. Gebhard Neumayr 2013 Aufgrund eines Ersuchens durch die BH Zell am See unterstützt diee Wildbach- und Lawinenverbauung die BH Zell am See seit 01.06.2013. 1. WETTER (Blöschl)
NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER FRICKTAL
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 09. September 2014 NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER FRICKTAL HOHBÄCHLI TEILÖFFNUNG UND VERLEGUNG IN DER GEMEINDE ZEIHEN
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Abteilung Landschaft und Gewässer Wasserbau 09. September 2014 NACHFÜHRUNG GEFAHRENKARTE HOCHWASSER FRICKTAL HOHBÄCHLI TEILÖFFNUNG UND VERLEGUNG IN DER GEMEINDE ZEIHEN
Technischer Hochwasserschutz
 Projekttag zum Thema Leben am Fluss Technischer Hochwasserschutz Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung: A. Goerigk, M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit d LfULG mit der
Projekttag zum Thema Leben am Fluss Technischer Hochwasserschutz Idee, Konzeption und Umsetzung: R. Herold, LfULG Sachsen Mitwirkung: A. Goerigk, M. Grafe, LfULG Sachsen Zusammenarbeit d LfULG mit der
1 von 6 28.04.2015 09:51
 1 von 6 28.04.2015 09:51 In Hasliberg Hohfluh ist das erste Einfamilienhaus im Berner Oberland mit dem «Herkunftszeichen Schweizer Holz» ausgezeichnet worden. 86 Prozent der verbauten 110 Kubikmeter Holz
1 von 6 28.04.2015 09:51 In Hasliberg Hohfluh ist das erste Einfamilienhaus im Berner Oberland mit dem «Herkunftszeichen Schweizer Holz» ausgezeichnet worden. 86 Prozent der verbauten 110 Kubikmeter Holz
Wildbach und Wildbachverbauungen Formen, Prozesse, Massnahmen und Ziele
 Stefan Manser Ernst Stauffer Wildbach und Wildbachverbauungen Formen, Prozesse, Massnahmen und Ziele Eine powerpointgestützte Unterrichtssequenz 1. Einführung Das Zusammenspiel von Geländeform, Wassersättigung
Stefan Manser Ernst Stauffer Wildbach und Wildbachverbauungen Formen, Prozesse, Massnahmen und Ziele Eine powerpointgestützte Unterrichtssequenz 1. Einführung Das Zusammenspiel von Geländeform, Wassersättigung
Seeufer Rechts Süd, SRS-1
 Tiefbauamt Ingenieur-Stab / Fachstelle Lärmschutz Gemeinde : 158 Stäfa Sanierungsregion : Seeufer Rechts Süd, SRS-1 Strasse : Allenbergstrasse Projekt : Lärmsanierung Staatsstrassen Bericht Schallschutzfenster
Tiefbauamt Ingenieur-Stab / Fachstelle Lärmschutz Gemeinde : 158 Stäfa Sanierungsregion : Seeufer Rechts Süd, SRS-1 Strasse : Allenbergstrasse Projekt : Lärmsanierung Staatsstrassen Bericht Schallschutzfenster
Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung
 Bundesamt für Umwelt BAFU Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung Peter Greminger Risikomanagement kann einen Beitrag dazu leisten, bei ungewisser Sachlage best
Bundesamt für Umwelt BAFU Gedanken zu: Wildbäche und Murgänge eine Herausforderung für Praxis und Forschung Peter Greminger Risikomanagement kann einen Beitrag dazu leisten, bei ungewisser Sachlage best
Bevölkerung Die neue Volkszählung. Strukturerhebung. Registererhebung. Omnibus. Erhebungen. Neuchâtel, 2011
 01 Bevölkerung 1132-1101-05 Die neue Volkszählung Omnibus Strukturerhebung Thematische Erhebungen Strukturerhebung Neuchâtel, 2011 Die neue Volkszählung Von 1850 bis 2000 lieferte die Volkszählung alle
01 Bevölkerung 1132-1101-05 Die neue Volkszählung Omnibus Strukturerhebung Thematische Erhebungen Strukturerhebung Neuchâtel, 2011 Die neue Volkszählung Von 1850 bis 2000 lieferte die Volkszählung alle
Bekämpfung des Litterings in der Schweiz
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Abfall und Rohstoffe Bekämpfung des in der Schweiz Gemeindeseminar vom 3. Juni 2015 Kanton
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Abfall und Rohstoffe Bekämpfung des in der Schweiz Gemeindeseminar vom 3. Juni 2015 Kanton
Wird nicht geprüft: Zahlen und Daten
 Test Wallis Teil 2 Freitag, 21. März, Lernziele Lötschbergtunnel Wieso baut man Kehrtunnels? Wieso hat der alte Tunnel eine Kurve? Die Südrampe mit ihren Brücken und Tunnels. Der neue Tunnel Gründe für
Test Wallis Teil 2 Freitag, 21. März, Lernziele Lötschbergtunnel Wieso baut man Kehrtunnels? Wieso hat der alte Tunnel eine Kurve? Die Südrampe mit ihren Brücken und Tunnels. Der neue Tunnel Gründe für
Integration einer Rettungsstation in den Katastrophendienst
 Integration einer Rettungsstation in den Katastrophendienst Organisation Mattertal Sommer und Winter Der Lawinendienst Mattertal ist folgendem Kantonale Amt unterstellt STAAT WALLIS Departement für Verkehr,
Integration einer Rettungsstation in den Katastrophendienst Organisation Mattertal Sommer und Winter Der Lawinendienst Mattertal ist folgendem Kantonale Amt unterstellt STAAT WALLIS Departement für Verkehr,
Klimawandel und Energie - wo stehen wir?
 Energie - wo Dr. Albert von Däniken 1 Der Klimawandel findet statt Das Ausmass des Klimawandels schwer feststellbar Die Veränderungen beschleunigen sich Es findet eine Erwärmung des Klimasystems statt
Energie - wo Dr. Albert von Däniken 1 Der Klimawandel findet statt Das Ausmass des Klimawandels schwer feststellbar Die Veränderungen beschleunigen sich Es findet eine Erwärmung des Klimasystems statt
Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet.
 Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet Lage und Wegbeschreibung Bergmatten befindet sich oberhalb von Hofstetten-Flüh, einer Gemeinde im Bezirk Dorneck des Kantons Solothurn. Die Gemeinde gehört
Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet Lage und Wegbeschreibung Bergmatten befindet sich oberhalb von Hofstetten-Flüh, einer Gemeinde im Bezirk Dorneck des Kantons Solothurn. Die Gemeinde gehört
REGIERUNGSRAT. Aarau, Juni 2014 HINTERGRUNDINFORMATION. Schlanke und effiziente Verwaltung im Kanton Aargau. 1. Zusammenfassung
 REGIERUNGSRAT Aarau, Juni 2014 HINTERGRUNDINFORMATION Schlanke und effiziente Verwaltung im Kanton Aargau 1. Zusammenfassung Der Kanton Aargau verfügt über eine schlanke und effiziente Staatsverwaltung.
REGIERUNGSRAT Aarau, Juni 2014 HINTERGRUNDINFORMATION Schlanke und effiziente Verwaltung im Kanton Aargau 1. Zusammenfassung Der Kanton Aargau verfügt über eine schlanke und effiziente Staatsverwaltung.
Pflege von Bach und Seeufer. Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen schützen
 Pflege von Bach und Seeufer Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen schützen Ihre Mitarbeit ist wichtig Sorgfältige Pflege schützt vor Hochwasser Das Bachnetz der Gemeinde Uttwil erstreckt sich über zirka
Pflege von Bach und Seeufer Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen schützen Ihre Mitarbeit ist wichtig Sorgfältige Pflege schützt vor Hochwasser Das Bachnetz der Gemeinde Uttwil erstreckt sich über zirka
6. ALLGEMEINE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ELEKTROMECHANISCHE EINRICHTUNGEN (ATS)
 und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Tiefbauamt Bau- Ausbau und Unterhalt 6. ALLGEMEINE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ELEKTROMECHANISCHE EINRICHTUNGEN (ATS) 6.4 ÖELABSCHEIDER UND RÜCKHALTEBECKEN
und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Tiefbauamt Bau- Ausbau und Unterhalt 6. ALLGEMEINE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR ELEKTROMECHANISCHE EINRICHTUNGEN (ATS) 6.4 ÖELABSCHEIDER UND RÜCKHALTEBECKEN
Schulung Gefahrenkarten Thurgau
 Schulung Gefahrenkarten Thurgau Modul 2: Objektschutz Referenten: Thomas Egli / Pierre Vanomsen / Daniel Sturzenegger Mai 2014 Inhalt Inhalt 1. Einführung 2. Was ist Objektschutz und was gibt es für Strategien
Schulung Gefahrenkarten Thurgau Modul 2: Objektschutz Referenten: Thomas Egli / Pierre Vanomsen / Daniel Sturzenegger Mai 2014 Inhalt Inhalt 1. Einführung 2. Was ist Objektschutz und was gibt es für Strategien
Georisiken in der Schweiz Strategie und Management
 3.8. Dr. Peter Heitzmann (Bundesamt für Wasser und Geologie, CH) Georisiken in der Schweiz Strategie und Management - 67 - 1. Einleitung Am 14. Oktober 2000 riss eine Hangmure drei Elemente der Steinschlagschutzmauer
3.8. Dr. Peter Heitzmann (Bundesamt für Wasser und Geologie, CH) Georisiken in der Schweiz Strategie und Management - 67 - 1. Einleitung Am 14. Oktober 2000 riss eine Hangmure drei Elemente der Steinschlagschutzmauer
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung
 84.3. Gesetz vom 6. November 965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung Der Grosse Rat des Kantons Freiburg gestützt auf das Bundesgesetz vom 9. März 965 über Ergänzungsleistungen
84.3. Gesetz vom 6. November 965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung Der Grosse Rat des Kantons Freiburg gestützt auf das Bundesgesetz vom 9. März 965 über Ergänzungsleistungen
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE
 6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
6. LEBENS- UND WIRTSCHAFTS- RÄUME DER ERDE. Ein Planet für über 6 Milliarden Wie viele Menschen leben auf der Erde und wo leben sie? Es gibt bereits über 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Mehr als die
Sommer Klimabulletin Sommer MeteoSchweiz. Warmer Sommer. Von nass bis trocken. 09. September 2016
 Sommer 2016 MeteoSchweiz Klimabulletin Sommer 2016 09. September 2016 Die Sommertemperatur 2016 lag im Mittel über die ganze Schweiz 0.7 Grad über der Norm 1981 2010. Die landesweite Niederschlagsmenge
Sommer 2016 MeteoSchweiz Klimabulletin Sommer 2016 09. September 2016 Die Sommertemperatur 2016 lag im Mittel über die ganze Schweiz 0.7 Grad über der Norm 1981 2010. Die landesweite Niederschlagsmenge
Retentionskataster. Flussgebiet Orb mit Haselbach
 Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Aufbau der Erde und Plattentektonik Vulkane. Erdbeben und Tsunamis Erdrutsche Halbe Probe
 23.11. Aufbau der Erde und Plattentektonik 30.11. Vulkane 7.12. Erdbeben und Tsunamis 14.12. Erdrutsche 21.12. Halbe Probe Erdbeben Wo Gesteinsblöcke sich in unterschiedlichen Richtungen bewegen baut
23.11. Aufbau der Erde und Plattentektonik 30.11. Vulkane 7.12. Erdbeben und Tsunamis 14.12. Erdrutsche 21.12. Halbe Probe Erdbeben Wo Gesteinsblöcke sich in unterschiedlichen Richtungen bewegen baut
Kristallhöhle Kobelwald
 Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Kristallhöhle Kobelwald Entdeckt im Jahre 1682. 1702 von Johann Jakob Scheuchzer erstmals in der Literatur erwähnt. Gesamtlänge der Höhle beträgt 665 m, davon sind 128 Meter ausgebaut und touristisch zugänglich
Dokumentation zum Ort:
 Dokumentation zum Ort: Oberer Schönenberg Kanton: Aargau Gemeinde: Bergdietikon Vergleich von Historischen Karte 1840: Michaeliskarte 1860: Dufour-Karte Oberer Schönenberg liegt 671 Meter über Meer. Es
Dokumentation zum Ort: Oberer Schönenberg Kanton: Aargau Gemeinde: Bergdietikon Vergleich von Historischen Karte 1840: Michaeliskarte 1860: Dufour-Karte Oberer Schönenberg liegt 671 Meter über Meer. Es
Schutzziele bei gravitativen Naturgefahren
 Kanton Bern Arbeitsgruppe Naturgefahren Schutzziele bei gravitativen Naturgefahren 8. September 2010 1. Idee und Adressaten 1.1. Erläuterung der Risikostrategie des Kantons Bern vom 2005 In der Risikostrategie
Kanton Bern Arbeitsgruppe Naturgefahren Schutzziele bei gravitativen Naturgefahren 8. September 2010 1. Idee und Adressaten 1.1. Erläuterung der Risikostrategie des Kantons Bern vom 2005 In der Risikostrategie
Rechtsetzungslehre. Prof. Dr. Felix Uhlmann. Universität Zürich HS Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre
 Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Universität Zürich Redaktion und Überprüfung 8 Impuls Konzept Kernteam Verwaltung Öffentlichkeit Konkretisierung Rückmeldungen Rückmeldungen Redaktion Überprüfung
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Universität Zürich Redaktion und Überprüfung 8 Impuls Konzept Kernteam Verwaltung Öffentlichkeit Konkretisierung Rückmeldungen Rückmeldungen Redaktion Überprüfung
Rückblick Orientierungsversammlung betr. Nördlistrasse
 Rückblick Orientierungsversammlung betr. Nördlistrasse Selbstkritisch hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung Rückschau zur Orientierungsversammlung zum Abstimmungsthema Kredit für die Sanierung
Rückblick Orientierungsversammlung betr. Nördlistrasse Selbstkritisch hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung Rückschau zur Orientierungsversammlung zum Abstimmungsthema Kredit für die Sanierung
NATURWALDRESERVAT DAMM
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
