Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22 (2010/2011) 3-18
|
|
|
- Erich Waltz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 22 (2010/2011) 3-18 Zur Verbreitung der Gestreiften und der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata und C. boltonii) im Kreis Höxter (Insecta, Odonata, Cordulegastridae) von Ralf LIEBELT, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH 1 Einleitung Die Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) und die Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) gehören im Kreis Höxter zu den seltenen Großlibellen-Arten. Beide Arten sind recht einfach von den übrigen Großlibellen- Arten zu unterscheiden: Die Imagines sind relativ groß, schwarz-gelb gezeichnet und haben grüne Augen. Der für die Gattung verwendete deutsche Name Quelljungfer ist nicht eindeutig, da in der Regel nur die Gestreifte Quelljungfer im Bereich von Quellen lebt, während die Zweigestreifte Quelljungfer Bäche und kleinere Flüsse besiedelt. Der aktuelle Kenntnisstand zur Verbreitung beider Arten im Kreis Höxter und angrenzenden Regionen ergibt nur wenige Fundpunkte (vgl. Abb. 11 und 12, AK LIBELLEN NRW in Vorb.). In der Roten Liste von NRW (LANUV 2011) wird Cordulegaster bidentata sowohl landesweit als auch für das nordrhein-westfälische Bergland als stark gefährdet (RL 2) eingestuft. Cordulegaster boltonii ist demnach sowohl landesweit als auch im Bergland gefährdet (RL 3). 2 Biologie der Arten Unterscheidungsmerkmale der Imagines Das im Gelände auffälligste Merkmal der Imagines (Geschlechtsstadium erwachsene Libelle) ist die gelbe Streifung am Hinterleib: Die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) hat auf der Oberseite des vierten bis siebten Hinterleibssegments je ein großes, gelbes Fleckenpaar (Abb. 1), wogegen die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) an gleicher Stelle je ein großes und ein kleines gelbes Fleckenpaar hat (Abb. 2). Abb. 1: Männchen der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata); Heiligenberg bei Bodenwerder, (Foto: Mathias LOHR) 3
2 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Abb. 2: Männchen der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii); Diemel bei Trendelburg, (Foto: Mathias LOHR) Das für die wissenschaftliche Namensgebung von C. bidentata zugrunde liegende Merkmal ist bei den Männchen an den oberen Hinterleibsanhängen von der Seite zu sehen: C. bidentata hat hier zwei nach unten abstehende Zähne ( bidentata ), während C. boltonii hier nur einen Zahn hat (Abb. 3). Abb. 4: Erstes Hinterleibssegment von C. bidentata seitlich mit gelbem Fleck in der Mitte, unterer Hinterrand schwarz (aus: LEHMANN & NÜSS 1998) Abb. 3: Obere Hinterleibsanhänge der Männchen von der Seite, links C. bidentata, rechts C. boltonii (aus: LEHMANN & NÜSS 1998) Ein weiteres leicht erkennbares Unterscheidungsmerkmal ist das erste Hinterleibssegment von der Seite betrachtet (Abb. 4 und 5). Abb. 5: Erstes Hinterleibssegment von C. boltonii seitlich am unteren Hinterrand gelb (aus: LEHMANN & NÜSS 1998) In LEHMANN & NÜSS (1998) werden die in Tab. 1 zusammengestellten Merkmale aufgeführt. 4
3 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter Tab. 1: Unterscheidungsmerkmale der Imagines von C. bidentata und C. boltonii nach LEHMANN & NÜSS (1998) Cordulegaster bidentata Cordulegaster boltonii Hinterleibssegmente 4-7 Erstes Hinterleibssegment seitlich je ein großes, gelbes Fleckenpaar mit gelbem Fleck in der Mitte, unterer Hinterrand schwarz Hinterhaupts-Dreieck von oben schwarz gelb Weibchen Legescheide Männchen Obere Hinterleibsanhänge von oben betrachtet Obere Hinterleibsanhänge von der Seite betrachtet Untere Hinterleibsanhänge von unten betrachtet ganz schwarz parallel verlaufend mit zwei sichtbaren Zähnen zum Ende schmaler werdend je ein großes und ein kleines gelbes Fleckenpaar am unteren Hinterrand gelb am Grund mit gelbem oder rotbraunem Fleck nach außen weisend mit einem sichtbaren Zahn parallelseitig Unterscheidungsmerkmale der Larven und Exuvien Das letzte Larvenstadium und dessen Exuvien (die bei der Verwandlung von der Larve zum erwachsenen Insekt zurückgelassene Chitinhülle) der Gattung Cordulegaster sind mit Körperlängen von etwa mm vergleichsweise groß. Sie haben im Gesamteindruck einen langgestreckten Körperbau (Abb. 6). Das eigentliche Erkennungsmerkmal der Gattung ist bei der Betrachtung des Kopfes von vorne zu sehen: Der unter den Augen gelegene Teil der sogenannten Fangmaske besitzt grob und unregelmäßig gesägte Lappenränder (Labialpalpen) (Abb. 7). Abb. 6: Larve der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) mit parallel verlaufenden Flügelscheiden (Pfeil; Foto: Mathias LOHR) Abb. 7: Exuvie der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata), Kopf mit grob und unregelmäßig gezähnten Lappen (Labialpalpen) der Fangmaske (Pfeil; Foto: Mathias LOHR) Die Larven beider Quelljungfer-Arten unterscheiden sich vor allem durch ein am Hinterleib gelegenes Detail: C. boltonii hat an den achten und neunten Hinterleibssegmenten jeweils Seitendornen, die bei C. bidentata fehlen (Abb. 8). Weiterhin sind bei den Larven von C. boltonii die Flügelscheiden stark gespreizt, bei C. bidentata parallel angeordnet (Abb. 6). Dieses Merkmal ist jedoch nur bei den Larven ausgebildet, da sich die Flügelscheiden beim Schlupf verschieben können und dann bei den Exuvien nicht mehr die ursprüngliche Position und Ausrichtung besitzen. 5
4 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Abb. 8: Hinterleib der Exuvien von Cordulegaster bidentata (Weibchen, links) und Cordulegaster boltonii (Männchen, rechts); C. boltonii besitzt am achten und neunten Hinterleibssegment Dornen (Pfeile), die bei C. bidentata fehlen (Fotos: Mathias LOHR) Biologie Sofern keine Literaturzitate genannt werden, sind alle Angaben zur Biologie den Arbeiten von STERNBERG et al. (2000a) und STERNBERG et al. (2000b) entnommen. Entwicklungszyklus (Larvalzeit) Die im Verborgenen lebenden Larven nehmen von der Gesamtlebensdauer eines Individuums her den deutlich größten Zeitabschnitt ein: Eine Quelljungfer-Larve lebt etwa vier bis sechs Jahre, die daraus schlüpfende Imago dagegen nur maximal sechs bis acht Wochen. Deswegen spielen die auf die Larven einwirkenden Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle im gesamten Lebenszyklus dieser Libellen. Dies gilt in ähnlicher Form auch für die übrigen Libellenarten. Die Körpergestalt der Larven ändert sich im Laufe der Entwicklung. Eine Zuordnung der Larven nach den bekannten Bestimmungs-Schlüsseln für Exuvien und Larven ist zumeist erst in den letzten Larvenstadien möglich, wenn sich nach zahlreichen Häutungen die Merkmale herausgebildet haben, die für das Erkennen der Art entscheidend sind. Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) Die aus den Eiern schlüpfenden Larven leben zunächst in der Nähe des Eiablage-Ortes und graben sich noch nicht im Sediment ein. Dies geschieht erst ab dem zweiten und dritten Larvenstadium, wodurch die Larve sehr gut getarnt ist (vgl. Abb. 9). 6
5 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter Nach DOMBROWSKI (1989) werden die älteren Larven v. a. weiter bachabwärts gefunden, was von der Autorin mit Verdriftung bei Hochwasser erklärt wird. Die Nahrung besteht aus Organismen der Quellbach-Fauna wie Larven von Steinund Eintagsfliegen und Bachflohkrebsen. Ältere Larven fressen auch kleine Larven des Feuersalamanders. Sind die Libellen-Larven noch kleiner, werden sie umgekehrt von größeren Feuersalamander-Larven gefressen. Die Larven der Gestreiften Quelljungfer können wenigstens drei Monate hungern, überstehen auch ein wochenlanges Austrocknen des Gewässers und sind somit gut an die teilweise unregelmäßige Wasserführung von Quellgewässern angepasst. Die Verwandlung von der Larve zum flugfähigen Insekt geschieht bei C. bidentata in der Regel nach fünf bis sechs Jahren (DOMBROWSKI 1989). Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) Wie bei C. bidentata leben auch die C. boltonii- Larven im Bachsediment eingegraben (Abb. 9). Flusskrebsen erbeutet werden. Extreme Umweltbedingungen können auch von C. boltonii- Larven ertragen werden, sie überstehen mehrere Wochen Austrocknung und relativ lange Hungerzeiten (KAMPWERTH 2010). Die Larvalzeit ist mit ca. vier bis fünf Jahren etwas kürzer als die von C. bidentata. Flugzeit der Imagines Phänologische Daten hängen immer auch mit dem Naturraum und dem Witterungsverlauf des jeweiligen Jahres zusammen, so dass sich die Flugzeiten von Region zu Region und Jahr zu Jahr unterscheiden können. Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) Nach LEHMANN & NÜSS (1998) beginnt die Flugzeit Mitte Mai und dauert bis Mitte August (etwa 13 Wochen). Nach LOHR (2010) konnten im Oberweserraum bei Bodenwerder die ersten Exuvien (von insgesamt 26) und Imagines (von insgesamt 57) schon Ende April gefunden werden (Abb. 10). Das Maximum der Exuvienfunde lag danach Mitte Mai (18.05.) und die letzten Exuvien wurden Mitte Juni gesammelt. Der Höhepunkt der Flugzeit lag Ende Juni (Median ), Abb. 9: Im Sediment eingegrabene Larve von C. boltonii (aus PRODON 1976) und die letzten Imagines konnten Ende August beobachtet werden. Alleine nach diesen Daten ist mit etwa 18 Wochen (25.04.bis ) C. boltonii-larven sind ähnlich wie die Larven eine um fünf Wochen längere Gesamtflugzeit als von C. bidentata Nahrungsopportunisten und nach LEHMANN & NÜSS (1998) belegt. werden in den kleinen Larvenstadien ebenfalls Die Lebenserwartung der einzelnen Imagines von den Larven des Feuersalamanders gefressen. In etwas größeren Bächen können auch beträgt etwa acht Wochen, wovon alleine die Reifeflugphase abseits der Gewässer ca. drei größere C. boltonii-larven von Bachforellen oder Wochen andauert (FRÄNZEL 1985). 7
6 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Med Ex = Med Im = Cordulegaster bidentata (n Im = 57, n Ex = 26) Anteil Exuvien [%] Anteil Imagines [%] 0 I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Abb. 10: Flugzeitendiagramm (Phänogramm) der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) im Oberweserraum. Dargestellt ist der Anteil der Exuvien und Imagines für die einzelnen Dekaden (aus: LOHR 2010). n Ex Gesamtzahl der beobachteten Exuvien, n Im Gesamtzahl der beobachteten Imagines; links Datum der ersten Beobachtung, rechts Datum der letzten Beobachtung; Med Ex Median der Exuvienfunde, Med Im Median der Imaginesbeobachtungen. Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) Nach LEHMANN & NÜSS (1998) beginnt die Flugzeit Mitte Mai und dauert bis Mitte September (etwa 18 Wochen). Die Flugzeit von C. boltonii dauert danach also etwa fünf Wochen länger als die von C. bidentata. Nach LOHR (2010) wurden die ersten Exuvien (von insgesamt 10) Anfang Juni gefunden. Die Daten lassen vermuten, dass auch schon davor Exuvien auffindbar gewesen wären, da der Median des Schlüpfverlaufes direkt am Beginn der Datenreihe liegt und nur relativ wenige Exuvien ausgewertet werden konnten. Der Höhepunkt der Flugzeit lag in dieser Untersuchung Mitte August, und die Flugzeit endete Ende August. Da jedoch auch bei den Imagines mit nur sieben Beobachtungen nur wenige Daten vorlagen, ist im Weserraum zumindest jahrweise von einer Flugzeit bis in den September auszugehen. Lebensraumansprüche Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) C. bidentata besiedelt Quellbäche im Übergangsbereich zur oberen Forellenregion (Hypokrenal bis Epirhithral) im Wald oder in Waldnähe. Die Entfernung der Vorkommen zur Quelle dürf- 8
7 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter te nur ausnahmsweise 300 m überschreiten. Der geologische Untergrund besteht meist aus Kalkgesteinen oder Keuper, seltener aus Buntsandstein. Die Larve lebt in (fein)sandigen Randbereichen mit z. T. sehr geringer Strömung, bei stärkerer Strömung in kleinen Kolken oder im strömungsberuhigten Bereich von Stauhindernissen, selten auch an Stellen mit schnellerem Wasserabfluss. In diesen strömungsarmen Bereichen sammelt sich abgestorbene organische Substanz an, die von einer oft artenreichen Kleintier-Fauna besiedelt wird. Diese Tiere sind als potentielle Beute für C. bidentata-larven von hoher Bedeutung. In Quellen und quellnahen Bächen im Laubwald bildet abgestorbenes Laub oft mächtige Detritusauflagen auf der Gewässersohle. In Nadelwäldern führt die viel schwerer zersetzbare Nadelstreu zu einer Verarmung der Kleintier-Lebensgemeinschaft, weshalb C. bidentata hier seltener und in zumeist geringeren Dichten zu finden ist. Höhere Pflanzen fehlen hier meist. Kalksinter- Quellbäche gehören in einigen Regionen zu den bevorzugten Larvalhabitaten der Art. Die Wassertiefe variiert je nach Jahreszeit zwischen 1 und 20 cm, besiedelte Bäche fallen seltener als wenige Wochen im Jahr trocken. Der Säuregrad des Wassers liegt meist im neutralen Bereich. Die Gewässer-Güte von C. bidentata-bächen liegt aufgrund der Lage in Wäldern und somit oft in Bereichen mit geringem anthropogenen Nährstoffeintrag meist in der Güteklasse I. Die Verwandlung zur flugfähigen Libelle findet oft in Ufernähe an Kräutern, Wurzeln oder Erdböschungen in wenigen Dezimetern Höhe statt. In wenigen Fällen wandern die schlupfbereiten Larven größere Strecken (Extremwerte: In vier Meter Höhe an Bäumen oder bis zu 10 Meter vom Bach entfernt). Die frisch geschlüpfte Libelle fliegt zur Nahrungssuche in den ersten Wochen vor der eigentlichen Fortpflanzungsperiode (= Reifeflug) besonders an lichten Stellen des Waldes oder am Waldrand. Die zur Fortpflanzung genutzten Quellbäche oder Quellmoore liegen oft im Wald, z. T. aber auch an Lichtungen, Wegen u. a. Die Gewässer sind meist beschattet. Der umgebende Wald ist in den deutlich überwiegenden Fällen ein Laubwald mit einem geringen Anteil an Unterholz. Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) C. boltonii lebt sowohl in Bächen über Kalkgesteinen als auch in Buntsandsteingebieten. Im Vergleich zu C. bidentata ist C. boltonii nicht auf den Bereich unmittelbar unterhalb der Quelle beschränkt, sondern besiedelt die gesamte Forellenregion (Epirhitral bis Hyporhithral). Die Bäche sind i. d. R. von Grünland umgeben, seltener von (lichten) Wäldern. Die Larve lebt eingegraben in strömungsberuhigten Zonen von Bächen und Gräben, etwa im Bereich von Stauhindernissen, an Gleithängen des Baches oder in Kolken. Vegetation ist meist nicht vorhanden. Der Gewässergrund wird überwiegend durch Feinsedimente gebildet, zu einem geringeren Teil auch durch Kies und Schotter. Bevorzugt halten sich die Larven dort auf, wo sich organisches Material am Gewässergrund konzentriert. Die Wassertiefe variiert überwiegend in einem Bereich von ca cm, häufig führt das Gewässer ganzjährig Wasser, kann aber auch für mehrere Wochen austrocknen. Die Breite der besiedelten Gewässer kann stark variieren, nach STERNBERG et al. (2000b) wurden Werte zwischen 10 und 350 cm festgestellt. Der ph-wert von besiedelten Gewässern liegt meist im neutralen Bereich. Der Nährstoffgehalt von C. boltonii-bächen ist meist hoch, da sie oft an Grünland grenzen und von hier ausgehende erhöhte Nährstoffeinträge zu einer Eutrophierung der Gewässer führen. Die Exuvien werden v. a. in unmittelbarer Nähe des Gewässers am Ufer gefunden, z. B. an vertikalen Strukturen wie Kräutern, Steinen, Wurzeln und Stämmen der Ufergehölze. In der Reifeflugphase halten sich die jungen Imagines z. B. in Grünland, Waldlichtungen oder an Waldwegen auf. Die Fortpflanzungsgewässer sind in den meisten Fällen stark besonnt. Zur Eiablage werden flach auslaufende Ufer oder 9
8 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Sedimentbänke aus feinkörnigem Substrat und geringer Wassertiefe (etwa bis 5 cm) benötigt. 3 Die Quelljungfern in der Region Egge-Weser Material und Methoden Für diese Arbeit wurden alle bekannten Beobachtungsdaten der Gestreiften (Cordulegaster bidentata) und der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) für den Kreis Höxter und die angrenzenden Regionen zusammengestellt. Diese basieren im Wesentlichen auf Erhebungen der drei Autoren zwischen 1990 und Darüberhinaus liegen einige wenige Einzelbeobachtungen von anderen Gewährsleuten (Rolf KIRCH, Johannes MÜTTERLEIN, Toni MÖLLER und Thomas BÜDENBENDER) vor. Außerdem wurden alle zugänglichen Publikationen und Gutachten mit libellenkundlichen Daten für den Kreis Höxter hinsichtlich Angaben zum Vorkommen der beiden Arten ausgewertet. Nachweise von Quelljungfern für den Kreis Höxter bzw. unmittelbar angrenzende Bereiche finden sich lediglich in JÖHREN (1979) und RETZLAFF (1984). Die Darstellung der bislang bekannt gewordenen Funde erfolgt auf der Basis von Messtischblatt- Viertelquadranten, die jeweils 2,5 Minutenfelder breit und 1,5 Minutenfelder hoch sind und deren Größe damit etwa 2,8 x 2,8 km beträgt. Ergebnisse Abb. 11: Bislang bekannte Verbreitung der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) im Kreis Höxter und angrenzenden Gebieten. Dargestellt sind die Funde der Art auf Basis von Messtischblatt-Viertelquadranten. Abb. 12: Bislang bekannte Verbreitung der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) im Kreis Höxter und angrenzenden Gebieten. Dargestellt sind die Funde der Art auf Basis von Messtischblatt-Viertelquadranten. 10
9 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter Verbreitung und Lebensräume der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) Für die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) liegen insgesamt neun Beobachtungen von neun Fundorten im Kreis Höxter vor. Die bislang bekannte Verbreitung der Art (Abb. 11) beschränkt sich auf Quellbereiche an der Ostabdachung von Köter- und Herbstberg im Norden, das westliche Oberwälder Land, die Ostabdachung der Egge im Westen sowie auf die südlichen Ausläufer der Egge im Südwesten. Besiedelt werden Quellbäche und Fließquellen (Rheokrenen) sowie Quellsümpfe (Helokrenen), die zumeist an Grenzschichten zwischen Unterem Keuper und Oberem Muschelkalk (Herbst- und Köterberg), Oberem und Mittlerem Muschelkalk oder Unterem Muschelkalk und Oberem Buntsandstein (östliche Egge) liegen. Die Quellgewässer finden sich zumeist an Lichtungen oder Rändern von Buchenwäldern. Sie weisen dementsprechend eine kleinräumig wechselnde, geringe bis mäßige Beschattung auf. Das Sohlsubstrat ist durch Ablagerungen von abgestorbenem Laub und anderem Pflanzenmaterial (Detritus) sowie bei kalkhaltigem Wasser von Sinter geprägt. Quellsümpfe können vor allem während der Sommermonate oberflächlich austrocknen, wobei sich zwischen und unter den Detritusablagerungen zumeist eine hohe Bodenfeuchte hält, in der die Larven überdauern können. Auch die permanent Wasser führenden Quellbäche weisen bei einer Gewässerbreite von einigen Dezimetern bis etwa 1,5 m meist nur eine Wassertiefe von wenigen Zentimetern auf. Die Fließgeschwindigkeiten können kleinräumig variieren und liegen zwischen 0,01 und 0,2 m/s. Aufgrund der Quellnähe der Gewässer unterliegen die Wassertemperaturen nur geringen Schwankungen und erreichen auch im Hochsommer selten mehr als 12 C (vgl. LOHR 2010). Im Weserbergland ist die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) die einzige Libellenart, die Quellgewässer zur Fortpflanzung nutzt. Bislang gibt es keine Nachweise von Vorkommen, in denen sie zusammen mit anderen Libellenarten dieselben Fortpflanzungsgewässer bewohnt. Regelmäßig wurden in den von der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) besiedelten Gewässern Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) angetroffen. STEINBORN (1982), der als erster eine Zusammenstellung der im Kreis Höxter vorkommenden Libellen gibt, führt weder die Gestreifte (C. bidentata) noch die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) auf. Demgegenüber sind Funde beider Arten aus den 1980er Jahren bereits für das östlich sich anschließende südniedersächsische und nordhessische Bergland bekannt (HAAG & RICHTER 1984, ALTMÜLLER et al. 1989, PIX & BACHMANN 1989). RETZLAFF (1984) beschreibt den Fund einer frisch geschlüpften Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) im Grenzgebiet von NRW und Niedersachsen. Die Angabe zwischen Polle und dem Ostabhang des Köterberges lässt offen, ob der Fundort im Kreis Höxter oder im Landkreis Holzminden liegt. Nachweise im Kreis Höxter Der erste sichere Nachweis der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) für den Kreis Höxter gelang dann erst 1991 durch MÜTTERLEIN (mdl.), der im Juni 1991 an einer Straße zwischen Lütmarsen und Brenkhausen bei Höxter ein totes Individuum fand. Ein Bezug zu einem in der Nähe gelegenen Fortpflanzungsgewässer konnte nicht hergestellt werden. Am wurde von KIRCH (mdl.) ein weiteres totes Exemplar in einer Feuchtwiese nahe der Straße zwischen Dringenberg und Neuenheerse gefunden. Hier waren nach Mitteilung des Finders potentiell geeignete Fortpflanzungsgewässer in erreichbarer Nähe. Gezielte Begehungen geeignet erscheinender Fortpflanzungsgewässer im Bereich von Sinterquellen bei Beverungen ab 2000 erbrachten bislang keine Funde. Ab dem Jahr 2005 gelangen den Verfassern durch gezielte Begehungen erstmals Nachweise in Fortpflanzungshabitaten, die im Folgenden beschrieben werden. 11
10 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Corveyer Forst (Ostabdachung des Herbstberges, Oberwälder Land) Am konnte einer der Autoren (LIE- BELT) ein Männchen beim Revierflug über dem potentiellen Fortpflanzungsgewässer beobachten. Der etwa cm breite Bach war stark mit Kräutern zugewachsen und floss durch ein lichtes Buchenaltholz (Abb. 13). Das Fluggebiet lag etwa 100 m von der Quelle entfernt. Abb. 14: Flughabitat von Cordulegaster bidentata an einem Bach am im Hinnenburger Forst (Foto: Ralf LIEBELT) Bad Driburg und Willebadessen (Ostabdachung der Egge) Abb. 13: Flughabitat von Cordulegaster bidentata am im Corveyer Forst. Der Bach ist durch krautige Vegetation stark zugewachsen. (Foto: Ralf LIEBELT) Hinnenburger Forst (Oberwälder Land) Bei der Suche im Hinnenburger Forst fand einer der Autoren (LIEBELT) am einen Bach, über dem gleichzeitig zwei Männchen flogen (Abb. 14). Der Bach war in Teilbereichen ca cm breit und etwa 10 cm tief. Er weitete sich in manchen Bereichen zu einer deutlich breiteren Fläche auf (ca. 200 cm), wo an einigen Stellen mit Moosen bewachsener Kalksinter zu finden waren. Die kleinräumig umgebenden, feuchten bis nassen Waldbereiche wurden von einem jüngeren Laubwald-Stangenholz gebildet. Die Quelle befand sich etwa 100 m vom Fundort entfernt. Etwa einen Kilometer entfernt konnte am gleichen Tag auf einer kleinen Lichtung eines alten Mischwaldes ein weiteres Männchen beobachtet werden. Der Quellbach lag in diesem Fall weiter hangabwärts. Am gelang LOHR in einem Quellsumpf zwischen Iburg und Gerkenberg etwa einen Kilometer südwestlich von Bad Driburg die Beobachtung eines Männchens, das über einem mit Moos bewachsenen Quellbereich flog. Der Bereich war von Buchen und Eschen mäßig beschattet und wies einzelne besonnte Stellen auf. An einem kleinen Quellbach direkt unterhalb einer von Kalksinter geprägten Quelle am Nordhang des Griesenbergs etwa 1,5 km östlich Willebadessen wurde am ein patrouillierendes Männchen beobachtet (LOHR). Der nur etwa 0,5 bis 1 m breite Bach war mäßig bis stark durch einen direkt angrenzenden Buchenwald beschattet. Wäschebachtal (Südliche Egge) Im Juli 2005 wurde im Rahmen der Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes für das Naturschutzgebiet Bleikuhlen bei Blankenrode und Wäschebachtal der Wäschebach hinsichtlich seiner Limnofauna untersucht. Ein Mitarbeiter der Landschaftsstation (T. MÖLLER) stieß dabei beim Aussieben der Substrates eines der Quellbäche auf mehrere Larven der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata). Einen Tag später wurde der Fundpunkt von einem der Autoren (BEINLICH) überprüft und der Nachweis durch eine exakte Nachbestimmung bestätigt. Der Quellbach weist an der Fundstelle eine Brei- 12
11 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter te von ca cm und eine Tiefe von ca. 10 cm auf. Das in einem Kerbtal verlaufende Bachbett ist durch gröberes, von Moosen bewachsenes Geröll strukturiert, die Quelle liegt ca. 30 m oberhalb der Fundstelle. Die angrenzenden Waldbestände weisen neben Buchen und Eschen sowie bachnah einigen Erlen einen höheren Anteil an Fichten auf. Imagines konnten nicht beobachtet werden. Pölinxer Wiesen (Südliche Egge) Im Rahmen von faunistischen Bestandserfassungen konnte T. BÜDENBENDER im Juli 2000 ein Männchen der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) in einem von zahlreichen Kleingewässern und Nasswiesen gut strukturiertem Bachtal beobachten. Das Männchen patrouillierte im Bereich des von Erlen bestandenen Bachoberlaufes des Pölinxer Baches entlang. Es handelte sich um eine einmalige Beobachtung. Eine spätere Nachsuche durch einen der Autoren (BEIN- LICH) nach Larven im Bach im Bereich der Fundstelle und im oberhalb gelegenen Quellbach ergaben aber keine Nachweise. Es ist somit fraglich, ob der Pölinxer Bach (Abb. 15) zur Fortpflanzung genutzt wird. Da der Wäschebach in räumlicher Nähe liegt, ist es auch durchaus möglich, dass das Männchen von dort aus zugeflogen ist. Abb. 15: Flughabitat von Cordulegaster bidentata im Bereich der Pölinxer Wiesen (Foto: F. GRAWE). Benachbarte Funde außerhalb des Kreises Im nördlich angrenzenden Kreis Lippe sind mehrere Fundorte der Art aus dem Schwalenberger Wald bekannt (AK LIBELLEN NRW, schriftl.). Im sich östlich an den Kreis Höxter anschließenden südniedersächsischen Leinebergland ist sie nicht selten. Sie kommt hier ebenfalls in Quellhorizonten tonhaltiger Schichten z. B. des Oberen Buntsandsteins vor, so im Weserengtal bei Bodenwerder (eigene Beobachtung), im Solling- Vorland und im Ith-Hils-Bergland (BÖKE 2008). Auch im südöstlich angrenzenden Westhessischen Hügel- und Beckenland gibt es mehrere Nachweise aus dem östlichen und südlichen Reinhardswald (HAAG & RICHTER 1984, PIX & BACHMANN 1989) und dem Bramwald (DOMB- ROWSKI 1989, ESPLÖR 1992). Verbreitung und Lebensräume der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) Von der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) gibt es bislang erst drei Beobachtungen an drei unterschiedlichen Fundorten im Kreis Höxter (Abb. 12). Zwei dieser Funde stammen von JÖHREN (1979), der in der Grube bei Ovenhausen und bei Höxter im Rahmen von Untersuchungen zum Makrozoobenthos jeweils Quelljungferlarven nachwies und sie als Cordulegaster spec. bestimmte. Da beide Larvenfunde außerhalb von Quellgewässern liegen, wurden diese Funde der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) zugeordnet. Aufgrund der Habitatansprüche beziehen sich die Larvenfunde im Unterlauf der Grube nahe der Mündung in die Weser mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii). Beim Larvenfund bei Ovenhausen ist hingegen nicht auszuschließen, dass es sich auch um die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) gehandelt haben könnte, die aus einem angrenzenden Quellbereich eingespült wurde. Ein gesicherter Nachweis der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) liegt für den Kreis Höxter bislang lediglich aus dem Jahr 2005 durch die Beobachtung eines Einzeltieres am kurz zuvor renaturierten Unterlauf der Schelpe bei Höxter vor. Da es sich um einen zum Zeitpunkt der Beobachtung voll besonnten, nicht von Gehölzen bestandenen Abschnitt handelt, der zudem zeitweise austrocknet und im Hochsommer 13
12 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH kaum noch Strömung aufweist, dürfte er als Fortpflanzungsgewässer zumindest aktuell keine Bedeutung haben. Die drei Funde liegen im östlichen Teil des Oberwälder Landes sowie im Holzmindener Wesertal. Lediglich die Larvenfunde in der Grube bei Höxter und Ovenhausen belegen die Bodenständigkeit der Art. Die Funde konnten jedoch trotz einiger Begehungen des Gewässers zur Flugzeit der Art seit den Beobachtungen von JÖHREN (1979) im Jahr 1978 nicht bestätigt werden. In den letzten fünf Jahren wurden zahlreiche Untersuchungen zur Libellenbesiedlung auch an für die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) geeignet erscheinenden Fließgewässern im Kreis Höxter durchgeführt. Dies betrifft u. a. den Ober-, Mittel- und Unterlauf der Nethe, die Aa, den Oberlauf der Emmer sowie den Heubach zwischen Vinsebeck und Steinheim. Dabei konnte die Art bislang nicht festgestellt werden. An einem von Hybridpappeln bestandenen Bördebach inmitten intensiv genutzter Äcker wurde im Juli 2010 bei Großeneder in der Warburger Börde eine Großlibelle kurzzeitig beobachtet, bei der es sich um eine Quelljungfer gehandelt haben dürfte. Da das Tier jedoch nicht gefangen werden konnte, wurde dieser Fund in den Verbreitungskarten nicht berücksichtigt. kommt die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) oft zusammen mit der Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) vor. In der Unteren Diemel besteht an einem hessischen Abschnitt ein Vorkommen der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii), wo die Bodenständigkeit der Art durch regelmäßige Exuvienfunde und Beobachtungen von Eiablagen seit mehr als 10 Jahren belegt ist (vgl. LOHR 2010). Hier besiedelt die Art von Ufergehölzen beschattete Abschnitte, die sich oft kleinräumig mit besonnten Bereichen abwechseln. Die Art nutzt flach überströmte Bereiche in Ufernähe mit lehmig bis feinsandigen Substraten zur Eiablage und als Larvalhabitat. Dabei stehen die Weibchen im Flug über der Eiablagestelle und stechen mit senkrechten Abwärtsbewegungen die Eier in das Sohlsubstrat des Gewässers (Abb. 16). Die Zweigestreifte Quelljungfer (C. botonii) besiedelt im Weserbergland Bäche und kleinere bis mittelgroße Flüsse. Die wenigen Beobachtungen der Art im Kreis Höxter lassen keine detaillierten Lebensraumbeschreibungen zu. Die folgenden Angaben zu Fortpflanzungshabitaten der Art stammen daher aus der unmittelbaren Umgebung, wo in mehreren Naturräumen zahlreiche Vorkommen existieren. Im südöstlich an den Kreis Höxter angrenzenden Reinhardswald findet sich die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) in mäßig bis stark beschatteten, meist unter 2 m breiten Bächen. Die Fließgeschwindigkeiten können stark variieren. Sie liegen an Stromschnellen bei 0,7 m/s, in strömungsberuhigten Kolken hingegen betragen sie selten mehr als 0,05 m/s. In diesen Bächen Abb. 16: Weibchen der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii immaculifrons) bei der Eiablage; Largue, Dépt. Vaucluse, Süd- Frankreich, (Foto: Mathias LOHR) Die zur Eiablage genutzten Bereiche sind meist strömungsberuhigt und die Fließgeschwindigkei- 14
13 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter ten liegen in Ufernähe nur bei 0,05 bis 0,15 m/s, während sie im Stromstrich bis zu 0,7 m/s auch bei Niedrigwasser erreichen können. Die Diemel ist hier durchschnittlich etwa 12 m breit. Neben der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) finden sich an den untersuchten Abschnitte der Diemel mit u. a. der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) sowie der Gebänderten und der Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx splendens und C. virgo) weitere für Fließgewässer typische Libellenarten. Im östlich und südlich an den Kreis Höxter angrenzenden Leinebergland und Westhessischen Hügel- und Beckenland findet sich die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) regelmäßig in Bächen des Sollings (ALTMÜLLER et al. 1989, BÖKE 2008), des Reinhardswaldes (HAAG & RICHTER 1984, PIX & BACHMANN 1989, TAMM 2009, PIX 2009) und des Bramwaldes (ESPLÖR 1992, PIX 2009). Diskussion Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) Die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) ist im Kreis Höxter vermutlich wesentlich weiter verbreitet, als noch bis vor kurzem angenommen. Die Funde der letzten sechs Jahre verdeutlichen dies. Trotz der bisher wenigen Nachweise dürfte die tatsächliche Fundortdichte deutlich höher sein. Nach der Art sollte daher zukünftig gezielt gesucht werden. Nachweise der Imagines sind infolge der geringen Dichte mit einem höheren Erfassungsaufwand verbunden. Die Suche nach Larven in geeignet erscheinenden Quellgewässern insbesondere kleinere Kolke mit strömungsberuhigten Bereichen und Detritusauflagen hat sich hingegen als erfolgversprechende Methode erwiesen (vgl. z. B. PIX 2009), die zudem fast ganzjährig durchgeführt werden kann. Zwar geben einige Autoren an, dass die Larven im Winter schwieriger nachzuweisen seien (z. B. STERNBERG et al. 2000a), Larvenfunde im Februar in Mittelfranken belegen jedoch, dass die Larven auch im Winter aufzufinden sind (eig. Beob.). Dabei hat sich das vorsichtige Durchsieben der Detritusauflagen in den strömungsberuhigten Kolken mit handelsüblichen Küchensieben als Nachweismethode bewährt. Um die Kenntnisse über die Verbreitung der Art im Kreis Höxter zu verbessern, sollte eine systematische Erfassung entsprechender Quellgewässer durch Larvensuche durchgeführt werden. An der Mitarbeit Interessierte wenden sich bitte an die Autoren. Im Raum Beverungen gibt es einige gut als Fortpflanzungsgewässer geeignet erscheinende Quellgewässer mit Sinterterrassen. Warum die Art hier bislang nicht nachgewiesen werden konnte, ist unklar. Die nächsten bekannten Vorkommen sind mindestens 20 km entfernt. Trotzdem dürfte die Besiedlung über solche Entfernungen für die mobile Art kein Problem darstellen. Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) Während für die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) mehrere Vorkommen im Kreis Höxter bekannt sind, gibt es für die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) bislang kaum Nachweise. In einigen Naturräumen des Weserberglandes ist die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) nicht selten. So fand PIX (2009) die Art im Reinhardswald an allen perennierenden Bächen mit einer Mindestlänge von 500 m. Auch aus den benachbarten Naturräumen des Solling und des Hochsauerlandes (AK LIBELLEN NRW schriftl.) gibt es zahlreiche Funde. Für den Kreis Höxter hingegen liegen trotz Begehungen an Gewässern mit geeignet erscheinenden Habitatstrukturen lediglich drei Funde vor, von denen zwei mehr als 30 Jahre zurückliegen. Die Art könnte bislang an einigen Gewässern des Kreises übersehen worden sein. Trotzdem erscheinen größere Vorkommen der auffälligen Art bei der Beobachterdichte momentan unwahrscheinlich. Eventuell war die Art bis in die 1970er Jahre hinein im Kreis Höxter weiter verbreitet und ging infolge von Gewässerbelastungen, insbesondere durch die Einleitung ungeklärter Abwässer, vielerorts stark zurück oder starb aus. Für die Blauflügel- 15
14 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH Prachtlibelle (Calopteryx virgo) konnte RETZLAFF (1984) trotz intensiver Suche zwischen 1969 und 1975 lediglich wenige Einzelnachweise im gesamten Weserbergland erbringen. Die Art war offensichtlich in den 1970er und 1980er Jahren auf wenige kleine Reliktpopulationen zurückgegangen. In den letzten 15 Jahren war eine starke Wiederausbreitung an vielen Fließgewässern des Kreises Höxter zu beobachten. Dies dürfte vor allem auf die verringerte organische Belastung vieler Bäche und kleinerer Flüsse zurückzuführen sein. Eventuell konnte eine entsprechende Entwicklung bei der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) noch nicht stattfinden, da die Art bei der geringen Siedlungsdichte längere Zeit für eine Wiederbesiedlung benötigt. Auch auf Vorkommen der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) sollte zukünftig verstärkt geachtet und an entsprechenden Gewässern gezielt gesucht werden. Eine Besonderheit stellen die Vorkommen in der Unteren Diemel dar, weil die Art hier bis zu 12 m breite und 1,6 m tiefe Abschnitte besiedelt (Abb. 17). Bislang sind Vorkommen lediglich für Bäche und kleinere Flüsse bis zu einer Breite von 4 m, in Ausnahmefällen bis 8 m bekannt (BUCHWALD 1988, FALTIN 1998). Abb. 17: Abschnitt der Unteren Diemel im Landkreis Kassel (Hessen). Am linken Ufer wurde die Eiablage der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) beobachtet. Zahlreiche Exuvienfunde belegen außerdem die Bodenständigkeit der Art an diesem Gewässer; (Foto: Mathias LOHR) Gefährdung und Schutzmaßnahmen In der aktuell überarbeiteten Roten Liste (LANUV 2011) werden sowohl landesweit als auch im nordrhein-westfälischen Bergland die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) als stark gefährdet (RL 2) und die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) als gefährdet (RL 3) eingestuft. Während die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) aufgrund der wenigen Einzelfunde momentan im Kreis Höxter sicherlich wesentlich stärker bedroht ist als dies die Rote Liste widerspiegelt, dürfte die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) noch mehrere vermutlich gut besetzte Vorkommen im Kreisgebiet besitzen. Die Einstufung als stark gefährdet wäre bei der Entdeckung neuer Vorkommen dann zumindest für das Bergland ggf. zu modifizieren. Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) Die Gefährdung der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) geht vor allem von baulichen Veränderungen, forstlichen Maßnahmen in Quellbereichen sowie von einer landwirtschaftlichen Übernutzung im Einzugsgebiet der Quellen aus. Hierdurch kommt es zu einem Nährstoff-, Feinsediment- und Schadstoffeintrag in die Gewässer und somit zu einer Beeinträchtigung der Fortpflanzungshabitate der Art. Auch bauliche Maßnahmen an Quellen wie das Einfassen oder Verrohren sowie Holzablagerungen in und an den Gewässern gefährden die Art. Da saure Gewässer mit einem ph-wert unter 5 gemieden werden (PIX 2009), beeinträchtigen Fichtenbestände in der Umgebung der Quellen die Vorkommen. Veränderungen im Wasserhaushalt z. B. durch Entnahme von Grundwasser stellen außerdem eine potentielle Gefahr dar, auch wenn bislang kein Fall einer solchen Gefährdung aus dem Kreis Höxter bekannt ist. Da die Gestreifte Quelljungfer (C. bidentata) in ihrer Verbreitung weitgehend auf Mitteleuropa beschränkt ist, kommt den Vorkommen in den nördlichen Mittelgebirgen an der Nordgrenze ihrer Verbreitung eine besondere Bedeutung für ihren Erhalt zu. Aufgrund der daraus resultierenden Verantwortung auch von Nordrhein-Westfalen für die Art, sollten die Vorkommen unbedingt nachhaltig geschützt werden. 16
15 Gestreifte & Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata & C. boltonii) im Kreis Höxter Zum Schutz der Gestreiften Quelljungfer (C. bidentata) sind insbesondere folgende Maßnahmen gut geeignet: Rücknahme von Quellverbauungen, keine Kahlschläge an und im weiteren Umfeld von Quellen, im unmittelbaren Bereich von Quellen möglichst keine forstwirtschaftliche Nutzung; wenn forstliche Maßnahmen unbedingt notwendig sind, lediglich Einzelstammentnahme und vorsichtige Rückemaßnahmen, Reduzierung von Nährstoff- und Feinsedimenteinträgen in die Quellgewässer durch Ausweisung von Pufferzonen, Umwandlung von Nadelforsten in standortgerechte Bestände mit autochthonem Pflanzgut im Bereich von Quellen, keine Veränderungen des Wasserhaushaltes durch Grundwasserentnahme im Bereich von Vorkommen der Art. Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) Die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) gehört momentan zu den seltensten Libellen des Kreises Höxter. Dies dürfte vor allem auf die Gewässerbelastungen der vergangenen Jahrzehnte zurückzuführen sein. Eine Wiederbesiedlung ehemals besiedelter Bachläufe sollte durch Renaturierungsmaßnahmen gefördert werden (s. u.). Herauszuheben ist die Bedeutung der in Hessen liegenden unteren Diemel als Libellenlebensraum. Hier kommt mit der Grünen Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) eine europaweit durch die FFH-Richtlinie geschützte Art vor. Daneben existieren bedeutende Vorkommen der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii). Für diesen Abschnitt der Diemel ist eine Ausweisung als FFH-Gebiet zu fordern, zumal die Europäische Kommission für die Art ein Meldedefizit im Bundesland Hessen festgestellt hat (EUROPEAN COMMISSION 2002). Der Bau weiterer Wehre muss unterbleiben. Unterhaltungsmaßnahmen müssen auf das absolut notwendige Maß beschränkt bleiben. Einträge aus landwirtschaftlicher Nutzung sollten durch Anlage von Uferrandstreifen vermindert werden. Durch Maßnahmen zur Förderung der Auen- und insbesondere der Geschiebedynamik könnten dabei neben der Grünen Keiljungfer (O. cecilia) auch die Zweigestreifte Quelljungfer (C. boltonii) gefördert werden. Zum Schutz der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden: Erhalt naturnaher Bachläufe, Förderung der Geschiebedynamik und der Renaturierung an Fließgewässern, z. B. durch Rückbau von Uferbefestigungen, Sohlverbauungen und Querbauwerken, Reduzierung von Nährstoff- und vor allem von Feinsedimenteinträgen, die die Larvalhabitate der Zweigestreiften Quelljungfer (C. boltonii) stark beeinträchtigen, durch Anlage von Uferrandstreifen oder Nutzungsextensivierung, Erhalt von Grünland und Brachen in der Umgebung von naturnahen Bachläufen als Nahrungshabitat v. a. der jungen Imagines in der Reifeflugphase. Danksagung Norbert Menke vom Arbeitskreis Libellen NRW, Rolf Kirch, Johannes Mütterlein, Toni Möller und Thomas Büdenbender danken wir für die Übermittlung von Cordulegaster-Funden im Kreis Höxter und angrenzenden Bereichen der Kreise Lippe und Paderborn. Literatur: AK LIBELLEN NRW (in Vorb.): Atlas der Libellen Nordrhein-Westfalens. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde. ALTMÜLLER, R., BREUER, M. & M. RASPER (1989): Zur Verbreitung und Situation der Fließgewässerlibellen in Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 9: BÖKE, R. (2008): Die Libellen (Odonata) im Landkreis Holzminden (Niedersachsen). Braunschweiger Naturkundliche Schriften 8: BUCHWALD, R. (1988): Die Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster bidentatus (Odonata) in Südwestdeutschland. Carolinea 46:
16 LIEBELT, Ralf, Mathias LOHR & Burkhard BEINLICH DOMBROWSKI, A. (1989): Ökologische Untersuchungen an Cordulegaster bidentatus Selys, Dipl.-arb. am Zoologischen Institut der Georg-August-Universität zu Göttingen. ESPLÖR, D. (1992): Ökologische Zustandsbeschreibung des Niemetales (Lkr. Göttingen) unter landespflegerischen Gesichtspunkten. Dipl.-arb. an der Universität-GH Paderborn, Abt. Höxter. EUROPEAN COMMISSION (2002): Continental Region. Conclusions on representativity within psci of habitat types and species. Doc. Cont./C/rev. 3, European Commission, European Environment Agency, Brüssel. FALTIN, I. (1998): Zweigestreifte Quelljungfer Cordulegaster boltonii (Donovan 1807). In: KUHN, K. & K. BURBACH (Bearb.): Libellen in Bayern. Stuttgart: Eugen Ulmer: FRÄNZEL, U. (1985): Öko-ethologische Untersuchungen an Cordulegaster bidentatus Selys, 1843 (Insecta: Odonata). Dipl.-Arb., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn. HAAG, H. & E. RICHTER (1984): Libellen im Kasseler Raum. Naturschutz in Nordhessen 7: JÖHREN, M. (1979): Die Grube. Zum Tierleben eines Baches im Oberen Weserbergland. Jahrbuch Kreis Höxter 1980: KAMPWERTH, U. (2010): Die Letzten werde die Ersten sein : Koexistenz von Cordulegaster- Larven und Köcherfliegen (Trichoptera: Limnephilidae) in temporären Fließgewässern. mercuriale 10: LANUV (LANDESANSTALT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN- WESTFALEN; 2011): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein- Westfalen. 4. Fassung abgerufen am LEHMANN, A. & J. H. NÜSS (1998): Libellen. Hamburg: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung. LOHR, M. (2010): Libellen zweier europäischer Flusslandschaften. Besiedlungsdynamik und Habitatnutzung von Libellengemeinschaften am Unteren Allier (Frankreich) und an der Oberweser (Deutschland). Arbeiten aus dem Institut für Landschaftsökologie Münster 17: PIX, A. (2009): Die Cordulegastriden im Reinhardswald. Libellen in Hessen 2: PIX, A. & P. BACHMANN (1989): Libellen im Reinhardswald (Nordhessen). Göttinger Naturkundliche Schriften 1: PRODON, R. (1976): Le substrat, facteur écologique et éthologique de la vie aquatique: Observations et expériences sur les larves de Micropterna testacea et Cordulegaster annulatus. Dipl.-arb., Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon. RETZLAFF, H. (1984): Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe 2. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischlippischer Entomologen 30: STEINBORN, G. (1982): Die Libellen im Kreis Höxter. In: Jahrbuch Kreis Höxter 1983: STERNBERG, K., BUCHWALD, R. & U. STEPHAN (2000a): Cordulegaster bidentata (Sélys, 1843). Gestreifte Quelljungfer. In: STERN- BERG, K. & R. BUCHWALD (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Bd. 2. Stuttgart: Eugen Ulmer: STERNBERG, K., BUCHWALD, R. & U. STEPHAN (2000b): Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807). Zweigestreifte Quelljungfer. In: STERNBERG, K. & R. BUCHWALD (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Bd. 2. Stuttgart, Eugen Ulmer: TAMM, J. (2009): Beobachtungen und Erfahrungen beim Kartieren der Quelljungfern Cordulegaster boltonii und C. bidentata in Hessen. Libellen in Hessen 2: Anschriften der Verfasser: Dipl.-Ing. Ralf LIEBELT Büro für Ökologie u. Landschaftsplanung Altes Forstamt Boffzen 05271/ ralf.liebelt@freenet.de Dr. Mathias LOHR Hochschule Ostwestfalen-Lippe An der Wilhelmshöhe Höxter mathias.lohr@hs-owl.de Dr. Burkhard BEINLICH Landschaftsstation im Kreis Höxter Zur Specke Borgentreich beinlich@landschaftsstation.de 18
Die Gestreifte Quelljungfer in der
 Die Gestreifte Quelljungfer in der Hersbrucker Alb Lisa Jeworutzki Dr. Kai Frobel 22.11.2008 Mitwitz Untersuchungsgebiet Hersbrucker Alb 2 1998 Flächendeckende Erfassung aller Waldquellen auf Präsenz der
Die Gestreifte Quelljungfer in der Hersbrucker Alb Lisa Jeworutzki Dr. Kai Frobel 22.11.2008 Mitwitz Untersuchungsgebiet Hersbrucker Alb 2 1998 Flächendeckende Erfassung aller Waldquellen auf Präsenz der
Unterlage 12.0B. Anlage 21
 Planfeststellung A 14, VKE 1153 Landesgrenze Sachsen-Anhalt (ST) / Brandenburg (BB) bis südlich AS Wittenberge Unterlage 12.0B Anlage 21 Unterlage 12.0B Anlage 21 Ergänzende faunistische Sonderuntersuchung
Planfeststellung A 14, VKE 1153 Landesgrenze Sachsen-Anhalt (ST) / Brandenburg (BB) bis südlich AS Wittenberge Unterlage 12.0B Anlage 21 Unterlage 12.0B Anlage 21 Ergänzende faunistische Sonderuntersuchung
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer
 150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
Pilotstudie: Handlungskonzept zum Schutz und zur Förderung der Bachmuschel
 Pilotstudie: Handlungskonzept zum Schutz und zur Förderung der Bachmuschel Projektvorstellung am 26.09.2015 bei der Fortbildung für Gewässerwarte des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e. V.
Pilotstudie: Handlungskonzept zum Schutz und zur Förderung der Bachmuschel Projektvorstellung am 26.09.2015 bei der Fortbildung für Gewässerwarte des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e. V.
Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) (Stand November 2011)
 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Wirbellosenarten in Niedersachsen Wirbellosenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit höchster Priorität für Erhaltungs-
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Wirbellosenarten in Niedersachsen Wirbellosenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit höchster Priorität für Erhaltungs-
Retentionskataster. Flussgebiet Lahn
 Retentionskataster Flussgebiet Lahn Flussgebiets-Kennzahl: 258 Bearbeitungsabschnitt: km 174+099 bis km 222+549 Retentionskataster Niederschlagsgebiet Lahn FKZ 258 Seite - 2-1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Retentionskataster Flussgebiet Lahn Flussgebiets-Kennzahl: 258 Bearbeitungsabschnitt: km 174+099 bis km 222+549 Retentionskataster Niederschlagsgebiet Lahn FKZ 258 Seite - 2-1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Die Libellen der Fließgewässer und ihre Begleitfauna im FFH-Gebiet Kottenforst bei Bonn. (Insecta: Odonata)
 Die Libellen der Fließgewässer und ihre Begleitfauna im FFH-Gebiet Kottenforst bei Bonn (Insecta: Odonata) Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom- Biologen der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen
Die Libellen der Fließgewässer und ihre Begleitfauna im FFH-Gebiet Kottenforst bei Bonn (Insecta: Odonata) Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom- Biologen der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen
Einige heimische Arten
 Einige heimische Arten Auf den nachfolgenden Seiten finden sich Informationen zur Gefährdung und zu den Lebensraumansprüchen einzelner Arten sowie zu besonderen Schutzmaßnahmen. Für genauere Informationen
Einige heimische Arten Auf den nachfolgenden Seiten finden sich Informationen zur Gefährdung und zu den Lebensraumansprüchen einzelner Arten sowie zu besonderen Schutzmaßnahmen. Für genauere Informationen
Nachsuche nach Großmuscheln
 Nachsuche nach Großmuscheln in der geplanten Ausgleichsfläche "Tauber unterhalb Wehr Edelfingen" Bebauungsplan "Bandhaus IV" Große Kreisstadt Bad Mergentheim Gemarkung Edelfingen im Auftrag der Stadtverwaltung
Nachsuche nach Großmuscheln in der geplanten Ausgleichsfläche "Tauber unterhalb Wehr Edelfingen" Bebauungsplan "Bandhaus IV" Große Kreisstadt Bad Mergentheim Gemarkung Edelfingen im Auftrag der Stadtverwaltung
Neuigkeiten zum Eschen-Scheckenfalter (Euphydryas maturna LINNAEUS, 1758) in Sachsen und Sachsen-Anhalt
 Neuigkeiten zum Eschen-Scheckenfalter (Euphydryas maturna LINNAEUS, 1758) in Sachsen und Sachsen-Anhalt 19. UFZ-Workshop Populationsbiologie von Tagfaltern und Widderchen 23.02.-25.02.2017 Referentin:
Neuigkeiten zum Eschen-Scheckenfalter (Euphydryas maturna LINNAEUS, 1758) in Sachsen und Sachsen-Anhalt 19. UFZ-Workshop Populationsbiologie von Tagfaltern und Widderchen 23.02.-25.02.2017 Referentin:
Gabel-Azurjungfer (Coenagrion scitulum) RAMBUR, 1842
 Gabel-Azurjungfer (Coenagrion scitulum) RAMBUR, 1842 Die Gabel Azurjungfer ist die kleinste aller Azurjungfern. Die Männchen überschreiten eine Körpergröße von 35 Millimetern nicht, wobei ihre Flügelspannweite
Gabel-Azurjungfer (Coenagrion scitulum) RAMBUR, 1842 Die Gabel Azurjungfer ist die kleinste aller Azurjungfern. Die Männchen überschreiten eine Körpergröße von 35 Millimetern nicht, wobei ihre Flügelspannweite
Bezirksregierung Detmold. Der Zustand der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe.
 Bezirksregierung Detmold Der Zustand der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe www.weser.nrw.de Stand Mai 2014 Der Zustand der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe Das Land NRW hat mit bundesweit abgestimmten Methoden
Bezirksregierung Detmold Der Zustand der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe www.weser.nrw.de Stand Mai 2014 Der Zustand der Gewässer in Ostwestfalen-Lippe Das Land NRW hat mit bundesweit abgestimmten Methoden
Tagfalter in Bingen. Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
Tagfalter in Bingen Der Magerrasen-Perlmutterfalter -lat. Boloria dia- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 3 Besonderheiten... 4 Beobachten / Nachweis... 4 Zucht / Umweltbildung...
... und sie bewegen sich doch! Beispiele und Hinweise für Renaturierungsmaßnahmen an lösslehmgeprägten Fließgewässern
 ... und sie bewegen sich doch! Beispiele und Hinweise für Renaturierungsmaßnahmen an lösslehmgeprägten Fließgewässern 25.03.2014 Gebietsforum Lippe Dipl.-Ing (FH) Volker Karthaus Wasserverband Obere Lippe
... und sie bewegen sich doch! Beispiele und Hinweise für Renaturierungsmaßnahmen an lösslehmgeprägten Fließgewässern 25.03.2014 Gebietsforum Lippe Dipl.-Ing (FH) Volker Karthaus Wasserverband Obere Lippe
NATURWALDRESERVAT DAMM
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg NATURWALDRESERVAT DAMM Naturwaldreservat Damm Buche gewinnt an Wuchsraum. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Damm ist das bisher einzige Buchenreservat
Informations- und Fortbildungsveranstaltung zur schonenden Gewässerunterhaltung in Schleswig-Holstein
 3.3 Gewässerökologie - Fauna Informations- und Fortbildungsveranstaltung zur schonenden Gewässerunterhaltung in Schleswig-Holstein Referentin: Dipl.-Biol. Friederike Eggers, EGGERS BIOLOGISCHE GUTACHTEN,
3.3 Gewässerökologie - Fauna Informations- und Fortbildungsveranstaltung zur schonenden Gewässerunterhaltung in Schleswig-Holstein Referentin: Dipl.-Biol. Friederike Eggers, EGGERS BIOLOGISCHE GUTACHTEN,
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Neuer Nachweis von Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca) in Mecklenburg-Vorpommern WOLFGANG ZESSIN, Schwerin Einleitung Die Ordnung der Blattfußkrebse (Phyllopoda) ist in Mitteleuropa mit etwa hundert,
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen
 Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Kammmolche (Triturus cristatus) in Baden-Württemberg Ein Vergleich von Populationen unterschiedlicher Höhenstufen Ergebnisüberblick Heiko Hinneberg heiko.hinneberg@web.de Methoden Habitatbeschaffenheit
Grundlage der ökologischen Fließgewässerbewertung
 Grundlage der ökologischen Fließgewässerbewertung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, seit 2000 in Kraft) Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt
Grundlage der ökologischen Fließgewässerbewertung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, seit 2000 in Kraft) Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt
Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra)
 Benedikt Schmidt benedikt.schmidt@unine.ch Silvia Zumbach silvia.zumbach@unine.ch Neuchâtel, 20. März 2017 Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) Anleitung Feuersalamander
Benedikt Schmidt benedikt.schmidt@unine.ch Silvia Zumbach silvia.zumbach@unine.ch Neuchâtel, 20. März 2017 Anleitung zur Erfassung der Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) Anleitung Feuersalamander
Zur Situation der Gelbbauchunke in Hessen Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.v. (AGAR)
 CHRISTIAN GESKE & ANDREAS MALTEN Zur Situation der Gelbbauchunke in Hessen Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.v. () IUCN: Least Concern FFH-Anhänge: II & IV Rote Liste Deutschland
CHRISTIAN GESKE & ANDREAS MALTEN Zur Situation der Gelbbauchunke in Hessen Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.v. () IUCN: Least Concern FFH-Anhänge: II & IV Rote Liste Deutschland
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe
 Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik
 Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik Auftraggeber: Ing.büro Wassermüller Ulm GmbH Hörvelsinger Weg 44 89081 Ulm 30.09.2017 Anlass: Die Gemeinde Wain will innerorts
Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik Auftraggeber: Ing.büro Wassermüller Ulm GmbH Hörvelsinger Weg 44 89081 Ulm 30.09.2017 Anlass: Die Gemeinde Wain will innerorts
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland
 Allen Unkenrufen zum Trotz Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) Tagung - 22. 23.11.2014 Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland Paula Höpfner,
Allen Unkenrufen zum Trotz Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) Tagung - 22. 23.11.2014 Fallstudie zur Reproduktionsökologie der Gelbbauchunke in zwei Lebensräumen im nördlichen Rheinland Paula Höpfner,
Bericht und 1. Effizienzkontrolle zur Umsiedlung der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Baugebiet " Raiffeisenstraße in Herxheim
 Bericht und 1. Effizienzkontrolle zur Umsiedlung der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Baugebiet " Raiffeisenstraße in Herxheim Abb. 1: Männchen der Zauneidechse in Ausgleichsfläche im Mai 2013 1. Anlass
Bericht und 1. Effizienzkontrolle zur Umsiedlung der Zauneidechse (Lacerta agilis) im Baugebiet " Raiffeisenstraße in Herxheim Abb. 1: Männchen der Zauneidechse in Ausgleichsfläche im Mai 2013 1. Anlass
Naturnahe Umgestaltung des Scharmbecker Bachs und der Wienbeck
 Naturnahe Umgestaltung des Scharmbecker Bachs und der Wienbeck Natürliche Fließgewässer sind dynamische Systeme, die sich durch einen sehr großen Strukturreichtum und sauberes Wasser auszeichnen. Sehr
Naturnahe Umgestaltung des Scharmbecker Bachs und der Wienbeck Natürliche Fließgewässer sind dynamische Systeme, die sich durch einen sehr großen Strukturreichtum und sauberes Wasser auszeichnen. Sehr
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen
 Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Sie kamen ins Moor: Die Kraniche Erster Brutnachweis in Nordrhein-Westfalen Von Ernst-Günter Bulk, Stefan Bulk & Eckhard Möller Die Wetten liefen bereits seit ein Paar Jahren: Die weiten dünn besiedelten
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
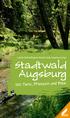 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798
 Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798 Orthetrum coerulescens erreicht eine Körperlänge von 3,6 bis 4,5 Zentimetern und eine Flügelspannweite von bis zu 6,5 Zentimetern. Nach ihrer
Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) FABRICIUS, 1798 Orthetrum coerulescens erreicht eine Körperlänge von 3,6 bis 4,5 Zentimetern und eine Flügelspannweite von bis zu 6,5 Zentimetern. Nach ihrer
Unser aktuelles Artenschutzprojekt: Die Wiederansiedlung der Äsche in der oberen Nidda
 Unser aktuelles Artenschutzprojekt: Die Wiederansiedlung der Äsche in der oberen Nidda Als größter und längster Fluss im Wetteraukreis spielt die Nidda als Lebensraum in unserer Region eine wichtige Rolle.
Unser aktuelles Artenschutzprojekt: Die Wiederansiedlung der Äsche in der oberen Nidda Als größter und längster Fluss im Wetteraukreis spielt die Nidda als Lebensraum in unserer Region eine wichtige Rolle.
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde
 Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg
 Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg PE Peter Endl (Dipl. Biol.) Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan
Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan Bleicherstraße/ Vollmerstraße Stadt Biberacha.d. Riß Baden-Württemberg PE Peter Endl (Dipl. Biol.) Fang- und Umsiedlung - Reptilien zum Bebauungsplan
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Erfolgskontrolle Schmetterlinge. - Abschlussbericht mit Unterstützung des Finanzierungsinstruments LIFE der Europäischen Gemeinschaft
 Erfolgskontrolle Schmetterlinge - Abschlussbericht 2015 - mit Unterstützung des Finanzierungsinstruments LIFE der Europäischen Gemeinschaft Auftraggeber: Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 56 Naturschutz
Erfolgskontrolle Schmetterlinge - Abschlussbericht 2015 - mit Unterstützung des Finanzierungsinstruments LIFE der Europäischen Gemeinschaft Auftraggeber: Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 56 Naturschutz
Bergbäche im Thüringer Wald
 Bergbäche im Thüringer Wald Gliederung 1. Ziele und Projektförderung 2. Projektgebiete und Partner 3. Teilziele und Projektlaufzeit 4. Leitarten 5. Erste Ergebnisse Projektvorstellung am 02. Februar 2013
Bergbäche im Thüringer Wald Gliederung 1. Ziele und Projektförderung 2. Projektgebiete und Partner 3. Teilziele und Projektlaufzeit 4. Leitarten 5. Erste Ergebnisse Projektvorstellung am 02. Februar 2013
Wälder mit natürlicher Entwicklung (NWE) in den Niedersächsischen Landesforsten (NLF)
 Wälder mit natürlicher Entwicklung (NWE) in den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) Wichtige Kennzeichen des NWE-Programms Stand: 22.10.2015 numfang 2013 und Entwicklung bis 2015 Am 01.06.2013 wurde
Wälder mit natürlicher Entwicklung (NWE) in den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) Wichtige Kennzeichen des NWE-Programms Stand: 22.10.2015 numfang 2013 und Entwicklung bis 2015 Am 01.06.2013 wurde
NATURWALDRESERVAT KREBSWIESE- LANGERJERGEN
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT KREBSWIESE- LANGERJERGEN Naturwaldreservat Krebswiese- Langerjergen Buchenwald mit Totholz ein Element naturnaher Wälder. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim NATURWALDRESERVAT KREBSWIESE- LANGERJERGEN Naturwaldreservat Krebswiese- Langerjergen Buchenwald mit Totholz ein Element naturnaher Wälder. ALLGEMEINES
Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet.
 Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet Lage und Wegbeschreibung Bergmatten befindet sich oberhalb von Hofstetten-Flüh, einer Gemeinde im Bezirk Dorneck des Kantons Solothurn. Die Gemeinde gehört
Bergmatten (SO) Informationen über das Gebiet Lage und Wegbeschreibung Bergmatten befindet sich oberhalb von Hofstetten-Flüh, einer Gemeinde im Bezirk Dorneck des Kantons Solothurn. Die Gemeinde gehört
Wanderung durch die Fischregionen / Gewässerregionen
 Wanderung durch die Fischregionen / Gewässerregionen Der Europäische Stör ist ein Wanderfisch, der den größten Teil seines Lebens im Meer oder Brackwasser verbringt. Zum Laichen steigt er, wie auch der
Wanderung durch die Fischregionen / Gewässerregionen Der Europäische Stör ist ein Wanderfisch, der den größten Teil seines Lebens im Meer oder Brackwasser verbringt. Zum Laichen steigt er, wie auch der
Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee
 Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee Naturraum Das Tessiner Moor liegt nördlich von Wittenburg zwischen Karft und Tessin (Abb. 1). Es hat eine Fläche
Konzeption zur ökologischen Sanierung des Tessiner Moores im Biosphärenreservat Schaalsee Naturraum Das Tessiner Moor liegt nördlich von Wittenburg zwischen Karft und Tessin (Abb. 1). Es hat eine Fläche
Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg
 Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg Dieser Artikel kann über Datei.. Drucken.. ausgedruckt werden Hochhausen Burgstall- Der Bergsporn erinnert an eine vergessene Burg von Frank Buchali und Marco
NATURWALDRESERVAT HECKE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
HESSEN-FORST. Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) Artensteckbrief. Stand: weitere Informationen erhalten Sie bei:
 HESSEN-FORST Artensteckbrief Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) Stand: 2006 weitere Informationen erhalten Sie bei: Hessen-Forst FENA Naturschutz Europastraße 10-12 35394 Gießen Tel.: 0641 / 4991-264
HESSEN-FORST Artensteckbrief Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) Stand: 2006 weitere Informationen erhalten Sie bei: Hessen-Forst FENA Naturschutz Europastraße 10-12 35394 Gießen Tel.: 0641 / 4991-264
Vorstellung des Bearbeitungsgebietes Schwalm
 1 EU-Wasserrahmenrichtlinie am Kooperation Schwalm Vorstellung des Bearbeitungsgebietes Schwalm Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR Dipl.-Ing. Wolfgang Kerstan Dipl.-Ing. Gregor Stanislowski 47441 Moers
1 EU-Wasserrahmenrichtlinie am Kooperation Schwalm Vorstellung des Bearbeitungsgebietes Schwalm Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR Dipl.-Ing. Wolfgang Kerstan Dipl.-Ing. Gregor Stanislowski 47441 Moers
Libellen am Fluss
 Libellen am Fluss 1 2 3 4 5 Flussjungfern Abbildungen: aus Dijkstra & Lewington 2006, verändert Grosslibellen (Anisoptera): 5 Familien Edellibellen Quelljungfern Aeshnidae Cordulegastridae Stefan Kohl
Libellen am Fluss 1 2 3 4 5 Flussjungfern Abbildungen: aus Dijkstra & Lewington 2006, verändert Grosslibellen (Anisoptera): 5 Familien Edellibellen Quelljungfern Aeshnidae Cordulegastridae Stefan Kohl
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Distelfalter -lat. Vanessa cardui- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 4 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Untersuchungen zum Befestigen von Totholzelementen in Fließgewässern
 Untersuchungen zum Befestigen von Totholzelementen in Fließgewässern Dipl. Ing. (FH) Falko Hartmann Sankt Franziskus Weg 2 53819 Neunkirchen Seelscheid nk@ibholzem hartmann.de Inhaltsverzeichnis 1. Totholz
Untersuchungen zum Befestigen von Totholzelementen in Fließgewässern Dipl. Ing. (FH) Falko Hartmann Sankt Franziskus Weg 2 53819 Neunkirchen Seelscheid nk@ibholzem hartmann.de Inhaltsverzeichnis 1. Totholz
Gewässer: Feldbach erheblich verändert
 LEBENDIGE BÖRDEBÄCHE UMSETZUNGSFAHRPLAN FÜR PE LIP 1600 Gewässer: Feldbach erheblich verändert 2786612_0 Feldbach Mündung in den Salzbach westlich von Werl bis Quelle km 0 bis 3,348 WKG_LIP-1601: Oberes
LEBENDIGE BÖRDEBÄCHE UMSETZUNGSFAHRPLAN FÜR PE LIP 1600 Gewässer: Feldbach erheblich verändert 2786612_0 Feldbach Mündung in den Salzbach westlich von Werl bis Quelle km 0 bis 3,348 WKG_LIP-1601: Oberes
QUELLEN. Besonderheiten. EU LIFE Projekt Soonwald. Was ist überhaupt eine Quelle?
 QUELLEN EU LIFE Projekt Soonwald Besonderheiten Erlenbruchwald auf quelligem Standort Was ist überhaupt eine Quelle? Quellen sind die natürlichen Austrittsstellen des Grundwassers an der Erdoberfläche.
QUELLEN EU LIFE Projekt Soonwald Besonderheiten Erlenbruchwald auf quelligem Standort Was ist überhaupt eine Quelle? Quellen sind die natürlichen Austrittsstellen des Grundwassers an der Erdoberfläche.
Die Stockwerke der Wiese
 Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Bachmuschelprojekt NRW - Kartierungshilfe
 Bachmuschelprojekt NRW - Kartierungshilfe Leere Muschelschalen: Am häufigsten dürften bei Begehungen am Gewässer Funde von leeren Muschelschalen sein. Dabei lohnt in jedem Fall ein etwas genauerer Blick.
Bachmuschelprojekt NRW - Kartierungshilfe Leere Muschelschalen: Am häufigsten dürften bei Begehungen am Gewässer Funde von leeren Muschelschalen sein. Dabei lohnt in jedem Fall ein etwas genauerer Blick.
Umgestaltung kleiner Fließgewässer zur Lebensraumverbesserung heimischer Fischarten
 Kreisanglerverband Ostvorpommern e.v. Umgestaltung kleiner Fließgewässer zur Lebensraumverbesserung heimischer Fischarten 06.12.2016 Ryck-Symposium Umgestaltung der Landschaft durch den Menschen aus verschiedenen
Kreisanglerverband Ostvorpommern e.v. Umgestaltung kleiner Fließgewässer zur Lebensraumverbesserung heimischer Fischarten 06.12.2016 Ryck-Symposium Umgestaltung der Landschaft durch den Menschen aus verschiedenen
Landratsamt Biberach Rollinstraße Biberach
 Tanja Irg umweltkonzept Schützenstraße 17 88477 Schwendi /Kleinschafhausen Landratsamt Biberach Rollinstraße 9 88400 Biberach Diplom Biologin Tanja Irg Telefon: 07353-75046-13 Mobil: 0176-24114165 E-Mail:
Tanja Irg umweltkonzept Schützenstraße 17 88477 Schwendi /Kleinschafhausen Landratsamt Biberach Rollinstraße 9 88400 Biberach Diplom Biologin Tanja Irg Telefon: 07353-75046-13 Mobil: 0176-24114165 E-Mail:
Auswirkungen des Klimawandels auf Fische (und Rundmäuler)
 Auswirkungen des Klimawandels auf Fische (und Rundmäuler) Dr. Margret Bunzel-Drüke Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.v. Bad Sassendorf-Lohne ) ) Was bringt der Klimawandel?
Auswirkungen des Klimawandels auf Fische (und Rundmäuler) Dr. Margret Bunzel-Drüke Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.v. Bad Sassendorf-Lohne ) ) Was bringt der Klimawandel?
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Pressestelle
 Pressemitteilung Parlamentarischer Staatssekretär Horst Becker: Artenvielfalt gelingt nur mit lebendigen Gewässern Sommertour des Umweltministeriums führt zum Steinkrebs- Projekt in die Eifel Tierart extrem
Pressemitteilung Parlamentarischer Staatssekretär Horst Becker: Artenvielfalt gelingt nur mit lebendigen Gewässern Sommertour des Umweltministeriums führt zum Steinkrebs- Projekt in die Eifel Tierart extrem
Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) (Stand November 2011)
 Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Wirbellosenarten in Niedersachsen Wirbellosenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit höchster Priorität für Erhaltungs-
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz von Wirbellosenarten in Niedersachsen Wirbellosenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit höchster Priorität für Erhaltungs-
Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90.
 Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige
Abb. 1 Mittleres Eintrittsdatum der maximalen Schneedeckenhöhe Zeitraum 1961/90. Abb. 2 Mittlere Schneedeckendauer Zeitraum 1961/90. Den Kartendarstellungen liegen ca. 550 geprüfte, vollständige 30-jährige
Newsletter. Krummzähniger Tannenborkenkäfer. 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5.
 Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
Newsletter Newsletter 4/2016 WBV Bad Kötzting Krummzähniger Tannenborkenkäfer 1. Beschreibung 2. Verbreitung 3. Lebensweise 4. Befallsmerkmale und Schadwirkung 5. Bekämpfung 1 1. Beschreibung Der Krummzähniger
HESSEN-FORST. Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) Artensteckbrief. Stand: weitere Informationen erhalten Sie bei:
 HESSEN-FORST Artensteckbrief Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) Stand: 2006 weitere Informationen erhalten Sie bei: Hessen-Forst FENA Naturschutz Europastraße 10-12 35394 Gießen Tel.: 0641 / 4991-264
HESSEN-FORST Artensteckbrief Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) Stand: 2006 weitere Informationen erhalten Sie bei: Hessen-Forst FENA Naturschutz Europastraße 10-12 35394 Gießen Tel.: 0641 / 4991-264
Tagfalter in Bingen. Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Kleine Fuchs -lat. Nymphalis urticae- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 3 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Änderung zur Planfeststellung
 Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg Änderung zur Planfeststellung für den Ersatzneubau der Straßenbrückenanlage Lanze-Buchhorst über den Elbe-Lübeck-Kanal Kanal-km 58,684 Planänderungsunterlagen Ergänzung
Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg Änderung zur Planfeststellung für den Ersatzneubau der Straßenbrückenanlage Lanze-Buchhorst über den Elbe-Lübeck-Kanal Kanal-km 58,684 Planänderungsunterlagen Ergänzung
NATURWALDRESERVAT ASCHOLDINGER AU
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen NATURWALDRESERVAT ASCHOLDINGER AU Naturwaldreservat Ascholdinger Au Unter dem lichten Kiefernschirm hält sich der Wacholder. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen NATURWALDRESERVAT ASCHOLDINGER AU Naturwaldreservat Ascholdinger Au Unter dem lichten Kiefernschirm hält sich der Wacholder. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat
Bechsteinfledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land Vom Leben einer Waldart in der offenen Kulturlandschaft
 Bechsteinfledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land Vom Leben einer Waldart in der offenen Kulturlandschaft Julia Kropfberger, Guido Reiter & Isabel Schmotzer Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) mittelgroßen
Bechsteinfledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land Vom Leben einer Waldart in der offenen Kulturlandschaft Julia Kropfberger, Guido Reiter & Isabel Schmotzer Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) mittelgroßen
Nachweise des Zünslers Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) im Niederrheinischen Tiefland 2014 (Lepidoptera: Pyraloidea)
 Nachweise des Zünslers Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) im Niederrheinischen Tiefland 2014 (Lepidoptera: Pyraloidea) Renate und Gerhard Freundt, Wesel Vorbemerkung Aktuelle Funde des Zünslers Pyrausta
Nachweise des Zünslers Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) im Niederrheinischen Tiefland 2014 (Lepidoptera: Pyraloidea) Renate und Gerhard Freundt, Wesel Vorbemerkung Aktuelle Funde des Zünslers Pyrausta
Ergänzung des Grünordnungsplans. Bewertung der Ökologischen Bilanz zum Bebauungsplanes Nr. 80 "Neuenkleusheim - Sägewerk Schrage" der Kreisstadt Olpe
 Ergänzung des Grünordnungsplans Bewertung der Ökologischen Bilanz zum Bebauungsplanes Nr. 80 "Neuenkleusheim - Sägewerk Schrage" der Kreisstadt Olpe Kreisstadt Olpe Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2.
Ergänzung des Grünordnungsplans Bewertung der Ökologischen Bilanz zum Bebauungsplanes Nr. 80 "Neuenkleusheim - Sägewerk Schrage" der Kreisstadt Olpe Kreisstadt Olpe Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2.
Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Sielmanns Natur-Ranger "Frechdachse Wuppertal" Scheidtstr. 108, Wuppertal
 Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Dort, wo nur ganz wenige Menschen leben, kann man in der Regel aus jedem fließenden Gewässer trinken; so wie aus dem kleinen lappländischen See auf dem Bild.
Wiewowas? "Biologische Gewässeruntersuchung" Dort, wo nur ganz wenige Menschen leben, kann man in der Regel aus jedem fließenden Gewässer trinken; so wie aus dem kleinen lappländischen See auf dem Bild.
DER GEWÄSSER -KNIGGE. Tipps und Informationen zum Leben an und mit unseren Gewässern
 DER GEWÄSSER -KNIGGE Tipps und Informationen zum Leben an und mit unseren Gewässern Gewässer-Knigge Teil 1 hier: Böschungs- und Gehölzpflege Die Unterhaltung der Gewässerböschungen ist in der Regel bis
DER GEWÄSSER -KNIGGE Tipps und Informationen zum Leben an und mit unseren Gewässern Gewässer-Knigge Teil 1 hier: Böschungs- und Gehölzpflege Die Unterhaltung der Gewässerböschungen ist in der Regel bis
Untersuchung der Tiere eines Gewässers
 Untersuchung der Tiere eines Gewässers In Gewässern ganz gleich, ob es sich um einen See, Teich oder Bach handelt leben typische Organismen. Viele davon sind mit bloßem Auge erkennbar, Kleinstlebewesen
Untersuchung der Tiere eines Gewässers In Gewässern ganz gleich, ob es sich um einen See, Teich oder Bach handelt leben typische Organismen. Viele davon sind mit bloßem Auge erkennbar, Kleinstlebewesen
Die Wiederansiedlung der Quappe (Lota lota) in NRW
 Die Wiederansiedlung der Quappe (Lota lota) in NRW Eine Aufgabe mit hohen Ansprüchen Ein Kooperationsprojekt des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e.v. und des Ruhrverbandes 7. Nordrhein- Westfälischer
Die Wiederansiedlung der Quappe (Lota lota) in NRW Eine Aufgabe mit hohen Ansprüchen Ein Kooperationsprojekt des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e.v. und des Ruhrverbandes 7. Nordrhein- Westfälischer
Blick ins Gewässer Klärwerkpersonalausbildung Juni 2017
 Blick ins Gewässer Klärwerkpersonalausbildung Juni 2017 Konzept: VSA - Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute Leitung, Texte, Bilder: Oikos 2000 Sagl (Alberto Conelli) Lernziel: Die Teilnehmer
Blick ins Gewässer Klärwerkpersonalausbildung Juni 2017 Konzept: VSA - Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute Leitung, Texte, Bilder: Oikos 2000 Sagl (Alberto Conelli) Lernziel: Die Teilnehmer
ART Jahrestagung Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen IBIS
 Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen INGENIEURE FÜR BIOLOGISCHE STUDIEN, INFORMATIONSSYSTEME UND STANDORTBEWERTUNG An der Kirche 5,
Erhaltungszustand der Gelbbauchunken-Population in Thüringen und daraus abzuleitende Handlungsempfehlungen INGENIEURE FÜR BIOLOGISCHE STUDIEN, INFORMATIONSSYSTEME UND STANDORTBEWERTUNG An der Kirche 5,
Der Eisvogel. Botschafter für lebendige Fliessgewässer
 Der Eisvogel Botschafter für lebendige Fliessgewässer Ein Projekt zur Verbesserung der Fließgewässerökologie in der Gemeinde Hellenthal Projektträger: Gefördert durch: Gemeinde Hellenthal Rathausstrasse
Der Eisvogel Botschafter für lebendige Fliessgewässer Ein Projekt zur Verbesserung der Fließgewässerökologie in der Gemeinde Hellenthal Projektträger: Gefördert durch: Gemeinde Hellenthal Rathausstrasse
Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau
 Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau Bericht: Ökologische Aufwertung und Projektbegleitung / Faunistisches Monitoring 2012 (Teilprojekt des Projektes Natur pur an Necker und Thur ) Thurlauf im Gebiet
Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau Bericht: Ökologische Aufwertung und Projektbegleitung / Faunistisches Monitoring 2012 (Teilprojekt des Projektes Natur pur an Necker und Thur ) Thurlauf im Gebiet
Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg
 Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
Tier-Steckbriefe. Tier-Steckbriefe. Lernziele: Material: Köcher iege. Arbeitsblatt 1 - Welches Tier lebt wo? Methode: Info:
 Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Fahrrinnenausbau Main Ökologische Gestaltungsmaßnahmen
 Fahrrinnenausbau Main Ökologische Gestaltungsmaßnahmen Gerd Karreis Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg Ausbau der Fahrrinne des Main Vertiefung von 2,50 m auf 2,90 m, Verbreiterung von 36 m auf 40 m
Fahrrinnenausbau Main Ökologische Gestaltungsmaßnahmen Gerd Karreis Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg Ausbau der Fahrrinne des Main Vertiefung von 2,50 m auf 2,90 m, Verbreiterung von 36 m auf 40 m
Natürlich tut naturnah gut!
 Natürlich tut naturnah gut! Notwendigkeit der ökologischen Verbesserung von Fließgewässern Tanja Pottgiesser umweltbüro essen Einführung Funktionen naturnaher Fließgewässer Nutzung von Fließgewässern Der
Natürlich tut naturnah gut! Notwendigkeit der ökologischen Verbesserung von Fließgewässern Tanja Pottgiesser umweltbüro essen Einführung Funktionen naturnaher Fließgewässer Nutzung von Fließgewässern Der
NRW. Merkblatt zur Artenförderung. Pfaffenhütchen. Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF)
 Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Pfaffenhütchen Bedrohung und Förderung des Pfaffenhütchens - Euonymus europaeus Obwohl
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Pfaffenhütchen Bedrohung und Förderung des Pfaffenhütchens - Euonymus europaeus Obwohl
3. Zweckbestimmungen für Brachflächen ( 24 LG)
 3. Zweckbestimmungen für Brachflächen ( 24 LG) Erläuterung: Gesetzliche Vorgaben Der Landschaftsplan kann nach Maßgabe der Entwicklungsziele ( 18 LG) eine Zweckbestimmung für Brachflächen in der Weise
3. Zweckbestimmungen für Brachflächen ( 24 LG) Erläuterung: Gesetzliche Vorgaben Der Landschaftsplan kann nach Maßgabe der Entwicklungsziele ( 18 LG) eine Zweckbestimmung für Brachflächen in der Weise
Bedeutung der Gewässerstruktur für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
 Bedeutung der Gewässerstruktur für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Gliederung 1. Grundlagen der Wasserrahmenrichtlinie a. Bewertung des ökologischen Zustands der Oberflächenwasserkörper 2. Rolle
Bedeutung der Gewässerstruktur für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Gliederung 1. Grundlagen der Wasserrahmenrichtlinie a. Bewertung des ökologischen Zustands der Oberflächenwasserkörper 2. Rolle
Archipel. Strand. Land- und Gewässerformen
 Land- und Gewässerformen Die Karten zeigen dir einzelne Land- und Gewässerformen. Ordne die Texte den richtigen Karten zu. Kontrolliere anschließend selbstständig. Du kannst ein eigenes Heft zu den Landschaftsformen
Land- und Gewässerformen Die Karten zeigen dir einzelne Land- und Gewässerformen. Ordne die Texte den richtigen Karten zu. Kontrolliere anschließend selbstständig. Du kannst ein eigenes Heft zu den Landschaftsformen
Epallage fatime (Charpentier, 1840) Orientjungfer, Blaue Orientjungfer E: Odalisque
 Epallage fatime (Charpentier, 1840) Orientjungfer, Blaue Orientjungfer E: Odalisque Name: Fatime ist ein arabischer Frauenname. Der deutsche Name bezieht sich auf die Verbreitung der Art bzw. die markante
Epallage fatime (Charpentier, 1840) Orientjungfer, Blaue Orientjungfer E: Odalisque Name: Fatime ist ein arabischer Frauenname. Der deutsche Name bezieht sich auf die Verbreitung der Art bzw. die markante
Die Bachforelle. Die Koppe. Turbinchens Schulstunde. Aussehen. Nahrung. Fortpflanzung. Lebensraum. Wissenswertes. Turbinchens Schulstunde.
 Die Bachforelle Ich gehöre zur Familie der Lachsfische und kann bis zu 80 cm lang und 2 kg schwer werden! Du erkennst mich an den roten und schwarzen, hell umrandeten Flecken an den Seiten. Sehr gerne
Die Bachforelle Ich gehöre zur Familie der Lachsfische und kann bis zu 80 cm lang und 2 kg schwer werden! Du erkennst mich an den roten und schwarzen, hell umrandeten Flecken an den Seiten. Sehr gerne
Duisburg, ein idealer Ort für Mauereidechsen 1
 Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 13.3 (2008): 1-7 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 13.3 (2008): 1-7 Duisburg, ein idealer Ort
Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 13.3 (2008): 1-7 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 13.3 (2008): 1-7 Duisburg, ein idealer Ort
Christine Schneider Maurice Gliem. Pilze finden. Der Blitzkurs für Einsteiger
 Christine Schneider Maurice Gliem Pilze finden Der Blitzkurs für Einsteiger Das A und O ist das Wo! 15 Des Pilzes Lebensraum Zu wissen, wo Pilze am liebsten und am prächtigsten gedeihen, ist die wahre
Christine Schneider Maurice Gliem Pilze finden Der Blitzkurs für Einsteiger Das A und O ist das Wo! 15 Des Pilzes Lebensraum Zu wissen, wo Pilze am liebsten und am prächtigsten gedeihen, ist die wahre
Immer noch Kontaminationsgefahr! Falter geschlüpft und Eiablage erfolgt
 Aktuelle Hinweise zum Eichenprozessionsspinner (EPS): Immer noch Kontaminationsgefahr! Falter geschlüpft und Eiablage erfolgt (Stand: 01.12.2005) Die Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners
Aktuelle Hinweise zum Eichenprozessionsspinner (EPS): Immer noch Kontaminationsgefahr! Falter geschlüpft und Eiablage erfolgt (Stand: 01.12.2005) Die Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners
Gewässerrandstreifen. Grundsätzliches Bezug zu Wassergesetzen Bezug zur WRRL Konflikte und Lösungsansätze Förderung / Finanzierung Beispiele
 Gewässerrandstreifen Grundsätzliches Bezug zu Wassergesetzen Bezug zur WRRL Konflikte und Lösungsansätze Förderung / Finanzierung Beispiele Gewässerrandstreifen / Vortrag / Geo-Forum 06.07.2017 / Andreas
Gewässerrandstreifen Grundsätzliches Bezug zu Wassergesetzen Bezug zur WRRL Konflikte und Lösungsansätze Förderung / Finanzierung Beispiele Gewässerrandstreifen / Vortrag / Geo-Forum 06.07.2017 / Andreas
Schafherden lebende Biotopverbundsysteme. Harald Plachter. 1. Einleitung
 Schafherden lebende Biotopverbundsysteme Harald Plachter 1. Einleitung Schafe zählen auch heute noch zur charakteristischen Ausstattung vieler Landschaften. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern
Schafherden lebende Biotopverbundsysteme Harald Plachter 1. Einleitung Schafe zählen auch heute noch zur charakteristischen Ausstattung vieler Landschaften. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern
Bebauungsplan Südlich Werre in Korntal-Münchingen Untersuchungen zur Artengruppe der Holzbewohnenden Käferarten
 Anlage 6 zur BU 123/2017 Bebauungsplan Südlich Werre in Korntal-Münchingen Untersuchungen zur Artengruppe der Holzbewohnenden Käferarten vorgelegt von Claus Wurst, Karlsruhe Im Auftrag des Büros Prof.
Anlage 6 zur BU 123/2017 Bebauungsplan Südlich Werre in Korntal-Münchingen Untersuchungen zur Artengruppe der Holzbewohnenden Käferarten vorgelegt von Claus Wurst, Karlsruhe Im Auftrag des Büros Prof.
06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung
 06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan samt örtlicher Bauvorschriften Löhl V, Legelshurst im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB Fassung für die Offenlage 17.06.2016 Projekt: 1627 Bearbeiter:
06 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan samt örtlicher Bauvorschriften Löhl V, Legelshurst im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB Fassung für die Offenlage 17.06.2016 Projekt: 1627 Bearbeiter:
Der Biber in Nordrhein-Westfalen Bestandsentwicklung und Prognosen
 Platzhalter Grafik (Bild/Foto) Foto: S. Venske, Biberzentrum Rheinland-Pfalz Der Biber in Nordrhein-Westfalen Bestandsentwicklung und Prognosen NUA-Seminar Der Biber kommt! Information und Austausch 30.-31.
Platzhalter Grafik (Bild/Foto) Foto: S. Venske, Biberzentrum Rheinland-Pfalz Der Biber in Nordrhein-Westfalen Bestandsentwicklung und Prognosen NUA-Seminar Der Biber kommt! Information und Austausch 30.-31.
Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen
 / 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
/ 0 1 * 2 3 ' (. *. ' ' / ( 0. Teichfrosch: Lebensraum und Aussehen Der Teichfrosch kommt im Spreewald häufig vor. Er sitzt gern am Rand bewachsener Gewässer und sonnt sich. Dabei ist er stets auf der
Thomas Engleder. Mag.rer.nat., Geograph & Ökologe
 An die Naturschutzabteilung des Landes OÖ z. H. Mag. Stefan Guttmann Bahnhofsplatz 1 A-4010 Linz/Donau Haslach, 30.10.2008 Kurzbericht: Kartierung der Art Euplagia quadripunctaria (Russischer Bär/ Spanische
An die Naturschutzabteilung des Landes OÖ z. H. Mag. Stefan Guttmann Bahnhofsplatz 1 A-4010 Linz/Donau Haslach, 30.10.2008 Kurzbericht: Kartierung der Art Euplagia quadripunctaria (Russischer Bär/ Spanische
Ein Ort voller Legenden. Was lebt noch in den Höhlen? Geschützter Wald. Einzigartige Vogelwelt. Wiederentdeckung der Höhlen
 Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Retentionskataster. Flussgebiet Weser
 Retentionskataster Flussgebiet Weser Flussgebiets-Kennzahl: 4 Bearbeitungsabschnitt: km 0+000 bis km 44+700 Retentionskataster Niederschlagsgebiet Weser FKZ 4 Seite - 2-1. Beschreibung des Untersuchungsgebiets
Retentionskataster Flussgebiet Weser Flussgebiets-Kennzahl: 4 Bearbeitungsabschnitt: km 0+000 bis km 44+700 Retentionskataster Niederschlagsgebiet Weser FKZ 4 Seite - 2-1. Beschreibung des Untersuchungsgebiets
Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte
 Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte Die Waldfläche in der Stadt Georgmarienhütte umfasst ca. 2.000 Hektar. Diese Größe entspricht in etwa dem Bundes- und liegt über dem Landesdurchschnitt
Bewirtschaftung von Waldflächen in der Stadt Georgsmarienhütte Die Waldfläche in der Stadt Georgmarienhütte umfasst ca. 2.000 Hektar. Diese Größe entspricht in etwa dem Bundes- und liegt über dem Landesdurchschnitt
SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE
 Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
