Von der Wahrheit De veritate (Quaestio I)
|
|
|
- Franz Hofmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 THOMAS VON AQUIN Von der Wahrheit De veritate (Quaestio I) Ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von ALBERT ZIMMERMANN Lateinisch -deutsch FELIX MEINER VERLAG HAMBURG
2 PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND 384 Der lateinische Text der Ausgabe basiert auf der Ausgabe S. Thomae de Aquino Opera Omnia, iussu Leonis XIII P. M. edita, Tomus XXII, Quaestiones disputatae de veritate, Volumen I, Fasc. 2, Qq 1 7 Rom Im Digitaldruck»on demand«hergestelltes, inhaltlich mit der ursprünglichen Ausgabe identisches Exemplar. Wir bitten um Verständnis für unvermeidliche Abweichungen in der Ausstattung, die der Einzelfertigung geschuldet sind. Weitere Informationen unter: Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliogra phi sche Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN ISBN ebook: Felix Meiner Verlag GmbH, Hamburg Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. Gesamtherstellung: BoD, Norderstedt. Gedruckt auf alterungsbeständigem Werkdruck papier, hergestellt aus 100 % chlor frei gebleich tem Zellstoff. Printed in Germany.
3 INHALT Einleitung. Von Albert Zimmermann IX 1. Zum Verfasser der "Quaestiones disputatae" IX 2. Zur "Quaestio disputata" XI 3. übersieht über die zwölf Artikel der Quaestio I XIV 4. Zu Text und Übersetzung XXXVII THOMAS VON AQUIN Von der Wahrheit De veritate Quaestio I Text und Übersetzung Erster Artikel 3 Zweiter Artikel Dritter Artikel Vierter Artikel Fünfter Artikel Sechster Artikel Siebenter Artikel Achter Artikel Neunter Artikel Zehnter Artikel Elfter Artikel Zwölfter Artikel Anmerkungen des Herausgebers Von Thomas benutzte Quellen Verzeichnis lateinischer Termini Namenverzeichnis
4 EINLEITUNG Der vorliegende Band enthält die wichtigen Texte aus der Quaestio I der "Quaestiones disputatae de veritate" des Thomas von Aquin. Er soll als Grundlage eines Studiums der Gedanken "über die Wahrheit" dienen, die dieser Denker vor mehr als 700 Jahren niedergeschrieben hat. Die Einleitung mit einer übersieht über die zwölf Artikel der Quaestio prima und die Erläuterungen sollen das Verständnis der Argumente des Aquinaten, die dem heutigen Leser manchmal fremdartig erscheinen und stellenweise auch sehr knapp gehalten sind, erleichtern. In den "Quaestiones disputatae" erörtert Thomas Fragen, denen damals die besondere Aufmerksamkeit der gelehrten Kreise der Universität von Paris, sowohl der Professoren wie auch der Studenten, galt. Diese Abhandlungen geben Einblick in die geistige Situation an den europäischen Hochschulen des 13. Jahrhunderts. Wie Thomas von Aquin in den "Quaestiones disputatae" fragen nachdenkliche Menschen auch heute, was "Wahrheit", "Erkennen", "Wissen", was "Übel", "Schuld", "Sünde" sind, wie sich menschliches Leben und Verhalten begreifen läßt. Natürlich sind manche Fragestellungen und Antworten des Thomas sehr eng mit der wissenschaftlichen Diskussion, in die er eingreift, verflochten, und vieles ist ohne eine genauere Kenntnis der zeitbedingten Anlässe und Motive nicht recht verständlich. Aber ein gründliches Studium der Texte führt schließlich immer wieder auch zu der Einsicht, daß das philosophische Gespräch die Menschen über die Abstände von Zeiten, Nationen und Zivilisationen hinweg miteinander verbinden kann. 1. Zum Verfasser der "Quaestiones disputatae" Thomas von Aquin lebte von 1224/5 bis Sein Wirken, vor allem als Professor an der damals wichtigsten
5 X Albert Zimmermann europäischen Universität in Paris, fiel in eine Zeit, als durch die Begegnung der traditionsreichen christlichen Schulgelehrsamkeit mit der arabischen und jüdischen Theologie und Philosophie, insbesondere mit vielen bis dahin nicht bekannten Werken des griechischen Denkens, und hier in erster Linie des Aristoteles, eine stürmische Entwicklung der Wissenschaften einsetzte. Thomas, als Student in Neapel in den (noch jungen) Orden der Dominikaner eingetreten und einige Jahre lang in Paris und Köln von Albertus Coloniensis, später "Magnus" genannt, ausgebildet, sah wie sein Lehrer eine wichtige Aufgabe darin, die gegensätzlichen Positionen, die sich aus einer starr an traditionellem Lehrgut festhaltenden Theologie einerseits und dem nun auf neue Quellen gestützten Rationalismus andererseits ergaben, gründlich zu durchdenken, miteinander ins Gespräch zu bringen und für den Fortgang der menschlichen Wahrheitssuche fruchtbar zu machen. Er hinterließ ein erstaunlich umfangreiches Opus, darunter die großen theologischen Summen, Kommentare zu den meisten Werken des Aristoteles und systematische philosophische Abhandlungen. Sein Einfluß sowohl auf Zeitgenossen wie auf das philosophische und theologische Denken späterer Jahrhunderte war groß. Seine Lehren fanden ebenso nachdrückliche Zustimmung wie scharfe Kritik. Auch in der Gegenwart wird Thomas - inzwischen in aller Welt - studiert, und es gibt viele Zeugnisse der Wirksamkeit seiner Gedanken bis in die jüngste Zeit. - Als allgemeine Einführungen in Leben und Werk seien genannt: G. M. Manser, Das Wesen des Thomismus, Fribourg M. Grabmann, Thomas von Aquin, Eine Einführung, München 1949 A. Walz, Thomas von Aquin, Basel1953 A. D. Sertillanges, Der hl. Thomas von Aquin, Köln-Oiten E. Gilson, The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, New York 1956 J. Pieper, Hinführung zu Thomas von Aquin, München 1958 M. D. Chenu, Das Werk des hl. Thomas von Aquin, Deut-
6 Einleitung XI sehe Thomas-Ausgabe, 2- Ergänzungsband, Graz- Wien -Köln, , Thomas von Aquin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Harnburg 1960 G. K. Chesterton, Der hl. Thomas von Aquin, Freiburg H. Meyer, Thomas von Aquin. Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung, Paderborn F. C. Copleston, Aquinas, Penguin Books, Baltimore 1970 R. Mc Inerny, St. Thomas Aquinas, Boston 1974 Thomas von Aquin im philosophischen Gespräch, hrsg. von W. Kluxen, Freiburg-München 1975 J. Weisheipl, Thomas von Aquin. Sein Leben und seine Theologie, Graz 1980 Thomas von Aquin, hrsg. von K. Bernath, Bd. 1: Chronologie und Werkanalyse, Darmstadt 1978, Bd. 2: Philosophische Fragen, Darmstadt A. Zimmermann, Thomas von Aquin, in: Klassiker des philosophischen Denkens, Bd. 1, München , S Zur "Quaestio disputata" Die Eigenart der unter dem Titel: "Quaestiones disputatae" zusammengestellten Texte wird verständlich, wenn man sich deren Entstehung im Lehrbetrieb an Hochschulen des 13. Jahrhunderts vergegenwärtigt. Während eines langen Zeitraums hatte der Unterricht vorwiegend in der "lectio", der Vorlesung eines Schultextes durch einen Professor, bestanden. Dieser versuchte dabei seinen Hörern alle schwierigen Passagen zu erläutern. Er formulierte Fragen, die mit dem Ziel, das vom jeweiligen Autor des Textes Gemeinte zu erschließen, erörtert wurden. Zur einfachen "lectio" gesellte sich somit ganz von selbst die "Quaestio", die "Frage", wobei der im Buch enthaltene Lehrstoff und das, was dessen Verfasser mitteilen wollte, wichtigster Maßstab der Beantwortung waren. Im Laufe des 13. Jahrhunderts, und zwar unter dem Einfluß der aristotelischen Logik und Wissenschaftslehre, gewann die Quaestio als eine
7 XII Albert Zimmermann Form des Unterrichts immer größere Bedeutung neben der Vorlesung im engeren Sinne. Die Zahl der Kommentare, in denen ein Text durch "Quaestiones" erklärt wird, nahm beständig zu. Sie waren in den meisten Fällen der literari sehe Niederschlag dieser Lehrveranstaltungen. Natürlich waren solche Kommentare an das Werk gebunden, das verständlich gemacht werden sollte. Bei der systematischen Untersuchung einer klar umrissenen Frage lockerte sich aber die Bindung an den Text, selbst wenn dieser die Frage veranlaßte. Sehr oft erforderte die methodisch einwandfreie Beantwortung es ja, andere Lehrstücke und andere Texte - sei es desselben Autors, sei es weiterer Autoritäten - zu berücksichtigen und sich mit bereits bekannten Interpretationen auseinanderzusetzen. Sicherlich warfen auch die Studenten Fragen auf, die über das Schulbuch hinausführten und den Professor zwangen, eine Antwort zu geben, die er aufgrund eigener Einsicht für richtig hielt. Diese Entwicklung brachte es mit sich, daß nach und nach die Quaestio, also die systematische Erörterung von mehr oder weniger allgemein interessierenden Fragen, eine eigenständige Form des akademischen Unterrichts wurde. Diese neue Lehrveranstaltung war die "Quaestio disputata". Mit ihr verfolgte man die Absicht, möglichst viele Gelehrte, die sich mit den anstehenden Problemen befaßten, zusammenzubringen und miteinander diskutieren zu lassen. Zugleich bot sie den fortgeschrittenen Studenten die Gelegenheit, sich in der Kunst der wissenschaftlichen Diskussion zu üben. In erster Linie erhoffte man sich von einer derartigen öffentlichen Disputation aber einen Beitrag zum Fortschritt der Erkenntnis. Deshalb wurde schließlich auch jeder Professor verpflichtet, in regelmäßigen Abständen eine "Quaestio disputata" zu veranstalten. Er hatte das Thema vorher bekanntzugeben. Während der Disputation fielen die Lehrveranstaltungen der Kollegen aus. Als Zuhörer waren nicht nur Universitätsangehörige zugelassen, sondern auch interessierte Bürger von außerhalb. Die endgültige schriftliche Fassung einer "Quaestio disputata" mußte der verantwortliche Professor anband der Aufzeichnungen, die während der Diskussion gemacht wor-
8 Einleitung XIII den waren, vornehmen. Er hatte dabei die wichtigsten Argumente, die von den disputierenden Parteien vorgebracht wurden, wiederzugeben, seine eigenen Antworten zu formulieren und zu begründen und schließlich die Einwände, die dagegen erhoben worden waren, zu widerlegen. über den Verlauf einer öffentlichen Disputation und die Entstehung der "Quaestiones disputatae" des Thomas von Aquin informieren: M. D. Chenu, Das Werk des hl. Thomas von Aquin, S , R.-W. Mulligan, Trilth. St. Thomas Aquinas, I. Chicago 1952, S. XIV-XVII. Der Text einer "Quaestio disputata" läßt deutlich den gedanklichen Verlauf der Diskussion über die anstehende Frage erkennen. Er ist - von wenigen Ausnahmen abgesehen - folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird der Gegenstand allgemein angegeben. Dies reicht jedoch nicht als Grundlage einer geordneten Diskussion aus; denn man weiß ja noch nicht, was im einzelnen hinsichtlich des Gegenstandes fragwürdig ist und Meinungsverschiedenheiten verursacht. Die Quaestio ist demnach in bestimmte einzelne Fragen aufzugliedern. Die präzisierte Frage bildet dann den Ausgangspunkt eines Artikels. Eine Quaestio zerfällt somit meistens in mehrere Artikel, die fortlaufend numeriert sind. So ist im vorliegenden Text als Gegenstand der Quaestio "Die Wahrheit" angegeben. Aber erst in den insgesamt 12 Artikeln werden die Probleme verdeutlicht, die im einzelnen zu erörtern sind, und erst die Antworten aller Artikel geben Aufschluß über das, was der Verfasser über den Gegenstand der Quaestio lehrt. Jeder Artikel wiederum ist so aufgebaut, wie es der Ablauf einer wissenschaftlichen Diskussion erfordert. Zuerst wird die Frage genau formuliert. Es werden dann Antworten gegeben, die jedoch nur vorläufig sind, hauptsächlich um durch deren Begründungen die Diskussion in Gang zu setzen. Der erste Teil dieser Antworten wird eingeleitet mit den Worten: "Videtur quod". Der zweite Teil, eingeleitet mit: "Sed contra", enthält Argumente für die entgegengesetzte Meinung. Bei den Begründungen spielen häufig Au-
9 XIV Albert Zimmermann toritäten eine Rolle. Nachdem auf diese Weise der Sinn und das Gewicht der Frage und die zu bewältigenden Schwierigkeiten einer Entscheidung deutlich herausgearbei tet sind, gibt der Professor seine Antwort, die mit den Wor ten: "Dicendum quod" eingeleitet wird. Diesen wichtig sten Teil eines Artikels nennt man "corpus articuli". Er gibt Auskunft über die Lehrmeinung des Autors und vor allem über die Beweise, auf welche sie sich stützt. Den Abschluß bilden die Erwiderungen auf die Argumente, die für die vorläufigen Antworten ins Feld geführt wurden. Thomas von Aquin hat, soweit man den auf uns gekommenen Texten entnehmen kann, sehr zahlreiche öffentliche Disputationen veranstaltet. Was er dabei als Ziel vor Augen hatte, beschrieb er selbst einmal so: "Gewisse Disputationen durch einen Magister in den Schulen dienen nicht der Zurückweisung eines Irrtums, sondern der Belehrung der Hörer, so daß diese dahin gelangen, die Wahrheit, auf die sich die Disputation richtet, zu verstehen; und dann muß man sich auf Beweise stützen, welche die Wurzel dieser Wahrheit aufspüren und bewirken, daß gewußt wird, inwiefern das Gesagte wahr ist" (Quaestiones quodlibetales, IV, 9, 18,c). 3. Obersicht über die zwölf Artikel der Quaestio I Diese übersieht dient der Einführung in die wichtigsten Lehrstücke, die sich in den corpora der zwölf Artikel der Quaestio I finden. In den drei ersten Artikeln wird schrittweise erarbeitet, worin die mittels des Wortes "Wahrheit" bezeichnete Seinsweise besteht. In den folgenden drei Artikeln untersucht Thomas Eigenschaften der Wahrheit. Gegenstand des Artikels 7 ist ein rein theologisches Problem. Eine Klärung des Verhältnisses zwischen der ersten Wahrheit und den von ihr herrührenden Wahrheiten erfolgt im Artikel 8. Während im Artikel 9 erörtert wird, was man unter der Wahrheit der Sinnesvermögen zu verstehen hat, betreffen die drei letzten Artikel den Begriff der Falschheit.
10 Einleitung XV Erster Artikel: Was ist Wahrheit? Ziel des Artikels ist es, die Bedeutung des Wortes "Wahrheit" und der mit diesem verwandten Wörter zu erschließen. Vorausgesetzt ist dabei, daß diese Wörter nicht sinnlos sind. Sie werden ja auch ganz selbstverständlich mit dem Anspruch verwendet, daß sie einen Sinn haben. Dieser Sinngehalt muß jedoch genauer in den Blick gerückt werden. Das geschieht hier durch Rückgang auf die grundlegenden Inhalte des menschlichen Verstehens. Es gibt solche "Grund-Begriffe", ebenso wie es "Grund-Sätze" gibt, die das Beweisen und Schlußfolgern möglich machen und regeln. Die Grundlage unseres Erkennens ist dasjenige Verstehen der Wirklichkeit, das seinen sprachlichen Ausdruck im Wort "Seiendes" findet. Eine systematische Rekonstruktion der Erkenntnis muß also hieran anknüpfen. Jeder Begriff fügt nun zum grundlegenden Inhalt "Seiendes" etwas hinzu, aber zugleich ist das, was hinzugefügt ist, selbst etwas Seiendes und also als ein solches irgendwie auch schon immer miterfaßt. Es kann sich demnach nicht um eine Hinzufügung "von außen" handeln, sondern sie muß auf einer Ent- oder Ausfaltung des Ersterkannten beruhen, welches mittels des Wortes "Seiendes" nicht schon erschöpfend bezeichnet ist. Die Entfaltung führt einmal auf "sondernde" Seinsweisen, die eine kategoriale Einteilung der Wirklichkeit begründen, und sie führt zweitens auf Seinsweisen, die jedwedem Seienden eignen und insofern "allgemeine" genannt werden, als die inhaltliche Vielfalt dessen, was ist, dabei außer Betracht bleibt. Mit der grundlegenden Erkenntnis ist allerdings unmittelbar diejenige einer Vielheit von Seienden verknüpft. Sie bildet gewissermaßen das Netz, an dem sich eine Entfaltung der allgemeinen Seinsweisen orientiert. Es kann nämlich erwogen werden, was ein Seiendes ohne den Hinblick auf irgendetwas von ihm Verschiedenes prägt, und es kann erwogen werden, was ihm im Hinblick auf das, was von ihm getrennt ist, zukommt. Ferner ist zu beachten, daß wir einer Erkenntnis Ausdruck geben, indem wir einem Gegenstand etwas zusprechen oder absprechen, indem wir also etwas von ihm bejahen oder verneinen.
11 XVI Albert Zimmermann Die Benennung "Seiendes" rührt daher, daß dem Benannten Sein zukommt, daß es "ist". Sie bezieht sich strenggenommen auf dieses Wirklichsein. Aber jedes Seiende ist bestimmte, geprägte Wirklichkeit, jedem ist ein "Wassein" zuzusprechen. Das Wort, welches diesen bejahenden Gedanken bezeichnet, ist "Wesen" ("res", "Ding"). Ferner ist jedes Seiende schon immer verstanden als etwas, dem als solchem das Geteiltsein abzusprechen ist. Diese Verneinung des Geteiltseins ist gemeint mit dem Wort "Eines" ("unum "). Wird ein Seiendes im Hinblick auf das, was es nicht selbst ist, verstanden, dann wird dabei ein Getrenntsein erfaßt. Dieses wird durch das Wort "anderes" (aliquid = aliud quid) benannt. Es kann auch das Gegenteil des Getrenntseins in den Blick kommen: das übereinkommen oder übereinstimmen. Eine allgemeine, jedwedem Seienden eignende Seinsweise kann dies jedoch nur sein, wenn es etwas gibt, das für jedes Seiende offen ist, so daß es mit ihm zusammenkommen oder übereinstimmen kann. Thomas führt im Anschluß an Aristoteles diese Bedingung an, nämlich die Existenz einer Seele. Als Ziel einer Strebebewegung der Seele wird ein Seiendes benannt, wenn man es als ein "Gutes" ("bonum") bezeichnet. Jedes Seiende ist nun mögliches Ziel eines solchen Strebens und heißt also zu Recht ein Gutes. Die Seele kann auch als erkennende das Getrenntsein von einem Seienden überwinden. In dieser Übereinstimmung eines Seienden mit der erkennenden Seele liegt der Kern der Bedeutung des Wortes "Wahres" ("verum"). Diese kann schon jetzt etwas genauer bestimmt werden, und zwar durch eine Besinnung auf das Erkennen. Jedem Erkennen liegt eine Anpassung des Erkennenden an das Erkannte zugrunde. Letzteres geht also der Sache nach dieser Anpassung vorauf, die wiederum die Erkenntnis zur Folge hat. So erleidet unter dem Einfluß eines farbigen Gegenstandes der Gesichtssinn eine Zustandsänderung, durch die er auf eine ihm gemäße Weise der Farbe angepaßt wird. Diese Anpassung ruft dann eine Wahrnehmung hervor. Je vollständiger die Anpassung ist, um so deutlicher ist die Wahrnehmung. Die Begegnungeines Seiendenmit dem Ver-
12 Einleitung XVII stand, die zu verstehendem Erkennen führt, ist entsprechend eine Angleichung beider. Diese bildet den Sinn des Wortes "Wahres", der durch das Wort "Seiendes" noch nicht ausgedrückt ist und der als grundlegendes Verhältnis des Seienden zum Verstand deren Zusammenstimmen (concordia) enthält. Das Erkennen ist die von jedermann bewußt erlebte Wirkung der Angleichung. Diese erste Erschließung des Sinnes des Wortes "Wahres" bringt demnach dreierlei vor den Blick: Als Grundlage das, wodurch ein Seiendes ist und wodurch es ein Was ist, zusammenfas~end "Seiendheit" genannt. In ihr kommt der Sinn von "Wahres" allerdings noch nicht zum Ausdruck. Zweitens die Seinsweise, die in der Angleichung von Ding und Verstand besteht. Drittens die unmittelbare Wirkung dieser Angleichung, nämlich die Erkenntnis. Der Zusammenhang von Seiendheit, Wahrheit und Erkennen ist so eng, daß die Erläuterung des Begriffs der Wahrheit bei jedem ansetzen kann. Das zeigen die überlieferten Beschreibungen und Erklärungen durch Augustinus, Avicenna, Isaak Israeli, Anselm von Canterbury, Aristoteles und Hilarius von Poitiers. Zweiter Artikel: Findet sich Wahrheit ursprünglicher im Verstand als in den Dingen? Wenn Wahrheit in einer Angleichung von Seiendem und Verstand besteht, wenn also von beidem gesagt werden kann, es käme ihm Wahrheit zu, bleibt zu klären, ob es dabei eine Ordnung gibt. Ziel des Artikels ist diese Klärung. Wird ein und dasselbe Prädikat von verschiedenartigen Dingen ausgesagt, ist immer zu untersuchen, ob und wie die Prädikationen miteinander zusammenhängen. Das klassische Beispiel ist seit Aristoteles die Verwendung des Prädikats "gesund". Es zeigt, daß die Ordnung verschiedener Bedeutungen sich nicht nach der Beziehung von Ursache und Wirkung richten muß. Sie richtet sich vielmehr danach, welcher Sinn der Prädikationen der ursprüngliche ist. Ob Wahrheit ursprünglicher eine Seinsweise des Verstandes oder eine solche der Dinge ist, läßt sich mittels einer Besinnung auf den Erkenntnisvorgang klären. Wahres ist
13 XVIII Albert Zimmermann ein Ding aufgrund seiner Hinordnung auf die erkennende Seele. Erkenntnis vollendet sich nun dadurch, daß das Ding als erkanntes in der Seele ist. Das kann es nur insoweit, als es in die Seele aufgenommen ist, also deren Eigenart annimmt. Somit gibt es die Angleichung zunächst und ursprünglich in der Seele. Das Streben hingegen ist eine Bewegung, die zwar eine Erkenntnis des Erstrebten voraussetzt, die aber nicht auf das Ding als in der Seele anwesendes gerichtet ist, sondern als etwas dem Erkennen Vorgegebenes und davon Unabhängiges. Aristoteles vergleicht den Verlauf der Seelentätigkeiten deshalb mit einem Kreislauf. Es wird auch verständlich, wie er das Wahre und das Gute und ihre Gegensätze der Seele und den Dingen zuordnet. Die Seinsweise des Wahren ist ursprünglich eine solche des Verstandes, während sie von den Dingen aufgrund ihrer Hinordnung auf die wirkliche Angleichung in der Seele ausgesagt wird. Nun ist der Verstand in zwei Weisen tätig, nämlich als theoretischer und als praktischer, je nachdem ob das Ziel eine Erkenntnis um ihrer selbst willen oder das Hervorbringen von etwas ist. Die Rollen, die bei diesen Verstandestätigkeiten Ding und Verstand spielen, werden mittels der Begriffe des Maßes (Maßstabs) und des Gemessenen erläutert. Ein Ding ist insofern etwas Gemessenes, als es durch ein anderes - sein Maß - bestimmt ist. Maß ist etwas insofern, als es bei einem anderen eine Bestimmung bewirkt. Demnach ist der praktische, entwerfende Verstand Maß der Dinge, die durch seinen Entwurf entstehen, während der theoretische Verstand die Dinge, die unabhängig von seiner Tätigkeit bestehen und die er bloß erkennt, zu seinem Maß hat. Nun verdanken alle Dinge der Natur ihr Sein dem schöpferischen Entwurf des göttlichen Verstandes, was hier ohne philosophische Begründung vorausgesetzt ist. Sie sind also im Hinblick auf den göttlichen Verstand etwas Gemessenes, während dieser ihr Maß ist. Da der göttliche Verstand selbst nicht von irgendetwas abhängig ist, ist er ausschließlich maßgebend. Das Verhältnis von Dingen und Verstand läßt sich demnach wie folgt kennzeichnen: 1. Der göttliche Verstand ist
14 Einleitung XIX maßgebend und nicht gemessen. 2. Ein Ding, das vom praktischen menschlichen Verstand unabhängig ist, ist sowohl maßgebend wie gemessen, maßgebend nämlich für die theoretische Erkenntnis durch den menschlichen Verstand, gemessen durch den göttlichen Verstand. 3. Der menschliche Verstand ist sowohl gemessen wie maßgebend, gemessen nämlich durch die Dinge, die er nicht bewirkt, maßgebend für die von ihm entworfenen "künstlichen" Dinge. Somit läßt sich auch Wahrheit als Seinsweise der Dinge genauer bestimmen. Ein Ding der Natur ist sowohl gemessen wie auch maßgebend und darum in zweifachem Sinn ein Wahres: Es ist Wahres als dem göttlichen Verstand angeglichenes. Diese Angleichung rührt vom göttlichen Verstand her und kommt ihm deshalb primär zu. Sie kommt aber auch dem Seienden zu, insofern es dem Entwurf des Schöpfers gemäß ist und wirkt. Die schon erwähnten Erklärungen von Wahrheit, in denen der Hinweis auf ein Verstandesvermögen nicht ausdrücklich enthalten ist, lassen sich nun besser verstehen; denn jedes Seiende ist als solches etwas dem maßgebenden göttlichen Verstand Entsprechendes. Jedes Seiende ist auch maßgebend für den menschlichen Verstand, insofern er theoretisch ist. Die Angleichung liegt darin, daß ein Ding eine Erkenntnis seiner selbst bewirken kann, bei der es also maßgebend ist. Diesem Sinn des Wortes "Wahrheit" entspricht auch ein solcher von "Falschheit". Ein Ding heißt "falsches", insofern es - wie Arjstoteles sagt - "geeignet ist, sehen zu lassen, was es nicht ist oder wie es nicht ist". (Näheres in Art. 10.) Die Wahrheit eines Dinges als Angleichung an den maßgebenden göttlichen Verstand geht der Sache nach der Wahrheit als Angleichung des Dinges an den menschlichen Verstand vorauf, sie ist also sachlich "früher". Ein Ding der Natur ist also ein Wahres zuerst, insofern es in seiner Seiendheit durch den göttlichen Verstand bestimmt ist. Diese Angleichung ist eine mit ihm stets und beständig verwirklichte Seinsweise. In zweiter Linie ist es ein Wahres, insofern es sich dem menschlichen Verstehen erschließen kann. Angleichung an den menschlichen Verstand ist etwas, das als etwas Verwirklichbares mit dem Ding gegeben ist.
15 XX Albert Zimmermann Aus dieser Ordnung ergibt sich eine Folgerung: Gäbe es keinen menschlichen Verstand, dann käme den Dingen die Seinsweise der Wahrheit dennoch zu, da sie ja dem göttlichen Verstand auf jeden Fall entsprechen. Aus der Annahme, es gäbe weder einen menschlichen noch den göttlichen Verstand und es gäbe gleichwohl Dinge (eine Annahme, die allerdings unhaltbar ist, da es ohne Schöpfer gar nichts gäbe), folgte, daß es die Seinsweise der Wahrheit gar nicht mehr gäbe. Dieses "Gedankenexperiment" macht also deutlich, was sich als erstes bei der Erschließung des Sinnes von Wahrheit ergab: Wahrsein ist nicht denkbar und nicht aussagbar, ohne daß dabei die Hinordnung des Seienden auf ein Verstandesvermögen im Blick steht. Dritter Artikel: Gibt es Wahrheit nur im zusammensetzenden und trennenden Verstand? In diesem Artikel wird die Wahrheit als Seinsweise des theoretischen Verstandes genauer bestimmt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Akten des theoretischen Verstandes, nämlich das Gewahren oder die Erfassung von etwas und das Urteilen. Das Erkennen findet sein Ende stets in einem Urteil, und dieses besteht in einem Zusammensetzen oder einem Trennen, wie die Struktur seines sprachlichen Zeichens, des Satzes, verrät. Voraussetzung für das Urteilen ist, daß das, was miteinander zusammengesetzt oder voneinander getrennt wird, vom Verstand aufgenommen oder erfaßt ist. Das bloße Erfassen von Inhalten istjedoch nicht hinreichend für den Urteilsakt, der somit vom Akt der Erfassung zu unterscheiden ist. Gefragt wird nun, ob nur dem urteilenden Verstand die Seinsweise der Wahrheit zukommt. Angleichung von Verstand und Ding besagt nicht, beide würden oder seien identisch. Als eine Weise der Gleichheit setzt die Angleichung vielmehr die Verschiedenheit des einander Angeglichenen voraus. Allerdings muß diese Verschiedenheit Raum für Übereinstimmung lassen. Daß Ding und Verstandesvermögen zwei voneinander getrennte Seiende sind, reicht nicht aus, um die Gleichheit, die in der Wahrheit liegt, zu begründen. Der Verstand muß über sein
16 TEXT MIT ÜBERSETZUNG QUAESTIONES DISPUTATAE DE VERITATE VON DER WAHRHEIT QUAESTIO PRIMA ERSTE FRAGE
17 QUAESTIONES DISPUTATAE DE VERITATE QUAESTIO PRIMA Articulus primus Quaestio est de veritate. Et primo quaeritur quid est veritas? Videtur autem quod verum sit omnino idem quod ens: Augustinus in libro Soliloquiorum 1 dieit quod nverum est id quod est«; sed id quod est nihil est nisi ens; ergo verum signifieat omnino idem quod ens. 3. Praeterea, quaeeumque differunt ratione ita se habent quod unum illorum potest intelligi sine altero: unde Boetius in libro De hebdomadibus 2 dieit quod potest intelligi Deus esse si separetur per intelleeturn paulisper bonitas eius; ens autem nullo modo potest intelligi si separetur ve rum quia per hoe intelligitur quod verum est; ergo verum et ens non differunt ratione. 6. Praeterea, quaeeumque non sunt idem aliquo modo differunt; sed verum et ens nullo modo differunt, quia non differunt per essentiam eum omne ens per essentiam suam sit verum, nee differunt per aliquas differentias quia oporteret quod in aliquo eommuni genere eonvenirent; ergo sunt omnino idem. 7. Item, si non sunt omnino idem oportet quod verum aliquid super ens addat; sed nihil addit verum super ens eum sit etiam in plus quam ens. Quod patet per Philosophum in IV Metaphysieae 3, ubi dieit quod verum diffinientes dieimus, 'quod dicimus esse quod est aut non esse quod non est', et sie verum includit ens et non ens; ergo ve- I II, c. 8, p. 134/19. 2 Quomodo substantiae... ed. Peiper, p. 171/85. 3 c. 16, 101lb25.
18 VON DER WAHRHEIT ERSTE FRAGE Erster Artikel Gegenstand der Frage ist die Wahrheit. Zuerst wird gefragt: Was ist Wahrheit? Es scheint aber, als sei Wahres ganz dasselbe wie Seiendes. 1. Augustinus 1 sagt in dem Buch "Alleingespräche": "Wahres ist das, was ist". Nur Seiendes ist aber das, was ist. Also bedeutet "Wahres" ganz dasselbe wie "Seiendes". 3. Was sich begrifflich voneinander unterscheidet, verhält sich so zueinander, daß eines davon ohne das andere verstanden werden kann. Daher sagt Boethius 2 im Buch "De hebdomadibus", man könne Gottes Sein verstehen, wenn man seine Gutheit einen Augenblick mittels des Verstandes abtrennt. Seiendes aber kann auf keine Weise verstanden werden, indem Wahres abgetrennt wird. Es wird ja nur dadurch verstanden, daß es Wahres ist. Wahres und Seiendes unterscheiden sich also nicht begrifflich voneinander. 6. Was nicht miteinander identisch ist, unterscheidet sich irgendwie voneinander. Wahres und Seiendes aber unterscheiden sich in keiner Weise voneinander; denn sie unterscheiden sich nicht durch die Wesenheit, da jedes Seiende durch seine Wesenheit ein Wahres ist; sie unterscheiden sich auch nicht durch irgendwelche Artunterschiede; denn dann müßten sie in einer gemeinsamen Gattung übereinkommen. Also sind sie ganz und gar dasselbe. 7. Wenn sie nicht ganz und gar dasselbe sind, muß Wahres etwas zu Seiendem hinzufügen. Wahres fügt aber Seiendem nichts hinzu, da es sich sogar weiter erstreckt als Seiendes. Dies erhellt durch den Philosophen 3, der im 4. Buch der Metaphysik sagt: Wir definieren, was Wahres ist, "indem wir sagen: was ist, ist, oder was nicht ist, ist nicht",
19 4 Articulus primus rum non addit aliquid super ens, et sie videtur omnmo idem esse verum quod ens. SED CONTRA, 'nugatio est eiusdem inutilis repetitio'; si ergo verum esset idem quod ens, esset nugatio dum dicitur ens verum, quod falsum est; ergo non sunt idem. RESPONSIO. Dicendum quod sicut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in aliqua principia per se intellec tui nota ita investigando quid est unumquodque, alias utro bique in infinitum iretur, et sie periret omnino scientia et cognitio rerum; illud autem quod primo intellectus conci pit quasi notissimum et in quod conceptiones omnes resolvit est ens, ut Avicenna dicit in principio suae Metaphysi cae 4 ; unde oportet quod omnes aliae conceptiones intellectus accipiantur ex additione ad ens. Sed enti non possunt addi aliqua quasi extranea per modum quo differentia additur generi vel accidens subiecto, quia quaelibet natura est essentialiter ens, unde probat etiam Philosophus in 111 Metaphysicae5 quod ens non potest esse genus; sed secundum hoc aliqua dicuntur addere super ens in quantum expri munt modum ipsius entis qui nomine entis non exprimitur, quod dupliciter contingit. Uno modo ut modus expressus sit aliquis specialis modus entis; sunt enim diversi gradus entitatis secundum quos accipiuntur diversi modi essendi et iuxta hos modos accipiuntur diversa rerum genera: sub stantia enim non addit super ens aliquam differentiam quae designet aliquam naturam superadditam enti sed nomine substantiae exprimitur specialis quidam modus essendi, scilicet per se ens, et ita est in aliis generibus. 4 I, c. V, p. 31/ c. 8, 998b22.
20 Erster Artikel 5 und somit schließt Wahres Seiendes und Nichtseiendes ein. Also fügt Wahres zu Seiendem nicht etwas hinzu, und somit scheint Wahres ganz und gar dasselbe zu sein wie Seiendes. DAGEGEN: Eine Tautologie ist die unnütze Wiederholung desselben. Wäre also Wahres dasselbe wie Seiendes, wäre es eine Tautologie, von wahrem Seienden zu sprechen. Das ist jedoch falsch. Also sind sie nicht dasselbe. ANTWORT. Wie es bei beweisbaren Sätzen ein Zurückführen auf gewisse durch sich dem Verstand bekannte Prinzipien geben muß, so auch bei jeder Erforschung dessen, was etwas ist. Sonst verliefe man sich in beiden Bereichen ins Unbegrenzte, und so verlören Wissenschaft und Erkenntnis der Dinge sich völlig. Seiendes aber ist jenes, was der Verstand zuerst als das ihm Bekannteste begreift und in das er alles Begriffene auflöst, wie Avicenna 4 zu Beginn seiner "Metaphysik" sagt. Deshalb müssen sich alle anderen Begriffe des Verstandes aus einer Hinzufügung zu dem des Seienden auffassen lassen. Zu "Seiendes" kann jedoch nicht etwas hinzugefügt werden wie ein außerhalb seiner liegender Gehalt, so wie etwa eine Artbestimmung zur Gattung oder ein Akzidens zu seinem Träger hinzukommt; denn jedwede Wirklichkeit ist wesenhaft Seiendes. Darum beweist auch der Philosoph im 3. Buch der "Metaphysik", daß das Seiende keine Gattung sein kann. Man sagt vielmehr, dem Begriff "Seiendes" werde etwas hinzugefügt, insofern dieses eine Weise des Seienden ausdrückt, die durch das Wort "Seiendes" nicht ausgedrückt ist. Dies ist auf zweifache Art der Fall: Erstens: Es wird eine gewisse besondere Seinsweise ausgedrückt. Es gibt nämlich verschiedene Grade der Seiendheit, denen gemäß man verschiedene Weisen von seiend erfaßt, und entsprechend diesen Weisen werden die verschiedenen Gattungen der Dinge aufgefaßt. Der Begriff der Substanz fügt nämlich zu dem des Seienden nicht irgendein unterscheidendes Merkmal hinzu, das eine zum Seienden hinzukommende Wirklichkeit bedeutet. Vielmehr drückt man mittels des Wortes "Substanz" eine gewisse besondere Weise zu sein aus, nämlich "an sich seiend"; entsprechend ist es mit den anderen Kategorien.
21 6 Articulus primus Alio rnodo ita quod rnodus expressus sit rnodus generalis eonsequens ornne ens, et hie rnodus duplieiter aeeipi potest: uno rnodo secundurn quod eonsequitur unurnquodque ens in se, alio rnodo seeundurn quod eonsequitur unurn ens in ordine ad aliud. Si prirno rnodo, hoe est duplieiter quia vel exprirnitur in ente aliquid affirmative vel negative; non autern invenitur aliquid affirmative dieturn absolute quod possit aeeipi in ornni ente nisi essentia eius seeundurn quam esse dieitur, et sie irnponitur hoe nornen res, quod in hoe differt ab ente, seeundurn Avieennam in prineipio Metaphysieae6, quod ens surnitur ab aetu essendi sed nornen rei exprirnit quiditatern vel essentiam entis; negatio autern eonsequens ornne ens absolute est indivisio, et hane exprirnit hoe nornen unurn: nihil aliud enirn est unurn quam ens indivisurn. Si autern rnodus entis aeeipiatur seeundo rnodo, seilieet seeundurn ordinern unius ad alterurn, hoe potest esse duplieiter. Uno rnodo seeundurn divisionern unius ab altero et hoe exprirnit hoe nornen aliquid: dieitur enirn aliquid quasi aliud quid, unde sieut ens dieitur unurn in quanturn est indivisurn in se ita dieitur aliquid in quanturn est ab aliis divisurn. Alio rnodo seeundurn eonvenientiam unius entis ad aliud, et hoe quidern non potest esse nisi aeeipiatur aliquid quod naturn sit eonvenire eurn ornni ente; hoe autern est anirna, quae»quodam rnodo est ornnia«, ut dieitur in 111 De anirna 7 : in anirna autern est vis eognitiva et appetitiva; eonvenientiam ergo entis ad appetiturn exprirnit hoe nornen bonurn, unde in prineipio Ethieorurn 8 dieitur quod» bonurn est quod ornnia appetunt<<, eonvenientiam vero entis ad intelleeturn exprirnit hoe nornen verurn. c. 5, p. 34/ c. 8, 43lb21. 8 I,c.l, 1094a3.
22 Erster Artikel 7 Zweitens: Es wird eine allgemeine, jedwedem Seienden folgende Seinsweise ausgedrückt. Diese kann zweifach aufgefaßt werden: Erstens insofern sie jedem Seienden in sich genommen folgt. Zweitens insofern sie dem einen Seienden in dessen Hinordnung auf ein anderes folgt. Auf die erste Art geschieht dies zweifach; denn es läßt sich von einem Seienden in sich genommen etwas bejahend oder verneinend ausdrücken. Das bejahend von einem Seienden ohne Hinblick auf anderes Ausgesagte, das sich in jedwedem Seienden erfassen läßt, ist aber nur dessen Wesenheit, gemäß welcher man ihm Sein zuspricht. So wird ihm der Name "Wesen" ("Ding") beigelegt. Er unterscheidet sich von "Seiendes" gemäß Avicenna zu Beginn der "Metaphysik" darin, daß "Seiendes" vom Akt des Seins her genommen wird, während das Wort "Wesen" die Washeit oder Wesenheit eines Seienden ausdrückt. Die Verneinung aber, die jedem Seienden ohne Hinsicht auf anderes genommen folgt, ist die Nichtgeteiltheit. Diese drückt das Wort "Eines" aus; denn Eines ist nichts anderes als ein ungeteiltes Seiendes. Nimmt man aber eine Seinsweise auf die zweite Art, nämlich gemäß der Hinordnung des einen zum anderen, so kann das zweifach geschehen. Erstens gemäß der Teilung des einen vom anderen, und das drückt das Wort "etwas" ("aliud quid") aus; "etwas" ("aliquid") heißt nämlich soviel wie "ein anderes Was" ("aliud quid"). Wie daher ein Seiendes "eines" genannt wird, insofern es in sich ungeteilt ist, so wird es "etwas" genannt, insofern es von anderen abgeteilt ist. Zweitens gemäß dem übereinstimmen eines Seienden mit einem anderen. Möglich ist das jedoch nur, wenn etwas angenommen wird, das mit jedem Seienden übereinstimmen kann. Dies aber ist die Seele, welche "gewissermaßen alles ist", wie es im 3. Buch "Von der Seele" heißt. In der Seele aber gibt es Erkenntnis- und Strebekraft. Das übereinstimmen eines Seienden mit dem Streben drückt also das Wort "Gutes" aus. Daher heißt es am Anfang der Ethik: "Das Gute ist, wonach alles strebt". Das übereinstimmen jedoch eines Seienden mit dem Verstand drückt das Wort "Wahres" aus.
23 8 Articulus primus Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem cognitam, ita quod assimilatio dicta est causa cognitionis, sicut visus per hoc quod disponitur secundum speciem coloris cognoscit colorem: prima ergo comparatio entis ad intelleeturn est ut ens intellectui concordet, quae quidem concordia adaequatio intellectus et rei dicitur, et in hoc formaliter ratio veri perficitur. Hoc est ergo quod addit verum super ens, scilicet conformitatem sive adaequationem rei et intellectus, ad quam conformitatem ut dieturn est, sequitur cognitio rei: sie ergo entitas rei praecedit rationem veritatis sed cognitio est quidam veritatis effectus. Secundum hoc ergo veritas sive verum triplieher invenitur diffiniri. Uno modo secundum illud quod praecedit rationem veritatis et in quo verum fundatur, et sie Augustinus diffinit in libro Soliloquiorum 9 )) Verum est id quod est«, et Avicenna in sua Metaphysica10 ))Veritas cuiusque rei est proprietas sui esse quod stabilitum est ei «, et quidam sic 11 )) Verum est indivisio esse et quod est«. Alio modo diffinitur secundum id in quo formaliter ratio veri perficitur, et sie dicit Ysaac 12 quod ))Veritas est adaequatio rei et intellectus«, et Anselmus in libro De veritate13 ))Veritas est rectitudo sola mente perceptibilis«,- rectitudo enim ista secundum adaequationem quandam dicitur -; et Philosophus dicit IV Metaphysicae14 quod diffinientes verum dicimus ' cum dicitur esse quod est aut non esse quod non est'. Tertio modo diffinitur verum secundum effectum consequentem, et sie dicit Hilarius15 quod ))Verum est declarativum et manife~tativum esse«, et Augustinus in libro De vera religione16 )) Veritas est qua osten- II, c. 8, p. 134/ VIII, c. 6, p. 413/ Cf. not. in Ed. Leonina, p Cf. not. in Ed. Leonina, p c. 11, ed. Schmitt, p c. 16, 10llb De trinitate V, 3, p c. 36, p. 230/15-16.
24 Erster Artikel 9 Jede Erkenntnis aber vollzieht sich durch eine Anpassung des Erkennenden an das erkannte Ding, und zwar derart, daß die besagte Anpassung Ursache der Erkenntnis ist. Der Gesichtssinn beispielsweise erkennt eine Farbe dadurch, daß er in einen der Art dieser Farbe gemäßen Zustand gerät. Das erste Verhältnis des Seienden zum Verstand besteht also darin, daß Seiendes und Verstand zusammenstimmen, welche Zusammenstimmung Angleichung des Verstandes und des Dinges genannt wird, und darin vollendet sich der Sinngehalt von "Wahres". Dies also ist es, was "Wahres" zu "Seiendes" hinzufügt: die Gleichförmigkeit oder Angleichung eines Dinges und des Verstandes. Dieser Gleichförmigkeit folgt, wie gesagt, die Erkenntnis des Dinges. So also geht die Seiendheit eines Dinges dem Sinngehalt von Wahrheit vorauf, die Erkenntnis aber ist eine gewisse Wirkung der Wahrheit. Demgemäß findet man, daß Wahrheit oder Wahres auf dreifache Art definiert werden. Erstens gemäß dem, was dem Sinngehalt von Wahrheit voraufgeht und worin Wahres grundgelegt ist. So definiert Augustinus im Buch "Alleingespräche": "Wahres ist das, was ist", und Avicenna im 11. Buch der "Metaphysik": "Die Wahrheit jedweden Dinges ist die Eigenart seines Seins, welches ihm dauerhaft eignet", und ein gewisser Autor 5 so: "Das Wahre ist die Ungeteiltheit von Sein und dessen, was ist". Zweitens wird definiert gemäß dem, worin der Sinngehalt von "Wahres" seine vollendete Form erreicht. Und so sagt lsaak 6 : "Wahrheit ist die Angleichung eines Dinges und des Verstandes", und Anselm 7 im Buch: "Von der Wahrheit": "Wahrheit ist die Rechtheit, die nur durch den Geist erfaßt werden kann" - von dieser Rechtheit ist nämlich im Sinne einer gewissen Angleichung die Rede -;und der Philosoph sagt im 4. Buch der Metaphysik: Wir definieren das Wahre, indem wir sagen: "wenn man sagt was ist, ist, oder was nicht ist, ist nicht". Drittens wird das Wahre definiert gemäß der ihm folgenden Wirkung, und so sagt Hilarius 8 : "Wahres zeigt Sein an und macht es augenscheinlich", und Augustinus im Buch: "Von der wahren Religion": "Wahrheit ist, wodurch sich
25 10 Articulus prirnus ditur id quod est«, et in eodern libro 17,, Veritas est seeundurn quam de inferioribus iudieamus«. 1. Ad prirnurn ergo dieendurn quod diffinitio illa Augustini datur de veritate seeundurn quod habet fundamenturn in re et non seeundurn id quod ratio veri eornpletur in adaequatione rei ad intelleeturn. - Vel dieendurn quod eurn dieitur verurn est id quod est, Ii est non aeeipitur ibi seeundurn quod signifieat aeturn essendi sed seeundurn quod est nota intelleetus eornponentis, prout seilieet affirrnationern propositionis signifieat, ut sit sensus: verurn est id quod est, id est eurn dieitur esse de aliquo quod est, ut sie in idern redeat diffinitio Augustini eurn diffinitione Philosophi supra indueta. 3. Ad tertiurn dieendurn quod aliquid intelligi sine altero potest aeeipi duplieiter. Uno rnodo quod intelligatur aliquid altero non intelleeto, et sie ea quae ratione differunt ita se habent quod unurn sine altero intelligi potest. Alio rnodo potest aeeipi aliquid intelligi sine altero, quod intelligitur eo non existente, et sie ens non potest intelligi sine vero, quia ens non potest intelligi sine hoe quod eoneordet vel adaequetur intelleetui; sed non tarnen oportet ut quieurnque intelligit rationern entis intelligat veri rationern, sieut nee quieurnque intelligit ens intelligit intelleeturn agentern, et tarnen sine intelleetu agente nihil intelligi potest. 6. Ad sexturn dicendurn quod verurn et ens differunt ratione per hoe quod aliquid est in ratione veri quod non est in ratione entis, non autern ita quod aliquid sit in ratione entis quod non sit in ratione veri; unde nee per essentiam 17 c. 31, p. 225/20-23.
26 Erster Artikel ]] das zeigt, was ist", und in demselben Buch: "Wahrheit ist das, demgemäß wir über die niederen Dinge urteilen". Zum ersten (Einwand) ist also zu sagen: Jene Definition des Augustinus betrifft die Wahrheit, insofern diese eine Grundlage im Ding hat, und bezieht sich nicht darauf, daß sich der Sinngehalt des Wahren in der Angleichung des Dinges an den Verstand vollendet. Oder: Wenn es heißt: "Wahres ist das, was ist", dann ist das (zweite) "ist" hier nicht aufgefaßt, insofern es einen Akt des Seins bezeichnet, sondern insofern es Zeichen des zusammensetzenden Verstandes ist, nämlich insofern es die Behauptung eines Satzes bezeichnet. Somit ist der Sinn: Wahres ist das, was ist, nämlich wenn man von etwas, das ist, sagt, daß es ist, so daß die Definition des Augustinus auf dasselbe hinausläuft wie die oben angeführte des Philosophen. Zum dritten: "Etwas ohne ein anderes verstehen" kann zweifach aufgefaßt werden. Erstens: Man versteht etwas, während man das andere nicht auch versteht. Entsprechend verhält sich, was begrifflich voneinander verschieden ist, so zueinander, daß das eine ohne das andere verstanden werden kann. Zweitens: Daß etwas ohne ein anderes verstanden wird, kann man so auffassen: Das eine wird verstanden, während es das andere nicht gibt. Auf diese Weise kann man Seiendes nicht ohne Wahres verstehen; denn Seiendes kann nicht verstanden werden, ohne daß es mit dem Verstand zusammenstimmt oder ihm angeglichen ist. Es ist dennoch nicht notwendig, daß jeder, der den Sinngehalt von "Seiendes" versteht, auch den von "Wahres" versteht, wie ja auch nicht jeder, der Seiendes versteht, den tätigen Verstand versteht, obwohl ohne den tätigen Verstand nichts verstanden werden kann. Zum sechsten: Wahres und Seiendes unterscheiden sich begrifflich dadurch, daß im Begriff des Wahren etwas enthalten ist, das nicht in dem des Seienden enthalten ist, nicht aber derart, daß im Begriff des Seienden etwas enthalten wäre, das nicht in dem des Wahren enthalten wäre. Daher gibt es keinen Wesensunterschied zwischen ihnen,
27 12 Articulus secundus differunt nee differentiis oppositis ab invieem distinguuntur. 7. Ad septimum dieendum quod verum non est in plus quam ens: ens enim aliquo modo aeeeptum dieitur de non ente seeundum quod non ens est apprehensum ab intelleetu, unde in IV Metaphysieae dieit Philosophus 18 quod negatio vel privatio entis uno modo dieitur ens, unde Avieenna etiam dieit in prineipio suae Metaphysieae 19 quod non potest formari enuntiatio nisi de ente quia oportet illud de quo propositio fomatur esse apprehensum ab intelleetu. Ex quo patet quod omne verum est aliquo modo ens. 1. Ad primum vero eorum quae eontra obiciuntur dieendum quod ideo non est nugatio eum dieitur 'ens verum' quia aliquid exprimitur nomine veri quod non exprimitur nomine entis, non propter hoe quod re differant. Articulus secundus Seeundo quaeritur utrum veritas prineipalius inveniatur in intelleetu quam in rebus. Et videtur quod non: verum enim, ut dieturn est, eonvertitur eum ente; sed ens prineipalius invenitur in rebus quam a}jud animam; ergo et verum. 3. Praeterea, omne quod est in aliquo eonsequitur id in quo est; si ergo veritas prineipaliter est in anima, tune iudieium de veritate erit seeundum aestimationem animae, et ita redibit antiquorum philosophorum error qui dieebant omne quod quis opinatur in intelleetu esse verum et duo eontradietoria simul esse vera, quod est absurdum. 18 c. 1, 1003b5... c. 6, p. 36/92-95.
28 Zweiter Artikel 13 und sie sind auch nicht aufgrund einander entgegengesetzter Artunterschiede voneinander verschieden. Zum siebten: Wahres erstreckt sich nicht weiter als Seiendes. "Seiendes", in einer gewissen Weise aufgefaßt, wird nämlich (auch) von Nichtseiendem gesagt, insofern Nichtseiendes vom Verstand erkannt wird. Daher sagt der Philosoph im 4. Buch der Metaphysik, daß Vemeinung oder Mangel des Seienden in einer gewissen Weise "Seiendes" genannt wird. Aus demselben Grund sagt auch Avicenna am Anfang seiner "Metaphysik", es lasse sich eine Aussage nur über etwas Seiendes bilden, weil das Subjekt der Aussage vom Verstand erkannt sein muß. Woraus offenkundig ist, daß jedes Wahre in gewisser Weise Seiendes ist. Zum ersten Gegeneinwand: Der Ausdruck "wahres Seiendes" ist keine Tautologie, und zwar deswegen nicht, weil durch das Wort "Wahres" etwas ausgedrückt wird, das durch "Seiendes" nicht ausgedrückt ist, nicht aber deswegen, weil Wahres und Seiendes der Wirklichkeit nach verschieden wären. Zweiter Artikel Zweitens wird gefragt: Findet sich Wahrheit ursprünglicher im Verstand als in den Dingen? Es scheint nicht. 1. "Wahres" nämlich ist, wie gesagt, mit "Seiendes" vertauschbar. Seiendes aber findet man ursprünglicher unter den Dingen als in der Seele. Also auch Wahres. 3. Ein jedes, das in etwas ist, richtet sich nach dem, worin es ist. Wenn also Wahrheit ursprünglich in der Seele ist, dann wird das Urteil über die Wahrheit gemäß der Einschätzung durch die Seele gefällt. So wird der Irrtum der alten Philosophen wiederkehren, die sagten, alles, was jemand in seinem Verstand wähnt, sei wahr, und von einander Widersprechendem sei beides zugleich wahr. Das ist ungereimt.
29 ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS 1. Aurelius Augustinus von Tagaste ( ), Bischof von Hippo, einer der einflußreichen Kirchenväter. Seine zahlreichen Werke prägten vor allem im Mittelalter bedeutende Denker und deren Schulen. Die hier zitierte Schrift entstand vor 387, dem Jahr seiner Bekehrung zum Christentum. 2. Boethius, Anicius Manlius Severinus ( ) ist als Vermittler der antiken Wissenschaft für den westeuropäischen mittelalterlichen Kulturkreis wichtig. Sein bekanntestes Werk: "De consolatione philosophiae" (Vom Trost der Philosophie). Die hier zitierte Schrift hat als vollständigen Titel: "Quomodo substantiae in eo quod sint, bonae sint, cum non sint substantialia bona". 3. Der "Philosoph" ist Aristoteles ( ). Er erhielt im Mittelalter diesen Ehrentitel, weil sein Werk den Gelehrten nachhaltige Impulse gab und in vielem als Maßstab angesehen wurde. Die hier erwähnte Stelle gilt als klassische Beschreibung des Sinnes von "wahr". - Thomas zitiert meistens Texte des Aristoteles, indem er nur den Buchtitel, nicht aber den Autor nennt_ Man wußte, worum es sich handelte. 4. Avicenna (Ibn Sina, ), bedeutender islamischer Gelehrter. Verfaßte zahlreiche Schriften, von denen vor allem das an der Systematik der aristotelischen Philosophie orientierte "Buch der Genesung" von den lateinischen Denkern hochgeschätzt wurde. In diesem Buch ist auch die hier erwähnte "Metaphysik" enthalten. 5. Es ist nicht bekannt, wer der erwähnte Autor ist_ Es gibt - außer im Sentenzenkommentar des Thomas - ein ähnliches Zitat in der von Philipp dem Kanzler (t 1236) verfaßten "Summa de bono." Auch Albert der Große erwähnt diese Definition, sagt aber zugleich, er kenne deren Herkunft nicht_ Er schreibt sie einmal dem Avicenna zu.- VgL die Anm. in der Leonina, S Isaak ben Salomon Israeli ( ), in Ägypten lebender jüdischer Arzt und Philosoph. Er wurde im 13. Jahrhundert oft zitiert, meistens aufgrund des von ihm verfaßten "Buches der Definitionen". - Allerdings wurde die ihm zugeschriebene Wahrheitsdefinition in seinen Werken nicht gefunden. Ihr Vorbild ist eher ein Text des Avicenna.- VgL die Anm. in der Leonina, S. 6.
2. Seinsweise, die in der Angleichung von Ding und Verstand besteht. 3. Unmittelbare Wirkung dieser Angleichung: die Erkenntnis.
 THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
Was ist ein Gedanke?
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Der Begriff der Wirklichkeit
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Der Begriff der Wirklichkeit Die letzte Vorlesung in diesem Semester findet am 18. Juli 2014 statt. Die erste Vorlesung im Wintersemester 2014/2015 findet am 10. Oktober
RENÉ DESCARTES. Meditationen. Übersetzt und herausgegeben von christian wohlers FELIX MEINER VERLAG HAMBURG
 RENÉ DESCARTES Meditationen Übersetzt und herausgegeben von christian wohlers FELIX MEINER VERLAG HAMBURG PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND 596 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
RENÉ DESCARTES Meditationen Übersetzt und herausgegeben von christian wohlers FELIX MEINER VERLAG HAMBURG PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND 596 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]
![Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] Wilhelm von Ockham. Lieferung 15 (1288/ ) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine]](/thumbs/54/35271140.jpg) Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Lieferung Wilhelm von Ockham (1288/ 1349) [Das Ersterkannte ist das Einzelne, nicht das Allgemeine] 2 Meine Antwort auf die Frage [ob das Ersterkannte der Vernunft, bezüglich der Erstheit des Entstehens,
Hilfsgerüst zum Thema:
 Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Lieferung 11 Hilfsgerüst zum Thema: Das Böse 1. Die Lehre des Averroes Alles Gute geht auf Gott zurück; Böses geht auf die Materie zurück. Die erste Vorsehung ist die Vorsehung Gottes. Er ist die Ursache,
Die Frage nach der Existenz Gottes
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Michael Bordt Aristoteles Metaphysik XII
 Michael Bordt Aristoteles Metaphysik XII WERKINTERPRETATIONEN Michael Bordt Aristoteles Metaphysik XII Einbandgestaltung: Peter Lohse, Büttelborn. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Michael Bordt Aristoteles Metaphysik XII WERKINTERPRETATIONEN Michael Bordt Aristoteles Metaphysik XII Einbandgestaltung: Peter Lohse, Büttelborn. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
DIE LOGIK ODER DIE KUNST DES DENKENS
 ANTOINE ARNAULD DIE LOGIK ODER DIE KUNST DES DENKENS 1972 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALT Hinweis 1 Erste Abhandlung, in welcher der Plan dieser neuen Logik aufgezeigt wird 2 Zweite
ANTOINE ARNAULD DIE LOGIK ODER DIE KUNST DES DENKENS 1972 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARMSTADT INHALT Hinweis 1 Erste Abhandlung, in welcher der Plan dieser neuen Logik aufgezeigt wird 2 Zweite
Gott als die Wahrheit selbst
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als die Wahrheit selbst 1. Gott ist die Wahrheit Augustinus Papst Leo I. (447): Kein Mensch ist die Wahrheit [... ]; aber viele sind Teilnehmer an der Wahrheit.
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Gott als die Wahrheit selbst 1. Gott ist die Wahrheit Augustinus Papst Leo I. (447): Kein Mensch ist die Wahrheit [... ]; aber viele sind Teilnehmer an der Wahrheit.
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin.
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Erste Lieferung. Zum Thema: Wahrheit und die Autoritäten Die theologsiche Hermeneutik der mittelalterlichen Scholastik
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung: Theologien im europäischen Mittelalter Die Vielfalt des Denkens in der Blütezeit der Theologie Erste Lieferung Zum Thema: Wahrheit und die
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung: Theologien im europäischen Mittelalter Die Vielfalt des Denkens in der Blütezeit der Theologie Erste Lieferung Zum Thema: Wahrheit und die
Richard Heinzmann. Philosophie des Mittelalters. Grundkurs Philosophie 7. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln
 Richard Heinzmann Philosophie des Mittelalters Grundkurs Philosophie 7 Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Vorwort 13 A. Griechische Philosophie und christliches Glaubenswissen 15 1. Zeitliche
Richard Heinzmann Philosophie des Mittelalters Grundkurs Philosophie 7 Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt Vorwort 13 A. Griechische Philosophie und christliches Glaubenswissen 15 1. Zeitliche
Erläuterung zum Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch
 TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin
 Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin Thomas von Aquin geb. 1225 in Roccasecca als Graf von Aquino gegen der Willen der Eltern wird er Dominikaner Schüler Alberts des Großen (Paris und Köln)
Gibt es Gott? Die fünf Wege des hl. Thomas von Aquin Thomas von Aquin geb. 1225 in Roccasecca als Graf von Aquino gegen der Willen der Eltern wird er Dominikaner Schüler Alberts des Großen (Paris und Köln)
Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich
 Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise
 Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise 1. Wie Richard Dawkins Gott versteht Dawkins: Ich möchte die Gotteshypothese, damit sie besser zu verteidigen ist, wie folgt definieren: Es gibt eine übermenschliche,
Lieferung 3 Hilfsgerüst zum Thema: Gottesbeweise 1. Wie Richard Dawkins Gott versteht Dawkins: Ich möchte die Gotteshypothese, damit sie besser zu verteidigen ist, wie folgt definieren: Es gibt eine übermenschliche,
Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5
 Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz
 Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation
 Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]
![[Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht] [Erste Intention: eine Intention, die nicht für eine Intention steht]](/thumbs/54/35269604.jpg) Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Aus der summa logicae des William von Ockham (ca. 1286 - ca. 1350) Übersetzung: Ruedi Imbach, nach Wilhelm von Ockham, Texte zur Theorie der Erkenntnis und der Wissenschaft, lat./dt., hg., übersetzt und
Vorlesung Teil III. Kants transzendentalphilosophische Philosophie
 Vorlesung Teil III Kants transzendentalphilosophische Philosophie Aufklärung: Säkularisierung III. Kant l âge de la raison Zeitalter der Vernunft le siécles des lumières Age of Enlightenment Aufklärung:
Vorlesung Teil III Kants transzendentalphilosophische Philosophie Aufklärung: Säkularisierung III. Kant l âge de la raison Zeitalter der Vernunft le siécles des lumières Age of Enlightenment Aufklärung:
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically
 Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Hermann Paul. Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften
 Hermann Paul Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften C e l t i s V e r l a g Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Hermann Paul Aufgabe und Methode der Geschichtswissenschaften C e l t i s V e r l a g Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
William K. Frankena. Ethik. Eine analytische Einführung 6. Auflage
 Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Ethik Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster Ann Arbor, USA Die Originalausgabe ist erschienen unter
Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Ethik Ethik Eine analytische Einführung 6. Auflage Herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster Ann Arbor, USA Die Originalausgabe ist erschienen unter
Die Physik des Klangs
 Die Physik des Klangs Eine Einführung von Klaus Gillessen STUDIO VERLAG Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;
Die Physik des Klangs Eine Einführung von Klaus Gillessen STUDIO VERLAG Bibliographische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;
Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise
 Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das. Dritte und letzte Lieferung. Zum Thema: Ist Gott das Glück?
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über das Glück Dritte und letzte Lieferung Zum Thema: Ist Gott das Glück? 1. Wer war Boethius? 2. Wie lautet die Glücksdefinition des Boethius?
Die Wunder Jesu. Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung.
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Die Wunder Jesu 1. Unsere Skepsis heute Eigentlich braucht der Glaube nicht mehr als die Auferstehung. 2. Wunder definiert als Durchbrechung eines Naturgesetzes Historisches
Anselm von Canterbury
 Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
Anselm von Canterbury *1034 in Aosta/Piemont Ab 1060 Novize, dann Mönch der Benediktinerabtei Bec ab 1078: Abt des Klosters von Bec 1093: Erzbischof von Canterbury *1109 in Canterbury 1076 Monologion (
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel. Sitzung vom 1. November 2004
 Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Sport. Silke Hubrig. Afrikanischer Tanz. Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik. Examensarbeit
 Sport Silke Hubrig Afrikanischer Tanz Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Sport Silke Hubrig Afrikanischer Tanz Zu den Möglichkeiten und Grenzen in der deutschen Tanzpädagogik Examensarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.
 Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Arbeitsbuch Mathematik
 Arbeitsbuch Mathematik Tilo Arens Frank Hettlich Christian Karpfinger Ulrich Kockelkorn Klaus Lichtenegger Hellmuth Stachel Arbeitsbuch Mathematik Aufgaben, Hinweise, Lösungen und Lösungswege 3. Auflage
Arbeitsbuch Mathematik Tilo Arens Frank Hettlich Christian Karpfinger Ulrich Kockelkorn Klaus Lichtenegger Hellmuth Stachel Arbeitsbuch Mathematik Aufgaben, Hinweise, Lösungen und Lösungswege 3. Auflage
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts
 Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts Willem Johannes Ouweneel EPV,online seit: 03.03.2006 soundwords.de/a1306.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel
Bibelstudium (5) Hauptgrundsätze: Zusammenhang eines Schriftworts Willem Johannes Ouweneel EPV,online seit: 03.03.2006 soundwords.de/a1306.html SoundWords 2000 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle Artikel
GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«
 ' < - ' ' - ' *,, GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«Mit einer Einführung von Enno Rudolph- >«.». -Klett-Cotta- INHALT Enno Rudolph Einführung XI EINLEITUNG 1. Die Gegenwärtigkeit des aristotelischen Denkens..
' < - ' ' - ' *,, GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«Mit einer Einführung von Enno Rudolph- >«.». -Klett-Cotta- INHALT Enno Rudolph Einführung XI EINLEITUNG 1. Die Gegenwärtigkeit des aristotelischen Denkens..
Logik, Sprache, Philosophie
 FRIEDRICH WAISMANN Logik, Sprache, Philosophie Mit einer Vorrede von Moritz Schlick herausgegeben von Gordon P. Baker und Brian McGuinness unter Mitwirkung von Joachim Schulte PHILIPP RECLAM ]UN. STUTTGART
FRIEDRICH WAISMANN Logik, Sprache, Philosophie Mit einer Vorrede von Moritz Schlick herausgegeben von Gordon P. Baker und Brian McGuinness unter Mitwirkung von Joachim Schulte PHILIPP RECLAM ]UN. STUTTGART
Die Macht der Reflexion. Zum Verhältnis von Kunst, Religion und Philosophie bei G.W.F. Hegel
 Geisteswissenschaft Daniel R. Kupfer Die Macht der Reflexion. Zum Verhältnis von Kunst, Religion und Philosophie bei G.W.F. Hegel Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Daniel R. Kupfer Die Macht der Reflexion. Zum Verhältnis von Kunst, Religion und Philosophie bei G.W.F. Hegel Masterarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
IMMANUEL KANT. Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. Mit einem Text zur Einführung von Ernst Cassirer Herausgegeben von Horst D.
 IMMANUEL KANT Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften Mit einem Text zur Einführung von Ernst Cassirer Herausgegeben von Horst D. Brandt FELIX MEINER VERLAG HAMBURG PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND
IMMANUEL KANT Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften Mit einem Text zur Einführung von Ernst Cassirer Herausgegeben von Horst D. Brandt FELIX MEINER VERLAG HAMBURG PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Physik und Metaphysik
 WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
Das Seiende und das Wesen
 Thomas von Aquin Das Seiende und das Wesen (De ente et essentia) 2 Einleitung Weil ein kleiner Irrtum am Anfang am Ende ein großer ist nach dem Philosophen im 1. Buch von»der Himmel und die Erde«, Seiendes
Thomas von Aquin Das Seiende und das Wesen (De ente et essentia) 2 Einleitung Weil ein kleiner Irrtum am Anfang am Ende ein großer ist nach dem Philosophen im 1. Buch von»der Himmel und die Erde«, Seiendes
4. Leitfrage und Grundfrage... 11
 INHALT DIE METAPHYSISCHEN GRUNDSTELLUNGEN DES ABENDLANDISCHEN DENKENS (METAPHYSIK) Ubungen im Wintersemester 1937/38 1. DIE METAPHYSISCHEN GRUNSTELLUNGEN DES ABENDLANDISCHEN DEN KENS (DIE ENTFALTUNG DER
INHALT DIE METAPHYSISCHEN GRUNDSTELLUNGEN DES ABENDLANDISCHEN DENKENS (METAPHYSIK) Ubungen im Wintersemester 1937/38 1. DIE METAPHYSISCHEN GRUNSTELLUNGEN DES ABENDLANDISCHEN DEN KENS (DIE ENTFALTUNG DER
Arthur Schopenhauer. Die Kunst, recht zu behalten. In achtunddreißig Kunstgriffen dargestellt ANACONDA
 Arthur Schopenhauer Die Kunst, recht zu behalten In achtunddreißig Kunstgriffen dargestellt ANACONDA Die vorliegende Ausgabe folgt der kritischen Edition Arthur Schopenhauer: Der handschriftliche Nachlaß.
Arthur Schopenhauer Die Kunst, recht zu behalten In achtunddreißig Kunstgriffen dargestellt ANACONDA Die vorliegende Ausgabe folgt der kritischen Edition Arthur Schopenhauer: Der handschriftliche Nachlaß.
Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles
 Blaue Reihe Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles von Pierre Aubenque, Nicolai Sinai, Ulrich J Schneider nicht bereinigt Meiner Hamburg 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 7873
Blaue Reihe Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles von Pierre Aubenque, Nicolai Sinai, Ulrich J Schneider nicht bereinigt Meiner Hamburg 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 7873
DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION
 DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis Der christliche Glaube wird vorausgesetzt. Der Beweis findet innerhalb eines intimen Gebets statt. Frömmigkeit und Rationalität
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Anselm von Canterburys Ontologischer Gottesbeweis Der christliche Glaube wird vorausgesetzt. Der Beweis findet innerhalb eines intimen Gebets statt. Frömmigkeit und Rationalität
Wenn alle Bären pelzig sind und Ned ein Bär ist, dann ist Ned pelzig.
 2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
2.2 Logische Gesetze 19 auch, was für Sätze logisch wahr sein sollen. Technisch gesehen besteht zwar zwischen einem Schluss und einem Satz selbst dann ein deutlicher Unterschied, wenn der Satz Wenn...dann
Wer denkt meine Gedanken?
 Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Lieferung 10 Hilfsgerüst zum Thema: Wer denkt meine Gedanken? FORTSETZUNG 1. Andere islamische Aristoteliker lehren, daß der Geist sich mit dem Leib wie der Beweger mit dem Bewegten verbindet Anders als
Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir
 - 1 - De ente et essentia, cap. 1 & 2 Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir 3 Seiend (ens) wird (nach Ar.) hat zwei Bedeutungen: (1) verteilt auf 10 Kategorien (genera),
- 1 - De ente et essentia, cap. 1 & 2 Was im Allgemeinen mit dem Wort Wesenheit und Seiendes bezeichnet wir 3 Seiend (ens) wird (nach Ar.) hat zwei Bedeutungen: (1) verteilt auf 10 Kategorien (genera),
INHALT. David Hume Ein Traktat über die menschliche Natur. Über die Affekte. [Vorwort] 336. ERSTER TEIL 337 Über Stolz und Niedergedrücktheit
![INHALT. David Hume Ein Traktat über die menschliche Natur. Über die Affekte. [Vorwort] 336. ERSTER TEIL 337 Über Stolz und Niedergedrücktheit INHALT. David Hume Ein Traktat über die menschliche Natur. Über die Affekte. [Vorwort] 336. ERSTER TEIL 337 Über Stolz und Niedergedrücktheit](/thumbs/61/46041192.jpg) INHALT David Hume Ein Traktat über die menschliche Natur BUCH II Über die Affekte [Vorwort] 336 ERSTER TEIL 337 Über Stolz und Niedergedrücktheit Erster Abschnitt. Einteilung des Gegenstandes 337 Zweiter
INHALT David Hume Ein Traktat über die menschliche Natur BUCH II Über die Affekte [Vorwort] 336 ERSTER TEIL 337 Über Stolz und Niedergedrücktheit Erster Abschnitt. Einteilung des Gegenstandes 337 Zweiter
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Kandidaten für logische Gesetze (nicht unbedingt erfolgreich)
 Kandidaten für logische Gesetze (nicht unbedingt erfolgreich) 1 2 1 Leibniz Substitutionssatz Der Träger des Namens A und der Träger des Namens B sind identisch, wenn man an beliebiger Stelle einer Aussage
Kandidaten für logische Gesetze (nicht unbedingt erfolgreich) 1 2 1 Leibniz Substitutionssatz Der Träger des Namens A und der Träger des Namens B sind identisch, wenn man an beliebiger Stelle einer Aussage
Michael Tilly Einführung in die Septuaginta
 Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Wissenschaftliche Buchgesellschaft Im Andenken an Günter Mayer (1936 2004) Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Michael Tilly Einführung in die Septuaginta Wissenschaftliche Buchgesellschaft Im Andenken an Günter Mayer (1936 2004) Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Voransicht. Bilder: Optische Täuschungen.
 S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Der ungläubige Thomas, wie er so oft genannt wird, sieht zum ersten Mal den auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus, den die andern Apostel be
 Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor Thomas? Einleitung Eine weitere bei Anhängern der Trinitätslehre sehr beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle sind die Wortes des Apostels Thomas, die uns
Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin
 Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin Die fünf Wege stammen nicht original von Thomas selbst, sondern werden von ihm in eigener Fassung dargestellt. Aristoteles ist
Lieferung 6 Hilfsgerüst zum Thema: Die Existenz Gottes nach Thomas von Aquin Die fünf Wege stammen nicht original von Thomas selbst, sondern werden von ihm in eigener Fassung dargestellt. Aristoteles ist
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
 Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Erhard Cramer Udo Kamps Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Eine Einführung für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 4. Auflage Springer-Lehrbuch
Drei Formen des Bewusstseins
 Franz von Kutschera Drei Formen des Bewusstseins mentis MÜNSTER Einbandabbildung: Hochchor der Kathedrale von Le Mans Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Franz von Kutschera Drei Formen des Bewusstseins mentis MÜNSTER Einbandabbildung: Hochchor der Kathedrale von Le Mans Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek
Stefan Oster. Mit-Mensch-Sein. Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich. Verlag Karl Alber Freiburg/München
 Stefan Oster Mit-Mensch-Sein Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich Verlag Karl Alber Freiburg/München Vorwort 5 Einführung 11 I Weisen des Zugangs 17 1. Ein aktueller Entwurf!" - Das
Stefan Oster Mit-Mensch-Sein Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich Verlag Karl Alber Freiburg/München Vorwort 5 Einführung 11 I Weisen des Zugangs 17 1. Ein aktueller Entwurf!" - Das
Einführung in die Literaturtheorie
 Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de
Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. Tim Henning
 Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland
 Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Erörterung. Hauptteil Zweck: Themafrage erörtern; Möglichkeiten des Hauptteils:
 Erörterung Ausgangsfrage Einleitung Zweck: Interesse wecken, Hinführung zum Thema; Einleitungsmöglichkeiten: geschichtlicher Bezug, Definition des Themabegriffs, aktuelles Ereignis, Statistik/Daten, Zitat/Sprichwort/Spruch;
Erörterung Ausgangsfrage Einleitung Zweck: Interesse wecken, Hinführung zum Thema; Einleitungsmöglichkeiten: geschichtlicher Bezug, Definition des Themabegriffs, aktuelles Ereignis, Statistik/Daten, Zitat/Sprichwort/Spruch;
Heiner Keupp. Reflexive Sozialpsychologie
 essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
essentials essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. essentials informieren
Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI
 Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI Mittelalter XI 02 Mittelalter XI 02 Aristotelesrezeption Gerardus Cremonensis/Gerhard von Cremona (1114 1187) Kanoniker in Toledo, Übersetzer
Geschichte der Philosophie II Mittelalter und frühe Neuzeit XI Mittelalter XI 02 Mittelalter XI 02 Aristotelesrezeption Gerardus Cremonensis/Gerhard von Cremona (1114 1187) Kanoniker in Toledo, Übersetzer
Politischer Humanismus und europäische Renaissance. Prof. Dr. Alexander Thumfart
 Politischer Humanismus und europäische Renaissance Prof. Dr. Alexander Thumfart Geboren: 24. Februar 1464; Mirandola (Po-Ebene) Gestorben: 17. November 1494; Florenz Ausbildung: Philosophie in Padua Leben:
Politischer Humanismus und europäische Renaissance Prof. Dr. Alexander Thumfart Geboren: 24. Februar 1464; Mirandola (Po-Ebene) Gestorben: 17. November 1494; Florenz Ausbildung: Philosophie in Padua Leben:
Die Einheit der Natur
 Die Einheit der Natur Studien von Carl Friedrich von Weizsäcker Deutscher Taschenbuch Verlag Vorwort 9 Einleitung 11 Teill. Wissenschaft, Sprache und Methode 17 I 1. Wie wird und soll die Rolle der Wissenschaft
Die Einheit der Natur Studien von Carl Friedrich von Weizsäcker Deutscher Taschenbuch Verlag Vorwort 9 Einleitung 11 Teill. Wissenschaft, Sprache und Methode 17 I 1. Wie wird und soll die Rolle der Wissenschaft
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Vortrage Reden Erinnerungen
 Vortrage Reden Erinnerungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH MaxPlanck Vorträge Reden Erinnerungen Herausgegeben von Hans Roos und Armin Hermann.~. T Springer Dr. Dr. Hans Roos Professor Dr. Max
Vortrage Reden Erinnerungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH MaxPlanck Vorträge Reden Erinnerungen Herausgegeben von Hans Roos und Armin Hermann.~. T Springer Dr. Dr. Hans Roos Professor Dr. Max
Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen
 Wirtschaft Christina Simon Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Wirtschaft Christina Simon Spätes Bietverhalten bei ebay-auktionen Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Thomas Christian Kotulla. Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt.
 Thomas Christian Kotulla Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Thomas Christian Kotulla Was soll ich hier? Eine Begründung der Welt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
2 Der Beweis. Themen: Satz und Beweis Indirekter Beweis Kritik des indirekten Beweises
 2 Der Beweis Themen: Satz und Beweis Indirekter Beweis Kritik des indirekten Beweises Satz und Beweis Ein mathematischer Satz besteht aus einer Voraussetzung und einer Behauptung. Satz und Beweis Ein mathematischer
2 Der Beweis Themen: Satz und Beweis Indirekter Beweis Kritik des indirekten Beweises Satz und Beweis Ein mathematischer Satz besteht aus einer Voraussetzung und einer Behauptung. Satz und Beweis Ein mathematischer
Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1
 Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1 Niklas Luhmann Soziologische Aufklärung 1 Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme 6. Auflage Westdeutscher Verlag 6. Auflage, 1991 Der Westdeutsche Verlag ist ein
Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung 1 Niklas Luhmann Soziologische Aufklärung 1 Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme 6. Auflage Westdeutscher Verlag 6. Auflage, 1991 Der Westdeutsche Verlag ist ein
Ist das Universum irgendwann entstanden?
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Ist das Universum irgendwann entstanden? Die Frage nach der Ewigkeit der Welt 1. Die von dem Bischof von Paris 1277 verurteilte Lehren These 87: Die Welt ist ewig in
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Ist das Universum irgendwann entstanden? Die Frage nach der Ewigkeit der Welt 1. Die von dem Bischof von Paris 1277 verurteilte Lehren These 87: Die Welt ist ewig in
Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung
 Germanistik Marco Kunze Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung Studienarbeit Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Seminar für deutsche Sprache und Literatur
Germanistik Marco Kunze Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung Studienarbeit Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Seminar für deutsche Sprache und Literatur
Frauen im Schwangerschaftskonflikt
 Geisteswissenschaft Susanne Kitzing Frauen im Schwangerschaftskonflikt Die Rolle der Schwangerschaftskonfliktberatung, die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch und seine Folgen Diplomarbeit Bibliografische
Geisteswissenschaft Susanne Kitzing Frauen im Schwangerschaftskonflikt Die Rolle der Schwangerschaftskonfliktberatung, die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch und seine Folgen Diplomarbeit Bibliografische
Friedemann Richert. Platon und Christus
 Friedemann Richert Platon und Christus Friedemann Richert Platon und Christus Antike Wurzeln des Neuen Testaments 2. Auflage Herrn Robert Spaemann gewidmet Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
Friedemann Richert Platon und Christus Friedemann Richert Platon und Christus Antike Wurzeln des Neuen Testaments 2. Auflage Herrn Robert Spaemann gewidmet Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART
 MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Thomas Morus - Utopia. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Thomas Morus - Utopia Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias Hengelbrock Thomas
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Thomas Morus - Utopia Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de e lectio Herausgegeben von Matthias Hengelbrock Thomas
Journalistische Praxis. Björn Staschen. Mobiler Journalismus
 Journalistische Praxis Björn Staschen Mobiler Journalismus Journalistische Praxis Gegründet von Walther von La Roche Herausgegeben von Gabriele Hooffacker Der Name ist Programm: Die Reihe Journalistische
Journalistische Praxis Björn Staschen Mobiler Journalismus Journalistische Praxis Gegründet von Walther von La Roche Herausgegeben von Gabriele Hooffacker Der Name ist Programm: Die Reihe Journalistische
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung
 Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Medienunternehmen im Social Web
 Medienunternehmen im Social Web Naemi Goldapp Medienunternehmen im Social Web Erkenntnisse zur reichweitenstarken Content-Generierung Naemi Goldapp Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-11736-8 DOI 10.1007/978-3-658-11737-5
Medienunternehmen im Social Web Naemi Goldapp Medienunternehmen im Social Web Erkenntnisse zur reichweitenstarken Content-Generierung Naemi Goldapp Berlin, Deutschland ISBN 978-3-658-11736-8 DOI 10.1007/978-3-658-11737-5
Bedeutung und psychischer Gehalt
 Gianfranco Soldati Bedeutung und psychischer Gehalt Eine Untersuchung zur sprachanalytischen Kritik von Husserls früher Phänomenologie Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien Zürich Gedruckt mit Unterstützung
Gianfranco Soldati Bedeutung und psychischer Gehalt Eine Untersuchung zur sprachanalytischen Kritik von Husserls früher Phänomenologie Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien Zürich Gedruckt mit Unterstützung
L e s e p r o b e V e r l a g L u d w i g saskia heber Das Buch im Buch Selbstreferenz, Intertextualität und Mythenadaption
 saskia heber Das Buch im Buch Selbstreferenz, Intertextualität und Mythenadaption in Cornelia Funkes Tinten-Trilogie Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater
saskia heber Das Buch im Buch Selbstreferenz, Intertextualität und Mythenadaption in Cornelia Funkes Tinten-Trilogie Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater
Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing
 Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
Germanistik Stephanie Reuter Die Fabel, ihre Entstehung und (Weiter-)Entwicklung im Wandel der Zeit - speziell bei Äsop, de La Fontaine und Lessing Zusätzlich ein kurzer Vergleich der Fabel 'Der Rabe und
t r a n s p o s i t i o n e n
 t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
Matthias Moßburger. Analysis in Dimension 1
 Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Matthias Moßburger Analysis in Dimension 1 Matthias Moßburger Analysis in Dimension1 Eine ausführliche Erklärung grundlegender Zusammenhänge STUDIUM Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Michalski DLD80 Ästhetik
 Michalski DLD80 Ästhetik 1565 2008 00104 23-04-2010 WIEDERHOLUNG Baumgartens Ästhetik hat nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Absicht. Definition der Ästhetik (im Unterschied zur
Michalski DLD80 Ästhetik 1565 2008 00104 23-04-2010 WIEDERHOLUNG Baumgartens Ästhetik hat nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Absicht. Definition der Ästhetik (im Unterschied zur
Thomas von Aquin. Das irrende Gewissen. Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Lieferung 16
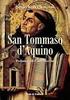 Lieferung 16 Thomas von Aquin Das irrende Gewissen Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Artikel 6 Artikel Ist ein von einer irrenden Vernunft abweichender Wille schlecht? Es scheint, daß ein von einer
Lieferung 16 Thomas von Aquin Das irrende Gewissen Summa theologiae, I a II ae, Frage 19, Artikel 6 Artikel Ist ein von einer irrenden Vernunft abweichender Wille schlecht? Es scheint, daß ein von einer
