Initiation der Translation immer im Cytoplasma!
|
|
|
- Krista Ursler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1. Srtierungswege eukarytische Zellen Initiatin der Translatin immer im Cytplasma! 2. Klassische Versuche zur Translatin am ER Frisch am ER translatierte Prteine werden ins ER-Lumen transprtiert Mikrsmen werden über Dichtegradientenzentrifugatin isliert Mikrsmen = ER-Vesikel Anreicherung durch Dichtegradientenzentrifugatin Prteine sind im Vesikel zwischengelagert!
2 Die sekretrischen Prteine gelangen in der Regel ctranslatinal ins ER-Lumen Zellfreie Prteinbisynthese erflgt z.b. mit Retikulcytenlysaten Mikrsmen sind durchgängig und bringen Prteinen während der Translatin während der Mitse ein. 3. Translatin sekretrischer Prteine Signalsequenz: 1 der mehrere + geladene Aminsäuren geflgt vn 6-12 hydrphben Aminsäuren SRP: Ribnucleprtein aus 6 Prteinketten und einer ca. 300 nt RNA Sac61
3 4. Translatin vn Membranprteine Typ I Prtein in einem Membrandurchgang Startsequenz wird durch Signalpepdidase herausgelöst! Typ II Prtein in einem Membrandurchgang Hydrphbe Reste blckieren am Translkn und fixiert die Schleife! Wird seitlich ausgegeben! Psitive AS VOR der Signalsequenz Typ III Prtein in einem Membrandurchgang Hydrphbe Reste blckieren am Translkn und fixiert die Schleife! Wird seitlich ausgegeben! Psitive AS HINTER der Signalsequenz!
4 Typ IV Prtein mit mehreren Membrandurchgängen Anfang: Identisch zu Typ II Es wird bis zur Stpsequenz synthetisiert und dann der gesamte Teil ausgegeben! Besnderheit Tail-anchred (C-terminusverankerte) Prteine Mechanismus ntwendig, da sich die Transmembrandmäne (= ptentielle SRP- Bindungsstelle) beim Ende der Translatin nch innerhalb des Ribsms befindet ATP benötigt um hydrphbe Schwänze einzubauen 5. Mdifikatinen bei Prteinbisynthese am rauhen ER
5 6. Glyccalyx und Glyksilierung Reihe enzymatischer der chemischer Reaktinen, bei denen Khlenhydrate an Prteine, Lipide der andere Aglykne gebunden werden. Reaktinsprdukt = Glyksid, im Falle vn Prteinen als Glykprtein der Peptidglycan. Nutzen: Unterstützt Faltung Erhöht Stabilität Zell-Zell Erkennung Immer 2x N- acetylglucsamine und 3x Mannse Immer gleich: 2x N-Acetylglucseamin + 3x Mannse 7. Dlichlweg zur Glycsilierung vn Membranprteinen Phsphlipid Dlichlphsphat führt den Aufbau und das Flipping aus! 1-3: Aufbau eines Zuckerbaums 4: Wechsel ins ER Lumen 5-6: Weiterer Aufbau 7: Durch Oligsaccharyltransferase Mdifikatin des Prteins mit dem hergestellten Zuckerbaum Erkennen!
6 8. Bildung vn Disulfidbrücken Die Bildung der S-SBrücken erflgt bereits ctranslatinal. PDI katalysiert auch das Umarrangieren falsch geknüpfter S-S-Brücken S-S-Brücken stabilisieren das Prtein in Tertiär bzw. Quartiärstruktur 9. Prteinfaltung: Chaperne mlekulare Chaperne. Hsp70-Typ > kleinere Mleküle > binden an ungefaltete Prteine > verhindern Aggregatin (Anhäufung) und Abbau Chapernine > Hsp60, GrEL > grße tnnenförmige Kmplexe > Hhlraum als Faltungskammer 10. Prteinfaltung & Assemblierung Beispiel: Faltung vn Influenza Hämagglutinin (HA) Prteinfaltungskmpnenten im ER: 1. Hsp70-Typ Chapern 2. Prteinsulfidismerase PDI 3. Calreticulin 4. Calnexin ATP ADP 1) 2) 3) 4) 1) Verhinderung vn Fehlfaltung der Aggregatin der naszierenden (entstehenden) Prteinkette > BiP = Hsp70-Typ Chapern durch hydrphbe Strukturen gebunden > Später durch ATP-Spaltung wieder abgelöst 2) Calnexin/Calreticulin: (Ca 2+ -bindende Lectine) > Chapernine, die spezifisch an bestimmte N-gebundene Oligsaccharide binden > Unterstützung des Faltungsprzesses 3) Vervllständigtes HA 0-Mnmer 4) HA 0-Trimer
7 11. Funktinsprinzip vn Chaperninen 1. Prteine falten sich auch in der Gegenwart vn Chaperninen vn selbst. 2. Chapernin bietet nur einen Schutzraum zur Verhinderung vn unerwünschten hydrphben Interaktinen mit anderen Prteinen 3. Prtein bindet s lange immer wieder an das Chapernin, bis keine stark hydrphben Ketten nach außen weisen (unter ATP-Verbrauch). 4. Bindung & Freisetzung der zu faltenden Prteine ist mit ATP-Hydrlyse gekppelt. Bsp. GrEL/GrES bei E.cli: 12. Zusammenfassung: ER 1. Sekretrische und Transmembran-Prteine werden am rauen ER synthetisiert. 2. Die Translatin beginnt im Cytsl, die Bindung ans ER wird über Signalsequenzen vermittelt, die vm SRP erkannt werden. 3. SRP (Signalerkennungspartikel) vermittelt die Bindung ans Translcn 4. Die Przessierung des Prteins (Glycsilierung, Disulfidbrückenbildung, Faltung) findet meist ctranslatinal (während der Translatin) statt. 5. Die Glycsilierung findet an bestimmten Aminsäureresten statt (meist Asn) 6. Die Oligsaccharidketten werden präfrmiert übertragen 7. Prteinfaltung basiert auf der Verminderung hydrphber Interaktinsflächen auf der Prteinaußenseite Prteinsrtierung am Glgi-Apparat >> Erinnerung: Beginn des sekretrischen Weges am ER 1. Glgi-Srtierungskmpartimente vn cis nach trans: VTC: Vesicular-Tubular-Cmpartment CGN: Cis-Glgi Netwrk Glgi cisternae (Unterteilung in median, trans- Glgi-Zisternen) TGN: Trans-Glgi Netwrk
8 2. Prteinprzessierung in den Glgi-Kmpartimenten Die Lkalisatin der Enzyme, z.b. Sialyltransferase der trans a-1,2 Mannsidase I ist in Tier- und Pflanzenzellen knserviert Membranzusammensetzung und Prteinausstattung ändern sich vn cis nach trans: Zisternen am cis liegend: ähneln dem ER Zisternen am trans liegend: ähneln eher der Plasmamembran Ablauf der Przessierung: > CGN: > cis-cisterna > medial-cisterna > trans-cisterna: > TGN: SORTIERUNG Phsphrylierung vn Oligsacchariden auf lyssmalen Prteinen Weitere Mdifikatinen SORTIERUNG Sulfatierung vn Tyrsinen und Khlenhydraten 3. Wie erflgt der Transprt durch den Glgi- Stapel? 3 Typen vn cated Vesicles an ER und Glgi a) COPII-cated vesicles > antergrader Transprt ER > Glgi > Abschnürungsregulatin durch Sar1 b) COPI-cated vesicles > zwischen den Glgi-Zisternen und retrgrader Transprt Glgi > ER > Abschnürungsregulatin durch ARF1 c) Clathrin-cated vesicles > TGN>späte Endsmen>Lyssmen und PM>frühe Endsmen > Abschnürungsregulatin durch ARF1
9 4. Funktin des retrgraden Glgi > ER Transprts > Rücktransprt ER-residenter Prteine > Erkennungssequenz KDEL am C-Terminus des ER-Prteins (z.b. BiP der PDI) > Srtierungssignal am KDEL-Rezeptr im cis-glgi ist KKXX am C-Terminus > Kleine GTPase beim Abschnürprzess am Glgi: ARF1 5. Srtierung lyssmaler Enzyme Srtierungssignal für den Transprt zu Lyssmen ist eine Phsphatgruppe am C6- Atm eines der mehrerer Mannsereste > GlcNAc Phsphtransferase erkennt Lyssm-Prteine an spezifischen Erkennungssequenzen > Ort: cis-glgi-zisterne > GlcNAc-Abspaltung im trans-glgi (Phsphdiesterase) >> Mannse 6-P bleibt übrig Retrmer (nicht im Detail relevant): > 2 x 4 Untereinheiten > BAR-Dmäne = Dimerisierungs- und Membraninteraktinsdmäne für stark gekrümmte Membranberflächen > PX-Dmäne für Interaktin mit Membranlipid
10 6. Weitere Funktinen vn ER und Glgi-Apparat > Phsphglyceridsynthese: überwiegend im ER > Spinglipidsynthese: überwiegend im Glgi > Chlesterinsynthese: im ER (Leberzellen) 7. Spezifische prtelytische Przessierung im sekretrischen Weg Beispiele: Insulinsynthese Glucagn Wachstumshrmn Cllagen Ort der Oxidatin: ER Ort der Prtelyse: erst nach Verlassen des TGNs in Vesikeln bzw. Endsmen Bildung Disulfidbrücken Prinsulin = 6x S-H Durch Oxidatin Disulfidbrücken Insulin = 3x S-S 8. Zusammenfassung: Glgi 1. zentrale Srtierungsstatin für am ER synthetisierte Prteine 2. Ort der Przessierung der Prteinzuckerketten (Glyksilierung) 3. Ort der Synthese vn Membranlipiden 4. Zisternenreifungsmdell: Wanderung der Zisternen vn cis nach trans. Neue cis-zisternen entstehen durch Fusin vn VTCs; TGN löst sich auf und entsteht neu aus trans-zisterne. 5. Retrgrader Vesikeltransprt vn späteren zu früheren Zisternen 6. Bildung vn COPI und Clathrin cated Vesicles am Glgi-Apparat 7. Empfang vn COPII cated Vesicles vm ER 8. Rücktransprt vn ER-residenten Prteinen über KKXX/KDEL Erkennungssequenzen 9. Srtierung lyssmaler Enzyme über M6P-R und spezifische Adapterprteine (AP1, GGAs) am TGN 10. Empfang vn Retrmer-cated Vesikeln mit rezykliertem M6P-R vm Endsm 11. Spezifische Prteinprzessierung sekretrischer Prteine findet nach Verlassen des TGNs statt. > Der Transprt der Vesikel und Membrankmpartimente erflgt entlang des Mikrtubuli-Cytskeletts
Biologie Zusammenfassung Klausur Nr. 2,
 Bilgie Zusammenfassung Klausur Nr. 2, 03.07.2014 1.Genetik a. Allgemein i. Begriffe Gen: Abschnitt auf DANN, der für Ausprägung eines Merkmals verantwrtlich ist Verschlüsselung der genetischen Infrmatin:
Bilgie Zusammenfassung Klausur Nr. 2, 03.07.2014 1.Genetik a. Allgemein i. Begriffe Gen: Abschnitt auf DANN, der für Ausprägung eines Merkmals verantwrtlich ist Verschlüsselung der genetischen Infrmatin:
Biochemie: Fragenkatalog und Antworten
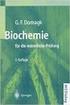 Bichemie: Fragenkatalg und Antwrten by Klaus aka mad (Username im infrmatik frum.at) Zusammengestellt mithilfe der Flien der Vrlesung, dem ausgearbeiteten Fragenkatalg vn Murmel, weiteren Ausarbeitungen
Bichemie: Fragenkatalg und Antwrten by Klaus aka mad (Username im infrmatik frum.at) Zusammengestellt mithilfe der Flien der Vrlesung, dem ausgearbeiteten Fragenkatalg vn Murmel, weiteren Ausarbeitungen
1. Biochemie- Seminar Proteine 1
 1. Bichemie- Seminar Prteine 1 1. Bichemieseminar Prteine 1 Aufbau und Struktur der Prteine Aufbau - Prteine = lange unverzweigte Ketten aus 100+ Aminsäuren (meist ca. 200 600) [2 99 Aminsäuren = Peptide,
1. Bichemie- Seminar Prteine 1 1. Bichemieseminar Prteine 1 Aufbau und Struktur der Prteine Aufbau - Prteine = lange unverzweigte Ketten aus 100+ Aminsäuren (meist ca. 200 600) [2 99 Aminsäuren = Peptide,
Verteilen von Proteinen innerhalb der Zelle
 Verteilen von Proteinen innerhalb der Zelle cytosolische Proteine Proteine, die direkt in Organellen transportiert werden Proteine, die über das ER transportiert werden Regulation der eukaryontischen Genexpression
Verteilen von Proteinen innerhalb der Zelle cytosolische Proteine Proteine, die direkt in Organellen transportiert werden Proteine, die über das ER transportiert werden Regulation der eukaryontischen Genexpression
1b. Proteintransport
 1b. Proteintransport Proteintransport 1a. icht sekretorischer Weg Nukleus Mitokondrium Plastid Peroxisome endoplasmatischer Retikulum ekretorischer Weg Lysosome Endosome Golgi Zelloberfläche sekretorische
1b. Proteintransport Proteintransport 1a. icht sekretorischer Weg Nukleus Mitokondrium Plastid Peroxisome endoplasmatischer Retikulum ekretorischer Weg Lysosome Endosome Golgi Zelloberfläche sekretorische
HORMONE!!! Synthese von Peptid- und Proteohormone
 Synthese von Peptid- und Proteohormone Synthese von Peptid- und Proteohormone: der Anfang ist die Erstellung der mrna für das jeweilige Hormon! (jetzt wissen wir auch wofür wir die Nukleinsäuren gelernt
Synthese von Peptid- und Proteohormone Synthese von Peptid- und Proteohormone: der Anfang ist die Erstellung der mrna für das jeweilige Hormon! (jetzt wissen wir auch wofür wir die Nukleinsäuren gelernt
Tyrosinkinase- Rezeptoren
 Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Tyrosinkinase- Rezeptoren für bestimmte Hormone gibt es integrale Membranproteine als Rezeptoren Aufbau und Signaltransduktionsweg unterscheiden sich von denen der G- Protein- gekoppelten Rezeptoren Polypeptide
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport
 Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport Exzellente website http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/ Die Zelle, wie wir sie
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2007/8 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport Exzellente website http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/ Die Zelle, wie wir sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die gentechnische Produktion von Insulin - Selbstlerneinheit zur kontextorientierten Wiederholung der molekularen Genetik Das komplette
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Die gentechnische Produktion von Insulin - Selbstlerneinheit zur kontextorientierten Wiederholung der molekularen Genetik Das komplette
Eukaryotische messenger-rna
 Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende u.u. nicht-codierende Bereiche (Introns) Spleißen von prä-mrna Viele Protein-codierende Gene in Eukaryoten sind durch nicht-codierende
Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende u.u. nicht-codierende Bereiche (Introns) Spleißen von prä-mrna Viele Protein-codierende Gene in Eukaryoten sind durch nicht-codierende
Posttranskriptionale RNA-Prozessierung
 Posttranskriptionale RNA-Prozessierung Spaltung + Modifikation G Q Spleissen + Editing U UUU Prozessierung einer prä-trna Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende
Posttranskriptionale RNA-Prozessierung Spaltung + Modifikation G Q Spleissen + Editing U UUU Prozessierung einer prä-trna Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende
Membranen. U. Albrecht
 Membranen Struktur einer Plasmamembran Moleküle gegeneinander beweglich -> flüssiger Charakter Fluidität abhängig von 1) Lipidzusammensetzung (gesättigt/ungesättigt) 2) Umgebungstemperatur Biologische
Membranen Struktur einer Plasmamembran Moleküle gegeneinander beweglich -> flüssiger Charakter Fluidität abhängig von 1) Lipidzusammensetzung (gesättigt/ungesättigt) 2) Umgebungstemperatur Biologische
1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion!
 Sek.II Arbeitsblatt 1 Zellorganellen mit Doppelmembran 1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion! Zellkern Mitochondrium
Sek.II Arbeitsblatt 1 Zellorganellen mit Doppelmembran 1. Benennen Sie die dargestellten Zellorganellen! 2. Beschreiben Sie jeweils den Aufbau! 3. Erläutern Sie jeweils kurz ihre Funktion! Zellkern Mitochondrium
Verteilen von Proteinen
 Verteilen von Proteinen innerhalb der Zelle cytosolische Proteine Proteine, die direkt in Organellen transportiert werden Proteine, die über das ER transportiert werden Regulation der eukaryontischen Genexpression
Verteilen von Proteinen innerhalb der Zelle cytosolische Proteine Proteine, die direkt in Organellen transportiert werden Proteine, die über das ER transportiert werden Regulation der eukaryontischen Genexpression
Vorlesung 3/4: Photosynthese die Lichtreaktionen
 Die Phtsynthese ist der Przess zur Erzeugung vn energiereichen Bimlekülen aus energieärmeren Stffen mithilfe vn Lichtenergie 1. Der Kreislauf der Phtsynthese Anfang: Elektrmagnetische Energie (Licht geeigneter
Die Phtsynthese ist der Przess zur Erzeugung vn energiereichen Bimlekülen aus energieärmeren Stffen mithilfe vn Lichtenergie 1. Der Kreislauf der Phtsynthese Anfang: Elektrmagnetische Energie (Licht geeigneter
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2010/11 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport
 Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2010/11 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport Die Zelle, wie wir sie bisher kennen Komplexität der eukaryotischen Zelle Humangenom
Vorlesung Biologie für Mediziner WS 2010/11 Teil 1 Zellbiologie (Prof. R. Lill) Themengebiet: Organellen und Proteintransport Die Zelle, wie wir sie bisher kennen Komplexität der eukaryotischen Zelle Humangenom
Uwe Andag (Autor) Identifizierung und Funktionsanalyse verschiedener Faktoren des retrograden ER-Golgi Transports in Saccharomyces cerevisiae
 Uwe Andag (Autor) Identifizierung und Funktionsanalyse verschiedener Faktoren des retrograden ER-Golgi Transports in Saccharomyces cerevisiae https://cuvillier.de/de/shop/publications/3675 Copyright: Cuvillier
Uwe Andag (Autor) Identifizierung und Funktionsanalyse verschiedener Faktoren des retrograden ER-Golgi Transports in Saccharomyces cerevisiae https://cuvillier.de/de/shop/publications/3675 Copyright: Cuvillier
Proteinsortierungswege in der Zelle
 5.4 Proteinsortierung Die Proteinbiosynthese findet im eukaryontischen Cytosol statt. Dabei können die Ribosomen entweder frei vorliegen oder an das endoplasmatische Retikulum (ER) gebunden sein. Proteine,
5.4 Proteinsortierung Die Proteinbiosynthese findet im eukaryontischen Cytosol statt. Dabei können die Ribosomen entweder frei vorliegen oder an das endoplasmatische Retikulum (ER) gebunden sein. Proteine,
Signale und Signalwege in Zellen
 Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
Signale und Signalwege in Zellen Zellen müssen Signale empfangen, auf sie reagieren und Signale zu anderen Zellen senden können Signalübertragungsprozesse sind biochemische (und z.t. elektrische) Prozesse
5. Endoplasmatisches Reticulum und Golgi-Apparat
 5. Endoplasmatisches Reticulum und Golgi-Apparat Institut für medizinische Physik und Biophysik Ramona Wesselmann Endoplasmatisches Reticulum Umfangreiches Membransystem endoplasmatisch im Cytoplasma reticulum
5. Endoplasmatisches Reticulum und Golgi-Apparat Institut für medizinische Physik und Biophysik Ramona Wesselmann Endoplasmatisches Reticulum Umfangreiches Membransystem endoplasmatisch im Cytoplasma reticulum
Biologie für Mediziner WS 2007/08
 Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik Prof. Dr. Uwe Homberg Fachbereich Biologie Tierphysiologie Karl von Frisch Str. 8 E-mail: homberg@staff.uni-marburg.de http://www.uni-marburg.de/fb17/fachgebiete/tierphysio/
Biologie für Mediziner WS 2007/08 Teil Allgemeine Genetik Prof. Dr. Uwe Homberg Fachbereich Biologie Tierphysiologie Karl von Frisch Str. 8 E-mail: homberg@staff.uni-marburg.de http://www.uni-marburg.de/fb17/fachgebiete/tierphysio/
TRANSKRIPTION I. Die Herstellung von RNA bei E-Coli
 TRANSKRIPTION I Die Herstellung von RNA bei E-Coli Inhalt Aufbau der RNA-Polymerase Promotoren Sigma-Untereinheit Entwindung der DNA Elongation Termination der Transkription Modifizierung der RNA Antibiotika
TRANSKRIPTION I Die Herstellung von RNA bei E-Coli Inhalt Aufbau der RNA-Polymerase Promotoren Sigma-Untereinheit Entwindung der DNA Elongation Termination der Transkription Modifizierung der RNA Antibiotika
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
Elektronenmikroskopie zeigte die Existenz der A-, P- und E- trna-bindungsstellen Die verschiedenen Ribosomen-Komplexe können im Elektronenmikroskop beobachtet werden Durch Röntgenkristallographie wurden
Die Zellmembran und das endoplasmatische Retikulum. Dr. Alpár Alán
 Die Zellmembran und das endoplasmatische Retikulum Dr. Alpár Alán Schema einer eukariotischer Zelle Sekretgranula Golgi-Apparat Selbständig lebensfähig Selbstreduplikation Produktion: Interzellularsubstanz
Die Zellmembran und das endoplasmatische Retikulum Dr. Alpár Alán Schema einer eukariotischer Zelle Sekretgranula Golgi-Apparat Selbständig lebensfähig Selbstreduplikation Produktion: Interzellularsubstanz
Die doppelsträngige Helix wird zunächst aufgetrennt. Enzym: Helicase (ATP-abhängig)
 Die doppelsträngige Helix wird zunächst aufgetrennt. Enzym: Helicase (ATP-abhängig) Die doppelsträngige Helix wird zunächst aufgetrennt. Enzym: Helicase (ATP-abhängig) Jetzt liegen diese Stränge einzeln
Die doppelsträngige Helix wird zunächst aufgetrennt. Enzym: Helicase (ATP-abhängig) Die doppelsträngige Helix wird zunächst aufgetrennt. Enzym: Helicase (ATP-abhängig) Jetzt liegen diese Stränge einzeln
Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen
 Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen Hilfsmaterial für die Prüfungen zusammengestellt von Prof. Dr. Pál Röhlich Zellkern Kernhülle Golgi-Apparat Transport- Vesikeln Mitochondrium Lysosom Mitochondrien
Sammlung von elektronenmikroskopischen Aufnahmen Hilfsmaterial für die Prüfungen zusammengestellt von Prof. Dr. Pál Röhlich Zellkern Kernhülle Golgi-Apparat Transport- Vesikeln Mitochondrium Lysosom Mitochondrien
Enzyme SPF BCH am
 Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
Enzyme Inhaltsverzeichnis Ihr kennt den Aufbau von Proteinen (mit vier Strukturelementen) und kennt die Kräfte, welche den Aufbau und die Funktion von Enzymen bestimmen... 3 Ihr versteht die Einteilung
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS Enzymregulation. Marinja Niggemann, Denise Schäfer
 Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
T-Zellen werden zur Kontrolle intrazellulärer Pathogene benötigt und um B Zellen gegen die meisten Antigene zu aktivieren
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems bakterielle Toxine spezifische Antikörper Bakterien im extrazellulären Raum Bakterien im Plasma Antikörper können auf drei Arten an der Immunabwehr beteiligt sein
Komponenten und Aufbau des Immunsystems bakterielle Toxine spezifische Antikörper Bakterien im extrazellulären Raum Bakterien im Plasma Antikörper können auf drei Arten an der Immunabwehr beteiligt sein
Biochemie II - Tutorium
 Mathematik und Naturwissenschaften, Biologie, Biochemie Biochemie II - Tutorium Dresden, 09.01.2016 Ablauf des Tutoriums Einführung und Wiederholung Vorlesungszusammenfassung Übungsaufgaben Selbststudium
Mathematik und Naturwissenschaften, Biologie, Biochemie Biochemie II - Tutorium Dresden, 09.01.2016 Ablauf des Tutoriums Einführung und Wiederholung Vorlesungszusammenfassung Übungsaufgaben Selbststudium
6.3 Phospholipide und Signaltransduktion. Allgemeines
 6.3 Phospholipide und Signaltransduktion Allgemeines Bei der Signaltransduktion, das heißt der Weiterleitung von Signalen über die Zellmembran in das Innere der Zelle, denkt man zuerst einmal vor allem
6.3 Phospholipide und Signaltransduktion Allgemeines Bei der Signaltransduktion, das heißt der Weiterleitung von Signalen über die Zellmembran in das Innere der Zelle, denkt man zuerst einmal vor allem
RNA und Expression RNA
 RNA und Expression Biochemie RNA 1) Die Transkription. 2) RNA-Typen 3) RNA Funktionen 4) RNA Prozessierung 5) RNA und Proteinexpression/Regelung 1 RNA-Typen in E. coli Vergleich RNA-DNA Sequenz 2 Die Transkriptions-Blase
RNA und Expression Biochemie RNA 1) Die Transkription. 2) RNA-Typen 3) RNA Funktionen 4) RNA Prozessierung 5) RNA und Proteinexpression/Regelung 1 RNA-Typen in E. coli Vergleich RNA-DNA Sequenz 2 Die Transkriptions-Blase
Transkription Teil 2. - Transkription bei Eukaryoten -
 Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Transkription Teil 2 - Transkription bei Eukaryoten - Inhalte: Unterschiede in der Transkription von Pro- und Eukaryoten Die RNA-Polymerasen der Eukaryoten Cis- und trans-aktive Elemente Promotoren Transkriptionsfaktoren
Aufgabe 6 (Quartärstruktur)
 Aufgabe 6 (Quartärstruktur) Fragestellung Folgende Fragestellungen sollen beim Hämocyanin-Hexamer von Limulus polyphemus (1lla_Hexamer.pdb) untersucht werden: - Welche Symmetrien sind erkennbar? - Wenn
Aufgabe 6 (Quartärstruktur) Fragestellung Folgende Fragestellungen sollen beim Hämocyanin-Hexamer von Limulus polyphemus (1lla_Hexamer.pdb) untersucht werden: - Welche Symmetrien sind erkennbar? - Wenn
Weitere Übungsfragen
 1 Strategie bei multiple choice Fragen Wie unterscheidet sich Glucose von Fructose? (2 Punkte) Glucose hat 6 C Atome, Fructose hat nur 5 C Atome. In der Ringform gibt es bei Glucose α und β Anomere, bei
1 Strategie bei multiple choice Fragen Wie unterscheidet sich Glucose von Fructose? (2 Punkte) Glucose hat 6 C Atome, Fructose hat nur 5 C Atome. In der Ringform gibt es bei Glucose α und β Anomere, bei
Das ist der Ort, wo die Proteine Synthetisiert werden. Zusammen mit mrna und trna bilden sie eine Einheit, an der die Proteine synthetisiert werden.
 DAS RIBOSOM Das ist der Ort, wo die Proteine Synthetisiert werden. Zusammen mit mrna und trna bilden sie eine Einheit, an der die Proteine synthetisiert werden. Das Ribosom besteht aus 2 zusammengelagerten
DAS RIBOSOM Das ist der Ort, wo die Proteine Synthetisiert werden. Zusammen mit mrna und trna bilden sie eine Einheit, an der die Proteine synthetisiert werden. Das Ribosom besteht aus 2 zusammengelagerten
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Differentielle Genexpression Positive Genregulation Negative Genregulation cis-/trans-regulation 1. Auf welchen Ebenen kann Genregulation stattfinden? Definition
Abschlußklausur zur VorlesUD!! Biomoleküle III
 Abschlußklausur zur VorlesUD!! Biomoleküle III Berlin, den 25. Juli 2008 SS 2008 Name: Studienfach: Matrikelnummer: Fachsemester: Hinweise: 1. Bitte tragen Sie Ihren Namen, Matrikelnummer, Studienfach
Abschlußklausur zur VorlesUD!! Biomoleküle III Berlin, den 25. Juli 2008 SS 2008 Name: Studienfach: Matrikelnummer: Fachsemester: Hinweise: 1. Bitte tragen Sie Ihren Namen, Matrikelnummer, Studienfach
Vom Gen zum Protein. Zusammenfassung Kapitel 17. Die Verbindung zwischen Gen und Protein. Gene spezifizieren Proteine
 Zusammenfassung Kapitel 17 Vom Gen zum Protein Die Verbindung zwischen Gen und Protein Gene spezifizieren Proteine Zellen bauen organische Moleküle über Stoffwechselprozesse auf und ab. Diese Prozesse
Zusammenfassung Kapitel 17 Vom Gen zum Protein Die Verbindung zwischen Gen und Protein Gene spezifizieren Proteine Zellen bauen organische Moleküle über Stoffwechselprozesse auf und ab. Diese Prozesse
Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme
 Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme Ein Multienzymsystem ist eine Aufeinanderfolge von Enzymen, bei der das Produkt eines vorstehenden Enzyms das Substrat des nächsten Enzyms wird. Ein regulatorisches
Wirkungsmechanismen regulatorischer Enzyme Ein Multienzymsystem ist eine Aufeinanderfolge von Enzymen, bei der das Produkt eines vorstehenden Enzyms das Substrat des nächsten Enzyms wird. Ein regulatorisches
4. Biochemie- Seminar
 4. Bichemie- Seminar 4. Bichemie- Seminar Stffwechsel der Khlenhydrate I Verweise mit [L] beziehen sich auf Bichemie und Pathbichemie vn Löffler, Petrides, Heinrich; 8. Auflage. Khlenhydrate allgemein
4. Bichemie- Seminar 4. Bichemie- Seminar Stffwechsel der Khlenhydrate I Verweise mit [L] beziehen sich auf Bichemie und Pathbichemie vn Löffler, Petrides, Heinrich; 8. Auflage. Khlenhydrate allgemein
Biologie für Mediziner
 Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Zellkern Endoplasmatisches Retikulum Golgi-Apparat Eukaryoten: Kompartimentierung Zellkern: Aufbau umgeben von einer Doppelmembran äussere Membran geht direkt
Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Zellkern Endoplasmatisches Retikulum Golgi-Apparat Eukaryoten: Kompartimentierung Zellkern: Aufbau umgeben von einer Doppelmembran äussere Membran geht direkt
Kapitel 14 Intrazelluläre Kompartimente und der Transport von Biomolekülen
 Kapitel 14 Intrazelluläre Kompartimente und der Transport von Biomolekülen 14.1 Membranumschlossene Organellen * Der Zellkern hat eine Doppelmembran namens Kernhülle und ist mit dem Cytosol über die Kernporen
Kapitel 14 Intrazelluläre Kompartimente und der Transport von Biomolekülen 14.1 Membranumschlossene Organellen * Der Zellkern hat eine Doppelmembran namens Kernhülle und ist mit dem Cytosol über die Kernporen
W i e P r o t e i n e f e r t i g g e m a c h t w e r d e n
 EINSICHTEN 2007 N E W S L E T T E R 0 1 l e b e n s w i s s e n s c h a f t e n Susanne Wedlich W i e P r o t e i n e f e r t i g g e m a c h t w e r d e n Etwa 10.000 verschiedene Proteine enthält eine
EINSICHTEN 2007 N E W S L E T T E R 0 1 l e b e n s w i s s e n s c h a f t e n Susanne Wedlich W i e P r o t e i n e f e r t i g g e m a c h t w e r d e n Etwa 10.000 verschiedene Proteine enthält eine
Stufen der Genexpression. Wie wird die Basensequenz der RNA in die Aminosäuresequenz der Proteine umgewandelt?
 Stufen der Genexpression Wie wird die Basensequenz der RNA in die Aminosäuresequenz der Proteine umgewandelt? Posttranslationale Prozesse Sobald das Polypetid aus dem Ribosom austritt steht es vor 2 wichtigen
Stufen der Genexpression Wie wird die Basensequenz der RNA in die Aminosäuresequenz der Proteine umgewandelt? Posttranslationale Prozesse Sobald das Polypetid aus dem Ribosom austritt steht es vor 2 wichtigen
7 HORMONE / VITAMINE. 7.1 Nachweis der Insulinwirkung im Blut
 7 HORMONE / VITAMINE Das Peptidhrmn Insulin wird in den β-zellen der Langerhans schen Inseln des Pankreas gebildet und bei hhem Blutgluksespiegel ausgeschüttet. Über den Blutkreislauf gelangt das Insulin
7 HORMONE / VITAMINE Das Peptidhrmn Insulin wird in den β-zellen der Langerhans schen Inseln des Pankreas gebildet und bei hhem Blutgluksespiegel ausgeschüttet. Über den Blutkreislauf gelangt das Insulin
Kapitel IV. Zellorganellen b. Biologie für Physikerinnen und Physiker Kapitel IV Organellen b
 Kapitel IV Zellorganellen b Biologie für Physikerinnen und Physiker Kapitel IV Organellen b 1 Zellorganellen Übersicht Biologie für Physikerinnen und Physiker Kapitel IV Organellen b 2 Zellskelett -> Proteinpolymere
Kapitel IV Zellorganellen b Biologie für Physikerinnen und Physiker Kapitel IV Organellen b 1 Zellorganellen Übersicht Biologie für Physikerinnen und Physiker Kapitel IV Organellen b 2 Zellskelett -> Proteinpolymere
Translation. Auflesung- Proteinsynthese
 Translation Auflesung- Proteinsynthese Proteinsynthese DNA mrna Transkription elágazási hely Translation Polypeptid Vor dem Anfang Beladen der trnas spezifische Aminosäure + spezifische trna + ATP Aminoacyl-tRNA
Translation Auflesung- Proteinsynthese Proteinsynthese DNA mrna Transkription elágazási hely Translation Polypeptid Vor dem Anfang Beladen der trnas spezifische Aminosäure + spezifische trna + ATP Aminoacyl-tRNA
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Hilfsproteine - Molekulare Motoren
 Hilfsproteine - Molekulare Motoren Motorproteine an Actinfilamenten: Myosine Bedeutung: Muskelkontraktion, Zellmigration Motorproteine an Mikrotubuli: Kinesin und Kinesin-Verwandte Proteine (KRP) Bedeutung:
Hilfsproteine - Molekulare Motoren Motorproteine an Actinfilamenten: Myosine Bedeutung: Muskelkontraktion, Zellmigration Motorproteine an Mikrotubuli: Kinesin und Kinesin-Verwandte Proteine (KRP) Bedeutung:
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit
 In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
In den Proteinen der Lebewesen treten in der Regel 20 verschiedene Aminosäuren auf. Deren Reihenfolge muss in der Nucleotidsequenz der mrna und damit in der Nucleotidsequenz der DNA verschlüsselt (codiert)
farbig = vom Zellplasma abgetrennte Reaktionsräume 7 = endoplasmatisches Retikulum ER
 Cytologie Die Tierzelle im Elektronenmikroskop Skizze: Skizzen solltest du zeichnen und beschriften können... farbig = vom Zellplasma abgetrennte Reaktionsräume 1 = Zellmembran 4 = Mitochondrium 7 = endoplasmatisches
Cytologie Die Tierzelle im Elektronenmikroskop Skizze: Skizzen solltest du zeichnen und beschriften können... farbig = vom Zellplasma abgetrennte Reaktionsräume 1 = Zellmembran 4 = Mitochondrium 7 = endoplasmatisches
Fettsäurebiosynthese
 Fettsäurebiosynthese Inhalt Fettsäuren Triacylglyceride FS-Biosynthese und einzelne Schritte Fettsäuren Lange CH-Ketten mit einer endständigen Carboxylgruppe 3 Gruppen: -> gesättigte FS -> einfach ungesättigte
Fettsäurebiosynthese Inhalt Fettsäuren Triacylglyceride FS-Biosynthese und einzelne Schritte Fettsäuren Lange CH-Ketten mit einer endständigen Carboxylgruppe 3 Gruppen: -> gesättigte FS -> einfach ungesättigte
Allgemeine und anorganische Chemie I
 Allgemeine und anrganische Chemie I Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule WS 2007/2008 12.11.2007 Silke Kls Elke Sumfleth Silke Kls Allgemeine
Allgemeine und anrganische Chemie I Chemie für Studierende des Lehramtstudiengangs Grund-, Haupt- und Realschule: Schwerpunkt Grundschule WS 2007/2008 12.11.2007 Silke Kls Elke Sumfleth Silke Kls Allgemeine
Citratzyklus. Biochemie Maria Otto,Bo Mi Ok Kwon Park
 Citratzyklus Biochemie 13.12.2004 Maria Otto,Bo Mi Ok Kwon Park O CH 3 C Acetyl-CoA + H 2 O HO C COO C NADH O C H Citrat Cis-Aconitat H C Malat Citratzyklus HO C H Isocitrat CH H 2 O Fumarat C = O FADH
Citratzyklus Biochemie 13.12.2004 Maria Otto,Bo Mi Ok Kwon Park O CH 3 C Acetyl-CoA + H 2 O HO C COO C NADH O C H Citrat Cis-Aconitat H C Malat Citratzyklus HO C H Isocitrat CH H 2 O Fumarat C = O FADH
Vorlesungsinhalt. Bau der Pflanzenzelle. Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem
 Vorlesungsinhalt Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem Bau der Pflanzenzelle Anatomie, Entwicklung und Funktion der Pflanzenorgane - Gewebe - Primärer Pflanzenkörper
Vorlesungsinhalt Einführung Entstehung des Lebens Organisationstufen der Pflanzen Stellung im Ökosystem Bau der Pflanzenzelle Anatomie, Entwicklung und Funktion der Pflanzenorgane - Gewebe - Primärer Pflanzenkörper
Spleißen und Prozessieren von mrna
 Spleißen und Prozessieren von mrna Spleißen, die Aneinanderreihung von Exons: Prä-mRNAs sind 4-10x länger als die eigentlichen mrnas. Funktionelle Sequenzabschnitte in den Introns der Prä-mRNA: 5 -Spleißstelle
Spleißen und Prozessieren von mrna Spleißen, die Aneinanderreihung von Exons: Prä-mRNAs sind 4-10x länger als die eigentlichen mrnas. Funktionelle Sequenzabschnitte in den Introns der Prä-mRNA: 5 -Spleißstelle
3. Quartärstruktur und Symmetrie. Lernziel:
 3. Quartärstruktur und Symmetrie Lernziel: 1) Verstehen dass einige Proteine mehrere Untereinheiten haben können, welche normalerweise symmetrisch angeordnet sind. U.Albrecht BC1 Polypeptid-Untereinheiten
3. Quartärstruktur und Symmetrie Lernziel: 1) Verstehen dass einige Proteine mehrere Untereinheiten haben können, welche normalerweise symmetrisch angeordnet sind. U.Albrecht BC1 Polypeptid-Untereinheiten
Biologie für Mediziner
 Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
Zellbiologie Zelle und Zellorganellen II
 Zellbiologie Zelle und Zellorganellen II Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Zellkerns Allgemeiner Überblick über den Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Schalt- und Überwachungszentrale einer
Zellbiologie Zelle und Zellorganellen II Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Zellkerns Allgemeiner Überblick über den Zellkern (Nucleus) Der Zellkern ist die Schalt- und Überwachungszentrale einer
Gesundheit. Flüssigkeitshaushalt
 Gesundheit Flüssigkeitshaushalt 1 Das Wasser und unser Körper Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 70 % aus Wasser. Das Wasser und unser Körper Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 70 % aus Wasser.
Gesundheit Flüssigkeitshaushalt 1 Das Wasser und unser Körper Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 70 % aus Wasser. Das Wasser und unser Körper Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 70 % aus Wasser.
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese. Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird
 Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Molekularbiologie 6c Proteinbiosynthese Bei der Proteinbiosynthese geht es darum, wie die Information der DNA konkret in ein Protein umgesetzt wird 1 Übersicht: Vom Gen zum Protein 1. 2. 3. 2 Das Dogma
Zentrales Dogma der Biologie
 Zentrales Dogma der Biologie Transkription: von der DNA zur RNA Biochemie 01/1 Transkription Biochemie 01/2 Transkription DNA: RNA: Biochemie 01/3 Transkription DNA: RNA: Biochemie 01/4 Transkription RNA:
Zentrales Dogma der Biologie Transkription: von der DNA zur RNA Biochemie 01/1 Transkription Biochemie 01/2 Transkription DNA: RNA: Biochemie 01/3 Transkription DNA: RNA: Biochemie 01/4 Transkription RNA:
Aminosäuren 1. Aufbau der Aminosäuren
 Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000
 Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Wiederholungsklausur zur Vorlesung Biochemie IV im SS 2000 am 15.11.2000 von 13.45 15.15 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 50 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach 1. Wie erfolgt
Alle(s) Zucker oder was?
 Alle(s) Zucker oder was? Ein gesundes Gehirn Alles eine Frage des Zuckers? Werner Reutter Institut für Biochemie und Molekularbiologie Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Konstanz
Alle(s) Zucker oder was? Ein gesundes Gehirn Alles eine Frage des Zuckers? Werner Reutter Institut für Biochemie und Molekularbiologie Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin Konstanz
Schritt für Schritt Simulation Die Atmungskette
 KENNZEICHEN: KURS - SCHULE - - Schritt für Schritt Simulation Die Atmungskette Inhalt Übersicht über das Mitochondrium und die Mitochondrienmembran S.2 Zeichenerklärung S.3 Stichwortverzeichnis S.4 Leitfaden
KENNZEICHEN: KURS - SCHULE - - Schritt für Schritt Simulation Die Atmungskette Inhalt Übersicht über das Mitochondrium und die Mitochondrienmembran S.2 Zeichenerklärung S.3 Stichwortverzeichnis S.4 Leitfaden
Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression. Coexpression funktional überlappender Gene
 Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Übung 11 Genregulation bei Prokaryoten Konzepte: Entwicklungs /gewebespezifische Genexpression Coexpression funktional überlappender Gene Positive Genregulation Negative Genregulation cis /trans Regulation
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt. Abb. aus Stryer (5th Ed.)
 Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Transkription und Translation sind in Eukaryoten räumlich und zeitlich getrennt Die Initiation der Translation bei Eukaryoten Der eukaryotische Initiationskomplex erkennt zuerst das 5 -cap der mrna und
Es ist die Zeit gekommen, zu verstehen, wie es zur Proteinbiosynthese kommt?! Wobei jeweils eine AS von 3 Basen codiert wird..
 Proteinbiosynthese Es ist die Zeit gekommen, zu verstehen, wie es zur Proteinbiosynthese kommt?! Alle Proteine, sind über die DNA codiert Wobei jeweils eine AS von 3 Basen codiert wird.. GENETISCHER CODE
Proteinbiosynthese Es ist die Zeit gekommen, zu verstehen, wie es zur Proteinbiosynthese kommt?! Alle Proteine, sind über die DNA codiert Wobei jeweils eine AS von 3 Basen codiert wird.. GENETISCHER CODE
1.1 Proteinsynthese und intrazellulärer Transport von integralen Membranproteinen in eukaryotischen Zellen
 1. Einleitung 1.1 Proteinsynthese und intrazellulärer Transport von integralen Membranproteinen in eukaryotischen Zellen Der intrazelluläre Transport von Membranproteinen erfolgt über den sogenannten sekretorischen
1. Einleitung 1.1 Proteinsynthese und intrazellulärer Transport von integralen Membranproteinen in eukaryotischen Zellen Der intrazelluläre Transport von Membranproteinen erfolgt über den sogenannten sekretorischen
Translation benötigt trnas und Ribosomen. Genetischer Code. Initiation Elongation Termination
 8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation Elongation Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse huma n bacter
8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation Elongation Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse huma n bacter
Stoffklasse: LIPIDE Funktionen in der Zelle
 Stoffklasse: LIPIDE Funktionen in der Zelle Zellmembranen Industrielle Nutzung Strukturelle Lipide Speicherstoffe Signalstoffe, Hormone Pigmente 2 1 R 1 R 2 3 5 7 2 4 A 6 B 8 R 3 1 21 22 9 N N H 17 1 20
Stoffklasse: LIPIDE Funktionen in der Zelle Zellmembranen Industrielle Nutzung Strukturelle Lipide Speicherstoffe Signalstoffe, Hormone Pigmente 2 1 R 1 R 2 3 5 7 2 4 A 6 B 8 R 3 1 21 22 9 N N H 17 1 20
Biophysikalisches Seminar
 Biophysikalisches Seminar Naturwissenschaftliche Fakultät III Institut für Biophysik und physikalische Biochemie Datum: 12.1./13.1.07 Thema: Die Bedeutung von Chaperonen und Verfasser: Claudia Seidl Chaperone
Biophysikalisches Seminar Naturwissenschaftliche Fakultät III Institut für Biophysik und physikalische Biochemie Datum: 12.1./13.1.07 Thema: Die Bedeutung von Chaperonen und Verfasser: Claudia Seidl Chaperone
Die nachfolgende Gliederung gibt nur einen groben Überblick über den in der Biologie für Mediziner Lehrveranstaltung vermittelten Stoffumfang und
 Die nachfolgende Gliederung gibt nur einen groben Überblick über den in der Biologie für Mediziner Lehrveranstaltung vermittelten Stoffumfang und kann daher nur als Anregung zum Nacharbeiten dienen. Es
Die nachfolgende Gliederung gibt nur einen groben Überblick über den in der Biologie für Mediziner Lehrveranstaltung vermittelten Stoffumfang und kann daher nur als Anregung zum Nacharbeiten dienen. Es
Prüfungsthema. Motorproteine, Zellbewegung Biologische Rolle der Motorproteine. Klassifizierung der Motoreiweiße
 Motorproteine, Zellbewegung den 02. Dezember 2016 Prüfungsthema Motorproteine, Zellbewegung. Definition der Motorproteine. Klassifizierung der Motorproteine. Der ATPase-Zyklus von Myosin (Querbrückenzyklus).
Motorproteine, Zellbewegung den 02. Dezember 2016 Prüfungsthema Motorproteine, Zellbewegung. Definition der Motorproteine. Klassifizierung der Motorproteine. Der ATPase-Zyklus von Myosin (Querbrückenzyklus).
Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle
 Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle Inhalt Anhang Kapitel 06.02: Die Zelle... 1 Inhalt... 2 Zellorganellen im EM: die Zellmembran... 3 Zellkern einer Leberzelle... 4 Zellkern... 4 Poren der Kernmembran...
Anhang zu Kapitel 06.02: Die Zelle Inhalt Anhang Kapitel 06.02: Die Zelle... 1 Inhalt... 2 Zellorganellen im EM: die Zellmembran... 3 Zellkern einer Leberzelle... 4 Zellkern... 4 Poren der Kernmembran...
PROTEINBIOSYNTHESE "Das zentrale Dogma der Molekularbiologie"
 PROTEINBIOSYNTHESE "Das zentrale Dogma der Molekularbiologie" Die für die Synthese von Eiweißstoffen notwendigen Schritte sind: (1) Replikation der DNA: Vor jeder Zellteilung wird die gesamte zelluläre
PROTEINBIOSYNTHESE "Das zentrale Dogma der Molekularbiologie" Die für die Synthese von Eiweißstoffen notwendigen Schritte sind: (1) Replikation der DNA: Vor jeder Zellteilung wird die gesamte zelluläre
Lebewesen und ihre Zellen
 Lebewesen und ihre Zellen Linus Metzler Die Zelle L i m e n e t L i n u s M e t z l e r W a t t s t r a s s e 3 9 3 0 6 F r e i d r f 0 7 1 4 5 5 1 9 1 5 0 7 9 5 2 8 1 7 4 2 0 2. 1 0. 2 0 0 9 2 Lebewesen
Lebewesen und ihre Zellen Linus Metzler Die Zelle L i m e n e t L i n u s M e t z l e r W a t t s t r a s s e 3 9 3 0 6 F r e i d r f 0 7 1 4 5 5 1 9 1 5 0 7 9 5 2 8 1 7 4 2 0 2. 1 0. 2 0 0 9 2 Lebewesen
Zellstrukturen und ihre Funktionen Raues Endoplasmatisches Retikulum
 Zellstrukturen und ihre Funktionen Raues Endoplasmatisches Retikulum besonders ausgeprägt in Drüsenzellen dann meist nur wenig oder kein glattes ER vorhanden rer einer Drüsenzelle: Ergastoplasma = Stapel
Zellstrukturen und ihre Funktionen Raues Endoplasmatisches Retikulum besonders ausgeprägt in Drüsenzellen dann meist nur wenig oder kein glattes ER vorhanden rer einer Drüsenzelle: Ergastoplasma = Stapel
Grundlagen der Biochemie (BCh 5.3) Prof. Dr. Christoph Thiele WS 2014/15 1. Klausur ( )
 Grundlagen der Biochemie (BCh 5.3) Prof. Dr. Christoph Thiele WS 2014/15 1. Klausur (6.2.2015) Aufgabe 1: Erläutern Sie die Primär-, Sekundär- und die Tertiärstruktur von Proteinen. [3 P] Aufgabe 2: Erklären
Grundlagen der Biochemie (BCh 5.3) Prof. Dr. Christoph Thiele WS 2014/15 1. Klausur (6.2.2015) Aufgabe 1: Erläutern Sie die Primär-, Sekundär- und die Tertiärstruktur von Proteinen. [3 P] Aufgabe 2: Erklären
GRUNDLAGEN DER MOLEKULARBIOLOGIE
 Page 1 of 7 GRUNDLAGEN DER MOLEKULARBIOLOGIE Prof. Dr. Anne Müller 6 Genetische Vielfalt / Gen-Umordnungen 6.1 RNA-Editing 6.2 Alternatives Spleissen 6.3 Gen-Umordnungen Wie kann die Zahl der Proteine
Page 1 of 7 GRUNDLAGEN DER MOLEKULARBIOLOGIE Prof. Dr. Anne Müller 6 Genetische Vielfalt / Gen-Umordnungen 6.1 RNA-Editing 6.2 Alternatives Spleissen 6.3 Gen-Umordnungen Wie kann die Zahl der Proteine
Transkription 3. Teil. Posttranskriptionale Modifikationen
 Transkription 3. Teil Posttranskriptionale Modifikationen Gliederung des Vortrags 1. Reifung der t-rna 2. Modifikationen der Prä-mRNA 5 Capping 3 Schwanzbildung RNA-Editing Spleißen Alternatives Spleißen
Transkription 3. Teil Posttranskriptionale Modifikationen Gliederung des Vortrags 1. Reifung der t-rna 2. Modifikationen der Prä-mRNA 5 Capping 3 Schwanzbildung RNA-Editing Spleißen Alternatives Spleißen
Translation benötigt trnas und Ribosomen. Genetischer Code. Initiation Elongation Termination
 8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation Elongation Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse huma n bacter
8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation Elongation Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse huma n bacter
Grundlagen der Genetik
 Grundlagen der Genetik DNA-Struktur Replikatin Transkriptin Translatin Mutatin Nutzungsbedingungen: cc/by-nc-sa Genetik als Teil der Biwissenschaften Die Genetik ist eine Biwissenschaft und spielt in vielen
Grundlagen der Genetik DNA-Struktur Replikatin Transkriptin Translatin Mutatin Nutzungsbedingungen: cc/by-nc-sa Genetik als Teil der Biwissenschaften Die Genetik ist eine Biwissenschaft und spielt in vielen
Biologie für Mediziner
 Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
Biologie für Mediziner - Zellbiologie 1 - Prof. Dr. Reiner Peters Institut für Medizinische Physik und Biophysik/CeNTech Robert-Koch-Strasse 31 Tel. 0251-835 6933, petersr@uni-muenster.de Dr. Martin Kahms
1) Erklären sie die Begriffe Primär Sekundär und Tertiärstruktur von Proteinen. Nennen Sie drei typische Sekundärstrukturelemente (6P)
 1. Klausur zum Modul 5.3 Biochemie WS 09/10 12.2.2010 1) Erklären sie die Begriffe Primär Sekundär und Tertiärstruktur von Proteinen. Nennen Sie drei typische Sekundärstrukturelemente (6P) 2) Welche Funktion
1. Klausur zum Modul 5.3 Biochemie WS 09/10 12.2.2010 1) Erklären sie die Begriffe Primär Sekundär und Tertiärstruktur von Proteinen. Nennen Sie drei typische Sekundärstrukturelemente (6P) 2) Welche Funktion
Das Zytoskelett. Mikrotubuli-bindende Proteine. Mikrotubuli-assoziierter Transport. Kinocilien
 Das Zytoskelett Mikrotubuli-bindende Proteine Mikrotubuli-assoziierter Transport Kinocilien Mikrotubuli-bindende Proteine Mikrotubuli-bindende Proteine Entwicklung der Asymmetrie von Mikrotubuli in Epithelzellen
Das Zytoskelett Mikrotubuli-bindende Proteine Mikrotubuli-assoziierter Transport Kinocilien Mikrotubuli-bindende Proteine Mikrotubuli-bindende Proteine Entwicklung der Asymmetrie von Mikrotubuli in Epithelzellen
Zusammenfassung. 1 Einleitung. 2 Material & Methoden. 1.1 Hepatitis B Virus (HBV) 1.2 Adeno-Assoziierte Viren (AAV) 1.3 Das humane Immunsystem
 Zusammenfassung 1 Einleitung 1.1 Hepatitis B Virus (HBV) 1.1.1 Epidemiologie des humanen HBV 1.1.2 Partikelaufbau des HBV 1.1.3 Hüllproteine 1.1.4 Genomorganisation 1.1.5 Replikationszyklus 1.2 Adeno-Assoziierte
Zusammenfassung 1 Einleitung 1.1 Hepatitis B Virus (HBV) 1.1.1 Epidemiologie des humanen HBV 1.1.2 Partikelaufbau des HBV 1.1.3 Hüllproteine 1.1.4 Genomorganisation 1.1.5 Replikationszyklus 1.2 Adeno-Assoziierte
Nucleophiler Angriff Ein Nucleophil greift ein positiv polarisiertes Kohlenstoff in einer Verbindung an.
 Weiter im Text: Der RNA-Primer, kann die DNA nucleophil angreifen. Nucleophil: ein stark "kernliebendes" Teilchen, das negativ polarisiert ist (z.b. OH-) und ein positiv polarisiertes (elektronenarmes)
Weiter im Text: Der RNA-Primer, kann die DNA nucleophil angreifen. Nucleophil: ein stark "kernliebendes" Teilchen, das negativ polarisiert ist (z.b. OH-) und ein positiv polarisiertes (elektronenarmes)
Hauptklausur Biologie der Zelle WS2011/2012. Auswertung. So, für alle Abgemeldeten und Nachfolgegenerationen: Die erste Klausur mit Panstruga-Teil.
 So, für alle Abgemeldeten und Nachfolgegenerationen: Die erste Klausur mit Panstruga-Teil. Hauptklausur Biologie der Zelle WS2011/2012 Maximal erreichbare Punktzahl: 100 Zeit: 60 Minuten* Punkte Note ab
So, für alle Abgemeldeten und Nachfolgegenerationen: Die erste Klausur mit Panstruga-Teil. Hauptklausur Biologie der Zelle WS2011/2012 Maximal erreichbare Punktzahl: 100 Zeit: 60 Minuten* Punkte Note ab
Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8)
 Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8) 1. Proteinfaltung: Theorie und Experiment 2. Proteindynamik 3. Strukturelle Evolution A. Protein-Renaturierung Denaturierung in
Faltung, Dynamik und strukturelle Evolution der Proteine (Voet Kapitel 8) 1. Proteinfaltung: Theorie und Experiment 2. Proteindynamik 3. Strukturelle Evolution A. Protein-Renaturierung Denaturierung in
Grundlagen der Molekularen Biophysik WS 2011/12 (Bachelor) Dozent: Prof Dr. Ulrike Alexiev (R , Tel /Sekretariat Frau Endrias Tel.
 Grundlagen der Molekularen Biophysik WS 2011/12 (Bachelor) Dozent: Prof Dr. Ulrike Alexiev (R.1.2.34, Tel. 55157/Sekretariat Frau Endrias Tel. 53337) Tutoren: Dr. Kristina Kirchberg, Alex Boreham 6-stündig
Grundlagen der Molekularen Biophysik WS 2011/12 (Bachelor) Dozent: Prof Dr. Ulrike Alexiev (R.1.2.34, Tel. 55157/Sekretariat Frau Endrias Tel. 53337) Tutoren: Dr. Kristina Kirchberg, Alex Boreham 6-stündig
Welche Hauptgruppen von Organismen gehören zu den Mikroorganismen? o Bacteria o Archaea o Pilze o Mikroalgen o Euglena o Protozoen o Viren
 Welche Hauptgruppen vn Organismen gehören zu den Mikrrganismen? Bacteria Archaea Pilze Mikralgen Euglena Prtzen Viren Welche mrphlgischen Grundfrmen der Bakterien kennen Sie? Kkken rund der eiförmig Stäbchen
Welche Hauptgruppen vn Organismen gehören zu den Mikrrganismen? Bacteria Archaea Pilze Mikralgen Euglena Prtzen Viren Welche mrphlgischen Grundfrmen der Bakterien kennen Sie? Kkken rund der eiförmig Stäbchen
Cholesterolmoleküle. Membranproteine können Zellen. miteinander verknüpfen. tragen Kohlenhydratketten. Manche Lipide (Glykolipide)
 Zellinnenraum Manche Lipide (Glykolipide) tragen Kohlenhydratketten. Membranproteine können Zellen miteinander verknüpfen. Manche Proteine (Glykoproteine) tragen Kohlenhydratketten. Cholesterolmoleküle
Zellinnenraum Manche Lipide (Glykolipide) tragen Kohlenhydratketten. Membranproteine können Zellen miteinander verknüpfen. Manche Proteine (Glykoproteine) tragen Kohlenhydratketten. Cholesterolmoleküle
SUMOylierung ein neuer Regulationsmechanismus. zur Membran
 SUMOylierung ein neuer Regulationsmechanismus des Transportes von CFTR zur Membran Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften an der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität
SUMOylierung ein neuer Regulationsmechanismus des Transportes von CFTR zur Membran Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften an der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität
Testklausur Zellbiologie - Grundvorlesungsstoff 2010
 - 1 - Testklausur Zellbiologie - Grundvorlesungsstoff 2010 Bereich B: Zellfunktionen (Vorlesungen 5-9) Insgesamt sollen 40 Kreuze gesetzt werden (= 40 Punkte), dh bei 10 Fragen sind mehrere Antworten (maximal
- 1 - Testklausur Zellbiologie - Grundvorlesungsstoff 2010 Bereich B: Zellfunktionen (Vorlesungen 5-9) Insgesamt sollen 40 Kreuze gesetzt werden (= 40 Punkte), dh bei 10 Fragen sind mehrere Antworten (maximal
Mögliche Verteilung der Inhalte Sekundarstufe I
 Tabelle 1 Verteilung der Fachinhalte Struktur und Funktin in der Sekundarstufe I Basisknzepts Sek I - SF1 1 Struktur und Funktin vn Organen bzw. Organsystemen bedingen sich gegenseitig. Sek I - SF2 Die
Tabelle 1 Verteilung der Fachinhalte Struktur und Funktin in der Sekundarstufe I Basisknzepts Sek I - SF1 1 Struktur und Funktin vn Organen bzw. Organsystemen bedingen sich gegenseitig. Sek I - SF2 Die
Golgi-Apparat und Transport
 E Bio 1 KW 4 Golgi-Apparat und Transport Aufgaben: 1) Erläutern Sie den Transport mittels Vesikel und die Funktion des Golgi- Apparats. 2) Geben Sie eine Definition für Endo- und Exocytose und Membranfluss
E Bio 1 KW 4 Golgi-Apparat und Transport Aufgaben: 1) Erläutern Sie den Transport mittels Vesikel und die Funktion des Golgi- Apparats. 2) Geben Sie eine Definition für Endo- und Exocytose und Membranfluss
