Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg.
|
|
|
- Inken Schenck
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Chirurgischen Klinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Werner Hohenberger durchgeführt am Lehrkrankenhaus Bayreuth in der Chirurgischen Klinik II Chefarzt: Prof. Dr. med. Dr. habil. Walter Wagner Klinische Evaluation zu Altersunterschieden, zu Unterschieden bei Zwei- und Mehrfragmentfrakturen und zum Gesamtergebnis nach der winkelstabilen Plattenosteosynthese proximaler Humerusfrakturen am Klinikum Bayreuth Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg vorgelegt von Kerstin Hackl aus Bayreuth 2012
2 Gedruckt mit Erlaubnis der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Dekan: Referent: Korreferent: Prof. Dr. Dr. h.c. J. Schüttler Prof. Dr. Dr. W. Wagner Priv. Doz. Dr. R. Richter Tag der mündlichen Prüfung: 29. August 2012
3 Meinen Eltern gewidmet
4 Inhaltsverzeichnis: 1 Zusammenfassung/Summary.1 2 Einleitung Theoretischer Teil Schultergelenk und proximaler Humerus Glenohumeralgelenk mit Kapsel-, Band-, Muskelstrukturen Proximaler Humerus Gefäß- und Nervenversorgung des proximaler Humerus Bewegungsausmaß des Schultergelenks Proximale Humerusfraktur Pathomechanismus Frakturklassifikation Neer Klassifikation AO/ASIF-Klassifikation Klinisch - praktische Einteilung Therapie Konservative Therapie Operative Therapie Material und Methoden Studienaufbau Patienten und Nachuntersuchungsrate Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien Philosplatte und Operationstechnik Zielsetzung Verwendete Scores DASH-Score
5 4.2.2 Constant-Score Statistische Methoden Ergebnisse Beschreibung des Patientenkollektivs Altersgruppen und Geschlecht Geschlecht und Body-Maß-Index Altersgruppen und ASA Altersgruppen und Anzahl der Fragmente Altersgruppen und Zeitraum Trauma bis OP Altersgruppen und Frakturursache Schulterluxation Frakturlokalisation Komplikationen Unterschiede in den Altersgruppen Dauer des stationären Aufenthalts je nach Altersgruppe Schnitt-Naht-Zeit je nach Altersgruppe DASH-Score alt je nach Altersgruppe DASH-Score neu je nach Altersgruppe Constant-Scores gesamt je nach Altersgruppe Bewertung des Constant-Score je nach Altersgruppe Schlafstörungen je nach Altersgruppe Schmerzen je nach Altersgruppe Einschränkungen im Alltag je nach Altersgruppe DASH-Score und Constant-Score ohne Vergleich Unterschiede je nach Anzahl der Fragmente Constant-Score Bewegung je nach Anzahl der Fragmente Constant-Scores gesamt je nach Anzahl der Fragmente.60
6 5.5 Unterschiede im Constant-Score je nach Zeitintervall Diskussion Allgemeine Betrachtung Diskussion der Ergebnisse der Nachuntersuchung bzw. Befragung 64 7 Literaturverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Danksagung Lebenslauf...74
7 - 1-1 Zusammenfassung Ziel Ziel dieser Arbeit ist die klinische Evaluation der operativen Versorgung proximaler Humerusfrakturen mit einer winkelstabilen Osteosynthese (Philos Platte). Altersunterschiede werden anhand des Constant- und des DASH-Score, anhand von Schmerzen, Schlafstörungen, Einschränkungen im Alltag, stationären Aufenthaltsdauer und Operationszeit bei drei Altersgruppen eruiert. Methodik Im Zeitraum vom bis wurden insgesamt 81 Patienten mit proximaler Humerusfraktur, die mit einer winkelstabilen Osteosynthese (Philos Platte) versorgt wurden, aufgenommen. Das mittlere Patientenalter war bei 67 Jahren. Der DASH-Score konnte bei 49 Patienten, der Constant-Score bei 47 Patienten erhoben werden. Es wurden drei fast gleich große Altersgruppen gebildet mit Jahre, Jahre und Jahre. Ergebnisse Signifikante Unterschiede bei der stationären Aufenthaltsdauer zeigten sich in den Altersgruppen weder im gesamten Patientenkollektiv noch bei den nachuntersuchten bzw. befragten Patienten. Die Aufenthaltsdauer lag im Durchschnitt in den Altersgruppen bei 9,4 bis 11,3 Tagen. Die Schnitt-Naht-Zeit in den Altersgruppen war sowohl im gesamten Patientenkollektiv als auch bei den nachuntersuchten bzw. befragten Patienten annähernd gleich. Sie lag im Mittelwert zwischen 60,7 Minuten und 64 Minuten. Der DASH-Score betrug bei allen nachuntersuchten bzw. befragten Patienten zehn bzw. 35 Punkte (nach dem neuen Berechnungssystem). Es bestanden zwar Unterschiede zwischen den Altersgruppen, beim paarweisen Einzelvergleich war nach dem neuen Berechnungssystem gerade noch (p-wert ist knapp unter dem adjustierten Wert) ein signifikanter Unterschied zwischen der ältesten und der jüngsten Altersgruppe zu sehen. Nach dem alten Berechnungssystem war gerade kein signifikanter Unterschied im paarweisen Einzelvergleich mehr nachweisbar.
8 - 2 - Der Constant-Score erreichte insgesamt 81,62%, was einem guten Ergebnis entspricht. Paarweise signifikante Differenzen traten nur zwischen der jüngsten und ältesten Gruppe auf. Im Mittel lag der Score in der jüngsten Gruppe bei 89,18%, in der mittleren bei 77,33% und in der ältesten bei 77,33 %. In den Altersgruppen gab es bei den Schlafstörungen und Schmerzen keine signifikanten Unterschiede. 41 von 49 Patienten hatten keine Schlafstörungen und 33 von 49 Patienten zeigten auch keine Schmerzen. Die Einschränkungen im Alltag traten in den älteren Altersguppen häufiger und stärker auf. Die Unterschiede zwischen den Altersklassen konnten aber nur als schwach signifikant gewertet werden. Im Constant-Score Bewegung sowie im Constant-Score gesamt gab es keine signifikanten Unterschiede je nach Anzahl der Fragmente (Zwei-, Drei- und Vierfragmentfraktur). Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede bei den Patienten festgestellt werden, die schon nach 13 oder erst nach 30 Monaten nachuntersucht bzw. befragt wurden. Schlussfolgerung Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die winkelstabile Plattenosteosynthese eine der besten Operationsmethoden zur Versorgung der proximalen Humerusfraktur mit einem guten Langzeitergebnis darstellt. Die älteren Patienten, bei denen erfahrungsgemäß oft eine Osteoporose vorliegt, zeigen auch gute Ergebnisse. Diese Ergebnisse werden durch mehrere in der neusten Zeit veröffentlichte Studien bestätigt. Summary Aims and objectives The aim of my research is the clinical evaluation of surgical patient care for proximal humerus fractures using a locking osteosynthesis (Philos plate). Differences between age groups is determined using the Constant Score and the DASH Score, measuring pain, sleep disturbance, restrictions in daily life, length of stay in hospital and operating time in three different age groups.
9 - 3 - Method In the time period from to , data on a total of 81 patients with proximal humerus fractures, who were treated with a locking osteosynthesis (Philos plate), was collected. The average age of the patients was 67. The DASH Score was ascertained for 49 patients, the Constant Score for 47. The patients were divided into three age groups of almost exactly the same size: years old, years old and years old. Results There were no significant differences in length of stay in hospital between the age groups, neither within the overall group of patients, nor within the group of patients who were subject to a follow-up study or an interview. The average length of stay in hospital in all age groups was between 9.4 and 11.3 days. The operating time was also roughly the same across the age groups, both within the overall group of patients, and within the group of patients who were subject to a follow-up study or an interview. The average operating time was between 60.7 minutes and 64 minutes. The DASH Score for those patients who were subject to a follow-up study or an interview was 10 points, or 35 points (according to the new scoring system). Although there were differences between the age groups, there was only a significant difference between the oldest and the youngest age group in the individual paired comparison, according to the new scoring system (the p-value is just below the adjusted value). According to the old scoring system, there was almost no significant difference discernable in the individual paired comparison. The result of the Constant Score was a total of 81.62%, which is a good result. Paired significant differences only emerged between the youngest and oldest groups. The average score in the youngest group was 89.18%, in the middle group 77.33% and in the oldest, 77.33%. There were no significant differences in sleep disturbance or pain across the age groups. 41 out of 49 patients had no sleep disturbance; 33 out of 49 patients did not experience any pain. Restrictions in daily life could be identified more frequently and more strongly in the older age groups. The differences between the age groups could however only be evaluated as weakly significant.
10 - 4 - In the Constant Score movement as well as in the Constant Score total, there were no significant differences between patients with a different number of fragments (two, three and four fragment fractures). Neither could significant differences be identified between patients who were subject to a follow-up study or interview after 13 and 30 months respectively. Conclusions The results of my research show that a locking osteosynthesis is one of the best methods of operating on and caring for patients with proximal humerus fractures, and also provides positive long-term results. This is particularly true in the case of older patients, who often suffer from osteoporosis. These results are confirmed by numerous very recently published studies.
11 - 5-2 Einleitung Etwa vier Prozent aller Frakturen des menschlichen Körpers betreffen den Oberarmkopf (26). Aufgrund der bekannten Altersverschiebung, die mit einem Anstieg des Durchschnittalters einhergeht, nimmt die Inzidenz der proximalen Humerusfraktur zu. Durch das höhere Patientenalter steigen auch die Komorbidität und damit die Komplikationsrate (20). Studien haben ergeben, dass die Inzidenz der proximalen Humerusfraktur bei 1120/ Personenjahre liegt. Die Bruchursache ist in 79 % der Fälle ein Sturz (13). Mittlerweile betrifft fast jede 20. Fraktur den Humeruskopf (34). Frauen sind im Durchschnitt zwei- bis dreimal so oft betroffen, da sie häufig eine ausgeprägtere Osteoporose haben als die männlichen Altersgenossen (10). Erfahrungsgemäß können etwa 75-85% der proximalen Humerusfrakturen konservativ behandelt werden. Die restlichen 15-25% der Frakturen sind instabil und somit eine Domäne der operativen Therapie (38). Zunehmend bevorzugen die Patienten auch bei dieser Fraktur eine operative Therapie, um lange Ruhigstellung zu vermeiden und schnell wieder ins Arbeitsleben zurückkehren zu können. Bei 20% der Frakturen besteht aufgrund der Dislokation oder Mehrfragmentfrakturen die Indikation zur operativen Therapie (20). Diese stellt meist wegen der dislozierten Brüche, der Knochenqualität und der degenerativen Veränderungen eine Herausforderung für die operative Therapie dar (41). Laut einer norwegischen Untersuchung liegt die Hospitalisationsrate bei elf Prozent. 45% aller Humerusfrakturen und 76% aller Humerusfrakturen bei über 40-jährigen betreffen den proximalen Anteil. Bei Kinder und Jugendlichen ist die proximale Humerusfraktur mit 3% aller Frakturen selten (11). Die proximale Humerusfraktur ist in ihrer Häufigkeit und Komplexität eine bleibende Herausforderung des klinischen Alltags und steht unverändert im Fokus klinischen und wissenschaftlichen Interesses. Es resultieren stetige Weiterentwicklungen und Innovationen in Versorgungsstrategie und -techniken. (42). In dieser Arbeit werden die Ergebnisse nach Osteosynthese mittels winkelstabilen Platten (Philos Platte, Synthes ) behandelt.
12 - 6-3 Theoretischer Teil 3.1 Das Schultergelenk und der proximale Humerus Das Glenohumeralgelenk mit Kapsel, Band-, Muskelstrukturen Das Schultergelenk ist das Kugelgelenk mit dem größten Bewegungsumfang aller Gelenke des Menschen (31). Das Schultergelenk (Articulatio humeri) wird von Humerus und Scapula gebildet. Dabei stellt das Caput humeri den Gelenkkopf. Der Humeruskopf hat einen Krümmungsradius von 2,5 cm. Die Gelenkpfanne bildet die Cavitas glenoidalis der Scapula. Das Verhältnis der Gelenkfläche des Kopfes und der Gelenkfläche der Pfanne ist 4:1. Die Kontaktfläche wird allerdings durch das Labrum glenoidale vergrößert. Dieser Faserknorpel verläuft am Rand der Cavitas glenoidalis ringsherum. Die Gelenkkapsel ist am Collum scapulae, am Labrum glenoidale und am Collum anatomicum humeri befestigt. Tuberculum majus und minus liegen außerhalb der Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel ist schlaff und weit, um den großen Bewegungsumfang zu ermöglichen. Zur Führung des Schultergelenks sind vor allem Muskeln und in die Gelenkkapsel einstrahlende Sehnen benachbarter Muskeln der Rotatorenmanschette (Sehnen des M. supraspinatus, des M. infrasinatus, des M. teres minor und des M. subscapularis) verantwortlich. Hierdurch wird die Kapsel verstärkt und die Dislokation der Gelenkflächen verhindert. Zur Gelenksicherung sind der Muskelmantel und die Sehne des langen Bizepskopfes verantwortlich. Das Schultergelenk ist das Gelenk mit Muskelführung. Der Bandapparat spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle (31).
13 - 7 - Abb. 1 Frontalschnitt aus dem rechten Schultergelenk (31) Proximaler Humerus Der Humerus besteht aus dem Corpus humeri und der Extremitas proximalis und distalis. An das halbkugelartige Caput humeri (Oberarmgelenkkopf) schließt sich das Collum anatomicum an. Darunter liegt das Tuberculum majus, nach lateral gerichtet, und das Tuberculum minus, nach ventral gerichtet. Nach distal setzen sich diese durch die Crista tuberculi majoris und Crista tuberculi minoris fort. Die Rinne zwischen den beiden Tuberculi nennt man Sulcus intertubercularis. In diesem verläuft die lange Bicepssehne. Unterhalb der Tuberculi liegt das Collum chirurgicum, das besonders bruchgefährdet ist (31).
14 - 8 - Abb. 2 Linker Humerus von vorne 45% (36) Die Gefäß- und Nervenversorgung des proximalen Humerus Der proximale Humerus wird durch die Äste der A. axillaris, die aus der A. subclavia kommt, versorgt. Sie verläuft von der Scapula bis zum Unterrand des M. pectoralis minor. Sie verläuft vorn in der Achselhöhle entlang des M. coracobrachialis. Für den proximalen Humerus wichtige Äste sind die A. circumflexa humeri anterior und posterior. Die A. circumflexa humeri anterior läuft um das Collum chirurgicum zum Sulcus intertubercularis und zieht dann zum Schultergelenk und zum M. deltoideus.
15 - 9 - Die A. circumflexa humeri posterior verläuft entlang der lateralen Achsellücke zusammen mit dem N. axiallis und den Vv. circumflexae posteriores humeri. Sie versorgt die Gelenkkapsel, M. deltoideus und das Caput longum des M triceps brachii. Die beiden beschriebenen Arterien bilden eine Anastomose (31). Schulter und Arm werden vom Plexus brachialis innerviert. Der Plexus wird durch die Rami anteriores der Spinalnerven aus den Segmenten C5- Th1 und kleinen Bündeln aus C4 und Th2 gebildet. Es werden drei Trunci gebildet: Truncus superior aus C5 und C6 mit kleinen Bündeln aus C4, Truncus medius aus C7, Truncus inferior aus C8 und Th1 mit kleinen Bündeln aus Th2. Diese ziehen durch die Skalenuslücke in den Bereich der Clavikula und bilden dort drei Fasciculi: Fasciculus lateralis aus Truncus superior und medius, Fasciculus medialis aus Truncus inferior und Fasciculus posterior aus den dorsalen Anteilen aller drei Trunci. Für die nervale Versorgung der Schulter ist der letztgenannte Fasciculus besonders wichtig. Aus dem Fasciculus posterior wird der N. radialis und der N. axillaris gebildet. Der N. axillaris ist für die Abduktionsfähigkeit im Schultergelenk und für die Sensibilität über dem Deltamuskel verantwortlich. Der Nervus radialis versorgt die Streckergruppe des Oberarms. (31) Abb. 3 A. subclavia dexter und A. axillaris mit ihren Ästen (31)
16 Bewegungsausmaß des Schultergelenks Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk mit drei Bewegungsachsen: 1. Transversale Achse : Anteversion / Retroversion 2. Sagittale Achse : Abduktion / Adduktion 3. Vertikale Achse : Außenrotation / Innenrotation (2) Abb. 4 a-d Untersuchung und Dokumentation des Bewegungsausmaßes im Schultergelenk nach der Neutral-0 -Methode (20)
17 Die proximale Humerusfraktur Pathomechanismus Die Verletzungsursache der proximale Humerusfraktur ist meist ein Sturz auf die ausgestreckte Hand, ein Anprall auf die Schulter oder eine übermäßige Außenrotationsbewegung auf den abduzierten Arm (10,13). Hinsichtlich der einwirkenden Kraft werden Kompressionsbrüche, Scherbrüche und Biegungsbrüche unterschieden (10). Als Verletzungsmechanismus genügt bei älteren Patienten oft ein Niedrigenergietrauma wie zum Beispiel ein einfacher Sturz aufgrund einer vorliegenden Osteoporose. Bei jüngeren Patienten liegt oft ein Hochenergietrauma wie ein Sportoder Verkehrsunfall vor (23). Dabei kommt es dann häufig zu Luxationen und anderen vital bedrohlichen Verletzungen (20) Frakturklassifikation Neer-Klassifikation Die gebräuchlichste Einteilung von Oberarmkopffrakturen, ist die nach Neer, der den proximalen Humerus in vier Hauptfragmente unterteilt: Kalotte Tuberculum majus Tuberculum minus Schaft (distal des Collum chirurgicum) (35). Entscheidend für die Einteilung sind die Anzahl der Fragmente, das Vorliegen einer Dislokation bzw. einer Luxation (siehe Abbildung 5).
18 Abb. 5 Klassifikation der proximalen Humerusfraktur nach Neer (3)
19 AO/ASIF-Klassifikation Mit der AO/ASIF-Klassifikation lässt sich am besten das Risiko einer Gefäßverletzung oder Kopfnekrose abschätzen. Man unterteilt drei Hauptgruppen. Typ-A-Frakturen sind rein extrakapsulär und gehen mit einem minimalen Risiko für eine Humeruskopfnekrose einher. Gefäßverletzungen sind unwahrscheinlich. In diese Kategorie gehören beispielsweise Frakturen des Tuberculum majus. Typ-B Frakturen sind partiell intrakapsulär gelegen. Drei der möglichen vier Fragmente sind betroffen. Das Risiko einer Humeruskopfnekrose ist erhöht. Das höchste Risiko hat die Typ-C-Fraktur. Sie liegt intrakapsulär und es sind alle vier Fragmente betroffen (20). Abb. 6 Die AO/ASIF-Klassifikation am proximalen Humerus (20)
20 Klinisch-praktische Einteilung Die oben genannten Klassifikationen sind sehr aufwendig und im Nachhinein schlecht reproduzierbar. Leichter nachzuvollziehen ist die klinisch-praktische Einteilung: - isolierter Abriss von Tuberculum majus oder Tuberculum minus - Fraktur durch das Collum anatomicum (Kalottenfraktur) oder chirurgicum (subkapitale Fraktur) - Fragmentzahl: Zwei- (Kopf und Schaft), Drei- (Kopf, Schaft und Tuberculum majus oder Tuberculum minus) und Vierfragmentfraktur (Kopf, Schaft und beide Tubercula) - reine Fraktur und Luxationsfraktur (37). Abb. 7 Proximale Humerusfrakturen (37) Therapie Je nach Schwere der Fraktur entscheidet man sich für eine konservative oder operative Therapie. Bei der operativen Therapie gibt es wiederum unterschiedliche Möglichkeiten je nach Frakturmorphologie, Alter, Knochenstabilität und Aktivitätsanforderungen des Patienten Konservative Therapie Nach Tingart et al. können 65-85% der proximalen Humerusfrakturen konservativ behandelt werden (20). Nicht dislozierte Frakturen werden meist konservativ behandelt. An der Uniklinik Hannover wird folgende Vorgehensweise praktiziert, nachdem Krettek et. al. eine Vergleichsstudie konservative Therapie versus operative Therapie publiziert hat, in der der Vorteil einer konservativen Therapie bei
21 bestimmter Frakturmorphologie bei über 60-jährigen nachgewiesen wurde. Bei Patienten die älter als 60 Jahre sind, besteht eine Indikation zum konservativen Vorgehen sowohl bei dislozierten Frakturen (< 1cm, < 45 ) als auch bei wenig dislozierten Frakturen (> 1cm, > 45 ), sofern keine klare OP-Indikation besteht. Klare OP-Indikationen sind Luxationsfrakturen, Head-split-Frakturen, offener Weichteilschaden, pathologische Frakturen und nicht reponierbaren Schaftdislokation größer 50% (18). Head-split-Frakturen sind Trümmerfrakturen des Humeruskopfes mit Destruktion der Gelenkfläche. Durch die Separation der fakturierten Anteile von der Gefäßversorgung besteht ein hohes Risiko für eine Humeruskopfnekrose (20). Anders ist die Empfehlung bei Patienten, die jünger sind als 60 Jahre. Hier wird die Indikation zur Operation deutlich enger gestellt. Hier wird nur bei nicht und gering dislozierten Frakturen ein konservatives Vorgehen empfohlen. Bei Patienten mit hohen Aktivitätsanforderungen kann es auch besser sein eine gering dislozierte Fraktur zu operieren. Diese Problematik ist mit jedem Patienten individuell zu diskutieren. Grundsätzlich müssen aber immer patientenbezogene Faktoren (Alter, Komorbidität, Aktivitätsanspruch, Begleitverletzungen) mit einbezogen werden (18). Die Abrissfraktur des Tuberkulum majus wird nur bei nicht und gering dislozierten Frakturen (< 3 cm) konservativ behandelt (34). Die Dislokation verläuft nach dorsokranial entsprechend der Zugrichtung des M. supraspinatus, M. infraspinatus und des M. teres minor (20). Erwartet man eine dauerhafte stabile Situation nach einer geschlossenen Reposition, so besteht eine Operationskontraindikation. Die Repositionsversuche sollten aber nicht zu oft wiederholt werden, da dies die Fraktursituation verschlimmern kann. Wenn nach erfolgter Reposition die Fraktur noch instabil ist oder nicht geschlossen werden kann, ist die Konsequenz die offene Reposition und Osteosynthese (20). In der ersten Woche wird der Oberarm durch einen Gilchrist-Verband ruhig gestellt. Pendelübungen und statische Muskelarbeit sind bereits nach wenigen Tagen erlaubt und erwünscht. Die angrenzenden Gelenke sollten bereits zu Beginn beübt werden. Ab der zweiten Woche kann das Schultergelenk bei fixierter Skapula bis 90 passiv trainiert werden. Nach drei Wochen erfolgt eine aktiv-assistive und nach sechs Wochen eine aktive Behandlung. Volle Belastbarkeit sollte nach zwölf Wochen erreicht werden (34).
22 Operative Therapie Das Ziel einer operativen Maßnahme ist hauptsächlich Schmerzarmut bzw. freiheit, frühfunktionelle Nachbehandlung und Wiederherstellung der Funktion. Die Wahl des Implantats erfolgt nach der Frakturmorphologie und in zweiter Linie nach den Erfahrungen des Operateurs mit den gebräuchlichen Implantaten. Gebräuchlich sind: 1. Kirschner-Drähte, Cerclagen (minimalinvasiv) 2. Schrauben (minimalinvasiv) 3. Winkelstabile Osteosyntheseplatten 4. Proximale Humerusnägel 5. Intramedulläre Drähte (kindliche Frakturen) 6. Endoprothesen Bei den minimalinvasiven Operationsmethoden mit Drähten und Schrauben besteht der Nachteil der fehlenden oder eingeschränkten Übungsstabilität. Bei Tuberculum majus Frakturen wird unter anderem auch die minimalinvasive Zugurtung und Cerclagen über eine Stichinzision angewandt (34). Die winkelstabile Plattenosteosynthese ist die Königsklasse der operativen Versorgung der proximalen Humerusfrakturen. Es wurden auch biomechanische Vorteile am osteoporotischen Knochen in aktuellen Studien nachgewiesen. In diesen betrug der Constant-Score im Median Punkte (42). Bei allen operationsbedürftigen proximalen Humerusfrakturen kann die winkelstabile Plattenosteosynthese angewandt werden. Sie hat den Vorteil, dass sie absolut übungsstabil ist. Typische Vertreter sind die Philos Platte und die LPHP (Locking Proximal Humerus Plate). Viele Jahre wurden auch konventionelle T-Platten implantiert. Es konnte zwar eine Übungsstabilität erreicht werden und Kopfnekrosen traten seltener auf, es kam aber häufiger zu Impingementsymptomatik bei zu weit proximaler Platzierung. Eine weitere Komplikation war der proximale Plattenausriss. Diese Probleme wurden durch die winkelstabilen Platten gelöst. Der Anpressdruck der Platte auf den Knochen wird reduziert und die Blutversorgung des Periost wird durch die starre Platten-Schrauben-Verbindung (Fixateur-interne-Prinzip) verbessert. Wegen der vielen Plattenlöcher können die Implantate auch besser fixiert werden (34).
23 Abb. 8 Kleeblatt (konventionelle T-Platte) (2) Abb. 9 Postoperatives Röntgenbild nach winkelstabiler Osteosynthese mit LPHP links (43) Nach Trapp und Bühren wird der proximale Humerusnagel bevorzugt bei Frakturen des osteopenischen Knochen, zertrümmerter Tuberkelregion mit fehlender medianer Abgrenzung, Mitbeteiligung des Schaftes sowie alle Fraktursituationen, bei denen durch eine geschlossene Reposition eine minimalinvasive Implantation des Nagels möglich ist (41).
24 Der Vorteil dieser Methode ist der minimalinvasive Zugangsweg. Über eine Inzision im Akromionbereich, Spaltung des M. deltoideus und der Rotatorenmanschette (nur 2 cm) wird der Marknagel in den Markraum des proximalen Humerus eingebracht und anschließend durch Spiralklinge, Bolzen und Schrauben fixiert. Durch die winkelstabile Osteosynthese mit zentralem Kraftträger entsteht auch beim osteoporotischen Knochen hohe Stabilität. Ein Nachteil sind die hohen Materialkosten (5). Abb. 10 Schemazeichnung des implantierten PHN (5) Neer schlägt vor allem bei älteren Patienten mit Humeruskopftrümmerfrakturen eine Endoprothese zur primären Versorgung vor, da eine Rekonstruktion bei einem osteoporotischen Knochen oft kaum möglich ist. Andere Indikationen sind 4-Fragmentfrakturen, Mehrfragmentluxationsfrakturen und Humeruskopfimpressionsfrakturen mit mehr als 50% Humeruskopfdefekt. Wenn die Gelenkfläche und der Ramus ascendens der A. circumflexa humeri anterior weitgehend zerstört ist, ist die Gefahr einer Nekrose sehr erhöht. Schmerzfreiheit wird in den meisten Fällen erreicht. Auch wenn oft ein Funktionsverlust zurückbleibt, es handelt sich auch um schwerste Frakturen, ist dieser bei den meist älteren Patienten in der Bewältigung der Alltagspflichten nicht relevant (7). Abb.11 Aequalis -Frakturschulterprothese, Tornier GmbH (27)
25 Material und Methoden 4.1 Studienaufbau Patientenaufnahme und Nachuntersuchung In der Unfallchirurgie am Klinikum Bayreuth, Lehrkrankenhaus der Universitätsklinik Erlangen, wurden vom bei 119 Patienten mit einer proximalen Humerusfraktur eine Plattenosteosynthese mittels der winkelstabilen Philos Platte durchgeführt. (Nach Überprüfung der Ein- und Ausschlusskriterien (siehe nächstes Kapitel) sind noch 81 Patienten geblieben.) Es wurde versucht diese Patienten telefonisch zu kontaktieren. Von 15 Patienten war auch nach längerem Bemühen (Telefonbuch, Akten, Internet) keine Telefonnummer mehr zu eruieren. Sicher sind auch einige umgezogen. Vier Patienten waren auch nach mehrmaligen Anrufen nicht erreichbar. Sieben Patienten lehnten eine Teilnahme an der Studie ab. Fünf Patienten hatten im Zeitraum nach der Operation noch weitere Erkrankungen entwickelt, die eine Teilnahme an der Studie ausschlossen Folgende Erkrankungen traten bei den Patienten auf: Ellenbogenfraktur am selben Arm, Apoplex mit Hemiparese am betroffenen Arm, Demenz, Parkinson und Immobilität. Ein Patient war verstorben. Insgesamt nahmen nun 49 Patienten an der Studie persönlich teil. 30 Patienten kamen zur Nachuntersuchung ins Klinikum Bayreuth. 19 Patienten wurden am Telefon befragt, da sie außerhalb von Bayreuth wohnen und nicht kommen konnten. Der DASH- Score ist am Telefon genau so gut zu bearbeiten wie im persönlichen Gespräch vor Ort. Der Constant Score wurde nur bei Patienten am Telefon bearbeitet, die in der Lage waren mir detailliert das Bewegungsausmaß zu beschreiben; dies waren dann 17 der 19 Telefonbefragungen. Der Zeitraum zwischen Operation und Nachuntersuchung lag zwischen 13 und 37 Monaten Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien Für die Studie wurden sämtliche vom in Klinikum Bayreuth mittels einer winkelstabilen Platte operierter Patienten mit einer proximalen
26 Humerusfraktur eingeschlossen. Das Alter muss mindestens 15 Jahren betragen, da man erst ab dem 15. Lebensjahr sicher sein kann, dass die Epiphysenfuge geschlossen ist. Es wurden Patienten mit Zwei- und Mehrfragmentfrakturen eingeschlossen, die mit einer Philos -Plattenosteosynthese versorgt wurden. Zwischen Operation und Nachuntersuchung sollten mindestens 12 Monate liegen. Folgende Ausschlusskriterien sind zu beachten: Immobilität (Bettlägerigkeit) Demenz Morbus Parkinson Schwere Herzinsuffizienz (EF > 30%) Hemiparese durch Apoplex Pathologische Frakturen Andere Frakturen am selben Arm Fortgeschrittene oder nicht behandelte Malignome Bei lang andauernder Immobilität können Kontrakturen entstehen. M. Parkinson ist durch eine Hypo- bzw. Akinese gekennzeichnet. In diesen Fällen sowie auch bei einer Hemiparese, ist die Beweglichkeit der Schulter nicht mehr ausreichend beurteilbar. Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz haben ein erhöhtes OP-Risiko, dazu trägt auch die Beach-Chair-Lagerung (Patienten sind in der Leiste abgewinkelt mit Beinen nach oben gelagert) bei, die bei der Operation der proximalen Humerusfraktur üblich ist. Bei pathologischen Frakturen kann der Frakturspalt oft nur schlecht verheilen und die Platte kann oft nur schlecht fixiert werden beispielsweise aufgrund des malignen Geschehens im Knochen Philosplatte und Operationstechnik Die Philos Platte ist entweder kurz (mit drei Schaftlöcher) oder lang (bis zu 290mm, mit fünf Schaftlöcher). Die lange Philosplatte wird benötigt, wenn sich die Fraktur bis zum Schaft ausdehnt. Im proximalen Bereich hat die Platte neun Schraubenlöcher für LCP(Locking Compression Plate)-Verriegelungsschrauben (3,5 mm Durchmesser, siehe Abb.12 A-E). Dadurch wird ein winkelstabiler Aufbau für einen besseren Halt auch bei Mehrfragmentfrakturen und bei osteoporotischen Knochen ermöglicht. Die Platte hat zehn proximale Nahtlöcher (40). Im Schaftbereich sind drei
27 bzw. fünf LCP-Kombilöcher (Abb.12 F-G) für Kortikalis- (3,5 mm Durchmesser) und Spongiosaschrauben (4 mm Durchmesser) (39). Abb.12 Philos Platte lang (1) Zu Beginn der Operation muss der Patient richtig gelagert werden. Üblich ist die Beach-Chair Position. Der Unterarm wird mit inkompletter Unterstützung positioniert, um eine Reposition durch Zug zu ermöglichen. Die Schulter und der gesamte Arm sind nach Abnahme der Schulterstütze frei zugänglich. Über den Ellenbogen und den Unterarm wird eine Stockinette gestülpt. Der Kopf wird in einer Schale fixiert, Knie und Fersen werden unterpolstert (22). Abb. 13 a-b Beach Chair Lagerung (22)
28 Vor der Implantation einer proximalen Humerusplatte wird der deltopektorale Zugang empfohlen (20). Dieser Zugang wird am häufigsten verwendet bei einer Arthroplastik des Schultergelenks (21). Kurzanleitung der Firma Synthes zur Implantation der Philosplatte: 1. Fraktur reponieren 2. Platte mit Zielgerät einbringen 3. Platte positionieren (unter Sichtkontrolle oder mit Kirschnerdraht) 4. Außenhülse und Bohrbüchse montieren 5. Schraubenloch vorbohren
29 Erforderliche Schraubenlänge ablesen 7. Bohrbüchse entfernen und Schraube durch Außenhülse einbringen 8. Schaftschrauben einbringen (40) Abb. 14 a-e: Kurzanleitung Implantation Philos Platte (40)
30 Zielsetzung Ziel dieser Arbeit ist die klinische Evaluation der operativen Versorgung proximaler Humerusfrakturen mit der Philos Platte, einer winkelstabilen Osteosynthese. Dabei soll vor allem das Augenmerk auf die Altersunterschiede im DASH-Score, Constant- Score, Schmerzen, Schlafstörungen, Einschränkungen im Alltag, Aufenthaltsdauer und Operationszeit gelegt werden. Dafür wurden drei Altersgruppen gebildet. Die Studie ist retrospektiv und klinisch durchgeführt. Zusätzlich sollen Unterschiede im Constant-Score eruiert werden, wenn eine Zwei-, Drei- oder Vierfragmentfraktur vorliegt oder wenn das Zeitintervall zwischen Operation und Nachuntersuchung unterschiedlich ist. 4.2 Verwendete Scores DASH-Score Der DASH Score (Disabilities of Arm, Shoulder and Hand) ist ein subjektives Instrument zur Beurteilung von Behandlungsergebnissen an der oberen Extremität (20): Die Patienten werden über Einschränkungen im Alltag, in der Freizeit und im Beruf bzw. Haushalt befragt. Dieser ist natürlich auch vom Patienten abhängig inwieweit es beispielsweise durch eine Bewegungseinschränkung auch tatsächlich zu einer Einschränkung im Alltag kommt. Laut einem Review Artikel der SICOT ist der DASH-Score der beste Score wenn es um Funktionsstörungen der oberen Extremität geht (9). Ich habe in meiner Arbeit zwei Berechnungsarten verwendet und doppelte Analysen durchgeführt: 1. Alte Berechnungsmethode (wird in der Arbeit DASH-Score alt genannt): DASH: Gesamtpunktzahl Minimalpunktzahl/1,20 (Breite) (20). 2. Neue Berechnungsmethode (wird in der Arbeit DASH-Score neu genannt): DASH: (Gesamtpunkzahl-1)/Anzahl der beantworteten Fragen x 25 (9).
31 Constant-Score Der Constant-Score dient zur Beurteilung der Schulterfunktion. Es werden von 100 möglichen Punkten maximal 40 für die Funktion, 25 für die Kraft, 15 für die Bewertung der Schmerzen und 20 für die Fähigkeiten des alltäglichen Lebens (activity of daily life=adl) vergeben (17). Vor allem der Faktor Kraft wird sehr unterschiedlich erfasst. In der Dissertation von Constant, als auch in seinen ersten Publikationen, wurde kein eindeutiger Messpunkt erfasst. Oft wird mit Federwaage gemessen. Vor allem die objektive Kraftmessung stellt aufgrund der Geschlechtsund Altersunterschiede einen Schwachpunkt des Constant-Scores dar. In zwei Arbeitsgruppen Katolik et al. und Yian et al. wurden Umrechnungstabellen, vom totalen Constant-Score in den normalisierten Constant-Score, erstellt und das Abweichen der Werte erklärt (20). Wegen der Rahmenbedingungen war es mir leider nicht möglich die Kraftmessung mit einer Federwaage durchzuführen. So wurden die Patienten befragt, ob die Kraft normal (25 P.), fast normal (20 P.), leicht eingeschränkt (15 P.), mäßig eingeschränkt (10 P.), stark eingeschränkt (5P.) ist. Keine Kraft entspricht null Punkten. Diese Einteilung ähnelt der im Neer-Score. Da die Patienten bei der Befragung schon von einer ihrem Alter gemäßen Kraft ausgehen, entsprechen diese Werte am ehesten den Normalisierten. Die Funktion zeigt nur geringe alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede. In der Dissertation von Koppers der TU München wurde bei 70 Patienten die Funktion der gesunden Seite untersucht (zwölf Monate nach der Operation). Bis auf fünf Patienten zeigten alle eine volle Funktion der gesunden Schulter (16). Daher ist die zusätzliche Anwendung der Umrechnungstabellen nicht sinnvoll. 4.3 Statistische Methoden Die statistischen Analysen wurden nach Sachs (29) durchgeführt. Berechnungen und statistische Analysen erfolgten mit XLStat2012, deutsche Version (Fahmy 2012). Für die Erstellung von Grafiken wurde XLStat2012 (Boxplots) oder Excel2003 (Säulendiagramme) eingesetzt. Als Signifikanzniveau wird p=0,05 verwendet (Bezeichnung: signifikant ). Testgrößen, die einen p-wert zwischen 0,05 und 0,10 liefern, werden als schwach signifikant bezeichnet.
32 In XLStat wird in den Boxplots das Minimum, das 1. Quartil (Q1, 25 % der Messwerte, unterer Rand der Box), der Median (50 % der Messwerte, schwarze Linie in der Box) und der arithmetische Mittelwert (ein rotes + Pluszeichen) dargestellt sowie das 3. Quartil (Q3, 75 % der Messwerte, oberer Rand der Box). Daneben werden die beiden Grenzen, jenseits derer man die Werte als Ausreißer ansehen kann, durch Linien dargestellt. Diese obere und untere Grenze (die Whiskers außerhalb der Box) stellen das 1,5fache des Interquartilsabstands dar (Interquartilsabstand: Q3 Q1, d.h. die mittleren 50 % der Messwerte). Minimum und Maximum werden durch einen ausgefüllten Kreis angezeigt. Auf diese Weise sind Lage- und Streuungsparameter ersichtlich. In den Tabellen der deskriptiven Statistik werden zusätzlich zu den obigen Kennwerten (Median, Minimum und Maximum, 1. und 3. Quartil, arithmetischer Mittelwert) noch die Standardabweichung sowie die 95%-Vertrauensbereiche des arithmetischen Mittelwerts und die mediane absolute Abweichung als Streuungsmaß des Medians dargestellt. Unterschiede in Mittelwerten wurden mit dem t-test (Zwei-Gruppen-Vergleich) bei Normalverteilung untersucht, wenn die Daten nicht normalverteilt waren mit dem U- Test nach Mann-Whitney. Im Fließtext werden der p-wert, die Zahl der Freiheitsgrade und die Prüfgrößen (z. B. t bei einem t-test, Chiquadrat bei einem Chiquadrattest) angegeben (z. B. (Chiquadrat=2,2147; FG=2; p=0,3304)). Wenn drei oder mehr Gruppen zu vergleichen waren, wurde die Rangvarianzanalyse (29) durchgeführt. Post-hoc-Tests (mit Bonferroni-Korrektur) werden nur im Anschluss an eine signifikante Varianzanalyse oder Rangvarianzanalyse aufgeführt. Prüfung auf Normalverteilung: Angewendet wurde der Shapiro-Wilk-Test, er gilt bei kleinen Stichproben (<50) als einer der besten Tests auf Normalverteilung (30). In Abhängigkeit von den Ergebnissen des Shapiro-Wilk-Tests auf Normalverteilung wurde über die Anwendung von parametrischen bzw. nicht-parametrischen Testverfahren entschieden. Da fast alle geprüften Variablen nicht-normalverteilt waren, wurde der Kruskal-Wallis-Test (=Rangvarianzanalyse) generell angewendet. Analyse von Häufigkeitsdaten: Häufigkeitsanalysen wurden mit dem Chiquadrat-Test nach Sachs (29.) durchgeführt. Die unabhängigen Variablen (z. B. Altersgruppe etc.) wurden in die Spalten geschrieben, die abhängigen Variablen in Zeilen. Die Berechnung der Prozentwerte erfolgte dann spaltenweise (14).
33 Ergebnisse 5.1 Beschreibungen des Patientenkollektivs Das Patientenkollektiv umfasst 81 Personen. DASH-Scores wurden bei 49 Personen ermittelt, Constant-Scores bei 47 Patienten. Es wurden drei Altersgruppen sowohl bei dem gesamten Patientenkollektiv als auch bei den untersuchten bzw. befragten Patienten gebildet. Hierdurch ergaben sich die Altersgruppen Jahre, Jahre und Jahre, die in allen folgenden Grafiken und Analysen verwendet werden. Diese Aufteilung führt zu fast gleich großen Gruppen (16, 16, 17) und ist daher für Vergleiche besonders gut geeignet. Bei diesen Patienten war das Durchschnittsalter bei 67 Jahren Altersgruppen und Geschlecht In allen drei Altersgruppen überwiegen im Patientenkollektiv weibliche Patienten, wie die folgende Grafik und nachfolgende Tabellen zeigen. Je nach Altersgruppe sind die Häufigkeiten unterschiedlich (Chiquadrat=7,8249; FG=2; p=0,02): Während in der jüngsten Altersgruppe das Geschlechterverhältnis annähernd gleich ist, vergrößert sich der Frauenanteil in den höheren Altersgruppen immens, Diese Entwicklung zeigt folgende Grafik:
34 Anzahl Personen Männlich Weiblich Altersgruppen und Geschlecht J J J. Altersgruppen Abbildung 15: Altersgruppen und Geschlecht, gesamtes Patientenkollektiv Tabelle 1: Altersgruppen und Geschlecht, gesamtes Patientenkollektiv a) Häufigkeiten Altersgruppe Männlich Weiblich Summe J J J Summe b) Prozentanteile Altersgruppe Männlich Weiblich Summe J. 60,9 27,6 37, J. 21,7 39,7 34, J. 17,4 32,8 28,4 Summe 100,0 100,0 100,0 Bei den untersuchten bzw. befragten Patienten sind in allen Altersgruppen Frauen häufiger, siehe folgende Grafik und Tabelle. Je nach Altersgruppe besteht kein signifikanter Unterschied (Chiquadrat = 2,6455, FG=2; p=0,2663), d.h. in den drei Altersgruppen ist das Verhältnis der Häufigkeiten der Geschlechter annähernd gleich
35 Anzahl Personen und stets zugunsten der Frauen verschoben, im Gegensatz zu allen 81 Patienten, bei denen in der jüngsten Altersgruppe Männer noch annähernd gleich viele vorhanden waren Männlich Weiblich Altersgruppen und Geschlecht, 49 Patienten J J J. Altersgruppen Abbildung 16: Altersgruppen und Geschlecht, 49 Patienten Tabelle 2: Altersgruppen und Geschlecht, 49 Patienten a) Häufigkeiten Altersgruppe Männlich Weiblich Summe J J J Summe b) Prozentanteile Altersgruppe Männlich Weiblich Summe J. 54,5 28,9 34, J. 27,3 34,2 32, J. 18,2 36,8 32,7 Summe 100,0 100,0 100,0
36 Anzahl Personen Geschlecht und Body-Maß-Index Die BMI-Werte wurden im gesamten Patientenkollektiv gruppiert und nach Geschlecht aufgeteilt, siehe folgende Grafik und nachfolgende Tabellen. Je nach BMI-Gruppe sind die Häufigkeiten nicht signifikant unterschiedlich (Chiquadrat=1,0274; FG=3; p=0,7946). Da Frauen im Datensatz häufiger vertreten sind, sind sie in allen BMI-Gruppen häufiger, und es tritt keine BMI-Gruppe auf, in denen dieses Häufigkeitsverhältnis deutlich anders wäre. Allgemein ist zu sagen, dass es insgesamt in der Studie mehr übergewichtige (>25) Patienten gibt Männlich Weiblich BMI und Geschlecht >40 BMI, gruppiert Abbildung 17: Altersgruppen und BMI, gesamtes Patientenkollektiv Tabelle 3: Altersgruppen und BMI, gesamtes Patientenkollektiv a) Häufigkeiten BMI, gruppiert Männlich Weiblich Summe > Summe
37 b) Prozentanteile BMI, gruppiert Männlich Weiblich Summe ,8 27,6 29, ,8 46,6 46, ,4 24,1 22,2 >40 0,0 1,7 1,2 Summe 100,0 100,0 100,0 Betrachtet man nur die gruppierten BMI-Werte der 49 nachuntersuchten bzw. befragten Patienten, so tritt die höchste BMI-Gruppe (eine Frau) nicht mehr auf, siehe folgende Grafik und nachfolgende Tabellen. Je nach BMI-Gruppe sind die Häufigkeiten nicht signifikant unterschiedlich (Chiquadrat=2,2147; FG=2; p=0,3304). Da Frauen im Datensatz häufiger vertreten sind, sind sie genauso wie im gesamten Patientenkollektiv in allen BMI-Gruppen häufiger. Abbildung 18: Altersgruppen und Geschlecht, 49 Patienten Tabelle 4: Altersgruppen und Geschlecht, 49 Patienten a) Häufigkeiten BMI, gruppiert Männlich Weiblich Summe
38 Summe b) Prozentanteile BMI, gruppiert Männlich Weiblich Summe ,0 23,1 22, ,0 46,2 51, ,0 30,8 26,5 Summe 100,0 100,0 100, Altersgruppen und ASA Die drei ASA-Gruppen wurden im gesamten Patientenkollektiv je nach Altersgruppe aufgeteilt, siehe folgende Grafik und nachfolgende Tabellen. Je nach Altersgruppe sind die Häufigkeiten der ASA-Klassen signifikant unterschiedlich (Chiquadrat=24,7896; FG=4; p=0,00006). In ASA-Klasse eins treten nur Personen unter 60 Jahre auf. In ASA-Klasse zwei und drei kommen zwar alle Altersklassen vor, jedoch in unterschiedlichen Verhältnissen: in ASA-Klasse drei treten mehr ältere Personen auf als in ASA-Klasse zwei, und deutlich weniger Personen der jüngsten Altersgruppe.
39 Anzahl Personen Altersgruppen und ASA J J J ASA Abbildung 19: Altersgruppen und ASA, gesamtes Patientenkollektiv Tabelle 5: Altersgruppen und ASA, gesamtes Patientenkollektiv a) Häufigkeiten ASA J J J. Summe Summe b) Prozentanteile ASA J J J. Summe 1 30,0 0,0 0,0 11,1 2 53,3 42,9 34,8 44,4 3 16,7 57,1 65,2 44,4 Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 Auch bei den 49 untersuchten bzw. befragten Patienten gilt: Je nach Altersgruppe sind die Häufigkeiten der ASA-Klassen signifikant unterschiedlich (Chiquadrat=16,4199; FG=3; p=0,0025). In ASA-Klasse eins treten nur Personen unter 60 Jahre auf. In ASA-Klasse zwei und drei kommen zwar alle Altersklassen
40 vor, jedoch in unterschiedlichen Verhältnissen: in ASA-Klasse drei treten mehr ältere Personen auf als in ASA-Klasse zwei, und deutlich weniger Personen der jüngsten Altersgruppe. In ASA-Klasse zwei sind die Häufigkeitsverhältnisse umgekehrt zu ASA-Klasse drei. Abbildung 20: Altersgruppen und ASA, 49 Patienten Tabelle 6: Altersgruppen und ASA, 49 Patienten a) Häufigkeiten ASA J J J. Summe Summe b) Prozentanteile ASA J J J. Summe 1 35,3 0,0 0,0 12,2 2 52,9 50,0 43,8 49,0 3 11,8 50,0 56,3 38,8
41 Summe 100,0 100,0 100,0 100, Altersgruppen und Anzahl der Fragmente In der folgenden Grafik und Tabellen ist die Anzahl der Fragmente je nach Altersgruppe im gesamten Patientenkollektiv dargestellt. Die meisten Personen wiesen Dreifragmentfrakturen auf, gefolgt von Zwei- und Vierfragmentfrakturen. Tabelle 7: Altersgruppen und Anzahl der Fragmente, gesamtes Kollektiv a) Häufigkeiten Fragmentierung J J J. Summe Dreifragmentfraktur Vierfragmentfraktur Zweifragmentfraktur Summe b) Prozentanteile Fragmentierung J J J. Summe Dreifragmentfraktur 66,7 57,1 69,6 64,2 Vierfragmentfraktur 6,7 3,6 4,3 4,9 Zweifragmentfraktur 26,7 39,3 26,1 30,9 Summe 100,0 100,0 100,0 100,0
42 Anzahl Personen J J J. Altersgruppen und Anzahl der Fragmente Zwei Drei Vier fragmentfrakturen Abbildung 21: Altersgruppen und Anzahl der Fragmente, gesamtes Kollektiv Die Anzahl der Frakturen bei den 49 untersuchten bzw. befragten Patienten ist in der folgenden Grafik dargestellt: Die meisten Patienten wiesen Dreifragmentfrakturen auf, und Zweifragmentfrakturen waren geringfügig häufiger als Vierfragmentfrakturen, aber beide deutlich seltener als Dreifragmentfrakturen Tabelle 8: Altersgruppen und Anzahl der Fragmente, 49 Patienten a) Häufigkeiten Fragmentierung J J J. Summe Zweifragmentfraktur Dreifragmentfraktur Vierfragmentfraktur Summe b) Prozentanteile Fragmentierung J J J. Summe Zweifragmentfraktur 23,5 25,0 12,5 20,4 Dreifragmentfraktur 70,6 68,8 81,3 73,5 Vierfragmentfraktur 5,9 6,3 6,3 6,1 Summe 100,0 100,0 100,0 100,0
43 Anzahl Personen Anzahl Personen J J J. Altersgruppen und Anzahl der Fragmente, 49 P Zwei Drei Vier fragmentfrakturen Abbildung 22: Altersgruppen und Anzahl der Fragmente, 49 Patienten Altersgruppen und Zeitraum Trauma bis OP In der folgenden Grafik ist der Zeitraum vom Trauma bis zur OP für das gesamte Patientenkollektiv je nach Altersgruppe dargestellt. Die meisten Personen wurden am zweiten Tag nach dem Trauma operiert, gefolgt vom ersten Tag J J J. Altersgruppen und Zeitraum Trauma-OP Gleicher Tag 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5-7 Tage Länger als eine Woche Zeitraum Trauma - OP Abbildung 23: Altersgruppen und Zeitraum Trauma/OP, gesamtes Kollektiv
44 Tabelle 9: Altersgruppen und Zeitraum Trauma/OP, gesamtes Kollektiv Häufigkeiten Zeit Trauma - OP J J J. Summe Gleicher Tag Tag Tage Tage Tage Tage Länger als eine Woche Summe Altersgruppen und Frakturursache In der folgenden Grafik und den Tabellen ist die Frakturursache je nach Altersgruppe für das Patientenkollektiv dargestellt. Die meisten Personen wiesen einen Sturz auf. Dagegen waren Sportunfälle, Verkehrsunfälle oder sonstige Unfälle recht selten. Betrachtet man die Prozentanteile der nachfolgenden Tabelle, so ist ersichtlich, dass einerseits der Sturz in allen Altersgruppen die höchsten Prozentsätze aufweist, dass aber Sport- und Verkehrsunfälle praktisch nur bei der jüngsten Altersgruppe in nennenswertem Umfang vorkommen, nicht aber bei der höchsten Altersgruppe.
45 Anzahl Personen J J J. Altersgruppen und Fraktur-Ursache Sportunfall Sturz Verkehrsunfall sonstiger Unfall Fraktur-Grund Abbildung 24: Altersgruppen und Unfallursache, gesamtes Kollektiv Tabelle 10: Altersgruppen und Unfallursache, gesamtes Kollektiv Prozentanteile Unfallursache J J J. Summe Sportunfall 13,8 3,6 0,0 6,3 Sturz 62,1 92,9 95,7 82,5 Verkehrsunfall 17,2 0,0 0,0 6,3 sonstiger Unf. 6,9 3,6 4,3 5,0 Summe 100,0 100,0 100,0 100, Schulterluxation Bei insgesamt sechs Patienten im gesamten Patientenkollektiv fand man eine luxierte proximale Humerusfraktur. Bei den untersuchten bzw. befragten Patienten hatten vier eine Luxation.
46 Frakturlokalisation Im gesamten Patientenkollektiv war bei 31 Patienten der rechte Arm betroffen, bei 50 Patienten der linke Arm. Der rechte Arm war in 38,3 % der Fälle betroffen, der linke Arm zu 61,7 % Komplikationen Im gesamten Patientenkollektiv (81 Patienten) sind insgesamt neun Komplikationen aufgetreten. Eine Patientin hatte eine Fallhand nach der Operation, drei Patienten entwickelten eine Frozen Shoulder, vier Patienten hatten ein Lymphödem und eine Patientin hatte eine Schraubendislokation. In den meisten Arbeiten wird ein Lymphödem nicht als Komplikation gesehen. Ohne Lymphödem hatten fünf Patienten eine Komplikation. Dies entspricht einen Anteil von 6,2 % (Komplikationen ohne Lymphödem) oder 11,1 % (Komplikationen mit Lymphödem). Vier Patienten mussten nachoperiert werden (4,9 %). 5.2 Unterschiede in den Altersgruppen Dauer des stationären Aufenthalts je nach Altersgruppe In der folgenden Grafik und der nachfolgenden Tabelle ist die Länge des stationären Aufenthalts je nach Altersgruppe für das Patientenkollektiv dargestellt. Die jüngste Altersgruppe wies eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 9,9 Tagen auf, die mittlere von 11,3 Tage und die älteste Gruppe von 10,6 Tagen. Signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen konnten nicht ermittelt werden (Kruskal-Wallis-Test; K=2,5947; FG=2; p-wert = 0,2733).
Definition. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann der Bruch folgende vier Knochenanteile betreffen: = Schultergelenkanteil des Oberarms
 Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR
 SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
Proximaler Oberarm. M. Dudda, A.S. Taheri. Diagnostisches Vorgehen. AO-Klassifikation. Therapeutisches Vorgehen. Prognose und funktionelle Ergebnisse
 17 Proximaler Oberarm M. Dudda, A.S. Taheri.1 Mechanismus 18. Klinik.3 Diagnostisches Vorgehen.4 Klassifikationen 18 18 19.4.1 AO-Klassifikation.4. Klassifikation nach Neer 19.5 Therapeutisches Vorgehen.5.1
17 Proximaler Oberarm M. Dudda, A.S. Taheri.1 Mechanismus 18. Klinik.3 Diagnostisches Vorgehen.4 Klassifikationen 18 18 19.4.1 AO-Klassifikation.4. Klassifikation nach Neer 19.5 Therapeutisches Vorgehen.5.1
Obere Extremität l-lll
 Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Fabian Hambücher, Kunstturner Obere Extremität l-lll Boston Red Socks, Clay Buchholz FS 204 Dr. Colacicco Dr. Amrein Pianist, Ray Charles Muskeln
Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Fabian Hambücher, Kunstturner Obere Extremität l-lll Boston Red Socks, Clay Buchholz FS 204 Dr. Colacicco Dr. Amrein Pianist, Ray Charles Muskeln
Obere Extremität l Schultergürtel
 Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Obere Extremität l Schultergürtel FS 05 Fabian Hambücher, deutscher Kunstturner PD Dr. Amrein Muskeln der oberen Extremität Übersicht Schultergürtel
Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsapparates Obere Extremität l Schultergürtel FS 05 Fabian Hambücher, deutscher Kunstturner PD Dr. Amrein Muskeln der oberen Extremität Übersicht Schultergürtel
Die proximale Humerusfraktur
 Die proximale Humerusfraktur Möglichkeiten und Grenzen der modernen Frakturversorgung Philipp Tuor Übersicht Anatomie Schulterfunktion Implantatwahl Decision-making Technik und Pitfalls Rehabilitation
Die proximale Humerusfraktur Möglichkeiten und Grenzen der modernen Frakturversorgung Philipp Tuor Übersicht Anatomie Schulterfunktion Implantatwahl Decision-making Technik und Pitfalls Rehabilitation
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes
 Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1
 Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1 Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus
Hauptvorlesung Chirurgie Unfallchirurgischer Abschnitt Obere Extremität 1 Klinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W.
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3
![Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3 Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3](/thumbs/98/135702962.jpg) 21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
5 Nachuntersuchung und Ergebnisse
 Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Proximale Humerusplatte. Für komplexe und instabile Frakturen.
 Proximale Humerusplatte. Für komplexe und instabile Frakturen. Eigenschaften und Vorteile Anatomisch vorgeformte Platte und niedriges Profil (2,2mm) 95 Kein Biegen erforderlich Minimierte Weichteilirritation
Proximale Humerusplatte. Für komplexe und instabile Frakturen. Eigenschaften und Vorteile Anatomisch vorgeformte Platte und niedriges Profil (2,2mm) 95 Kein Biegen erforderlich Minimierte Weichteilirritation
Palpation der Schulter
 Acromion Acromioclaviculargelenk (ACG) Sternoclaviculargelenk (SCG) Processus coracoideus Tuberculum minus / Crista tuberculi minoris Sulcus intertubercularis Tuberculum majus in Verlängerung der Spina
Acromion Acromioclaviculargelenk (ACG) Sternoclaviculargelenk (SCG) Processus coracoideus Tuberculum minus / Crista tuberculi minoris Sulcus intertubercularis Tuberculum majus in Verlängerung der Spina
Muskelfunktionen am Schultergürtel. ~30 o
 Muskelfunktionen am Schultergürtel 5 ~30 o Muskelfuntionen am Schultergelenk ll e b f c d g a i h 3 fache Muskelsicherung des Schultergelenks: > Rotatorenmanschette > Oberes Schulterdach mit M. deltoideus
Muskelfunktionen am Schultergürtel 5 ~30 o Muskelfuntionen am Schultergelenk ll e b f c d g a i h 3 fache Muskelsicherung des Schultergelenks: > Rotatorenmanschette > Oberes Schulterdach mit M. deltoideus
Die Anatomie der Schulter
 Die Anatomie der Schulter Univ.Doz. Dr. Georg Lajtai Wie sieht das Schultergelenk innen aus und wie funktioniert es? Die Schulter ist das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang des menschlichen Körpers.
Die Anatomie der Schulter Univ.Doz. Dr. Georg Lajtai Wie sieht das Schultergelenk innen aus und wie funktioniert es? Die Schulter ist das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang des menschlichen Körpers.
Diagnosen für das Angebot AOK-Sports
 Diagnosen für das Angebot AOK-Sports ICD Schlüssel Klartext M75.- Schulterläsionen M75.0 Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel M75.1 Läsionen der Rotatorenmanschette M75.2 Tendinitis des M. biceps
Diagnosen für das Angebot AOK-Sports ICD Schlüssel Klartext M75.- Schulterläsionen M75.0 Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel M75.1 Läsionen der Rotatorenmanschette M75.2 Tendinitis des M. biceps
Traumatologie am Schultergürtel
 Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Abb. 7: Body-Mass-Index der 71 untersuchten Patienten unterteilt nach Geschlecht.
 4 ERGEBNISSE 4.1 Body-Mass-Index (BMI) Von den 71 untersuchten Patienten, 55 Männern und 16 Frauen, wurde der Body-Mass- Index bestimmt. Untergewicht besaßen 18% der Männer. 36% waren normalgewichtig und
4 ERGEBNISSE 4.1 Body-Mass-Index (BMI) Von den 71 untersuchten Patienten, 55 Männern und 16 Frauen, wurde der Body-Mass- Index bestimmt. Untergewicht besaßen 18% der Männer. 36% waren normalgewichtig und
Der Sturz im Alter. Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie. Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz
 Der Sturz im Alter Klinik für Unfall-, Hand und Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz Der Sturz im Alter Deutschland bis 2050 Statistisches Bundesamt 2007 Frakturen im Alter Kombination aus 2 Faktoren!
Der Sturz im Alter Klinik für Unfall-, Hand und Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz Der Sturz im Alter Deutschland bis 2050 Statistisches Bundesamt 2007 Frakturen im Alter Kombination aus 2 Faktoren!
Checkliste Orthopädie
 Reihe, CHECKLISTEN MEDIZIN Checkliste Orthopädie Bearbeitet von René Baumgartner, Andreas B. Imhoff, Ralf Linke, Philipp Ahrens, Christoph Bartl, Knut Beitzel, Peter Brucker, Stefan Buchmann, Matthias
Reihe, CHECKLISTEN MEDIZIN Checkliste Orthopädie Bearbeitet von René Baumgartner, Andreas B. Imhoff, Ralf Linke, Philipp Ahrens, Christoph Bartl, Knut Beitzel, Peter Brucker, Stefan Buchmann, Matthias
ALIANS PROXIMALER HUMERUS INNOVATION MEANS MOTION DUALTEC SYSTEM
 INNOVATION MEANS MOTION ALIANS PROXIMALER HUMERUS WINKELSTABILE POLYAXIALE VERRIEGELUNG MIT HILFE DES EINZIGARTIGEN DUALTEC SYSTEM Polyaxiale Winkelstabilität von 25 Anatomisches Plattendesign (rechts/
INNOVATION MEANS MOTION ALIANS PROXIMALER HUMERUS WINKELSTABILE POLYAXIALE VERRIEGELUNG MIT HILFE DES EINZIGARTIGEN DUALTEC SYSTEM Polyaxiale Winkelstabilität von 25 Anatomisches Plattendesign (rechts/
POLYAXNAIL. Kurzinformation. Polyaxialer proximaler Humerusnagel
 POLYAXNAIL Kurzinformation Polyaxialer proximaler Humerusnagel SYNTHESE DER VORTEILE Neuartige Versorgung von Humerusfrakturen Die jeweiligen Vorteile von variabel winkelstabilen Platten und intramedullären
POLYAXNAIL Kurzinformation Polyaxialer proximaler Humerusnagel SYNTHESE DER VORTEILE Neuartige Versorgung von Humerusfrakturen Die jeweiligen Vorteile von variabel winkelstabilen Platten und intramedullären
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Medizin
 Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
Traumatologie für Physiotherapeuten
 physiolehrbuch Traumatologie für Physiotherapeuten (physiolehrbuch Krankheitslehre) von Gert Krischak. 317 Abbildungen, 13 Tabellen Thieme 2005 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 13 138231
physiolehrbuch Traumatologie für Physiotherapeuten (physiolehrbuch Krankheitslehre) von Gert Krischak. 317 Abbildungen, 13 Tabellen Thieme 2005 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 13 138231
Klinische Untersuchung der Schulter - Tipps und Tricks. J. Specht, C. Dehler
 Klinische Untersuchung der Schulter - Tipps und Tricks J. Specht, C. Dehler Orthopädische Klinik im St. Josefs-Hospital Wiesbaden Chefarzt: Prof. Dr. med. J. Pfeil www.joho.de Impingementtests Impingement-Test
Klinische Untersuchung der Schulter - Tipps und Tricks J. Specht, C. Dehler Orthopädische Klinik im St. Josefs-Hospital Wiesbaden Chefarzt: Prof. Dr. med. J. Pfeil www.joho.de Impingementtests Impingement-Test
Innerbetriebliche Fortbildung Zollernalb Klinikum
 Innerbetriebliche Fortbildung Zollernalb Klinikum Erkrankungen der Schulter und deren Behandlung Uwe H. Bierbach Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Zollernalb Klinikum ggmbh Balingen Einführung Schultergürtel
Innerbetriebliche Fortbildung Zollernalb Klinikum Erkrankungen der Schulter und deren Behandlung Uwe H. Bierbach Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Zollernalb Klinikum ggmbh Balingen Einführung Schultergürtel
A Aus der Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates
 A Aus der Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates Sektion für Unfallchirurgie der Universität zu Lübeck Direktor: Prof. Dr. med. C. Jürgens Untersuchung des Outcome komplexer Oberarmkopffrakturen
A Aus der Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates Sektion für Unfallchirurgie der Universität zu Lübeck Direktor: Prof. Dr. med. C. Jürgens Untersuchung des Outcome komplexer Oberarmkopffrakturen
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
AO Prinzipien des Frakturenmanagements
 AO Prinzipien des Frakturenmanagements 2 Bände mit CD-ROM Bearbeitet von Thomas Rüedi, Richard E. Buckley, Christopher G. Moran Neuausgabe 2008. Buch. 400 S. Hardcover ISBN 978 3 13 129662 7 Format (B
AO Prinzipien des Frakturenmanagements 2 Bände mit CD-ROM Bearbeitet von Thomas Rüedi, Richard E. Buckley, Christopher G. Moran Neuausgabe 2008. Buch. 400 S. Hardcover ISBN 978 3 13 129662 7 Format (B
Sehr geehrte Damen und Herren,
 Industriestraße 2 70565 Stuttgart Deutschland MEDIVERBUND AG Industriestraße 2 70565 Stuttgart Telefon (07 11) 80 60 79-0 Fax (07 11) 80 60 79-555 E-Mail: info@medi-verbund.de www.medi-verbund.de Ansprechpartner:
Industriestraße 2 70565 Stuttgart Deutschland MEDIVERBUND AG Industriestraße 2 70565 Stuttgart Telefon (07 11) 80 60 79-0 Fax (07 11) 80 60 79-555 E-Mail: info@medi-verbund.de www.medi-verbund.de Ansprechpartner:
Wiederaufweitung des Spinalkanales. Prozent der normalen Spinalkanalweite
 23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
Kindertraumatologie: obere Extremität. M. Sperl Abteilung für Kinderorthopädie Universitätsklinik für Kinderchirurgie Graz
 Kindertraumatologie: obere Extremität M. Sperl Abteilung für Kinderorthopädie Universitätsklinik für Kinderchirurgie Graz Kindertraumatologie obere Extremität Häufigkeiten Fraktur % Clavicula 6,4 proximaler
Kindertraumatologie: obere Extremität M. Sperl Abteilung für Kinderorthopädie Universitätsklinik für Kinderchirurgie Graz Kindertraumatologie obere Extremität Häufigkeiten Fraktur % Clavicula 6,4 proximaler
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Duale Reihe Anatomie
 Duale Reihe Anatomie 4., aktualisierte Aufl. 2017. Buch inkl. Online-Nutzung. 1336 S. Inkl. Online-Version in der eref. Kartoniert ISBN 978 3 13 241752 6 Format (B x L): 19,5 x 27 cm Weitere Fachgebiete
Duale Reihe Anatomie 4., aktualisierte Aufl. 2017. Buch inkl. Online-Nutzung. 1336 S. Inkl. Online-Version in der eref. Kartoniert ISBN 978 3 13 241752 6 Format (B x L): 19,5 x 27 cm Weitere Fachgebiete
Aus der Klinik für Unfallchirurgie der medizinischen Fakultät der Otto- von- Guericke Universität Magdeburg
 Aus der Klinik für Unfallchirurgie der medizinischen Fakultät der Otto- von- Guericke Universität Magdeburg Humeruskopffrakturen Funktionelle, radiologische und neurophysiologische Ergebnisse nach winkelstabiler
Aus der Klinik für Unfallchirurgie der medizinischen Fakultät der Otto- von- Guericke Universität Magdeburg Humeruskopffrakturen Funktionelle, radiologische und neurophysiologische Ergebnisse nach winkelstabiler
Aus der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen Klinik für Unfallchirurgie Ärztlicher Direktor: Professor Dr. K. Weise
 Aus der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen Klinik für Unfallchirurgie Ärztlicher Direktor: Professor Dr. K. Weise Nachuntersuchung von Humeruskopfmehrfragmentfrakturen mit dem Schwerpunkt
Aus der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen Klinik für Unfallchirurgie Ärztlicher Direktor: Professor Dr. K. Weise Nachuntersuchung von Humeruskopfmehrfragmentfrakturen mit dem Schwerpunkt
1.5 Frakturklassifikation
 Um jede Fraktur einem zuordnen zu können, muss das Zentrum der Fraktur bestimmt werden. Bei einer einfachen spiralförmigen, schrägen oder queren Fraktur liegt das Zentrum in der Mitte der Bruchlinie. Bei
Um jede Fraktur einem zuordnen zu können, muss das Zentrum der Fraktur bestimmt werden. Bei einer einfachen spiralförmigen, schrägen oder queren Fraktur liegt das Zentrum in der Mitte der Bruchlinie. Bei
Ergebnisse VitA und VitVM
 Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Ergebnisse VitA und VitVM 1 Basisparameter... 2 1.1 n... 2 1.2 Alter... 2 1.3 Geschlecht... 5 1.4 Beobachtungszeitraum (von 1. Datum bis letzte in situ)... 9 2 Extraktion... 11 3 Extraktionsgründe... 15
Proximales Humerus-System 3.5
 OPERATIONSTECHNIK Proximales Humerus-System 3.5 APTUS Shoulder Inhaltsverzeichnis 4 Proximales Humerus-System 3.5 5 Fixation einer proximalen Humerusfraktur mit Platte und Spiralklinge 14 Fixation einer
OPERATIONSTECHNIK Proximales Humerus-System 3.5 APTUS Shoulder Inhaltsverzeichnis 4 Proximales Humerus-System 3.5 5 Fixation einer proximalen Humerusfraktur mit Platte und Spiralklinge 14 Fixation einer
FibulA-PLATTE. Kurzinformation. VaWiKo laterale distale Fibulaplatte 3.5
 FibulA-PLATTE Kurzinformation VaWiKo laterale distale Fibulaplatte 3.5 SPRUNGGELENKSFRAKTUREN Neue Wege der Plattenosteosynthese Die winkelstabile Plattenosteosynthese gehört heute in den meisten Bereichen
FibulA-PLATTE Kurzinformation VaWiKo laterale distale Fibulaplatte 3.5 SPRUNGGELENKSFRAKTUREN Neue Wege der Plattenosteosynthese Die winkelstabile Plattenosteosynthese gehört heute in den meisten Bereichen
Schultergelenk
 .3 Gelenke und Muskeln 231.3.2 Schultergelenk Scapula und Humerus sind verbunden über die Articulatio humeri (Schultergelenk), ein Kugelgelenk mit 3 Freiheitsgraden. Eine schlaffe Gelenkkapsel und ein
.3 Gelenke und Muskeln 231.3.2 Schultergelenk Scapula und Humerus sind verbunden über die Articulatio humeri (Schultergelenk), ein Kugelgelenk mit 3 Freiheitsgraden. Eine schlaffe Gelenkkapsel und ein
3. Ergebnisse Geschlechts- und Altersverteilung
 23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula.
 Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula. J Hallbauer 1,3, K Klos 1, A Gräfenstein 4, F Wipf 5, C Beimel 6, GO Hofmann 1, 2, T Mückley 4 1
Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula. J Hallbauer 1,3, K Klos 1, A Gräfenstein 4, F Wipf 5, C Beimel 6, GO Hofmann 1, 2, T Mückley 4 1
LCP DF und PLT. Plattensystem für das Distale Femur und die Proximale Laterale Tibia.
 LCP DF und PLT. Plattensystem für das Distale Femur und die Proximale Laterale Tibia. Breite Auswahl anatomisch vorgeformter Platten LCP Kombinationslöcher Winkelstabilität Inhaltsverzeichnis Einführung
LCP DF und PLT. Plattensystem für das Distale Femur und die Proximale Laterale Tibia. Breite Auswahl anatomisch vorgeformter Platten LCP Kombinationslöcher Winkelstabilität Inhaltsverzeichnis Einführung
Aus der Unfallchirurgischen Klinik und Poliklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Direktor: Prof. Dr. med. F. F.
 Aus der Unfallchirurgischen Klinik und Poliklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Direktor: Prof. Dr. med. F. F. Hennig Durchgeführt im Akademischen Lehrkrankenhaus Klinikum Rummelsberg,
Aus der Unfallchirurgischen Klinik und Poliklinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Direktor: Prof. Dr. med. F. F. Hennig Durchgeführt im Akademischen Lehrkrankenhaus Klinikum Rummelsberg,
Typische Ursachen. Symptomatik
 Definition Der Unterschenkelbruch bezeichnet den gemeinsamen Knochenbruch von Schienund Wadenbein. Natürlich können Schienbein und Wadenbein auch isoliert gebrochen sein. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin
Definition Der Unterschenkelbruch bezeichnet den gemeinsamen Knochenbruch von Schienund Wadenbein. Natürlich können Schienbein und Wadenbein auch isoliert gebrochen sein. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin
Indikationsgruppen. Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums
 Indikationsgruppen ICD Schlüssel Klartext Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums S22.3- Rippenfraktur S22.31 Fraktur der ersten Rippe S22.32 Fraktur einer sonstigen Rippe
Indikationsgruppen ICD Schlüssel Klartext Fraktur Behandlungspfad 3 obere Extremität S22.2 Fraktur des Sternums S22.3- Rippenfraktur S22.31 Fraktur der ersten Rippe S22.32 Fraktur einer sonstigen Rippe
6. Diskussion. 6.1 Zusammenfassung
 6. Diskussion 6.1 Zusammenfassung Die subkapitalen Humerusfrakturen und Humerusschaftfrakturen stellen als Problemfrakturen vorrangig im hohen Lebensalter eine große Herausforderung an den Mediziner. Primär
6. Diskussion 6.1 Zusammenfassung Die subkapitalen Humerusfrakturen und Humerusschaftfrakturen stellen als Problemfrakturen vorrangig im hohen Lebensalter eine große Herausforderung an den Mediziner. Primär
Schulter Instabilität - Luxation
 Schulter Instabilität - Luxation Welche Formen der Instabilität gibt es? Die Schulter ist das beweglichste Gelenk im menschlichen Köper. Dadurch ist sie aber anfällig für eine Instabilität bis hin zu einer
Schulter Instabilität - Luxation Welche Formen der Instabilität gibt es? Die Schulter ist das beweglichste Gelenk im menschlichen Köper. Dadurch ist sie aber anfällig für eine Instabilität bis hin zu einer
Aus der Klinik für Unfall- und Handchirurgie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Windolf
 Aus der Klinik für Unfall- und Handchirurgie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Windolf Vergleichende mittelfristige klinisch-funktionelle Ergebnisse operativ versorgter
Aus der Klinik für Unfall- und Handchirurgie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. J. Windolf Vergleichende mittelfristige klinisch-funktionelle Ergebnisse operativ versorgter
Aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 Aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Direktor: Prof. Dr. med. Johannes Rueger Mittelfristige funktionelle Ergebnisse
Aus der Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand-, und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Direktor: Prof. Dr. med. Johannes Rueger Mittelfristige funktionelle Ergebnisse
Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart
 Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart Traumaversorgung rund um die Hüfte E. Ramms, Assistenzärztin Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Traumaversorgung rund ums
Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart Traumaversorgung rund um die Hüfte E. Ramms, Assistenzärztin Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Traumaversorgung rund ums
Klinischer Vergleich eines extra- und eines intramedullären Fixateur interne-systems für die proximale Humerusfraktur
 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Abteilung für Unfallchirurgie (Vorstand: Univ.-Prof. Dr. U. Stöckle) Klinischer Vergleich eines extra-
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Abteilung für Unfallchirurgie (Vorstand: Univ.-Prof. Dr. U. Stöckle) Klinischer Vergleich eines extra-
Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005
 Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der oberen Extremität SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Überblick Klavikulafraktur direkt (Schlag/Stoß/Schuß)
Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der oberen Extremität SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Überblick Klavikulafraktur direkt (Schlag/Stoß/Schuß)
3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit
 13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
Schulterluxation- Reposition im Rettungsdienst?
 Schulterluxation- Reposition im Rettungsdienst? Ingmar Meinecke Park-Krankenhaus Leipzig Südost GmbH Schulterinstabilität = pathologischer Zustand mit der Unfähigkeit des Zentrierens des Humeruskopfes
Schulterluxation- Reposition im Rettungsdienst? Ingmar Meinecke Park-Krankenhaus Leipzig Südost GmbH Schulterinstabilität = pathologischer Zustand mit der Unfähigkeit des Zentrierens des Humeruskopfes
Schulterluxation & Schulterinstabilität
 Universitätsklinik Balgrist Schulter- und Ellbogenchirurgie Schulterluxation & Schulterinstabilität Schulterluxation & Schulterinstabilität Abb. 1: Bankart Läsion Abb. 2: Bankart Refixation Was ist eine
Universitätsklinik Balgrist Schulter- und Ellbogenchirurgie Schulterluxation & Schulterinstabilität Schulterluxation & Schulterinstabilität Abb. 1: Bankart Läsion Abb. 2: Bankart Refixation Was ist eine
Aufgaben zu Kapitel 8
 Aufgaben zu Kapitel 8 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen U-Test für das in Kapitel 8.1 besprochene Beispiel mit verbundenen Rängen. Die entsprechende Testvariable punkte2 finden Sie im Datensatz Rangdaten.sav.
Aufgaben zu Kapitel 8 Aufgabe 1 a) Berechnen Sie einen U-Test für das in Kapitel 8.1 besprochene Beispiel mit verbundenen Rängen. Die entsprechende Testvariable punkte2 finden Sie im Datensatz Rangdaten.sav.
dualtec system ALIANS PROXIMALER HUMERUS Winkelstabile polyaxiale Verriegelung mit Hilfe des einzigartigen
 ALIANS PROXIMALER HUMERUS Winkelstabile polyaxiale Verriegelung mit Hilfe des einzigartigen dualtec system -> Polyaxial Winkelstabil mit einem Winkel von 5 -> Vereinfachte Knochennaht der Rotatorenmanschette
ALIANS PROXIMALER HUMERUS Winkelstabile polyaxiale Verriegelung mit Hilfe des einzigartigen dualtec system -> Polyaxial Winkelstabil mit einem Winkel von 5 -> Vereinfachte Knochennaht der Rotatorenmanschette
Morphologische 3D Analyse der anatomischen Lage von drei Marknagelmodellen zur Versorgung proximaler Humerusfrakturen. Tobias M.
 Technische Universität München Abteilung für Unfallchirurgie am Klinikum rechts der Isar (Leitung: Univ.-Prof. Dr. U. Stöckle) Morphologische 3D Analyse der anatomischen Lage von drei Marknagelmodellen
Technische Universität München Abteilung für Unfallchirurgie am Klinikum rechts der Isar (Leitung: Univ.-Prof. Dr. U. Stöckle) Morphologische 3D Analyse der anatomischen Lage von drei Marknagelmodellen
Der Bruch des Ellenbogengelenkes
 KLINIKUM WESTFALEN Der Bruch des Ellenbogengelenkes Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue
KLINIKUM WESTFALEN Der Bruch des Ellenbogengelenkes Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue
Schulterluxation & Schulterinstabilität
 Schulterluxation & Schulterinstabilität Schulterluxation & Schulterinstabilität Was ist eine Schulterluxation? Bei einer ausgerenkten (luxierten) Schulter ist der Oberarmkopf aus der Pfanne ausgekugelt,
Schulterluxation & Schulterinstabilität Schulterluxation & Schulterinstabilität Was ist eine Schulterluxation? Bei einer ausgerenkten (luxierten) Schulter ist der Oberarmkopf aus der Pfanne ausgekugelt,
Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005
 Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der unteren Extremität SS 2005 Prof.
Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der unteren Extremität SS 2005 Prof.
Operationstechnik. LCP Distale Tibiaplatte.
 Operationstechnik LCP Distale Tibiaplatte. Inhaltsverzeichnis Indikationen 2 Implantate und Instrumente 3 Operationstechnik 4 Implantate entfernen 9 Bildverstärkerkontrolle Warnung Diese Beschreibung
Operationstechnik LCP Distale Tibiaplatte. Inhaltsverzeichnis Indikationen 2 Implantate und Instrumente 3 Operationstechnik 4 Implantate entfernen 9 Bildverstärkerkontrolle Warnung Diese Beschreibung
Sönke Drischmann. Facharzt für Orthopädie/Rheumatologie. Orthopädie Zentrum Altona Paul-Nevermann-Platz Hamburg
 Sönke Drischmann Facharzt für Orthopädie/Rheumatologie Orthopädie Zentrum Altona Paul-Nevermann-Platz 5-22765 Hamburg Sehnenrisse der Schulter Aktuelle Behandlungsmethoden heute Krankheitskunde der Sehnenrisse
Sönke Drischmann Facharzt für Orthopädie/Rheumatologie Orthopädie Zentrum Altona Paul-Nevermann-Platz 5-22765 Hamburg Sehnenrisse der Schulter Aktuelle Behandlungsmethoden heute Krankheitskunde der Sehnenrisse
Funktionelle und röntgenologische Ergebnisse. nach osteosynthetischer Versorgung. von proximalen Humerusfrakturen
 Funktionelle und röntgenologische Ergebnisse nach osteosynthetischer Versorgung von proximalen Humerusfrakturen unter Einsatz des Proximalen Humerusnagels Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades
Funktionelle und röntgenologische Ergebnisse nach osteosynthetischer Versorgung von proximalen Humerusfrakturen unter Einsatz des Proximalen Humerusnagels Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades
Schultersprechstunde. Merkblatt für Patienten. Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Schulter, Ellenbogen & Schlüsselbein)
 Schultersprechstunde Merkblatt für Patienten Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Schulter, Ellenbogen & Schlüsselbein) Schulter Voraussetzung für eine geeignete individuell angepasste
Schultersprechstunde Merkblatt für Patienten Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie (Schulter, Ellenbogen & Schlüsselbein) Schulter Voraussetzung für eine geeignete individuell angepasste
Ellenbogen - Trauma Knorpel, Frakturen, komplexe Luxationen
 Ellenbogen - Trauma Knorpel, Frakturen, komplexe Luxationen Trainingswoche Muskuloskelettale Radiologie 18. - 22. September 2017 Portals Nous, Mallorca Prof. Dr. R. Schmitt Diagnostische und Interventionelle
Ellenbogen - Trauma Knorpel, Frakturen, komplexe Luxationen Trainingswoche Muskuloskelettale Radiologie 18. - 22. September 2017 Portals Nous, Mallorca Prof. Dr. R. Schmitt Diagnostische und Interventionelle
Die differenzierte Behandlung der proximalen Humerusfraktur eine prospektive Analyse Implantation einer Frakturprothese
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie des Universitätsklinikums Halle (Saale) Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. K.-St. Delank Die differenzierte Behandlung der proximalen Humerusfraktur
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie des Universitätsklinikums Halle (Saale) Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. K.-St. Delank Die differenzierte Behandlung der proximalen Humerusfraktur
Phallosan-Studie. Statistischer Bericht
 Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
Phallosan-Studie Statistischer Bericht Verfasser: Dr. Clemens Tilke 15.04.2005 1/36 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Einleitung... 3 Alter der Patienten... 4 Körpergewicht... 6 Penisumfang...
Shoulder Joint with Rotator Cuff
 A880 (100017) Latin 1 Clavicula 2 M. supraspinatus M. serratus anterior, insertio 4 M. subscapularis M. deltoideus, insertio Humerus 7 M. teres major, insertio 8 M. latissimus dorsi, insertio 9 M. pectoralis
A880 (100017) Latin 1 Clavicula 2 M. supraspinatus M. serratus anterior, insertio 4 M. subscapularis M. deltoideus, insertio Humerus 7 M. teres major, insertio 8 M. latissimus dorsi, insertio 9 M. pectoralis
Topographische Anatomie: Obere Extremität: Schulter
 Topographische Anatomie: Obere Extremität: Schulter 1 Topographische Anatomie: Obere Extremität: Schulter < Topographische Anatomie Obere Extremität An der Schulter gibt es einige wichtige Regionen Im
Topographische Anatomie: Obere Extremität: Schulter 1 Topographische Anatomie: Obere Extremität: Schulter < Topographische Anatomie Obere Extremität An der Schulter gibt es einige wichtige Regionen Im
Schulterdiagnostik - Welche Bildgebung braucht der Orthopäde?
 43. Fortbildungskongress für ärztliches Assistenzpersonal in der Radiologie Schulterdiagnostik - Welche Bildgebung braucht der Orthopäde? Dr. med. Roland Biber Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie
43. Fortbildungskongress für ärztliches Assistenzpersonal in der Radiologie Schulterdiagnostik - Welche Bildgebung braucht der Orthopäde? Dr. med. Roland Biber Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten
 4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
Die Untersuchungsergebnisse nach osteosynthetischer Versorgung von Humeruskopffrakturen. Ein Vergleich zwischen. LPHP vs.
 Die Untersuchungsergebnisse nach osteosynthetischer Versorgung von Humeruskopffrakturen Ein Vergleich zwischen LPHP vs. KLEEBLATT Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Die Untersuchungsergebnisse nach osteosynthetischer Versorgung von Humeruskopffrakturen Ein Vergleich zwischen LPHP vs. KLEEBLATT Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität. Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma. Orthopädische Universitäts- und Poliklinik
 Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Direktor Prof. Dr. med. D. Kohn Schulter - Anatomie Schulter
Orthopädischer Untersuchungskurs (Praktikum) Obere Extremität Dr. med. O. Steimer, Dr. med. M.Kusma Orthopädische Universitäts- und Poliklinik Direktor Prof. Dr. med. D. Kohn Schulter - Anatomie Schulter
Korrelation zwischen Unfallmechanismus und radiomorphologischem Befund bei Frakturen des Tuberculum majus humeri
 Aus der Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie der Philipps-Universität Marburg Leiter: Prof. Dr. med. L. Gotzen Korrelation zwischen Unfallmechanismus und radiomorphologischem Befund
Aus der Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie der Philipps-Universität Marburg Leiter: Prof. Dr. med. L. Gotzen Korrelation zwischen Unfallmechanismus und radiomorphologischem Befund
Tabelle 1: Altersverteilung der Patienten (n = 42) in Jahren
 3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
Der Oberschenkelhalsbruch
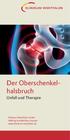 KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
Die Versorgung proximaler Humerusfrakturen durch die winkelstabile Marknagelung mit dem Targon-PH-Nagel. Technik und mittelfristige Ergebnisse
 Universitätsklinikum Ulm Zentrum für Chirurgie Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. F. Gebhard Die Versorgung proximaler Humerusfrakturen
Universitätsklinikum Ulm Zentrum für Chirurgie Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. F. Gebhard Die Versorgung proximaler Humerusfrakturen
Die winkelstabile Osteosynthese am proximalen Humerus mit der PHILOS Platte
 Aus der Klinik für Allgemeine,Unfall-,Hand-und Plastische Chirugie der Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. W. E. Mutschler Die winkelstabile Osteosynthese am
Aus der Klinik für Allgemeine,Unfall-,Hand-und Plastische Chirugie der Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. W. E. Mutschler Die winkelstabile Osteosynthese am
KLINIKUM WESTFALEN. Der Speichenbruch. Unfall und Therapie. Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen
 KLINIKUM WESTFALEN Der Speichenbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich über Ihr
KLINIKUM WESTFALEN Der Speichenbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich über Ihr
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie LMU München
 ERGEBNISSE DER FRÜHFUNKTIONELLEN BEHANDLUNG VON METAPHYSÄREN FRAKTUREN DER METATARSALE V BASIS (ZONE 1 UND 2 NACH LAWRENCE AND BOTTE) Baumbach SF, Kramer M, Braunstein M, Böcker W, Polzer H HINTERGRUND
ERGEBNISSE DER FRÜHFUNKTIONELLEN BEHANDLUNG VON METAPHYSÄREN FRAKTUREN DER METATARSALE V BASIS (ZONE 1 UND 2 NACH LAWRENCE AND BOTTE) Baumbach SF, Kramer M, Braunstein M, Böcker W, Polzer H HINTERGRUND
Schmerz-Wegweiser: Schulter, oberer Rücken und Oberarm
 Kapitel 5: Schmerzen in Schulter, oberem Rücken und Oberarm 131 Schmerz-Wegweiser: Schulter, oberer Rücken und Oberarm Ein primäres Schmerzmuster ist in Fettschrift gesetzt. In Normalschrift gesetzter
Kapitel 5: Schmerzen in Schulter, oberem Rücken und Oberarm 131 Schmerz-Wegweiser: Schulter, oberer Rücken und Oberarm Ein primäres Schmerzmuster ist in Fettschrift gesetzt. In Normalschrift gesetzter
Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt.
 3 Ergebnisse 3.1 Ergebnisse der Nachuntersuchung Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt. 3.1.1 Bewegungsumfänge Das Winkelmaß des
3 Ergebnisse 3.1 Ergebnisse der Nachuntersuchung Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt. 3.1.1 Bewegungsumfänge Das Winkelmaß des
Mitralklappen-Clipping bei Hochrisikopatienten mit degenerativer oder funktioneller Mitralklappeninsuffizienz
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deskription, Statistische Testverfahren und Regression. Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien
 Deskription, Statistische Testverfahren und Regression Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: beschreibende Statistik, empirische
Deskription, Statistische Testverfahren und Regression Seminar: Planung und Auswertung klinischer und experimenteller Studien Deskriptive Statistik Deskriptive Statistik: beschreibende Statistik, empirische
Die Schulter schmerzt! Was tun?
 Die Schulter schmerzt! Was tun? Clarahof Praxisgemeinschaft für Orthopädie seit über 30 Jahren in Basel Robert Graf Hans Jenny Geert Pagenstert Andreas Oeri Ursachen von Schulterschmerzen Krankheit Impingement
Die Schulter schmerzt! Was tun? Clarahof Praxisgemeinschaft für Orthopädie seit über 30 Jahren in Basel Robert Graf Hans Jenny Geert Pagenstert Andreas Oeri Ursachen von Schulterschmerzen Krankheit Impingement
Muskulatur und Bewegungstests der oberen Extremität
 118 Obere Extremität Muskulatur und Bewegungstests der oberen Extremität Schulterblatt Aus praktischen Gründen ist es sinnvoll, die Schulterblattbewegungen im Test von den Bewegungen im Schultergelenk
118 Obere Extremität Muskulatur und Bewegungstests der oberen Extremität Schulterblatt Aus praktischen Gründen ist es sinnvoll, die Schulterblattbewegungen im Test von den Bewegungen im Schultergelenk
Besonderheiten der Frakturversorgung beim Kleintier
 Besonderheiten der Frakturversorgung beim Kleintier Dr. Miriam Biel 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag 1 Frakturformen 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag 2 Implantate 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag
Besonderheiten der Frakturversorgung beim Kleintier Dr. Miriam Biel 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag 1 Frakturformen 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag 2 Implantate 03.10.2013 14. Hofheimer Tierärztetag
Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar
 Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar Vergleichende Untersuchung funktioneller Ergebnisse nach Stabilisierung proximaler Humerusfrakturen:
Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar Vergleichende Untersuchung funktioneller Ergebnisse nach Stabilisierung proximaler Humerusfrakturen:
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. WS 2006/2007, 2. Februar 2007
 Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
Rotatorenmanschettenriss
 Rotatorenmanschettenriss Univ.Doz. Dr. Georg Lajtai 1. Was ist ein Rotatorenmanschette und wo befindet sich diese? Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Es setzt sich aus dem Oberarmkopf und der flachen
Rotatorenmanschettenriss Univ.Doz. Dr. Georg Lajtai 1. Was ist ein Rotatorenmanschette und wo befindet sich diese? Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Es setzt sich aus dem Oberarmkopf und der flachen
Operationstechnik. LCP Compact Foot/Compact Hand.
 Operationstechnik LCP Compact Foot/Compact Hand. Inhaltsverzeichnis Indikationen 2 Systembeschreibung LCP 3 Implantate 5 Spezifische Instrumente 8 Übersicht Instrumente 9 Operationstechnik 10 Standardschrauben
Operationstechnik LCP Compact Foot/Compact Hand. Inhaltsverzeichnis Indikationen 2 Systembeschreibung LCP 3 Implantate 5 Spezifische Instrumente 8 Übersicht Instrumente 9 Operationstechnik 10 Standardschrauben
3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben
 3. ERGEBNISSE 3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben In der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
3. ERGEBNISSE 3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben In der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
Langzeitergebnisse nach LAUP / UPPP bei Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe und primärem Schnarchen
 Medizinische Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Scherer Langzeitergebnisse nach LAUP /
Medizinische Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Scherer Langzeitergebnisse nach LAUP /
LCP Periartikuläre Proximale Humerusplatte 3.5. Das anatomische Fixationssystem mit anterolateraler Schaftplatzierung.
 LCP Periartikuläre Proximale Humerusplatte 3.5. Das anatomische Fixationssystem mit anterolateraler Schaftplatzierung. Operationstechnik Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung in den USA bestimmt. Instrumente
LCP Periartikuläre Proximale Humerusplatte 3.5. Das anatomische Fixationssystem mit anterolateraler Schaftplatzierung. Operationstechnik Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung in den USA bestimmt. Instrumente
Das DHS-Prinzip in der Versorgung proximaler Humerusfrakturen
 Das DHS-Prinzip in der Versorgung proximaler Humerusfrakturen Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin
Das DHS-Prinzip in der Versorgung proximaler Humerusfrakturen Von der Medizinischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin
