Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Geschäftsbericht 2013
|
|
|
- Benjamin Sommer
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Geschäftsbericht 2013
2 Impressum Herausgeber Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Kölnische Straße Kassel Telefon: Fax: Internet: Dieser Veröffentlichung erscheint in der Reihe Fachinformationen des LLH Nr.: 2/2014 ISSN Layout Jennifer Kolling Druck Hessisches Statistisches Landesamt Ausgabe Oktober 2014
3 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 3 2. Situation der hessischen Landwirtschaft Fachgebiet 31 Ökonomie 4 Wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe 4 3. Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr Fachgebiet 41 Organisation, Recht 9 Organisation und Aufgaben des LLH Fachgebiet 42 Personal 11 Personalsituation und -entwicklung Abteilung 1 Beratung Fachgebiet 12 Beratungsteam Gartenbau 13 Beet- und Balkonpflanze des Jahres in Hessen 13 Erhaltung alter Süßkirschsorten Fachgebiet 13 Beratungsteam Pflanzenproduktion und Fachgebiet 15 Beratungsteam Ökologischer Landbau 18 Beratungsangebot: Lagercheck und Vorratsschutz für Getreide, Raps und Körnerleguminosen 18 Fachveranstaltung: Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais Fachgebiet 15 Beratungsteam Ökologischer Landbau 25 Mechanische Beikrautregulierung in Hackkulturen 25 Körnerleguminosen und Bodenfruchtbarkeit Fachgebiet 16 Qualitätssicherung und Leistungsermittlung Tier 30 Beratung zur artgerechten Pferdehaltung Abteilung 2 Bildung Fachgebiet 21 Zuständige Stelle 32 Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nachwuchswerbung in den Landwirtschaftlichen Berufen Fachgebiet 23 Hessische Gartenakademie Jahre Hessische Gartenakademie - ein Rück- und Ausblick 34 1
4 5.3. Fachgebiet 24 Ressortweite Fortbildung 37 Klimawandel - Anpassungs- und Verminderungsstrategien im Pflanzenbau 37 Fachtagung Landwirtschaft zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung Fachgebiet 25 Landgestüt Dillenburg, Landesreit- und Fahrschule 42 Neues aus der Landes-, Reit- und Fahrschule Dillenburg Abteilung 3 Fachinformation Fachgebiet 32 Fachinformation Gartenbau 44 Assimilationsbelichtung bei Dill, Bohnenkraut und Majoran mit verschiedenen Lampenspektren 44 Potentiale neuer Leuchtmittel - Technologien für die Pflanzenbelichtung im Gartenbau Fachgebiet 33 Fachinformation Pflanzenproduktion 53 Effizient bewässern - BLE-Modellvorhaben zur Effizienzsteigerung der Bewässerungstechnik und des Bewässerungsmanagements im Freiland gemüsebau 53 Landessortenversuche - hier trennen wir für Sie die Spreu vom Weizen! 56 Deutscher Grünlandtag 2013 auf dem Eichhof Fachgebiet 34 Fachinformation Tierhaltung 61 Sauenfütterung mit heimischen Proteinträgern 61 Futteraufnahme bei Milchkühen - den TM-Gehalt der Trogration optimieren Fachgebiet 35 Bieneninstitut Kirchhain 69 Auswirkungen von Neonikotinoiden und Varroaziden auf die Gesundheit von Honigbienen 69 Welche Rolle spielen die genetische Herkunft und spezifische Umwelt anpassung für Gesundheit, Leistung und Verhalten von Bienenvölkern? Fachgebiet 36 Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie 73 Biomassekompaktierung in der Praxis 73 Substrateinsatz in hessischen Biogasanlagen - Ergebnisse einer aktuellen Praxiserhebung Autorenverzeichnis 77 2
5 1. Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, vor Ihnen liegt der Geschäftsbericht des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen für das Jahr In bewährter Form berichten wir über die Situation der hessischen Landwirtschaft und des hessischen Gartenbaus im abgelaufenen Jahr, die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr und über ausgewählte Themen aus allen Arbeitsbereichen. Damit wollen wir über die große fachliche Spannbreite des LLH berichten. Neben der fachlichen Arbeit haben uns im vergangenen Jahr auch wieder große Bauprojekte beschäftigt. So konnte das alte Reithaus des Landgestütes feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. Im Bieneninstitut Kirchhain machte die energetische Gebäudesanierung große Fortschritte. Die Herausforderungen für Landwirtschaft und Gartenbau in Hessen werden zukünftig nicht weniger. Umso mehr kommt es darauf an, dass die fachlichen Angebote des LLH immer auf dem aktuellen Stand sind. Um neue Themen angemessen aufzugreifen, werden wir zunehmend in Projekten tätig sein, wie zum Beispiel in der Grundberatung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie oder bei der Mitwirkung im bundesweiten Soja-Demonstrationsnetzwerk. Liebe Leserinnen und Leser! Ich bitte Sie, auch zukünftig unsere Arbeit durch eine offene Diskussion und konstruktive Kritik zu begleiten. Nur durch diesen Austausch sind wir in der Lage, unsere Arbeit im Sinne von Landwirten, Gärtnern und gesellschaftlichen Anforderungen zu leisten. Ihr A. Sandhäger (Direktor) 3
6 Situation der hessischen Landwirtschaft 2. Situation der hessischen Landwirtschaft 2.1. Fachgebiet 31 Ökonomie Wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe Anne Mawick Leichter Gewinnanstieg - Ackerbau und Veredlung im Plus Die in der hessischen Regionalstatistik ausgewerteten 663 Haupterwerbsbetriebe erzielten im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen durchschnittlichen Unternehmensgewinn von Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Gewinnplus von 3,9 %. Nach den beiden schwierigen Wirtschaftsjahren 2008/09 und 2009/10 befinden sich die Ergebnisse seit nunmehr drei Wirtschaftsjahren auf einem gefestigten Niveau und bieten den Betrieben eine gute Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung. Dies schlägt sich auch in der allgemeinen Stimmung in der Landwirtschaft nieder. Der Konjunkturbarometer Agrar spiegelt mit einem Wert von 35,5 zuletzt im September 2013 diese gute Situation wider. Auch in Hessen zeigt sich dies durch nochmals leicht gestiegene Brutto- und Nettoinvestitionen. Im WJ 2012/13 bewirtschafteten die Haupterwerbsbetriebe der Regionalstatistik 108,85 ha mit einem Viehbesatz von 123,0 Vieheinheiten je 100 ha LF und waren mit 2,32 AK, von denen 1,56 AK aus der Familie stammen, ausgestattet. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Ausstattung mit Familienarbeitskräften kaum verändert. Der zusätzliche Arbeitszeitbedarf wird über Fremdarbeitskräfte gedeckt. Dadurch bietet die Landwirtschaft gut qualifizierten Arbeitskräften zunehmend eine berufliche Perspektive. Sie muss aber auch auf eine immer höhere Arbeitsproduktivität setzen, um diese Arbeitskräfte dann bezahlen zu können. Abb. 1 zeigt die Entwicklung der Gewinne in den verschiedenen Betriebsformen. Dabei überragen für das Wirtschaftsjahr 2012/13 die Ergebnisse der Ackerbau- und Veredlungsbetriebe die der Futterbau- und Verbundbetriebe um ca Betrachtet man den Durchschnittsgewinn der vergangenen 10 Jahre ( /HE Betrieb und / nak), liegt das Ergebnis des WJ 2012/13 wieder deutlich darüber. Drei der vier höchsten Durchschnittsgewinne wurden dabei in den letzten drei Wirtschaftsjahren erzielt. Verwunderlich ist dies nicht, da die Betriebe in der Vergangenheit ihre Produktionskapazitäten ausgedehnt haben und nun höhere Betriebsergebnisse benötigen, um ihren wirtschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die Volatilität der Märkte hat mittlerweile alle Betriebsformen erreicht und nach wie vor wachsen hessische Betriebe stärker über die Fläche als über die Tierhaltung. Die Wachstumsschwelle liegt in Hessen deutlich über 100 ha. Parallel konnten die Betriebe aber ihre Produktionsleistungen erhöhen. 4
7 Situation der hessischen Landwirtschaft Abb. 1: Vergleich der Gewinne in den verschied. Betriebsformen WJ 2008/09 bis 2012/13 Quelle: Hessische Regionalstatistik, verschiedene Jahrgänge Was passierte in den verschiedenen Betriebsformen? Nach einem von der Witterung geprägten schwierigen Vorjahr konnten die Ackerbaubetriebe die größte Gewinnsteigerung erzielen. Die Umsatzerlöse aus der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion erhöhten sich von auf (+4,2 %). Umsatzstärkster Bereich ist nach wie vor der Getreide anbau ( ), dessen Erlösanstieg auf die gestiegenen Getreidepreise zurückzuführen ist. Aber auch im Rapsanbau konnten die Betriebe die Erlöse ( ) durch Preis- und Mengensteigerung erhöhen. Obwohl die Erlöse im Feldgemüsebau (incl. Spargelanbau) um 3,5 % zurückgegangen sind, bleibt dieser der zweitstärkste Umsatzbereich. Die betrieblichen Aufwendungen sind leicht gestiegen, obwohl die variablen Kostenpositionen wie Saatgut, Düngemittel und Treib- und Schmierstoffe im Verglich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sind. In den Ackerbaubetrieben hat sich der Pacht- (182 /ha) und der Personalaufwand erhöht. Diese Betriebe wirtschafteten mit 104,4 ha und haben mit 11,7 VE je 100 ha LF nur einen sehr geringen Viehbesatz, der für den wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe keine Rolle spielt. Ausgehend von dem guten Wirtschaftsjahr 2010/11 mussten die Futterbaubetriebe zum zweiten Mal einen Gewinnrückgang hinnehmen. Das erreichte Durchschnittsergebnis bedeutet ein Minus von 5,4 % gegenüber dem WJ 2011/12. Die Futterbaubetriebe sind in der Flächenausstattung (112,8 ha LF) und in der Anzahl der Milchkühe (75,7 St.) gewachsen. Die Milchleistung blieb mit kg/kuh ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Nachdem zu Beginn des Wirtschaftsjahres bei niedrigen Milchpreisen und explodierenden Futterkosten die Betreibe auf ein Liquiditätstief zu steuerten, konnte diese Entwicklung mit den steigenden Milchpreisen im Verlauf des Wirtschaftsjahres wieder aufgefangen werden. Der durchschnittliche Milchpreis ging daher nur leicht zurück und aufgrund der gewachsenen Bestände konnte ein Umsatzplus bei der Milch erzielt werden. Dieses Plus reichte allerdings nicht aus, um die gestiegenen betrieblichen Aufwendungen aufzufangen. Hier sind vor allem die Futtermittelausgaben (auch infolge der schlechteren Grundfutterqualität) zu nennen, sie explodierten um 21,2 % auf
8 Situation der hessischen Landwirtschaft Die Veredlungsbetriebe wirtschafteten mit 76,24 ha (+2,24 ha) und einem Viehbesatz von 359 VE/100 ha LF. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Anteil der Sauenhalter im Vergleich zu den Mästern in der Gruppe zugenommen. Die Betriebe konnten sich über gestiegene Verkaufserlöse für Ferkel und Läufer (+7,6 %) auf 56,64 /St. und für Mastschweine (+9,0 %) auf 160,29 /St. freuen. Hierdurch stiegen die betrieblichen Erträge stärker als die Aufwendungen, obwohl der Futtermittelzukauf je Betrieb um 8 % gestiegen ist. Die Veredlungsbetriebe verbesserten so durchschnittlich ihren Gewinn um 6,9 % auf In diesem Jahr haben die Verbundbetriebe erneut nicht das durchschnittliche Ergebnis aller Betriebe erreichen können und mussten einen leichten Gewinnrückgang von 2,0 % hinnehmen. Die Spezialisierung anderer Gruppen bewirkt in guten Wirtschaftsjahren deutlich bessere Ergebnisse, die in Verbundbetrieben nicht erreicht werden können. Sie erzielen in allen wichtigen Betriebszweigen nicht die produktionstechnischen Leistungen, wie andere Betriebsformen. Welche wichtigen Entwicklungen gab es noch? Neben dem Gewinn ist vor allem das Ordentliche Ergebnis zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Betriebe eine wichtige Kennzahl. Wird der Gewinn um Investitionszulagen sowie zeitraumfremde und außerordentliche Einflüsse bereinigt, erhält man das Ordentliche Ergebnis. Es ist von im WJ 2011/12 lediglich um 0,3 % auf je Unternehmen im WJ 2012/13 gestiegen. Hieraus müssen die Betriebe ihre privaten Entnahmen finanzieren und streben eine positive Eigenkapitalbildung an, um notwendige Tilgungen und Nettoinvestitionen auch aus Eigenkapital finanzieren zu können. Die zeitraumechte und bereinigte Eigenkapitalbildung liegt mit um 3,8 % über dem Vorjahresergebnis und bewegt sich damit auf einem Niveau, welches die Haupterwerbsbetriebe zur Sicherung ihrer Liquidität und Stabilität aber auch erreichen sollten. Die Investitionstätigkeit hat sich im WJ 2012/13 weiter erhöht. Die fest tendierenden Milchpreise, die gestiegenen Raps-, Getreide- sowie Schweinepreise wirken sich deutlich auf die Liquidität der Betriebe aus, auch wenn die betrieblichen Aufwendungen ein weiteres Jahr in Folge gestiegen sind. Sowohl die Brutto- (von aus dem WJ 2010/11 über im WJ 2011/12 auf im WJ 2012/13) als auch die Nettoinvestitionen (von über auf ) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und ermöglichen eine weitere Betriebsentwicklung. Ein Kriterium für erfolgreiches Wirtschaften ist die Nettorentabilität (Abb. 2). Liegt sie über 100 %, werden die bisher nicht entlohnten Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital entsprechend der gewählten Ansätze entlohnt und es entsteht ein echter Unternehmergewinn. In den letzten drei Wirtschaftsjahren ist dies den erfolgreichen (25 % Besten) und dem Durchschnitt der ausgewerteten hessischen Haupterwerbsbetriebe gelungen. 6
9 Situation der hessischen Landwirtschaft Abb. 2: Entwicklung der Nettorentabilität in den Haupterwerbsbetrieben Allerdings hat sich die Einkommensdisparität (Abb. 3) innerhalb der Landwirtschaft in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Betrug der Abstand beim Unternehmensgewinn der erfolgreichen Betriebe (oberstes Viertel) zu den weniger erfolgreichen Betrieben (unterstes Viertel) im WJ 2003/04 noch , so sind es im WJ 2012/13 bereits Abb. 3: Relation des Gewinns der erfolgreichen und weniger erfolgreichen Betriebe zum Durchschnittsgewinn der Haupterwerbsbetriebe Was bringt das laufende WJ 2013/14? Die erfreulichen Ergebnisse scheinen sich im laufenden Wirtschaftsjahr 2013/14 überwiegend fortzusetzen. Allerdings werden die Ackerbaubetriebe gegenüber dem guten Vorjahr einen Rückgang im Unternehmensergebnis wegen der deutlich niedrigeren Marktpreise für Getreide und Raps hinnehmen müssen, die nicht von den höheren Ernteerträgen aufgefangen werden. Insgesamt schneiden diese Betriebe aber immer noch gut ab. 7
10 Situation der hessischen Landwirtschaft Die Milchviehbetriebe profitieren von Milchpreisen auf Rekordniveau und sinkenden Futterkosten. Sie werden die Gewinner des Wirtschaftsjahres 2013/14 sein. Aufgrund der aktuellen Preissituation bei rückläufigen Futtermittelpreisen können die Veredlungsbetriebe ihr gutes Gewinnniveau aus dem Vorjahr halten. Weniger erfreulich wird das Wirtschaftsjahr für die Rindermäster und Mutterkuhhalter ausgehen. Sinkende Rindfleischpreise und die einheitliche Flächenprämie setzen diese Betriebe unter Druck. Außerdem werden die Ausgaben für Löhne in allen Betriebsformen weiter ansteigen, was bei gleichzeitig steigender Arbeitsproduktivität aber unproblematisch ist. Die Investitionstätigkeit wird in Form von Neu- und Ersatzinvestitionen als Folge der guten Ergebnisse im Vorjahr wieder zunehmen. Demgemäß ist mit höheren Aufwendungen für Abschreibung und Unterhaltung von Gebäuden und Maschinen zu rechnen. Auch in Hessen ist von steigenden Pachtbelastungen auszugehen. 8
11 Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr 3. Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr 3.1. Fachgebiet 41 Organisation, Recht Organisation und Aufgaben des LLH Hartmut Fischer und Christiane Foos Der seit dem Jahr 2005 bestehende Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ist Teil des Umweltressorts der hessischen Landesverwaltung und dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstellt. Der Landesbetrieb stellt als fachbezogene Informations- und Beratungsinstitution Fachinformationen, Beratung und Bildungsangebote für die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe Hessens bereit. Hierdurch wird die wirtschaftliche Situation der Betriebe verbessert wie auch der Schutz der natürlichen Ressourcen gestärkt. Eine starke Bündelung der Aufgaben und die Präsens in der Fläche sind hierfür ausschlaggebend. Der LLH strukturiert sich unterhalb der Leitungsebene mit seiner Stabstelle Controlling in drei Fachabteilungen Beratung, Bildung und Fachinformation sowie die Abteilung Zentrale Dienstleistungen. Den Abteilungen sind Fachgebiete mit unterschiedlichen Kernkompetenzen zugeordnet. Die Abteilung Beratung arbeitet eng mit dem Kuratorium für das landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratungswesen in Hessen zusammen. Durch die sich heraus ergebenden vielfältigen Synergien werden die Beratungsdienstleistungen abgerundet. ORGANISATIONSPLAN Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz *) LANDESBETRIEB LANDWIRTSCHAFT HESSEN Kuratorium Leitung Controlling 1 Beratung 2 Bildung 3 Fachinformation 4 Zentrale Dienstleistungen 11 Beratungsteam Ökonomie 11.1 Beratung Ökonomie, Verfahrenstechnik 11.2 Landtourismus, Erwerbskombination 12 Beratungsteam Gartenbau 21 Zuständige Stelle 22 Bildung Landwirtschaft 23 Hessische Gartenakademie 24 Ressortweite Fortbildung 25 Landgestüt Dillenburg, Landesreit- und Fahrschule 31 Ökonomie 32 Fachinformation Gartenbau 33 Fachinformation Pflanzenproduktion 34 Fachinformation Tierhaltung 35 Bieneninstitut 41 Organisation, Recht 42 Personal 43 Finanzen 44 Informationstechnik 13 Beratungsteam Pflanzenproduktion 36 Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie 14 Beratungsteam Tierhaltung 15 Beratungsteam Ökologischer Landbau 16 Qualitätssicherung und Leistungsermittlung Tier (*) Bezeichnung seit dem : Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 9
12 Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr Der Sitz der Landesbetriebs-Zentrale ist Kassel. Die Bildungs- und Beratungszentren in Alsfeld, Fritzlar, Griesheim, Petersberg und Wetzlar, das Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld, das Gartenbauzentrum Geisenheim, das Bildungsseminar Rauischholzhausen sowie das Bieneninstitut Kirchhain bilden Außenstellen des Landesbetriebs. Hinzu kommen sieben Beratungsstellen, die zumeist in Bürogemeinschaften mit den Landratsverwaltungen untergebracht sind. Des Weiteren zählen eine Versuchsstation für das pflanzenbauliche Versuchswesen (Kassel) sowie sechs Versuchsfelder (5 konventionell: Butzbach-Nieder-Weisel, Riedstadt-Leeheim, Bad Hersfeld, Homberg-Mardorf, Vöhl; 1 ökologisch: Alsfeld) hinzu. 10
13 Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr 3.2. Fachgebiet 42 Personal Harald Kruppa Personalsituation und -entwicklung Schwerpunkte der Personalarbeit im Berichtszeitraum waren u.a. Erstellung eines Konzepts der Personalentwicklung im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Erstellung von konkreten Regelungen für die Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten im LLH. Erstellung einer Handlungshilfe Aufbau und Bestandteile einer Stellenausschreibung. Umsetzung der Neuregelungen des Urlaubsanspruchs für Beamte/innen und Tarifbeschäftigte aufgrund der ergangenen EU-Rechtsprechung und Änderungen der Hess. UrlVO und des TV-H. Umsetzung der verlängerten Besitzstandsregelungen für den weiteren Bewährungsaufstieg nach dem TVÜ-H bis zum Inkrafttreten einer Entgeltordnung zum TV-H. Vorarbeiten für die Umsetzung der Neuregelungen zum 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ab Entwicklung des Personalbestandes Die normale Fluktuation ist beim LLH weiterhin unterdurchschnittlich, was insbesondere auf eine sehr geringe Anzahl von Altersabgängen zurück zu führen ist. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen besteht für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und quantitativ adäquaten Personalausstattung nur ein begrenzter Handlungsspielraum. Personalbestand Personalbestand Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen am am Beschäftigte Köpfe verfügbare AK Köpfe verfügbare AK Beamte 92 81, ,50 Tarifbeschäftigte, unbefristet , ,07 Summe unbefristet , ,57 Auszubildende/Referendare 25 25, ,00 Tarifbeschäftigte, befristet 37 30, ,09 Summe befristet 62 55, ,09 Summe LLH , ,66 zum LLH abgeordnet (org. Zuordnung) 1 1,00 0 0,00 Summe Abordnung zum LLH 1 1,00 0 0,00 Gesamt , ,66 11
14 Die Entwicklung des LLH im Geschäftsjahr Entwicklung des Stellenplans Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) bewirtschaftet die Stellen für seinen Geschäftsbereich zentral. Die Stellenpläne im Haushaltsplan stellen daher nicht die korrekte Stellensituation des LLH dar. Basis für die Arbeit des LLH sind bis auf weiteres die jährlichen Stellenzuweisungen durch das HMUKLV, die teilweise erheblich von den Angaben im Haushaltsplan abweichen. Stellenzuweisung Stellenzuweisung Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen durch HMULV durch HMULV Stand Stand Beamte 113,5 111,5 Tarifbeschäftigte 247,0 241,0 Summe 360,5 352,5 Anwärter/Referendare 0,0 0,0 Auszubildende Tarifbeschäftigte 35,0 35,0 Summe 35,0 35,0 Leerstellen Beamte 0,0 0,0 Leerstellen Tarifbeschäftigte 6,0 4,0 Summe 6,0 4,0 Altersteilzeitstellen Beamte 3,0 3,5 Altersteilzeitstellen Tarifbeschäftigte 12,5 16,5 Summe 15,5 20,0 Gesamt 417,0 411,5 12
15 Abteilung 1 Beratung 4. Abteilung 1 Beratung 4.1. Fachgebiet 12 Beratungsteam Gartenbau Beet- und Balkonpflanze des Jahres in Hessen Günter Wilde Für viele hessische Produktions- und Einzelhandelsgärtnereien der Fachrichtung Zierpflanzenbau sind Beet- und Balkonpflanzen die umsatzstärkste und damit wichtigste Warengruppe. Um sich von Baumärkten, Discountern etc. besser abgrenzen zu können, wurde in der Fachgruppe Zierpflanzenbau des Hessischen Gärtnereiverbandes die Idee geboren, jährlich eine Hessische Balkonpflanze des Jahres zu küren und diese medienwirksam ins Rampenlicht zu stellen. Die Aktion hat als weitere Ziele: die Absatzsteigerung von Beet- und Balkonpflanzen bei Produzenten und Einzelhandelsgärtnereien, die Erhöhung des Bekanntheitsgrades des gesamten Beet- und Balkonpflanzensortiments, die bessere Wahrnehmung von Fachkompetenz und Qualität beim Verbraucher. Abb. 1: Pressetermin zur Taufe der Zuckerpuppe in der Gärtnerei Uffelmann 2013 (Bildnachweis: Hessischer Gärtnereiverband) Die Auswahl der Pflanze erfolgt durch eine Kommission, die sich aus Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern, Gartenbauberatern und Mitarbeitern gartenbaulicher Versuchsanstalten zusammensetzt. Jedes Jahr im Sommer trifft sich diese Gruppe an der LWG Veitshöchheim unmittelbar im Anschluss an den Beet- und Balkonpflanzentag und wählt aus Vorschlägen von Jungpflanzenbetrieben und aus dem Schausortiment des dortigen Versuchsfelds eine geeignete Pflanze aus. Die Kriterien, die die Pflanze nach Möglichkeit erfüllen soll, sind: sie sollte eine echte Neuheit sein, sie sollte noch nicht im branchenfremden Handel angeboten worden sein, sie soll möglichst robust sein, sie soll eine einzigartige Blütenfülle besitzen, 13
16 Abteilung 1 Beratung sie soll den ganzen Sommer über blühen, sie soll möglichst vielfältig verwendbar sein, sie soll mit anderen Pflanzen gut kombinierbar sein, es sollen ausreichende Mengen Jungpflanzen verfügbar sein, sie soll von möglichst vielen Gärtnereien produzierbar sein. Damit die Pflanze aus dem breiten Balkonpflanzensortiment heraussticht, wird ihr noch ein markanter Name verliehen. Nach Festlegung des Namens wird vom Hessischen Gärtnereiverband ein Werbemittel- Paket geschnürt und den an der Aktion teilnehmenden Betrieben für einen günstigen Preis zur Verfügung gestellt. Dieses Paket besteht aus wetterfesten DIN A1- Plakaten, DIN A4-Aktionsschildern für die Preisauszeichnung, Stecketiketten für Töpfe und einer Daten-CD mit weiteren Werbemitteln zum Ausdrucken, weiterführenden Informationen zur Aktion und Pressetexten. Finanziell wird die Aktion vom Blumengroßmarkt Frankfurt und den Jungpflanzenunternehmen unterstützt. Im Jahr 2013 wurde als Beet- und Balkonpflanze die Zuckerpuppe (Petunienneuheit) gewählt. Zu Saisonbeginn im April wird die Balkonpflanze des Jahres als PR-Maßnahme bei Veranstaltungen wie Hessentag, Pflanzenmarkt im Hessenpark und auf Kreisebene in verschiedenen Einzelhandelsgärtnereien im Beisein bekannter Persönlichkeiten der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Der Erfolg der Aktion hat Spuren hinterlassen. Seit 2007 beteiligen sich der Badische Gärtnereiverband und seit 2009 auch der Württembergische Gärtnereiverband an der Aktion. Aus dieser Kooperation heraus ist die gemeinsame homepage die von der Lehr- und Versuchsanstalt Heidelberg erstellt wurde und jährlich aktualisiert wird, entstanden. Das in 2009 gegründete Grüne Medienhaus stellt Journalisten Beiträge und Bilder zu vielen gartenbaulichen Themen, u.a. auch zur Balkonpflanze des Jahres, zur Verfügung. Viele Tageszeitungen greifen auf dieses Angebot zurück und haben in den vergangenen Jahren über die Balkonpflanze des Jahres in Hessen berichtet. Erstmals in 2014 hat der Frankfurter Blumengroßmarkt in einem regionalen Rundfunksender Werbespots zu dieser Marketingaktion geschaltet. Abb. 2: Der Knutschfleck, die bislang erfolgreichste Balkonpflanze des Jahres (Bildnachweis: Wilde) Abb. 3: Die 3 Elfen, Balkonpflanze des Jahres 2014 (Bildnachweis: ( 14
17 Abteilung 1 Beratung Zur Balkonpflanze des Jahres in Hessen wurden bislang gekürt: 2004 Champagner-Begonie (Begonia Champagner`) 2005 Knutschfleck (Pelargonium Angeleyes`-Serie) 2006 Liebesperlen (Impatiens Neo Cameo`) 2007 Caliente (Pelargonium Caliente`) 2008 Susi Sorglos (Calibrachoa Callie Deep Yellow`) 2009 Schneeprinzessin (Lobularia Snow Princess`) 2010 Mein Sunnyboy (Bracteantha bracteata Totally Yellow`) 2011 Petticoat (Calibrachoa Trixi Petticoat`) 2012 Klunkerheidi (Begonia Peardrop`) 2013 Zuckerpuppe (Petunia Rythm & Blues`) Es wäre wünschenswert, wenn sich flächendeckend mehr Einzelhandelsgärtnereien und Blumenfachgeschäfte an dieser Aktion beteiligen würden. 15
18 Abteilung 1 Beratung Erhaltung alter Süßkirschsorten Eberhard Walther Der Süßkirschenanbau hat in der Region Witzenhausen eine sehr lange Tradition. Seit über 400 Jahren werden hier Süßkirschen angebaut. Im 18. Jahrhundert kam es zu einer sehr starken Ausweitung des Anbaues. Mit der Gründung des pomologischen Institutes 1877 in Kassel wurde der Süßkirschenanbau auf wirtschaftlich sichere Füße gestellt. Eine Vielzahl von Lokalsorten und Sorten mit lokalem Bezug wurden in dieser Zeit gepflanzt. Bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts prägten die ausgedehnten Kirschenanlagen mit hochstämmigen Baumformen das Landschaftsbild der Region. Abb. 1: Kirschblüte im Werratal Durch die Intensivierung des Kirschenanbaues sind in den letzten Jahrzehnten viele dieser lokal bedeutsamen Sorten zurückgedrängt worden, da sie den Erfordernissen des modernen Süßkirschenanbaues nicht mehr entsprachen. 16
19 Abteilung 1 Beratung Mit der Gründung eines gemeinsamen Projektes zur Erhaltung alter Süßkirschensorten in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und der Stadt Witzenhausen wurden regional bedeutende Sorten zunächst registriert und vermehrt. Seit dem Jahr 2013 werden im Süßkirschen- Versuchsbetrieb Wendershausen diese Sorten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zu wissenschaftlichen Zwecken aufgepflanzt, bislang waren es ca. 70 Süßkirschsorten. Das Sortiment soll um weitere Sorten mit sozio kulturellen, lokalen, oder historischem Bezug ergänzt werden. Das Süßkirschsortiment wird in Zusammenarbeit mit dem Obstbauinstitut der Hochschule Geisenheim und dem Consortium deutscher Baum schulen um ein Pflaumen- und Zwetschen sortiment erweitert. Abb. 2: Neupflanzung April 2014 Mit dem Programm zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist der Süßkirschen-Versuchsbetrieb Wendershausen im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen ein wichtiger Standort alter regionaler Süßkirschsorten. Abb. 3: Unveredelte Wurzelsorten 17
20 Abteilung 1 Beratung 4.2. Fachgebiet 13 Beratungsteam Pflanzenproduktion und Fachgebiet 15 Beratungsteam Ökologischer Landbau Beratungsangebot: Lagercheck und Vorratsschutz für Getreide, Raps und Körnerleguminosen Karl-Heinrich Claus und Heinz Gengenbach Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Das Thema Vorratsschutz wird in Veranstaltungen äußerst zurückhaltend diskutiert. Wer nachfragt, oder sich an Diskussionen beteiligt, hat offenbar selbst Probleme auf dem Betrieb. Die LLH Beratungsteams Ökonomie, Pflanzenproduktion und Ökolandbau haben deshalb in den vergangenen Monaten das Beratungsangebot Lagercheck und Vorratsschutz entwickelt, das dem Landwirt eine individuelle Beratung ermöglicht. Für Landwirte ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn Abb. 1: Schaden durch Kornkäfer die Ernte endlich eingefahren ist. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass Getreide im Lager wirklich sicher aufbewahrt ist. Nach der Einlagerung kann Getreide von Schädlingen befallen werden. Es entsteht Feuchtigkeit, die Temperatur im Lager steigt an - Bedingungen, die dann auch Lagerpilze fördern. Bei der Lagerung von Futtermitteln = Lebensmitteln spielt die Qualitätssicherung eine entscheidende Rolle. Es geht darum Risiken zu vermeiden, um die Vermarktung bzw. das Verfüttern gesunder und handelsüblicher Ware sicherzustellen. Der Lagercheck des LLH hat das Ziel, von außen auf bestehende Abläufe zu blicken - Stärken und Schwächen zu analysieren und ggf. Lösungsmöglichkeiten mit dem Betriebsleiter zu erarbeiten. Leider erleben viele Landwirte jedes Jahr unliebsame Überraschungen. Im Laufe des Winters soll das im Sommer eingelagerte Getreide zum Verfüttern umgelagert werden. Beim Betreten des Schüttbodens stellt der Landwirt fest, dass die Spitze des Schüttkegels grün gewachsen ist. Beim Anfassen des Getreides bemerkt der Betriebsleiter, dass dieses erwärmt ist, nicht nachrieselt, stattdessen klumpt und Brücken bildet. Beim näheren Betrachten sind Löcher in den Körnern zu sehen. Außerdem fällt ihm auf, dass das Getreide, wenn er es in der Hand hält, stark mehlig ist. An der Stelle, wo der Landwirt in den Stapel gefasst hat, geht es mittlerweile wie in einem Ameisenhaufen zu. Tausende von Kornkäfern und andere Lagerschädlinge sind bei genauerem Hinsehen mit dem bloßen Auge auszumachen. Ein Beispiel, welches so oder in ähnlicher Form häufiger auftritt. Betroffen von Lagerproblemen sind oft viehhaltende Betriebe, deren Betriebsleiter arbeitswirtschaftlich häufig anderweitig stark eingespannt sind, Betriebe, deren betrieblicher Schwerpunkt eben nicht im Ackerbau liegt, Betriebe die gewachsen sind, im Hinblick auf die Lagerhaltung mit Investitionen zurückhaltend waren, deswegen aber jede Möglichkeit zum Einlagern nutzen. Aber auch spezialisierte Ackerbauern sind betroffen. 18
21 Abteilung 1 Beratung Der Blick von außen, z. B. durch einen unabhängigen Berater, bietet eine gute Möglichkeit, Abläufe und Arbeitsprozesse rund um die Lagerung sorgfältig zu prüfen und gezielt zu optimieren. Viele Prüfkriterien sind seit langem etabliert und selbstverständlich, werden jedoch im Alltag mal übersehen oder vernachlässigt - mit zum Teil gravierenden Folgen. Die Prüfkriterien lassen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche einteilen: Prüfung Lagerstätten Bekämpfung Schadnager Bekämpfung Vorratsschädlinge Lebens- und Futtermittelsicherheit Rückverfolgbarkeit/ Dokumentation Verschiedene Verordnungen weisen dem Landwirt als Lebensmittel- bzw. Futtermittelerzeuger die Verantwortung für das Inverkehrbringen zu. Landwirte haben bei der Lagerung von Lebens- und Futtermitteln mittlerweile viele gesetzliche Auflagen einzuhalten. Ernteprodukte mit qualitativen Mängeln können und dürfen nicht mehr vermarktet oder verfüttert werden. Jeder Landwirt ist verantwortlich für die Qualität seiner eingelagerten Lebens-und Futtermittel. Seit 2005 gelten EU weit Cross Compliance (CC) Anforderungen, d.h. Landwirte sind an die rechtlichen Regelungen und zusätzlich an das Fachrecht gebunden. Die EU Agrarförderung ist u.a. an die Einhaltung dieser Vorschriften gekoppelt. Landwirte, die dagegen verstoßen, riskieren Kürzungen und damit finanzielle Verluste. Der Lagercheck trägt dazu bei, die Stabilität im Speicher zu gewährleisten. Beim Beratungsangebot des LLH Lagercheck und Vorratsschutz arbeiten Betriebsleiter und Berater gemeinsam daran, die Situation im Betrieb Schritt für Schritt zu optimieren. Ziel ist es, das Erntegut in qualitativ und quantitativ hochwertigem Zustand für die Vermarktung oder die Verfütterung zu erhalten sowie alle rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Das Konzept sieht vor, dass ein Berater zusammen mit dem Betriebsleiter zunächst eine Bestandsaufnahme der Lagerhaltung von Getreide, Raps und Leguminosen durchführt. Diese Analyse hat das Ziel, Schwachstellen und Stärken aufzuzeigen. Für alle Fragen gibt es im vielköpfigen Lagercheck -Team des LLH einen festen Ansprechpartner. Werden größere Mängel ausgemacht, nutzt der Berater auch seine Kontakte zu Kollegen im LLH sowie externen Fachleuten, erarbeitet mit ihnen praktikable Lösungsansätze und stellt gegebenenfalls einen Maßnahmenplan auf. Mit Hilfe neuester Messtechnik haben die LLH-Berater nicht nur die Möglichkeit die Temperatur und die Luftfeuchte im Getreidestapel festzustellen, sondern auch den Wert für die Wasseraktivität (a W -Wert) des Getreides zu bestimmen. Dieser Parameter wird nach Ansicht von Lagerexperten zukünftig einen hohen Stellenwert bei der Vermarktung von Getreide erlangen. Der Wert beschreibt den im Getreide ungebunden Anteil an Feuchtigkeit, der für Schaderreger und Atmungsprozesse verfügbar ist, und ggf. auch zur Mykotoxinbildung im Lager führen kann (Dr. Klaus Münzing, MRI Detmold). 19
22 Abteilung 1 Beratung ( Weitere Infos dazu auch in: Getreidelagerung. Sauber, sicher und wirtschaftlich, 2013, Hrsg.: Heinz Gengenbach u.a. in der Reihe AgrarPraxisKompakt. Ein Kooperationsprojekt des DLG Verlags mit dem LLH). Informationen über Qualitätssicherungsprogramme für Druschfrüchte, die Überprüfung der CC Anforderungen, Hilfe beim Erfüllen der Dokumentationspflicht und ein Controlling zu den gesamten Aktivitäten runden das Beratungsangebot ab. Das Beratungsangebot des LLH richtet sich an alle hessischen Betriebe, unabhängig von der Größe bzw. Lagermenge. Abb. 2: Der Wasseraktivitäts (aw-wert) liegt mit 0,586 im grünen Bereich. Bei einer Lagertemperatur des Weizens von 15,66 C. Mit Hilfe dieses Gerätes kann die Lagerstabilität ermittelt werden. Hinweis: Das Beratungsangebot des LLH Lagercheck und Vorratsschutz ist unter im Downloadbereich im Beratungskatalog zu finden. 20
23 Abteilung 1 Beratung Fachveranstaltung: Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais Dr. Marco Schneider In einer Gemeinschaftsveranstaltung des Deutschen Maiskommitees (DMK), der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung (GKB) und des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH) wurde am 22. Oktober 2013 in der Stadthalle Alsfeld und auf den Flächen des Betriebs Georg GbR Alsfeld im Rahmen eines Praktikertages der Frage nachgegangen, welche Maßnahmen dazu geeignet sind eine zügige Strohrotte nach der Silomais- oder Körnermaisernte einzuleiten und der Ausbreitung von Schädlingen vorzubeugen. Rund 250 Tagungsteilnehmer besuchten die Veranstaltung, die durch den Vorsitzenden des Deutschen Maiskommitees, Prof. Dr. Friedhelm Taube von der Uni Kiel und Herrn Klaus Reinhardt (LLH) eröffnet und moderiert wurde. Privatdozent Dr. Hans-Heinrich Voßhenrich vom von Thünen-Institut Braunschweig skizzierte ein leitend in seinem Referat Feldhygiene - Häckseln/Mulchen - zur Optimierung von Bodenbearbeitung und Pflanzengesundheit die phytosanitäre Problematik des Maisanbaus. Schäden treten am häufigsten auf durch phytopatogene Pilze, wie z. B. Fusarien, die den in der Fruchtfolge nachfolgenden Weizen infizieren und dort Mykotoxine wie DON hervorrufen können. Oder auch durch den Maisbeulenbrand oder durch Schadinsekten wie den Maiszünsler mit Raupenfraß im Maisstängel und den Maiswurzelbohrer mit Wurzelfraß. Da die Überwinterung der Schädlinge maßgeb- Abb. 1: Aktive Zerkleinerung durch einen Schlegelmulcher lich von unzersetzten Ernterückständen abhängt, stellt der Referent als zentrales Problem die Stoppelund Strohzerkleinerung heraus, die die Zersetzung der Erntereste primär beeinflusst. An Bildbeispielen sind die Zerkleinerungswirkung verschiedener Geräte und Gerätesysteme auch in Abhängigkeit der Werkzeugform und Fahrgeschwindigkeit verdeutlicht. In multifaktoriellen Kleinparzellenversuchen sei nachgewiesen worden, dass mit der Intensität der Zerkleinerung und Einarbeitung in den Boden der DON-Gehalt im nachfolgenden Weizen bis auf 14 % des Ausgangswertes gedrückt werden konnte. Verbesserungen beim Fusarien befall könnten zudem durch eine geeignete Sortenwahl und eine verbesserte Fruchtfolge erzielt werden. Hinsichtlich des Maiszünslerbefalls würden ebenfalls Maßnahmen durch Stoppelhäckseln (so kurz wie möglich) und eine intensive Einarbeitung in den Boden helfen. Ein Problem beim Stoppelhäckseln stellen allerdings durch die Erntetechnik umgefahrene Stoppeln in Radspuren dar, die durch die Werkzeuge von Sichel-, zum Teil auch von Schlegelhäckslern nicht erfasst werden. In Versuchen seien Lösungen durch direkten Schlegelanbau an die Erfassungsorgane zur Silo- oder Körnermaisernte untersucht worden, die gute Ergebnisse gebracht hätten, aber von der Landtechnik noch nicht angeboten würden. Umgefahrene Stoppel können Maiszünslerlarven beherbergen, da diese zur Silomaisernte in den unteren Stängelbereichen anzutreffen sind. Eine Vorbesichtigung der Alsfelder Praxisflächen am Vortag hätte zur Überraschung der Experten gezeigt, dass ein Großteil der Larven in Stängelbereiche unterhalb des 1. Internodiums ca. 2 bis 4 cm über dem Bodenhorizont eingewandert waren und so nur schwer von den Werkzeugen der Stoppelhäcksler erfasst würden. In diesem Zusammenhang sei auch wichtig, dass bei der Bodenbearbeitung vor der Maisbestellung ein sehr ebenes Saatbeet erreicht werde. Ferner sei eine standortangepasste Sortenwahl wichtig, auch der Spleißgrad der 21
24 Abteilung 1 Beratung Erntemaschine spiele eine Rolle. Hilfreich könne auch die Arbeitsrichtung bei der Mulcharbeit (gegen die Stoppel) sein. Michael Lenz vom Pflanzenschutzdienst Hessen ging auf die Biologie des Maiszünslers ein, der in Hessen durch die widrigen Witterungsbedingungen im Frühjahr 2013 erst ab Juli auftrat, dann jedoch ideale Entwicklungsbedingungen durch Trockenheit und hohe Temperaturen vorfand. Zu den entscheidenden Zeitpunkten des Falterfluges und der Eiablage an den Unterseiten der Maisblätter betreibt der Pflanzenschutzdienst Hessen in Kooperation mit dem LTZ Baden-Württemberg ein Monitoring mit Licht- und Pheromonfallen an 16 hessischen Standorten, die regionalbezogene Aussagen für das Auftreten des Abb. 2: Detailierte Maschinenpräsentation Zünslers ermöglichen und über Warndienst und Internet ( verbreitet werden. In 2013 wurde an allen hessischen Standorten das Zünslerauftreten zwischen der 27. und 33. mit einem Höhepunkt der Lichtfallenfänge in der 30. KW festgestellt, wobei ein Befall der Pflanzen bis zu 80 % nachgewiesen werden konnte. Die Befallstärke hänge von den ersten 2 bis 3 Tagen nach dem Junglarvenschlupf ab. In diesem Zeitraum können Witterung und auch Feinde zu hohen Verlusten bei den Larven führen. Da die Larven während ihrer gesamten Lebenszeit wandern, können sie auch mehrere Pflanzen befallen. Selbst aus eingearbeiteten Stoppeln können Larven durch den Boden wieder an die Oberfläche gelangen und dort weitere Stoppelreste besiedeln. Zur Erntezeit würden sich ca. 60 % der Zünslerlarven in Stängelbereichen unterhalb des 2. Internodiums befinden, die bei der Ernte nicht erfasst werden. Neben durch Zünsler verursachte Fraßschäden würde häufig auch ein Sekundärschaden durch Fusarienbefall festgestellt, der eine DON-Belastung bei Weizen als Folgefrucht verursachen kann. Dies bestätigte auch Dr. Marco Schneider vom LLH Alsfeld, der die Möglichkeiten eines verbesserten Strohmanagements beleuchtete. In einem multifaktoriellen Versuch mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung durch Pflug oder Grubber, einer unterlassenen oder durchgeführten Strohzerkleinerung mittels eines Schlegelmulchgerätes und einer Fungizidbehandlung zur Weizenblüte, bzw. Unterlassung dieser Maßnahme konnten deutliche Einflüsse auf die DON-Gehalte bei Weizen festgestellt werden. Diese waren bei steigender Intensität der Bearbeitungs-, und Behandlungsmaßnahmen wesentlich geringer. Mit Blick auf die Zerkleinerungs- und Erfassungswirkung unterschiedlicher Geräte stellte der Referent fest, dass Geräte mit passiver Zerkleinerung und Sichelmulcher nur etwa 50% der Stoppel ausreichend schädigen während Schlegelmulcher Werte bis über 80% geschädigte Stoppel erzielen. Entscheidend sei hier auch die Zerkleinerungsqualität. Innerhalb der Fahrspuren würden die Stoppeln zum größeren Teil nur gequetscht und weniger gesplissen, was für eine zügige Strohrotte aber wesentlich besser sei. An Praxisbeispielen bei Raps konnte Schneider die Wirkung eines Strohmulchs nach Mulchereinsatz und flacher, bzw. tiefer Kurzscheibenegge auch bezüglich Ausfallraps und der N-Mobilisierung im Boden nachweisen. Bei tieferer Bodenbearbeitung (12 cm) mit der Kurzscheibenegge wurde der Ausfallraps vergraben und am Auflaufen gehindert, gleichzeitig wurde durch diese Maßnahme die N-Mineralisierung angeregt, die mit einem N-min Wert von 59 kg (0-90 cm) doppelt so hoch lag wie auf den Vergleichsvarianten. Die unbearbeitete Versuchsvariante und die flache Bearbeitung mit einer Kurzscheibenegge (3 cm) hatten ähnliche Ergebnisse bei aufgelaufenem Ausfallraps und N-min Werten gezeigt. Die Rapsstop- 22
25 Abteilung 1 Beratung pel war nach Kurzscheibenegge jedoch zum überwiegenden Teil eingearbeitet oder zerstört. Der Mulcher zeigte durch die gute Strohzerkleinerung den besten Effekt auf die Strohrotte und den aufgelaufenen Ausfallraps, der gegenüber den zuvor genannten Varianten um 50 % verbessert werden konnte. Schneider wies auf die Gefahr einer Verticillium-Infektion für nachfolgenden Weizen hin, die durch Sklerotien an der Raps stoppel übertragen werden könnten, weshalb zur besseren Rotte generell eine Stoppelzerkleinerung vor der Einarbeitung in den Boden erfolgen sollte. Dies gelte auch für Getreidestoppel, da die Verteilung bei der Einarbeitung durch kurze Häcksellängen wesentlich verbessert wird. Der Referent stellte abschließend fest, dass sich der Maiszünslerbefall durch konsequenten Mulchereinsatz langfristig mit maximal 25-30% befallenen Pflanzen unter der wirtschaftlichen Schadschwelle halten lässt. Aus diesem Grund sei die Forderung zu erheben, dass alle Maisflächen in einer Region gemulcht und dies in das Anlagenkonzept von Biogasanlagen integriert werden sollte. Die Stroh- und Stoppelzerkleinerung bei Mais sei auch eine entscheidende vorbeugende Maßnahme zur Senkung der Mykotoxingehalte im nachfolgenden Weizen. Der Mulcharbeitsgang sei bei gleichen Kosten eine effektivere Maßnahme als eine zusätzliche Bodenbearbeitung mit dem Grubber. In einem Praktikerbericht stellte Franz-Josef Lintel- Höping aus Senden (Westfalen) anschaulich seine Vorgehensweise zur Maiszünslerbekämpfung und zum Strohmanagement im System der konservierenden Bodenbearbeitung vor. Der 150 ha Ackerbaubetrieb mit Schweine- und Bullenmast liegt 15 km südwestlich von Münster und betreibt seit 1995 einen pfluglosen Ackerbau. Die Fruchtfolge besteht aus 50 % Mais (Silomais und CCM), 20 % Weizen, 10 % Gerste und 20 % Triticale/Roggen. Der betriebliche Maschineneinsatz wird teilweise in Kooperation mit einem Nachbarbetrieb betrieben, Erntearbeiten und Abb. 3: Passive Zerkleinerung durch eine Quetschwalze die Gülleausbringung erledigt ein Lohnunternehmer. Getreidestroh wird komplett abgefahren und zur Einstreu bei der Bullenmast verwendet. Das Maisstroh wird zeitnah nach der Ernte gemulcht, wobei der in die Wurzel abwandernde Maiszünsler erfasst wird. Lintel-Höping stellt die Mulchtiefe so ein, dass etwa 1 cm Boden mit erfasst wird und so auch liegende Stoppeln zerkleinert werden. Um angedrückte Stoppel besser zu erreichen wird gegen die Häckselrichtung gemulcht und eine angemessene Arbeitsgeschwindigkeit von 6-8 km/h eingehalten. Den notwendigen Kraftaufwand beziffert der Betriebsleiter mit 50 PS je Meter Arbeitsbreite bei Maisstroh und 35 PS je Meter Arbeitsbreite bei Maisstoppel. Besondere Aufmerksamkeit wird einer gleichmäßigen Einarbeitung und Einmischung der Erntereste geschenkt, die nach dem Motto so tief wie nötig und so flach wie möglich optimale Rottebedingungen vorfinden sollen. Da Maisstroh bei der Aussaat der Folgefrucht zu Verstopfungen führen kann, hat der Betrieb mulchsaatfähige Bodenbearbeitungsgeräte und Bestelltechnik im Einsatz. Nach Einebnung des Saathorizonts erfolgt die Aussaat mit räumenden Säscharen und anschließender Rückverfestigung. Bei Bedarf kommt eine Walze zum Einsatz. Nach kurzer Vorstellung des Praxisbetriebs Georg GbR wurde auf einem abge erntetem Maisschlag (Silomais und Körnermais) die technische Demonstration von Stoppel- und Strohzerkleinerungsgeräten durchgeführt. Unter der Moderation von Frank Käufler von der Gesellschaft für Konservierende Bodenbearbeitung (GKB) wurden Geräte mit passiven Werkzeugen (Doppelt-Vierkantwalze) und aktiven 23
26 Abteilung 1 Beratung Werkzeugen (Sichelmulcher, Mulcher mit Y-Schlegel, Mulcher mit leichtem Hammerschlegel und Mulcher mit schwerem Hammerschlegel) auf Maisstoppel und Maisstroh vorgestellt. Der Moderator informierte über die technischen Besonderheiten, Leistungsanspruch an die Zug- und Antriebsmaschine, Flächenleistung sowie die Gerätekosten. Unterschiedliche Arbeitsqualitäten wurden für die Besucher bei den Demon strationen direkt sichtbar. Aus Witterungsgründen wurde auf die Demonstration von Bodenbearbeitungsgeräten für die Bestellung von Weizen nach Mais verzichtet. Dr. Hans-Heinrich Voßhenrich und Dr. Marco Schneider konnten die Wirkungsweisen dennoch an Demonstrationsparzellen erläutern, die Tage zuvor angelegt waren und Ergebnisse der Bodenbearbeitung bei unzerkleinerten und zerkleinerten Mais stoppeln und Maisstroh durch Kurzscheibenegge, Scheibeneggen-Grubberkombination, dem Pflug und einer Kreiselgrubber-Drillmaschinenkombination zeigten. Der Bekämpfungserfolg des Maiszünslers wurde im Vegetationsverlauf mehrfach auf den angelegten Demonstrationsflächen ausgezählt. Die erarbeiteten Ergebnisse zeigten einen hohen Wirkungsgrad dieser vorbeugenden Bekämpfungsmaßnahme. Diese erstmalig in Deutschland durchgeführten Untersuchungen sind die Basis für eine fundierte pflanzenbauliche Beratung zum Maisanbau durch den LLH. Die wichtigsten Bonituren in der folgenden Darstellung belegen die Effizienz dieser Maßnahme. Abb. 4: Zünslerlarven pro m² nach unterschiedlicher Strohbearbeitung 24
27 Abteilung 1 Beratung 4.3. Fachgebiet 15 Beratungsteam Ökologischer Landbau Mechanische Beikrautregulierung in Hackkulturen Heinz Gengenbach Naturland Hessen, Bioland Mitte und der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) hatten zu einem gemeinsamen Stammtisch auf das Hofgut Habitzheim bei Otzberg eingeladen. Schwerpunkt waren verschiedene Geräte zur Beikrautregulierung in Hackkulturen wie z. B. Zuckerrüben, Mais, Sojabohnen und Kräuter. In der Gruppe der Striegel hat sich der in einer Maschinengemeinschaft genutzte Treffler Präzisionsstriegel besonders in Hack- und Dammkulturen bewährt. Erstmals zeigte in Hessen die französische Firma Carre mit dem Sarclese, einen Hackstriegel, der per Handhebel eine einfache Einstellung der Zinkenstellung ermöglicht. Praktisch ist die Möglichkeit, die Zinken per Klappspint schnell zu wechseln. Jens Graf vom Hofgut Habitzheim berichtete, dass in diesem Jahr der Striegeleinsatz vor der Aussaat und auch im Vorauflauf, kombiniert mit der Abflammtechnik, besonders in Zuckerrüben und bei Kräutern Abb. 1: Der Präzisionsstriegel hat sich in Hack- und Dammkulturen bewährt wie z. B. Dill und Ringelblumen zu sauberen Beständen geführt hat. Die zusätzlichen Handarbeits stunden mit 180 h/ ha hielten sich im Rahmen. Christoph Förster vom Hofgut Marienborn, Büdingen hatte seine Yetter Sternrollhacke mitgebracht. Diese kann im zeitigen Frühjahr, nach seinen Angaben, bereits im dunklen Boden eingesetzt werden. Im Fädchenstadium der Beikräuter hat dieses Gerät mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 km/ ha die beste Wirkung. Bei langsamer Fahrt greifen die Sterne mehr d.h. hier können die Verluste bei den Kultur pflanzen höher ausfallen. Eine Schwachstelle sind die Lager der einzelnen Sterne, deshalb hat er sein Gerät in Zusammenarbeit mit einer Werkstatt gegen Seitendruck stabilisiert. Die Firma Carre hat ebenfalls eine Sternrollhacke (Arbeitsbreiten von 3-10 m) im Angebot, die aus Elementen der Firma Yetter besteht. Eine Herausforderung für Reihenkulturen ist stets die Frage wie die Reihe selbst frei von Beikräutern gehalten werden kann. Die Firma Annaburger bietet dazu einen Turborollstriegel an, der in Kombination mit einem Hackgerät zwischen den Reihen Einsatz findet. Abb. 2: Der Turborollstriegel für Reihenkulturen kann in Kombination mit einem Hackgerät zwischen den Reihen eingesetzt werden 25
28 Abteilung 1 Beratung Jens Graf vom Hofgut Habitzheim hat die Ausführung mit Doppelelementen bei den Zuckerrüben getestet. Die kleineren Pflanzen d.h. bis ca. 5 cm hätten den Einsatz besser vertragen als die schon etwas größeren. Es gibt auch einzelne Elemente von Annaburger, die per Zahnkranz im Winkel verstellt werden können. Es scheint interessant zu sein, dieses Gerät in weiteren Kulturen zu testen. Abb. 3: Vier Kameras am Verschieberahmen der Fa. Reichardt nehmen die Pflanzenreihe ab Christoph Förster erläuterte einen kameragestützten Verschieberahmen, der von der Fa. Reichhardt gerade weiter entwickelt wird. Vier Kameras, die laut Förster relativ einfach einzustellen sind, nehmen die Pflanzenreihe ab. Ein Hydraulikzylinder verschiebt dann das Anbaugerät nach links oder rechts und führt es so in der gewünschten Position an den Reihen entlang. Voraussetzung ist eine ca. 5 bis 10 cm hohe Justiermöglichkeit. Dies könne die zu schützende Kulturpflanze oder auch eine entsprechend tiefe Furche in der Mitte der Reihenkultur sein. In Kombination mit GPS auf dem Schlepper sahen die Anwesenden darin eine vielversprechende Option für den Einsatz in Hackkulturen. Zu sehen war auch noch der Präzisionsgrubber der Fa. Treffler, der ebenfalls in einer Maschinengemeinschaft genutzt wird. Martin Trieschmann von der Naturland Fachberatung wies besonders auf die flächig schneidende Wirkung der Gänsefußschare hin. Für die Wurzelunkrautbekämpfung ist dieser exakte Schnitt ein Ansatz, um diese besondere Herausforderung im Griff zu halten. Der Aufbau dieses Grubbers ist auf diesen flächigen exakten Schnitt ausgerichtet und weniger auf das Wühlen bzw. Mischen im Boden. Die Nachlaufelemente sorgen dafür, dass die abgeschnittenen Wurzelreste an die Oberfläche gebracht werden. Das lebhafte Interesse sowohl von Acker- als auch Feldgemüsebauern an dieser Veranstaltung zeigt einmal mehr, dass es wichtig ist, die technischen Entwicklungen im Bereich der mechanischen Beikrautregulierung aufmerksam zu beobachten und derartige Geräte vorzustellen. 26
Strohmanagement und Bodenbearbeitung
 Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 22.10.2013 Fachvorträge und Technik-Demonstration Alsfeld Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von Mais
Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 22.10.2013 Fachvorträge und Technik-Demonstration Alsfeld Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von Mais
Beratungsangebot Lagercheck / Vorratsschutz
 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Fachtagung Getreide sicher lagern Beratungsangebot Lagercheck / Vorratsschutz Echzell, 19. März 2013 Karl-Heinrich Claus, LLH Petersberg Vorratsschutz ein Thema, zu
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Fachtagung Getreide sicher lagern Beratungsangebot Lagercheck / Vorratsschutz Echzell, 19. März 2013 Karl-Heinrich Claus, LLH Petersberg Vorratsschutz ein Thema, zu
Strohmanagement und Bodenbearbeitung
 Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 20. Oktober 2015 Fachvorträge und Technik-Demonstration Saerbeck Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von
Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 20. Oktober 2015 Fachvorträge und Technik-Demonstration Saerbeck Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von
Leit-Bild. Elbe-Werkstätten GmbH und. PIER Service & Consulting GmbH. Mit Menschen erfolgreich
 Leit-Bild Elbe-Werkstätten GmbH und PIER Service & Consulting GmbH Mit Menschen erfolgreich Vorwort zu dem Leit-Bild Was ist ein Leit-Bild? Ein Leit-Bild sind wichtige Regeln. Nach diesen Regeln arbeiten
Leit-Bild Elbe-Werkstätten GmbH und PIER Service & Consulting GmbH Mit Menschen erfolgreich Vorwort zu dem Leit-Bild Was ist ein Leit-Bild? Ein Leit-Bild sind wichtige Regeln. Nach diesen Regeln arbeiten
Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz
 Beitrag für Bibliothek aktuell Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz Von Sandra Merten Im Rahmen des Projekts Informationskompetenz wurde ein Musterkurs entwickelt, der den Lehrenden als
Beitrag für Bibliothek aktuell Die Lernumgebung des Projekts Informationskompetenz Von Sandra Merten Im Rahmen des Projekts Informationskompetenz wurde ein Musterkurs entwickelt, der den Lehrenden als
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache
 Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
Das Persönliche Budget in verständlicher Sprache Das Persönliche Budget mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstbewusstsein! Dieser Text soll den behinderten Menschen in Westfalen-Lippe,
Umfrage: Kreditzugang weiter schwierig BDS-Präsident Hieber: Kreditnot nicht verharmlosen
 Presseinformation 11.03.2010 Umfrage: Kreditzugang weiter schwierig BDS-Präsident Hieber: Kreditnot nicht verharmlosen Berlin. Die Finanz- und Wirtschaftkrise hat weiterhin deutliche Auswirkungen auf die
Presseinformation 11.03.2010 Umfrage: Kreditzugang weiter schwierig BDS-Präsident Hieber: Kreditnot nicht verharmlosen Berlin. Die Finanz- und Wirtschaftkrise hat weiterhin deutliche Auswirkungen auf die
Sächsischer Baustammtisch
 Sächsischer Baustammtisch Leipziger Straße 3 09599 Freiberg Tel.: 03731/215006 Fax: 03731/33027 Handy: 0172 3510310 Internet: www.saechsischer-baustammtisch.de Mail: info@saechsischer-baustammtisch.de
Sächsischer Baustammtisch Leipziger Straße 3 09599 Freiberg Tel.: 03731/215006 Fax: 03731/33027 Handy: 0172 3510310 Internet: www.saechsischer-baustammtisch.de Mail: info@saechsischer-baustammtisch.de
Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern
 Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen bereits die meisten Kinder. Wo und wann aber wächst welches Obst und Gemüse? Woher kommen die Früchte, die
Thema 1: Obst und Gemüse große Auswahl von nah und fern Obst und Gemüse sind gesund. Das wissen bereits die meisten Kinder. Wo und wann aber wächst welches Obst und Gemüse? Woher kommen die Früchte, die
40-Tage-Wunder- Kurs. Umarme, was Du nicht ändern kannst.
 40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
40-Tage-Wunder- Kurs Umarme, was Du nicht ändern kannst. Das sagt Wikipedia: Als Wunder (griechisch thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass
«PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.»
 «PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.» www.pse-solutions.ch ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 1 PROJECT SYSTEM ENGINEERING
«PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.» www.pse-solutions.ch ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 1 PROJECT SYSTEM ENGINEERING
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb
 6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
6 Schulungsmodul: Probenahme im Betrieb WIEDNER Wie schon im Kapitel VI erwähnt, ist die Probenahme in Betrieben, die Produkte nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch herstellen oder in den Verkehr
ZIELE erreichen WERTSTROM. IDEEN entwickeln. KULTUR leben. optimieren. KVP und Lean Management:
 KVP und Lean Management: Damit machen wir Ihre Prozesse robuster, schneller und kostengünstiger. ZIELE erreichen WERTSTROM optimieren IDEEN entwickeln KULTUR leben 1 Lean Management Teil 1: Das Geheimnis
KVP und Lean Management: Damit machen wir Ihre Prozesse robuster, schneller und kostengünstiger. ZIELE erreichen WERTSTROM optimieren IDEEN entwickeln KULTUR leben 1 Lean Management Teil 1: Das Geheimnis
PIERAU PLANUNG GESELLSCHAFT FÜR UNTERNEHMENSBERATUNG
 Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
Übersicht Wer ist? Was macht anders? Wir denken langfristig. Wir individualisieren. Wir sind unabhängig. Wir realisieren. Wir bieten Erfahrung. Für wen arbeitet? Pierau Planung ist eine Gesellschaft für
FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler?
 FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler? In der gedruckten Version der Spielregeln steht: der Startspieler ist der Spieler, dessen Arena unmittelbar links neben dem Kaiser steht [im Uhrzeigersinn].
FAQ Spielvorbereitung Startspieler: Wer ist Startspieler? In der gedruckten Version der Spielregeln steht: der Startspieler ist der Spieler, dessen Arena unmittelbar links neben dem Kaiser steht [im Uhrzeigersinn].
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich?
 Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Herzlich Willkommen beim Webinar: Was verkaufen wir eigentlich? Was verkaufen wir eigentlich? Provokativ gefragt! Ein Hotel Marketing Konzept Was ist das? Keine Webseite, kein SEO, kein Paket,. Was verkaufen
Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument
 Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument 1. Was nützt die Mitarbeiterbefragung? Eine Mitarbeiterbefragung hat den Sinn, die Sichtweisen der im Unternehmen tätigen Menschen zu erkennen und für die
Mitarbeiterbefragung als PE- und OE-Instrument 1. Was nützt die Mitarbeiterbefragung? Eine Mitarbeiterbefragung hat den Sinn, die Sichtweisen der im Unternehmen tätigen Menschen zu erkennen und für die
Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit
 Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit politische Lage verlassen sich auf Familie persönliche, finanzielle Lage meinen, sich Vorsorge leisten zu können meinen, sie seien zu alt nicht mit
Gründe für fehlende Vorsorgemaßnahmen gegen Krankheit politische Lage verlassen sich auf Familie persönliche, finanzielle Lage meinen, sich Vorsorge leisten zu können meinen, sie seien zu alt nicht mit
Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?
 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren
Fortbildung als effizientes Marketing-Instrument
 Für Kundenbindung und Markenpflege: Fortbildung als effizientes Marketing-Instrument Informationen zum AVA-Veranstaltungsservice für Industrieunternehmen Hoher Stellenwert im tierärztlichen Bereich Gerade
Für Kundenbindung und Markenpflege: Fortbildung als effizientes Marketing-Instrument Informationen zum AVA-Veranstaltungsservice für Industrieunternehmen Hoher Stellenwert im tierärztlichen Bereich Gerade
Urlaubsregel in David
 Urlaubsregel in David Inhaltsverzeichnis KlickDown Beitrag von Tobit...3 Präambel...3 Benachrichtigung externer Absender...3 Erstellen oder Anpassen des Anworttextes...3 Erstellen oder Anpassen der Auto-Reply-Regel...5
Urlaubsregel in David Inhaltsverzeichnis KlickDown Beitrag von Tobit...3 Präambel...3 Benachrichtigung externer Absender...3 Erstellen oder Anpassen des Anworttextes...3 Erstellen oder Anpassen der Auto-Reply-Regel...5
Projektmanagement in der Spieleentwicklung
 Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Projektmanagement in der Spieleentwicklung Inhalt 1. Warum brauche ich ein Projekt-Management? 2. Die Charaktere des Projektmanagement - Mastermind - Producer - Projektleiter 3. Schnittstellen definieren
Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite:
 Anmeldung und Zugang zum Webinar Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite: Dort finden Sie die Ankündigung unserer Webinare: Wenn Sie auf den Eintrag zum gewünschten
Anmeldung und Zugang zum Webinar Über den Link https://www.edudip.com/academy/dbv erreichen Sie unsere Einstiegsseite: Dort finden Sie die Ankündigung unserer Webinare: Wenn Sie auf den Eintrag zum gewünschten
1. Fabrikatshändlerkongress. Schlussworte Robert Rademacher
 Robert Rademacher Präsident Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe - Zentralverband - 1. Fabrikatshändlerkongress Schlussworte Robert Rademacher 24. Oktober 2008 Frankfurt Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr
Robert Rademacher Präsident Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe - Zentralverband - 1. Fabrikatshändlerkongress Schlussworte Robert Rademacher 24. Oktober 2008 Frankfurt Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr
NACHHALTIGKEIT ANERKENNUNG DER ARBEIT - TIERWOHL GESUNDE LEBENSMITTEL
 NACHHALTIGKEIT ANERKENNUNG DER ARBEIT - TIERWOHL GESUNDE LEBENSMITTEL Sehr geehrte Damen und Herren, die Landwirtschaft gehört zu Schleswig-Holstein. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte mit ihren
NACHHALTIGKEIT ANERKENNUNG DER ARBEIT - TIERWOHL GESUNDE LEBENSMITTEL Sehr geehrte Damen und Herren, die Landwirtschaft gehört zu Schleswig-Holstein. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte mit ihren
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl
 Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon
Neu in Führung. Die k.brio Coaching-Begleitung für Führungskräfte und ihre Teams. k.brio coaching GbR. Grobkonzept. offen gesagt: gut beraten.
 k.brio coaching GbR Neu in Führung Die k.brio Coaching-Begleitung für Führungskräfte und ihre Teams Grobkonzept nif_gk_v10_neu in Führung_Coaching-Begleitung Ihre Chance für den perfekten Aufschlag! Wenn
k.brio coaching GbR Neu in Führung Die k.brio Coaching-Begleitung für Führungskräfte und ihre Teams Grobkonzept nif_gk_v10_neu in Führung_Coaching-Begleitung Ihre Chance für den perfekten Aufschlag! Wenn
Strohmanagement und Bodenbearbeitung
 Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 23. Oktober 2012 Fachvorträge und Technik-Demonstration Ergolding Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von
Strohmanagement und Bodenbearbeitung nach Mais 23. Oktober 2012 Fachvorträge und Technik-Demonstration Ergolding Maisstoppeln und Maisstroh zerkleinern und in den Boden einmischen aber wie? Der Anbau von
1. Management Summary. 2. Grundlagen ERP. 3. ERP für die Produktion. 4. ERP für den Handel. 5. EPR für Dienstleistung. 6.
 Inhalt Erfolg für Ihr Projekt 1. Management Summary 2. Grundlagen ERP 3. ERP für die Produktion 4. ERP für den Handel 5. EPR für Dienstleistung 6. Einzelne Module 7. Blick auf Markt und Technologien 8.
Inhalt Erfolg für Ihr Projekt 1. Management Summary 2. Grundlagen ERP 3. ERP für die Produktion 4. ERP für den Handel 5. EPR für Dienstleistung 6. Einzelne Module 7. Blick auf Markt und Technologien 8.
Zur Teilnahme am Webinar bitten wir Sie, sich auf der Lernplattform der Firma edudip zu registrieren.
 Informationen zur Anmeldung auf der Lernplattform der Firma edudip Zur Teilnahme am Webinar bitten wir Sie, sich auf der Lernplattform der Firma edudip zu registrieren. Was ist ein Webinar? Ein Webinar
Informationen zur Anmeldung auf der Lernplattform der Firma edudip Zur Teilnahme am Webinar bitten wir Sie, sich auf der Lernplattform der Firma edudip zu registrieren. Was ist ein Webinar? Ein Webinar
Erstellung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes. für die Samtgemeinde Sottrum
 Erstellung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Samtgemeinde Sottrum Das Protokoll zur Auftaktveranstaltung am 06. Mai 2015 Tag, Zeit: Ort: 06.05.2015, 19:00 bis 21:00 Uhr Sitzungssaal
Erstellung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Samtgemeinde Sottrum Das Protokoll zur Auftaktveranstaltung am 06. Mai 2015 Tag, Zeit: Ort: 06.05.2015, 19:00 bis 21:00 Uhr Sitzungssaal
Teil I Buchhaltung. 1 Bestandskonten. 6 Bilanzen
 6 Bilanzen Teil I Buchhaltung In dem ersten Teil Buchhaltung soll lediglich ein generelles Verständnis für die Art zu buchen, also für Buchungssätze, geschaffen werden. Wir wollen hier keinen großen Überblick
6 Bilanzen Teil I Buchhaltung In dem ersten Teil Buchhaltung soll lediglich ein generelles Verständnis für die Art zu buchen, also für Buchungssätze, geschaffen werden. Wir wollen hier keinen großen Überblick
Wie wird ein Jahreswechsel (vorläufig und endgültig) ausgeführt?
 Wie wird ein (vorläufig und endgültig) ausgeführt? VORLÄUFIGER JAHRESWECHSEL Führen Sie unbedingt vor dem eine aktuelle Datensicherung durch. Einleitung Ein vorläufiger Jahresabschluss wird durchgeführt,
Wie wird ein (vorläufig und endgültig) ausgeführt? VORLÄUFIGER JAHRESWECHSEL Führen Sie unbedingt vor dem eine aktuelle Datensicherung durch. Einleitung Ein vorläufiger Jahresabschluss wird durchgeführt,
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT
 DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
DER SELBST-CHECK FÜR IHR PROJEKT In 30 Fragen und 5 Tipps zum erfolgreichen Projekt! Beantworten Sie die wichtigsten Fragen rund um Ihr Projekt für Ihren Erfolg und für Ihre Unterstützer. IHR LEITFADEN
Letzte Krankenkassen streichen Zusatzbeiträge
 Zusatzbeiträge - Gesundheitsfonds Foto: D. Claus Einige n verlangten 2010 Zusatzbeiträge von ihren Versicherten. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011 ermöglichte den n die Rücknahme der
Zusatzbeiträge - Gesundheitsfonds Foto: D. Claus Einige n verlangten 2010 Zusatzbeiträge von ihren Versicherten. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011 ermöglichte den n die Rücknahme der
Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert?
 Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Unternehmenssteuerung auf dem Prüfstand Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert? Performance durch strategiekonforme und wirksame Controllingkommunikation steigern INHALT Editorial Seite 3 Wurden
Fragen und Antworten zum Thema. Lieferanspruch
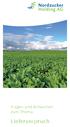 Fragen und Antworten zum Thema Lieferanspruch Was ist der Lieferanspruch und warum tritt er in Kraft? Der Lieferanspruch ist in den Satzungen der Nordzucker Holding AG und der Union-Zucker Südhannover
Fragen und Antworten zum Thema Lieferanspruch Was ist der Lieferanspruch und warum tritt er in Kraft? Der Lieferanspruch ist in den Satzungen der Nordzucker Holding AG und der Union-Zucker Südhannover
Gentechnisch verändert?
 Gentechnisch verändert? So wird gekennzeichnet! VERBRAUCHERSCHUTZ ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT Gentechnik in Lebensmitteln gibt es das schon? In Europa und Deutschland wurden bislang kaum gentechnisch veränderte
Gentechnisch verändert? So wird gekennzeichnet! VERBRAUCHERSCHUTZ ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT Gentechnik in Lebensmitteln gibt es das schon? In Europa und Deutschland wurden bislang kaum gentechnisch veränderte
Leseauszug DGQ-Band 14-26
 Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Leseauszug DGQ-Band 14-26 Einleitung Dieser Band liefert einen Ansatz zur Einführung von Prozessmanagement in kleinen und mittleren Organisationen (KMO) 1. Die Erfolgskriterien für eine Einführung werden
Anwendungsbeispiele. Neuerungen in den E-Mails. Webling ist ein Produkt der Firma:
 Anwendungsbeispiele Neuerungen in den E-Mails Webling ist ein Produkt der Firma: Inhaltsverzeichnis 1 Neuerungen in den E- Mails 2 Was gibt es neues? 3 E- Mail Designs 4 Bilder in E- Mails einfügen 1 Neuerungen
Anwendungsbeispiele Neuerungen in den E-Mails Webling ist ein Produkt der Firma: Inhaltsverzeichnis 1 Neuerungen in den E- Mails 2 Was gibt es neues? 3 E- Mail Designs 4 Bilder in E- Mails einfügen 1 Neuerungen
Neuer Rahmen für die Unternehmensführung Welche Strategie soll es zukünftig sein? Franz Hunger Abteilung Bildung und Beratung
 Neuer Rahmen für die Unternehmensführung Welche Strategie soll es zukünftig sein? Franz Hunger Abteilung Bildung und Beratung Überblick Was ist eine Strategie? Was beeinflusst die Strategie? Entwicklungen
Neuer Rahmen für die Unternehmensführung Welche Strategie soll es zukünftig sein? Franz Hunger Abteilung Bildung und Beratung Überblick Was ist eine Strategie? Was beeinflusst die Strategie? Entwicklungen
ConTraX Real Estate. Büromarkt in Deutschland 2005 / Office Market Report
 ConTraX Real Estate Büromarkt in Deutschland 2005 / Office Market Report Der deutsche Büromarkt ist in 2005 wieder gestiegen. Mit einer Steigerung von 10,6 % gegenüber 2004 wurde das beste Ergebnis seit
ConTraX Real Estate Büromarkt in Deutschland 2005 / Office Market Report Der deutsche Büromarkt ist in 2005 wieder gestiegen. Mit einer Steigerung von 10,6 % gegenüber 2004 wurde das beste Ergebnis seit
infach Geld FBV Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Florian Mock
 infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
infach Ihr Weg zum finanzellen Erfolg Geld Florian Mock FBV Die Grundlagen für finanziellen Erfolg Denn Sie müssten anschließend wieder vom Gehaltskonto Rückzahlungen in Höhe der Entnahmen vornehmen, um
Kostenstellen verwalten. Tipps & Tricks
 Tipps & Tricks INHALT SEITE 1.1 Kostenstellen erstellen 3 13 1.3 Zugriffsberechtigungen überprüfen 30 2 1.1 Kostenstellen erstellen Mein Profil 3 1.1 Kostenstellen erstellen Kostenstelle(n) verwalten 4
Tipps & Tricks INHALT SEITE 1.1 Kostenstellen erstellen 3 13 1.3 Zugriffsberechtigungen überprüfen 30 2 1.1 Kostenstellen erstellen Mein Profil 3 1.1 Kostenstellen erstellen Kostenstelle(n) verwalten 4
Ihren Kundendienst effektiver machen
 Ihren Kundendienst effektiver machen Wenn Sie einen neuen Kundendienstauftrag per Handy an Ihrem Monteur senden mag das ja funktionieren, aber hat Ihr Kunde nicht schon darüber gemeckert? Muss der Kunde
Ihren Kundendienst effektiver machen Wenn Sie einen neuen Kundendienstauftrag per Handy an Ihrem Monteur senden mag das ja funktionieren, aber hat Ihr Kunde nicht schon darüber gemeckert? Muss der Kunde
Kreditversorgung der Hamburger Wirtschaft
 Ergebnisse einer Sonderbefragung im Rahmen des Hamburger Konjunkturbarometers Herbst 2009 Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft hellt sich weiter auf das ist das Ergebnis des Konjunkturbarometers unserer
Ergebnisse einer Sonderbefragung im Rahmen des Hamburger Konjunkturbarometers Herbst 2009 Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft hellt sich weiter auf das ist das Ergebnis des Konjunkturbarometers unserer
D i e n s t v e r e i n b a r u n g über die Durchführung von Mitarbeiter/innen- Gesprächen
 D i e n s t v e r e i n b a r u n g über die Durchführung von Mitarbeiter/innen- Gesprächen Vom 02.02.2011 Magistrat der Stadt Bremerhaven Personalamt 11/4 Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven E-Mail:
D i e n s t v e r e i n b a r u n g über die Durchführung von Mitarbeiter/innen- Gesprächen Vom 02.02.2011 Magistrat der Stadt Bremerhaven Personalamt 11/4 Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven E-Mail:
Die neue Aufgabe von der Monitoring-Stelle. Das ist die Monitoring-Stelle:
 Die neue Aufgabe von der Monitoring-Stelle Das ist die Monitoring-Stelle: Am Deutschen Institut für Menschen-Rechte in Berlin gibt es ein besonderes Büro. Dieses Büro heißt Monitoring-Stelle. Mo-ni-to-ring
Die neue Aufgabe von der Monitoring-Stelle Das ist die Monitoring-Stelle: Am Deutschen Institut für Menschen-Rechte in Berlin gibt es ein besonderes Büro. Dieses Büro heißt Monitoring-Stelle. Mo-ni-to-ring
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen. Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung. Wir machen aus Zahlen Werte
 Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung Wir machen aus Zahlen Werte Ihre Fragen Ich schwimme irgendwie in meinen Finanzen, ich weiß nicht so genau wo ich stehe
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Vermögensplanung Wir machen aus Zahlen Werte Ihre Fragen Ich schwimme irgendwie in meinen Finanzen, ich weiß nicht so genau wo ich stehe
Psychosoziale Gesundheit. Schulentwicklung. Suchtprävention. Bewegung. Ernährung
 wgkk.at Schulentwicklung Bewegung Psychosoziale Gesundheit Suchtprävention Ernährung Qualitätsgesicherte Angebote in der schulischen Gesundheitsförderung für alle Wiener Schulen Impressum Herausgeber und
wgkk.at Schulentwicklung Bewegung Psychosoziale Gesundheit Suchtprävention Ernährung Qualitätsgesicherte Angebote in der schulischen Gesundheitsförderung für alle Wiener Schulen Impressum Herausgeber und
Das Leitbild vom Verein WIR
 Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich
Sicher durch das Studium. Unsere Angebote für Studenten
 Sicher durch das Studium Unsere Angebote für Studenten Starke Leistungen AUSGEZEICHNET! FOCUS-MONEY Im Vergleich von 95 gesetzlichen Krankenkassen wurde die TK zum achten Mal in Folge Gesamtsieger. Einen
Sicher durch das Studium Unsere Angebote für Studenten Starke Leistungen AUSGEZEICHNET! FOCUS-MONEY Im Vergleich von 95 gesetzlichen Krankenkassen wurde die TK zum achten Mal in Folge Gesamtsieger. Einen
Führung und Gesundheit. Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können
 Führung und Gesundheit Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können Was ist gesundheitsförderliche Führung? Haben denn Führung und Gesundheit der Mitarbeiter etwas miteinander zu tun?
Führung und Gesundheit Wie Führungskräfte die Gesundheit der Mitarbeiter fördern können Was ist gesundheitsförderliche Führung? Haben denn Führung und Gesundheit der Mitarbeiter etwas miteinander zu tun?
Leichte-Sprache-Bilder
 Leichte-Sprache-Bilder Reinhild Kassing Information - So geht es 1. Bilder gucken 2. anmelden für Probe-Bilder 3. Bilder bestellen 4. Rechnung bezahlen 5. Bilder runterladen 6. neue Bilder vorschlagen
Leichte-Sprache-Bilder Reinhild Kassing Information - So geht es 1. Bilder gucken 2. anmelden für Probe-Bilder 3. Bilder bestellen 4. Rechnung bezahlen 5. Bilder runterladen 6. neue Bilder vorschlagen
Der Wunschkunden- Test
 Der Wunschkunden- Test Firma Frau/Herr Branche Datum Uhrzeit Ich plane mich im Bereich Controlling selbständig zu machen. Um zu erfahren, ob ich mit meinem Angebot richtig liege, würde ich Ihnen gerne
Der Wunschkunden- Test Firma Frau/Herr Branche Datum Uhrzeit Ich plane mich im Bereich Controlling selbständig zu machen. Um zu erfahren, ob ich mit meinem Angebot richtig liege, würde ich Ihnen gerne
How to do? Projekte - Zeiterfassung
 How to do? Projekte - Zeiterfassung Stand: Version 4.0.1, 18.03.2009 1. EINLEITUNG...3 2. PROJEKTE UND STAMMDATEN...4 2.1 Projekte... 4 2.2 Projektmitarbeiter... 5 2.3 Tätigkeiten... 6 2.4 Unterprojekte...
How to do? Projekte - Zeiterfassung Stand: Version 4.0.1, 18.03.2009 1. EINLEITUNG...3 2. PROJEKTE UND STAMMDATEN...4 2.1 Projekte... 4 2.2 Projektmitarbeiter... 5 2.3 Tätigkeiten... 6 2.4 Unterprojekte...
Berufsunfähigkeit? Da bin ich finanziell im Trockenen.
 Berufsunfähigkeit? Da bin ich finanziell im Trockenen. Unsere EinkommensSicherung schützt während des gesamten Berufslebens und passt sich an neue Lebenssituationen an. Meine Arbeitskraft für ein finanziell
Berufsunfähigkeit? Da bin ich finanziell im Trockenen. Unsere EinkommensSicherung schützt während des gesamten Berufslebens und passt sich an neue Lebenssituationen an. Meine Arbeitskraft für ein finanziell
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden,
 Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
Bei der Tagung werden die Aspekte der DLRL aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Ich habe mich für die Betrachtung der Chancen entschieden, weil dieser Aspekt bei der Diskussion der Probleme meist
GPP Projekte gemeinsam zum Erfolg führen
 GPP Projekte gemeinsam zum Erfolg führen IT-Sicherheit Schaffen Sie dauerhaft wirksame IT-Sicherheit nach zivilen oder militärischen Standards wie der ISO 27001, dem BSI Grundschutz oder der ZDv 54/100.
GPP Projekte gemeinsam zum Erfolg führen IT-Sicherheit Schaffen Sie dauerhaft wirksame IT-Sicherheit nach zivilen oder militärischen Standards wie der ISO 27001, dem BSI Grundschutz oder der ZDv 54/100.
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken
 Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
Handbuch ECDL 2003 Basic Modul 5: Datenbank Grundlagen von relationalen Datenbanken Dateiname: ecdl5_01_00_documentation_standard.doc Speicherdatum: 14.02.2005 ECDL 2003 Basic Modul 5 Datenbank - Grundlagen
Und im Bereich Lernschwächen kommen sie, wenn sie merken, das Kind hat Probleme beim Rechnen oder Lesen und Schreiben.
 5.e. PDF zur Hördatei und Herr Kennedy zum Thema: Unsere Erfahrungen in der Kennedy-Schule Teil 2 Herr Kennedy, Sie haben eine Nachhilfeschule in der schwerpunktmäßig an Lernschwächen wie Lese-Rechtschreibschwäche,
5.e. PDF zur Hördatei und Herr Kennedy zum Thema: Unsere Erfahrungen in der Kennedy-Schule Teil 2 Herr Kennedy, Sie haben eine Nachhilfeschule in der schwerpunktmäßig an Lernschwächen wie Lese-Rechtschreibschwäche,
Welchen Nutzen haben Risikoanalysen für Privatanleger?
 Welchen Nutzen haben Risikoanalysen für Privatanleger? Beispiel: Sie sind im Sommer 2007 Erbe deutscher Aktien mit einem Depotwert von z. B. 1 Mio. geworden. Diese Aktien lassen Sie passiv im Depot liegen,
Welchen Nutzen haben Risikoanalysen für Privatanleger? Beispiel: Sie sind im Sommer 2007 Erbe deutscher Aktien mit einem Depotwert von z. B. 1 Mio. geworden. Diese Aktien lassen Sie passiv im Depot liegen,
Ehrenamtliche weiterbilden, beraten, informieren
 Ehrenamtliche weiterbilden, beraten, informieren Inhaltsverzeichnis Regionalentwicklung und 16 Zukunftsprojekte 3 Weiterbildung worum geht es? 4 Ein konkretes Beispiel 5 Seminar Freiwilligenmanagement
Ehrenamtliche weiterbilden, beraten, informieren Inhaltsverzeichnis Regionalentwicklung und 16 Zukunftsprojekte 3 Weiterbildung worum geht es? 4 Ein konkretes Beispiel 5 Seminar Freiwilligenmanagement
Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes
 Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes Was ist ein Umwandlungssatz? Die PKE führt für jede versicherte Person ein individuelles Konto. Diesem werden die Beiträge, allfällige Einlagen
Senkung des technischen Zinssatzes und des Umwandlungssatzes Was ist ein Umwandlungssatz? Die PKE führt für jede versicherte Person ein individuelles Konto. Diesem werden die Beiträge, allfällige Einlagen
Einrichten einer Festplatte mit FDISK unter Windows 95/98/98SE/Me
 Einrichten einer Festplatte mit FDISK unter Windows 95/98/98SE/Me Bevor Sie die Platte zum ersten Mal benutzen können, muss sie noch partitioniert und formatiert werden! Vorher zeigt sich die Festplatte
Einrichten einer Festplatte mit FDISK unter Windows 95/98/98SE/Me Bevor Sie die Platte zum ersten Mal benutzen können, muss sie noch partitioniert und formatiert werden! Vorher zeigt sich die Festplatte
Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen
 Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen Die EU und die einzelnen Mitglieds-Staaten bezahlen viel für die Unterstützung von ärmeren Ländern. Sie bezahlen mehr als die Hälfte des Geldes, das alle
Gemeinsam können die Länder der EU mehr erreichen Die EU und die einzelnen Mitglieds-Staaten bezahlen viel für die Unterstützung von ärmeren Ländern. Sie bezahlen mehr als die Hälfte des Geldes, das alle
Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Mitarbeiter/innen
 UNIVERSITÄT HOHENHEIM DER KANZLER Miteinander Aktiv - Gestalten Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Mitarbeiter/innen Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden in nächster Zeit mit Ihrem
UNIVERSITÄT HOHENHEIM DER KANZLER Miteinander Aktiv - Gestalten Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräch (MAG) für Mitarbeiter/innen Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden in nächster Zeit mit Ihrem
Ihre Protein Analyse
 Ihre Protein Analyse Patient Max Dusan Mustermann Sladek... geboren am 17.10.1986... Gewicht 83 kg... Probennummer P07245... Probenmaterial Plasma... Eingang 18.6.2014... Ausgang 7.7.2014 Sehr geehrter
Ihre Protein Analyse Patient Max Dusan Mustermann Sladek... geboren am 17.10.1986... Gewicht 83 kg... Probennummer P07245... Probenmaterial Plasma... Eingang 18.6.2014... Ausgang 7.7.2014 Sehr geehrter
Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität.
 Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Verantwortung statt Versprechen: Qualität permanent neu erarbeiten. Geyer & Weinig ist der erfahrene Spezialist für Service Level Management.
Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Verantwortung statt Versprechen: Qualität permanent neu erarbeiten. Geyer & Weinig ist der erfahrene Spezialist für Service Level Management.
Projektmanagement. Einleitung. Beginn. Was ist Projektmanagement? In dieser Dokumentation erfahren Sie Folgendes:
 Projektmanagement Link http://promana.edulearning.at/projektleitung.html Einleitung Was ist Projektmanagement? In dieser Dokumentation erfahren Sie Folgendes: Definition des Begriffs Projekt" Kriterien
Projektmanagement Link http://promana.edulearning.at/projektleitung.html Einleitung Was ist Projektmanagement? In dieser Dokumentation erfahren Sie Folgendes: Definition des Begriffs Projekt" Kriterien
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern
 Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November
Onlineredaktionssystem für das Mitteilungsblatt Betzdorf Kurzanleitung zum Einstellen von Berichten sowie das Hochladen von Fotos und Plakaten
 Onlineredaktionssystem für das Mitteilungsblatt Betzdorf Kurzanleitung zum Einstellen von Berichten sowie das Hochladen von Fotos und Plakaten Einloggen ins System: Entweder über www.cms.wittich.de oder
Onlineredaktionssystem für das Mitteilungsblatt Betzdorf Kurzanleitung zum Einstellen von Berichten sowie das Hochladen von Fotos und Plakaten Einloggen ins System: Entweder über www.cms.wittich.de oder
Studieren- Erklärungen und Tipps
 Studieren- Erklärungen und Tipps Es gibt Berufe, die man nicht lernen kann, sondern für die man ein Studium machen muss. Das ist zum Beispiel so wenn man Arzt oder Lehrer werden möchte. Hat ihr Kind das
Studieren- Erklärungen und Tipps Es gibt Berufe, die man nicht lernen kann, sondern für die man ein Studium machen muss. Das ist zum Beispiel so wenn man Arzt oder Lehrer werden möchte. Hat ihr Kind das
Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung
 DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
DR. BETTINA DILCHER Management Consultants Network Die 7 wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Zielvereinbarungen und deren Ergebnissicherung Leonhardtstr. 7, 14057 Berlin, USt.-ID: DE 225920389
Finanzierung: Übungsserie III Innenfinanzierung
 Thema Dokumentart Finanzierung: Übungsserie III Innenfinanzierung Lösungen Theorie im Buch "Integrale Betriebswirtschaftslehre" Teil: Kapitel: D1 Finanzmanagement 2.3 Innenfinanzierung Finanzierung: Übungsserie
Thema Dokumentart Finanzierung: Übungsserie III Innenfinanzierung Lösungen Theorie im Buch "Integrale Betriebswirtschaftslehre" Teil: Kapitel: D1 Finanzmanagement 2.3 Innenfinanzierung Finanzierung: Übungsserie
Eigenen Farbverlauf erstellen
 Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Diese Serie ist an totale Neulinge gerichtet. Neu bei PhotoLine, evtl. sogar komplett neu, was Bildbearbeitung betrifft. So versuche ich, hier alles einfach zu halten. Ich habe sogar PhotoLine ein zweites
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung
 Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also
Synthax OnlineShop. Inhalt. 1 Einleitung 3. 2 Welche Vorteile bietet der OnlineShop 4
 Inhalt 1 Einleitung 3 2 Welche Vorteile bietet der OnlineShop 4 3 Die Registrierung (Neukunden) 5 3.1 Privatkunden... 6 3.2 Firmenkunden... 7 4 Die Anmeldung (Bestandskunden) 8 5 Bestellvorgang 10 5.1
Inhalt 1 Einleitung 3 2 Welche Vorteile bietet der OnlineShop 4 3 Die Registrierung (Neukunden) 5 3.1 Privatkunden... 6 3.2 Firmenkunden... 7 4 Die Anmeldung (Bestandskunden) 8 5 Bestellvorgang 10 5.1
Begeisterung und Leidenschaft im Vertrieb machen erfolgreich. Kurzdarstellung des Dienstleistungsangebots
 Begeisterung und Leidenschaft im Vertrieb machen erfolgreich Kurzdarstellung des Dienstleistungsangebots Überzeugung Ulrich Vieweg Verkaufs- & Erfolgstraining hat sich seit Jahren am Markt etabliert und
Begeisterung und Leidenschaft im Vertrieb machen erfolgreich Kurzdarstellung des Dienstleistungsangebots Überzeugung Ulrich Vieweg Verkaufs- & Erfolgstraining hat sich seit Jahren am Markt etabliert und
Moodle-Kurzübersicht Kurse Sichern und Zurücksetzen
 Moodle-Kurzübersicht Kurse Sichern und Zurücksetzen elearning.hs-lausitz.de Inhaltsverzeichnis: 1. Kurse Zurücksetzen 2. Kurse Sichern 3. Kurse Wiederherstellen Weitere Hilfe finden Sie unter www.hs-lausitz.de/studium/elearning.html
Moodle-Kurzübersicht Kurse Sichern und Zurücksetzen elearning.hs-lausitz.de Inhaltsverzeichnis: 1. Kurse Zurücksetzen 2. Kurse Sichern 3. Kurse Wiederherstellen Weitere Hilfe finden Sie unter www.hs-lausitz.de/studium/elearning.html
a) Bis zu welchem Datum müssen sie spätestens ihre jetzigen Wohnungen gekündigt haben, wenn sie selber keine Nachmieter suchen wollen?
 Thema Wohnen 1. Ben und Jennifer sind seit einiger Zeit ein Paar und beschliessen deshalb, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. Sie haben Glück und finden eine geeignete Dreizimmer-Wohnung auf den 1.Oktober
Thema Wohnen 1. Ben und Jennifer sind seit einiger Zeit ein Paar und beschliessen deshalb, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. Sie haben Glück und finden eine geeignete Dreizimmer-Wohnung auf den 1.Oktober
Es gilt das gesprochene Wort. Anrede
 Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs
Schnellstart - Checkliste
 Schnellstart - Checkliste http://www.ollis-tipps.de/schnellstart-in-7-schritten/ Copyright Olaf Ebers / http://www.ollis-tipps.de/ - Alle Rechte vorbehalten - weltweit Seite 1 von 6 Einleitung Mein Name
Schnellstart - Checkliste http://www.ollis-tipps.de/schnellstart-in-7-schritten/ Copyright Olaf Ebers / http://www.ollis-tipps.de/ - Alle Rechte vorbehalten - weltweit Seite 1 von 6 Einleitung Mein Name
Personal der Frankfurter Pflegeeinrichtungen 2005
 290 Personal der Frankfurter Pflegeeinrichtungen Petra Meister Personal der Frankfurter Pflegedienste Anteil der Teilzeitbeschäftigten lag deutlich über 50 % Ende des Jahres gab es 117 Pflegedienste in
290 Personal der Frankfurter Pflegeeinrichtungen Petra Meister Personal der Frankfurter Pflegedienste Anteil der Teilzeitbeschäftigten lag deutlich über 50 % Ende des Jahres gab es 117 Pflegedienste in
Vermögen sichern - Finanzierung optimieren
 I. Vermögen sichern - Finanzierung optimieren Persönlicher und beruflicher Hintergrund: geboren 1951 Bauernsohn landwirtschaftliche Lehre Landwirtschaftsschule ab 1974 Umschulung zum Bankkaufmann ab 1982
I. Vermögen sichern - Finanzierung optimieren Persönlicher und beruflicher Hintergrund: geboren 1951 Bauernsohn landwirtschaftliche Lehre Landwirtschaftsschule ab 1974 Umschulung zum Bankkaufmann ab 1982
Qualitätsbereich. Mahlzeiten und Essen
 Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Qualitätsbereich Mahlzeiten und Essen 1. Voraussetzungen in unserer Einrichtung Räumliche Bedingungen / Innenbereich Für die Kinder stehen in jeder Gruppe und in der Küche der Körpergröße entsprechende
Die ABL Montag, 3. August 2009 Letzte Aktualisierung Mittwoch, 27. Juli 2011
 Die ABL Montag, 3. August 2009 Letzte Aktualisierung Mittwoch, 27. Juli 2011 Landesverband Rheinland-Pfalz - Saarland Bäuerliche Interessen vertreten! Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
Die ABL Montag, 3. August 2009 Letzte Aktualisierung Mittwoch, 27. Juli 2011 Landesverband Rheinland-Pfalz - Saarland Bäuerliche Interessen vertreten! Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen
 geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
geben. Die Wahrscheinlichkeit von 100% ist hier demnach nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Gehen wir einmal davon aus, dass die von uns angenommenen 70% im Beispiel exakt berechnet sind. Was würde
Azubi Plus. projekt zukunft. Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit...
 Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit... Das unglaubliche Zusatz-Training zur Ausbildung: Sie werden Ihre Azubis nicht wieder erkennen! PERSONALENTWICKLUNG Personalentwicklung
Gestalten Sie Ihre Ausbildungen attraktiver, interessanter und wirkungsvoller mit... Das unglaubliche Zusatz-Training zur Ausbildung: Sie werden Ihre Azubis nicht wieder erkennen! PERSONALENTWICKLUNG Personalentwicklung
Dokumentation der Veranstaltung: Perspektiven der energetischen Biomassenutzung: Chancen, Risiken und Konkurrenzen
 Seite 1 von 5 Dokumentation der Veranstaltung: Perspektiven der energetischen Biomassenutzung: Chancen, Risiken und Konkurrenzen Datum: 21.03.2007 Ort: Kieler Innovations- und Technologiezentrum Veranstalter:
Seite 1 von 5 Dokumentation der Veranstaltung: Perspektiven der energetischen Biomassenutzung: Chancen, Risiken und Konkurrenzen Datum: 21.03.2007 Ort: Kieler Innovations- und Technologiezentrum Veranstalter:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Übungsbuch für den Grundkurs mit Tipps und Lösungen: Analysis Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de
Agile Enterprise Development. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
 Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Agile Enterprise Development Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? Steigern Sie noch immer die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens alleine durch Kostensenkung? Im Projektportfolio steckt das Potenzial
Diese Ansicht erhalten Sie nach der erfolgreichen Anmeldung bei Wordpress.
 Anmeldung http://www.ihredomain.de/wp-admin Dashboard Diese Ansicht erhalten Sie nach der erfolgreichen Anmeldung bei Wordpress. Das Dashboard gibt Ihnen eine kurze Übersicht, z.b. Anzahl der Beiträge,
Anmeldung http://www.ihredomain.de/wp-admin Dashboard Diese Ansicht erhalten Sie nach der erfolgreichen Anmeldung bei Wordpress. Das Dashboard gibt Ihnen eine kurze Übersicht, z.b. Anzahl der Beiträge,
Perspektivenpapier Neue MedieN für innovative der Wert gemeinsamen HaNdelNs formate NutzeN WisseNscHaft im ÖffeNtlicHeN raum
 Perspektivenpapier Wissenschaft im Öffentlichen Raum Zwischenbilanz und Perspektiven für das nächste Jahrzehnt November 2009 Wissenschaft im Öffentlichen Raum Zwischenbilanz und Perspektiven für das nächste
Perspektivenpapier Wissenschaft im Öffentlichen Raum Zwischenbilanz und Perspektiven für das nächste Jahrzehnt November 2009 Wissenschaft im Öffentlichen Raum Zwischenbilanz und Perspektiven für das nächste
2 Terme 2.1 Einführung
 2 Terme 2.1 Einführung In der Fahrschule lernt man zur Berechnung des Bremsweges (in m) folgende Faustregel: Dividiere die Geschwindigkeit (in km h ) durch 10 und multipliziere das Ergebnis mit sich selbst.
2 Terme 2.1 Einführung In der Fahrschule lernt man zur Berechnung des Bremsweges (in m) folgende Faustregel: Dividiere die Geschwindigkeit (in km h ) durch 10 und multipliziere das Ergebnis mit sich selbst.
Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems
 Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems Name: Bruno Handler Funktion: Marketing/Vertrieb Organisation: AXAVIA Software GmbH Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Fehler und Probleme bei Auswahl und Installation eines Dokumentenmanagement Systems Name: Bruno Handler Funktion: Marketing/Vertrieb Organisation: AXAVIA Software GmbH Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Erklärung zum Internet-Bestellschein
 Erklärung zum Internet-Bestellschein Herzlich Willkommen bei Modellbahnbau Reinhardt. Auf den nächsten Seiten wird Ihnen mit hilfreichen Bildern erklärt, wie Sie den Internet-Bestellschein ausfüllen und
Erklärung zum Internet-Bestellschein Herzlich Willkommen bei Modellbahnbau Reinhardt. Auf den nächsten Seiten wird Ihnen mit hilfreichen Bildern erklärt, wie Sie den Internet-Bestellschein ausfüllen und
Befragt wurden 4.003 Personen zwischen 14 und 75 Jahren von August bis September 2013. Einstellung zur Organ- und Gewebespende (Passive Akzeptanz)
 Wissen, Einstellung und Verhalten der deutschen Allgemeinbevölkerung (1 bis Jahre) zur Organspende Bundesweite Repräsentativbefragung 201 - Erste Studienergebnisse Befragt wurden.00 Personen zwischen 1
Wissen, Einstellung und Verhalten der deutschen Allgemeinbevölkerung (1 bis Jahre) zur Organspende Bundesweite Repräsentativbefragung 201 - Erste Studienergebnisse Befragt wurden.00 Personen zwischen 1
Chancen und Potenziale von Cloud Computing Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Rede Hans-Joachim Otto Parlamentarischer Staatssekretär
 Chancen und Potenziale von Cloud Computing Herausforderungen für Politik und Gesellschaft Rede Hans-Joachim Otto Parlamentarischer Staatssekretär Veranstaltung der Microsoft Deutschland GmbH in Berlin
Chancen und Potenziale von Cloud Computing Herausforderungen für Politik und Gesellschaft Rede Hans-Joachim Otto Parlamentarischer Staatssekretär Veranstaltung der Microsoft Deutschland GmbH in Berlin
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter!
 Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und
