Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution
|
|
|
- Hinrich Klein
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 66 Wirbellose Tiere Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution Vor über 500 Millionen Jahren zweigten sich die vielzelligen Urtiere in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Grundbauplänen auf. Misst man deren evolutionären Erfolg an biologischen Maßstäben, wie Artenzahl, Vielfalt der genutzten Lebensräume, Vermehrungsgeschwindigkeit oder auch Individuenzahl auf der Erde, übertrifft der Stamm Gliederfüßer und unter ihnen an erster Stelle die Klasse Insekten alle anderen Gruppen bei Weitem: Drei Viertel aller Arten überhaupt sind Gliederfüßer, davon stellen die Insekten mit etwa 90 % die überwältigende Mehrheit. Ihr besonderer Körperbau hat ihnen faszinierende Möglichkeiten der Fortbewegung und Ernährung eröffnet. Ihre leistungsfähigen Sinnesorgane und ihre Verhaltensprogramme ermöglichen es ihnen, sich von Generation zu Generation sehr erfolgreich fortzupflanzen. Einigen von ihnen ist durch die Bildung von Staaten sogar der Sprung auf eine neue, höhere Organisationsebene gelungen. Durch ihre ungeheure Zahl, ihren unersättlichen Appetit und ihre einfallsreiche Art, sich zu ernähren, sind Insekten und ihre Verwandten im Naturhaushalt und für uns Menschen von großer Bedeutung. 1 Beschreibe Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Gliederfüßerarten auf den Fotos. Ordne sie dir bekannten Verwandtschaftsgruppen zu und benenne sie, soweit möglich. 2 Erkläre, warum die oben genannten biologischen Maßstäbe geeignet sind, um den evolutionären Erfolg verschiedener Gruppe zu vergleichen. 3 Einige evolutionäre Erfindungen der Insekten dienen als Vorbild für technische Lösungen. Suche Beispiele.
2 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 67 Libellen seit Jahrmillionen unverändert Aus dem Leben eines schnellen Jägers. Langsam kriecht die Libellenlarve aus dem Wasser am Schilfhalm empor. Sie verharrt eine Weile, ohne eine Bewegung oder Veränderung zu zeigen. Dann reißt die Haut auf dem Rücken auf und das Tier beginnt sich mühsam aus seiner Larvenhülle zu befreien. Zerknitterte Häute entfalten sich schließlich zu großen, durchscheinenden Flügeln. Der Körper beginnt allmählich metallisch zu schimmern. Nach bald einer Stunde plötzlich ein Blitzstart. Von einer Sekunde auf die andere fliegt die Quelljungfer los, als ob sie sich schon immer so bewegt hätte. Sie steigt, sinkt, fliegt vorwärts und rückwärts wie ein Hubschrauber, während sie mit riesigen Facettenaugen unablässig nach Beute sucht. Hat sie ein fliegendes Insekt entdeckt, steuert sie es mit bis zu 50 km in der Stunde an. Vor dem Zusammentreffen schließen sich ihre Gliedmaßen zu einem Fangkorb, in den sie die Beute präzise aufnimmt. Noch im Flug wird das erbeutete Insekt mit den Vorderbeinen zum Mund geführt und mithilfe der kräftigen Mundwerkzeuge verzehrt. Wenn der Sommer zu Ende geht, beginnt der letzte Abschnitt im Leben einer Libelle. Nach der Paarung, die im Flug erfolgt, werden die Eier vom Weibchen ins Wasser abgelegt. Danach sterben die erwachsenen Tiere. Aus den Eiern schlüpfen die wasserlebenden Larven, die ebenfalls als Jäger leben. Sie häuten sich mehrfach. Frühestens nach einem, bei manchen Arten erst nach vier Jahren verlassen sie das Wasser und pflanzen sich als erwachsene, also geschlechtsreife Tiere wiederum fort. 2 Libellenlarve 1 Vor wenigen Minuten ist die Quelljungfer geschlüpft. Libellen eine uralte Insektenordnung. Libellen gehören zu den ältesten Insektengruppen. Sie haben, wie Fossilien zeigen ( Seite 61), ihre Gestalt und Lebensweise seit Hunderten von Millionen Jahren beibehalten. Ihre durchschnittliche Flügelspannweite beträgt heute nur noch 3 14 cm. Vor 300 Millionen Jahren jagten in den Baumfarnwäldern des Karbons aber auch Riesenformen mit bis zu 75 cm Spannweite. 1 Vergleiche so weit wie möglich den Körperbau der abgebildeten Libelle mit dem Grundbauplan der Gliederfüßer ( Seite 51) und dem der Insektenvorfahren ( Seite 60). Benenne und beschreibe die Veränderungen. 2 Welchen Vorteil bietet deiner Ansicht nach die veränderte Gestalt den Insekten? 3 Erkläre den Begriff Larve. Welche Tiergruppen kennst du, bei denen ebenfalls Larven aufreten? Beschreibe, wie sie sich zum erwachsenen Tier entwickeln. Paarung Eiablage Schlüpfen Entwicklung der Larve 3 Lebenslauf einer Libelle
3 68 Wirbellose Tiere Der Bauplan der Insekten Hinterleib Brust Kopf 1 Bauplan eines Insekts (am Beispiel Schmetterling) Körpergliederung. Libellen scheinen anders gebaut zu sein als ihre Gliederfüßervorfahren. Auf den ersten Blick kann man an ihrem Körper statt vieler kleiner Segmente nur drei große Abschnitte unterscheiden, die man als Kopf, Brust und Hinterleib bezeichnet. Bei näherer Betrachtung erkennt man jedoch, dass diese neuen, größeren Körperabschnitte immer noch aus Segmenten aufgebaut sind. Durch Verschmelzung mehrerer Segmente mit dem ursprünglich kleinen Kopfsegment entstand eine vergrößerte Kopfkapsel. Sie bot mehr Raum für die Augen und das Gehirn, sodass mehr Informationen aufgenommen und rascher verarbeitet werden konnten. Die Gliedmaßen der zur Kopfkapsel verschmolzenen Segmente wurden zu Mundwerkzeugen, die zusammen mit kräftigen Kaumuskeln die Nutzung neuer Nahrungsquellen ermöglichten. Der Brustabschnitt setzt sich aus drei Segmenten zusammen. Gegenüber den anderen Körperabschnitten ist er beträchtlich vergrößert und als Antriebseinheit auf Bewegung spezialisiert. An seiner Oberseite sitzen zwei Flügelpaare, an der Unterseite an jedem Segment ein Paar Gliedmaßen. Das Innere des Brustabschnitts bietet Platz für kräftige Muskeln zur Bewegung von Flügeln und Gliedmaßen. Der Hinterleib besteht je nach Art aus neun bis elf Segmenten, die von wenigen Ausnahmen abgesehen keine Gliedmaßen mehr tragen. Er ist spezialisiert auf Verdauung, Sauerstoffaufnahme, Ausscheidung und Fortpflanzung. Bei vielen Insektenarten ist die Gliederung in die drei großen Körperabschnitte Kopf, Brust und Hinterleib sehr ausgeprägt und hat zu der Bezeichnung Insekten (von lateinisch insectum: eingeschnitten, gekerbt) für die gesamte Klasse geführt ( Bild 2). Wegen ihrer charakteristischen Gliedmaßenzahl werden die Insekten manchmal auch Hexapoda genannt (von griechisch hexa: sechs und podes: Füße). 1 Ordne den mit Nummern versehenen Teilen des Insektenkörpers in deinem Heft die richtigen Bezeichnungen zu und gib die jeweilige Aufgabe an. 2 Beschreibe Unterschiede im Vergleich zu den Wirbeltieren. 2 Manche Insekten wie diese Wespe zeigen die typische Körpergliederung besonders deutlich.
4 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 69 Atembewegung ( Pumpen ) Stigma Chitinaußenskelett Reuse Schließmuskel Trachee, aufgeschnitten Verschlusshebel kleinere Trachee Muskel kleinere Trachee Tracheole (Ausläufer der Trachee) 1 Das Außenskelett (im Foto ein Blutströpfchen) ist nicht überall gleich dick und hat nicht nur Schutzfunktion. Außenskelett. Die äußere Körperhülle oder Cuticula bietet den Insekten nicht nur Schutz vor Sonneneinstrahlung, Parasiten, Verletzung und Austrocknung, sondern übernimmt wie bei allen Gliederfüßern auch die Aufgabe eines Skeletts (Außenskelett). Das Material für die zylinderförmige Außenhülle wird von einer Schicht von Hautzellen, der Epidermis, ausgeschieden. Es besteht aus einem Netzwerk von langkettigen Protein- und Chitinmolekülen. Diese Verbundbauweise ermöglicht große Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die Cuticula ist am Aufbau von Härchen, Fühlern, Augen, Flügeln und Gliedmaßen beteiligt, also an allen Strukturen auf der Außenseite des Körpers. Selbst einige Strukturen im Körperinnern, zum Beispiel die Tracheen, werden von ihr gebildet. Je nachdem, wie viele Chitinmoleküle in einem Körperbereich eingebaut werden, hat die Außenhülle ganz unterschiedliche Eigenschaften: Sie kann sehr hart und starr, aber auch dünn und flexibel sein. Im Gegensatz zu Fell oder Federn bei Wirbeltieren kann die Cuticula den Insektenkörper nicht isolieren. Insekten sind daher wie die anderen Gliederfüßer wechselwarme Tiere. Schwieriges Wachstum. Genau wie eine Rüstung nicht mit ihrem Besitzer mitwachsen kann, kann auch die Cuticula der Insekten, die ja ebenfalls aus totem Material besteht, nicht mitwachsen. Wachstum ist bei Insekten und allen anderen Gliederfüßern daher immer mit Häutungen verbunden. Wenn die alte Hülle zu klein wird, bilden die Tiere darunter eine neue, zunächst noch weiche und dehnungsfähige Cuticula. Dann stoßen sie die Reste der alten Hülle ab und schlucken Luft oder auch Wasser, um die neue Außenhülle durch Volumenvergrößerung zu straffen. Die sich anschließende Aushärtung der neuen Cuticula wird durch Hormone präzise gesteuert und kann einige Stunden in Anspruch nehmen. 2 Tracheenatmung der Insekten. Zusammenpressen des Hinterleibs unterstützt das Ausatmen. Tracheen Direktversorgung mit Sauerstoff. Im Zusammenhang mit der Besiedlung des Lands ist bei den Vorfahren der Insekten durch Einstülpung der Cuticula ( Seite 61) ein inneres Röhrensystem entstanden. Durch das Tracheensystem können Sauerstoffmoleküle ohne Umweg über das Blut zu den Organen gelangen und Kohlenstoffdioxidmoleküle auf die gleiche Weise den Körper verlassen. Die Aufnahme und Abgabe der Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidmoleküle erfolgt über kleine Öffnungen an den Hinterleibs- und Brustsegmenten, die Stigmen (von griechisch stigma: Stich, Fleck). Die Stigmen haben an ihrem Eingang eine Art Reuse und können verschlossen werden. Von den Stigmen aus führen die Tracheen ins Körperinnere. Dabei verzweigen sie sich immer feiner, bis sie direkt an die Zellen der zu versorgenden Organe anschließen. Die Zirkulation von Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidmolekülen in den Tracheen wird hauptsächlich durch Bewegungen des Hinterleibs ( Pumpen ) unterstützt. 1 Überlege, welche zusätzliche Aufgabe die Außenhülle bei Insekten noch haben könnte. 2 Beschreibe die eines Skeletts. 3 Ordne verschiedenen Bereichen der Cuticula in Bild 1 unterschiedliche Eigenschaften zu (hart, weich ). Begründe deine Zuordnung. 4 Erkläre die Begriffe wechselwarm und gleichwarm. 5 Stelle mit einer Zeichnung möglichst genau dar, wie eine Zelle bei einem Insekt und bei einem Wirbeltier mit Sauerstoff und Traubenzucker (Glucose) versorgt wird. 6 Welche biologische Bedeutung könnte die Verschließbarkeit der Stigmen und die Reuse an den Stigmen haben? Erkläre!
5 70 Wirbellose Tiere Überleben dank hoch entwickelter Sinnesorgane Gleiche Umwelt vergleichbare Lösungen. Während ihrer langen Evolution sind bei den Insekten ebenso leistungsfähige Sinnesorgane entstanden wie bei den Wirbeltieren oder auch den Kopffüßern. Insekten können sehen, schmecken, riechen, Berührungsreize und Erschütterungen wahrnehmen. Sie können oben und unten unterscheiden, die Feuchtigkeit und die Temperatur messen. Einige besitzen eingebaute Tachometer, andere Entfernungsmesser, einige Arten auch eine sehr genau gehende innere Uhr. Ihre Sinnesorgane sprechen auf dieselben Reize wie die der Wirbeltiere an, also beispielsweise Schall, Licht, Schwerkraft oder das Eintreffen bestimmter Moleküle. Der Aufbau der Sinnesorgane, ihre Lage im Körper und ihre Leistung ist bei den viel kleineren Insekten zwar anders als bei den Wirbeltieren, das Ergebnis jedoch dasselbe: Es ermöglicht das Überleben. 1 Facettenaugen einer Libelle Facettenaugen liefern andere Bilder als Linsenaugen. Jedes Einzelauge eines Facettenauges erzeugt einen winzig kleinen Bildausschnitt, sodass das entstehende Bild mosaikartig aus vielen einzelnen Lichtpunkten zusammengesetzt ist. Bei einem Insekt mit 2500 Einzelaugen beträgt die Bildschärfe daher nur etwa 1 bis 2 % im Vergleich zur Bildschärfe des menschlichen Auges. Sein Bild müsste grob gerastert erscheinen. Welchen Bildeindruck sein Gehirn ihm aus den eingehenden Informationen aber wirklich errechnet, wissen wir nicht und können nur Vermutungen anstellen. Facettenaugen arbeiten wie Zeitlupenkameras. Wer schon einmal versucht hat, eine Fliege oder gar eine Libelle mit der Hand zu fangen, weiß, dass sie ungeheuer schnell auf Bewegungen reagieren. Für einen Sekundenbruchteil wird ein bewegtes Objekt von einem Einzelauge abgebildet, dann wird es von den benachbarten Einzelaugen registriert, dann von den nächsten Bei unserem Linsenauge dagegen nehmen viele Sinneszellen in der Netzhaut das sich bewegende Objekt gleichzeitig wahr. Bis sie sich wieder erholt haben und ein neues Bild liefern können, hat sich ein schnelles Objekt schon ein Stück weiterbewegt. Gehen mehr als 60 Bilder pro Sekunde ein, werden sie von unserem Gehirn zu einem zusammenhängenden Film verschmolzen. Bienen und Fliegen hingegen können über 300 Einzelbilder pro Sekunde noch immer als voneinander getrennte Standbilder wahrnehmen. 1 Ordne den Nummern von Bild 2 in deinem Heft die passenden Bezeichnungen zu. 2 Vergleiche den Aufbau eines Einzelauges mit dem eines Linsenauges bei Wirbeltieren. 3 Erkläre, welchen Vorteil eine höhere Anzahl Einzelaugen bringt und welcher Nachteil damit verbunden ist. Facettenaugen ähnlich und doch ganz anders. Die Facettenaugen, die die Insekten von ihren Gliederfüßervorfahren geerbt haben, unterscheiden sich erheblich von unseren Augen. Sie bestehen je nach Insektenart aus mehreren Hundert bis zu winzigen sechseckigen Einzelaugen. Jedes Einzelauge stellt ein vollständiges funktionsfähiges Auge dar. Durch Pigmentzellen, die durch einen Farbstoff lichtundurchlässig sind, ist es von den anderen Einzelaugen abgeschirmt. Ein Einzelauge besteht aus einer von der Cuticula gebildeten kleinen Linse, die das Licht über einen Kristallkegel in einen Kanal leitet. Dieser wird von mehreren kreisförmig angeordneten Sinneszellen gebildet. Dort trifft es auf haarfeine, lichtempfindliche Ausstülpungen der Sehzellen, die nach ihrer Reizung schwache elektrische Signale über den Sehnerv an das Gehirn übermitteln. 2 Bau des Facettenauges
6 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 71 Viele Insektenarten sehen die Welt in Farbe. Von Honigbienen und vielen anderen Insektenarten weiß man heute, dass sie ihre Umwelt farbig sehen. Der Münchner Biologe und Nobelpreisträger Karl von Frisch führte dazu verschiedene Experimente durch. Versuch 1: Er bot Bienen eine Zeit lang auf einem Tisch eine Schale mit Zuckerwasser auf einem blauen Blatt Papier an. Beobachtung 1: Die Bienen flogen nach kurzer Zeit regelmäßig die Schale an und wurden von Karl von Frisch dabei mit einem Farbtupfer markiert. Versuch 2: Jetzt verschob der Forscher mehrfach die leere Schale zusammen mit dem blauen Papier an andere Positionen. Zusätzlich stellte er dabei noch leere Schalen ohne blaue Unterlage mit auf den Tisch. Beobachtung 2: Die Bienen flogen gezielt die Schale auf der blauen Unterlage an. 1 Karl von Frischs Versuch 3 Versuch 3: Nun stellte von Frisch zusätzlich zu der leeren Schale auf der blauen Unterlage mehrere leere Schalen auf gleich große Papierblätter in unterschiedlichen Grautönen auf den Tisch. Beobachtung 3: Die Bienen flogen gezielt die Schale auf der blauen Unterlage an. Aus diesen Beobachtungen zog Karl von Frisch den Schluss, dass Bienen die Farbe Blau erkennen können. Solche und weitere Experimente zeigten, dass Bienen (und auch andere Insektenarten) Farben erkennen können. Es sind allerdings nicht dieselben Farben, die wir wahrnehmen. Für Bienen beispielsweise erscheint das für uns unsichtbare UV-Licht als Farbe. 1 Welche Überlegung könnte von Frisch dazu veranlasst haben, das Farbensehen bei Honigbienen zu testen? 2 Erkläre genau, warum der Wissenschaftler sein Experiment in der beschriebenen Weise durchgeführt hat. (Tipp: Überlege dir dabei auch, wie ein farbenblinder Mensch seine farbige Umwelt wahrnimmt.) 3 In den gemäßigten Breiten gibt es nur sehr wenig Pflanzenarten mit rein roten Blüten. Welche Schlussfolgerung würdest du daraus ziehen? Erkläre! 2 Nachtfaltermännchen haben gr0ße, verästelte Fühler. Leistungsfähiger Geruchssinn auf minimalem Raum. Insekten verfügen über einen hochempfindlichen Geruchssinn. Mithilfe der Antennen (Fühler) kann ein Nachtschmetterling vom Weibchen abgegebene Lockstoffmoleküle auf mehrere Kilometer Entfernung wahrnehmen. Auf seinen Antennen sitzen viele Tausend Härchen mit zahlreichen Poren von 1/1000 mm Durchmesser. Durch diese Poren gelangen Lockstoffmoleküle zu den Zellmembranen von Nervenzellen. Können sie dort an einem Empfängermolekül andocken, wird ein schwaches elektrisches Signal ausgelöst und zum Gehirn weitergeleitet. Fühlen: Härchen als Berührungssensoren. Der gesamte Insektenkörper ist mit Härchen besetzt, die auf Verformung oder Biegung mit einem schwachen elektrischen Signal reagieren. Auf diese Weise kann ein Insekt beispielsweise mit den Härchen an den Gliedmaßen fühlen, wie der 3 Kopf einer Biene, REM Untergrund beschaffen ist. Hören. Viele Insektenarten können Schall wahrnehmen, also hören. Ihre Ohren, also die schallaufnehmenden Organe, sitzen je nach Art an unterschiedlichen Stellen im Körper. Bei Grillen und Laubheuschrecken beispielsweise liegen die Gehörorgane an den Vorderbeinen. Sie nehmen den Schall mithilfe von Membranen auf, die durch die Vibrationen der Luft selbst in Schwingungen versetzt werden. 4 Welches in der Biologie häufige Konstruktionsprinzip lassen die Schmetterlingsfühler erkennen? Erkläre! 5 Bienen können mithilfe von Härchen am Kopf ihre Fluggeschwindigkeit messen. Erkläre! 6 Was würdest du aus der Lage der Gehörorgane bei Insekten und Wirbeltieren schließen? Erkläre!
7 72 Wirbellose Tiere Insekten zum Kennenlernen: die artenreichsten Ordnungen 1 Goldlaufkäfer 3 Schwalbenschwanz, ein einheimischer Tagfalter Ordnung Käfer. Mit etwa Arten bilden die Käfer die größte Insektenordnung. Mit Ausnahme von Kopf und erstem Brustsegment sind bei ihnen alle Segmente von den harten Vorderflügeln (Deckflügeln) bedeckt. Um die weit größeren, häutigen Hinterflügel unter den Deckflügeln zu verstauen, werden sie der Länge und Breite nach gefaltet. Nur die Hinterflügel sind flugtauglich. Die Deckflügel werden beim Fliegen seitlich ausgestreckt und dienen als Tragflächen. Die stark chitinisierten Käfer sind eher langsame, wenig ausdauernde Flieger. Käfer haben kräftige kauend-beißende Mundwerkzeuge ( Seite 80/81). Ihre Nahrungsmittelauswahl umfasst Blätter, Holz, Früchte, Blüten, Samen, Pilze, andere Insekten, Aas, Kot und Lebensmittel. So sind zum Beispiel Laufkäfer ( Bild 1) nachtaktive Jäger, die in die Bisswunde der Beute einen Verdauungssaft mit eiweißspaltenden Enzymen erbrechen. Die vorverdaute Nahrung schlürfen sie dann ein. Da Laufkäfer vor allem Schmetterlingsraupen und auch kleine Nacktschnecken angreifen, sind sie bei der biologischen Schädlingsbekämpfung ebenso wertvolle Partner wie die Marienkäfer (und ihre Larven), die in ihrem kurzen Leben über 3000 Blattläuse vertilgen. In Baumholz lebende und blattfressende Käfer sowie ihre Larven sind häufig auf eine oder wenige Pflanzenarten spezialisiert. Sie finden in Monokulturen optimale Lebensbedingungen und können dort erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten, zum Beispiel manche Borkenkäfer in reinen Fichtenbeständen. Eine bedeutende Rolle als Destruenten spielen Aas- und Dungkäfer und ihre Larven, die sich in Leichen und Kot entwickeln. Alle Käfer durchlaufen eine vollkommene Verwandlung ( Seite 86). Ordnung Schmetterlinge. Die meisten der Arten Schmetterlinge erkennt man leicht an ihren großen Flügeln. Bei einem südamerikanischen Eulenfalter weisen sie eine Spannweite von rund 32 cm auf! Sie sind mit dachziegelartig angeordneten Schuppen bedeckt, die die Färbung und Zeichnung der Flügel hervorrufen. Die Schuppen enthalten Farbstoffe (Pigmente). Oft entstehen aber die Farbtöne auch durch Lichtreflexe an ihrer Oberflächenstruktur. Die meisten Schmetterlinge besitzen einen langen, spiralig gedrehten Rüssel, mit dem sie Flüssigkeiten aufsaugen, vor allem Nektar aus Blüten, in seltenen Fällen auch Blut oder Tränenflüssigkeit. Sie besuchen bevorzugt langröhrige Blüten und bestäuben sie dabei. Schwärmerfalter stehen wie Kolibris schwirrend mit Flügelschlägen pro Sekunde vor der Blüte in der Luft. Die Schmetterlingslarven (Raupen) sind meist Pflanzenfresser und oft auf ganz bestimmte Nahrungspflanzen angewiesen, zum Beispiel legt der Schwalbenschwanz ( Bild 3) seine Eier vor allem auf der Wilden Möhre ab. Das Verschwinden vieler Ackerwildkräuter und Trockenwiesenpflanzen durch chemische Bekämpfung und Überdüngung ist eine der Ursachen dafür, dass Schmetterlinge immer seltener werden. Forscher haben einen Rückgang um 90 % innerhalb von 50 Jahren festgestellt! Wenige Arten wie der Kiefernspinner profitieren von Monokulturen; ihre Raupen fressen bei Massenentwicklungen Tausende Hektar kahl. Viele Raupen können Seide spinnen. Einige Arten spinnen sich einen Kokon, in dem sie sich verpuppen. Die Seidenspinnerraupe produziert einen 3000 m langen Faden, die Rohseide. Seidenspinner werden in China seit 5000 Jahren gezüchtet. 2 Entwicklung eines Käfers 4 Entwicklung eines Schmetterlings
8 Insekten zum Kennenlernen: die fortschrittlichsten Ordnungen Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 73 1 Schwebfliege 3 Rote Waldameisen beim Raupentransport Ordnung Zweiflügler. Zweiflügler besitzen nur ein einziges häutiges Flügelpaar. Die Hinterflügel sind zu kleinen Schwingkölbchen umgewandelt, die in der Form Trommelschlägeln ähneln. Sie dienen als Flugstabilisatoren und Gleichgewichtsorgane. Fliegen wirken eher gedrungen und haben kaum erkennbare Fühler. Haftballen zwischen den Klauen ermöglichen ihnen das Festhalten an glatten Flächen. Mücken haben einen lang gestreckten, schlanken Körper und fadenförmige Fühler. Die Larvenformen sind sehr vielgestaltig. Bei manchen Fliegen schlüpfen aus den Eiern beinlose Maden. Stechmückenlarven und -puppen sind schwimmfähig und entwickeln sich im Wasser. Die Zweiflügler haben sich die verschiedensten Nahrungsquellen erschlossen. Stuben- und Fleischfliegen tupfen mithilfe eines stempelartigen Saugrüssels flüssige Nahrung auf ( Seite 81). Ihre Geschmackssinnesorgane befinden sich in den Vorderfüßen. Da Fliegen Ausscheidungen und faulige Stoffe aufsuchen, um ihre Eier abzulegen, können sie Krankheitserreger übertragen. Das tun auch blutsaugende Stechfliegen und Stechmücken. So übertragen die afrikanische Tsetsefliege die Erreger der Schlafkrankheit und die in tropischen und subtropischen Regionen weitverbreiteten Fiebermücken die Malaria ( Seite 82). Dagegen sind die ähnlich wie Wespen gezeichneten, doch völlig harmlosen Schwebfliegen bedeutende Blütenbestäuber ( Bild 1). Seit Kurzem setzt man sogar die Maden einer Schmeißfliegenart in der Medizin zur besseren Wundheilung ein. Sie verdauen nämlich nur tote Zellen und scheiden gleichzeitig bakterientötende sowie wundheilungsfördernde Stoffe aus. Ordnung Hautflügler. Alle Hautflügler besitzen zwei durchsichtige Flügelpaare. Das hintere ist kleiner und über eine Häkchenreihe mit dem vorderen Flügelpaar verbunden. Dadurch entsteht eine einheitliche Tragfläche. Die Larven sind meist Maden. Aussehen und Lebensweise der Hautflügler sind außerordentlich vielgestaltig. Schlupfwespen sind Brutparasiten. Sie legen ihre Eier mit einem bis zu 6 cm langen Legestachel in die Eier, Larven, Puppen oder erwachsenen Tiere anderer Insekten. Die schlüpfenden Larven fressen ihren Wirt von innen auf. Schlupfwespen spielen eine wichtige Rolle bei der Schädlingsbekämpfung. Viele Hautflügler leben sozial. Hummeln (Blütenbestäuber) und Wespen (vorwiegend Insektenräuber) bilden Sommerstaaten, Bienen ( Seite 90) und Ameisen auch Dauerstaaten mit großen Individuenzahlen (bei der Roten Waldameise bis zu einer Million Tiere). Bei den Ameisen tragen nur Männchen und junge Königinnen während des Hochzeitsflugs Flügel. Oft sind in einem Nest mehrere Königinnen vorhanden. Die Arbeiterinnen übernehmen im Prinzip die gleichen wie im Bienenstaat. Ameisen bevorzugen proteinreiche Nahrung und erbeuten vor allem Schmetterligsraupen bis zu Insekten an einem Sommertag! Ihre zweite wichtige Nahrungsquelle ist der zuckerhaltige Honigtau, den Blattläuse ausscheiden ( Seite 74). Die Verständigung erfolgt mit den Fühlern über einen empfindlichen Geruchs- und Tastsinn. Die tropischen Blattschneiderameisen züchten auf einem zerkauten Blattbrei Pilze, von denen sie sich ernähren. Sklavenhalterameisen rauben aus Nestern anderer Arten Larven und Puppen. Die geschlüpften Tiere sind für die Sklavenhalter tätig. 2 Entwicklung einer Fliege 4 Entwicklung einer Ameise
9 74 Wirbellose Tiere Insekten zum Kennenlernen: Säftesauger 1 Feuerwanze 4 Rosenblattläuse Ordnung Wanzen. Der Körper der Wanzen wirkt gedrungen, ist aber im Gegensatz zu dem der Käfer abgeflacht. Zwischen den Vorderflügeln liegt meist ein dreieckiges Schildchen. Die Vorderflügel sind am Grund stark chitinisiert und an der Spitze dünnhäutig, die Hinterflügel häutig. Viele Wanzen besitzen Stinkdrüsen zur Abwehr von Feinden. Die Larven ähneln den erwachsenen Tieren und leben mit ihnen im gleichen Lebensraum. Die stechend-saugenden Mundwerkzeuge 2 Eine Baumwanze saugt sind als Rüssel ausgebildet eine Raupe aus. ( Seite 81). Beeren- und Feuerwanzen parasitieren an Pflanzen und saugen Pflanzensäfte. Wasserläufer und Rückenschwimmer ( Bild 3) leben dagegen räuberisch auf der Wasseroberfläche oder im Wasser. Rückenschwimmer fressen Mückenlarven, aber auch Fischbrut. Ihr Stich ist zusammen mit dem giftigen Speichel sogar für den Menschen schmerzhaft. Wie andere Wasserwanzen nehmen sie einen Luftvorrat mit unter Wasser (zum Beispiel unter den Flügeln). Wasserläufer tragen an den Fußspitzen fettige Haarbüschel, mit denen sie die Wasseroberfläche nicht durchbrechen, sondern nur Dellen darin erzeugen. Die flügellose, nur 4 mm große Bettwanze saugt nicht nur am Menschen, sondern auch an anderen gleichwarmen Wirbeltieren Blut. Die nachtaktiven Parasiten finden ihre Wirte mithilfe empfindlicher Temperatursinnesorgane. Ordnung Pflanzensauger. Blattläuse bohren mit einem feinen Saugrüssel das Leitungssystem spezieller Wirtspflanzen an. Da der Pflanzensaft wenig Proteine enthält, müssen sie große Mengen davon aufnehmen, um ihren Bedarf an Aminosäuren zu decken. Der überschüssige Zucker wird unverdaut als klebriger Honigtau ausgeschieden. Den energiereichen Läusekot lecken nicht nur Ameisen auf, sondern auch Bienen, die ihn zu dunklem Waldhonig verarbeiten. Bei starkem Läusebefall rollen sich die Blätter ein, sodass die Fotosynthese und damit das Wachstum der Pflanze beeinträchtigt ist. Zudem übertragen Läuse mit dem Speichel oft Viren, die die Wirtspflanzen zusätzlich schädigen. Zu Massenvermehrungen mit bis zu 15 Generationen im Jahr kommt es durch Jungfernzeugung: Ungeflügelte Weibchen bringen ab dem Frühjahr alle 14 Tage lebende Junge zur Welt, die ihrerseits schon wieder Junge in sich tragen. Im Sommer sichern geflügelte Weibchen die Ausbreitung. Erst gegen Herbst entstehen bei niedrigeren Temperaturen auch geflügelte Männchen, die die Weibchen begatten. Diese legen dann an geschützten Stellen Eier ab, die überwintern. Die auf Feigenkakteen (Opuntien) lebenden Scharlachschildläuse liefern den roten Farbstoff Cochenille, der auch heute noch für die Herstellung von Lippenstiften verwendet wird. Man gewinnt ihn aus den getrockneten Läusen. 5 Geburt einer Blattlaus 3 Rückenschwimmer, eine Wasserwanze 6 Scharlachschildläuse auf einem Feigenkaktus
10 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 75 Insekten zum Kennenlernen: Oldtimer 1 Wanderheuschrecken 4 Termitenkönigin mit König (vorn) und Arbeiterinnen Ordnung Heuschrecken. Das hintere Beinpaar der Heuschrecken ist besonders lang und im oberen Abschnitt sehr muskulös. Mit diesen Sprungbeinen erreichen sie mit etwa 80 cm die größten Weiten unter den Insekten. Größere Distanzen werden mit den Hinterflügeln überwunden. Sie liegen in Ruhe zusammengefaltet unter den schmalen, verdickten Deckflügeln. Heuschrecken und Grillen können durch Aneinanderreiben verschiedener Körperteile Töne erzeugen. Grillen beispielsweise zirpen mit beiden Deckflügeln. Ihre Gehörorgane liegen in den Vorderbeinen. Laubheuschrecken wie das 2 Feldheuschrecke beim Zirpen 3 Feldgrille Grüne Heupferd und die dunkel pigmentierte Feldgrille sind Allesfresser; man erkennt sie an den langen fadenförmigen Fühlern. Feldheuschrecken wie der Gemeine Heuhüpfer oder die Wanderheuschrecke tragen kurze Fühler. Mit ihren kauenden Mundwerkzeugen fressen sie Pflanzenteile. Wanderheuschrecken wurden schon in der Bibel als schreckliche Plage, im Koran als Zähne des Winds beschrieben. Sie leben normalerweise einzeln in den Trockengebieten Afrikas und Asiens. Regnet es irgendwo, kommen sie im Umkreis von 300 km in das Gebiet geflogen. Jedes Weibchen legt etwa 100 Eier. Die Larven der sich unvollkommen entwickelnden Insekten vereinigen sich zu immer größeren Hüpferschwärmen. Die 3 g schweren, flugfähigen erwachsenen Tiere fressen täglich ihr eigenes Körpergewicht. Man hat Schwärme mit etwa 75 Milliarden Tieren, 20 km Breite und 250 km Länge beobachtet, die Milliarden Euro Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen anrichten. Sie fliegen mit dem Wind etwa 340 km pro Tag! Die Schwarmentwicklung wird heute über Satelliten verfolgt. Wirksam kann man nur die Larven bekämpfen. Ordnung Termiten. In den Tropen können pro mc bis zu Termiten leben. Die heute ausschließlich Staaten bildenden Insekten existieren seit mindestens 300 Millionen Jahren. Es gibt kleine Staaten, die nur Fraßgänge in vermoderndem Holz bewohnen, aber auch große, die im Vergleich zu ihrer Körpergröße Riesenbauten errichten. Als Baumaterial dienen Erde oder Holzspäne, die mit Speichel oder breiigem Kot vermischt werden und beim Trocknen aushärten. Jeder Staat hat langlebige Geschlechtstiere. Die Eierstöcke der Königin, die in Abständen vom König begattet wird, produzieren Eier täglich. Ihr Hinterleib ist auf 8 cm Länge angeschwollen, sodass das unbewegliche Insekt ständig von den Arbeiterinnen versorgt werden muss. Sie füttern auch die Larven und die Soldaten, die den Staat mit ihren kräftigen Kiefern oder Sekreten aus einer Stirndrüse verteidigen. Die meisten Termiten fressen totes Pflanzenmaterial, insbesondere Holz. An Holzbauten können sie daher in den Tropen großen Schaden anrichten. Symbiontische Einzeller, die im Darm der Termiten leben, produzieren Enzyme, die Zellulose in verwertbare Zuckermoleküle zerlegen können. Andere Arten formen in Pilzkammern aus zerkautem Laub schwammähnliche Gebilde. Darauf wachsen im feuchten Klima des Termitenbaus Pilze, die den Termiten als Nahrung dienen. Termitenbauten sind mit einer ausgeklügelten Klimaanlage ausgerüstet, deren Wirkungsprinzip schon bei Hochhausbauten eingesetzt wird: Aus einem Luftspeicher unter dem Nest strömt kühle, feuchte Luft nach oben. Der Stoffwechsel der Termiten (und Pilze) erzeugt Wärme. Die erwärmte, sauerstoffarme Luft steigt nach oben in Kamine, die in Türmchen enden. Hier erfolgt der Luftaustausch. Die kühle Frischluft sinkt in den Speicherkeller zurück und wird dort angefeuchtet. 5 Termitenhügel
11 76 Wirbellose Tiere Fortbewegung bei Insekten: Laufen, Springen, Klettern, Schwimmen Schenkelring Schenkelring Schenkel Hüfte Schiene Fuß 2 Warzenbeißer, eine Laubheuschrecke Fangbein (Gottesanbeterin) Klammerbein (Laus) Ausgangskonstruktion Laufbein. Die im Meer lebenden Vorfahren der Insekten besaßen wie alle Gliederfüßer zahlreiche Gliedmaßen, mit deren Hilfe sie auf dem Gewässergrund laufen konnten. Bei der Besiedlung des Lands ( Seite 60) waren diese Gliedmaßen ein großer Vorteil, da sie den Körper entgegen der Schwerkraft vom Boden abheben und ihn dadurch energiesparend vorwärts bewegen konnten. Im Zusammenhang mit der Nutzung des neuen Lebensraums Land bildeten sich die Gliedmaßen der hinteren Körpersegmente immer weiter zurück. Die Fortbewegung erfolgte schließlich nur noch mit den auf das Laufen spezialisierten Beinpaaren an den drei Brustsegmenten. Dabei entstand die für Insekten typische Beinkonstruktion, die sich dann auch bei anderen Fortbewegungsarten bewährte. Das Bein der Insekten ( Bild 1) ist aus vier gelenkig miteinander verbunden Röhren zusammengesetzt. Es endet in einem mehrgliedrigen Fuß, der je nach Art mit paarigen Klauen und verschiedenen Härchen und Häkchen zum Festhalten ausgestattet ist. Sprungbein (Heuschrecke) Schenkel Schiene Sammelbein (Honigbiene) 1 Grundbauplan eines Insekts mit Laufbein sowie Abwandlungen des Laufbeins Oberschenkel Unterschenkel 1 Die Abbildung zeigt als Umriss einen Abschnitt eines Insekten- und eines Wirbeltierbeins. Übernimm die Zeichnung vergrößert in dein Heft. Zeichne die Muskeln, Sehnen und sonstigen gegebenenfalls notwendigen Skelettteile ein, die für eine Bewegung in die angegebene Richtung (Pfeil) erforderlich sind. 2 Überlege, in welcher Reihenfolge ein Insekt die Beine anheben muss, um zu vermeiden, mit dem Körper den Boden zu berühren. Springen für Insekten schwieriger als für Säugetiere. Um Feinden zu entkommen, vielleicht aber auch, weil das Laufen im Gras langsamer geht und zu viel Energie kostet, sind manche Insekten zu Springern geworden. Für alle Springer gilt: Ein Sprung ist umso weiter, je länger und kraftvoller der Körper von den Beinen beschleunigt wird. Gute Springer haben daher im Vergleich zu Nichtspringern längere Gliedmaßen mit kräftigeren Muskeln. Verglichen mit Säugetierbeinen, sind aber die Gliedmaßen von Insekten viel kürzer. Sie können daher den Körper nicht so lange beschleunigen. Als Ausweg setzen Extremspringer wie Heuschrecken ( Bild 1 und Seite 75) oder Flöhe mehr Kraft für den Sprung ein. Heuschrecken bauen dazu eine starke Muskelspannung auf, indem sie ihr Hinterbein verdrehen. Durch plötzliches Entsperren wird die gespeicherte Energie schlagartig freigesetzt und katapultiert den Körper über eine weite Entfernung. Noch raffinierter ist der Sprungmechanismus bei Flöhen. Sie haben spezielle Sprungproteine, die sie wie ein Gummipolster komprimieren. Entsperren sie diesen Energiespeicher, heben sie mit dem 200-Fachen der Erdbeschleunigung ab. Insektenbeine als Allroundwerkzeuge. Bei vielen Insektenarten haben die Beine neue übernommen. Zahlreiche Insekten können mithilfe ihrer Beine klettern. Die Maulwurfsgrille hat schaufelartig verbreiterte Grabbeine. Bei Gottesanbeterinnen dient das vordere Beinpaar als Fangmesser. Läuse besitzen Greifklauen zum Festklammern an den Haaren ihrer Opfer. Die Honigbiene nutzt ein Beinpaar auch als Tragetasche beim Pollensammeln. 3 Gottesanbeterin 3 Überlege dir, warum man einen kleinen Gegenstand mit dem zuvor am Daumen vorgespannten Zeigefinger sehr weit wegschnalzen kann. 4 Skizziere das Grabbein einer Maulwurfsgrille. Gehe dabei von der Grundkonstruktion des Insektenbeins aus.
12 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 77 1 Wasserläufer 3 Gelbrandkäfer Zurück in den Lebensraum Wasser. Ähnlich wie bei Säugetieren oder Vögeln sind auch einige Insekten nach der Landbesiedlung wieder ins Wasser zurückgekehrt. Vermutlich hatten Tiere, die im Uferbereich lebten, weniger Konkurrenten, wenn sie ihre Nahrung im Wasser suchten oder sich dort vor Feinden in Sicherheit brachten. Anfangs lebten die Rückkehrer wahrscheinlich noch amphibisch. Schrittweise Veränderungen bei der Fortbewegung und der Atmung im Lauf vieler Millionen Jahre ermöglichten einigen Arten, wieder ganz im Wasser zu leben. Auf dem Wasser laufen. Jeder hat schon einmal Wasserläufer ( Bild 1 und Seite 74) gesehen und sich vielleicht gefragt, wie es möglich ist, dass sie auf der Wasseroberfläche laufen können, ohne einzusinken. Der Trick besteht aus zwei Teilen: Zum einen hat Wasser an der Oberfläche eine winzige Spannung, die Oberflächenspannung. Sie kommt dadurch zustande, dass sich die Wassermoleküle untereinander anziehen. Die Moleküle der obersten Schicht, die ja weniger anziehende Partner haben als die im Innern, ordnen sich so an, dass auch sie möglichst viele Partner um sich herum haben. Dadurch entsteht eine gekrümmte und etwas gespannte Wasseroberfläche. Bei kleinen Wassermengen führt das zur Tropfenform. Solange ein Insekt die gespannte Wasseroberfläche nicht durchstößt, wird es getragen. 2 Wassertropfen Wasserläufer verteilen zudem eine ölige Flüssigkeit über ihre Beine. Diese Wasser abstoßende Hülle trägt dazu bei, dass die Beine die Wasseroberfläche nicht durchstoßen. Versuche 1 Fülle Wasser in einen tiefen Teller. Schneide von einer Alufolie einige kleine Quadrate (Seitenlänge 5 mm) ab und gib sie auf die völlig ruhige Wasseroberfläche. 2 Teste mit einem Streichholz vorsichtig die Oberflächenspannung. Gib dann ein Spülmittel hinzu. Erkläre seine Wirkung. 3 Reibe mit dem Finger neue Aluschnipsel mit sehr wenig Öl ein und teste erneut. Beine ersetzen Flossen Insekten als Schwimmer. Einige Insektenarten wie der Rückenschwimmer ( Seite 74) und der Gelbrandkäfer leben vorwiegend unter der Wasseroberfläche und sind geschickte Schwimmer. Bei den meisten wasserlebenden Insektenarten wird die Schwimmbewegung von den hinteren Gliedmaßen erzeugt, die sich ähnlich wie unsere Arme beim Brustschwimmen bewegen. Andere Arten wie der Kolbenwasserkäfer haben eine Art Kraulstil, während sich der Rückenschwimmer, auf dem Rücken liegend, vorwärtsstößt. 1 Erkläre anhand von Bild 3, in welcher Weise die Gliedmaßen des Gelbrandkäfers an die Fortbewegung unter Wasser angepasst sind. 2 Welche weiteren Anpassungen im Körperbau an die Fortbewegung unter Wasser würdest du bei Wasserinsekten noch erwarten? Begründe! Nachgehakt: Atmen unter Wasser Ähnlich wie die ins Wasser zurückgekehrten Säugetiere müssen auch die meisten Wasserinsekten und ihre Larven zur Sauerstoffaufnahme an die Oberfläche kommen. Viele Arten tanken an der Oberfläche Luft, die sie als silbrig schimmernden Film in einem Haarpelz auf der Unterseite speichern. Beim Wasserskorpion, einer Wasserwanze, ist das Hinterleibsende zu einer Röhre ausgezogen, über die der Wasserskorpion den Sauerstoffvorrat erneuern kann, während er untergetaucht ist. Im Gegensatz zu den Larven der Stechmücken ( Bild 4) müssen Libellenlarven nicht zur Sauerstoffaufnahme an die Wasseroberfläche. Sie füllen den Enddarm mit Wasser und nehmen daraus über die dünne Darmwand die Sauerstoffmoleküle auf. 4 Stechmückenlarven atmen über ein Atemrohr.
13 78 Wirbellose Tiere Flugpioniere und Flugkünstler 1 Eine Blaugrüne Mosaikjungfer im Flug Insekten die ersten Lebewesen mit Flügeln. Die Urinsekten ( Seite 60) besaßen noch keine Flügel. Auch heute noch gibt es einige ursprüngliche flügellose Insektengruppen. Nach der Besiedlung des Lands vor mehr als 350 Millionen Jahren entstanden bei den Insekten die Flügel aus Ausstülpungen der Cuticula am Brustabschnitt. Anfangs waren es vermutlich nur kleine Stummel, die nicht zum Fliegen geeignet waren. Welche Aufgabe sie zunächst hatten und welcher Vorteil mit ihnen verbunden war, ist noch unklar. Dienten sie als Paddel, als Kiemen oder als Tragflächen für sehr kurze Gleitflüge? Der bislang älteste Fossilfund einer Libelle jedenfalls ist etwa 350 Millionen Jahre alt und zeigt schon die Grundkonstruktion eines Insektenflügels, wie sie sich heute noch bei allen geflügelten Arten findet. Tragflächenmaterial Chitin Vorteile und Probleme. Während der Larvenentwicklung zum erwachsenen Tier bestehen die Flügelanlagen aus lebendem Gewebe, in dem Blut fließt und Tracheen und Nervenbahnen verlaufen. Erst nach Abschluss des Wachstums, also nach der letzten Häutung, entsteht die leichte und sehr stabile Flügeltragfläche. Danach stirbt das lebende Gewebe im Flügel größtenteils ab. Wird der Flügel später beschädigt, kann er daher nicht mehr repariert oder ersetzt werden. Insektenflügel anders konstruiert als Vogelflügel. Während ein Vogelflügel durch Knochen und Muskeln, die zum Teil im Flügel selbst liegen, verformt und auch bewegt werden kann, können Insektenflügel nur über Gelenke an der Verbindung mit dem Brustabschnitt verstellt und bewegt werden. Da die Flügel nur wenig gewölbt sind, wird der Auftrieb auch dadurch erzeugt, dass die Flügel beim Schlagen nicht waagerecht, sondern leicht nach vorn gekippt gehalten werden. Vorteilhafte Konstruktionsänderungen. Die älteren flugfähigen Insektengruppen, beispielsweise Libellen und Netzflügler wie die Florfliege ( Bild 3), haben nur ein Flügelgelenk, sodass sie ihre Flügel nicht zusammenfalten können. Modernere Fluginsekten besitzen dagegen ein zweites Flügelgelenk. Sie können mit den zusammengeklappten Flügeln ohne Probleme in Ritzen oder unter Rinde kriechen und so neue Lebensräume nutzen. Zugleich sind die Flügel im zusammengeklappten Zustand besser geschützt. Bei einigen Insektenordnungen, zum Beispiel den Hautflüglern ( Seite 73) wie Bienen oder Wespen, sind Vorder- und Hinterflügel miteinander verhakt und werden dadurch gemeinsam bewegt. Vorteilhaft war auch die Umwandlung der Vorderflügel in harte Deckflügel bei den Käfern ( Bild 2 und Seite 72). Käfer können sich mit ihren auf diese Weise sicher verstauten Hinterflügeln schnell und ohne Beschädigungsrisiko auf rissigen Rinden, in Laub oder kleinen Spalten am Boden bewegen. 2 Maikäfer im Flug. Bewegt werden nur die häutigen Hinterflügel. 1 Erkläre, welche Vorteile mit dem Flugvermögen verbunden sind. 2 Erkläre mithilfe einer Zeichnung, wie es möglich ist, dass sich ein Insekt oder ein Vogel in der Luft hält. 3 Beschreibe die verschiedenen Flugarten, die bei Vögeln beobachtet werden. 4 Erkläre, in welcher Weise die beim Fliegen seitlich ausgestreckten und unbewegten gewölbten Deckflügel zum Flugvermögen der Käfer beitragen können. 3 Florfliegen haben nur ein Flügelgelenk. Sie legen daher ihre Flügel in Ruhe auf dem Rücken zusammen.
14 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 79 Der Flügelantrieb. Bei Libellen und anderen älteren Gruppen werden die Flügel durch Flugmuskeln bewegt, die zum Teil direkt am Flügelgelenk angreifen. Bei moderneren Insektengruppen setzen die Flugmuskeln statt am Flügelansatz Längsschnitt am Außenskelett des elastischen Brustabschnitts an und verformen ihn durch abwechselnden Zug. Die Verformung überträgt sich Querschnitt dann über Gelenke auf die Flügelansätze und drückt sie nach oben (Aufschlag) beziehungsweise nach unten (Abschlag). 1 Indirekter Flügelantrieb Aufgabe 1 Erkläre anhand von Bild 1 oder eines selbst gebauten Modells, wie die Flügel aktiv nach unten und oben bewegt werden. Für Bastler: Mit einem Joghurtbecher, 4 Büroklammern und einem Heftapparat kann man sich ein Modell des indirekten Flügelantriebs bauen. Online-Angebot: Hier kannst du dir bei Bastelproblemen Tipps holen. Kleine Insekten müssen die Schlagzahl erhöhen. Größere Insekten wie der Kohlweißling benötigen nur Flügelschläge pro Sekunde für eine Fluggeschwindigkeit von 15 km in der Stunde. Kleinere Insekten aber haben auch kleinere Tragflächen, die pro Schlag weniger Vortrieb erzeugen. Sie können nur dann eine brauchbare Fluggeschwindigkeit erreichen, wenn sie die Schlagzahl erhöhen. Messungen bei Bienen zeigen, dass sie mit bis zu 200 Flügelschlägen pro Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 30 km in der Stunde kommen. Stechmücken schaffen mit einer Schlagzahl von 500 noch 1,5 km in der Stunde. Den Rekord hält eine winzige Mückenart mit über 1000 Flügelschlägen pro Sekunde. Da ein Nerv nur eine begrenzte Anzahl Befehle pro Sekunde an einen Muskel übermitteln kann, war es lange ein Rätsel, wie solche hohen Schlagzahlen zustande kommen. Heute weiß man, dass der elastische Brustabschnitt durch die Tätigkeit der Flugmuskeln in Schwingungen gerät und dadurch abwechselnd an den Flugmuskeln zieht. Jedes Ziehen bewirkt eine Muskelaktion und damit eine Flügelbewegung, ohne dass dazu ein Nervensignal notwendig ist. Während die Flügel so eine extrem schnelle Schlagbewegung ausführen, können sie von anderen Muskeln in aller Ruhe verstellt werden. Das ermöglicht dem Insekt, vorwärts-, seitwärts- und sogar rückwärtszufliegen sowie in der Luft zu stehen. 2 Admiral, ein Wanderfalter aus dem Süden Insekten als Langstreckenflieger. Viele Insektenarten unternehmen in ihrem Lebensraum nur kurze Flüge. Honigbienen haben beim Sammeln von Nektar und Pollen schon einen Aktionsradius von 8 km ( Seite 92). Vor allem Schmetterlinge ( Seite 72) legen aber Entfernungen zurück, die denen von Zugvögeln entsprechen: Distelfalter und Admiral zum Beispiel sind Wanderfalter, die im Frühjahr, von Italien kommend, die Alpen überqueren und weit nach Norden fliegen, teilweise bis nach England. Die weitesten und spektakulärsten Wanderungen unter den Insekten unternimmt jedoch der Monarchfalter. Jedes Jahr fliegen über 100 Millionen Falter aus dem südöstlichen Kanada nach Mexiko, um dort zu überwintern. Danach fliegen sie in die Golfregion, legen dort ihre Eier ab und sterben. Die nächste Generation wandert wieder ein Stück weit nach Norden, die nächste ebenfalls, bis schließlich die vierte oder fünfte Generation wieder Kanada erreicht. Während ihrer Wanderungen steigen sie in Höhen von 1000 m auf und legen bis zu 130 km pro Tag zurück. Wenn möglich, lassen sie sich dabei kräftesparend vom Wind tragen. Trotzdem müssen sie immer wieder glucosehaltigen Nektar aufnehmen, um den hohen Energieverbrauch auszugleichen. Zur Orientierung verwenden die Falter vermutlich die Sonne, vielleicht auch das Magnetfeld der Erde. Aufgabe 2 Ermittle mithilfe eines Atlas die von den beschriebenen Wanderinsekten zurückgelegten Entfernungen. 3 Monarchfalter im Überwinterungsgebiet
15 80 Wirbellose Tiere Insekten sind die vielseitigsten Nahrungsnutzer 1 bis 7 Ernährungsvielfalt bei Insekten Nichts, was nicht gefressen werden könnte. Es gibt kaum eine Nahrungsquelle, die nicht in irgendeiner Weise von einer Insektenart für ihre Ernährung genutzt wird. Manche sind Jäger oder Aasfresser. Pflanzenfresser leben von Samen, schneiden Stücke aus Blättern oder Früchten oder nagen an Wurzeln. Pflanzensaftsauger stechen die Leitbündel an und zweigen Zuckerlösung für sich ab. Auch Blutsauger sitzen direkt an der Quelle und sparen sich so viel Verdauungsarbeit. Kotfresser nutzen die schlechte Futterverwertung großer Säugetiere aus. Viele Arten sind Nektartrinker und Pollenfresser, andere verwerten Holz. Die Entwicklung zu der hier nur angedeuteten Ernährungsvielfalt begann vor weit über 300 Millionen Jahren mit der Entstehung effektvoll arbeitender Fresswerkzeuge. Überflüssige Beine werden zu Mundwerkzeugen. Anfangs besaßen die Gliederfüßervorfahren nur eine Mundöffnung ohne zusätzliche Kiefer oder Lippen für die Nahrungsaufnahme. Im Lauf der Zeit aber übernahmen die mit der Kopfbildung ( Seite 68) überflüssig gewordenen Laufbeine der vorderen Segmente das Festhalten, die Aufnahme und die Zerkleinerung von Nahrung. Aus diesen drei Beinpaaren entstanden so allmählich überaus wirksame Mundwerkzeuge. Neben dem Flugvermögen waren die Mundwerkzeuge entscheidend für den Erfolg der Insekten. Vom Allesfresser zum Spezialisten. Zu Beginn der Landbesiedlung ernährten sich die Insekten noch hauptsächlich von vermodernden Algenresten im Uferbereich. Die ersten Fraßspuren an Landpflanzen finden sich an einem etwa 300 Millionen Jahre alten Farnwedelfossil. Sie zeigen, dass es damals schon Insekten gab, die in der Lage waren, derbere pflanzliche Nahrung zu knacken. Mit dem Auftreten zahlreicher Samenpflanzen (Blütenpflanzen) und etwas später auch von Säugetieren ( Seite 61) vor etwa 130 Millionen Jahren änderte sich die Situation. In kurzer Zeit entstanden Arten, die das neue Nahrungsangebot nutzen konnten und sich im Lauf der Zeit immer mehr auf eine der Nahrungsquellen spezialisierten. Die ursprünglichen kauend-beißenden Mundwerkzeuge wurden dabei je nach Ernährungstyp teilweise so stark abgewandelt, dass sie kaum wiederzuerkennen sind. Bei pflanzen- und fleischfressenden Insekten wurde dagegen die Ausgangskonstruktion bis heute fast unverändert beibehalten. 1 Benenne die Insekten auf den Fotos und beschreibe, wie sie sich ernähren. 2 Erkläre genau, in welcher Weise die beschriebenen Ernährungsweisen von Insekten positive oder negative Auswirkungen für den Menschen haben können.
16 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 81 Unterlippe Oberlippe Oberkiefer Stech- Saugzange (Ameisenlöwe) Unterkiefer Tupf- und Saugrüssel (Stubenfliege) Rüssel (Haselnussbohrer) Stech- Saugrüssel (Stechmücke) 1 Grundbauplan eines Insekts mit kauend-beißenden Mundwerkzeugen sowie Abwandlungen davon Eine solide Konstruktion für feste Nahrung. Unter der lappenförmigen Oberlippe liegen die kräftigen Oberkiefer, die wie eine Kneifzange zum Abbeißen der Nahrung dienen. Die kleineren Unterkiefer darunter werden vor allem zum Festhalten und Zerkleinern der Nahrung genutzt. Die Unterlippe durch Verschmelzen von zwei Beinen entstanden hilft als klappenartig beweglicher Abschluss des Mundraums die zerkleinerte Nahrung in den Schlund zu schieben. Die paarigen Kiefer- und Lippentaster sind Neubildungen und besitzen Sinneszellen zur Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Sie dienen zum Erkennen und Prüfen der Nahrung. Am Grund des Munds befindet sich eine Zunge, über die Speichel ausgeschieden wird. Ein Saugrohr für leicht 2 Kauend: Heuschrecke zugängliche Flüssigkeiten. Leicht zugängliche Flüssignahrung wie Nektar, Urin, Tränenflüssigkeit und die Flüssigkeiten aus faulendem Obst oder verwesenden Kadavern werden mithilfe von Saugrohren ge 3 Saugend: Schmetterling schlürft. In den verschiedenen Insektengruppen ist diese Ernährungsweise mehrfach unabhängig voneinander entstanden. Dabei wurden jeweils unterschiedliche Teile der Mundwerkzeuge für die Saugrohrkonstruktion genutzt. Bei Schmetterlingen beispielsweise besteht der Rüssel aus den zwei lang gezogenen Unterkiefern. Stubenfliegen saugen mithilfe der Unterlip pe, die gleichzeitig auch als Tupfer dient. Bienen können zwar mit dem Oberkiefer noch zubeißen und Wachs kneten, besitzen aber auch einen Trinkhalm für Nektar, der von Unterkiefer und Unterlippe gebildet wird. Flüssige Nahrung erbohren. Auch das Erbohren ist mehrfach vermutlich als Weiterentwicklung des einfachen Aufsaugens in verschiedenen Insektengruppen entstanden. Bremsen schneiden dazu zuerst mit den gezähnten Oberkiefern ein Loch in die 4 Tupfend-saugend: Stubenfliege 5 Bohrend : Bremse Haut des Opfers. Dann bohren sie mit den verlängerten hakenbesetzten Unterkiefern einen Kanal in das Gewebe und saugen mit einer Röhre aus Oberlippe und Zunge das austretende Blut auf. Bei Stechmücken bildet die Unterlippe ein Futteral für die nun borstenförmig geformten Schneid- und Stechwerkzeuge. Damit der feine Stichkanal nicht sofort verschlossen wird, pumpen sie gerinnungshemmenden Speichel in die Öffnung, was den typischen Juckreiz erzeugt. Ganz ähnlich funktionieren die stechend-saugenden Mundwerkzeuge der Bettwanze und anderer Wanzenarten ( Seite 74). Evolution kennt keine Pause: Falter als Blutsauger. Unter den Schmetterlingsarten gibt es eine Handvoll Ausreißer, die ihren Rüssel als Stechwerkzeug zum Blutsaugen einsetzen. Vermutlich handelt es sich um eine ziemlich junge Erfindung, deren Entstehen sich anhand verschiedener Übergangsformen nachvollziehen lässt: Viele tropische Nachtfalter ernähren sich vom Saft beschädigter Früchte. Andere kratzen bereits mit ihrem Rüssel weichhäutige Früchte auf und saugen den austretenden Saft auf. Bei verschiedenen Arten ist der Rüssel schon so stabil und mit kleinen Zähnchen ausgestattet, dass sie auch dickere Fruchtschalen zu durchstoßen in der Lage sind. Man kann sich daher vorstellen, dass solche Falter in einem nächsten Schritt auch die Haut von Säugetieren durchbohren und Blut saugen können.
17 82 Wirbellose Tiere Nachgehakt: Blutsaugende Insekten als Parasiten und Krankheitsüberträger NACHGEHAKT Flöhe. Flöhe eine eigene Insektenordnung haben im Lauf ihres parasitischen Daseins die Flügel zurückgebildet und dafür das Sprungvermögen ( Seite 76) verbessert. Sie sind je nach Art etwa 2 5 mm lang und haben sich auf verschiedene Wirte spezialisiert. Daher werden sie beispielsweise als Hunde-, Katzen-, Ratten- oder auch Menschenfloh bezeichnet. Sie halten sich normalerweise nur zum Blutsaugen auf ihrem Wirt auf und suchen nach ihrer Mahlzeit geeignete Verstecke auf. Menschenflöhe legen ihre bis zu 450 Eier in Bodenritzen ab. Die Larven ernähren sich von ausgeschiedenen Blutresten ihrer Eltern. Die Flöhe können beim Blutsaugen das Pestbakterium 1 Floh, Mikrofoto übertragen. Läuse uralte Weggefährten des Menschen. Läuse leben als blutsaugende Parasiten ständig auf ihren Wirten, auf die sie sehr stark spezialisiert sind. Sie messen zwischen 0,5 und 5 mm und sind flügellos. Unsere Läuse sind die Kopflaus, die Scham- oder Filzlaus und die Kleiderlaus. Die Kopflaus lebt im Kopfhaar, die Kleiderlaus in den Kleidern und die Schamlaus in der Schambehaarung. Ihre bis zu 90 Eier kleben die Weibchen mithilfe eines Spezialklebers an den Haaren fest. Nach dem Schlüpfen ernähren sich auch die Larven durch Blutsaugen. Kopfläuse werden am einfachsten und wirkungsvollsten mit einem insektizidhaltigen Shampoo bekämpft, das in Apotheken erhältlich ist. Läuse können auch verschiedene Krankheiten übertragen. Dazu gehört zum Beispiel das Fleckfieber (Übertrager: Kleiderlaus), an dem vor allem in Kriegszeiten schon viele Menschen gestorben sind. Stechmücken als Malariaüberträger. Die Mahlzeiten, die unsere heimischen Stechmückenarten an uns einnehmen, sind bis auf den lästigen Juckreiz harmlos. Eine nahe Verwandte unserer Stechmücke aber, die Fiebermücke Anopheles, überträgt durch Blutsaugen den Erreger der Malaria, eine der gefährlichsten Tropenkrankheiten. Schätzungsweise treten jedes Jahr über 100 Millionen neue Krankheitsfälle auf, die für etwa 2 Millionen Menschen tödlich verlaufen. Die Erreger der Malaria sind eukaryotische Einzeller ( Seite 39), Plasmodien genannt, die nach der Übertragung vor allem in rote Blutkörperchen ihrer Wirte eindringen. Dort ernähren sie sich vom roten Blutfarbstoff Hämoglobin und vermehren sich, bis die Blutkörperchen zerfallen. Dabei werden die Abfallstoffe der Plasmodien frei, die dann die lebensgefährlichen Fieberanfälle auslösen. Beim Blutsaugen kann die 3 Fiebermücke Anophelesmücke von einem erkrankten Menschen Erreger aufnehmen, die sich in der Mücke weiterentwickeln, bis sie wieder durch Stechen auf einen neuen Wirt übertragen werden. Da die Erreger für ihre Entwicklung in der Stechmücke eine Temperatur von mehr als 16 C benötigen, kommt die Malaria vor allem in wärmeren Zonen vor. Die Malaria spielte aber früher auch in den Küstengebieten Westund Mitteleuropas, also auch in Deutschland, eine Rolle. Tsetsefliegen übertragen die Schlafkrankheit. Durch Blutsaugen übertragen einige Stechfliegenarten in den tropischen und subtropischen Regionen Afrikas die Erreger der Schlafkrankheit. Sie leben im Blut der befallenen Wirte. Ihre giftigen Abfallstoffe lösen schwere Fieberanfälle sowie Erschöpfungszustände mit starkem Schlafbedürfnis aus und führen häufig zum Tod. Von der Erkrankung sind nicht nur Menschen, sondern auch die für die Bevölkerung wirtschaftlich wichtigen Viehbestände betroffen. 2 Laus, Mikrofoto 4 Tsetsefliege, die Überträgerin der Schlafkrankheit 1 Menschenflöhe treten heute nur noch sehr selten auf. Welche Ursachen könnten das bewirkt haben? Erkläre! 2 Im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt und der zu erwartenden Klimaveränderung muss mit einem verstärkten Auftreten von Malaria, auch in Deutschland, gerechnet werden. Erkläre, wie man zu dieser Aussage kommt. 3 Erkläre, welche Folgen die Zerstörung der roten Blutkörperchen für Malariakranke hat.
18 Lexikon: Pflanzenfressende Insekten und ihre Spuren Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 83 Blattfresser: Insekten, die an Blättern fressen, verursachen dabei ganz typische Fraßbilder. Besonders häufig findet man den Fensterfraß von einer Blattseite aus, bei dem noch ein dünnes Häutchen stehen bleibt, und den Lochfraß, wie ihn zum Beispiel die Raupen des 1 Lochfraß der Kohlweißlingraupen Kohlweißlings an Kohlblättern verursachen. Die winzigen Larven verschiedener Käfer- und auch Schmetterlingsarten, zum Beispiel die der Kastanienminiermotte, fressen dagegen Gänge ( Minen ) im Blattinnern, die sich von außen hell gegen das übrige Blatt abheben. Holzfresser: Die Larven einiger Insektenarten, wie beispielsweise der Holzwespen und vor allem der Borkenkäfer, sind gefürchtete Forstschädlinge, da sie unter der Rinde oder im Holz geschwächter Bäume fressen. Der nur 5 mm große Fichtenborkenkäfer 4 Fichtenborkenkäfer und seine ebenso kleine Larve können bei Massenbefall ganze Fichtenforste zum Absterben bringen. Wie Säugetiere bei der Verwertung von Zellulosemolekülen sind auch holzfressende Insekten auf Teamwork mit Symbionten oft im Darm lebende Bakterien angewiesen. LEXIKON Gallen: Besonders raffiniert gehen Insektenarten wie die Eichengallwespen vor. Die Weibchen legen ihre Eier mithilfe einer Legeröhre ins Blattgewebe ab. Durch vom Ei abgegebene Stoffe wird eine Wucherung des Pflanzengewebes ausgelöst, 2 Eichengallwespe Galle genannt. Die sich darin entwickelnden Larven sind geschützt und ernähren sich vom Gewebe der Galle. Gallbildende Insektenarten sind meist auf eine Pflanzenart und hier auf bestimmte Pflanzenteile spezialisiert. Fruchtfresser: Ähnlich wie die Gallwespen sorgen auch andere Insektenarten für ihre Brut. Der Apfelwickler, eine Schmetterlingsart, legt seine Eier auf die sich entwickelnden Früchte des Ap felbaums. Bald nach dem Schlüpfen bohren sich die Raupen in den Apfel und ernähren sich vom Fruchtgewebe. 3 Raupe des Apfelwicklers 5 Fraßgänge des Fichtenborkenkäfers unter der Rinde 1 Säugetiere und Vögel betreiben Brutpflege. Das Verhalten von Apfelwickler oder Eichengallwespe bezeichnet man dagegen als Brutfürsorge. Erkläre, worin die Gemeinsamkeit beider Verhaltensweisen besteht und welcher Unterschied zu der unterschiedlichen Bezeichnung geführt hat. Formuliere eine Definition für den Begriff Brutfürsorge. 2 Beschreibe, wie pflanzenfressende Säugetiere das Zelluloseproblem lösen. 3 Einige Insektenarten sind absolute Nahrungsspezialisten, andere Arten eher Generalisten mit einem breiten Nahrungsspektrum. Beschreibe Vor- und Nachteile, die mit diesen beiden Ernährungsformen verbunden sind. Aufgabe für Profis 1 Manche holzfressenden Insektenarten besitzen keine zellulosespaltenden Darmbakterien, wie man eigentlich erwarten würde. Stattdessen findet man in ihren Gängen im Holz ein dichtes Geflecht von Pilzfäden, die von den Insekten angesät wurden. Wie würdest du diese Beobachtung erklären?
19 84 Wirbellose Tiere Spezielle Verhaltensweisen verbessern den Fortpflanzungserfolg 1 Kaisermantel, ein einheimischer Tagschmetterling Partner suchen und erkennen. Bei den meisten Insektenarten betreiben die Männchen eine energieaufwendige Partnersuche. Sie orientieren sich dabei wie der Kaisermantel ( Bild 1) an optischen Signalen, also an der Farbe und Zeichnung der Weibchen, aber auch an chemischen Signalen, die in Form von Duftstoffen ( Seite 71) von den Weibchen abgegeben werden. Das unterschiedliche Verhalten von Männchen und Weibchen kann man mit dem Kosten-Nutzen-Prinzip erklären. Für Männchen gilt: Je mehr paarungsbereite Weibchen es findet, desto mehr Nachkommen hat es. Männchen investieren also Energie in die Suche nach möglichst vielen Partnerinnen. Weibchen investieren dagegen viel Energie in die Eizellen. Für ihren Fortpflanzungserfolg kommt es darauf an, einen Partner mit möglichst vorteilhaften Eigenschaften zu finden. Partner überzeugen Partner auswählen. Meist sind die Weibchen nur zur Paarung bereit, wenn ein Männchen bestimmte Verhaltensweisen zeigt. Dieses Balzverhalten ist nicht nur eine freundliche Einladung der Männchen an die Weibchen, sondern gleichzeitig auch ein Qualitätstest. Nur wenn ein Männchen durch Geschenke, Körpergröße, Wendigkeit und Ausdauer bei Flugmanövern oder ein ausgeprägt farbenprächtiges Balzkleid genügend vorteilhafte Eigenschaften signalisiert, wird es vom Weibchen ausgewählt. Ähnlich wie bei Säugetieren finden auch bei manchen Insektenarten, zum Beispiel dem Hirschkäfer, Rivalenkämpfe statt, bei denen sich die Tiere aber nicht ernsthaft attackieren. Nachgehakt: Partnererkennung beim Kaisermantel Zur Fortpflanzungszeit sind die Männchen des Kaisermantels auf der Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Ist ein Weibchen in der Nähe, fliegen sie es gezielt an. Da Männchen und Weibchen nahezu gleich groß sind (6 7 cm) und sich im Aussehen nicht unterscheiden, stellte sich die Frage, an welchen optischen Signalen die Männchen die Weibchen erkennen. In einem Experiment bot man suchenden Männchen vereinfachte Nachbildungen von Weibchen an und beobachtete, welche Merkmale dieser Attrappen das Anflugverhalten auslösten. Experiment 1 22 cm 2 20 Zahl der Anflüge Experiment cm cm cm cm Rivalenkämpfe beim Hirschkäfer 1 Was sollte mit dem Experiment 1, was mit dem Experiment 2 untersucht werden? 2 Wie kann man die Ergebnisse von Experiment 1 und 2 interpretieren? 3 Erkläre, welchen Vorteil Attrappenversuche bieten. 4 Anhand von welchem einfachen Signal könnte ein suchendes Männchen schnell Weibchen und Männchen unterscheiden? Erkläre!
20 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 85 1 Paarungsrad zweier Federlibellen. Auch beim Fliegen bleiben sie gepaart. Paarung und Befruchtung. Wenn ein Männchen von einem Weibchen als Fortpflanzungspartner akzeptiert wird, kommt es zur Paarung. Da Insekten Landtiere sind, haben sie eine innere Befruchtung. Die Spermien werden in den Körper der Weibchen übertragen bei Libellen sogar im Flug. Bei den meisten Insektenarten werden sie zuvor sicher in kleine Behälter verpackt. Die Fähigkeit, Spermien auf diese Weise an den Partner zu übergeben, findet man auch bei wasserlebenden Gliederfüßern, sodass man annimmt, dass sie bereits bei den ursprünglichen Gliederfüßern vorhanden war. Eier versorgen und schützen den Embryo. Nach der Befruchtung erfolgt die Eiablage. Bei manchen Insektenarten wie bei der Sandwespe legen die Weibchen nur 10 Eier, Kohlweißlingweibchen legen bis zu 600 und Fruchtfliegen bis zu 3000 Eier. Die Eier entsprechen wie Vogeloder Reptilieneier jeweils einer Riesenzelle, die alle für die Entwicklung des Embryos nötigen Stoffe enthält. Sie sind von einer widerstandsfähigen Schale umgeben, an deren Innenseite bei fast allen Arten eine dünne Wachsschicht aufgelagert ist. 1 Während der Fortpflanzungszeit kann man bei manchen Insektenarten beobachten, dass die Männchen bestimmte Plätze gegen andere Männchen verteidigen. Erkläre den biologischen Sinn dieses Verhaltens. 2 Grillenmännchen locken durch ihren Gesang paarungsbereite Weibchen an. Passt diese umgekehrte Rollenverteilung mit der Kosten-Nutzen-Theorie zusammen? Erkläre! 3 Welche Stoffe müssen in Insekteneiern enthalten sein? Begründe deine Ansicht. 4 Welche Aufgabe hat vermutlich die Wachsschicht auf der Innenseite? Erkläre! 5 Wie würdest du die sehr unterschiedlichen Eizahlen bei Insekten erklären? 6 Erkläre, wie die Fähigkeit der Insektenvorfahren, Spermien in Behältern zu übergeben, die Landbesiedlung erleichtert haben könnte. Mehr Chancen durch Brutfürsorge und Brutpflege. Die Weibchen vieler Insektenarten legen ihre Eier an Stellen mit ausreichend Feuchtigkeit ab. Außerdem können sie die Überlebenschancen ihrer Nachkommen verbessern, indem sie die Eier an Orten ablegen, an denen das Gelege vor Feinden besonders gut geschützt ist. Die ausschlüpfenden Larven haben natürlich auch dann mehr Überlebenschancen, wenn die Eier an Plätze gelegt werden, an denen die Junglarven die von ihnen benötigte Nahrung finden. Insekten mit pflanzenfressenden Larven wie Kohlweißling oder Schwalbenschwanz können das durch Eiablage an der Nahrungspflanze erreichen ( Seite 83). Jäger wie die Sandwespe graben Höhlen und legen darin einen Nahrungsvorrat für ihre fleischfressenden Larven an. Dazu tragen sie Beutetiere ein, die sie mit Gift bewegungsunfähig gemacht haben ( Seite 88). Diese Art Vorsorge für die Nachkommen, die sich auf Maßnahmen vor und bei der Eiablage beschränkt, bezeichnet man als Brutfürsorge. Es gibt allerdings auch Insektenarten mit Brutpflege. Totengräberkäfer erleichtern ihren Nachkommen die Nahrungsaufnahme, indem sie Aas vorverdauen und diesen Nahrungsbrei dann den bettelnden Larven auswürgen. 2 Brutfürsorge beim Kohlweißling. Die schlüpfenden Raupen finden sofort die geeignete Nahrung. 3 Brutpflege beim Totengräber. Das Weibchen verdaut Aas vor und füttert dann damit die Larven. Aufgabe 7 Welches Fortpflanzungsverhalten würdest du von einer Bienenart erwarten, die als Kuckucksbiene bezeichnet wird? Beschreibe ihr Verhalten unter Anwendung des Kosten-Nutzen-Prinzips.
21 86 Wirbellose Tiere Insektenentwicklung verschiedene Wege von der Larve zum erwachsenen Tier funktionsfähig und die Flügel haben ihre volle Größe erreicht und werden entfaltet. Aus der Larve ist das geschlechtsreife Tier entstanden, das auch als Imago oder Vollinsekt bezeichnet wird. 1 Erkläre den Unterschied zwischen einer Larve und einem Embryo. 2 Nenne Wirbeltiere, bei denen eine Verwandlung auftritt, und beschreibe diese. 1 Entwicklung ohne Verwandlung: Silberfischchen Insekten ohne Verwandlung. Silberfischchen ( Bild 1) und Springschwänze gehören sehr alten, flügellosen Insektengruppen an. Bei diesen Insektenordnungen sind die aus dem Ei schlüpfenden Nachkommen den erwachsenen, also geschlechtsreifen Tieren sehr ähnlich. Wegen der chitinhaltigen Cuticula ( Seite 69) erfolgt ihr Wachstum nicht stetig, sondern in Schüben und ist stets mit einer Häutung verbunden. Wenn die Tiere eine bestimmte Größe erreicht haben, werden sie geschlechtsreif und erzeugen Nachkommen, setzen aber Wachstum und Häutungen fort. Flügel erschweren Wachstum und Häutung. Vermutlich verlief die Entwicklung aller Insekten anfangs ähnlich wie bei den Silberfischchen. Mit der Erfindung der Flügel aber änderte sich die Situation: Entfaltete und ausgehärtete Flügel können nämlich nicht mehr durch eine weitere Häutung vergrößert werden. Tiere, deren Flügel verzögert wuchsen und erst gegen Ende der Larvenentwicklung ihre volle Größe erreichten, waren jetzt im Vorteil. Durch solche Änderungen im zeitlichen Ablauf des Entwicklungsprogramms entstanden im Lauf der Zeit zwei andere Formen der Entwicklung bei den Insekten, bei denen eine unterschiedlich starke Verwandlung oder Metamorphose auftritt. Unvollkommene Verwandlung. Nach dem Schlüpfen sind Heuschreckenlarven nur wenige Millimeter groß und ihre Ähnlichkeit mit den erwachsenen Tieren ist unverkennbar. Im Lauf ihrer Entwicklung wachsen sie und durchlaufen mehrere Häutungen. Dabei vergrößern sich die Flügelanlagen zunehmend und auch die anderen Merkmale der erwachsenen Tiere treten mehr und mehr in Erscheinung. Nach der letzten Häutung sind die Fortpflanzungsorgane 2 Unvollkommene Verwandlung: Laubheuschrecke Vollkommene Verwandlung. Der spektakuläre Umbau einer Raupe in einen Schmetterling ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich bei Schmetterlingen und anderen modernen Insektenordnungen wie Käfern oder Zweiflüglern (Fliegen und Mücken) die Entwicklung von der Larve bis zum erwachsenen Tier verändert hat. Die Larven sehen völlig anders aus als die erwachsenen Tiere und ernähren sich wie bei den Schmetterlingen meist ganz anders als diese. Je nach Insektengruppe haben die Larven unterschiedliches Aussehen und werden mit anderen Namen bezeichnet: Larven, die mithilfe von Stummelfüßen kriechen, nennt man beispielsweise Raupen, Larven ohne Beine wie die von Fliegen bezeichnet man als Maden. 3 Schwalbenschwanz, Raupe Aufgabe 3 Beschreibe die Unterschiede zwischen dem Körper einer Raupe und dem des erwachsenen Insekts. Die Larven, ob Made oder Raupe, fressen, wachsen und unterziehen sich einer Reihe von Häutungen, behalten dabei aber ihr anfängliches Aussehen unverändert bei. Äußerlich sind keine Flügelanlagen zu erkennen, da sie in kleine, nach innen gerichteten Taschen eingesenkt sind. Dadurch sind die Flügel von den Häutungen der Außenhülle abgekoppelt und können sich ungestört entwickeln. Dieser Entwicklungsabschnitt im Leben eines Insekts mit vollkommener Verwandlung kann je nach Art einige Tage, aber auch wie bei Maikäfern mehrere Jahre andauern.
22 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 87 1 Ältere Raupe 2 Puppe 3 Schwalbenschwanz, Vollinsekt Wenn die Larven eine bestimmte Größe erreicht haben, suchen sie ein geeignetes Versteck für den letzten Abschnitt ihrer Verwandlung auf. Schmetterlingsraupen produzieren mithilfe spezieller Drüsen Seidenfäden und heften sich mit diesen an der Unterlage fest ( Bild 1). Manche Arten wie der Seidenspinner spinnen sich völlig in einen Kokon aus Seide ein. Danach kommt es im Schutz der Cuticula zu einem starken Umbau der äußeren Gestalt, der mit einer Häutung abgeschlossen wird. Dabei bilden sich beispielsweise die insektentypische Körpergliederung, die Gliedmaßen, die Fühler, teilweise die Mundwerkzeuge und die Flügel. Das Insekt hat jetzt ein Entwicklungsstadium erreicht, das als Puppe bezeichnet wird. Die Puppe nimmt keinerlei Nahrung auf und ist bewegungsunfähig. In ihrem Innern findet ein tief greifender Umbau an Darm, Tracheen, Nervensystem und Sinnesorganen statt. Beim Schwalbenschwanz dauert das Puppenstadium je nach Tageslänge und Temperatur bis zu mehreren Monaten (Überwinterung als Puppe). Danach sprengt das Tier die Puppenhülle, entfaltet die Flügel und startet als flugfähiges Vollinsekt in den letzten Lebensabschnitt, der mit der Erzeugung von Nachkommen endet. 1 Welchen Vorteil hat die Gestalt einer Raupe? Erkläre! 2 Typisch für die vollkommene Verwandlung ist die unterschiedliche Lebensweise und Ernährung von Larve und Imago. Könnte das mit ein Grund für das Entstehen dieser Entwicklungsform gewesen sein? Erkläre! Nachgehakt: Steuerung der Insektenentwicklung Die verblüffende Veränderung während des Puppenstadiums wird seit Langem intensiv untersucht. Wissenschaftler führten folgenden Versuch durch: Einige Tage vor der Verpuppung einer Schmetterlingsraupe schnürten sie diese mit einem Faden zwischen Brust und Hinterleib so stark ein, dass kein Blut mehr aus der vorderen in die hintere Körperhälfte gelangte. Als Folge verpuppte sich nur der vordere Teil. Spritzte man jedoch dem abgeschnürten Hinterleib Blut aus der vorderen (verpuppten) Körperhälfte ein, verpuppte er sich ebenfalls. Aufgabe 3 Was konnten die Wissenschaftler aus dem Schnürungsexperiment folgern? Begründe! Die Entwicklung der Insekten wird von zwei Hormonen gesteuert. Eines der Hormone wird von einer Drüse im Gehirn produziert. Es wird Juvenilhormon genannt (von lateinisch iuvenilis: jugendlich), da es die Ausbildung der Erwachsenenmerkmale verzögert und das Verbleiben im Larvenzustand bewirkt. Ecdyson, das andere Hormon (von griechisch ekdysis: Herauskriechen) wird im Brustabschnitt gebildet und löst Häutungen aus. Solange beide Hormone in bestimmtem Mengenverhältnis vorhanden sind, erfolgen Häutungen und die Larve wächst. Wenn die Konzentration an Juvenilhormon unter einen bestimmten Wert sinkt, wird eine Häutung in Gang gesetzt, die zur Bildung der Puppe und damit zur Metamorphose führt. 4 In einem Experiment wurde einer noch kleinen Larve die Juvenilhormondrüse entfernt. Welche Auswirkung auf die weitere Entwicklung der Larve erwartest du? Begründe! 5 Welche Folgen hätte die Entfernung der Ecdysondrüse bei einem frühen Larvenstadium? 6 Ordne den Begriffen Ei, Larve, Puppe, Imago die Begriffe Fress- bzw. Wachstumsstadium, Vermehrungsstadium, Verbreitungsstadium und Umwandlungsstadium zu. Begründe!
23 88 Wirbellose Tiere Verhalten kluge Programme und individuelle Erfahrung Tiere können daher nicht wie Automaten programmiert sein, sondern besitzen auch die Fähigkeit, ihr Verhalten zweckmäßig an neue Situationen anzupassen. Die Erfahrungen, die sie dabei machen, können sie in ihrem Gedächtnis speichern und nutzen. Ein Hund beispielsweise lernt auf diese Weise sehr schnell, wie er sich verhalten muss, um eine Belohnung zu bekommen. 1 Eine Sandwespe hat eine Raupe erbeutet. Wer sich richtig verhält, überlebt. Dass sich Tiere verhalten und wie sie sich verhalten, kommt uns ganz selbstverständlich vor. Libellen sind eben Jäger und ergreifen Beute im Flug, Gottesanbeterinnen lauern ihren Opfern auf, Schmetterlinge saugen Nektar an Blüten und Sandwespen fangen Raupen als Nahrung für die eigenen Larven. Solche Verhaltensweisen ermöglichen das Überleben und damit auch den Fortpflanzungserfolg eines Tiers. Sie haben sich im Lauf der Evolution von einfachen Anfängen bei Bakterien ( Seite 25) zu immer vielfältigeren Formen entwickelt. Zweckmäßiges Verhalten setzt Wissen voraus. Um Beute zu orten, nutzen Libellen und Gottesanbeterin ihre leistungsfähigen Facettenaugen. Die Sandwespe spürt die Raupen mit dem Geruchssinn auf. Blitzschnell werden im Gehirn der Tiere die eingehenden Informationen ausgewertet und Entscheidungen getroffen. Verhalten besteht aber nicht nur in der schnellen Reaktion auf Informationen der Sinnesorgane. Die Libelle muss wissen, dass sie ihre Beute im Flug erbeutet. Die Gottesanbeterin muss dagegen wissen, dass sie eine Lauerjägerin ist. Und das Sandwespenweibchen muss wissen, dass seine Larven Raupen fressen und dass es diese lähmen und in das Nest schaffen muss. Richtiges Verhalten setzt also auch immer Wissen darüber voraus, was und in welcher Reihenfolge es zu tun ist. Ein Teil dieses umfangreichen, für das Überleben notwendigen Wissens steckt als angeborenes Programm einer Software vergleichbar in den Nervenzellen des Gehirns. Wie die Organe des Körpers, beispielsweise die Mundwerkzeuge, sind auch diese Programme ein Ergebnis jahrmillionenlanger Evolution. Zweckmäßiges Verhalten wird durch individuelle Erfahrung optimiert. Angeborene Verhaltensweisen allein sind jedoch zum Überleben nicht ausreichend. Die jagende Libelle zum Beispiel hat nur dann Erfolg, wenn sie in der Lage ist, die Geschwindigkeit und den Kurs ihres Opfers richtig einzukalkulieren. Die Sandwespe muss bei ihrem lähmenden Stich auch die Gegenwehr der Raupe mit berücksichtigen. Aufgabe 1 Formuliere Definitionen für Lernen und für angeborenes Verhalten. 2 Erkläre, wie in der Evolution Verhaltensprogramme entstehen können. Das Brutpflegeverhalten der Sandwespe. In welchem Umfang das Verhalten von Tieren durch kluge Programme gesteuert wird, wie flexibel sie auf veränderte Situationen reagieren und ob sie Erfahrungen nutzen können, wird seit Jahrzehnten untersucht. Ein bekanntes Beispiel sind die von dem Biologen Baerends um 1940 durchgeführten Versuche zum Brutpflegeverhalten der Sandwespe. Zunächst beobachtete er das Brutpflegeverhalten ( Seite 85) der Sandwespe, das sich in drei Abschnitte unterteilen lässt. Abschnitt 1: Das Weibchen baut in sandigem Gelände in etwa 3 cm Tiefe eine Brutkammer, deren Eingang sie mit Erdklümpchen verschließt. Nach dem Nestbau sucht sie eine Raupe, lähmt diese durch Stiche, transportiert sie zum Nest und legt sie neben dem Eingang ab. Danach öffnet sie die das Nest, kriecht hinein, zieht die Raupe hinein und legt ein Ei auf der gelähmten Raupe ab. Dann verschließt sie das Nest erneut mit einem Erdkrümel. Abschnitt 2: Nach einigen Tagen erfolgt ein erster Inspektionsbesuch, der nur wenige Sekunden dauert. Ist die Larve geschlüpft, schafft die Sandwespe bis zu drei neue Raupen herbei. Dabei verläuft der Vorgang bei jedem Eintragen einer Raupe wie in Abschnitt 1: suchen, lähmen, zum Nest transportieren, ablegen, hineinkriechen, Raupe hineinziehen, verschließen. Abschnitt 3: Nach einigen Tagen erfolgt wieder als Erstes ein Inspektionsbesuch des Nests. Anschließend werden 3 10 Raupen auf die gleiche Weise wie vorher eingetragen. Danach wird das Nest nicht mehr aufgesucht. 2 Die Sandwespe verschließt die Bruthöhle.
24 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 89 natürlicher Boden abnehmbarer oberer Teil unterer Teil Drahtgri Gipsnest Kork 1 Mit einem solchen Kunstnest wurde das Brutpflegeverhalten der Sandwespe untersucht. Störexperimente als Arbeitsmethode. Wie alle Verhaltensweisen von Tieren sieht das Brutpflegeverhalten der Sandwespe glatt und gekonnt aus. Aber weiß die Sandwespe eigentlich, was sie tut? Wonach richtet sie sich bei der Zahl der eingebrachten Raupen? Wie flexibel ist ihr Verhalten? Um solche Fragestellungen zu untersuchen, muss man die für das Verhalten entscheidende Situation manipulieren und beobachten, wie das Tier darauf reagiert. Da Manipulationen an den natürlichen Nestern schwierig durchzuführen sind, arbeitete Baerends mit künstlichen Nestern, die er leicht öffnen konnte. Störexperiment 1. Baerends wollte herausfinden, wie die Sandwespe entscheidet, wie viele Raupen sie nach dem ersten Inspektionsbesuch zu Beginn von Abschnitt 2 einträgt. Entfernte er vor dem Inspektionsbesuch die Sandwespenlarve, wurde keine Raupe mehr eingetragen. Tauschte er eine bereits geschlüpfte Larve gegen ein Ei aus, trug die Sandwespe keine Raupe ein, sondern wartete, bis sie bei der nächsten Inspektion eine geschlüpfte Raupe vorfand. Ersetzte er ein Ei durch eine Larve, wurden dagegen sofort Raupen eingetragen. Entfernte man die Raupen jedoch nach dem Inspektionsbesuch, trug die Wespe nur wenige Raupen ins Nest ein. Tauschte man vor dem Inspektionsbesuch die Sandwespenlarve gegen eine Puppe aus, verließ die Sandwespe das Nest sofort und verschloss es endgültig. 2 Wie entscheidet die Sandwespe, wie viele Raupen sie in Abschnitt 2 in das Nest einträgt? 3 Welche Schlussfolgerung kann man aus dem unterschiedlichen Verhalten der Sandwespe vor und nach dem Inspektionsbesuch ziehen? Begründe! 4 Ist nach den Ergebnissen der verschiedenen Experimente die Bezeichnung Inspektionsbesuch gerechtfertigt? Begründe! 5 Was erwartest du, wenn man nach dem Inspektionsbesuch eine Puppe ins Nest bringt? Begründe! Störexperiment 3. Der Forscher legte um den Nesteingang der Sandwespe einen Kreis von Kiefernzapfen. Nachdem die Wespe das Nest mehrere Male besucht hatte, versetzte er den Zapfenkreis um einige Meter. Er beobachtete, dass die Sandwespe bei ihrer Rückkehr von der Jagd den Nesteingang im Innern des versetzten Zapfenkreises suchte. In einem zusätzlichen Experiment wurden die Kiefernzapfen in Form eines Dreiecks um den Nesteingang platziert und ein Stück weiter ein Kreis aus kleinen Steinchen gelegt. Baerends beobachtete, dass die Sandwespe jetzt den Steinkreis anflog. Aufgabe 1 Welche Schlussfolgerung konnte Baerends aus seinem Störexperiment ziehen? Begründe! Störexperiment 2. Deponierte Baerends vor dem Inspektionsbesuch zu Beginn von Abschnitt 3 zusätzliche gelähmte Raupen im Nest, trug die Wespe weniger Raupen als üblich ein. Deponierte Baerend zusätzliche, gelähmte Raupen nach dem Inspektionsbesuch, trug die Sandwespe genauso viele Raupen ein wie üblich. Entfernte man vor dem Inspektionsbesuch zu Beginn von Abschnitt 3 alle Raupen aus dem Brutnest, brachte die Sandwespe danach mehr neue Raupen zum Nest als gewöhnlich. Das tat sie selbst dann, wenn sie dazu den ganzen Tag oder sogar zusätzlich noch den folgenden Morgen benötigte. 2 Baerends Störexperiment 3 7 Welche Frage untersuchte Baerends mit diesem Experiment? 8 Welche Schlüsse kann man aus den Ergebnissen ziehen? Begründe!
25 90 Wirbellose Tiere Honigbienen bilden einen Superorganismus Das kleinste Haustier des Menschen. Die Wildform unserer Honigbiene stammt ursprünglich aus den Tropen Südostasiens und wurde durch den Menschen über die ganze Welt verbreitet. Honigbiene und Seidenspinner sind die einzigen Insektenarten, die der Mensch als Haustiere nutzt. An Zahl übertreffen dabei die Honigbienen mit geschätzten 3 Billionen alle anderen Haustiere bei Weitem. Phänomen Insektenstaat. Bis zu Honigbienen leben gleichzeitig in einem Bienenstock auf engstem Raum zusammen. Sie sammeln Nektar und Pollen, ziehen gemeinsam Larven groß, verteidigen den Stock und teilen sich viele andere. Nur bei ganz wenigen Tierarten wie Ameisen, Termiten, Wespen und auch Menschen leben vergleichbar viele Individuen in so enger Gemeinschaft zusammen. Zwar ist nur eine kleine Zahl etwa 2 % der Insektenarten Staaten bildend oder sozial, diese Minderheit macht aber über 50 % der Masse aller Insekten auf der Erde aus! Wie solche Staaten in der Evolution entstanden sind, wie sie organisiert sind, wie die Verständigung erfolgt, das sind Fragen, auf die Wissenschaftler mit Hightechmethoden immer neue, immer verblüffendere Antworten und immer wieder auch neue Fragen erhalten. Honigbienen als Superorganismus. Vom Beginn des Lebens auf der Erde an lässt sich immer wieder feststellen, dass durch Verbindung zuvor einzeln lebender Organismen zu einem größeren Ganzen eine neue, höhere Organisationsebene entsteht, die in vieler Hinsicht leistungsfähiger ist. Honigbienen zum Beispiel können gemeinsam als Superorganismus ein riesiges Nahrungsgebiet effizient nutzen. Sie können sich durch Nahrungsvorräte und ihre Bauten von Temperaturschwankungen und den Jahreszeiten ein Stück weit unabhängig machen. Sie können aufwendige Brutpflege betreiben, Feinde wirkungsvoll abwehren und den Superorganismus theoretisch unbegrenzte Zeit am Leben erhalten. Entscheidend für die neuen Fähigkeiten ist die Möglichkeit zur Arbeitsteilung und Spezialisierung auf der neuen, höheren Organisationsebene. 1 Informiere dich bei einem Imkerbesuch, im Internet, oder in einem Lexikon über das Haustier Honigbiene. 2 Beschreibe die in der Evolution aufgetretenen Zusammenschlüsse zu neuen Organisationsstufen. 1 Honigbienen am Einflugloch des Bienenstocks Die Mitglieder des Superorganismus. Honigbienen gehören zur Insektenordnung Hautflügler ( Seite 73) und durchlaufen eine vollkommene Verwandlung ( Seite 86). Als Folge der Arbeitsteilung gibt es bei ihnen mit Königin, Drohne und Arbeiterin drei verschiedene Ausführungen des erwachsenen Insekts. Jede ist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert, an die sie durch Körperbau und Verhalten angepasst ist. Die Königin ist ausschließlich auf die Erzeugung von Nachkommen spezialisiert 2 Königin, vom Imker markiert, mit Hofstaat aus Arbeiterinnen und hat einen vergrößerten Hinterleib, in dem die Eierstöcke Platz finden. Um die Vermehrung zu optimieren, wird sie von einigen Arbeiterinnen, die sie rund um die Uhr umsorgen, ständig mit energie- und proteinreicher Nahrung gefüttert. Nur so kann sie täglich bis zu 2000 Eier produzieren das entspricht ihrem eigenen Körpergewicht! Maximal hält eine Königin die Arbeit als Legemaschine fünf Jahre durch. Sobald sie in ihrer Leistung zu sehr nachlässt, wird sie von den Arbeiterinnen durch eine neue Königin ersetzt. Drohnen sind männliche Bienen, die ebenfalls auf die Erzeugung von Nachkommen spezialisiert sind. Sie entwickeln sich in etwas größeren Brutzellen am Rand der Wabe aus unbefruchteten Eiern. Die Drohnen, von denen nur einige Tausend produziert werden, beteiligen sich nicht an den Arbeiten im Stock. Nach der Fortpflanzungszeit werden sie immer weniger gefüttert, bis sie schließlich verhungern. Arbeiterinnen entwickeln sich wie Königinnen aus befruchteten Eiern. Da sie aber nur kurze Zeit mit einer speziellen Nahrung, der Schwesternmilch, gefüttert werden, reifen ihre Eierstöcke nicht aus. Sie zeigen daher kein Fortpflanzungsverhalten, sondern übernehmen in Arbeitsteilung Tätigkeiten, die ein einzeln lebendes Insekt, beispielsweise eine Einsiedlerbiene (verschiedene Wildbienenarten), sämtlich allein ausführen muss.
26 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 91 Nie durchläuft eine Biene alle Tätigkeiten und die Arbeiterinnen erledigen ihre auch unterschiedlich intensiv. Bei Bedarf kann die zahlenmäßige Verteilung der Bienen auf die verschiedenen Tätigkeiten jederzeit an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden. 1 Zeichne ein Flussdiagramm, das nacheinander die verschiedenen Tätigkeiten einer Arbeiterin zeigt. 2 Im Gegensatz zu allen anderen Insekten sinkt bei Bienenarbeiterinnen die Konzentration von Juvenilhormon ( Seite 86) nicht auf null, sondern steigt mit dem Alter der Biene. Wie würdest du diese Beobachtung erklären? 1 Junge Arbeiterinnen beim Wabenbau Arbeitsteilung nach Lebensalter und Bedarf. Die Arbeiterinnen übernehmen altersabhängig verschiedene Tätigkeiten, was jeweils mit einer Veränderung in Verhalten und Körperbau verbunden ist. Nach dem Schlüpfen kümmern sie sich um Reinigung und Verschließen von Brutzellen. Anschließend füttern sie als Ammenbienen ältere Larven mit proteinhaltigem Pollen und energiereichem Honig. Mit speziellen Drüsen, die für einige Tage aktiv sind, produzieren sie dann die Schwesternmilch und füttern damit die jungen Larven. Einige Bienen übernehmen als Hofstaat die Versorgung der Königin, andere nehmen von den zurückkehrenden Sammelbienen Nektar auf, verarbeiten ihn zu Honig und deponieren ihn in Vorratszellen. Im Anschluss sorgen sie für Hygiene und entfernen Verunreinigungen und tote Artgenossen aus dem Stock. Sodann werden Pollen in Vorratszellen eingestampft und mithilfe nun aktiver Wachsdrüsen Waben gebaut ( Bild 1). Ein Teil der Jungbienen übernimmt danach die Aircondition des Bienenstocks. Diese Heizerbienen lassen ihre Flugmuskeln auf Hochtouren laufen und kuppeln gleichzeitig die Flügel aus. Durch die bei der Muskelarbeit entstehende Wärme regulieren sie die Temperatur im Brutnest auf 35 C. Das ist vor allem für die Verwandlung der Larven wichtig. Da Heizerbienen die energieaufwendige Arbeit nur 30 Minuten durchhalten, gibt es mobile Tankstellenbienen, die sie mit Treibstoff, also Honig, versorgen. Droht Überhitzung, wird Wasser eingetragen und als Film über die Waben ausgebreitet. Die Verdunstung wird durch einen Luftstrom verstärkt, der durch Flügelschlagen erzeugt wird. Einige Tiere arbeiten auch als Wächterbienen am Stockeingang, wo sie die ankommenden Bienen anhand ihres Duftausweises überprüfen. Dann endet das etwa 20-tägige Dasein als Stockbiene. Es beginnt für maximal drei Wochen die Tätigkeit als Sammelbiene. Danach stirbt die Arbeiterin. Waben Bauten mit hoch entwickelter Infrastruktur. Das Nest hat für die Honigbienen vielfältige Bedeutung: Es dient als Schutz- und Ruheraum, als Speicherplatz für Honig und Pollen, es ermöglicht Kommunikation und schafft optimale Bedingungen für die Aufzucht der Nachkommen. All das wird durch den Baustoff Wachs und die raffinierte Wabenbautechnik der Honigbienen erzielt. Die wachsproduzierenden Drüsen der Honigbiene sind keine völlig neuen Organe. Sie sind aus Drüsen entstanden, die bei allen Insekten vorkommen und den wasserundurchlässigen Wachsfilm auf der Cuticula erzeugen. Ein durchschnittliches Nest enthält etwa 5 Waben mit insgesamt Zellen. Das Wachs wird mit größter Präzision zu fugenlos aneinandergrenzenden, sechseckigen Zellen geformt, deren Wände exakt 0,07 mm dick sind. Dabei benutzen die Bienen den eigenen Körper als Schablone und bauen um sich herum zylinderförmige Röhren auf. Dann erhitzen sie die Röhren auf 40 C. Das Wachs beginnt zu fließen und die exakten Sechsecke entstehen wie von selbst. Mit ihren Fühlern können die Honigbienen feinste Nuancen der Wachszusammensetzung unterscheiden und stockfremde Bienen am fremden Wachsgeruch sofort erkennen. Durch eine von Blütenknospen stammende harzartige Substanz, Propolis genannt, erhält das Wachs eine antibakterielle und pilztötende Beschichtung. 2 Mit Pollen beladene Sammelbienen auf der Wabe
27 92 Wirbellose Tiere Honig die Energiequelle für den Superorganismus Der Jahreslauf des Superorganismus. Den Winter überleben die Bienen, indem sie sich dicht zu einer Traube zusammenschließen, in deren Zentrum sich die Königin befindet. Durch Muskelarbeit mit ausgekuppelten Flügeln wird mit dem eingelagerten Honig als Brennstoff eine Temperatur von 25 C im Innern der Traube erzeugt, bei der das Bienenvolk überleben kann. Mit den ersten wärmeren Tagen wird die Temperatur in der Traube auf 35 C erhöht. Die Aufzucht von Larven läuft an. Je mehr Blüten abgeerntet werden können, desto mehr Larven werden aufgezogen, bis das Volk die Maximalgröße von Bienen erreicht hat. Signalstoffe der Königin, die durch gegenseitiges Füttern von den Arbeiterinnen weitergegeben werden, sind dann so verdünnt, dass sie die Arbeiterinnen nicht mehr hemmen, Drohnenzellen und auch fünf bis sechs größere Königinnenzellen zu bauen und so die Fortpflanzungzeit einzuleiten. In den Drohnenzellen entwickeln sich männliche Tiere, in den Königinnen- oder Weiselzellen zunächst normale weibliche Larven. Da diese aber ausschließlich mit der Schwesternmilch gefüttert werden, entwickeln sie sich zu Königinnen, also Weibchen mit voll entwickelten Eierstöcken. Kurz bevor die erste Jungkönigin schlüpft, verlässt die alte Königin mit einem Großteil der Arbeiterinnen den Stock und schwärmt aus, um eine geeignete Wohnhöhle zu finden. Gelingt es dem Imker, den Schwarm jetzt einzufangen, kann er ihn in eine andere künstliche Wohnhöhle, einen Bienenkasten, einsetzen. 1 Der Bienenschwarm wird eingefangen. Sind genügend Arbeiterinnen im alten Stock, kann die erste der geschlüpften Jungköniginnen einen Nachschwarm bilden und ebenfalls den Stock verlassen. Die nächste ausschlüpfende Jungkönigin tötet die übrigen und fliegt dann mit den Drohnen aus dem Stock. Auf diesem Hochzeitsflug paart sie sich mit mehreren Drohnen und nimmt von diesen einen Vorrat von Millionen Spermazellen auf. Diese werden im Körper in einem speziellen Behälter gelagert, in dem sie jahrelang befruchtungsfähig bleiben. Danach kehrt die junge Königin in den Stock zurück und beginnt mit der Ablage von Eiern. Das Bienenvolk versucht jetzt möglichst viel Honig für den Winter einzutragen. Im Herbst vermindert die Königin allmählich ihre Legetätigkeit. Die Arbeiterinnen stellen die Sammelflüge ein. Mit Beginn der kühlen Jahreszeit bildet das Volk wieder die Wintertraube. 2 Bienen beim Honigsaugen auf der Wabe 1 Stelle den Jahreslauf eines Bienenvolks in Kreisform dar. 2 Erkläre den Vorgang, bei dem in den Muskelzellen Wärme gebildet wird. 3 Wie viele Nachkommen hat ein Bienenvolk, wenn man es als Superorganismus betrachtet? Erkläre! 4 Erkläre, warum der Superorganismus während der Überwinterung Trauben- oder Kugelform annimmt. Honig Treibstoff und Heizstoff. Grundlage für die Vermehrung, die Bildung von Tochterschwärmen und das Überleben des Volks ist bei Bienen der energiereiche Honig. Honig wird zur Aufzucht der Larven, als energieliefernder Treibstoff für die Sammelflüge und für die Produktion von Wachs benötigt. Den größten Teil des Honigs aber investiert ein Bienenvolk für Heizzwecke. Dadurch macht es sich bei der Larvenaufzucht weitgehend von Schwankungen der Umgebungstemperatur unabhängig und kann den Winter überleben. Die Bienen stellen Honig aus Nektar her, den sie von Blüten aufnehmen und in einem tankartigen Teil des Darms, dem Sammelmagen, speichern. Nektar enthält verschiedene Typen von Zuckermolekülen, darunter Glucose. Sammelbienen unternehmen pro Tag zwischen drei und zehn Ernteflüge. Wie fleißig sie sind, haben Forscher durch Mikrochips herausgefunden, die sie auf dem Bienenrücken befestigten ( Bild 3). Eine Honigbiene kann bei einem Flug etwa 70 % ihres Eigengewichts, also etwa 40 mg Nektar, transportieren. Unter optimalen Bedingungen könnte ein großes Volk theoretisch 1600 kg Nektar im Jahr eintragen. Die wirkliche Sammelleistung liegt jedoch mit kg deutlich niedriger. 3 Biene mit Mikrochip
28 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 93 weit in großem Maßstab gehalten. Als Haustiere in der Obhut von Imkern erzeugen sie große Mengen an Honig. Viel wichtiger ist jedoch die damit verbundene sichere Bestäubung vieler Millionen Obstbäume und Beerensträucher. Erst sie sorgt ja für die Fruchtbildung und ermöglicht so ertragreiche Ernten. 1 Übergabe von Nektar Bei ihrer Rückkehr pumpt die Sammelbiene den Inhalt ihres Sammelmagens nach oben und übergibt den Nektar an Stockbienen. Diese bieten ihn entweder anderen Stockbienen zum sofortigen Verzehr an, meist aber verarbeiten sie ihn zu Honig. Dabei entziehen sie dem Nektar das Wasser, indem sie ihn zwischen ihren Kiefern hin und her kneten. Durch Enzyme werden größere Zuckermoleküle in kleinere Moleküle zerlegt und das Ganze durch Zusatz chemischer Verbindungen vor Pilz- und Bakterienbefall geschützt. Durch den Wasserverlust halbiert sich die Masse des eingetragenen Nektars etwa um die Hälfte. Aus 2 g Nektar entsteht 1 g Honig, genau die Menge, die in eine Honigvorratszelle passt. Neben dem Nektar werden während der Sommermonate noch etwa 30 kg Pollen gesammelt. Imker und andere Honigdiebe. Der Honigschatz eines Bienenvolks stellt eine sehr energiereiche Nahrungsquelle dar. Im Lauf der Evolution haben daher verschiedene Tiere den Honigdiebstahl als lohnendes Zusatzeinkommen entdeckt. Fremde Bienen oder verwandte Hautflügler, die die Wächterbienen erfolgreich geblufft haben, füllen auf diese Weise die eigenen Honigvorräte auf. Bären oder der afrikanische Honigdachs naschen mit Leidenschaft Honig und vernichten dabei die ganze Wohnhöhle. Vor den Angriffen der Bienen sind sie durch ihre dicke Haut einigermaßen geschützt. Vermutlich haben bereits die Menschen in der Steinzeit den Honig als wohlschmeckende Energiequelle entdeckt. Sie plünderten die Nester allerdings ähnlich rücksichtslos wie Bären und Honigdachse. Erst um 1850 entdeckte man, wie man Bienen in künstlichen Wohnhöhlen hält. Heute werden Bienen welt 2 Imker bei der Wabenentnahme 1 Erkläre die Rolle der Bienen bei der Fruchtbildung. 2 Warum benötigt das Bienenvolk im Winter keinen Pollen? 3 Nach der Honigentnahme im Sommer deponiert der Imker Zuckerlösung im Stock. Erkläre! Honigbienen beherrschen den Nektarmarkt. Ursprünglich wurde der Pollen bei Samenpflanzen durch den Wind übertragen, wie heute noch bei Nadelbäumen, Haseln oder Birken. Im Lauf der Zeit entdeckten Insekten den reichlich produzierten Pollen als Nahrungsquelle. Der dabei erfolgende unbeabsichtigte Pollentransport von einer Blüte zur anderen war auch für die Pflanzen ein Vorteil. Im einsetzenden Konkurrenzkampf um mehr Bestäuber waren diejenigen Pflanzen begünstigt, die durch Abgabe von Zuckerlösung (Nektar) einen Zusatznutzen boten. Duftstoffe und auffallende Blütenblätter waren die nächsten Schritte im Wettbewerb. Gleichzeitig mit den Pflanzen veränderten sich auch die bestäubenden Insekten in der Weise, dass sie immer besser an das Finden und Abernten von Blüten angepasst waren. Die heutige Vielfalt von Blüten und Insekten ist also auch das Ergebnis einer Millionen Jahre langen evolutionären Wechselwirkung zwischen Insekten und Blütenpflanzen, die man als Koevolution bezeichnet. Honigbienen sind heute die wirkungsvollsten Blütennutzer unter den Insekten. Rund 70 % aller Samenpflanzen werden von ihnen besucht und dabei bestäubt. Bei Obstbäumen sind es sogar 90 %. Die Gründe für die beherrschende Marktstellung sind einerseits Merkmale wie geeignete Mundwerkzeuge, Sammelbeine, ausgezeichneter Geruchssinn, Fähigkeit zum Farbensehen ( Seite 71) und hoch entwickeltes Lernvermögen. Andererseits sind für den konkurrenzlosen Sammelerfolg der Honigbiene aber auch ihre Organisation der Zusammenarbeit und ihre einzigartige Kommunikation entscheidend. 1 Welche Vorteile hatten die windblütigen Pflanzen zunächst durch die Insektenbestäubung? Erkläre! 2 Bienen sind blütenstet, das heißt, sie ernten in der Regel die Blüten einer bestimmten Art ab, bevor sie sich der nächsten Nahrungsquelle zuwenden. Welche Vorteile hat dieses Verhalten für die Pflanzen? Welchen Vorteil hat es für die Bienen? Wie könnte es entstanden sein? Erkläre!
29 94 Wirbellose Tiere Kommunikation ermöglicht schnelles Ausbeuten von Nahrungsquellen Nektarsammeln so viel und so schnell wie möglich. Das Nahrungsangebot für Bienen ist in der Natur nicht gleichmäßig und verlässlich. Wenn ein Bienenvolk einen Blütenbestand mit hoher Nektar- oder Pollenproduktion entdeckt hat, muss die Futterquelle möglichst schnell abgeerntet werden, bevor Konkurrenten auftauchen, sich das Wetter verschlechtert oder die Blüten verwelken. Einer der Ersten, der das Sammelverhalten von Honigbienen systematisch untersuchte, war der Münchner Biologe Karl von Frisch ( Seite 71). Er beobachtete, dass nach der Rückkehr von ihm markierter Kundschafterinnen zum Stock in kurzer Zeit immer mehr Bienen desselben Volks an der neuen Nahrungsquelle eintrafen. Er vermutete daher, dass diese Kundschafterbienen auf irgendeine Weise im Stock andere Sammelbienen über die Position der neuen Nahrungsquelle informierten. 1 Karl von Frisch ( ) Kundschafterinnen werben freie Sammelbienen an. Um das Verhalten der Kundschafterinnen beobachten zu können, verwendete Karl von Frisch künstliche Futterquellen und umgebaute Bienenstöcke. Schnell erkannte er, dass die von der neuen Futterquelle zurückkehrenden Kundschafterbienen auf den senkrecht stehenden Waben im Stockinnern intensive, tanzartige Bewegungen durchführten. Beim Schwänzeltanz schiebt die Kundschafterin den Körper gerade nach vorn, wobei sie den Hinterleib schnell hin- und herbewegt ( Schwänzeln ). Dann läuft sie im Halbkreis zurück, schließt erneut eine gerade Schwänzelphase an, läuft in der anderen Richtung im Halbkreis zurück, schwänzelt wieder gerade nach vorn usw. Dieses Verhalten wiederholt sie viele Male. Bis zu zehn beschäftigungslose Sammelbienen tanzen ihr mehrfach nach und fliegen dann aus zu der Futterquelle, von der die Kundschafterin kam. Der gesamte Bewegungsablauf dauert nur wenige Sekunden und spielt sich auf einer sehr kleinen Fläche von 2 4 cm Durchmesser ab. Für von Frisch, der noch nicht die Möglichkeit einer hochauflösenden Zeitlupenaufzeichnung hatte, war die Untersuchung der Tanzsprache sehr schwierig. Nach jahrelanger Forschungsarbeit gelang es ihm aber schließlich, die Art der Nachrichtenübermittlung und den verwendeten Code zu entschlüsseln. Für diese wissenschaftliche Leistung erhielt er 1973 den Nobelpreis. 1 Überlege, welche Informationen über eine neue Futterquelle der Tanz einer Kundschafterin enthalten könnte. 2 Die heimkommenden Kundschafterinnen füttern Sammelbienen mit Nektar. Welche Bedeutung könnte das Verhalten haben? Bei seinen Beobachtungen fiel dem Bienenforscher auf, dass sich die Ausrichtung der Schwänzelstrecke gegenüber der Wabensenkrechten im Lauf des Tages kontinuierlich verschob, obwohl die Bienen die ganze Zeit dieselbe Futterquelle anflogen. Das war für ihn ein entscheidender Hinweis auf den Code der Tanzsprache, der sich auf die Richtungsangabe bezieht. Aufgabe 3 Welche Schlüsse hättest du aus der Beobachtung gezogen? Begründe! 2 Tanzende Biene (Mitte) mit Stockgenossinnen Neue Forschungen. Weltweit wird heute mit modernen technischen Mitteln an Bienen geforscht. Dabei haben beispielsweise Wissenschaftler der Universität Würzburg die Vermutung Karl von Frischs bestätigt, dass auch Vibrationen bei der Kommunikation im Bienenstock eine Rolle spielen. Eine tanzende Kundschafterin erzeugt nämlich durch kurzes Gasgeben mit der Flugmuskulatur (bei ausgekuppelten Flügeln) kurze, intensive Vibrationen der Waben, sodass die Sammelbienen im Dunkel des Nests auf sie aufmerksam werden. Auch weiß man inzwischen, wie die nachtanzenden Sammelbienen die Information aus dem Tanz der Kundschafterin herauslesen: Sie gehen mit ihrem Kopf so nah an den Hinterleib der Kundschafterin, dass ihre Fühler durch deren Bewegungen abgelenkt werden. Aus der Ablenkung errechnet ihr Gehirn die Position der Futterquelle.
30 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 95 Wer entschlüsselt den Code? Experimente und zur Honigbiene Wie wird die Richtung der Futterquelle codiert? Die Bilder rechts zeigen drei verschiedene experimentelle Situationen zur Tanzsprache der Bienen. Dargestellt ist jeweils die Situation im Gelände, das heißt der Bienenstock und die Position der Futterquelle (durch Blütenpflanze symbolisiert). Dazu ist jeweils die Tanzfigur der Kundschafterin auf der senkrecht stehenden Wabe im Stock wiedergegeben. Experiment 1 Aufgabe 1 Versuche einen Zusammenhang zwischen der Position der Futterquelle in der Stockumgebung und dem Verhalten der von dieser Futterquelle zurückgekehrten Kundschafterbienen bei den verschiedenen Experimenten herzustellen. Formuliere den von dir gefundenen Zusammenhang. Süßer = attraktiver? In einem Experiment stellte ein Wissenschaftler in genau entgegengesetzter Richtung, aber exakt gleicher Entfernung zu einem Bienenstock zwei Schalen mit Zuckerlösung als Futterquellen auf. Die Zuckerkonzentration in Schale a betrug 18 g in 0,1 Liter, in Schale b 27 g in 0,1 Liter. Experiment 2 Experiment 3 2 Was genau wollte er mit diesem Experiment testen? 3 Was würdest du erwarten? Begründe! Nach einigen Stunden vertauschte der Forscher die beiden unterschiedich konzentrierten Zuckerlösungen. 4 Finde eine Erklärung für dieses Vorgehen. 5 Was würdest du erwarten, wenn man bei ansonsten gleichen Bedingungen die Entfernung der konzentrierteren Zuckerlösung vom Stock stufenweise vergrößern würde? Begründe! einlagern Stofffluss im Bienenvolk Das Schema rechts zeigt stark vereinfacht die Weitergabe oder den Stofffluss von Nektar, Honig und Pollen in einem Bienenvolk. + 6 Übertrage das Schema in dein Heft. Schreibe die Begriffe aus dieser Wortliste in die passenden Kästchen: Tankstellenbienen, Nektar, Pollen, Honigzellen, Pollenzellen, Nektarabnehmerinnen, Sammelbienen, Ammenbienen, Hofstaat, Königin, Eier, Heizerbienen. 7 Kennzeichne in deinem Schema den Stofffluss von Honig und Pollen im Bienenvolk durch rote (Honig) und grüne (Pollen) Pfeile zwischen den Kästchen. 8 Schreibe jeweils ein passendes Verb, wie zum Beispiel füttern, auf oder neben die gestrichelten Pfeile. Larven 9 Ergänze dein Schema in der gleichen Weise um weitere Begriffe, zum Beispiel: Sonne, Lichtenergie, Blätter, Fotosynthese, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Blüten 10 Überlege dir, in welcher Form die im Nektar beziehungsweise Honig enthaltene Energie den Bienenstock wieder verlässt.
31 96 Wirbellose Tiere Spinnentiere achtbeinige Gliederfüßer Die bis zu 3 m langen Seeskorpione, im Meer lebende Räuber, waren wohl die ersten Spinnentiere. Ihre Fossilien sind etwa 520 Millionen Jahre alt. Spinnentiere sind räuberisch oder parasitisch lebende Gliederfüßer, die sich von den Insekten durch die 4 Beinpaare, die Gliederung in nur 2 Körperabschnitte (Kopfbruststück und Hinterleib) sowie das Fehlen von Fühlern und Flügeln unterscheiden. Die zwei paarigen Extremitäten der Kopfsegmente sind zu klauen- oder scherenartigen Mundwerkzeugen umgewandelt. Trotzdem können Spinnentiere niemals eine Beute stückweise verzehren, da sie nur eine winzige Mundöffnung haben. Alle Arten verdauen die Nahrung außerhalb des Körpers: Sie speien Verdauungsenzyme in das Beutetier hinein und saugen den Brei mit den gelösten Nährstoffen wieder auf. Spinnentiere atmen über Lungen (Fächerlungen) oder über relativ einfach gebaute Tracheen. Wie die Insekten haben sie ein Chitinaußenskelett. 1 Skorpion aus Südeuropa Ordnung Skorpione Skorpione zeigen mit 18 deutlich erkennbaren Körpersegmenten die vollständigste Gliederung aller Spinnentiere. Ihr Aussehen hat sich seit Millionen Jahren so gut wie nicht verändert. Sie zählen zu den ersten Landtieren überhaupt. Bei den heute lebenden Arten setzt der Hinterleib in ganzer Breite an das Kopfbruststück an, die letzten Segmente sind schmal und gut beweglich. Dadurch können Skorpione ihren Giftstachel über den Rücken nach vorn schlagen und so größere Beutetiere, die sie mit den großen Kieferscheren festhalten, durch das Gift töten. Erbeutet werden vor allem Insekten, Spinnen und Tausendfüßer, bei manchen Arten auch kleine Wirbeltiere wie Eidechsen. Nur wenige Skorpionarten sind für den Menschen gefährlich wie der Saharaskorpion, dessen Stich unbehandelt einen Menschen innerhalb von sieben Stunden töten kann. Am meisten durch Skorpionstiche verursachte Todesfälle etwa 100 pro Jahr gibt es in Mexiko. 2 und 3 Kreuzspinne im Netz und Spinnwarzen Ordnung Webspinnen Körperbau. Bei den Spinnen ist anders als bei den Skorpionen der Hinterleib durch einen kurzen Stiel deutlich vom Kopfbruststück abgesetzt. Einzelne Segmente lassen sich äußerlich nicht mehr erkennen. Mit ihren acht Einzelaugen kann die Kreuzspinne nur hell und dunkel unterscheiden. Andere Arten wie die Springspinnen hingegen nehmen mit ihren Linsenaugen Bewegungen, Formen und sogar Farben wahr. Besonders empfindlich sind bei den meisten Spinnen die Tastsinnesorgane, die sich vor allem an den Fußgliedern der Laufbeine befinden. Die Oberkiefer enden in je einer spitzen Klaue, die von einem Giftkanal durchzogen ist. Die Gifte der heimischen Spinnenarten sind für uns völlig harmlos. Nur wenige Arten auf der Welt werden auch dem Menschen gefährlich. So genügen 0,006 g des Nervengifts der südamerikanischen Kammspinne, um eine Maus zu töten. Die Spinne ist ausnahmsweise mit Bananenlieferungen auch schon nach Deutschland gelangt. Die meisten Bisse werden von den etwa 30 Arten der Schwarzen Witwe zugefügt, die auch in Südeuropa beheimatet sind. Die Giftmenge reicht aber normalerweise nicht aus, um einen Menschen zu töten. Vogelspinnen haben nur kleine Giftdrüsen. Bisswunden neigen allerdings zur Infektion und müssen desinfiziert werden. Die Webspinnen stellen ihre Fangnetze oder andere Gespinste wie Wohnröhren oder Eikokons aus Spinnfäden selbst her. Dazu sondern sie ein von Spinndrüsen im Hinterleib abgesondertes Sekret durch feine, auf Spinnwarzen sitzende Spinnspulen ins Freie, wo es erhärtet ( Bild 3). Die Spinnwarzen sind umgewandelte und ans Körperende verlagerte Gliedmaßen von Segmenten des Hinterleibs. Die Spinnfäden der Webspinnen sind noch elastischer und tragfähiger 4 Vogelspinne
32 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 97 als die Seidenfäden der Schmetterlingsraupen. Versuche zur wirtschaftlichen Nutzung wurden mehrfach unternommen. So setzt man sie in der optischen Industrie bei der Herstellung von Fadenkreuzen und Skalenstrichen für Messinstrumente ein. Beutefang. Die Kreuzspinne baut nach einem angeborenen Verhaltensprogramm zum Beutefang Radnetze. Sie benötigt zunächst eine Art Gerüst, einen Rahmen aus Fäden, der an Pflanzen oder an Steinen verankert wird. Innerhalb des Rahmens spannt sie ein dichtes Fadennetzwerk in Form einer Spirale. Die trockenen Fäden werden als Laufsteg benutzt, um dann von außen nach innen die Fangspirale anzufertigen, die aus einem dickeren Faden mit klebrigen Tröpfchen besteht. Alle Hilfsfäden werden wieder aufgefressen. Bei einem Netzdurchmesser von durchschnittlich 18 cm werden etwa m Faden versponnen. Baldachinspinnen sind Fallensteller. Sie bauen waagerechte teppich- oder baldachinartige Netze, unter denen sie mit dem Bauch nach oben lauern. Über dem Netz haben sie ein zartes Gespinst kreuz und quer verlaufender Stolperfäden ausgespannt, das fliegende Insekten leicht zum Absturz bringt. Die Beute wird durch das Netz hindurch gegriffen. Die auf dem Waldboden häufigen schnellen Wolfsspinnen sind Überfalljäger. Manche Arten warten in Erdröhren auf vorbeikommende Insekten. Krabbenspinnen lauern in Blüten. Sie können ihre Körperfarbe dem Untergrund anpassen und sind dadurch gut getarnt. 1 Netz einer Baldachinspinne 2 Krabbenspinne mit erbeuteter Schwebfliege Fortpflanzung. Spinnenmännchen sind wesentlich kleiner als die Weibchen ( Bild 3) und passen damit in deren Beuteschema. Trotzdem ist Kannibalismus bei der Paarung keineswegs die Regel, weil sich bei den Männchen Verhaltensweisen ausgebildet haben, die letztlich zu einer erfolgreichen Begattung führen. Vor allem muss das Männchen sich dem Weibchen zu erkennen geben, um dessen Angriffsverhalten auszuschalten. Bei einigen Arten zupfen die Männchen in bestimmten Rhythmen am Netz der Weibchen, andere richten sich auf und winken oder führen sogar Tänze auf. Jagdspinnenmännchen fangen eine Fliege, spinnen sie ein, stolzieren dem Weibchen 3 Weibchen und Männchen (rechts) der Röhrenspinne entgegegen und überreichen ihm den Kokon als Brautgeschenk. Kompliziert ist auch die Begattungstechnik, da die Männchen keinen Penis besitzen. Sie geben ihr Sperma auf ein winziges Netz ab, nehmen das Sperma mit den Kiefertastern auf und pumpen es in die weibliche Geschlechtsöffnung. Viele Arten betreiben eine intensive Brutpflege. Sie bewachen den Eikokon, Wolfsspinnen tragen ihn und die Jungspinnen sogar am Hinterleib mit sich herum. Ordnung Milben Milben sind nur wenige Millimeter große Spinnentiere mit ungegliedertem Körper. Neben Abfallfressern wie der Hausstaubmilbe, die sich zum Beispiel von Hautschuppen ernährt, sowie Raubmilben gibt es zahlreiche Parasiten an Pflanzen (wie die Spinnmilben) und an Tieren (wie die Varroamilbe an Bienen). Zecken saugen das Blut von gleichwarmen Tieren einschließlich des Menschen. Die Weibchen können das 120-Fache ihres Eigengewichts an Blut aufnehmen. Sie übertragen dabei oft Borrelien (Bakterien, die sich mit Antibiotika behandeln lassen) sowie eine lebensbedrohliche Hirnhautentzündung (FSME = Frühsommer-Meningo-Enzephalitis). Gegen die Viruserkrankung kann man sich nur durch Impfung schützen. 4 Hausstaubmilben, REM 5 Zecke
33 98 Wirbellose Tiere Krebse Gliederfüßer im Lebensraum Krebse haben sich in ihrer 600 Millionen Jahre dauernden Evolution so vielgestaltig entwickelt, dass man ihre Klassenzugehörigkeit oft nur noch anhand der allen Krebsen gemeinsamen Larvenform erkennen kann. Krebse atmen durch Kiemen. Gliedmaßen können an allen Körpersegmenten auftreten und erfüllen je nach Lage und Gestalt verschiedene : am Kopf als Antennen (Fühler) und Kiefer, im Brustbereich als kräftige Scheren und Schreitbeine, am Hinterleib als kleine Hinterleibsbeine, die das Atemwasser nach vorn zur Kiemenregion fächeln. Durch Einlagerung von Kalk ist das Außenskelett krustenartig hart (Krustentiere). Wachstum erfolgt zeitlebens durch Häutungen. Der gedrungene Bau der Krabben rührt daher, dass der kleine Hinterleib unter das Kopfbruststück eingeschlagen ist. Krabben laufen meist seitwärts. Die häufige Strandkrabbe aus der Nordsee wird 6 cm breit, der Taschenkrebs kann sogar eine Breite von 30 cm 3 Strandkrabbe und ein Gewicht von 6 kg erreichen. Der größte bekannte Krebs ist eine Japanische Riesenkrabbe mit einer Beinspannweite von 3,70 m und einem Gewicht von 18,6 kg. 4 Wasserfloh 5 Hüpferling 1 Flusskrebs Zehnfüßige Krebse. Bei allen zehnfüßigen Krebsen sind Kopf und Brust zu einem Stück verwachsen. Mit den kräftigen Scheren ergreifen und knacken sie auch hartschalige Beute. Die Antennen messen die Strömung, fühlen, schmecken und riechen gleichzeitig. Mit gestielten Facettenaugen fixieren die Krebse die Umgebung. Der Flusskrebs, einer der wenigen Süßwasserkrebse, gilt als Delikatesse. Durch eine Pilzkrankheit, Gewässerverschmutzung und Überfischung waren seine Bestände stark dezimiert, beginnen sich aber mancherorts durch Renaturierungsmaßnahmen und Nachzucht wieder etwas zu erholen. Wie bei den bis 50 cm langen Hummern und den Langusten, die beide an felsigen Meeresküsten leben, isst man nur die Muskeln in den Scheren und das Muskelfleisch des Hinterleibs. Garnelen wie die Nordseegarnele kommen der Grundgestalt der Urkrebse am nächsten. Sie gelangen als Krabben oder Shrimps in den Handel. Die Krillkrebse, die in riesigen Schwärmen in den Polarmeeren vorkommen, bilden die Hauptnahrung der Bartenwale und vieler Fische. 2 Nordseegarnele Kleinkrebse aus verschiedenen Gruppen. Mit Größen zwischen 0,25 und 6 mm sind Wasserflöhe die kleinsten Krebse. Sie kommen in allen stehenden Gewässern vor. Zusammen mit den Hüpferlingen bilden sie als Zooplankton die Nahrungsgrundlage für viele Jung- und Kleinfische. Wasserflöhe bewegen sich ruckartig durch kräftiges Schlagen mit den Antennen fort. In einem Brutraum auf der Rückenseite entwickeln sich die Eier. Hüpferlinge tragen Eiersäckchen am Hinterende. Die Kleinkrebse atmen durch die Körperoberfläche. Die etwa 12 mm großen Seepocken finden sich in der Gezeitenzone. Sie sitzen auf Steinen oder Muschelschalen fest, sind also sessil. Mithilfe ihrer zu feingliedrigen Fangarmen umfunktionierten Gliedmaßen filtern sie Plankton aus dem 6 Seepocke Wasser. Ihr Gehäuse setzt sich aus Kalkplatten zusammen. Unter den Asseln gibt es Landbewohner wie die Kellerassel. Als Kiemenatmer sind sie an feuchte Orte gebunden. Sie fressen Falllaub und spielen eine wichtige Rolle als Humusbildner. 7 Kellerassel
34 Insekten und Co. Erfolgsmodelle der Evolution 99 Zusammenfassung! Körperbau und Sinnesorgane Der Körper von Insekten besteht aus Segmenten, die drei Abschnitte (Kopf, Brust, Hinterleib) bilden. Am Brustabschnitt sitzen 3 Bein- und 2 Flügelpaare. Wie alle Gliederfüßer haben Insekten ein Außenskelett (chitinhaltige Cuticula), einen offenen Blutkreislauf mit Röhrenherz und ein Strickleiternervensystem auf der Bauchseite. Sie atmen mithilfe von Tracheen. Wegen des Außenskeletts ist bei ihnen Wachstum mit Häutungen verbunden. Insekten haben hoch entwickelte Sinnesorgane: Facettenaugen, Fühler (Geruchsorgane), Tasthärchen. Fortbewegung Insekten laufen mithilfe ihrer in 4 Abschnitte gegliederten Beine. In manchen Insektengruppen entstanden unter Veränderungen des ursprünglichen Laufbeins neue Bewegungsformen (Springen, Schwimmen). Beim Fliegen werden die Flügel direkt von Muskeln (Libellen) oder indirekt über Verformung des Brustabschnitts bewegt. Ernährung Die Mundwerkzeuge der Insekten sind aus umgebildeten Beinen entstanden. Sie bestehen aus Ober- und Unterlippe, Ober- und Unterkiefer. Veränderungen der ursprünglich kauend-beißenden Mundwerkzeuge ermöglichten die Nutzung neuer Nahrungsquellen. Als Fleisch-, Kot-, Aas- und Pflanzenfresser, als Blutoder Pflanzensaftsauger spielen Insekten eine große Rolle im Naturhaushalt, als Nützlinge oder Schädlinge auch für den Menschen. Fortpflanzung und Entwicklung Viele Insektenarten betreiben Brutfürsorge, manche, wie die Sandwespe, auch Brutpflege. Bei ursprünglicheren Insektenordnungen (wie Libellen, Heuschrecken) entwickeln sich die Larven allmählich zum erwachsenen Tier: unvollkommene Verwandlung. Bei jüngeren Ordnungen (wie Schmetterlingen, Käfern) ist die Larve ein reines Wachstumsstadium, der Umbau zum erwachsenen Tier erfolgt während des Puppenstadiums: vollkommene Verwandlung. Die Entwicklung wird durch Hormone gesteuert. Kluge Programme und individuelle Erfahrung Verhalten von Insekten setzt sich aus angeborenen und aus erfahrungsbedingten Anteilen zusammen. Die angeborenen Teile ( kluge Programme ) sind Ergebnis der Evolution. Durch Experimente kann man sie von den flexibleren erfahrungsbedingten Anteilen unterscheiden. Superorganismus Honigbiene Honigbienen gehören zu den Staaten bildenden oder sozialen Insekten. Durch Arbeitsteilung erreichen sie eine neue Organisationsstufe, die auch als Superorganismus bezeichnet wird. Königin und Drohnen (männliche Bienen) sind auf Fortpflanzung spezialisiert. Arbeiterinnen (unfruchtbare Weibchen) übernehmen verschiedene wie Wabenbau, Füttern der Larven oder Eintragen von Nektar und Pollen. Durch eine Tanzsprache wird die Position einer Nahrungsquelle übermittelt. Arbeitsteilung, Pollen- und Honigvorräte ermöglichen die sichere Versorgung von Larven und Königin sowie die Überwinterung des ganzen Volks. Als Bestäuber vieler Nutzpflanzen sind Honigbienen wirtschaftlich von großer Bedeutung Verwandte Gliederfüßer: Spinnentiere und Krebse Bei Spinnentieren ist keine Segmentierung mehr zu erkennen. Sie haben 4 Beinpaare. Ihr Körper ist in 2 Abschnitte (Kopfbruststück und Hinterleib) gegliedert. Alle Arten sind Fleischfresser und verdauen ihre Beute außerhalb des Körpers. Krebse besitzen noch die starke Segmentierung und die vielen Beinpaare ursprünglicher Gliederfüßer. Sie sind größtenteils Wasserbewohner und atmen mit Kiemen. Die vordersten Beinpaare sind oft zu Scheren umgebildet. Am Kopfbruststück sitzen die Laufbeine. Alles klar? 1 Stelle die Menge der von einem Schmetterling (zum Beispiel Kohlweißling) gefressenen Blätter in allen Phasen seiner Entwicklung in einem geeigneten Diagramm dar und erkläre dein Vorgehen. Wie würde das Diagramm bei einer Heuschrecke (zum Beispiel Wanderheuschrecke) aussehen? 2 Die ursprüngliche Blütenform der meisten Samenpflanzen ähnelte einer Kirsch- oder Heckenrosenblüte. Erst nach Auftreten der Insekten entstanden Blütenformen wie die des Salbeis. Erkläre die Entstehung solcher Blütenformen.
Was fliegt denn da? Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Anatomie Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Die SuS lesen Texte, welche die der Biene abhandeln und erarbeiten verschiedene Arbeitsaufträge dazu. Ziel Die SuS können Körperteile der Biene richtig benennen. Die
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Die SuS lesen Texte, welche die der Biene abhandeln und erarbeiten verschiedene Arbeitsaufträge dazu. Ziel Die SuS können Körperteile der Biene richtig benennen. Die
VORANSICHT. Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Insekten. Das Wichtigste auf einen Blick
 III Tiere Beitrag 19 (Kl. 7/8) 1 von 26 Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Ein Beitrag von Gerd Rothfuchs, Etschberg Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart
III Tiere Beitrag 19 (Kl. 7/8) 1 von 26 Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Ein Beitrag von Gerd Rothfuchs, Etschberg Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart
Bienen, Hummeln und Wespen
 Hautflügler Die Insektenordnung Hymenoptera Körperbau eines Hautflüglers Merkmale der Hautflügler Abbildung 2 Schwebfliege Abbildung 1Taillenwespe Aufgabe 1: Beschrifte in beiden Abbildungen jeweils die
Hautflügler Die Insektenordnung Hymenoptera Körperbau eines Hautflüglers Merkmale der Hautflügler Abbildung 2 Schwebfliege Abbildung 1Taillenwespe Aufgabe 1: Beschrifte in beiden Abbildungen jeweils die
Altersgemäße Sachtexte sinnverstehend lesen
 1 Die Biene Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der Panzer ist wie das Skelett der Bienen und stützt den ganzen Körper. Er besteht aus Chitin. Manche Bienen
1 Die Biene Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der Panzer ist wie das Skelett der Bienen und stützt den ganzen Körper. Er besteht aus Chitin. Manche Bienen
Altersgemäße Sachtexte sinnverstehend lesen
 1 Die Biene Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der Panzer ist wie das Skelett der Bienen und stützt den ganzen Körper. Er besteht aus Chinin. Manche Bienen
1 Die Biene Bienen gehören zu den Insekten und haben sechs Beine, vier Flügel und einen Panzer. Der Panzer ist wie das Skelett der Bienen und stützt den ganzen Körper. Er besteht aus Chinin. Manche Bienen
Die Stockwerke der Wiese
 Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
Die Stockwerke der Wiese I. Die Stockwerke der Wiese..................................... 6 II. Der Aufbau der Blume........................................ 8 III. Die Biene..................................................
- Kopf. - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare. - Hinterleib. - Körpergliederung. - Außenskelett ( Chitin ) - Facettenaugen aus vielen Einzelaugen
 Gliederung des Insektenkörpers ( 8. Klasse 1 / 32 ) - Kopf - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare - meist 2 Flügelpaare - Hinterleib Kennzeichen des Insektenkörpers ( 8. Klasse 2 / 32 ) - Körpergliederung - Außenskelett
Gliederung des Insektenkörpers ( 8. Klasse 1 / 32 ) - Kopf - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare - meist 2 Flügelpaare - Hinterleib Kennzeichen des Insektenkörpers ( 8. Klasse 2 / 32 ) - Körpergliederung - Außenskelett
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Kopf und ein Fühler (rot) Hinterleib (gelb) Brust und ein gegliedertes Bein (blau) Code 1 : Die Farbgebung ist richtig
 Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Die Große Kerbameise
 Die Große Kerbameise Berlin (8. November 2010) Die Große Kerbameise ist das Insekt des Jahres 2011. Das 7 bis 8 mm große Tier tritt nie einzeln auf und ist alleine auch gar nicht überlebensfähig, denn
Die Große Kerbameise Berlin (8. November 2010) Die Große Kerbameise ist das Insekt des Jahres 2011. Das 7 bis 8 mm große Tier tritt nie einzeln auf und ist alleine auch gar nicht überlebensfähig, denn
Der Schwalbenschwanz legt 50 bis 80 Eier auf die Futterpflanzen. Als Futterpflanzen kommen alle Doldenblütler in Frage.
 Das Eistadium Der Schwalbenschwanz legt 50 bis 80 Eier auf die Futterpflanzen ab. Als Futterpflanzen kommen alle Doldenblütler in Frage. Diese drei Pflanzen sind häufig: Wilde Möhre Fenchel Rüeblikraut
Das Eistadium Der Schwalbenschwanz legt 50 bis 80 Eier auf die Futterpflanzen ab. Als Futterpflanzen kommen alle Doldenblütler in Frage. Diese drei Pflanzen sind häufig: Wilde Möhre Fenchel Rüeblikraut
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Vorklasse. Insektenbestimmung. Stand:
 Insektenbestimmung Stand: 12.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtung Sozialwesen) Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen 1. Teil: ca. 40 Minuten 2. Teil:
Insektenbestimmung Stand: 12.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtung Sozialwesen) Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen 1. Teil: ca. 40 Minuten 2. Teil:
Lösungen zu den Arbeitsblättern ANATOMIE & BIOLOGIE
 Lösungen zu den Arbeitsblättern ANATOMIE & BIOLOGIE Die Lösungen aller auf den Arbeitsblättern gestellten Aufgaben und Fragen können Schülerinnen finden, nachdem sie über den Körperbau und die Lebensweise
Lösungen zu den Arbeitsblättern ANATOMIE & BIOLOGIE Die Lösungen aller auf den Arbeitsblättern gestellten Aufgaben und Fragen können Schülerinnen finden, nachdem sie über den Körperbau und die Lebensweise
Insektenbuch von: 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1: Teil 2: Teil 3:
 Insektenbuch von: 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1: 2 3 4 5 Teil 2: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Teil 3: 16 17 18 19 20 21 1 Zeichne ein Insekt: 2 Hier kannst du notieren, an welchen Merkmalen man erkennt, dass
Insektenbuch von: 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1: 2 3 4 5 Teil 2: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Teil 3: 16 17 18 19 20 21 1 Zeichne ein Insekt: 2 Hier kannst du notieren, an welchen Merkmalen man erkennt, dass
Praxis Grundschule 2/2010 Lösungen
 Praxis Grundschule 2/2010 Lösungen Von Löwenzahn bis Pusteblume Alexandra Hanneforth Die Lösungen finden Sie auf den folgenden n. Die Honigbiene Susanne Rennert Die Lösungen finden Sie im Anschluss. von
Praxis Grundschule 2/2010 Lösungen Von Löwenzahn bis Pusteblume Alexandra Hanneforth Die Lösungen finden Sie auf den folgenden n. Die Honigbiene Susanne Rennert Die Lösungen finden Sie im Anschluss. von
Nützliche Insekten im Garten. Referentin: Dr. Sandra Lerche
 im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
Biologie. I. Grundlegende Begriffe im Überblick:
 I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
Das Blut fließt nicht wie beim geschlossenen Blutkreislauf in Gefäßen (Adern) zu den Organen, sondern umspült diese frei.
 Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010
 ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010 Frosch- und Vogelperspektive diese Begriffe haben es längst in unseren Sprachgebrauch geschafft. Doch sagen sie nur etwas über den Standpunkt aus, von dem diese beiden
ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010 Frosch- und Vogelperspektive diese Begriffe haben es längst in unseren Sprachgebrauch geschafft. Doch sagen sie nur etwas über den Standpunkt aus, von dem diese beiden
M4: Die Superstars-Das Spiel
 DAS SPIELMATERIAL, BLATT 1 M4: Die Superstars-Das Spiel Die Nützlinge Unterrichtseinheit GS/3 Seite 1/10 DAS SPIELMATERIAL, BLATT 2 Blattläuse (Male 4 rot, 4 grün, 4 braun und 4 gelb an und schneide sie
DAS SPIELMATERIAL, BLATT 1 M4: Die Superstars-Das Spiel Die Nützlinge Unterrichtseinheit GS/3 Seite 1/10 DAS SPIELMATERIAL, BLATT 2 Blattläuse (Male 4 rot, 4 grün, 4 braun und 4 gelb an und schneide sie
EINZELNE UNTERRICHTSEINHEIT: Wespen - die verkannten Nützlinge II (Solitäre - Einzeln lebende Wespen)
 Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
AUFGABENSAMMLUNG Lösungen. Laufen: Skelett. Lösungen
 Laufen: Skelett Bei der Fortbewegung spielt das Skelett eine wichtige Rolle. Wirbeltiere zeichnen sich durch ein Innenskelett aus. Beschrifte die Knochen des Hundes. 1 Laufen: Gangarten Die meisten Vierbeiner
Laufen: Skelett Bei der Fortbewegung spielt das Skelett eine wichtige Rolle. Wirbeltiere zeichnen sich durch ein Innenskelett aus. Beschrifte die Knochen des Hundes. 1 Laufen: Gangarten Die meisten Vierbeiner
Bulldoggenameise: Sie kommt aus Australien. Sie hat sehr große und starke Kiefer. Wenn ihr Nest angegriffen wird, benutzt sie diese Kiefer.
 Alles Ameisen! (1) Bulldoggenameise: Sie kommt aus Australien. Sie hat sehr große und starke Kiefer. Wenn ihr Nest angegriffen wird, benutzt sie diese Kiefer. Wanderameise: Sie lebt in Asien, Afrika und
Alles Ameisen! (1) Bulldoggenameise: Sie kommt aus Australien. Sie hat sehr große und starke Kiefer. Wenn ihr Nest angegriffen wird, benutzt sie diese Kiefer. Wanderameise: Sie lebt in Asien, Afrika und
3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch!
 1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
Ihr lernt die interessantesten Vertreter der Insektenwelt kennen und werdet feststellen, dass sie wunderschön und unserer Bewunderung wert sind.
 Ihr lernt die interessantesten Vertreter der Insektenwelt kennen und werdet feststellen, dass sie wunderschön und unserer Bewunderung wert sind. Die merkwürdige Insektenwelt Im Bienenstock der Honigbiene
Ihr lernt die interessantesten Vertreter der Insektenwelt kennen und werdet feststellen, dass sie wunderschön und unserer Bewunderung wert sind. Die merkwürdige Insektenwelt Im Bienenstock der Honigbiene
Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt
 55 11216 Didaktische FWU-DVD differenziertes Arbeitsmaterial Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt Biologie Klasse 5 8 Trailer ansehen Schlagwörter Ameisen; Bestäubung; Bienen; Blütenpflanzen; Evolution;
55 11216 Didaktische FWU-DVD differenziertes Arbeitsmaterial Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt Biologie Klasse 5 8 Trailer ansehen Schlagwörter Ameisen; Bestäubung; Bienen; Blütenpflanzen; Evolution;
Wie fliegen Vögel und Insekten?
 Vögel und Insekten 02 Fliegen PowerPoint-Präsentation Wie fliegen Vögel und Insekten? Wir Menschen sind seit Jahrhunderten fasziniert von der Vorstellung, fliegen zu können. Deshalb haben wir die Vögel
Vögel und Insekten 02 Fliegen PowerPoint-Präsentation Wie fliegen Vögel und Insekten? Wir Menschen sind seit Jahrhunderten fasziniert von der Vorstellung, fliegen zu können. Deshalb haben wir die Vögel
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
VORSCHAU. zur Vollversion. Hinweise zum Material:
 Hinweise zum Material: entdecken - staunen - lernen Schmetterlinge Das Material zum Thema Schmetterling bietet eine Grundlage für die Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema. Es enthält eine Kartei,
Hinweise zum Material: entdecken - staunen - lernen Schmetterlinge Das Material zum Thema Schmetterling bietet eine Grundlage für die Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema. Es enthält eine Kartei,
Info: Wechselwirkungen
 Info: Wechselwirkungen Abbildung 1: Dickkopffalter an einer Skabiosenblüte In der Sprache einiger Naturvölker werden Schmetterlinge auch fliegende Blumen genannt. Schmetterlinge gleichen in ihrer Schönheit
Info: Wechselwirkungen Abbildung 1: Dickkopffalter an einer Skabiosenblüte In der Sprache einiger Naturvölker werden Schmetterlinge auch fliegende Blumen genannt. Schmetterlinge gleichen in ihrer Schönheit
Enchyträe. Regenwurm. Größe: etwa 10 mm
 Enchyträe 0 Größe: etwa 10 mm Nahrung: totes pflanzliches und z.t. auch tierisches Material. Durch Speichelsäfte wird die Nahrung außerhalb des Körpers vorverdaut. Ringelwürmer, Wenigborster Regenwurm
Enchyträe 0 Größe: etwa 10 mm Nahrung: totes pflanzliches und z.t. auch tierisches Material. Durch Speichelsäfte wird die Nahrung außerhalb des Körpers vorverdaut. Ringelwürmer, Wenigborster Regenwurm
Station 5: Die Mundwerkzeuge der Insekten
 Station 5: Die Mundwerkzeuge der Insekten Was erfährst du an dieser Station? Wie viele Zähne haben eigentlich Insekten? Oder haben sie etwa gar keine? Antworten auf diese und andere Fragen rund um die
Station 5: Die Mundwerkzeuge der Insekten Was erfährst du an dieser Station? Wie viele Zähne haben eigentlich Insekten? Oder haben sie etwa gar keine? Antworten auf diese und andere Fragen rund um die
Sachinformation Marienkäfer
 Sachinformation Marienkäfer Allgemein Der Marienkäfer gehört zu den Insekten. Seine Körpergröße beträgt zwischen sechs und acht Millimeter (Vergleich Fingernagel). Marienkäfer leben auf Wiesen, in Gärten
Sachinformation Marienkäfer Allgemein Der Marienkäfer gehört zu den Insekten. Seine Körpergröße beträgt zwischen sechs und acht Millimeter (Vergleich Fingernagel). Marienkäfer leben auf Wiesen, in Gärten
Bienen, Hummeln und Wespen
 Hautflügler Die Insektenordnung Hymenoptera Körperbau eines Hautflüglers Merkmale der Hautflügler Komplexaugen Fühler Fühler Komplexaugen Kopf Kopf Brust Beine Brust Hinterleib Beine Hinterleib Abbildung
Hautflügler Die Insektenordnung Hymenoptera Körperbau eines Hautflüglers Merkmale der Hautflügler Komplexaugen Fühler Fühler Komplexaugen Kopf Kopf Brust Beine Brust Hinterleib Beine Hinterleib Abbildung
Ernährung und Stofftransport
 Inhalt Lebewesen bestehen aus Zellen 1 Kennzeichen des Lebens 12 2 Organisationsebenen des Lebendigen 14 3 Geschichte der Zellenlehre 16 4 Das Lichtmikroskop 17 5 Untersuchungen mit dem Mikroskop 18 6
Inhalt Lebewesen bestehen aus Zellen 1 Kennzeichen des Lebens 12 2 Organisationsebenen des Lebendigen 14 3 Geschichte der Zellenlehre 16 4 Das Lichtmikroskop 17 5 Untersuchungen mit dem Mikroskop 18 6
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Materialübersicht
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Materialübersicht
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen
 Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
Anleitung zum Erkennen funktioneller Gruppen Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Pflanzen und Tiere an und um einen Baum herum leben? Tritt näher und wirf einen Blick auf die Vielfalt der
EINZELNE UNTERRICHTSEINHEIT: Wespen - die verkannten Nützlinge I (staatenbildende Wespen)
 Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer
 Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer Dass Gartenarbeit anstrengend sein kann, weiß jeder. Viel anstrengender wäre sie aber, wenn nicht jeden Tag viele kleine Helfer mit uns ackern würden. Grund genug für
Die TOP 10 der kleinen Gartenhelfer Dass Gartenarbeit anstrengend sein kann, weiß jeder. Viel anstrengender wäre sie aber, wenn nicht jeden Tag viele kleine Helfer mit uns ackern würden. Grund genug für
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse
 Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Grundwissen Natur und Technik 5. Klasse Biologie Lehre der Lebewesen Kennzeichen der Lebewesen Aufbau aus Zellen Bewegung aus eigener Kraft Fortpflanzung Aufbau aus Zellen Zellkern Chef der Zelle Zellmembran
Die Stabheuschrecke. Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, Sprache: Deutsch. Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2
 Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Material. 3 Akteure im Simulationsspiel
 Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Der Bien das Bienenvolk
 Der Bien das Bienenvolk Ein Bienenvolk besteht aus 1 Königin, ca. 1000 Drohnen und ca. 40.000 Arbeiterinnen. Wusstest du, dass eine Bienenkönigin bis zu 5 Jahre alt werden kann, während eine Drohne nur
Der Bien das Bienenvolk Ein Bienenvolk besteht aus 1 Königin, ca. 1000 Drohnen und ca. 40.000 Arbeiterinnen. Wusstest du, dass eine Bienenkönigin bis zu 5 Jahre alt werden kann, während eine Drohne nur
Tiere im Teich - Frühling
 00.05 Endlich ist der Winter vorbei, jetzt kommt langsam der Frühling. An der Oberfläche des Teiches ist es aber noch ziemlich ruhig. Auch im Wasser sieht man noch nicht viel. Aber es wird jeden Tag ein
00.05 Endlich ist der Winter vorbei, jetzt kommt langsam der Frühling. An der Oberfläche des Teiches ist es aber noch ziemlich ruhig. Auch im Wasser sieht man noch nicht viel. Aber es wird jeden Tag ein
Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge!
 Bläulinge: Infoblatt 1 Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge! Die Hochmoor-Bläulinge sind etwas ganz Besonderes. Sie leben nur im Hochmoor. Warum eigentlich? Wofür brauchen Hochmoor-Bläulinge diese
Bläulinge: Infoblatt 1 Gestatten, mein Name ist: Hochmoor-Bläulinge! Die Hochmoor-Bläulinge sind etwas ganz Besonderes. Sie leben nur im Hochmoor. Warum eigentlich? Wofür brauchen Hochmoor-Bläulinge diese
M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens. Voransicht
 S 4 M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens Für das Eichhörnchen sind bestimmte Merkmale im Körperbau typisch. Durch sie ist es an seinen Lebensraum angepasst. Befasse
S 4 M 5 Ein Leben in den Baumwipfeln Anpassungen im Körperbau des Eichhörnchens Für das Eichhörnchen sind bestimmte Merkmale im Körperbau typisch. Durch sie ist es an seinen Lebensraum angepasst. Befasse
Schmetterlinge Kleine, bunte Wunder der Natur
 Schmetterlinge Kleine, bunte Wunder der Natur Wenn wir an einem schönen, sonnigen Frühlingsoder Sommertag durch die Natur wandern, werden wir oft von bunten Schmetterlingen umgaukelt. Wandern wir im Frühling
Schmetterlinge Kleine, bunte Wunder der Natur Wenn wir an einem schönen, sonnigen Frühlingsoder Sommertag durch die Natur wandern, werden wir oft von bunten Schmetterlingen umgaukelt. Wandern wir im Frühling
mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
 mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
mentor Grundwissen mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse Alle wichtigen Themen von Franz X Stratil, Wolfgang Ruppert, Reiner Kleinert 1. Auflage mentor Grundwissen: Biologie bis zur 10. Klasse
Das Bienenvolk Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Im Sommer leben neben der Königin Tausende Arbeiterinnen und viele Drohnen im Volk. Die SuS lernen, welche Aufgaben die jeweiligen Bienen haben und wie aus einem
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Ziel Im Sommer leben neben der Königin Tausende Arbeiterinnen und viele Drohnen im Volk. Die SuS lernen, welche Aufgaben die jeweiligen Bienen haben und wie aus einem
Thema/Aufgabe: Die Entwicklung vom Mehlwurm(Larve des Mehlkäfers) zum Mehlkäfer
 Thema/Aufgabe: Die Entwicklung vom Mehlwurm(Larve des Mehlkäfers) zum Mehlkäfer I. Besonderheiten des Mehlwurms (bzw. des Mehlkäfers): Atmung: Die Mehlwürmer atmen durch Tracheen wie die meisten Insekten.
Thema/Aufgabe: Die Entwicklung vom Mehlwurm(Larve des Mehlkäfers) zum Mehlkäfer I. Besonderheiten des Mehlwurms (bzw. des Mehlkäfers): Atmung: Die Mehlwürmer atmen durch Tracheen wie die meisten Insekten.
Flussnapfschnecke Hakenkäfer. Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs. große Köcherfliegenlarve. larve. Schlammschnecke. Kriebelmücke (Larve) Kugelmuschel
 Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Zeigertiere in Fließgewässern Mit diesen Zeigertieren kannst du die Wasserqualität von Fließgewässern bestimmen. (Dargestellt sind häufig Larven der genannten Tiere.) Eintagsfliege (Larve) Flohkrebs Flussnapfschnecke
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Wiese. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Wiese Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Hummeln stechen! 2. suchen sich ein neues, größeres Haus wenn sie wachsen! 3. Viele Spinnen haben 8 Augen!
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Wiese Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Hummeln stechen! 2. suchen sich ein neues, größeres Haus wenn sie wachsen! 3. Viele Spinnen haben 8 Augen!
VORANSICHT I/F5. Text 1: Das Igelgebiss (M 2) Text 2: Die Sinne des Igels (M 2)
 S 4 Text 1: Das Igelgebiss (M 2) Der Igel hat ein Insektenfressergebiss. Etwa drei Wochen nach der Geburt verlieren die Igelbabys ihre Milchzähne. Wie alle Säugetiere besitzt auch der Igel Schneide-, Eck-
S 4 Text 1: Das Igelgebiss (M 2) Der Igel hat ein Insektenfressergebiss. Etwa drei Wochen nach der Geburt verlieren die Igelbabys ihre Milchzähne. Wie alle Säugetiere besitzt auch der Igel Schneide-, Eck-
Wirbeltiere. Kennzeichen der Fische. Kennzeichen der Amphibien (Lurche) Kennzeichen der Reptilien
 Wirbeltiere Allen Wirbeltieren sind folgende Merkmale gemeinsam: Geschlossener Blutkreislauf Innenskelett mit Wirbelsäule und Schädel Gliederung des Körpers in Kopf, Rumpf und Schwanz Man unterscheidet
Wirbeltiere Allen Wirbeltieren sind folgende Merkmale gemeinsam: Geschlossener Blutkreislauf Innenskelett mit Wirbelsäule und Schädel Gliederung des Körpers in Kopf, Rumpf und Schwanz Man unterscheidet
Einheimische Amphibien Amphibia. Lösungsblätter. Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien (Amphibia)
 Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Unterrichtshilfe Einheimische Amphibien Amphibia Lösungsblätter Die Aufgaben sind anhand der ausgestellten Tiere in den Vitrinen und anhand der Informationen auf dem Touchscreen lösbar. Zoologisches Museum
Nachtschwärmer Schullerer, Burgstaller
 Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu2.veritas.at
Vorlage Stichwortzettel (zu S. 92)
 Vorlage Stichwortzettel (zu S. 92) Stichwortzettel Aussehen: Lebensraum: Nahrung: Feinde: Besonderheiten: 1 Fülle den Stichwortzettel aus. Ergänze ihn mit weiteren Informationen. Kennen von Formen zur
Vorlage Stichwortzettel (zu S. 92) Stichwortzettel Aussehen: Lebensraum: Nahrung: Feinde: Besonderheiten: 1 Fülle den Stichwortzettel aus. Ergänze ihn mit weiteren Informationen. Kennen von Formen zur
Pfeilgiftfrösche. Wie sehen Pfeilgiftfrösche aus und sind sie wirklich giftig?
 Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
Wie sehen aus und sind sie wirklich giftig? sind kleine Frösche und haben sehr auffällige, knallbunte Farben. Einige Frösche sind schwarz und haben gelbe, rote oder blaue Flecken, manche sind orange oder
Warum können Vögel fliegen?
 Eine Kohlmeise fliegt mit breit gefächertem Schwanz und weit ausgebreiteten Flügeln am Fenster vorbei. Mit lang gestreckten Beinen und gespreizten Zehen steuert sie auf einen Ast zu. Die vier Zehen umschließen
Eine Kohlmeise fliegt mit breit gefächertem Schwanz und weit ausgebreiteten Flügeln am Fenster vorbei. Mit lang gestreckten Beinen und gespreizten Zehen steuert sie auf einen Ast zu. Die vier Zehen umschließen
Die Kopfformen der drei Bienenwesen. Tafel VIII. Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Bienenkunde,Wien. Entw. Ing. R. Jordan, gez.ass. med. H.
 Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Bienenkunde,Wien Die Kopfformen der drei Bienenwesen Mandibeln: Mehrzweckwerkzeug (Zange) Wachs kneten Zelle öffnen Pollen stampfen usw. Fühler: Riechorgan Duft der
Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Bienenkunde,Wien Die Kopfformen der drei Bienenwesen Mandibeln: Mehrzweckwerkzeug (Zange) Wachs kneten Zelle öffnen Pollen stampfen usw. Fühler: Riechorgan Duft der
Die Honigbiene. Einige Merkmale sind typisch für Insekten. Der Körper besteht aus drei großen Teilen: Kopf, Brust, Hinterleib
 Die Honigbiene Einige Merkmale sind typisch für Insekten. Der Körper besteht aus drei großen Teilen: Kopf, Brust, Hinterleib Die Fühler sind abgewinkelt. Auf den Fühlern sitzt der Geruchssinn und der Tastsinn.
Die Honigbiene Einige Merkmale sind typisch für Insekten. Der Körper besteht aus drei großen Teilen: Kopf, Brust, Hinterleib Die Fühler sind abgewinkelt. Auf den Fühlern sitzt der Geruchssinn und der Tastsinn.
Frank und Katrin Hecker. Der große NATURFÜ H RER
 Frank und Katrin Hecker Der große NATURFÜ H RER für Kindeflranzen Tiere & P 13 heimliches Doppelleben. Halb im Wasser und halb an Land. Ihre Eier legen sie in Teiche oder Bäche. Dar aus schlüpfen kleine
Frank und Katrin Hecker Der große NATURFÜ H RER für Kindeflranzen Tiere & P 13 heimliches Doppelleben. Halb im Wasser und halb an Land. Ihre Eier legen sie in Teiche oder Bäche. Dar aus schlüpfen kleine
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere
 Hüpfdiktat 1 - Waldtiere 1 trägt seinen Namen, 2 jedoch werden sie etwa 3 auf Bäumen mit Blättern A B C D E F Früchte, Eicheln, Im August bringt Waldkauz, Katzen, Tiere haben viele Feinde, herumklettern
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere 1 trägt seinen Namen, 2 jedoch werden sie etwa 3 auf Bäumen mit Blättern A B C D E F Früchte, Eicheln, Im August bringt Waldkauz, Katzen, Tiere haben viele Feinde, herumklettern
Wie fliegen Vögel und Insekten? - Faszination des Fliegens seit Jahrhunderten - Forschung - der Mensch fliegt
 Wie fliegen Vögel und Insekten? - Faszination des Fliegens seit Jahrhunderten - Forschung - der Mensch fliegt Voraussetzungen Wie muss ein Vogel gebaut sein, dass er fliegen kann? 1. besondere Flügelform
Wie fliegen Vögel und Insekten? - Faszination des Fliegens seit Jahrhunderten - Forschung - der Mensch fliegt Voraussetzungen Wie muss ein Vogel gebaut sein, dass er fliegen kann? 1. besondere Flügelform
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Evolution. Skelett (5B1) (5B2) (5B3) (5B4)
 Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
Ein Ort voller Legenden. Was lebt noch in den Höhlen? Geschützter Wald. Einzigartige Vogelwelt. Wiederentdeckung der Höhlen
 Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Die im Fiordland Nationalpark sind Teil einer In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren die ein Die Glühwürmchen-Höhlen befinden sich am Westufer des Lake Te Anau. Sie sind Teil eines 6,7 km langen Kalksteinlabyrinths,
Info: Schmetterlinge. Abbildung 3: Metamorphose heißt bei Insekten die vollständige Entwicklung über Ei, Raupe und Puppe zum ausgewachsenen Tier.
 Info: Schmetterlinge Abbildung 1: Tagfalter halten ihre Flügel in Ruhe zusammengeklappt aufrecht über dem Rücken. Ihre Fühler sind vorne Keulenförmig verdickt. Schmetterlinge sind Insekten, es gibt mindestens
Info: Schmetterlinge Abbildung 1: Tagfalter halten ihre Flügel in Ruhe zusammengeklappt aufrecht über dem Rücken. Ihre Fühler sind vorne Keulenförmig verdickt. Schmetterlinge sind Insekten, es gibt mindestens
Grundwissen 6. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8
 Grundwissen 6. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Wirbeltiere in verschiedenen Lebensräumen Kennzeichen o Wirbelsäule aus einzelnen Wirbeln o Innenskelett aus Knochen und Knorpeln 1.1
Grundwissen 6. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Wirbeltiere in verschiedenen Lebensräumen Kennzeichen o Wirbelsäule aus einzelnen Wirbeln o Innenskelett aus Knochen und Knorpeln 1.1
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere
 Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Hüpfdiktat 1 - Waldtiere A B C D E 1 Weibchen zwei bis Diese Vögel werden jedoch jagen und haben ihre Augen der Nacht genannt. 2 Da Uhus vor allem in der 3 ihre Flügelspannweite 4 Leben lang zusammen,
Die Wespe. spärlich behaart. schwarz-gelb gefärbt. SCHLANK GEBAUT Wespentaille. Glatter Stachel, kann zurückgezogen werden
 Die Wespe Soziale Wespen bilden einjährige Völker, die im Herbst absterben. Nur begattete Jungköniginnen überwintern in einer Kältestarre an frostgeschützten Schlupfwinkeln in der Natur. schwarz-gelb gefärbt
Die Wespe Soziale Wespen bilden einjährige Völker, die im Herbst absterben. Nur begattete Jungköniginnen überwintern in einer Kältestarre an frostgeschützten Schlupfwinkeln in der Natur. schwarz-gelb gefärbt
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief.
 Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Infotexte und Steckbriefe zum Thema Tiere des Waldes Jede Gruppe bekommt einen Infotext und jedes Kind erhält einen auszufüllenden Steckbrief. Bilder Daniela A. Maurer Das Eichhörnchen Das Eichhörnchen
Wer wohnt wo? Ziel Arten in Zierrasen; Fettwiese und Magerwiese kennenlernen. Material Computer Willkommen im Lebensraum Wiese
 Wer wohnt wo? Ziel Arten in Zierrasen; Fettwiese und Magerwiese kennenlernen. Material Computer Willkommen im Lebensraum Wiese 17 Lebensraum Wiese Auftrag 1. Lies den Beschrieb der verschiedenen Wiesentypen
Wer wohnt wo? Ziel Arten in Zierrasen; Fettwiese und Magerwiese kennenlernen. Material Computer Willkommen im Lebensraum Wiese 17 Lebensraum Wiese Auftrag 1. Lies den Beschrieb der verschiedenen Wiesentypen
Kleiner Beutenkäfer. Gekommen um zu bleiben?
 Kleiner Beutenkäfer Gekommen um zu bleiben? 1 Kleiner Beutenkäfer Aufbau 1. Aktuelle Situation 2. Aussehen 3. Lebenszyklus 4. Schäden 5. Bekämpfung 6. Verhalten der Imkerinnen und Imker 2 Verbreitungsgebiete
Kleiner Beutenkäfer Gekommen um zu bleiben? 1 Kleiner Beutenkäfer Aufbau 1. Aktuelle Situation 2. Aussehen 3. Lebenszyklus 4. Schäden 5. Bekämpfung 6. Verhalten der Imkerinnen und Imker 2 Verbreitungsgebiete
Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie Seiten
 Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
weisst du die lösung... körperteile des baumes...
 weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
weisst du die lösung... körperteile des baumes... Welche Körperteile des Baumes kennst Du? Mit welchen menschlichen Körperteilen sind sie vergleichbar? Verbinde die zusammengehörenden Felder mit einem
Insekten BAND 30. www.wasistwas.de SEHEN HÖREN MITMACHEN
 BAND 30 www.wasistwas.de Insekten SEHEN HÖREN MITMACHEN Inhalt Insekten: die vielfältigste Tiergruppe Woran erkennt man ein Insekt? 4 Wie ist diese Vielzahl überschaubar? 5 Ordnungen der Insekten Wie viele
BAND 30 www.wasistwas.de Insekten SEHEN HÖREN MITMACHEN Inhalt Insekten: die vielfältigste Tiergruppe Woran erkennt man ein Insekt? 4 Wie ist diese Vielzahl überschaubar? 5 Ordnungen der Insekten Wie viele
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL
 PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL Zeit 10 Minuten Material Puzzleteile und Texte zu folgenden Paaren: Aguti Paranuss Fledermaus Bananenblüte Kolibri Helekonie/Ingwerblüte Pfeilgiftfrosch Bromelie
PUZZLESPIEL: AUF JEDEN TOPF PASST EIN DECKEL Zeit 10 Minuten Material Puzzleteile und Texte zu folgenden Paaren: Aguti Paranuss Fledermaus Bananenblüte Kolibri Helekonie/Ingwerblüte Pfeilgiftfrosch Bromelie
Das ist ein Siebenpunkt-Marienkäfer beim Abflug.
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 14. Mai 2018 Hallo, ich bin Kubi! Die kunterbunte Kinderzeitung Ausgabe 2018/418 wöchentlich, außer in den Ferien Das ist ein Siebenpunkt-Marienkäfer
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 14. Mai 2018 Hallo, ich bin Kubi! Die kunterbunte Kinderzeitung Ausgabe 2018/418 wöchentlich, außer in den Ferien Das ist ein Siebenpunkt-Marienkäfer
Das Wichtigste auf einen Blick... 66
 Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Inhaltsverzeichnis Bio 5/6 3 Inhaltsverzeichnis 1 Biologie Was ist das?... 8 Kennzeichen des Lebens.... 9 1 Lebendes oder Nichtlebendes?... 10 Arbeitsgebiete und Arbeitsgeräte der Biologen... 11 Tiere
Schulmaterial Haie und Rochen
 Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
 Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Elefanten Elefanten erkennt man sofort an ihren langen Rüsseln, mit denen sie Gegenstände greifen und festhalten können, den gebogenen Stoßzähnen und den riesigen Ohren. Da Elefanten nicht schwitzen können,
Natur und Technik. Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik. Datum:
 Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 In der Schule werden die Übergänge von reinem Wasser zwischen den
Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 In der Schule werden die Übergänge von reinem Wasser zwischen den
Pflanzen nehmen Informationen auf und reagieren darauf
 Pflanzen nehmen Informationen auf und reagieren darauf Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- 2 Unterrichtsstunden
Pflanzen nehmen Informationen auf und reagieren darauf Jahrgangsstufen 6 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- 2 Unterrichtsstunden
Inhaltsverzeichnis. Haustiere und Nutztiere
 Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Inhaltsverzeichnis M Aufgaben richtig verstehen 8 M Biologische Prinzipien 10 1 Kennzeichen von Lebewesen 1.1 Biologie ein neues Unterrichtsfach 12 M Mein Biologieheft führen 13 1.2 Lebewesen haben typische
Körperbau der Honigbiene: Funktionelle Anatomie
 Dr. Peter Rosenkranz LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de Körperbau der Honigbiene: Funktionelle Anatomie Kurs Funktionelle Anatomie der Honigbiene
Dr. Peter Rosenkranz LA Bienenkunde, Universität Hohenheim, D-70599 Stuttgart peter.rosenkranz@uni-hohenheim.de Körperbau der Honigbiene: Funktionelle Anatomie Kurs Funktionelle Anatomie der Honigbiene
Schmetterling. Portfolio im Sachunterricht Klasse. u Annette Stechbart. Andrea Torggler. Portfolio o o im Sachunterricht
 Annette Stechbart Andrea Torggler Portfolio im Sachunterricht 1. 2. Klasse Downloadauszug aus dem Originaltitel: Grundschule u Annette Stechbart Andrea Torggler 1. 1 4.K Klasse se Portfolio o o im Sachunterricht
Annette Stechbart Andrea Torggler Portfolio im Sachunterricht 1. 2. Klasse Downloadauszug aus dem Originaltitel: Grundschule u Annette Stechbart Andrea Torggler 1. 1 4.K Klasse se Portfolio o o im Sachunterricht
Der Regenwurm. Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar.
 Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Inhaltsverzeichnis. Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16
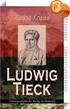 Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Inhaltsverzeichnis Was sind Naturwissenschaften?... 8 Rundgang durch den Nawi-Raum... 10 Kennzeichen des Lebendigen................................. 12 Vom ganz Kleinen und ganz Großen 16 Die Pflanzenzelle...
Zellen. Biologie. Kennzeichen des Lebens. Das Skelett des Menschen. Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen.
 1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
5 Alter und Wachstum
 Bäume Auftrag 14 5 Alter und Wachstum Ziel Ich bestimme das Alter eines Baumes. Auftrag Lies das Blatt Alter und Wachstum. Bestimme das Alter eines Baumes, indem du die Jahrringe zählst. Bestimme anhand
Bäume Auftrag 14 5 Alter und Wachstum Ziel Ich bestimme das Alter eines Baumes. Auftrag Lies das Blatt Alter und Wachstum. Bestimme das Alter eines Baumes, indem du die Jahrringe zählst. Bestimme anhand
Amphibien. Froschlurche (Kröten, Unken und Frösche)
 Auriedbewohner Arbeitsblatt 1 Amphibien Zu den Amphibien oder Lurchen gehören Salamander, Molche, Kröten, Unken und Frösche. Im Mittelland kommen 14 verschiedene Amphibienarten vor. Folgende 8 Arten kannst
Auriedbewohner Arbeitsblatt 1 Amphibien Zu den Amphibien oder Lurchen gehören Salamander, Molche, Kröten, Unken und Frösche. Im Mittelland kommen 14 verschiedene Amphibienarten vor. Folgende 8 Arten kannst
