stuttgarter leben stuttgart erleben
|
|
|
- Helmuth Förstner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft stuttgarter leben stuttgart erleben Kulturwissenschaftliche Erkundungen zur Gegenwart einer Stadt Herausgegeben von Anja Dauschek, Sarah Kubin-Scharnowski & Bernhard Tschofen
3 Projektgruppe Christoph Bareither, Ina Boner, Nina Giede, Stefanie Graf, Fanny Gutsche, Anja Hägele, Helene Hoffmann, Matthias Klückmann, Gerrit Knieps, Annelie Knust, Elisa Krücke, Charlotte Löffler, Martha Mazanek, Vincent Meissner, Katharina-Pia Müller, Sarah Nimführ, Dina Nurpeissova, Agnes Obenhuber, Sarah Petrasch, Susanne Prinzen, Sophie Rau, Zlatibor Ristic, Katie Rodgers, Annette Sandkötter, Marielle Schubert, Jochen Schwab, Gloria Simon Lopez, Eva Wächter, Ann-Christine Zeumer Projektleitung Anja Dauschek Bernhard Tschofen Projektassistenz Sarah Kubin-Scharnowski Gastautor Clemens Breuninger In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart Impressum Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Ein Titelsatz für diese Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhältlich ISBN 10: ISBN 13: Satz und Bildbearbeitung: Renate Deregowski indensity Balingen Fotograf: Zlatibor Ristic Umschlag und Gestaltung: Stephanie Kreber Art Direction, Werbung, Design Stuttgart Alle Rechte vorbehalten. Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.,
4 Inhalt Zugänge 13 Anja Dauschek & Sarah Kubin-Scharnowski Stuttgarter leben Stuttgart erleben Eine Dokumentation Stuttgarter Gegenwart zur Vorbereitung des Stadtmuseums Stuttgart Heimaten 29 Gerrit Knieps Willkommen in Stuttgart Vom Ankommen in einer Stadt 41 Sarah Nimführ Stuttgarter Melange Integrationserfahrungen in der Schwabenmetropole 57 Elisa Krücke & Katie Rodgers Hier fühle ich mich wohl. Wie soziale Beziehungen Heimat konstruieren 71 Eva Wächter, Annette Sandkötter & Vincent Meissner Materielle Bezugspunkte im Beheimatungsprozess 86 Annelie Knust & Charlotte Löffler Kulturschock Schwäbisch? Zur Bedeutung des Dialekts im vielsprachigen Stuttgart
5 Atmosphären und Ambivalenzen 103 Matthias Klückmann & Ann-Christine Zeumer Stuttgart: Ein Motor? Atmosphäre und Image einer Stadt 121 Stefanie Graf & Agnes Obenhuber Stadt und 1001 Städtle Stuttgart eine Synthese aus Dorf und Stadt 137 Sarah Petrasch rein, rauf, runter, raus Symbolische und soziale Unterschiede im Raum der Stadt Stuttgart 153 Katharina P. Müller Grün-Grau Wahrnehmungsspaziergänge zwischen gebauter, gedachter und gefühlter Stadt 175 Clemens Breuninger Zwischen Einkaufstrubel und Ruhepol Empirische Atmosphärenforschung in der Stuttgarter Königstraße 189 Fanny Gutsche & Zlatibor Ristic Wissen Sie, mir ist noch nichts passiert, aber Über das Leben und Erleben von (Un-)Sicherheit in Stuttgart 203 Marta Mazanek & Jochen Schwab Was mir am Senf gespart haben, tun mir am Kaviar wieder naus Wie die Stuttgarter ihre Stadtpolitik (mit)erleben 221 Susanne Prinzen Stuttgarter Träume, die auf Potentiale hinweisen Stadtleben 237 Marielle Schubert Das Stuttgarter Grün Zur Bedeutung der Natur für die Stuttgarter 251 Anja Hägele Heilig s Blechle Die Wahrnehmung des Stuttgarter Verkehrs zwischen Stau, Stadtbahn und Feinstaub 267 Helene Hoffmann & Sophie Rau Kultur im Kessel Warum der Schaffner einfach dazugehört 281 Nina Giede Consuming the City Einkaufsstadt Stuttgart 293 Ina Boner & Gloria Simon Lopez Die Stadt, die man kennt Wie Jugendliche eines Stuttgarter Jugendzentrums ihre Stadt erleben 309 Sarah Kubin-Scharnowski Kinder erleben Stuttgart Die Stadt aus der Sicht Fünf- und Sechsjähriger 327 Christoph Bareither Stuttgart erleben / Stuttgart erinnern Wie die Vergangenheit einer Stadt ihre Gegenwart gestaltet Anhang 347 Abbildungsverzeichnis 349 Dank 352 English Summary
6 Zugänge
7 Stuttgarter leben Stuttgart erleben Eine Dokumentation Stuttgarter Gegenwart zur Vorbereitung des Stadtmuseums Stuttgart Anja Dauschek & Sarah Kubin-Scharnowski Das Dümmste, was man bezüglich Stuttgart eigentlich tun kann, ist, etwas über die Stadt schreiben zu wollen so beginnt Heinrich Steinfest, Stuttgarter Autor Wiener Herkunft, seinen Essay Über den Umgang mit Stuttgart. Er tut dies an prominenter Stelle, im 2008 erschienenen Merian-Heft zur Stadt. 1 Fasst man Steinfests Diktum weiter, könnte man darunter auch den Versuch fassen, ein Museum über und für Stuttgart entwickeln zu wollen. Wir haben dieses Experiment 2007 begonnen, allerdings und dies ist Gegenstand dieser Publikation nicht ohne die Stuttgarter selbst zu Wort kommen zu lassen. Stuttgart ist, aktuell neben Wiesbaden, die einzige deutsche Landeshauptstadt, die bislang kein Stadtmuseum hat. Warum darüber lässt sich spekulieren. Weil das Stuttgarter Bürgertum im ausgehenden 19. Jahrhundert kein Bedürfnis nach Selbstdarstellung hatte? Oder weil die Stuttgarter lieber die Zukunft planen, als sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen? beschloss der Stuttgarter Gemeinderat, ein Stadtmuseum einzurichten und eröffnete damit die Chance, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Stadtmuseum neu zu denken. Das in diesem Band dokumentierte studentische Forschungsprojekt Stuttgarter leben Stuttgart erleben ist ein wichtiger Baustein für die Museumsplanung. Es Das Wilhelmspalais am Charlottenplatz, das zukünftige Museumsgebäude.
8 15 16 wurde realisiert als Kooperationsprojekt zwischen dem Planungsstab Stadtmuseum Stuttgart im Kulturamt der Landeshauptstadt und dem Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen. Ausgangspunkt für die von den Studierenden entwickelte Forschungsfrage Stuttgart: Wie (er)leben Menschen eine Stadt waren die Planungsprämissen, die 2007 für das Stadtmuseum definiert wurden: 3 Die Menschen und ihre Geschichte stehen im Mittelpunkt des Konzeptes. Das Konzept wird soweit möglich partizipativ entwickelt. Das Konzept verbindet Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt Stuttgart. Vermittlung ist ein zentraler Auftrag des Stadtmuseums. Das Stadtmuseum ist besucherorientiert und strebt eine hohe Erlebnisqualität an. Das zukünftige Stadtmuseum, so das Leitbild, soll nicht nur ein Ort der Geschichte Stuttgarts sein, sondern versteht sich als offenes und einladendes Forum für die Diskussion über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt. 4 Zentral für die Planung des Stadtmuseums als Museum von Bürgern für Bürger war und ist die Relevanz seiner Themen und ihrer Präsentationen für die Stadtbevölkerung. Deshalb sollen aktuelle Themen und Fragestellungen Ausgangspunkt der Annäherungen an Stuttgart sein. Auch die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen städtischen Identität ist ein Ziel des Museums 5 dazu ist es aber notwendig zu wissen, wie sich Menschen unterschiedlicher Hintergründe in der Stadtmetropole Stuttgart verorten und wie sie ihre lokale Identität definieren. Vor diesem Hintergrund entstand das gemeinsame, dreisemestrige Studienprojekt, in dem insgesamt 29 Studierende praktische Forschung erprobten. Die Ergebnisse des Projektes stellen für das zukünftige Stadtmuseum Stuttgart eine wichtige Planungsgrundlage dar, denn es sollte in Erfahrung gebracht werden, wie Stuttgarter ihre Stadt erleben, wie sie sich in der Stadt bewegen, welche Orte für sie von Bedeutung sind, an welche Orte Erinnerungen geknüpft sind, was sie an Stuttgart mögen, was sie gerne verändern würden, ob Stuttgart für sie Heimat ist. Dabei interessierten ausdrücklich das Unspektakuläre und Selbstverständlichkeiten. Fragen und Methoden orientierten sich, wie auch von Thomas Hengartner gefordert, an der alltäglichen Dimension der Urbanität, an Erfahrungen, Praxen und der Bedeutungsproduktion 6 der Bevölkerung. Das Forschungsprojekt fungierte in der Museumsplanung im Sinne einer Front-End Evaluation 7 als offene Erkundung über das Museumsobjekt Stadt und seine Protagonisten und war gleichzeitig eine Begegnung mit den zukünftigen Besucherinnen und Besuchern des Stadtmuseums. Ausgangspunkte des Projekts Das Forschungsprojekt nahm einerseits die umfangreichen theoretischen Diskurse über die Stadt und über das Urbane zum Ausgangspunkt, 8 andererseits die museologischen Diskussionen der letzten 30 Jahre. Gerade Stadtmuseen, die am Schnittpunkt dieser beiden Themen stehen, sind seit einigen Jahren in einem zunehmend sichtbaren Wandel begriffen. Mit ihren heterogenen Sammlungen und eher unspezifischen Themenstellungen führten sie lange Zeit eher ein Mauerblümchendasein in der Museumswelt. Aber mit der Entdeckung der Stadt als Thema erlebt dieser Museumstyp eine Renaissance, denn the city museum is increasingly focusing on the city itself. The city has become the artefact. [ ] The contemporary is seen as worthy of record and debate. 9 Ablauf des Forschungsprojektes Ziel des dreisemestrigen Projektes war es, mit leitfadengestützten Interviews und anderen, im Verlauf der Arbeit entwickelten Methoden, die Beziehungen der Stuttgarter zu ihrer Stadt zu untersuchen. Das Forschungsvorhaben zielte auf eine akteurszentrierte Dokumentation und Analyse von Stuttgarter Lebensläufen und Lebensstilen ab, den darin manifesten räumlichen Orientierungen und (auch symbolischen) Ordnungen der Stadt. Unter dem Seminartitel HeimatStadt Stuttgart wurden im ersten Projektsemester gemeinsam die theoretischen Grundlagen der aktuellen Stadtforschung erarbeitet und die möglichen Forschungsmethoden sondiert. Der Einstieg in die Stadt Stuttgart fand im Rahmen einer zweitägigen Exkursion im Juni 2008 statt. In drei Gruppen wurde die Stadt erkundet. Insgesamt 23 Experten führten die Studierenden an ebenso vielen Orten in bekannte und unbekannte Bezirke und Themen der Stadt ein. Viele der dort geknüpften Kontakte halfen bei der weiteren Forschung. Das zweite Semester stand unter dem Zeichen der praktischen Arbeit im Feld. Die Studierenden führten im Herbst leitfadengestützte Interviews. Eine repräsentative Befragung war im Rahmen des studentischen Forschungsprojektes nicht möglich und im Hinblick auf den qualitativen Charakter der Forschung auch nicht erforderlich. Ziel war es, unterschiedliche Blicke auf Stuttgart (s. u.) kennen zu lernen: Blicke von Menschen, die schon ihr ganzes Leben in Stuttgart verbringen oder erst vor kurzem in die Stadt gezogen sind. Blicke von jungen und von älteren Menschen, Blicke von in Deutschland Geborenen und von Migranten. Dennoch muss hier angemerkt werden, dass gerade der Anteil der Interviewpartner mit Migrationshintergrund mit 9 Personen nicht so hoch ausfiel wie erhofft. Die Interviewkontakte kamen über Aufrufe in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften zustande 1. Insgesamt meldeten sich 79 Personen, 70 davon wurden von den Studierenden des Forschungsprojekts interviewt. Die Altersspanne der Befragten reichte von 16 bis 81 Jahren, der Altersdurchschnitt lag bei 50 Jahren 2, was die relativ hohe Beteiligung von Frauen und Männern im Rentenalter widerspiegelt. Frauen waren mit 42 Personen gegenüber 28 Männern überrepräsentiert. Er-
9 17 18 freulicherweise waren die Wohnorte der Interviewpartnerinnen und -partner über das gesamte Stadtgebiet verstreut, so dass Berichte aus den unterschiedlichsten Stadtteilen dokumentiert werden konnten. Da sich kaum Jugendliche und nur vergleichsweise wenige Menschen mit Migrationshintergrund auf die Zeitungsaufrufe gemeldet hatten, wurden hier gezielt weitere Gesprächspartner gesucht und gefunden. Ergänzend zu den oben beschriebenen Interviews mit Einzelpersonen kamen so etwa 30 Experten- und Gruppeninterviews mit Kindern, Jugendlichen, Stuttgarter mit Migrationshintergrund oder bestimmten Berufs- oder Interessensgruppen zustande. 3 Zur Ergänzung und Vertiefung des Interviewmaterials wurden außerdem von mehreren Forscherinnen und Forschern Wahrnehmungsspaziergänge, teilnehmende Beobachtungen und ethnographische Beschreibungen durchgeführt. Alle Leitfadeninterviews starteten mit dem jeweils eigenen Bild von Stuttgart jede Gesprächspartnerin und jeder Gesprächspartner zeichnete zu Beginn des Interviews eine persönliche kognitive Karte ( Mental Map ) der Stadt. Einige der Karten sind hier im Band abgebildet. Sie waren der Einstieg in das Interview und halfen Interviewtem und Interviewer, sich zu verorten. Im dritten Semester wurden die Ergebnisse gesichtet und geordnet. Die Forschungsgruppe definierte Themen, recherchierte wo nötig noch einmal nach und verfasste die hier nachfolgenden Essays. Neben der vorliegenden Publikation entstanden noch weitere Produkte des Projektes: eine öffentliche Präsentation im zukünftigen Museumsgebäude, dem Wilhelmspalais im Juli 2009, eine Webseite zu den Ergebnissen ( eine kleine Ausstellung der Mental Maps im Museum Hegel-Haus und eine stadtweite Plakataktion mit besonders treffenden Zitaten aus den Interviews. Zusätzlich wurden sechs ausgewählte Interviewpartner in einer Serie der Stuttgarter Nachrichten im Sommer 2009 vorgestellt. 1 In folgenden Blättern erschienen Aufrufe: Amtsblatt der Stadt Stuttgart ( ), Stuttgarter Nachrichten ( ), Stuttgarter Zeitung ( ), Lift Stuttgart (Heft November 2008), Elternzeitung Luftballon ( ), Wilih ( ). 2 Die Aufteilung der Interviewpartner in Altersklassen: Jahre: 1 Person, Jahre: 9 Personen, Jahre: 14 Personen, Jahre: 11 Personen, Jahre: 9 Personen, Jahre: 18 Personen, Jahre: 6 Personen, Jahre: 1 Person. Museologischer Hintergrund: Alltagsgeschichte, Biographien, Migration In Stadtmuseen und in den kulturhistorischen Museen insgesamt sind mit Beginn der 1980er Jahre und verstärkt in den 1990er Jahren Veränderungen zu beobachten, sowohl in den Strukturen von Museen, in der Wahl der narrativen Strategien und Produktionsformen als auch im Sammlungswesen. Zum einen fand die Alltags- und Sozialgeschichte ihren Weg von den Universitäten in die Museen und veränderte dort die Ausstellungsnarrative. Aufsehen erregte etwa die Neukonzeption des Ruhrlandmuseums in Essen im Jahr 1984, die die Geologie des Ruhrgebietes mit der Sozialgeschichte seiner Industrialisierung verknüpfte und mit innovativen Präsentationsformen wie Objektensembles und inszenierten Bildräumen arbeitete. 10 Als weitere Beispiele wären zu nennen die Ausstellung Feuer und Flamme (1994/1995 im Gasometer Oberhausen) 11 oder Sonderausstellungen des Deutschen Hygienemuseums Dresden (etwa Unter anderen Umständen. Zur Geschichte der Abtreibung, 1993; Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte, 1995) 12. In den 1980er Jahren begannen Museen auch, biographische Ansätze für Ausstellungen, Sammlung und Forschung zu nutzen. Diese persönliche, individuelle Ebene ermöglichte einen fristiges Forschungsprojekt zum Thema Migrations- 3 Parallel zu HeimatStadt Stuttgart wurde ein langgeschichte begonnen. In einem ersten Schritt werden weniger abstrakten, verständlicheren und menschlicheren 13 Mitglieder von Migrantenkulturvereinen kontaktiert und Gruppen- und Einzelinterviews geführt. Zugang zur Geschichte. Carola Lipp spricht in diesem Zusammenhang auch von einer subjektorientierten Darstellungsweise 14 von Dingen, Themen und Geschichte(n). Ziel der neuen Ausstellungsnarrative war, dem Besucher durch individuelle Biographien eine größere Nähe zu früheren (und heutigen) Lebenswirklichkeiten zu ermöglichen. Ein neues Thema für kulturhistorische Museen und Stadtmuseen im Rahmen biographischer Arbeit ist dabei auch der Bereich Migration. Ein Pilotprojekt dazu war im Jahr 1998 die Ausstellung Fremde Heimat. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei des Ruhrlandmuseums Essen in Zusammenarbeit mit DOMiT. 15 Weitere Beispiele sind die Alltagsdokumentation von 25 Migrantenfamilien unter dem Titel Born in Europe (Heimatmuseums Neukölln, 2004) 16 und das Projekt Villa Global des Jugendmuseums Berlin-Schöneberg. Die Villa Global umfasst 14 sehr detailreich eingerichtete Zimmer, die die Vielfalt der Lebensgeschichten realer Schöneberger, ihre Gewohnheiten, Ansichten, Träume und Wünsche lebendig werden lassen. 17 Gegenwart sammeln und ausstellen Museales Sammeln und Ausstellen bezieht sich heute nicht mehr nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Lebensbedingungen und die Sachkultur der Gegenwart. Neue Sammlungsstrategien basieren auf der Vorstellung, das kulturgeschichtliche Museum sei auch Museum für morgen, eine Dokumentationsstätte für die Überlieferung der Gegenwart 18. Vorteile des Gegenwartsammelns und -dokumentierens sind die vergleichsweise preisgünstige Objektbeschaffung, die bewusste Auswahl von Objekten durch zeitgenössische Experten und die Möglichkeit, die gegenwärtige Generation ihr Leben aus der eigenen Sicht für zukünftige Generationen beschreiben zu lassen. Ein Nachteil ist das breite Spektrum und die Masse möglicher Objekte und Themen. Was soll, kann, muss gesammelt und festgehalten werden? Eine historische Bewertung ist beim Sammeln des Gegenwärtigen nicht möglich, dementsprechend schwer fällt die Auswahl.
10 19 20 Fußballtrikot einer Fußballmannschaft, deren Mitglieder Mitte der 1990er-Jahre überwiegend in einer Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart- Plieningen wohnten. Seit 2007 ist das Trikot Teil der Sammlung des zukünftigen Museums. Bekanntestes Beispiel der musealen Gegenwartsdokumentation ist das Programm SAMDOK, 19 ein langfristig angelegtes, umfangreiches Gemeinschaftsprojekt 80 schwedischer Museen. Doch auch in Deutschland wird die Gegenwart dokumentiert und ausgestellt: Aus der Materialfülle der Objektkultur des 20. Jahrhunderts 20 entnahm zum Beispiel das Westfälische Freilichtmuseum Detmold fünf komplette Kinder- und Jugendzimmer und zeigte diese in der Ausstellung ZimmerWelten. Das Focke-Museum Bremen forderte unter dem Titel Meine Sache. Bremens Gegenwart. die Bevölkerung auf, persönliche Erinnerungen an das letzte Jahr und einen Gegenstand, der dafür steht ins Museum zu bringen. 21 Auch Berg der Erinnerungen 22, eine Ausstellung des Landesmuseums Joanneum zur Kulturhauptstadt Graz 2003 machte die Grazer Bevölkerung zu Sammlern persönlicher Grazer Erinnerungen. Gegenwarts- bzw. Zeitdiagnose ist, so Udo Gößwald, ein Topos musealer Praxis, mit dem Museen ihren Besuchern Angebote zur Interpretation [ihrer] Wirklichkeit 23 bieten können. Die Darstellung und Reflektion des Gegenwärtigen ermöglicht und verlangt von Museen, mit ihrem Publikum in Dialog zu treten einen Dialog der nicht retrospektiv, sondern auf individuelle und gruppenspezifische Zukunftsentwürfe 24 angelegt sein sollte. Diese Aufgabe ist gerade in den immer komplexer werdenden Städten kein einfacher Auftrag. Wegweisende Beispiele für dialogorientierte Museumskonzepte finden sich insbesondere im angloamerikanischen Raum. So sammelte das Liverpool Museum im Rahmen seiner Neukonzeption unter dem Motto eighthundredlives tell us your stories of Liverpool life 800 persönliche Geschichten über und mit der Stadt, um so the experiences, hopes and aspirations of the people of Liverpool in the last 60 years 25 repräsentieren zu können. Ähnlich setzte das Stadtmuseum Newcastle einen people-based approach um. 26 Im Fokus der Museen befinden sich auch Stimmen, die sonst nur selten gehört werden: In der Dauerausstellung London, Sugar & Slavery des Museums in den Docklands zum Beispiel wird London als Schauplatz des transatlantischen Sklavenhandels im 18. und 19. Jahrhundert präsentiert. Durch persönliche Geschichten, Filme, Musik, Objekte und Hands-on-Aktivitäten wird die historische Migra tionserfahrung mit der Gegenwart britisch-karibischer Beziehungen verknüpft. 27 Und das Museum of London veröffentlichte 2006/2007 in der Sonderausstellung Belonging: Voices of London s Refugees die Geschichten von (auch illegalen) Flüchtlingen. 28 Museum und Stadt Museen gehören zum Image einer Stadt, ein Stadtmuseum hat dabei gleichzeitig die Aufgabe, das Bild der Stadt zu zeichnen. Das Stadtmuseum des 21. Jahrhunderts kann sich dabei nicht mehr nur auf die Interpretation der Geschichte der Stadt beschränken. Vielmehr muss es vielfältige Perspektiven auf die zeitgenössische Stadt ermöglichen und Reaktionen auf die ständige Veränderung erlauben, die Städte durchlaufen. 29 Im besten Falle ist ein Stadtmuseum a hub of connectivity, a docking station for people, ideas, discourse 30 und kann so kritisch-reflektierend an der Entwicklung einer Stadt aktiv teilnehmen. Die Rahmenbedingungen für die Planung eines Stuttgarter Stadtmuseums, zu dem das Forschungsprojekt beitragen sollte, sind dabei zu Beginn des neuen Jahrhunderts hinsichtlich Thema und Publikum gleichermaßen herausfordernd: Städte werden heute nicht mehr durch eine Stadtmauer oder politisch-territorial definiert sie sind keine isolierten Einheiten. Sie sind transnationale Knotenpunkte mit schwer zu definierenden Grenzen, die nicht nur in die Region wirken, sondern international vernetzt sind. Global Cities und Second Cities haben, so Saskia Sassen, Nationalstaaten in ihrer ökonomischen Bedeutung abgelöst. 31 Stuttgart ist zwar weder Global noch Second City, aber dennoch geprägt von den Aktivitäten international agierender Konzerne und weist über seine Gemarkungsgrenze hinaus. Gleichzeitig gibt es hier neben urbanen Strukturen auch stark ländliche geprägte Stadtbezirke:
11 21 22 Der Stuttgarter Kessel und seine Hänge. Die Weinberge beginnen hinter der Konzernzentrale von Daimler. Großstädte sind in deutlichem Kontrast zu Kleinstädten und ländlichen Gemeinden Orte großer Vielfalt. Insbesondere Migration prägt urbane Strukturen und das, was als Globalisierung verhandelt wird, findet in der unmittelbaren städtischen Nachbarschaft statt. Das gilt besonders für Stuttgart die Stadt hat den höchsten Anteil von Einwohnern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Ob Stuttgart viel schöner ist als Berlin 32 mag zu diskutieren sein, ähnlich bunt ist es sicherlich. Die Bewohner von Städten sind mobil und Städte stehen heute in einem globalen Wettbewerb um Image und Köpfe ausgedrückt in Städterankings aller Art. Das Image einer Stadt ist entscheidend, um die Creative Class 33 anzulocken und zu binden. Und dies wiederum entscheidet über den Erfolg und das Wachstum einer Stadt. Hier steht eine Stadt wie Stuttgart mit Blick auf potentielle Unternehmer, Arbeitnehmer aber auch Studierende nicht nur im Wettbewerb mit anderen deutschen Städten, sondern mit Städten weltweit. Die Stuttgarter und ihre Stadt Wie also sehen die Stuttgarter ihre Stadt? In den Interviews wurden mit großer Offenheit alltägliche Gepflogenheiten, biographische Ereignisse, Lieblingsorte und schöne Seiten Stuttgarts, aber durchaus auch Kritisches und Veränderungswürdiges geschildert. Die Bereitschaft, dem noch nicht existierenden Stadtmuseum Auskunft über das eigene Leben in Stuttgart zu geben, war groß die Stadt und ihr Habitus sind also durchaus ein Thema für die Stuttgarter. Das ist ein erstes und wichtiges Fazit des Projektes. Die Ergebnisse der insgesamt 100 Interviews lassen sich nur schwer zusammenfassen, denn Stuttgart wurde zum Teil sehr unterschiedlich, teilweise auch widersprüchlich beschrieben. Dennoch werden auch Überschneidungen und Parallelen in den Sichtweisen der Befragten deutlich, sie verweisen auf das für Stuttgart Typische : Das ist die naturräumliche Gliederung der Stadt, vor allem die Kessellage, und die damit verbundenen sozialen Topographien der Stadtteile und Wohngebiete. Auch wenn viele Stadtteile nicht im oder am Kessel liegen. Auch die früheren Erfahrungen in und mit der Stadt spielen für die Befragten eine wichtige Rolle. Erinnerungen an ein vergangenes oder erzähltes Stuttgart sind wichtige Folien für die Wahrnehmung und Einordnung der gegenwärtigen Stadt und ihrer Entwicklungen. In einer Stadt, die sich nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges und mit dem nachfolgenden Umbau zur Autostadt radikal veränderte, ist diese erinnerte Stadt ein wichtiger Bezugspunkt für das Stadtmuseum. In vielen Interviews wird auf Widersprüche in der Stadt Bezug genommen die Stuttgart traditionell nachgesagte Dialektik scheint durch eigene Erfahrungen untermauert oder sogar zur Grundlage von Wahrnehmungen zu werden. So sind für die Befragten sowohl typisch dörfliche als auch städtische Atmosphären spürbar, je nachdem, auf welche Stadtviertel Bezug genommen wird. Ein anderer, häufig beschriebener Gegensatz ist das deutlich wahrgenommene Spannungsverhältnis zwischen grau und grün, zwischen Architektur, Beton (und dem prominenten Kennzeichen Autostadt ) auf der einen und auffallend viel Natur, Weinbergen, Wald und Parks auf der anderen Seite. Auch die häufige Feststellung, Stuttgart werde oft unterschätzt, oder sei eine Stadt, die ihre Qualitäten erst auf den zweiten Blick zu erkennen gebe, macht deutlich, dass für viele der Befragten ein Widerspruch zwischen der (angenommenen) Außen- und ihrer persönlichen Innenperspektive auf Stuttgart besteht. Stuttgart ermöglicht offensichtlich seinen Bewohnern unterschiedliche Optionen der Beheimatung. Orte, soziale Beziehungen, Dialekt und/oder materielle Gegebenheiten bieten ein Geflecht von affektiven Bezugspunkten, die von den Befragten unterschiedlich gewertet und in Beziehung gesetzt werden. Stuttgart kann einzige, erste, zweite oder dritte Heimat sein, für manche ist und bleibt die Stadt aber auch fremd. Themen, die die Stuttgarter beschäftigen und zu kontroversen Positionen veranlassen sind darüber hinaus das Projekt Stuttgart 21, Sicherheit und Unsicherheit in der Stadt, Natur, Verkehr, Freizeitgestaltung, Migration und Integration. Diese Themen, aber auch Atmosphären und Images und der besondere Blick von Kindern und Jugendlichen auf die Stadt sind Gegenstand der folgenden Essays.
12 23 24 Ein Schritt weiter auf dem Weg zum Stadtmuseum Wie werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts in die Konzeption des Stadtmuseums einfließen? Menschen und ihre Lebenserfahrungen als Besucher ebenso wie als Akteure der Stadtgeschichte sollen im Zentrum des Museums stehen. 34 Dazu trägt Stuttgarterleben in zweifacher Hinsicht bei: Zum einen können die oben beschriebenen, typischen Merkmale als konzeptionelle Ausgangspunkte genutzt werden. In den Beschreibungen spiegeln und vermischen sich individuelle Wahrnehmungen mit gängigen Images der Stadt mit diesen Bildern im Kopf werden viele der zukünftigen Besucher ins Museum kommen. Die Museumserzählung kann diese Stuttgart-Images nutzen, hinterfragen und differenzieren. Interessant sind unter anderem die Gedächtnisorte und Landschaften, auf die sich die Interviewten immer wieder beziehen. Angesichts der Altersstruktur der Befragten wird es für die Konzeption des Museums wichtig sein, eine weitere Befragung jüngerer Stuttgarter durchzuführen. Zum anderen profitiert das Stadtmuseum von der Bandbreite individueller Beobachtungen, die mit den transkribierten Interviews vorliegen. Mit den vorliegenden Essays wurde eine erste thematische Zusammenschau erstellt der Fundus an möglichen Geschichten und Gegenwartsbezügen, die sich aus den Interviews und den ausdrucksstarken Mental Maps ergeben, ist jedoch weit größer. Auch wenn mit diesem Projekt keine Objekte für das Museum gesammelt werden konnten, entstand mit den Mental Maps eine eigene neue Objektgattung, die für die Ausstellung, aber auch für die Vermittlungsarbeit interessante Impulse gibt. Das Stadtmuseum hat mit diesem Forschungsprojekt einen ersten Schritt dahingehend gemacht, durch das Sammeln von Geschichten Wissen über die Stadt zu generieren. Diesem ersten Forschungsschritt müssen weitere folgen, vor allem aber muss dieses Wissen im Museum so umgesetzt werden, dass die Besucher die in den Interviews begonnene Auseinandersetzung mit der Stadt in den Präsentationen des Museums selbst fortsetzen können. Anmerkungen 1 Heinrich Steinfest: Über den Umgang mit Stuttgart. In: Merian Stuttgart. Heft 4/2008, S Die Anfänge der heute vorhandenen städtischen Sammlung gehen auf das Jahr 1928 und die Gründung des Stadtarchivs zurück. Obwohl es temporäre Ausstellungen dieser stadtgeschichtlichen Sammlung gab, wurde nie ein eigenes Museum eingerichtet. 3 Landeshauptstadt Stuttgart Gemeinderatsdrucksache GRDrs 612/2007, November Eine ständige Ausstellung auf ca. 1000m² wird das Herz des künftigen Museums. Sie präsentiert die Geschichte und Gegenwart der Stadt auf einen Blick und im thematischen Detail. Hinzu kommen ein StadtLabor als eigener Bereich für Kinder und Jugendliche, in dem Gegenwart und Zukunft der Stadt analysiert und geplant werden können, ein Sonderausstellungsbereich, Veranstaltungs- und Vermittlungsangebote für verschiedene Altersgruppen und als Verbindung von Besucherservice, Vertiefungsangeboten und aktueller Information der sogenannte StadtRaum mit Museumscafé. Vgl. Planungsstab Stadtmuseum Stuttgart: Ein Stadtmuseum für Stuttgart. Stuttgart 2009, S Ebd., S Thomas Hengartner: Zur Kulturanalyse der Stadtforschung. In: Beate Binder u. a. (Hg.): Ort. Arbeit. Körper. Ethnografie Europäischer Modernen. 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Berlin Münster u. a. 2005, S , hier S Zum Thema Vorab-Erkundung und -evaluation in Museen vgl. etwa Armin Klein: Besucherbindung im Kulturbetrieb. Ein Handbuch. 2. Aufl., Wiesbaden 2008, S. 78ff und Annette Noschka-Roos: Besucherforschung und Didaktik: ein museumspädagogisches Plädoyer. Opladen 1994, S. 178f. 8 Städte wurden mit dem spatial turn zu einem der zentralen Themen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Vgl. Doris Bachmann-Medick: Spatial Turn. In: Dies.: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. 3. Aufl., Reinbek 2009, S Ian Jones: Cities and Museums about them. In: Ders./Robert R. Macdonald/Darryl McIntyre (Hg.): City Museums and City Development. Lanham u. a. 2008, S. 1-15, hier S. 5. Ian Jones ist Sekretär der Fachgruppe CAMOC (Collections and Activities of Museums of Cities) im International Council of Museums ICOM. 10 Vgl. Felicitas Weil u. a.: Zur Konzeption und Gestaltung der industrie- und sozialgeschichtlichen Ausstellung. In: Dies.: Ruhrlandmuseum Essen. Braunschweig 1986, S Ulrich Borsdorf (Hg.): Feuer & Flamme. 200 Jahre Ruhrgebiet. Essen Gisela Staupe (Hg.): Unter anderen Umständen. Zur Geschichte der Abtreibung. Berlin Wilderotter, Hans (Hg.): Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte. Berlin Nina Hennig: Lebensgeschichte in Objekten. Biografien als museales Sammelkonzept. Münster 2004, S Carola Lipp: Zum Verhältnis von Alltagskultur- und Sachkulturforschung. Eine Antwort auf die kritischen Anmerkungen der Museologen Helmut Ottenjann und Uwe Meiners. In: Volkskunde in Niedersachsen 2. Cloppenburg 1994, S , hier S. 85. Frühe biographisch arbeitende Ausstellungen waren u. a. Walter: *1926, 1945 an der Ostfront im Historischen Museum Frankfurt (Vgl. Cornelia Rühlig/Jürgen Steen: Walter: *1926, 1945 an der Ostfront. Leben und Lebensbedingungen eines Frankfurter Jungen im III. Reich. Frankfurt/M ) und Karl Sauer Annäherungen an das Leben eines Buchdruckers im Hamburger Museums der Arbeit (Vgl. Rolf Bornholdt: Lebensgeschichten als Sammlungsaufgabe und Ausstellungsthema. In: Ders. (Hg.): Ein Mensch kommt ins Museum. Lebensgeschichten als Sammlungsaufgabe und Ausstellungsthema. Hamburg 1990, S )
13 Aytaç Eryilmaz/Mathilde Jamin (Hg.): Fremde Heimat. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Essen DOMiT wurde 1990 als Initiative von türkischstämmigen Migranten als Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei gegründet. Seit 2002 berücksichtigt der Verein bei seinen Forschungs- und Ausstellungsprojekten auch andere Länder und heißt jetzt DOMiD Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V.. 16 Museum Neukölln (Hg.): Born in Europe. Begleitband zur Sonderausstellung im Martin- Gropius-Bau vom Berlin Elektronisches Dokument. URL= villaglobal.de/ [ ]. Auch die Völker- und Volkskundlichen Museen in Berlin arbeiten mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammen: Elisabeth Tietmeyer: Wie gegenwartorientiert können ethnologische Museen Kulturen der Welt darstellen? In: Martina Krause/Dagmar Neuland-Kitzerow/Karoline Noack (Hg.): Ethnografisches Arbeiten in Berlin. Wissenschaftsgeschichtliche Annäherungen. Münster u. a Martin Ruch: Tod und Sterben in Offenburg: Ein Projekt der Gegenwartsdokumentation. In: Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg (Hg.): Museumsarbeit. Zwischen Bewahrungspflicht und Publikumsanspruch. Stuttgart 1992, S , hier S Vgl. Britt Bogren Ekfeldt: Samtidsdokumentation: SAMDOK Gegenwartsdokumentation in Schweden. In: Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg (Hg.): Museumsarbeit. Zwischen Bewahrungspflicht und Publikumsanspruch. Stuttgart 1992, S Vgl. auch: Eva Kjerström Sjölin: Fokus Gegenwart: Die aktuelle Diskussion und Praxis der Dokumentation schwedischer Museen. In: Jan Carstensen (Hg.): Die Dinge umgehen? Sammeln und Forschen in kulturhistorischen Museen. Münster u. a. 2003, S Jan Carstensen/Claudia Richartz-Sasse: ZimmerWelten im Museum. Zur Dokumentation und Sammlung gegenwärtiger Wohnkultur junger Menschen. In: Jan Carstensen/Thomas Düllo/Claudia Richartz- Sasse (Hg.): ZimmerWelten. Wie junge Menschen heute wohnen. Ausstellungskatalog, Essen 2000, S. 8-26, hier S. 8. Vgl. auch: Claudia Richartz-Sasse: Ausgestellte Gegenwart: ZimmerWelten. Zur aktuellen Sammlungsstrategie des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold. In: Uwe Meiners (Hg.): Materielle Kultur. Sammlungs- und Ausstellungsstrategien im historischen Museum. Referate der 14. Tagung der Arbeitsgruppe Sachkulturforschung und Museum in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. Cloppenburg 2002, S Focke-Museum: Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Hg.): Meine Sache. Bremens Gegenwart. Ein Ausstellungsprojekt des Focke-Museums und des Master-Studiengangs Kunst- und Kulturvermittlung der Universität Bremen. Bremen 2006, S Elektronisches Dokument. URL= graz03.at/servlet/sls/tornado/web/2003/con tent/2530e0a20981c3a6c1256b0e004fa2 DA [ ]. 23 Udo Gößwald: Museum und kultureller Dialog. In: Ders./Rita Klages (Hg.): Stadtkultur im Museum. Ein Haus in Europa. Bd. 2. Leverkusen 1996, S , hier S Ebd., S Vgl. auch: Udo Gößwald: In einem anderen Licht. Heimatbegriff und Erinnerungsarbeit. In: Joachim Meynert/Volker Rodekamp (Hg.): Heimatmuseum Ausgangspunkte und Perspektiven. Bielefeld 1993, S Elektronisches Dokument. URL= eighthundredlives.org.uk [ ]. 26 David Fleming: The City A Wondrous Place? In: Renée Kistemaker (Hg.): City museums as centres of civic dialogue? Amsterdam 2006, S , hier S Zum Beispiel wurde eine Ausstellungsreihe mit dem Titel People s Gallery eingeführt, in der verschiedene Gruppen der Stadtbevölkerung Präsentations- und Ausstellungsprojekte (mit-)gestalten können. 27 Pressemitteilung zur Ausstellung: Elektronisches Dokument. URL= museumindocklands.org.uk/nr/rdon- lyres/c0cd2d0d-1ed cf- 03DA3014A4DF/0/LSS_press_pack.pdf [ ]. 28 Ausschnitte können als Audiodateien auf der Homepage des Museums angehört werden. Elektronisches Dokument. URL= EventsExhibitions/Community/Belonging/. 29 Claudia Haas: Das Stadtmuseum des 21. Jahrhunderts Mehr Fragen als Antworten. In: Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.): Ein Stadtmuseum für das 21. Jahrhundert. Ergebnisse eines internationalen Expertenhearings im Rahmen der Planung für das Stadtmuseum Stuttgart. Stuttgart 2007, S , hier S. 30f. 30 Klaus Müller: City Museums as a hub of connectivity. In: Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.): Ein Stadtmuseum für das 21. Jahrhundert. Ergebnisse eines internationalen Expertenhearings im Rahmen der Planung für das Stadtmuseum Stuttgart. Stuttgart 2007, S , hier S Saskia Sassen. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton Vgl. auch: Dies. Metropolen des Weltmarkts. Die neue Rolle der Global Cities. Frankfurt/M Stuttgart ist viel schöner als Berlin war der Slogan der deutschen Fans zur Fußball-WM (Durch die Niederlage gegen Italien verpasste die deutsche Mannschaft das Endspiel in Berlin und trat stattdessen in Stuttgart im Spiel um den dritten Platz an.) 33 Vgl. u. a. Richard Florida: The Rise of the Creative Class. New York, Vgl. auch: Charles Landry: The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. London Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.): Ein Stadtmuseum für das 21. Jahrhundert. Ergebnisse eines internationalen Expertenhearings im Rahmen der Planung für das Stadtmuseum Stuttgart. Stuttgart 2007, S. 10.
14 Heimaten
15 Willkommen in Stuttgart Vom Ankommen in einer Stadt Gerrit Knieps Stuttgart, naja, was ist Stuttgart? Es war so n bisschen weißer Fleck auf der Landschaft. 1 Ankommen Willkommen in Stuttgart 2 begrüßt die Informationsbroschüre der Stadt Stuttgart Neubürger. Willkommen in der Stadt, willkommen in einem neuen Umfeld, neuen Lebensabschnitt, neuen Leben? Die Stadt begrüßt die Neubewohner persönlich, als wäre sie ein einzelnes Individuum und nicht der Ausdruck einer großen Masse Menschen, Strukturen, Vorstellungen und Handlungen. Diese lassen erst in ihrer Kombination und Menge die Stadt Stuttgart zu dem werden, was sie ist. Und ähnlich dem Ankommen in einer neuen sozialen Gruppe, das sich durch die klassischen Schritte des ersten Herantastens, des Aushandelns der eigenen Rolle und dem Festigen der Beziehung und eigenen Position auszeichnet, gestaltet sich das Ankommen in einer Stadt. Dieser Essay handelt von Personen, die nicht für einen kurzfristigen Aufenthalt nach Stuttgart kommen, sondern sich für einen dauerhaften Zeitraum in Stuttgart niederlassen. Stuttgart ist die Stadt mit einer der höchsten Zuwanderungsraten unter den deutschen Großstädten, die sich konstant in einem Spannungsfeld zwischen den Original-Stuttgartern, zugezogenen Binnenmigranten und einem sehr großen Anteil an Migranten (siehe auch: Stuttgarter Melange ) befindet. Bisher fehlen allerdings Studien dazu, wie sich für diese letzten beiden Gruppen das Ankommen in Stuttgart gestaltet. Wie nehmen sie die Stadt anfangs wahr? Wie begegnen sie den vorherrschenden, schwäbischen Mentalitätsstrukturen? Warum fiel die Wahl auf Stuttgart?
16 31 32 Einfahrt in den Stuttgarter Hauptbahnhof für viele der erste Blick auf die Stadt. Was für Anreize und Vorstellungen gibt es vor der Ankunft? Und wie sieht schließlich die Realität danach aus? Dies ist zugleich auch die Hauptfrage: Wie ist die Realität, die das Leben in Stuttgart erzeugt, im Gegensatz zu den noch davor herrschenden Wünschen und Vorstellungen? Da ein Teil der Interviewpartner aus dem Interviewkorpus des Projekts schon einmal in der Situation des Neu-Ankommens in Stuttgart war, bietet sich genügend Untersuchungsmaterial, um sich den oben genannten Fragen anhand exemplarischer Geschichten zu nähern. Da sich ein anderer Beitrag mit einem ähnlichen Phänomen beschäftigt, wird hier auf die Geschichten von Binnenmigranten eingegangen, die nochmals in einer anderen Situation verankert sind. Beginnen wir die Untersuchung mit der grundlegenden Frage nach dem Grund: Wie kommt es zu Binnenmigration? Binnenmigration Die Frage ist an sich gar nicht so einfach gestrickt, wie sie im ersten Moment klingen mag. Binnenmigration ist ein viel untersuchtes Thema, das sich mit den prinzipiellen Fragestellungen nach Beweggründen und Faktoren für das Verlassen eines Ortes und die Wahl eines anderen auseinandersetzt. Binnenmigration versteht man generell als Wanderung innerhalb eines Gebiets 3, wobei dies ein Staat oder auch eine Region sein kann. Das ist nicht sehr trennscharf, zeigt aber deutlich, dass es sich um eine Form räumlicher Mobilität handelt, die zu neuen Möglichkeiten und Chancen führt. Je geringer die zu überwindende Distanz ist, umso häufiger finden Wanderungen statt. Daraus lässt sich ableiten, dass Menschen versuchen großräumige Wanderungen zu vermeiden, so dass starke Motive vorliegen müssen, die sie bewegen ihren Herkunftsort zu verlassen. Um 1970 konkretisierte und schematisierte Michael P. Todaro als einer der Ersten die Beweggründe für (Binnen-)Migration mit einem push/pull Modell. 4 Das mittlerweile etwas angestaubte Modell macht die grundlegenden Vorgänge jedoch deutlich: Push-Faktoren werden als Bedingungen am Herkunftsort dargestellt, die als abstoßend oder bedrohlich empfunden werden und Menschen dazu bewegen ihre Heimat zu verlassen. Pull-Faktoren dagegen existieren in der Zielregion, in dem sie etwas bieten, was einfach gesagt anziehend wirkt. 5 Potentielle Binnenmigranten wägen also ab, was die Herkunftsregion zu bieten hat, welche abstoßenden ( push ) und welche anziehenden ( pull ) Faktoren vorhanden sind und vergleichen diese mit den Push- und Pull-Faktoren der potentiellen Zielregion. Pull-Faktoren können z. B. höhere Arbeitslöhne oder ein größeres Jobangebot sein, aber auch günstigere Mieten, ein besseres kulturelles Angebot, die regionale Ausstattung an sozialer Infrastruktur sowie auch die subjektiven Bewertungen der Lebensqualität, und vieles mehr. Todaros Modell geht allerdings nicht sehr weit über die Ergebnisse der allgemeinen Migrationsforschung hinaus. Das Modell ist nicht binnenmigrations-spezifisch und ignoriert einige Faktoren, die nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene funktionieren, wie das Image, die Bindung an die Herkunftsfamilie, die Aussichten zur Familiengründung, die Identifikation mit der Region und auch die Heimatliebe als Gebundenheit an die eigene Herkunft. Für all diese Maßstäbe gibt es noch keine abschließenden Untersuchungskriterien, sie nehmen aber auch das einzelmenschliche Handeln nicht in Betrachtung. Die bessere Wohnsituation oder Lohndifferenzen selber handeln nicht, sondern wirken sich nur aus, wenn Menschen sich von ihnen in ihrem Handeln stärker bestimmen lassen als zum Beispiel von ihren Familienbindungen. Im Folgenden wird nun kurz auf die Zuzugsmotive bezüglich Stuttgart eingegangen. Zuzugsmotive Zu Beginn des neuen Jahrtausends erschienen die Ergebnisse einer Studie der Stadt Stuttgart, die die Untersuchung der Zuzugsmotive von Neubürgern zum Inhalt hatte und 1998 in Auftrag gegeben worden war. 6 Neubürger mussten bei ihrer Ankunft einen Fragebogen zu Motivation, Gründen und ähnlichem für ihren Wechsel nach Stuttgart ausfüllen. Die Studie ergab, dass der häufigste An-
17 33 34 Mit Sack und Pack ins Ländle doch für wie lange? lass, der den Umzug ausgelöst hat, berufsorientiert (Arbeitsplatzwechsel, Studienortwechsel) war (69 Prozent). Am zweithäufigsten war das Zusammenziehen mit einem Partner genannt, danach folgten das Näher-Ziehen an Bekannte/Verwandte und die Gründung eines eigenen Hausstandes. In einer weiteren Frage konnten die Zuziehenden ein Eigenschaftsprofil von Stuttgart entwerfen, indem sie die ihrer Meinung nach treffendsten Adjektive für die Stadt vergaben. Stuttgart wurde am meisten als eine wirtschaftskräftige, zukunftsorientierte, interessante und moderne Stadt 7 bezeichnet. Dies ist, nicht überraschend, analog zur Wahl Stuttgarts für den eigenen neuen Arbeitsplatz, da die Stadt der Meinung der Befragten nach genügend Wirtschafts- und Zukunftspotential bietet. Decken sich die Erkenntnisse von 1998 mit den Aussagen in den Interviews der Projektgruppe 2008? So gibt zum Beispiel Frau Reusch, gefragt nach den Gründen für Stuttgart, folgende Antwort: Also er hat 1950 angefangen mit seinem Studium in Stuttgart, weil es hieß, Stuttgart hat eine besonders gute Architektenausbildung. 8 Hier spielt also der Ruf des besseren Bildungsangebots eine Rolle, die besseren Chancen durch eine höherwertige Ausbildung stehen über anderen Gründen. Frau Hälbig erging es ähnlich: Äh, mein Mann hat diesen Beruf also gefunden, den er immer haben wollte, ja, ja beruflich wegen meinem Mann sind wir hierher gekommen. 9 Wenn man diese beiden Aussagen stellvertretend für die weiteren im Interviewkorpus nimmt, hat sich augenscheinlich nicht viel geändert an den Anreizen, sich für Stuttgart zu entscheiden allerdings sind diese alle auch nur bedingt Stuttgart-spezifisch und austauschbar mit anderen Städten. Es ist nicht immer einfach Interessant sind in diesem Zusammenhang jedoch Aussagen der folgenden Art: [ ] so hat es uns dann nach Stuttgart verschlagen. Ähm, das war natürlich, erstmal waren wir skeptisch und natürlich auch mit Vor- behalten. [ ] Und da war für mich Stuttgart eine wenig schöne Stadt. So habe ich das erlebt, aus dem Fenster raus, von der Straßenbahn. 10 Die Erfahrungen des Herrn Stein decken sich damit: Ich bin hierher gekommen und hab mir gedacht: Oh, Gott, was ist das für ne Stadt hier? 11 Es scheint ganz so, als gäbe es ein sich wiederholendes Motiv, nämlich dass Stuttgart zwar aus zum Beispiel Berufsgründen gewählt wird, die jeweiligen Personen aber eigentlich wenig positive Bilder und Meinungen von Stuttgart haben. So auch Frau Beck, die sich anfangs mit der Mentalität nicht zurechtfinden konnte: Also ich fand die Leute hier [in Stuttgart; A. d. V.] manchmal etwas kleinkariert. 12 Die Mentalität wird oft konkret als Schwierigkeit oder als Teil eines Exklusionsprozesses genannt, der den Zugang zur Stadt, den Mitbewohnern und zu einem integrierten Leben anfangs erschwert. Herr Trautmann drückt sich folgendermaßen darüber aus: [ ] dass man es schwer hatte als Norddeutscher also insgesamt sich hier einzugewöhnen. Wenn man sich nicht gewehrt hat, war man [ ] immer der Reingeschmeckte, ja. [ ] So nannte man uns ja damals so ganz allgemein, [ ] die jetzt plötzlich nach Stuttgart kamen. 13 Eine abwehrende Haltung der Schwaben gegen Fremde ist ein oft vorkommendes und genanntes Thema. Einzelne schaffen es nicht, darüber hinwegzukommen: Die [ ] konnten sich mit dem Schwabenland nicht ganz verbinden. [ ] Die sind alle wieder zurück nach Norddeutschland. 14 So vermitteln viele der Interviewten den Eindruck, als wäre dies mit die größte Schwierigkeit beim Ankommen in der Stadt, unter anderem auch Herr Werth: Und ja, okay, ich muss sagen, ich hatte am Anfang Probleme im Schwabenland, weil als Pfälzer ist man gewohnt, wenn man irgendwo in ein Lokal geht, dann setzt man sich irgendwo an einen Tisch dazu und redet mit den Leuten und unterhält sich, und das hab ich hier versucht, ein, zwei, vielleicht auch drei mal, und habe festgestellt, dass des zumindest damals bei den Schwaben nicht gewünscht war. Da saß jeder an seinem Tisch, und wenn kein Tisch mehr frei war, dann ist man rausgegangen. 15 Solche detailreichen Beschreibungen deuten auf das hohe Beobachtungspotential hin, das Binnenmigranten nutzen um Sinn in festen Strukturen zu finden. Eine weitere dieser Beobachtungen ist,
18 35 36 dass der Faktor Zeit eine ausschlaggebende Rolle spielt. Herr Werth sieht sein erstes Gefühl nicht als eine Exklusion, sondern gibt sich Zeit, um die Schwaben kennen zu lernen und schließt zufrieden: Das ist der Vorteil bei den Schwaben, wenn man mal eine Freundschaft geschlossen hat, dann ist die mehr oder weniger auch für s Leben. 16 Es ergeht allerdings nicht allen so, und es wäre auch zu einfach zu sagen, dass man sich mit der Zeit automatisch selbst integriert. Frau Cevik-Röcker konstatiert: Ich bin noch nicht so richtig angekommen. Ich bemühe mich, also ich bemühe mich Kontakte zu kriegen. 17 Das Gefühl, richtig zu einer Stadt dazuzugehören, integriert zu sein, definiert sich oft über die Anzahl der sozialen Kontakte und inwieweit diese gefestigt sind. Soziale Kontakte bieten Identifikationspunkte in einem Gefüge aus Zusammengehörigkeit, das wiederum signalisiert Ich gehöre jetzt dazu, ich bin angekommen. [ ] ich hab hier nicht persönliche Bindungen, nicht mit anderen Menschen. Es gibt über der Straße einen Nachbar, der uns begrüßt hat, als wir da hergezogen sind gleich zu Anfang. Das ist ein bisschen Beziehung. 18 Es ist interessant, dass nur wenige der Interviewpartner Probleme mit den strukturellen Bedingungen der Stadt (Verwaltung, Verkehr, usw.) und ihrem Agieren in diesen haben, sondern eben ihren Status als Angekommene nur auf einem sozialen Level festmachen. Natürlich, es wird die Verkehrssituation getadelt, über Stuttgart 21 gemeckert und das Kulturangebot als zu eingeschränkt bezeichnet, jedoch meistens aus einer Wir-Perspektive die ausdrückt, dass sich der Interviewte als Stuttgarter sieht, aber trotzdem nicht unbedingt als vollständig integriert. Eventuell lässt sich diese Diskrepanz mit einem Unterschied in der Selbst- und Fremdwahrnehmung erklären: Die Interviewten fühlen sich selber als Stuttgarter, nehmen Stuttgart auch als ihre Heimat an, gehen aber davon aus, dass sie in der Wahrnehmung der alteingesessenen Stuttgarter noch nicht als solche gelten. Herr Engelsberg Um sich die Phasen, in denen sich das Ankommen in Stuttgart abspielt, an einem Beispiel noch mal genauer zu betrachten, sei hier exemplarisch die Geschichte von Herrn Engelsberg herausgegriffen. 19 Als Herr Engelsberg 1999 bei einer Krankenkasse in Stuttgart ein gutes Jobangebot bekam, zögerte er erstmal nicht lange: Wie kam es zu Stuttgart? Ja, einmal natürlich weil dort war der beste Job den ich gefunden hab. Ganz klar. Ja, gut, und du hattest schon so ein paar Prioritäten, Frankfurt oder so, und da wollte ich definitiv nicht hin und Stuttgart erschien einfach s Sympathischste. [ ] Der erste Gedanke war Stuttgart - ein Jahr und dann weiter, jetzt bin ich aber doch schon ein bisschen länger da. 20 Diese Antwort ist typisch für die Frage nach Gründen für Stuttgart in dem Sinne, dass es zum einen aus Berufsgründen gewählt wurde, zum anderen einen sympathischen Ruf hat, aber auch ein bisschen Widerstand aufkommt, länger vor Ort zu bleiben. Auf die Frage Warum nur ein Jahr? wird von ihm so auch geantwortet: Ja weil ich mir des hier eigentlich doch ein bisschen zu provinziell vorgestellt hatte. 21 Stuttgart wird selten als Großstadt definiert, was auch ein durchgängiges Thema bei den meisten Interviewpartnern war. Stuttgart besitzt zwar alle Eigenschaften und Qualitäten einer großen Metropole, und trotzdem sehen die Einwohner die Stadt selber als provinziell, als ein [z]iemlich grüner Fleck und klein und irgendwo im Loch 22. Aber vielleicht zeichnet genau dies die Stadt aus (siehe auch: Stadt und 1001 Städtle. Stuttgart, eine Synthese von Dorf und Stadt ) und macht ein Ankommen einfach. Überträgt man die typischen Zuschreibungen eines ländlichen Dorfes enge Gemeinschaft, partnerschaftliche Strukturen, gegenseitige Unterstützung auf Stuttgart, so könnte dies erklären, warum es den wenigsten der Interviewpartner wirkliche, schwerwiegende Probleme bereitete, sich nach einem kurzen oder etwas längeren Zeitraum zugehörig zu fühlen. Also die ersten zwei, drei Jahre dacht ich dann schon so immer ich sollt jetzt mal den Absprung schaffen, aber dann hat s irgendwann mal Klick gemacht. Und seitdem ist es schon so, dass ich sagen würde Stuttgart juhuu. [ ] Und ich gebe zu, mittlerweile ist es auch Mein Stuttgart geb ich zu. 23
Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive
 Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive Beitrag zur 7. Hessenkonferenz von Oktober 2015 Der Behälterraum Der Behälterraum bezeichnet ein Territorium bzw. ein dreidimensional einzugrenzendes Gebiet
Raumwahrnehmung aus soziologischer Perspektive Beitrag zur 7. Hessenkonferenz von Oktober 2015 Der Behälterraum Der Behälterraum bezeichnet ein Territorium bzw. ein dreidimensional einzugrenzendes Gebiet
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
17/07/15 Stimmen aus Berlin L. Raderschall FU Berlin Tagung Zukunftsforschung
 1 2 3 IDEE 4 Ein Projekt bei der die Zukunft Berlins aus der Perspektive unterschiedlicher Subkulturen mit Hilfe ethnografischer Methoden untersucht wird. 5 FRAGEN 6 Wie sehen Zukunftsbilder dieser Subkulturen
1 2 3 IDEE 4 Ein Projekt bei der die Zukunft Berlins aus der Perspektive unterschiedlicher Subkulturen mit Hilfe ethnografischer Methoden untersucht wird. 5 FRAGEN 6 Wie sehen Zukunftsbilder dieser Subkulturen
Nachbarn finden Eine kulturwissenschaftliche Analyse urbaner Nachbarschaftsinitiativen am Beispiel des NachbarNET Basel
 Nachbarn finden Eine kulturwissenschaftliche Analyse urbaner Nachbarschaftsinitiativen am Beispiel des NachbarNET Basel Christina Besmer, MA Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie Universität
Nachbarn finden Eine kulturwissenschaftliche Analyse urbaner Nachbarschaftsinitiativen am Beispiel des NachbarNET Basel Christina Besmer, MA Seminar für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie Universität
3.1 Konstruktion des Fragebogens... 5
 3.1 Konstruktion des Fragebogens... 5 4.1 Analyse der Hypothesen und Interpretation... 7 4.2 Zusammenfassung... 16 4.3 Beantwortung der Forschungsfragen... 17 5.1 Methodische Schwierigkeiten... 18 5.2
3.1 Konstruktion des Fragebogens... 5 4.1 Analyse der Hypothesen und Interpretation... 7 4.2 Zusammenfassung... 16 4.3 Beantwortung der Forschungsfragen... 17 5.1 Methodische Schwierigkeiten... 18 5.2
Kultureller Austausch zwischen zwei verschiedenen Gemeinschaften in einem Körper. Methodistische Kirche Kleinbasel.
 Kultureller Austausch zwischen zwei verschiedenen Gemeinschaften in einem Körper. Methodistische Kirche Kleinbasel. CAS Interkulturelle Theologie und Migration-Abschlussarbeit Tutorin Claudia Hoffmann
Kultureller Austausch zwischen zwei verschiedenen Gemeinschaften in einem Körper. Methodistische Kirche Kleinbasel. CAS Interkulturelle Theologie und Migration-Abschlussarbeit Tutorin Claudia Hoffmann
Walderholung mit Migrationshintergrund?
 Walderholung mit Migrationshintergrund? Wie Migrationserfahrungen und soziale Zugehörigkeiten die Waldnutzung und -wahrnehmung prägen NNA-Forum In und von der Landschaft leben (IV) Multikulturelle Perspektiven
Walderholung mit Migrationshintergrund? Wie Migrationserfahrungen und soziale Zugehörigkeiten die Waldnutzung und -wahrnehmung prägen NNA-Forum In und von der Landschaft leben (IV) Multikulturelle Perspektiven
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Das MdM ein Museum für alle?
 Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
tur le? al Baukul für
 Baukultur für alle? Impressum 1000 Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz wurden zum Thema Baukultur befragt. Sie äusserten sich zur bevorzugten Wohnsituationen, zur Bedeutung der Baukultur für ihren Alltag,
Baukultur für alle? Impressum 1000 Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz wurden zum Thema Baukultur befragt. Sie äusserten sich zur bevorzugten Wohnsituationen, zur Bedeutung der Baukultur für ihren Alltag,
1. Jan Böttcher Das Kaff (Leseprobe)
 1. Jan Böttcher Das Kaff (Leseprobe) Wie ist es, von der Großstadt zurück aufs Land zu kommen? Davon handelt der neueste Roman Das Kaff des deutschen Schriftstellers Jan Böttcher (geb. 1973). Die Einstellung
1. Jan Böttcher Das Kaff (Leseprobe) Wie ist es, von der Großstadt zurück aufs Land zu kommen? Davon handelt der neueste Roman Das Kaff des deutschen Schriftstellers Jan Böttcher (geb. 1973). Die Einstellung
Zeitgenössische Kunst verstehen. Wir machen Programm Museumsdienst Köln
 Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Zeitgenössische Kunst verstehen Wir machen Programm Museumsdienst Köln Der Begriff Zeitgenössische Kunst beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv.
Johannes 20, Woche: zweifeln, Thomas, Auferstehung. Zweifeln ist erlaubt! 1. Erklärungen zum Text
 Johannes 20,24-31 14. Woche: 01.04. 07.04.2018 zweifeln, Thomas, Auferstehung Zweifeln ist erlaubt! 1. Erklärungen zum Text Vorgeschichte: Jesus wurde verurteilt und gekreuzigt. Am dritten Tag ist er auferstanden
Johannes 20,24-31 14. Woche: 01.04. 07.04.2018 zweifeln, Thomas, Auferstehung Zweifeln ist erlaubt! 1. Erklärungen zum Text Vorgeschichte: Jesus wurde verurteilt und gekreuzigt. Am dritten Tag ist er auferstanden
4.4 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung Verknüpfung und zusammenfassende Ergebnisdarstellung Schlussfolgerungen für eine
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 7 1 Einleitung...9 2 Das soziale Phänomen der Stigmatisierung in Theorie und Empirie...10 2.1 Stigmatisierung in theoretischen Konzepten...10 2.1.1 Ausgangspunkte...11 2.1.2
Politische Partizipation und gesellschaftliches Engagement in
 Hans Zehetmair Politische Partizipation und gesellschaftliches Engagement in Bayern Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 4. Februar 2011 unter www.hss.de/download/110204_rm_zehetmair.pdf
Hans Zehetmair Politische Partizipation und gesellschaftliches Engagement in Bayern Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 4. Februar 2011 unter www.hss.de/download/110204_rm_zehetmair.pdf
Buchbare Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz und Beratung
 Buchbare Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz und Beratung Wie berate ich Jugendliche mit Migrationshintergrund erfolgreich? Wie kann ich Vorurteile abbauen und die Chancen aller Jugendlichen verbessern?
Buchbare Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz und Beratung Wie berate ich Jugendliche mit Migrationshintergrund erfolgreich? Wie kann ich Vorurteile abbauen und die Chancen aller Jugendlichen verbessern?
Forschung wird zum Stadtgespräch. Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen.
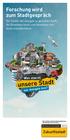 Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Karlsruhe revisited Fotografische Annäherungen an ein bekanntes Terrain
 Karlsruhe revisited Fotografische Annäherungen an ein bekanntes Terrain Seminar am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale, 2011 Karlsruhe revisited Fotografische Annäherungen an
Karlsruhe revisited Fotografische Annäherungen an ein bekanntes Terrain Seminar am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale, 2011 Karlsruhe revisited Fotografische Annäherungen an
Urbanes Grün und Gesundheit
 Urbanes Grün und Gesundheit Ergebnisse einer Befragung von Bewohnern in deutschen Großstädten 5. Juni 2015 q5436/31707 Pl, Ma forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30
Urbanes Grün und Gesundheit Ergebnisse einer Befragung von Bewohnern in deutschen Großstädten 5. Juni 2015 q5436/31707 Pl, Ma forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30
Walzwerk null Ausstellungsraum für Fotografie und Videokunst
 Andrea Grützner ERBGERICHT In Erbgericht beschäftigt sich Andrea Grützner mit dem gleichnamigen Traditionsgasthof im sächsischen Dorf ihrer Großeltern. Mit farbigem Licht spürt sie dem Zauber und der Aura
Andrea Grützner ERBGERICHT In Erbgericht beschäftigt sich Andrea Grützner mit dem gleichnamigen Traditionsgasthof im sächsischen Dorf ihrer Großeltern. Mit farbigem Licht spürt sie dem Zauber und der Aura
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Erfolgreich im globalen Dorf!
 ID I N T E G R A L D E V E L O P M E N T World Café Dialog: Erfolgreich im globalen Dorf! 10.10.2008, 10.15 15.45 Uhr, Leonardo-Büro Part Sachsen, Technische Universität Dresden Moderation: Ulrich Soeder,
ID I N T E G R A L D E V E L O P M E N T World Café Dialog: Erfolgreich im globalen Dorf! 10.10.2008, 10.15 15.45 Uhr, Leonardo-Büro Part Sachsen, Technische Universität Dresden Moderation: Ulrich Soeder,
Biografie - Partizipation - Behinderung
 Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Klinkhardt forschung Biografie - Partizipation - Behinderung Theoretische Grundlagen und eine partizipative Forschungsstudie von 1. Auflage Julius Klinkhardt 2014 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit
 Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
"Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben.
 Jugend - Demografischer Wandel - Ländlicher Raum "Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben. Statistiken und Prognosen zeigen übereinstimmend:
Jugend - Demografischer Wandel - Ländlicher Raum "Weggehen oder Hierbleiben?" Vor dieser Frage stehen viele junge Menschen an der Schwelle ins Erwachsenenleben. Statistiken und Prognosen zeigen übereinstimmend:
{play}mp3/interviewblanchaudde.mp3{/play} Von Christian Duwe und Flore Guiffault
 {play}mp3/interviewblanchaudde.mp3{/play} Von Christian Duwe und Flore Guiffault Clarisse Blanchaud gehört zu der immer größer werdenden frankophonen Minderheit in Berlin. Nach Ihrem Umzug in das Berliner
{play}mp3/interviewblanchaudde.mp3{/play} Von Christian Duwe und Flore Guiffault Clarisse Blanchaud gehört zu der immer größer werdenden frankophonen Minderheit in Berlin. Nach Ihrem Umzug in das Berliner
Hamburgs Stadtkuratorin: "Mit Schulterzucken kann ich leben...
 INTERVIEW Hamburgs Stadtkuratorin: "Mit Schulterzucken kann ich leben" 15.04.14 Matthias Gretzschel und Iris Hellmuth Foto: Marcelo Hernandez Es ist ein einzigartiges Projekt: Sophie Goltz ist Hamburgs
INTERVIEW Hamburgs Stadtkuratorin: "Mit Schulterzucken kann ich leben" 15.04.14 Matthias Gretzschel und Iris Hellmuth Foto: Marcelo Hernandez Es ist ein einzigartiges Projekt: Sophie Goltz ist Hamburgs
Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen
 Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Der Wissenschaftsrat
Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Qualitätskriterien für wissenschaftliche Universitätssammlungen Der Wissenschaftsrat
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung des Brüsseler Platzes und des Rathenauplatzes in Köln
 Sebastian Themann Email: sthemann@uni-bonn.de Exposé zur Masterarbeit Betreuung: Herr Prof. Dr. C.-C. Wiegandt Anmeldung: 4. April 2013 Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung
Sebastian Themann Email: sthemann@uni-bonn.de Exposé zur Masterarbeit Betreuung: Herr Prof. Dr. C.-C. Wiegandt Anmeldung: 4. April 2013 Nutzung und Aneignung öffentlicher Räume eine vergleichende Untersuchung
Design Thinking Crash-Kurs
 Wo ist das Problem? Design Thinking als neues Management-Paradigma In Anlehnung an das Hasso Plattner Institute of Design in Stanford : Der Auftrag Zeitraum des es beträgt 60 Minuten, d.h. der Prozess
Wo ist das Problem? Design Thinking als neues Management-Paradigma In Anlehnung an das Hasso Plattner Institute of Design in Stanford : Der Auftrag Zeitraum des es beträgt 60 Minuten, d.h. der Prozess
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
20 Jahre Laupheimer Museum. Heimat revisited. 25. April bis 22. Juli 2018
 20 Jahre Laupheimer Museum Heimat revisited 25. April bis 22. Juli 2018 Heimat revisited Wie sieht die Zukunft der städtischen Museen aus? Was sind die Aufgaben, Kernaufgaben? Gibt es Pflichten im Kulturbereich,
20 Jahre Laupheimer Museum Heimat revisited 25. April bis 22. Juli 2018 Heimat revisited Wie sieht die Zukunft der städtischen Museen aus? Was sind die Aufgaben, Kernaufgaben? Gibt es Pflichten im Kulturbereich,
Exportmodule aus dem MA Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft (PO vom )
 e aus dem MA Europäische Ethnologie/ (PO vom 25.05.2016) Übersicht über Prüfungen... 1 Historische Anthropologie/Kulturgeschichte... 2 Globalisierung und regionale Kulturentwicklung... 3 Visuelle Anthropologie...
e aus dem MA Europäische Ethnologie/ (PO vom 25.05.2016) Übersicht über Prüfungen... 1 Historische Anthropologie/Kulturgeschichte... 2 Globalisierung und regionale Kulturentwicklung... 3 Visuelle Anthropologie...
Unter uns. Ausstellung Stuttgart Stadtraum in Bewegung? Eine fotografische Spurensuche. Raumintervention Anja Ohliger, Christian Holl
 Ausstellung Stuttgart Stadtraum in Bewegung? Eine fotografische Spurensuche. Raumintervention Anja Ohliger, Christian Holl Unter uns Eines der größten Abenteuer der Architektur: in die Innenecken zu schauen
Ausstellung Stuttgart Stadtraum in Bewegung? Eine fotografische Spurensuche. Raumintervention Anja Ohliger, Christian Holl Unter uns Eines der größten Abenteuer der Architektur: in die Innenecken zu schauen
Fachtagung Das Publikum im Blick Besucherforschung als Impuls für besucherorientierte Museumsarbeit. 7. bis 8. November 2013
 LWL-Freilichtmuseum Hagen Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik Fachtagung Das Publikum im Blick Besucherforschung als Impuls für besucherorientierte Museumsarbeit 7. bis 8. November 2013
LWL-Freilichtmuseum Hagen Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik Fachtagung Das Publikum im Blick Besucherforschung als Impuls für besucherorientierte Museumsarbeit 7. bis 8. November 2013
Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko.
 Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko. María Guadalupe Rivera Garay Universität Bielefeld Hintergrund des Vortrags Basiert auf der Forschung
Migration zwischen Mexiko und den USA: Das Beispiel der indigenen Gemeinschaft El Alberto in Zentralmexiko. María Guadalupe Rivera Garay Universität Bielefeld Hintergrund des Vortrags Basiert auf der Forschung
Archive und Migration
 Archive und Migration Vorträge des 73. Südwestdeutschen Archivtags am 21. und 22. Juni 2013 in Stuttgart Herausgegeben von Roland Deigendesch und Peter Müller Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2014 Titelbild:
Archive und Migration Vorträge des 73. Südwestdeutschen Archivtags am 21. und 22. Juni 2013 in Stuttgart Herausgegeben von Roland Deigendesch und Peter Müller Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2014 Titelbild:
Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«
 Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«-Qualitative Methoden- Aufbau des weiterbildenden Masterstudiengangs "Evidenzbasierte Logopädie" im Rahmen des BMBF-Teilprojektes PuG Prof. Dr.
Kommentierter Reader»Forschungsmethoden in der Logopädie«-Qualitative Methoden- Aufbau des weiterbildenden Masterstudiengangs "Evidenzbasierte Logopädie" im Rahmen des BMBF-Teilprojektes PuG Prof. Dr.
Grundlagen der systemischen Beratung
 Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander
Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander
Schlaf gut, Baby! Neue Medien in der SIDS Prävention Inwiefern funktioniert die Kampagne?
 Schlaf gut, Baby! Neue Medien in der SIDS Prävention Inwiefern funktioniert die Kampagne? 11. Hamburger Fachgespräch Plötzlicher Säuglingstod 1. März 2017 Dr. Claudia Lampert & Michael Grimm, M.A. Schlaf
Schlaf gut, Baby! Neue Medien in der SIDS Prävention Inwiefern funktioniert die Kampagne? 11. Hamburger Fachgespräch Plötzlicher Säuglingstod 1. März 2017 Dr. Claudia Lampert & Michael Grimm, M.A. Schlaf
DER 5-SINNE-CHECK PERCEPT. Betrachte das Bild aufmerksam, lasse es auf dich wirken und schreibe auf: Schreibe auf:
 PERCEPT Schreibe auf: Was sehe ich? Was denke ich? Was fühle ich? DER 5-SINNE-CHECK Betrachte das Bild aufmerksam, lasse es auf dich wirken und schreibe auf: Was kann man hören / sehen / fühlen / riechen
PERCEPT Schreibe auf: Was sehe ich? Was denke ich? Was fühle ich? DER 5-SINNE-CHECK Betrachte das Bild aufmerksam, lasse es auf dich wirken und schreibe auf: Was kann man hören / sehen / fühlen / riechen
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY VORWORT... 19
 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 11 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 13 ZUSAMMENFASSUNG... 15 SUMMARY... 17 VORWORT... 19 1. HOCHQUALIFIZIERTE MIGRANTEN IM PERLFLUSSDELTA: EINE FORSCHUNGSHERAUSFORDERUNG...
INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 11 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 13 ZUSAMMENFASSUNG... 15 SUMMARY... 17 VORWORT... 19 1. HOCHQUALIFIZIERTE MIGRANTEN IM PERLFLUSSDELTA: EINE FORSCHUNGSHERAUSFORDERUNG...
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT
 INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
Eine Schöne Zeit erleben
 Eine Schöne Zeit erleben Jochen Schmauck-Langer Geschäftsführer dementia+art Kulturgeragoge, Autor und Dozent, Kunstbegleiter für Ältere und besonders für Menschen mit Demenz Qualifikation zur Alltagsbegleitung
Eine Schöne Zeit erleben Jochen Schmauck-Langer Geschäftsführer dementia+art Kulturgeragoge, Autor und Dozent, Kunstbegleiter für Ältere und besonders für Menschen mit Demenz Qualifikation zur Alltagsbegleitung
Stadtentwicklung Olten Dornacherstrasse Olten
 Wohnpolitik Olten Kurzauswertung Zuzugsbefragung Auftraggeberin Verfasserin Eva Gerber Stadtentwicklung Olten Dornacherstrasse 4603 Olten Joëlle Zimmerli Zimraum Raum + Gesellschaft Müllerstr. 48 8004
Wohnpolitik Olten Kurzauswertung Zuzugsbefragung Auftraggeberin Verfasserin Eva Gerber Stadtentwicklung Olten Dornacherstrasse 4603 Olten Joëlle Zimmerli Zimraum Raum + Gesellschaft Müllerstr. 48 8004
Wir wollten uns mal vorstellen!
 Eine Gruppe von fünf jungen FotografenInnen reist neugierig zusammen in die prägenden Städte ihrer Jugend. Die Städte, denen so lange fern geblieben war, bieten eine Möglichkeit, sich mit der Heimat zu
Eine Gruppe von fünf jungen FotografenInnen reist neugierig zusammen in die prägenden Städte ihrer Jugend. Die Städte, denen so lange fern geblieben war, bieten eine Möglichkeit, sich mit der Heimat zu
REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
 Stadt Bern Direktion für Bildung Soziales und Sport Kick-off «Schwerpunkteplan Integration 2018-2021» vom Montag, 29. Januar 2018 REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
Stadt Bern Direktion für Bildung Soziales und Sport Kick-off «Schwerpunkteplan Integration 2018-2021» vom Montag, 29. Januar 2018 REFERAT VON FRANZISKA TEUSCHER, DIREKTORIN FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT
Biografien in anderem Licht Erwachsenenbildung zwischen gestern und morgen. Erwachsenenbildung und Behinderung ISSN
 Erwachsenenbildung und Behinderung ISSN 0967-7468 Jahrgang 17 Heft 2: Oktober 2006 Biografien in anderem Licht Erwachsenenbildung zwischen gestern und morgen Inhaltsverzeichnis Editorial Werner Schlummer:
Erwachsenenbildung und Behinderung ISSN 0967-7468 Jahrgang 17 Heft 2: Oktober 2006 Biografien in anderem Licht Erwachsenenbildung zwischen gestern und morgen Inhaltsverzeichnis Editorial Werner Schlummer:
Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale
 Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale Tagung des Jugendministeriums des Freistaats Thüringen 20. Sept. 2017 Prof. Klaus Schäfer Das Jugendalter und auch das frühe Erwachsenenalter
Schulische Ganztagsangebote im Jugendalter Ambivalenzen und Potenziale Tagung des Jugendministeriums des Freistaats Thüringen 20. Sept. 2017 Prof. Klaus Schäfer Das Jugendalter und auch das frühe Erwachsenenalter
Erinnerung an eine Mode - Robert Musils Reflektion über die gesellschaftliche Reaktion auf die "Neue Frau" in den Mode-Essays von 1912 und 1929
 Germanistik Charlotte Baier Erinnerung an eine Mode - Robert Musils Reflektion über die gesellschaftliche Reaktion auf die "Neue Frau" in den Mode-Essays von 1912 und 1929 Studienarbeit Leibniz Universität
Germanistik Charlotte Baier Erinnerung an eine Mode - Robert Musils Reflektion über die gesellschaftliche Reaktion auf die "Neue Frau" in den Mode-Essays von 1912 und 1929 Studienarbeit Leibniz Universität
Wege aus der Fremde Wege in die Fremde Wege zu den Fremden Migration in Europa: Was steht auf dem Spiel? Teil 1
 Europa entsteht durch Begegnung Die Europäische Akademie Otzenhausen ist Mitglied der 10.11.2015/Br PG-JA Thema: Wege aus der Fremde Wege in die Fremde Wege zu den Fremden Migration in Europa: Was steht
Europa entsteht durch Begegnung Die Europäische Akademie Otzenhausen ist Mitglied der 10.11.2015/Br PG-JA Thema: Wege aus der Fremde Wege in die Fremde Wege zu den Fremden Migration in Europa: Was steht
Blick nach Innen Der Konzeptionelle Arbeitsraum als Methodisches Rahmenmodell AOC
 Blick nach Innen Der Konzeptionelle Arbeitsraum als Methodisches Rahmenmodell Der Konzeptionelle Arbeitsraum... ist ein heuristisches Modell zur Analyse, Reflexion und Wissensgenerierung zur Gestaltung
Blick nach Innen Der Konzeptionelle Arbeitsraum als Methodisches Rahmenmodell Der Konzeptionelle Arbeitsraum... ist ein heuristisches Modell zur Analyse, Reflexion und Wissensgenerierung zur Gestaltung
Zur Typologie des Kulturhistorischen Museums, Freilichtmuseen und kulturhistorische Räume
 Ingrid Edeler Zur Typologie des Kulturhistorischen Museums, Freilichtmuseen und kulturhistorische Räume PETER LANG Frankfurt am Main Bern New York Paris INHALTSANGABE Seite Vorwort 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Ingrid Edeler Zur Typologie des Kulturhistorischen Museums, Freilichtmuseen und kulturhistorische Räume PETER LANG Frankfurt am Main Bern New York Paris INHALTSANGABE Seite Vorwort 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Gemeinsam Sorge tragen Vorausschauende Gespräche führen
 Gemeinsam Sorge tragen Vorausschauende Gespräche führen Unser Leben ist wie ein Buch, das wir selbst geschrieben haben - vielfältig, einmalig und voller Erinnerungen. Wir können immer nur ein Kapitel nach
Gemeinsam Sorge tragen Vorausschauende Gespräche führen Unser Leben ist wie ein Buch, das wir selbst geschrieben haben - vielfältig, einmalig und voller Erinnerungen. Wir können immer nur ein Kapitel nach
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
LebensWerte Kommunen sind die Basis einer zukunftsfähigen Gesellschaft
 LebensWerte Kommune Unser Leitbild Unser Leitbild LebensWerte Kommunen sind die Basis einer zukunftsfähigen Gesellschaft Kommunen sind die Wiege der Demokratie. Ob und wie das Zusammenleben in der Gesellschaft
LebensWerte Kommune Unser Leitbild Unser Leitbild LebensWerte Kommunen sind die Basis einer zukunftsfähigen Gesellschaft Kommunen sind die Wiege der Demokratie. Ob und wie das Zusammenleben in der Gesellschaft
Dokumentation»Alles auf Start!
 Dokumentation»Alles auf Start! Inhalt: Gedanken zum Projekt Vorbereitung & Kooperation Verlauf: 1. Spielen & Analyse 2. abstrakte Malerei 3. Workshopangebote 4. Projekttage 5. Spielmesse Reflektion & Danksagung
Dokumentation»Alles auf Start! Inhalt: Gedanken zum Projekt Vorbereitung & Kooperation Verlauf: 1. Spielen & Analyse 2. abstrakte Malerei 3. Workshopangebote 4. Projekttage 5. Spielmesse Reflektion & Danksagung
Klemens Schaupp. Ein spiritueller Übungsweg. echter
 Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Kunst- und Kulturgeschichte
 Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Wie erinnerst Du Bedeutungen?
 Wie erinnerst Du Bedeutungen? WORUM GEHT`S? Wie wird ein Gegenstand oder auch ein Körperteil zu einem Bild für etwas Anderes? Gemeinsam denken wir über die Bedeutung und den Nutzen von Symbolen nach. i
Wie erinnerst Du Bedeutungen? WORUM GEHT`S? Wie wird ein Gegenstand oder auch ein Körperteil zu einem Bild für etwas Anderes? Gemeinsam denken wir über die Bedeutung und den Nutzen von Symbolen nach. i
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung... 1 Antje Flade
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung................................................ 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung................................. 13 Monica Rüthers 2.1 Geschichte und Methoden
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung................................................ 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung................................. 13 Monica Rüthers 2.1 Geschichte und Methoden
Auftaktveranstaltung Gründung Aktion! Karl-Marx-Straße
 Auftaktveranstaltung Gründung Bewerbungsverfahren Aktive Stadtzentren Dienstag, 13. Mai 2008, 19:00 Uhr, Foyer Museum Neukölln Gründung Bewerbungsverfahren Aktive Stadtzentren Die Bilder in unserem Kopf!
Auftaktveranstaltung Gründung Bewerbungsverfahren Aktive Stadtzentren Dienstag, 13. Mai 2008, 19:00 Uhr, Foyer Museum Neukölln Gründung Bewerbungsverfahren Aktive Stadtzentren Die Bilder in unserem Kopf!
Auswertung der Nachbefragung T&I: Telefoninterviews
 ..spontan erinnern? wirklich neu? Nun,...! Auswertung der Nachbefragung T&I: Telefoninterviews..konkret umgesetzt? Teilnehmer A (30.06.2010) 1. (Wenn Sie an die Veranstaltung T&I zurückdenken), an was
..spontan erinnern? wirklich neu? Nun,...! Auswertung der Nachbefragung T&I: Telefoninterviews..konkret umgesetzt? Teilnehmer A (30.06.2010) 1. (Wenn Sie an die Veranstaltung T&I zurückdenken), an was
Woran scheitern Veränderung Prozesse?
 So verändern Sie Ihre Firma erfolgreich! Woran scheitern Veränderung Prozesse? Der Begriff Change Management steht für Veränderungen für den Betrieb und die Mitarbeiter. So meistern Arbeitgeber erfolgreich
So verändern Sie Ihre Firma erfolgreich! Woran scheitern Veränderung Prozesse? Der Begriff Change Management steht für Veränderungen für den Betrieb und die Mitarbeiter. So meistern Arbeitgeber erfolgreich
Jahrgang 8. Thema + Leitfrage Kategorien: Erdkunde = E Politik = P Geschichte = G Wirtschaft = W. Projekte Medien Methoden
 - beschreiben gesellschaftliche, konfessionelle und machtpolitische Faktoren als Konfliktpotential in der frühen Neuzeit. - benennen und vergleichen anhand von Karten Herrschaftsgebiete sowie durch Expansion
- beschreiben gesellschaftliche, konfessionelle und machtpolitische Faktoren als Konfliktpotential in der frühen Neuzeit. - benennen und vergleichen anhand von Karten Herrschaftsgebiete sowie durch Expansion
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Univ.-Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne. Landschaftsentwicklungen zwischen physischen Räumen und gesellschaftlichen Verständnissen
 Univ.-Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne Landschaftsentwicklungen zwischen physischen Räumen und gesellschaftlichen Verständnissen Ebenen des gesellschaftlichen Landschaftsbezugs 1. die gesellschaftliche Ebene,
Univ.-Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne Landschaftsentwicklungen zwischen physischen Räumen und gesellschaftlichen Verständnissen Ebenen des gesellschaftlichen Landschaftsbezugs 1. die gesellschaftliche Ebene,
Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft. im Fokus aktueller. Stadtforschung. Konzepte-Herausforderungen- Perspektiven.
 Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft im Fokus aktueller Stadtforschung KonzepteHerausforderungen Perspektiven ^ Springer VS Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung
Antje Flade (Hrsg.) Stadt und Gesellschaft im Fokus aktueller Stadtforschung KonzepteHerausforderungen Perspektiven ^ Springer VS Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 Antje Flade 2 Historische Stadtforschung
Die Veranstaltung wurde unterstützt von
 Der Film Auf den Spuren von Martha Muchow erzählt die Geschichte der wegweisenden Forschungsarbeit Martha Muchows, die mit ihren detaillierten und unvoreingenommenen Beschreibungen zum Lebensraum des Großstadtkindes
Der Film Auf den Spuren von Martha Muchow erzählt die Geschichte der wegweisenden Forschungsarbeit Martha Muchows, die mit ihren detaillierten und unvoreingenommenen Beschreibungen zum Lebensraum des Großstadtkindes
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Mäeutik und die Arbeitszufriedenheit im Pflegeberuf. Eine Erhebung des Status Quo im Alten- und Pflegeheim St. Klara.
 Mäeutik und die Arbeitszufriedenheit im Pflegeberuf Eine Erhebung des Status Quo im Alten- und Pflegeheim St. Klara Forschungsfragen Hat die Einführung des Mäeutischen Pflegemodells eine auf die generelle
Mäeutik und die Arbeitszufriedenheit im Pflegeberuf Eine Erhebung des Status Quo im Alten- und Pflegeheim St. Klara Forschungsfragen Hat die Einführung des Mäeutischen Pflegemodells eine auf die generelle
Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland
 Geschichte Frank Bodenschatz Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland Eine vergleichende Betrachtung von Sachsen und Rheinland-Westfalen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Geschichte Frank Bodenschatz Regionale Differenzierung der Industrialisierung in Deutschland Eine vergleichende Betrachtung von Sachsen und Rheinland-Westfalen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung
Wie Städte Diversität gestalten
 Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity Wie Städte Diversität gestalten Karen Schönwälder
Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity Wie Städte Diversität gestalten Karen Schönwälder
Lebensqualität in deutschen Städten Erste Ergebnisse der zweiten koordinierten Bürgerbefragung VDSt Frühjahrstagung in Bonn, 16.
 Lebensqualität in deutschen Städten Erste Ergebnisse der zweiten koordinierten Bürgerbefragung 2009 Einleitung und Moderation Ergebnisse zur Zufriedenheit Ergebnisse zum Familienmodul Methodische Aspekte
Lebensqualität in deutschen Städten Erste Ergebnisse der zweiten koordinierten Bürgerbefragung 2009 Einleitung und Moderation Ergebnisse zur Zufriedenheit Ergebnisse zum Familienmodul Methodische Aspekte
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Umweltbewusstsein in Deutschland 2018
 Für Mensch und Umwelt Stand: 14. Mai 2018 Umweltbewusstsein in Deutschland 2018 Zentrale Befunde Methodik der Umweltbewusstseinsstudie Die Umweltbewusstseinsstudie wird zum 12. Mal vorgelegt. Seit 1996
Für Mensch und Umwelt Stand: 14. Mai 2018 Umweltbewusstsein in Deutschland 2018 Zentrale Befunde Methodik der Umweltbewusstseinsstudie Die Umweltbewusstseinsstudie wird zum 12. Mal vorgelegt. Seit 1996
Kulturelle Differenz?
 Kulturelle Differenz? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kultur und seinen Folgen Prof. Dr. Chantal Munsch Selbstreflexion Was denken Sie, wenn Ihnen eine SchülerIn oder eine KollegIn
Kulturelle Differenz? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kultur und seinen Folgen Prof. Dr. Chantal Munsch Selbstreflexion Was denken Sie, wenn Ihnen eine SchülerIn oder eine KollegIn
Motivationen. Befragung Vor Beginn der Tagung in Reggio Emilia:
 Von Reggio lernen eine Übertragung von Ideen ist möglich, aber es kann keinen Import oder Export von Erfahrungen geben, denn diese muss man selbst machen. Erfahrungen sind immer verbunden mit der Geschichte
Von Reggio lernen eine Übertragung von Ideen ist möglich, aber es kann keinen Import oder Export von Erfahrungen geben, denn diese muss man selbst machen. Erfahrungen sind immer verbunden mit der Geschichte
Niemand war schon immer da.
 Geschichte Schweiz, Teil 1 Niemand war schon immer da. Arbeitspapier für Lernende LN 1 Externe Lernorte Pascal Kälin pascalkaelin@bluewin.ch ZHSF FS2010 Juni 2010 Einbettung in den Lehrplan Der Besuch
Geschichte Schweiz, Teil 1 Niemand war schon immer da. Arbeitspapier für Lernende LN 1 Externe Lernorte Pascal Kälin pascalkaelin@bluewin.ch ZHSF FS2010 Juni 2010 Einbettung in den Lehrplan Der Besuch
Jugend und europäische Identität
 Jugend und europäische Identität Referat über die ersten Ergebnisse des EU-Projektes Youth and European Identity Im Rahmen der 167. Sitzung des Landesjugendbeirates Bregenz, 25. September 3 Mag. Reingard
Jugend und europäische Identität Referat über die ersten Ergebnisse des EU-Projektes Youth and European Identity Im Rahmen der 167. Sitzung des Landesjugendbeirates Bregenz, 25. September 3 Mag. Reingard
Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung'
 Germanistik Christoph Höbel Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung' Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Gregor Samsa... 3 2.1. Erster Teil der Erzählung... 3 2.2. Zweiter
Germanistik Christoph Höbel Das Vater-Sohn-Problem in Franz Kafkas 'Die Verwandlung' Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Gregor Samsa... 3 2.1. Erster Teil der Erzählung... 3 2.2. Zweiter
Wirtschaft und Sprache
 forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
forum ANGEWANDTE LINGUISTIK BAND 23 Wirtschaft und Sprache Kongreßbeiträge zur 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL e.v. Herausgegeben von Bernd Spillner PETER LANG Frankfurt
die Jugendlichen aus Belgien und Deutschland, die ihr diese Gedenkfeier heute mitgestaltet.
 Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Gedenkrede Elke Twesten MdL Vorstandsmitglied des Volksbundes in Niedersachsen anlässlich des Volkstrauertages auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien) Sonntag 17.11.2013 Sehr geehrte Exzellenzen,
Internationale Migration hoch qualifizierter Arbeitskräfte
 Heike Pethe Internationale Migration hoch qualifizierter Arbeitskräfte Die Greencard-Regelung in Deutschland Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Marlies Schulz Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsverzeichnis
Heike Pethe Internationale Migration hoch qualifizierter Arbeitskräfte Die Greencard-Regelung in Deutschland Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Marlies Schulz Deutscher Universitäts-Verlag Inhaltsverzeichnis
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen
 Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Integration in die Gesellschaft? Jens Schneider Universität Osnabrück
 Integration in die Gesellschaft? Jens Schneider Universität Osnabrück Ist das Integration? strukturell: schlechtere Bildung, höhere Arbeitslosigkeit = schlecht integriert sozial: Kontakte + Beziehungen
Integration in die Gesellschaft? Jens Schneider Universität Osnabrück Ist das Integration? strukturell: schlechtere Bildung, höhere Arbeitslosigkeit = schlecht integriert sozial: Kontakte + Beziehungen
Georg-August-Universität Göttingen Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse
 Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
AG JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG. Jonen
 JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG Eine Gemeinde in die Zukunft zu führen, bedarf der Mitarbeit aller. Das Leitbild der Gemeinde Jonen dient als Fundament für die weitere Entwicklung des Dorfes. Es setzt
JONEN AKTIV, ATTRAKTIV, LEBENDIG Eine Gemeinde in die Zukunft zu führen, bedarf der Mitarbeit aller. Das Leitbild der Gemeinde Jonen dient als Fundament für die weitere Entwicklung des Dorfes. Es setzt
KONZEPT FÜR DIE VERGLEICHENDE ANALYSE VON LJUBLJANA UND GRAZ
 KONZEPT FÜR DIE VERGLEICHENDE ANALYSE VON LJUBLJANA UND GRAZ ELABORAT KAZALO PROJEKT THEME... 2 METHODISCHE ANSÄTZE... 3 SPEZIFISCHE AUFGABEN DER FORSCHUNG UND DER VERWENDUNG VON FORSCHUNGSERGEBNISSEN...
KONZEPT FÜR DIE VERGLEICHENDE ANALYSE VON LJUBLJANA UND GRAZ ELABORAT KAZALO PROJEKT THEME... 2 METHODISCHE ANSÄTZE... 3 SPEZIFISCHE AUFGABEN DER FORSCHUNG UND DER VERWENDUNG VON FORSCHUNGSERGEBNISSEN...
Impulsreferat Prof. Dr. Nikolaus Werz KAAD- Jahresakademie 2016
 Identitätspolitik: Eine allseits akzeptierte Definition von Identitätspolitik liegt nicht vor. In vielen südlichen Ländern findet seit der Dekolonisation eine Suche nach Identität statt. Identitätspolitik
Identitätspolitik: Eine allseits akzeptierte Definition von Identitätspolitik liegt nicht vor. In vielen südlichen Ländern findet seit der Dekolonisation eine Suche nach Identität statt. Identitätspolitik
Susanne Gesser, Angela Jannelli, Martin Handschin, Sibylle Lichtensteiger 10
 Inhalt Das partizipative Museum Susanne Gesser, Angela Jannelli, Martin Handschin, Sibylle Lichtensteiger 10 1 PARTIZIPATION UND GEGENWART: ZWEI TRENDS IM SPIEGEL DER EUROPÄISCHEN MUSEUMSLANDSCHAFT Einführung
Inhalt Das partizipative Museum Susanne Gesser, Angela Jannelli, Martin Handschin, Sibylle Lichtensteiger 10 1 PARTIZIPATION UND GEGENWART: ZWEI TRENDS IM SPIEGEL DER EUROPÄISCHEN MUSEUMSLANDSCHAFT Einführung
Bausteine für kreatives Denken Mitarbeiter gezielt zu kreativem Denken fördern. Autorin: Caroline Bernardi
 Bausteine für kreatives Denken Mitarbeiter gezielt zu kreativem Denken fördern Autorin: Caroline Bernardi Essay von: Franziska Binder, Katja Rossi 31. Januar 2007 Einleitung Der Verlauf der heutigen Wirtschaft
Bausteine für kreatives Denken Mitarbeiter gezielt zu kreativem Denken fördern Autorin: Caroline Bernardi Essay von: Franziska Binder, Katja Rossi 31. Januar 2007 Einleitung Der Verlauf der heutigen Wirtschaft
Vienna Chinatown INvisible
 Vienna Chinatown INvisible Eine Reise durch das chinesische Wien Herausgegeben von Fariba Mosleh INHALT. Vienna Chinatown INvisible Eine Reise durch das chinesische Wien Seite: 4-9 Seite: 30-41 Seite:
Vienna Chinatown INvisible Eine Reise durch das chinesische Wien Herausgegeben von Fariba Mosleh INHALT. Vienna Chinatown INvisible Eine Reise durch das chinesische Wien Seite: 4-9 Seite: 30-41 Seite:
Schwäbisch Gmünd 2020
 Schwäbisch Gmünd 2020 Agenda für eine nachhaltige Stadtentwicklung Städtebauliche und bürgerschaftliche Projekte zur Bildung einer neuen Identität Dipl.- Ing. Julius Mihm, Architekt, Bürgermeister Stadt
Schwäbisch Gmünd 2020 Agenda für eine nachhaltige Stadtentwicklung Städtebauliche und bürgerschaftliche Projekte zur Bildung einer neuen Identität Dipl.- Ing. Julius Mihm, Architekt, Bürgermeister Stadt
4. Feministische Herbstakademie: Occupy feministisch!
 4. Feministische Herbstakademie: Occupy feministisch! Der Herbst zeigte sich von seiner sonnendurchfluteten, malerischen Seite, als sich mehr als 30 Frauen aus der LINKEN, aus Gewerkschaften und sozialen
4. Feministische Herbstakademie: Occupy feministisch! Der Herbst zeigte sich von seiner sonnendurchfluteten, malerischen Seite, als sich mehr als 30 Frauen aus der LINKEN, aus Gewerkschaften und sozialen
Ausblick Antworten der Erwachsenenbildung: Lehre und Lernen Gewünschte Inhalte
 Futuro D als Tagungsformat Entstehung, Absicht Fünf Tagungen und deren Inhalte Ausblick Antworten der Erwachsenenbildung: Lehre und Lernen Gewünschte Inhalte Futuro D steht für Zukunft gestalten in Deutschland
Futuro D als Tagungsformat Entstehung, Absicht Fünf Tagungen und deren Inhalte Ausblick Antworten der Erwachsenenbildung: Lehre und Lernen Gewünschte Inhalte Futuro D steht für Zukunft gestalten in Deutschland
Zusammenarbeit in virtuellen Teams
 Zusammenarbeit in virtuellen Teams Herausforderungen für die Führungskraft der Zukunft Sprecherausschusstag 2017 1. Juni 2017 Definition: Virtualität Virtualität bedeutet nicht echt, nicht in Wirklichkeit
Zusammenarbeit in virtuellen Teams Herausforderungen für die Führungskraft der Zukunft Sprecherausschusstag 2017 1. Juni 2017 Definition: Virtualität Virtualität bedeutet nicht echt, nicht in Wirklichkeit
