Farbe immateriell oder: Welche Farbe hat das Nichts?
|
|
|
- Ludo Biermann
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Entwurf zum Begleitbuch der Ausstellung rot. grün. blau. Experiment in Farbe & Licht , Ilmenau. Hrsg. K. Scheurmann, Seiten Farbe immateriell oder: Welche Farbe hat das Nichts? Christoph Schierz Sowohl in Zürich als auch in Basel gibt es ein Restaurant mit dem Namen blindekuh. Es handelt sich um ein Gastronomiekonzept, bei dem die Gäste in Dunkeln essen und die Speisen und Getränke nicht sehen können. Sie werden von Gastgebern bedient, die blind oder stark sehbehindert sind. Sich im Raum zu orientieren bereitet den Gastgebern keine Mühe, die Gäste jedoch erfahren dies als Herausforderung: Mit Händen und Füssen tastend voranzuschreiten ist zwar zögerlich möglich, auch die Verwendung von Messer und Gabel oder das Füllen der Gläser gelingt mit viel Unterstützung der Finger. Aber die Sicherheit mit der wir uns sonst um Tische herum, an Wänden entlang oder auf ein bestimmtes Ziel hinzu bewegen, ist verloren. Nach einer gewissen Zeit entsteht das Gefühl, die Wände hören zu können und der Geruch und der Geschmack der Speisen wird viel bedeutsamer als er beim Essen sonst schon ist. Aber überall wo wir hinsehen, ob mit offenen oder geschlossenen Augen, nehmen wir nur etwas wahr: Die Farbe Schwarz. Ist Schwarz wirklich eine Farbe? Ist es Schwarz, was die blinden Gastgeber tagtäglich zu sehen bekommen? Zur Beantwortung dieser Fragen führen wir folgendes Experiment durch: Versuchen wir ohne den Kopf zu drehen zu sehen, welche Farben sich gerade jetzt hinter unserem Kopf befinden. Unzweifelhaft sind dort weder bunte Farben, noch Weiß, aber auch nicht Schwarz zu erkennen, sondern einfach nichts! Weil wir hinter dem Kopf keine Augen haben, sehen wir dort dasselbe wie vollständig erblindete Menschen: Nichts. Dieses Nichts ist somit nicht dasselbe wie Schwarz. Die Sehenden erkennen Schwarz nur deshalb, weil sie funktionsfähige Augen haben und weil das Gehirn die vom Auge ausgehenden Nervensignale passend verarbeitet. Wir erkennen Schwarz nur, weil wir auch Hell erkennen können, weil wir dafür die selben Prozesse im Auge und im Gehirn beanspruchen. Somit ist es gerechtfertigt, Schwarz als Farbe zu bezeichnen, ein Etwas, das vollständig erblindete Menschen nicht wahrnehmen können. Die Frage ist nun, was mit Hell gemeint ist. Würde im Restaurant blindekuh nur ein schwacher Lichtstrahl eindringen, könnten wir damit zwar noch nicht Zeitung lesen, uns aber nach einer gewissen Anpassungszeit bereits im Raum orientieren. Die Physiker beschreiben Lichtstrahlen als ein Bündel von Teilchen, so genannte Photonen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit in Richtung des Lichtstrahls fortbewegen. Bereits etwa 30 solcher ins Auge gelangender Photonen reichen für einen Helligkeitseindruck aus, wobei davon nur ein paar einzelne bis zur Rückwand des Auges, der Netzhaut mit den Sehrezeptoren gelangen. Das ist eine äußerst hohe Lichtempfindlichkeit. Zum Vergleich: In einer klaren, mondlosen Nacht gelangen ausgehend von den Sternen jede Sekunde rund 400 Millionen für die Helligkeitswahrnehmung ge- 1
2 eignete Photonen auf einen Quadratzentimeter Bodenfläche; ein ordnungsgemäß beleuchteter Büroarbeitsplatz benötigt mindestens noch ½ Million mal mehr. Damit ist aber noch nicht geklärt, warum wir Farben sehen können. Die Vermutung ist, dass Lichtstrahlen neben der Intensität auch andere Qualitäten annehmen, welche wir als Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Braun, Rosa usw. bezeichnen. Photonen sind nicht alle gleich, sie enthalten ein unterschiedliches Ausmaß an innerer Energie. Nur Photonen in einem ganz bestimmten Energiebereich sind in der Lage, einen Helligkeitseindruck zu erzeugen. Möglicherweise hängen die Farbqualitäten mit den unterschiedlichen Photonenenergien zusammen? Die Tatsache aber, dass Schwarz auch eine Farbe ist, passt nicht in dieses Bild, es sei denn, es gibt auch schwarze Lichtstrahlen ohne Photonen. Stutzig machen sollte uns zudem die alltägliche Wahrnehmung: Sehen wir tatsächlich Lichtstrahlen oder gar Photonen? Bevor wir dieser Frage nachgehen, wird erst eine weitere physikalische Beschreibung von Licht und Farbe vorgestellt. Der Physiker beginnt die Erklärung des Phänomens Farbe mit Lichtstrahlen, die von einer Lichtquelle ausgesandt, bestimmte Wellenlängen besitzen. Das heißt, Licht breitet sich in Richtung des Lichtstrahls in Form elektromagnetischer Wellen aus und der Abstand von einem Wellenberg zum nächsten ist die Wellenlänge. Dies ist eine alternative Beschreibung des Lichts in Form von Wellen statt in Form von Teilchen, den Photonen. Die beiden Beschreibungsweisen lassen sich verbinden: Zu jeder Wellenlänge gehören Photonen einer bestimmten inneren Energie. Die Intensität hingegen, im Teilchenbild die Anzahl Photonen, steckt im Wellenbild in der Höhe der Welle, der Wellenamplitude. Eine Teilchentheorie des Lichts entwickelte Isaac Newton bereits 1675 (Korpuskeltheorie), eine Wellentheorie 1690 Christian Huygens. Damals kontrovers umstritten, bilden heute beide Theorien in weiterentwickelter Form gemeinsam eine Grundlage der Quantenphysik. Abbildung 1 relative spektrale Lichtintensität 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Emissionsspektrum einer Leuchtstofflampe mit der Lichtfarbe "Tageslichtweiß" Wellenlänge in nm 2
3 Im Allgemeinen besteht Licht aus einem Gemisch überlagerter Lichtstrahlen mit je eigenen Wellenlängen. Das so genannte Emissionsspektrum einer Lichtquelle beschreibt, wie intensiv das Licht jeder Wellenlänge im Gemisch auftritt (Abbildung1). Mehrere Lichtquellen können sich in ihrem Spektrum gegenseitig ergänzen. Das neue Gemisch macht sich später in der Wahrnehmung als additive Farbmischung bemerkbar. Blaues und gelbes Licht etwa ergeben zusammen weißes Licht. Die O- berflächen von Objekten reflektieren und streuen die Lichtstrahlen und ändern dabei deren Richtung. Auch das Spektrum verändert sich je nach Wellenlänge unterschiedlich stark. Der spektrale Reflexionsgrad beschreibt für jede Wellenlänge, welchen Prozentsatz der ursprünglichen Lichtintensität die Objekte noch reflektieren (Abbildung 2). Die anderen Anteile werden von den Oberflächen absorbiert und fehlen nach der Reflexion im Spektrum. Das macht sich in der Wahrnehmung als subtraktive Farbmischung bemerkbar. Fällt etwa gelbes Licht auf eine blaue Oberfläche erscheint das reflektierte Licht grün. Einige der reflektierten Lichtstrahlen gelangen ins Auge und bewirken dort eine Farbwahrnehmung der Oberfläche. Gemäß der physikalischen Betrachtungsweise bestimmen also das Emissionsspektrum der Lichtquelle und das spektrale Reflexionsvermögen der beleuchteten Objekte die Objektfarbe. Abbildung 2 spektraler Reflexionsgrad in % Zitrone Orange Tomate Kohl Wellenlänge in nm Besteht das Spektrum nur aus einer einzigen Wellenlänge, entstehen die so genannten Spektralfarben, die auch im Regenbogen zu erkennen sind. Sind in einem Spektrum hingegen alle Wellenlängen gleich stark vertreten, erscheint dies als Weiß. Die Vorstellung, dass Licht aus unterschiedlichen Spektralfarben zusammengesetzt ist, liegt bereits Isaac Newtons Farbenlehre von 1704 zu Grunde. Er zeigte dies mit einem Prisma durch die Auftrennung von weißem Licht in Spektralfarben. Beim Tageslicht tritt Weiß in verschiedenen Varianten auf. Je nach Sonnenstand wirkt es gelblicher oder bläulicher. Dies liegt daran, dass die so genannte Rayleigh-Streuung Lichtstrahlen aus dem kurwelligen Bereich blauer Spektralfarben stärker an Luftparti- 3
4 keln und Dichteschwankungen streuen lässt als solche aus dem langwelligen Bereich roter Spektralfarben. Sie entfernen sich daher vom direkten Weg Sonne- Beobachter und geben dem Himmel seine blaue Farbe. Die Sonne wirkt mit dem übrig bleibenden Spektralanteil je nach Stärke des Effekts gelb, orange oder rot. Auch elektrische Lampen sind in unterschiedlicher Lichtfarbe erhältlich. Glühlampen haben ein sehr warmes, rötliches Licht; bei Leuchtstofflampen spricht man von Tageslichtweiß (bläulich), Warmweiß (gelblich) und Neutralweiß. Um viele Objektfarben richtig zu erkennen, müssen im beleuchtenden Licht möglichst alle Wellenlängen vorhanden sein. Das Problem wird deutlich, wenn wir bei nächtlicher Straßenbeleuchtung unter der orangen Spektralfarbe von Natriumdampf- Niederdrucklampen vergeblich versuchen, Farben zu erkennen. Spektralfarben sind daher für Beleuchtungszwecke ungeeignet, da sie andere Farben nicht zulassen. Spektral kontinuierliches weißes Licht wäre zu bevorzugen, ist aber bei der künstlichen Beleuchtung nicht besonders energieeffizient. Effiziente neutralweiße Leuchtstofflampen erzeugen diskontinuierliche Spektren (Abbildung 1). Ein leichte Verschiebung der Oberflächenfarben kann unter diesen Lichtquellen sichtbar werden, die Objekte wirken dann farblich unnatürlich. Der so genannte Farbwiedergabeindex erfasst diese Verschiebung mehr oder weniger gut. Je höher die Anforderungen an das Erkennen und Unterscheiden von Farben sind, desto größer muss sein Wert sein. Tageslichtspektren und Glühlampenlicht erreichen ein Maximum von 100, die Leuchtstofflampe von Abbildung 1 den Wert 85. Beispiele mit hohen Anforderungen an die Farbwiedergabe von Licht sind Patientenuntersuchungsräume, Haarpflege, Kosmetik, Intarsienarbeiten, Auswahl oder Kontrolle von Furnierhölzern, Nahrungsmitteln, Leder, Textilien sowie Erzeugnisse des Mehrfarbendrucks. Soweit die physikalische Erklärung zum Phänomen Farbe. Sind es nun farbige Lichtstrahlen oder gar Bündel von farbigen Photonen, die wir als Beobachter sehen? Ü- berlegen wir uns dazu, wie denn ein Lichtstrahl aussieht. Wir kennen die Situation im Wald, in der einzelne Sonnenstrahlen durch die Bäume fallen. Wir haben uns auch schon im Strahl einer Taschenlampe durch die finstere Nacht bewegt. Doch diese Strahlen stimmen nicht mit der physikalischen Beschreibung überein, welche fordert, dass Lichtstrahlen ins Auge gelangen müssen, um sichtbar zu werden. Weder der beobachtete Sonnenstrahl noch der Strahl der Taschenlampe tun das. Was wir sehen sind leuchtende oder beleuchtete Objekte, Trübungen in der Luft oder im Wasser, keine Lichtstrahlen. Und nicht einmal das ist korrekt: Auch die Objekte und Trübungen offenbaren sich uns nicht als Bestandteile einer objektiven Welt. Wir müssen sie vielmehr in unserer subjektiven Welt als Sinneseindrücke aus den Sinnesdaten und mit Hilfe unserer Erfahrung rekonstruieren. Wir können somit festhalten: Farbe ist kein physikalisches Phänomen, sondern eine Konstruktion, erzeugt durch unsere Wahrnehmungsprozesse. Farbe ohne ein sehendes Auge gibt es nicht! Und auch Photonen sind nicht gefärbt, die Farbe kommt 4
5 erst während der Verarbeitung der Information im Auge und im Gehirn hinzu. Damit ist auch klar, dass Spektrum und Farbe nicht gleichbedeutend sind. Spektren lassen sich direkt physikalisch messen. Farben hingegen sind subjektive Sinneseindrücke. In dieses Bild passt auch das, was wir uns zu Schwarz überlegt haben. Schwarz ist gleichwertig wie die anderen Farben eine Konstruktion unserer Wahrnehmung und wir dürfen es mit Recht als Farbe auffassen. Auch wenn Farben subjektive Sinneseindrücke sind, bedeutet dies nicht, dass man sie nicht auch messtechnisch vorhersagen kann. Es ist Aufgabe der so genannten Psychophysik auf Grund von Beobachtungen an Testpersonen herauszufinden, welche Gesetzmäßigkeiten zwischen einem Lichtspektrum und der wahrgenommenen Farbe bestehen. Diese Gesetzmäßigkeiten können genutzt werden, um aus dem physikalisch bestimmten Spektrum Farbeigenschaften wie die Sättigung, die Helligkeit, den Farbton oder auch den Grad an Weißheit oder an Reinheit zu berechnen. Eine Gesetzmäßigkeit zeigt beispielsweise, dass es mehr Spektren als Farben gibt. Übereinstimmende Farben können durchaus von unterschiedlichen Spektren stammen. Man spricht dann von bedingt-gleichen oder metameren Farben. Das Weiß von Tageslicht und das Tageslichtweiß von Leuchtstofflampen sind Beispiele für bedingtgleiche Farben. Viele Phänomene des Farbensehens waren bereits im 19. Jahrhundert bekannt. Thomas Young und Hermann von Helmholtz zeigten 1802 bzw. 1852, dass die additive Mischung von mindestens drei geeignet gewählten Spektralfarben jeden anderen Farbton erzeugen kann, wenn auch nicht mit der maximalen Farbsättigung. Mit nur zwei Spektralfarben gelingt dies nicht. Dieser Sachverhalt und Untersuchungen an farbenblinden Personen ließen drei Typen von Sehrezeptoren in der Netzhaut vermuten. Moderne Untersuchungen können diese Typen inzwischen direkt nachweisen. Die Rezeptoren heißen Zapfen, im Gegensatz zu den Stäbchen, welche nicht dem Farbsehen, sondern dem Helligkeitssehen in dunkler Umgebung dienen. Abbildung 3 zeigt die spektralen Empfindlichkeiten der drei Zapfentypen. Es ist zu erkennen, wie stark jeder der drei Typen auf die einzelnen Wellenlängen im Spektrum reagiert. Außerdem ist zu erkennen, dass die im grünen Spektralbereich empfindlichen Zapfen auch auf Licht aus dem rot erscheinenden Bereich reagieren. Die Bezeichnungen Grünzapfen, Rotzapfen oder Blauzapfen sind daher eigentlich nicht korrekt, werden hier der Anschaulichkeit halber aber beibehalten. Jeder der drei Zapfentypen allein sieht keine Farbe. Voraussetzung für die Wahrnehmung von Farbe ist das Zusammenspiel der Signale aller drei Zapfentypen. Dass wir Weiß von Gelb unterscheiden können, liegt z. B. am unterschiedlichen Beitrag, den die Blauzapfen liefern. Es ist nun technisch möglich, die Empfindlichkeiten der Zapfen auch in einem Messgerät mit drei lichtempfindlichen Sensoren nachzubilden. Unterschiedlich gefärbte Gläser, über jedem der drei Sensoren angebracht, verändern das Lichtspektrum so, dass die Sensoren die spektralen Empfindlichkeiten der Zapfentypen von 5
6 Abbildung 3 erhalten. Ein solches Dreibereichs-Farbmessgerät simuliert das Verhalten der Rezeptoren im Auge 1. 1,2 Abbildung 3 relative spektrale Empfindlichkeit 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 B-Zapfen 400 G-Zapfen R-Zapfen Wellenlänge in nm Weil drei Rezeptortypen für die Farbwahrnehmung zuständig sind, lässt sich jede Farbe in einem dreidimensionalen Raum darstellen, dem so genannten Farbraum. Die Disziplin der Farbmetrik beschreibt Farbräume mathematisch und verwendet dafür drei Farbkoordinaten. Eine der Koordinaten kann beispielsweise für die Helligkeit stehen und die anderen beiden beschreiben eine zweidimensionale Farbtafel mit Farbton (z.b. Grün, Rot) und Sättigung (z.b. Rot, Rosa). Die Farbmetrik ermöglicht es, die zu erwartende Mischfarbe von aus beliebigen Wellenlängen zusammengesetzten Lichtspektren vorauszusagen. Die drei Signale eines Dreibereichs- Farbmessgeräts können zu den Farbkoordinaten eines gewünschten Farbraums verrechnet werden, womit der Sinneseindruck Farbe indirekt messbar geworden ist. Das Verhältnis der Anzahl Blau- zu Grün- zu Rotzapfen in der Netzhaut beträgt etwa 1:17:34. Die geringe Zahl von Blauzapfen bewirkt in stark blauem Licht eine verminderte Sehschärfe. Personen bei welchen die Rot- oder Grünzapfen fehlen, sind rotgrün-farbenblind und können unter anderem zwischen den Farbtönen Rot, Gelb und Grün nicht unterscheiden. Etwa 2% aller Männer sind davon betroffen, bei den Frauen sind es nur 0,03%. Weitere 6% der Männer haben eine Farbsehschwäche. Blaugelb-Farbenblindheit ist dagegen sehr selten. Alle diese Personen sind benachteiligt, wenn sie ungünstig gefärbte Objekte unterscheiden müssen. Rot-grün-farbenblinde Personen können zum Beispiel rote Schrift auf grünem Hintergrund kaum lesen. 1 6 Hinweis: In käuflichen Messgeräten sind zwar andere Farbfilter üblich, die Messergebnisse lassen sich aber ineinander umrechnen.
7 Markierungen sollten sich nicht nur durch Farben wie Rot, Gelb oder Grün unterscheiden, sondern auch durch ihre Form oder Helligkeit. Bisher haben wir uns darum gekümmert, wie Photonen sich als Licht ausbreiten, an Gegenständen reflektiert werden und in den Rezeptoren des Auges bzw. den Sensoren eines Messgeräts Signale auslösen, welche einer Farbwahrnehmung bzw. einer Farbbeschreibung dienen. Offen bleibt noch, wie Photonen überhaupt entstehen können. Grundsätzlich kann man für die im Alltag üblichen Lichtquellen davon ausgehen, dass Photonen in Atomen geboren werden. Ein einfaches physikalisches Modell, das 1913 von Niels Bohr entwickelt wurde, beschreibt Atome als einen A- tomkern, der von Elektronen wie auf Planetenbahnen umkreist wird. Diese Bahnen besitzen ganz bestimmte Durchmesser, zwischen den Bahnen dürfen sich keine E- lektronen aufhalten. Elektronen können aber ihre Bahn verlassen und auf eine höhere oder tiefere Bahn wechseln, wenn dort noch Plätze frei sind. Wie bei einem Fahrstuhl benötigen sie Energie, wenn sie auf eine höhere Ebene wechseln; das Atom ist dann angeregt. Beim Wechsel des Elektrons auf eine tiefere Ebene wird Energie frei, die das Atom in Form eines Photons verlässt. Die innere Energie des Photons entspricht genau dem frei gewordenen Energiebetrag. Auch in Festkörpern in einem Verbund von vielen Atomen sind Sprünge von Elektronen mit Photonenabstrahlung möglich. Allerdings bewegen sie sich dort nicht auf starren Bahnen, sondern innerhalb von so genannten Bändern. Die Kunst des Lampenbauers ist es, einerseits die richtigen Atome oder Festkörperstrukturen auszuwählen, damit die Elektronensprünge Photonen erzeugen, deren innere Energie im Bereich des sichtbaren Lichts liegt. Andererseits muss er Methoden entwickeln, um die benötigte Anregungsenergie effizient den Atomen zuzuführen. Dies ist auf verschiedene Arten möglich. In einer Glühlampe führt die Erhitzung zur gewünschten Energiezufuhr, in einer Entladungslampe das Bombardement mit anderen Elektronen. In einer Leuchtdiode (LED) erfolgt die Anregung durch elektrische Spannungen und in einem Leuchtstoff durch das Bombardement mit anderen Photonen. Lichtquellen bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten der Anwendung, sei es innerhalb technisch-optischer Geräte, sei es direkt zum Nutzen menschlicher Tätigkeiten am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedliche Eigenschaften der Quelle und des erzeugten Lichts erforderlich. So müssen neben der Intensität, der Lichtfarbe und der Farbwiedergabe auch die Kosten, die Lebensdauer, der Energieverbrauch, die Alterung, die Erwärmung, die Handhabung, die Ökologie, das zeitliche Verhalten und die räumliche Lichtverteilung je nach Anwendung passend ausgewählt werden. Momentan stoßen in der Entwicklung und der Anwendungsforschung Kompakt- Leuchtstofflampen ( Sparlampen ) und röhrenförmige Leuchtstofflampen ( Neonröhren ) auf sehr großes Interesse, da diese bei hoher Lichtintensität wenig elektrische 7
8 Energie verbrauchen und auf Grund der Klimaerwärmung und der CO 2 -Diskussion in möglichst allen Bereichen die Glühlampe ablösen sollen. Es handelt sich bei beiden Lampentypen um innen mit Leuchtstoff beschichtete Niederdruck-Entladungslampen, in denen Quecksilberatome angeregt werden. Außerdem läuft die Entwicklung von immer effizienteren LEDs mit immer höherer Lichtintensität auf Hochtouren. LEDs wurden bisher hauptsächlich als Signalquellen und in Anzeigen verwendet. Sie begegnen uns z.b. als Fahrzeugbremslichter, in Verkehrsampeln oder als Hinterleuchtung von Mobiltelefon-Displays. Inzwischen gibt es auch erste Anwendungen von LEDs als Beleuchtungsmittel. So enthalten bereits einzelne Straßenleuchten und einzelne Fahrzeug-Frontscheinwerfer Hochleistungs-LEDs. Wenn die Entwicklung der LED nach höherer Effizienz, geringerer Wärmeentwicklung und besserer Farbwiedergabe mit der selben Geschwindigkeit weitergeht wie bisher, könnten sie in fünf bis zehn Jahren sogar die Leuchtstofflampen ablösen. Die LED-Technologie ermöglicht es, Licht mit fast jeder Wellenlänge zu erzeugen. Damit kann man sich beliebige Spektren und beliebige Farben additiv zusammenmischen. Sind wir heute in der Lage, Licht in einer Farbe herzustellen, die unsere Ahnen nie haben sehen können? In der Farbbenennung ungeübte Personen können nicht mehr als sechs Farbtöne sowie Unbunt (schwarz-grau-weiß) unterscheiden. Bei direktem Farbvergleich hingegen werden sehr viele Farben differenziert. Dennoch ist unser Farbsehen begrenzt. Im mathematisch beschriebenen Farbenraum gibt es Koordinaten für so genannte virtuelle Farben, die wir niemals sehen können. Auch ist es uns nicht möglich, an ein bläuliches Orange, ein rötliches Grün oder ein gelbliches Violett zu denken. In der Tierwelt gibt es eine große Vielfalt von anderen Farbsystemen. Die meisten Säugetiere weisen zwar nur zwei Zapfentypen auf und sind rotgrün-farbenblind. Die Vögel hingegen haben sogar vier Zapfentypen, einen mehr als wir Menschen. Das macht ihre Farbenwelt weitaus vielfältiger als unsere. Bedingtgleiche Farben, die wir nicht unterscheiden können, sind für sie verschieden. In ihrer visuellen Welt erscheinen wir als Farbenblinde. Viele Insekten können auch im ultravioletten Wellenlängenbereich sehen und nehmen dies als eine Farbe wahr, die uns vollkommen verschlossen bleibt. Im letzten Jahrzehnt hat sich aber herausgestellt, dass beim Menschen in der Netzhaut neben den drei Zapfentypen und den Stäbchen noch ein zusätzlicher Rezeptortyp vorhanden ist. Dieser dient allerdings ähnlich wie die Stäbchen nicht direkt dem Farbensehen. Ein allgemein akzeptierter Name ist noch nicht gefunden, die Wissenschaftler nennen diese Zellen iprgc. Dieser Rezeptortyp spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung biologischer Vorgänge im Menschen. So zeigte sich, dass Licht über diese Rezeptoren die innere biologische Uhr neu einstellen kann. Dies ist zum Beispiel beim Jet-Lag notwendig, wenn nach einem Atlantikflug der Wach-Schlaf-Rhythmus der inneren Uhr nicht mehr mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der äußeren Uhr übereinstimmt. Licht vergrößert über diese Rezeptoren auch die 8
9 Munterkeit und wirkt aktivierend. Dies könnte etwa bei anspruchsvoller Nachtarbeit sehr wichtig sein. Die biologischen Lichtwirkungen finden in den letzten Jahren in zunehmendem Maß das Interesse der Lichttechnik. Es zeigte sich nämlich, dass die neu entdeckten Rezeptoren im kurzwelligen Bereich des Spektrums empfindlich sind, da wo sich die blauen Spektralfarben befinden. Das bedeutet, dass blaues, bläuliches oder tageslichtweißes Licht bei gleicher wahrgenommener Helligkeit biologisch stärker wirkt als gelbliches, rötliches oder warmweißes Licht. Die Lampenhersteller haben neue Leuchtstofflampen mit einem vergrößerten Blauanteil entwickelt. Welche Bedeutung diese Lichtwirkungen im Alltag haben, ist noch nicht abschließend bekannt. Es ist ja zum Beispiel am Arbeitsplatz nicht sinnvoll und wohl auch nicht gesund, mit viel bläulichem Licht eine ständige Aktivierung zu verursachen. Aber für zeitlich begrenzte Arbeitssituationen kann dies durchaus von Vorteil sein. Bei vielen unserer Gastgeber im Restaurant blindenkuh sind diese biologischen Lichtwirkungen nicht vorhanden. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass ihre innere Uhr nur zufällig mit der äußeren Uhr synchronisiert ist. Sie werden müde zu Tageszeiten an denen wir hell wach sind und sind dafür morgens um 3 Uhr aktiv. Ein paar Wochen später hat sich der Rhythmus bereits wieder verschoben. Es gibt aber auch blinde Personen, bei denen das System der neu entdeckten Rezeptoren intakt ist. Wie es auch immer um die Munterkeit der Gastgeber steht, die beiden Restaurants sind ein großer Erfolg und es ist allen die gerade in Zürich oder Basel sind zu empfehlen, dort einzukehren und angesichts der Farbe Schwarz über das Wesen der anderen Farben nachzudenken. Ch. Schierz, 25. September
Broschüre-Licht und Farbe
 Broschüre-Licht und Farbe Juliane Banach Juni 2008 bearbeitet mit: FreeHand 2007 Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Was ist Licht? 4 Das Auge 5 Stäbchen und Zapfen 6 Dispersion 7 Farbspektrum 8 Absorption
Broschüre-Licht und Farbe Juliane Banach Juni 2008 bearbeitet mit: FreeHand 2007 Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Was ist Licht? 4 Das Auge 5 Stäbchen und Zapfen 6 Dispersion 7 Farbspektrum 8 Absorption
Objekterkennung durch Vergleich von Farben. Videoanalyse Dr. Stephan Kopf HWS2007 Kapitel 5: Objekterkennung
 Objekterkennung durch Vergleich von Farben 48 Farbräume (I) Definitionen: Farbe: Sinnesempfindung (keine physikalische Eigenschaft), falls Licht einer bestimmten Wellenlänge auf die Netzhaut des Auges
Objekterkennung durch Vergleich von Farben 48 Farbräume (I) Definitionen: Farbe: Sinnesempfindung (keine physikalische Eigenschaft), falls Licht einer bestimmten Wellenlänge auf die Netzhaut des Auges
Das Sehen des menschlichen Auges
 Das Sehen des menschlichen Auges Der Lichteinfall auf die lichtempfindlichen Organe des Auges wird durch die Iris gesteuert, welche ihren Durchmesser vergrößern oder verkleinern kann. Diese auf der Netzhaut
Das Sehen des menschlichen Auges Der Lichteinfall auf die lichtempfindlichen Organe des Auges wird durch die Iris gesteuert, welche ihren Durchmesser vergrößern oder verkleinern kann. Diese auf der Netzhaut
Farblehre. Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung. Die 8 Grundfarben. Additive Farbmischung. Subtraktive Farbmischung
 Farblehre Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung Die 8 Grundfarben Additive Farbmischung Subtraktive Farbmischung Simultankontrast Harmonische Farbgestaltungen Farbkontrast
Farblehre Was ist Farbe und wie nehmen wir sie wahr? Licht und Farbempfindung Die 8 Grundfarben Additive Farbmischung Subtraktive Farbmischung Simultankontrast Harmonische Farbgestaltungen Farbkontrast
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Licht und Optik. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Licht und Optik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Licht und Optik Seite 7 von 20
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Licht und Optik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Licht und Optik Seite 7 von 20
Kontrollaufgaben zur Optik
 Kontrollaufgaben zur Optik 1. Wie schnell bewegt sich Licht im Vakuum? 2. Warum hat die Lichtgeschwindigkeit gemäss moderner Physik eine spezielle Bedeutung? 3. Wie nennt man die elektromagnetische Strahlung,
Kontrollaufgaben zur Optik 1. Wie schnell bewegt sich Licht im Vakuum? 2. Warum hat die Lichtgeschwindigkeit gemäss moderner Physik eine spezielle Bedeutung? 3. Wie nennt man die elektromagnetische Strahlung,
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden
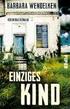 Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden
 Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Weiße. Weiße SICHTBARES LICHT VIOLETTES ROTLICHT RADIO- WELLEN ORANGE VIOLETT. 457 nm BLAU INFRA- GRÜN LICHT GELB ROT. WELLENLÄNGE in Nanometer (nm)
 Weiße Weiße ist in mancherlei Hinsicht kein einfach zu erklärender Begriff. Im physikalischen Sinne ist eine weiße Oberfläche eine perfekt diffus reflektierende Oberfläche. Tatsächlich gibt es jedoch keine
Weiße Weiße ist in mancherlei Hinsicht kein einfach zu erklärender Begriff. Im physikalischen Sinne ist eine weiße Oberfläche eine perfekt diffus reflektierende Oberfläche. Tatsächlich gibt es jedoch keine
2 Einführung in Licht und Farbe
 2.1 Lernziele 1. Sie wissen, dass Farbe im Gehirn erzeugt wird. 2. Sie sind mit den drei Prinzipien vertraut, die einen Gegenstand farbig machen können. 3. Sie kennen den Zusammenhang zwischen Farbe und
2.1 Lernziele 1. Sie wissen, dass Farbe im Gehirn erzeugt wird. 2. Sie sind mit den drei Prinzipien vertraut, die einen Gegenstand farbig machen können. 3. Sie kennen den Zusammenhang zwischen Farbe und
Das visuelle Wahrnehmungssystem
 Das visuelle Wahrnehmungssystem Grobaufbau Das Auge Hell-Dunkel Wahrnehmung Farbwahrnehmung Objektwahrnehmung und Organisationsprinzipien von Perzeption und Kognition Tiefen- und Grössenwahrnehmung Täuschungen
Das visuelle Wahrnehmungssystem Grobaufbau Das Auge Hell-Dunkel Wahrnehmung Farbwahrnehmung Objektwahrnehmung und Organisationsprinzipien von Perzeption und Kognition Tiefen- und Grössenwahrnehmung Täuschungen
Die Spektralfarben des Lichtes
 Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Die Spektralfarben des Lichtes 1 Farben sind meistens bunt. Es gibt rot, grün, gelb, blau, helldunkles rosarot,... und noch viele mehr. Es gibt vier Grundfarben, die anderen werden zusammengemischt. Wenn
Physik für Naturwissenschaften. Dr. Andreas Reichert
 Physik für Naturwissenschaften Dr. Andreas Reichert Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Termine Klausur: 5. Februar?, 12-14 Uhr,
Physik für Naturwissenschaften Dr. Andreas Reichert Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Modulhandbuch Termine Klausur: 5. Februar?, 12-14 Uhr,
Farbe in der Computergraphik
 Farbe in der Computergraphik 1 Hernieder ist der Sonnen Schein, die braune Nacht fällt stark herein. 2 Gliederung 1. Definition 2. Farbwahrnehmung 3. Farbtheorie 4. Zusammenfassung 5. Quellen 3 1. Definition
Farbe in der Computergraphik 1 Hernieder ist der Sonnen Schein, die braune Nacht fällt stark herein. 2 Gliederung 1. Definition 2. Farbwahrnehmung 3. Farbtheorie 4. Zusammenfassung 5. Quellen 3 1. Definition
Leseprobe. 3. Wie wir Farben bezeichnen Bezeichnung von Pigmentfarben (Malfarben) Bezeichnung von Farbtönen in der Umgangssprache 8
 Inhaltsverzeichnis 1. Wie wir Farben sehen 3 1.1. Farben sehen unser Auge 3 1.2. Farbe ist Licht 4 1.2.1. Wahrnehmung von Farben über Schwingungen 4 1.2.2. Wahrnehmung durch die Brechung des Lichtes 4
Inhaltsverzeichnis 1. Wie wir Farben sehen 3 1.1. Farben sehen unser Auge 3 1.2. Farbe ist Licht 4 1.2.1. Wahrnehmung von Farben über Schwingungen 4 1.2.2. Wahrnehmung durch die Brechung des Lichtes 4
Der dreidimensionale Farbraum
 Der dreidimensionale Farbraum Der dreidimensionale Farbraum - ein Thema für den Physikunterricht? Übersicht: 1. Vorüberlegungen 2. Ein anschauliches Modell für den Farbraum 3. Licht und Farbe 4. Der Farbraum
Der dreidimensionale Farbraum Der dreidimensionale Farbraum - ein Thema für den Physikunterricht? Übersicht: 1. Vorüberlegungen 2. Ein anschauliches Modell für den Farbraum 3. Licht und Farbe 4. Der Farbraum
Wellen, Quanten und Rezeptoren
 Seminar: Visuelle Wahrnehmung WS 01-02 Leitung: Prof. Gegenfurthner Referent: Nico Schnabel Thema: Coulor Mechanisms of the Eye (Denis Baylor) Wellen, Quanten und Rezeptoren Über die Neurophysiologie
Seminar: Visuelle Wahrnehmung WS 01-02 Leitung: Prof. Gegenfurthner Referent: Nico Schnabel Thema: Coulor Mechanisms of the Eye (Denis Baylor) Wellen, Quanten und Rezeptoren Über die Neurophysiologie
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden
 Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens
 Licht Wissen... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens Inhalt: # 1 Das Farbempfinden # 2 Die Farbtemperatur # 3 Lumen, Candela, Lux 1. Das Farbempfinden: Das Farbempfinden
Licht Wissen... ein kleiner Ausflug in die Physik des Lichts und des Farbempfindens Inhalt: # 1 Das Farbempfinden # 2 Die Farbtemperatur # 3 Lumen, Candela, Lux 1. Das Farbempfinden: Das Farbempfinden
Gymnasium / Realschule. Atomphysik 2. Klasse / G8. Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht)
 Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht) 1. Was versteht man unter einem Elektronenvolt (ev)? 2. Welche physikalische Größe wird in Elektronenvolt gemessen? Definiere diese Größe und gib weitere Einheiten
KAISERSLAUTERN. Untersuchung von Lichtspektren. Lampen mit eigenem Versuchsaufbau. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht
 ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht KAISERSLAUTERN Untersuchung von Lichtspektren bei verschiedenen Lampen mit eigenem Versuchsaufbau Johannes Kührt Schule: Burggymnasium Burgstraße
ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht KAISERSLAUTERN Untersuchung von Lichtspektren bei verschiedenen Lampen mit eigenem Versuchsaufbau Johannes Kührt Schule: Burggymnasium Burgstraße
18.Elektromagnetische Wellen 19.Geometrische Optik. Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht. EPI WS 2006/7 Dünnweber/Faessler
 Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht Ausbreitung von Licht Verschiedene Beschreibungen je nach Größe des leuchtenden (oder beleuchteten) Objekts relativ zur Wellenlänge a) Geometrische Optik: Querdimension
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Farbwahrnehmung
 VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Farbwahrnehmung Macht der Farbe Er sah die Haut von Menschen, die Haut seiner Frau und seine eigene Haut als ein abstoßendes grau; hautfarben erschien ihm nunmehr Rattenfarben
VL Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Farbwahrnehmung Macht der Farbe Er sah die Haut von Menschen, die Haut seiner Frau und seine eigene Haut als ein abstoßendes grau; hautfarben erschien ihm nunmehr Rattenfarben
Das beidäugige Gesichtsfeld umfaßt etwa 170 Bogengrad.
 3 Farben 3.1 Licht 3.2 Farbwahrnehmung 3.3 RGB-Modell 3.4 CIE-Modell 3.5 YCrCb-Modell Licht: Als Licht sieht man den Teil des elektromagnetischen Spektrums zwischen etwa 400 nm bis 750 nm Wellenlänge an.
3 Farben 3.1 Licht 3.2 Farbwahrnehmung 3.3 RGB-Modell 3.4 CIE-Modell 3.5 YCrCb-Modell Licht: Als Licht sieht man den Teil des elektromagnetischen Spektrums zwischen etwa 400 nm bis 750 nm Wellenlänge an.
Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen
 Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen Bienen sehen die Welt anders als wir und finden sich ganz anders zurecht. Welche Möglichkeiten gibt es in der Schule in diese andere Welt
Bienen, Licht & Farbe: Es ist nicht alles so, wie wir es sehen Bienen sehen die Welt anders als wir und finden sich ganz anders zurecht. Welche Möglichkeiten gibt es in der Schule in diese andere Welt
Licht und Farbe mit Chemie
 Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farben: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farben: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Experiment 1 (Mensch)
 Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 3 - Experimente zum Farbensehen Experiment 1 (Mensch) AB 3-1 100 70 30 60 40 Gelb Grün Rot Grün Rot 4 4 8 2 4 4 Arbeitsauftrag: In dem Spektrum-Artikel wird ein
Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 3 - Experimente zum Farbensehen Experiment 1 (Mensch) AB 3-1 100 70 30 60 40 Gelb Grün Rot Grün Rot 4 4 8 2 4 4 Arbeitsauftrag: In dem Spektrum-Artikel wird ein
Ajdovic/Mühl Farbmodelle FARBMODELLE
 FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
FARBMODELLE Grundlagen: Gegenstände, die von einer Lichtquelle beleuchtet werden, reflektieren und absorbieren jeweils einen Teil des Lichts. Dabei wird das von den Gegenständen reflektierte Licht vom
(21. Vorlesung: III) Elektrizität und Magnetismus 21. Wechselstrom 22. Elektromagnetische Wellen )
 . Vorlesung EP (. Vorlesung: III) Elektrizität und Magnetismus. Wechselstrom. Elektromagnetische Wellen ) IV) Optik = Lehre vom Licht. Licht = sichtbare elektromagnetische Wellen 3. Geometrische Optik
. Vorlesung EP (. Vorlesung: III) Elektrizität und Magnetismus. Wechselstrom. Elektromagnetische Wellen ) IV) Optik = Lehre vom Licht. Licht = sichtbare elektromagnetische Wellen 3. Geometrische Optik
Licht und Farbe mit Chemie
 Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Licht und Farbe mit Chemie Folie 1 Was verstehen wir eigentlich unter Licht? Licht nehmen wir mit unseren Augen wahr Helligkeit: Farbe: Schwarz - Grau - Weiß Blau - Grün - Rot UV-Strahlung Blau Türkis
Visuelle Wahrnehmung. DI (FH) Dr. Alexander Berzler
 Visuelle Wahrnehmung DI (FH) Dr. Alexander Berzler Grundlagen der visuellen Wahrnehmung Wie funktioniert der Prozess des Sehens? Das Licht tritt zunächst durch die Cornea (Hornhaut) ein, durchquert das
Visuelle Wahrnehmung DI (FH) Dr. Alexander Berzler Grundlagen der visuellen Wahrnehmung Wie funktioniert der Prozess des Sehens? Das Licht tritt zunächst durch die Cornea (Hornhaut) ein, durchquert das
6 Farben und Entstehung von Licht
 6 Farben und Entstehung von Licht 6.1 Die Grenzen der Strahlenoptik Bisher haben wir uns mit geometrischer Optik oder Strahlenoptik befasst. Sie beruht auf der Voraussetzung der geradlinigen Ausbreitung
6 Farben und Entstehung von Licht 6.1 Die Grenzen der Strahlenoptik Bisher haben wir uns mit geometrischer Optik oder Strahlenoptik befasst. Sie beruht auf der Voraussetzung der geradlinigen Ausbreitung
FARBE UND WAHRNEHMUNG
 B G R FARBE UND WAHRNEHMUNG 4 DAS FUNKTIONSPRINZIP DES SEHORGANS 4.1 Die Duplizitätstheorie 4.2 Die Dreifarbentheorie (Young-Helmholtz-Theorie) 4.3 RGB - Das physiologische Prinzip des Farbensehens 4.4
B G R FARBE UND WAHRNEHMUNG 4 DAS FUNKTIONSPRINZIP DES SEHORGANS 4.1 Die Duplizitätstheorie 4.2 Die Dreifarbentheorie (Young-Helmholtz-Theorie) 4.3 RGB - Das physiologische Prinzip des Farbensehens 4.4
Die Farben des Lichts
 Einen Regenbogen herbeizaubern Ist es möglich, hier im Schülerlabor einen Regenbogen zu erzeugen? Ja Nein Wo und wann hast du schon Regenbögen oder Regenbogenfarben gesehen? Regenbogen in der Natur nach
Einen Regenbogen herbeizaubern Ist es möglich, hier im Schülerlabor einen Regenbogen zu erzeugen? Ja Nein Wo und wann hast du schon Regenbögen oder Regenbogenfarben gesehen? Regenbogen in der Natur nach
Weißes Licht wird farbig
 B1 Experiment Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Glühlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Glasprisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter
B1 Experiment Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Glühlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Glasprisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter
Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation
 Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Objekt zu sehen: (1) Wir sehen das vom Objekt emittierte Licht direkt (eine Glühlampe, eine Flamme,
Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Objekt zu sehen: (1) Wir sehen das vom Objekt emittierte Licht direkt (eine Glühlampe, eine Flamme,
1. Warum sehen wir Erdbeeren?
 Kinder-Universität Winterthur Prof. Christophe Huber huber.christophe@gmail.com 1. Warum sehen wir Erdbeeren? 1.1. Licht, Farbe und das menschliche Auge Farbe ist ein Aspekt von Licht. Das menschliche
Kinder-Universität Winterthur Prof. Christophe Huber huber.christophe@gmail.com 1. Warum sehen wir Erdbeeren? 1.1. Licht, Farbe und das menschliche Auge Farbe ist ein Aspekt von Licht. Das menschliche
Farbmanagement für Fotografen
 Farbmanagement für Fotografen Ein Praxishandbuch für den digitalen Foto-Workflow Bearbeitet von Tim Grey, Jürgen Gulbins 1. Auflage 2005. Buch. 282 S. Hardcover ISBN 978 3 89864 329 0 Format (B x L): 17,5
Farbmanagement für Fotografen Ein Praxishandbuch für den digitalen Foto-Workflow Bearbeitet von Tim Grey, Jürgen Gulbins 1. Auflage 2005. Buch. 282 S. Hardcover ISBN 978 3 89864 329 0 Format (B x L): 17,5
Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale
 Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale Als Mendelejew sein Periodensystem aufstellte waren die Edelgase sowie einige andere Elemente noch nicht entdeck (gelb unterlegt). Trotzdem
Periodensystem, elektromagnetische Spektren, Atombau, Orbitale Als Mendelejew sein Periodensystem aufstellte waren die Edelgase sowie einige andere Elemente noch nicht entdeck (gelb unterlegt). Trotzdem
Protokoll. Farben und Spektren. Thomas Altendorfer 9956153
 Protokoll Farben und Spektren Thomas Altendorfer 9956153 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Ziele, Vorwissen 3 Theoretische Grundlagen 3-6 Versuche 1.) 3 D Würfel 7 2.) Additive Farbmischung 8 3.) Haus 9
Protokoll Farben und Spektren Thomas Altendorfer 9956153 1 Inhaltsverzeichnis Einleitung Ziele, Vorwissen 3 Theoretische Grundlagen 3-6 Versuche 1.) 3 D Würfel 7 2.) Additive Farbmischung 8 3.) Haus 9
Spektren und Farben. Schulversuchspraktikum WS 2002/2003. Jetzinger Anamaria Mat.Nr.:
 Spektren und Farben Schulversuchspraktikum WS 2002/2003 Jetzinger Anamaria Mat.Nr.: 9755276 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwissen der Schüler 2. Lernziele 3. Theoretische Grundlagen 3.1 Farbwahrnehmung 3.2 Das
Spektren und Farben Schulversuchspraktikum WS 2002/2003 Jetzinger Anamaria Mat.Nr.: 9755276 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwissen der Schüler 2. Lernziele 3. Theoretische Grundlagen 3.1 Farbwahrnehmung 3.2 Das
Grundlagen der Farbbildverarbeitung
 Grundlagen der Farbbildverarbeitung Inhalt 1. Grundlagen - Was ist Farbe? - Wie lässt sich Farbe messen? 2. Technik der Farbkameras - Wie kann eine Kamera Farben sehen? - Bauformen 3. Funktion von Farb-BV-Systemen
Grundlagen der Farbbildverarbeitung Inhalt 1. Grundlagen - Was ist Farbe? - Wie lässt sich Farbe messen? 2. Technik der Farbkameras - Wie kann eine Kamera Farben sehen? - Bauformen 3. Funktion von Farb-BV-Systemen
Bilder Ton Zeit [s] Vorspann
![Bilder Ton Zeit [s] Vorspann Bilder Ton Zeit [s] Vorspann](/thumbs/62/47191146.jpg) Bilder Ton Zeit [s] Vorspann 4 Intro Man kennt es aus dem Alltag: 5 Gegenstände die unter Schwarzlicht leuchten. Aber welche Eigenschaften muss ein Stoff haben, um in Schwarzlicht leuchten zu können? 6
Bilder Ton Zeit [s] Vorspann 4 Intro Man kennt es aus dem Alltag: 5 Gegenstände die unter Schwarzlicht leuchten. Aber welche Eigenschaften muss ein Stoff haben, um in Schwarzlicht leuchten zu können? 6
Die Farben des Lichts oder Das Geheimnis des Regenbogens
 Kurzinformation Lehrkräfte (Sachanalyse) Sachanalyse Das sichtbare Licht, das die Farben unserer Welt erzeugt, hat eine bestimmte Wellenlänge, sodass es unser menschliches Auge sehen kann. Es ist jedoch
Kurzinformation Lehrkräfte (Sachanalyse) Sachanalyse Das sichtbare Licht, das die Farben unserer Welt erzeugt, hat eine bestimmte Wellenlänge, sodass es unser menschliches Auge sehen kann. Es ist jedoch
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden
 Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden Scheint nach einem Regenschauer die Sonne, so kann ein Regenbogen entstehen. Dieser besteht aus vielen bunten Farben. Alle diese Farben sind im Sonnenlicht
Farbwahrnehmung. } Unterscheidung von Licht verschiedener Wellenlängen. Björn Rasch Vorlesung Allg. Psychologie Uni FR
 Farbwahrnehmung } Unterscheidung von Licht verschiedener Wellenlängen } primär durch die 3 Zapfentypen mit max. Empfindlichkeit für verschiedene Wellenlängen } K-Zapfen: kurzwelliges Licht (ca. 420 nm,
Farbwahrnehmung } Unterscheidung von Licht verschiedener Wellenlängen } primär durch die 3 Zapfentypen mit max. Empfindlichkeit für verschiedene Wellenlängen } K-Zapfen: kurzwelliges Licht (ca. 420 nm,
10/6/2015. Licht IST FARBIG! DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN OPTISCHE AUFHELLER IN DER KUNSTSTOFF- INDUSTRIE. Alle Objekte sind Reflektoren!
 DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN OPTISCHE AUFHELLER IN DER KUNSTSTOFF- INDUSTRIE 1 WAS GENAU SIND OPTISCHE AUFHELLER? Optische Aufheller sind chemische Stoffe welche im elektromagnetischen Spektrum Licht
DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN OPTISCHE AUFHELLER IN DER KUNSTSTOFF- INDUSTRIE 1 WAS GENAU SIND OPTISCHE AUFHELLER? Optische Aufheller sind chemische Stoffe welche im elektromagnetischen Spektrum Licht
Prof. H. Mixdorff Farbmetrik und IBK-Farbdiagramm
 Prof. H. Mixdorff Farbmetrik und IBK-Farbdiagramm Die Farbwahrnehmung basiert auf der komplexen Verarbeitung von Nervenimpulsen dreier verschiedener Arten von Rezeptoren auf der Retina, den so genannten
Prof. H. Mixdorff Farbmetrik und IBK-Farbdiagramm Die Farbwahrnehmung basiert auf der komplexen Verarbeitung von Nervenimpulsen dreier verschiedener Arten von Rezeptoren auf der Retina, den so genannten
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit. Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz
 Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Referentin: Carina Kogel Seminar: Visuelle Wahrnehmung Dozent: Dr. Alexander C. Schütz Die Wahrnehmung von Durchsichtigkeit Ein Mosaik aus undurchsichtigen Farbflächen
Grundlagen der Farbenlehre
 Lichtfarbe Einige leuchten selbst z.b. Glühlampen, Leuchtstofflampen, Monitore, Glühwürmchen usw. Selbstleuchtende Gegenstände (Selbstleuchter) emittieren Licht (senden Licht aus). Für das von Selbstleuchtern
Lichtfarbe Einige leuchten selbst z.b. Glühlampen, Leuchtstofflampen, Monitore, Glühwürmchen usw. Selbstleuchtende Gegenstände (Selbstleuchter) emittieren Licht (senden Licht aus). Für das von Selbstleuchtern
Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut
 Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Seminar: Visuelle Wahrnehmung Datum: 8. November 2001 Referentin: Iris Skorka Dozent: Prof. Dr. Gegenfurtner Ernst Mach: Über die Wirkung der räumlichen Verteilung des Lichtreizes auf die Netzhaut 1. Überblick:
Farbtheorie idealer Farben
 Farbtheorie idealer Farben Die Bezeichnung Colormanagement enthält die Worte Farbe und Management. Wer als Manager nicht genau weiß, warum er etwas tut, muss ständig mit unangenehmen Überraschungen rechnen.
Farbtheorie idealer Farben Die Bezeichnung Colormanagement enthält die Worte Farbe und Management. Wer als Manager nicht genau weiß, warum er etwas tut, muss ständig mit unangenehmen Überraschungen rechnen.
Licht in der Arbeitswelt Wirkung auf den Menschen
 Licht in der Arbeitswelt Wirkung auf den Menschen Guido Kempter Fachhochschule Vorarlberg 30. September 2010 in Arbon Ausreichende Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz verringert die Fehlerquote und steigert
Licht in der Arbeitswelt Wirkung auf den Menschen Guido Kempter Fachhochschule Vorarlberg 30. September 2010 in Arbon Ausreichende Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz verringert die Fehlerquote und steigert
A K K O M M O D A T I O N
 biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
biologie aktiv 4/Auge/Station 2/Lösung Welche Teile des Auges sind von außen sichtbar? Augenbraue, Augenlid, Wimpern, Pupille, Iris, Lederhaut, Hornhaut (durchsichtiger Bereich der Lederhaut) Leuchte nun
1 Grundlagen. 1.1 Definition des Lichts
 1 Grundlagen Der Sehvorgang»beginnt«mit dem Licht. Ohne Licht ist eine visuelle Wahrnehmung nicht möglich, denn das menschliche Auge kann Körper nur wahrnehmen, wenn von ihnen ausgehendes bzw. reflektiertes
1 Grundlagen Der Sehvorgang»beginnt«mit dem Licht. Ohne Licht ist eine visuelle Wahrnehmung nicht möglich, denn das menschliche Auge kann Körper nur wahrnehmen, wenn von ihnen ausgehendes bzw. reflektiertes
9. GV: Atom- und Molekülspektren
 Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Physik Praktikum I: WS 2005/06 Protokoll zum Praktikum Dienstag, 25.10.05 9. GV: Atom- und Molekülspektren Protokollanten Jörg Mönnich Anton Friesen - Veranstalter Andreas Branding - 1 - Theorie Während
Was bedeutet Optik? Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Definitionen erarbeiten Beispiele nennen Wellenspektrum beschriften Farben mit Wellenlängen versehen Wellenlängen verstehen und zuordnen Visualisieren Beispiele
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Definitionen erarbeiten Beispiele nennen Wellenspektrum beschriften Farben mit Wellenlängen versehen Wellenlängen verstehen und zuordnen Visualisieren Beispiele
Farbmischungen. Die Unterschiede zwischen RGB und CMYK. Stand Juni 2015. Langner Marketing Unternehmensplanung Metzgerstraße 59 72764 Reutlingen
 Die Unterschiede zwischen RGB und CMYK Stand Juni 2015 Langner Marketing Unternehmensplanung Metzgerstraße 59 72764 Reutlingen T 0 71 21 / 2 03 89-0 F 0 71 21 / 2 03 89-20 www.langner-beratung.de info@langner-beratung.de
Die Unterschiede zwischen RGB und CMYK Stand Juni 2015 Langner Marketing Unternehmensplanung Metzgerstraße 59 72764 Reutlingen T 0 71 21 / 2 03 89-0 F 0 71 21 / 2 03 89-20 www.langner-beratung.de info@langner-beratung.de
21.Vorlesung. IV Optik. 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente
 2.Vorlesung IV Optik 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente Versuche Lochkamera Brechung, Reflexion, Totalreflexion Lichtleiter Dispersion (Prisma)
2.Vorlesung IV Optik 23. Geometrische Optik Brechung und Totalreflexion Dispersion 24. Farbe 25. Optische Instrumente Versuche Lochkamera Brechung, Reflexion, Totalreflexion Lichtleiter Dispersion (Prisma)
Internet-Akademie. Streifzüge durch die Naturwissenschaften. Serie. Prinzip des Sehvorganges. Folge 01. Autor: Hans Stobinsky
 Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky - 1 - Sehen: Licht als Reporter 1. Über Selbstverständlichkeiten denkt man am wenigsten nach Sehen ist für uns ein alltäglicher, ständig
Serie Streifzüge durch die Naturwissenschaften Autor: Hans Stobinsky - 1 - Sehen: Licht als Reporter 1. Über Selbstverständlichkeiten denkt man am wenigsten nach Sehen ist für uns ein alltäglicher, ständig
FARBE 1 6. InDesign cs6. Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht.
 1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
1 6 Additive und subtraktive Farbmischung Additive Farbmischung = Das Mischen von farbigem Licht. Wenn zwei Taschenlampen auf ein und dieselbe Fläche gehalten werden, so wird diese Fläche heller beleuchtet,
Erklärung. Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre
 Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre Fixieren Sie durch die Röhre einen Gegenstand in der Ferne. Führen Sie dann, wie in der Abbildung gezeigt, ihre Hand an der Röhre entlang langsam in Richtung Auge.
Was sehen wir? Der Blick durch die Röhre Fixieren Sie durch die Röhre einen Gegenstand in der Ferne. Führen Sie dann, wie in der Abbildung gezeigt, ihre Hand an der Röhre entlang langsam in Richtung Auge.
Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung
 Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung Kapitel 5 Seeing Brightness des Buches Eye and Brain the psychology of seeing von Richard L. Gregory Vortragender: Stefan Magalowski 1/33 Inhalt o Dunkeladaption o Anpassung
Vortrag zur Helligkeitswahrnehmung Kapitel 5 Seeing Brightness des Buches Eye and Brain the psychology of seeing von Richard L. Gregory Vortragender: Stefan Magalowski 1/33 Inhalt o Dunkeladaption o Anpassung
Grundlagen der Lichttechnik I
 Grundlagen der Lichttechnik I S. Aydınlı Raum: E 203 Tel.: 314 23489 Technische Universität Berlin Fachgebiet Lichttechnik, Sekr. E6 Einsteinufer 19 10587 Berlin email: sirri.aydinli@tu-berlin.de http://www.li.tu-berlin.de
Grundlagen der Lichttechnik I S. Aydınlı Raum: E 203 Tel.: 314 23489 Technische Universität Berlin Fachgebiet Lichttechnik, Sekr. E6 Einsteinufer 19 10587 Berlin email: sirri.aydinli@tu-berlin.de http://www.li.tu-berlin.de
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern
 Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern Gegenstand der Aufgaben ist die spektroskopische Untersuchung von sichtbarem Licht, Mikrowellenund Röntgenstrahlung mithilfe geeigneter Gitter.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Licht und Optik - Stationenlernen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Licht und Optik - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Licht und Optik - Stationenlernen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Licht und Optik - Stationenlernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Licht und Optik - Stationenlernen
Quantenphysik in der Sekundarstufe I
 Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Quantenphysik in der Sekundarstufe I Atome und Atomhülle Quantenphysik in der Sek I, Folie 1 Inhalt Voraussetzungen 1. Der Aufbau der Atome 2. Größe und Dichte der Atomhülle 3. Die verschiedenen Zustände
Unser Auge ist sehr kompliziert aufgebaut. Um zu verstehen wie es funktioniert, haben wir einige Experimente für dich vorbereitet:
 Die Betreuungspersonen (BP) lesen die Anleitungen zu den Experimenten laut für die Gruppe vor. Die Antworten sind in grüner Schrift. Nur das, was nicht grau hinterlegt ist, befindet sich auf dem SuS-Blatt.
Die Betreuungspersonen (BP) lesen die Anleitungen zu den Experimenten laut für die Gruppe vor. Die Antworten sind in grüner Schrift. Nur das, was nicht grau hinterlegt ist, befindet sich auf dem SuS-Blatt.
Uni für Alle. Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV. 14. März Seite 1
 Uni für Alle Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV 14. März 2017 Seite 1 Ablauf - Energiestrategie 2050 - Lichttechnische Begriffe - Energielabel - Begriffe welche auf der Verpackung stehen
Uni für Alle Patrik Janett Labor für Energieeffizienz und EMV 14. März 2017 Seite 1 Ablauf - Energiestrategie 2050 - Lichttechnische Begriffe - Energielabel - Begriffe welche auf der Verpackung stehen
Ist es möglich, hier im Schülerlabor einen Regenbogen zu erzeugen? Nein. Wo und wann hast du schon Regenbögen oder Regenbogenfarben gesehen?
 Der Regenbogen Die Betreuungspersonen (BP) lesen die Anleitungen zu den Experimenten laut für die Gruppe vor. Die Antworten sind in grüner Schrift. Nur das, was nicht grau hinterlegt ist, befindet sich
Der Regenbogen Die Betreuungspersonen (BP) lesen die Anleitungen zu den Experimenten laut für die Gruppe vor. Die Antworten sind in grüner Schrift. Nur das, was nicht grau hinterlegt ist, befindet sich
Übungsfragen zu den Diagrammen
 Übungsfragen zu den Diagrammen 1. SONNENSPEKTRUM 2500 2000 1500 1000 idealer Schwarzer Körper (Temperatur 5900 K) extraterrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse AM0) terrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse
Übungsfragen zu den Diagrammen 1. SONNENSPEKTRUM 2500 2000 1500 1000 idealer Schwarzer Körper (Temperatur 5900 K) extraterrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse AM0) terrestrische Sonnenstrahlung (Luftmasse
Weißes Licht wird farbig
 B1 Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Halogenlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Prisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter dem Prisma
B1 Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Halogenlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Prisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter dem Prisma
Farbentheorie. Die Wirkung der Farben
 Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Theorie Teil 2: Die Wirkung von Farben Agenda Teil 2: Die Wirkung der Farben: Relatives Farbensehen Farbentheorie Optische Phänomene Simultankontrast und Sukzessivkontrast Farben und Stimmung Die Wirkung
Das CD-Spektroskop. 15 min
 50 Experimente- Physik / 9.-13. Schulstufe Das CD-Spektroskop 15 min Welche Beleuchtung eignet sich für Innenräume am besten? Seit die Glühlampe aus den Wohnungen verbannt wurde, wird in den Medien über
50 Experimente- Physik / 9.-13. Schulstufe Das CD-Spektroskop 15 min Welche Beleuchtung eignet sich für Innenräume am besten? Seit die Glühlampe aus den Wohnungen verbannt wurde, wird in den Medien über
Eine Abbildung ist eindeutig, wenn jedem Gegenstandspunkt genau ein Bildpunkt zugeordnet wird 2.1 Lochkamera
 Physik: Strahlenoptik 1 Linsen 1.1 Sammellinse (Konvexlinsen) f = Brennweite = Abstand von der Mitte zur Brennebene Strahlenverlauf: Parallelstrahl (parallel zur optischen Achse) wird zu Brennpunktstrahl
Physik: Strahlenoptik 1 Linsen 1.1 Sammellinse (Konvexlinsen) f = Brennweite = Abstand von der Mitte zur Brennebene Strahlenverlauf: Parallelstrahl (parallel zur optischen Achse) wird zu Brennpunktstrahl
Farbe. Licht Farbmodelle Farbsysteme
 Farbe Licht Farbmodelle Farbsysteme Übungsblatt 5 http://www.uni-koblenz.de/~ugotit Organisatorisches Übung am 13.07. fällt aus. Neuer Termin 06.07. Übung am 06.07. ist damit auch letzte Übung vor der
Farbe Licht Farbmodelle Farbsysteme Übungsblatt 5 http://www.uni-koblenz.de/~ugotit Organisatorisches Übung am 13.07. fällt aus. Neuer Termin 06.07. Übung am 06.07. ist damit auch letzte Übung vor der
Farbtechnik und Raumgestaltung/EDV
 Abb. 1 Das RGB-Farbmodell Über die additive Farbmischung werden durch die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau alle Farben erzeugt. Im RGB Modell werden ihre Werte je von 0 bis 1 festgelegt. R = G = B = 1
Abb. 1 Das RGB-Farbmodell Über die additive Farbmischung werden durch die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau alle Farben erzeugt. Im RGB Modell werden ihre Werte je von 0 bis 1 festgelegt. R = G = B = 1
Butz, Krüger: Mensch-Maschine-Interaktion, Kapitel 2 - Wahrnehmung. Mensch-Maschine-Interaktion
 Folie 1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze
Folie 1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze
Farbumfänge. Arbeiten mit Farbe
 Farbumfänge Beim Farbumfang bzw. Farbraum eines Farbsystems handelt es sich um den Farbbereich, der angezeigt oder gedruckt werden kann. Das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Farbspektrum ist größer als
Farbumfänge Beim Farbumfang bzw. Farbraum eines Farbsystems handelt es sich um den Farbbereich, der angezeigt oder gedruckt werden kann. Das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Farbspektrum ist größer als
Lernen an Stationen Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/14 Arbeitsauftrag Ziel Die LP legt anhand der Liste an verschiedenen Tischen das bereit. An jeder Station liegt eine Karteikarte mit den Anweisungen. Die Karteikarten mit den Lösungen
Lehrerinformation 1/14 Arbeitsauftrag Ziel Die LP legt anhand der Liste an verschiedenen Tischen das bereit. An jeder Station liegt eine Karteikarte mit den Anweisungen. Die Karteikarten mit den Lösungen
Was ist der Farbwiedergabeindex?
 Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Was ist der Farbwiedergabeindex? Das Licht bestimmt die Farbe Unter der Farbwiedergabe einer Lichtquelle versteht man deren Eigenschaft, welche Farberscheinung ihr Licht auf Gegenständen bewirkt. Farbwiedergabe
Definition. Farbe ist diejenige Empfindung, die es uns erlaubt, zwei strukturlose Oberflächen gleicher Helligkeit zu unterscheiden
 Farbwahrnehmung Farbe ist eine Empfindung (color versus paint) Im Auge gibt es drei Arten von Zapfen, die Licht in Nervenimpulse umwandeln Diese werden in den Ganglienzellen der Retina in Gegenfarben transformiert
Farbwahrnehmung Farbe ist eine Empfindung (color versus paint) Im Auge gibt es drei Arten von Zapfen, die Licht in Nervenimpulse umwandeln Diese werden in den Ganglienzellen der Retina in Gegenfarben transformiert
Wellenlängen bei Strahlungsmessungen. im Gebiet der Meteorologie nm nm
 Die Solarstrahlung Die Sonne sendet uns ein breites Frequenzspektrum. Die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die am oberen Rand der Erdatmosphäre einfällt, wird als extraterrestrische Sonnenstrahlung
Die Solarstrahlung Die Sonne sendet uns ein breites Frequenzspektrum. Die elektromagnetische Strahlung der Sonne, die am oberen Rand der Erdatmosphäre einfällt, wird als extraterrestrische Sonnenstrahlung
SPEKTRUM. Bilden Sie zu Beginn des Beispieles eine Blende oder einen Spalt ab und studieren Sie die Eigenschaften
 SPEKTRUM Bilden Sie zu Beginn des Beispieles eine Blende oder einen Spalt ab und studieren Sie die Eigenschaften dieser Abbildung. Wie hängen Bildgröße und Brennweite der Abbildungslinse zusammen? Wie
SPEKTRUM Bilden Sie zu Beginn des Beispieles eine Blende oder einen Spalt ab und studieren Sie die Eigenschaften dieser Abbildung. Wie hängen Bildgröße und Brennweite der Abbildungslinse zusammen? Wie
Präparation dynamischer Eigenschaften
 Kapitel 2 Präparation dynamischer Eigenschaften 2.1 Präparation dynamischer Eigenschaften in der klassischen Mechanik Physikalische Objekte, die in einem Experiment untersucht werden sollen, müssen vorher
Kapitel 2 Präparation dynamischer Eigenschaften 2.1 Präparation dynamischer Eigenschaften in der klassischen Mechanik Physikalische Objekte, die in einem Experiment untersucht werden sollen, müssen vorher
- GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbh - 1. Gerontotechnik Verbindung von Gerontologie und Technik.
 - GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbh - 1 Die GGT Gerontotechnik Gerontotechnik Verbindung von Gerontologie und Technik. Gerontologie Wissenschaftliche Untersuchung des Alters, wobei der Schwerpunkt
- GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbh - 1 Die GGT Gerontotechnik Gerontotechnik Verbindung von Gerontologie und Technik. Gerontologie Wissenschaftliche Untersuchung des Alters, wobei der Schwerpunkt
Das Auge isst mit. Farbe als Qualitätsmerkmal von Lebensmitteln
 Das Auge isst mit Farbe als Qualitätsmerkmal von Lebensmitteln Forum gezielte Qualitätssteigerung Sortieren Separieren Farbmetrik 10. März 2016 Urs Pratter / Konica Minolta Sensing Europe B.V. Konica Minolta
Das Auge isst mit Farbe als Qualitätsmerkmal von Lebensmitteln Forum gezielte Qualitätssteigerung Sortieren Separieren Farbmetrik 10. März 2016 Urs Pratter / Konica Minolta Sensing Europe B.V. Konica Minolta
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Arbeitsblätter für die Klassen 5 bis 6: Licht und Optik
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Arbeitsblätter für die Klassen 5 bis 6: Licht und Optik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Arbeitsblätter
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Arbeitsblätter für die Klassen 5 bis 6: Licht und Optik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de SCHOOL-SCOUT Arbeitsblätter
Der Welle-Teilchen-Dualismus
 Quantenphysik Der Welle-Teilchen-Dualismus Welle-Teilchen-Dualismus http://bluesky.blogg.de/2005/05/03/fachbegriffe-der-modernen-physik-ix/ Welle-Teilchen-Dualismus Alles ist gleichzeitig Welle und Teilchen.
Quantenphysik Der Welle-Teilchen-Dualismus Welle-Teilchen-Dualismus http://bluesky.blogg.de/2005/05/03/fachbegriffe-der-modernen-physik-ix/ Welle-Teilchen-Dualismus Alles ist gleichzeitig Welle und Teilchen.
LMU München LFE Medieninformatik Mensch-Maschine Interaktion (Prof. Dr. Florian Alt) SS2016. Mensch-Maschine-Interaktion
 1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze Hörsinn
1 Mensch-Maschine-Interaktion Kapitel 2 - Wahrnehmung Sehsinn und visuelle Wahrnehmung Physiologie der visuellen Wahrnehmung Farbwahrnehmung Attentive und präattentive Wahrnehmung Gestaltgesetze Hörsinn
Allgemeines über die LED
 Allgemeines über die LED Quelle: www.led-beleuchtungstechnik.com LED steht für Licht emittierende Diode (oder technisch oft Luminiszenzdiode genannt) und gehört zu den elektronischen Halbleiter- Elementen.
Allgemeines über die LED Quelle: www.led-beleuchtungstechnik.com LED steht für Licht emittierende Diode (oder technisch oft Luminiszenzdiode genannt) und gehört zu den elektronischen Halbleiter- Elementen.
LED Energetische und qualitative Eigenschaften
 LED Energetische und qualitative Eigenschaften Prof. M. Wambsganß / M. Schmidt - 1 Gliederung! Grundlagen " Technologie der (weißen) LED " (LED-) Licht und Gesundheit! Effizienz! Qualitätsmerkmale " Temperaturmanagement
LED Energetische und qualitative Eigenschaften Prof. M. Wambsganß / M. Schmidt - 1 Gliederung! Grundlagen " Technologie der (weißen) LED " (LED-) Licht und Gesundheit! Effizienz! Qualitätsmerkmale " Temperaturmanagement
Ich sehe was, was du nicht siehst. Visuelle Wahrnehmung
 Ich sehe was, was du nicht siehst Visuelle Wahrnehmung Prof. Dr. Horst O. Mayer Warum sind die Augen rot? 1 Die Netzhaut ist rot Und bei Katzen? reflektierende Schicht 2 Warum sind in der Nacht alle Katzen
Ich sehe was, was du nicht siehst Visuelle Wahrnehmung Prof. Dr. Horst O. Mayer Warum sind die Augen rot? 1 Die Netzhaut ist rot Und bei Katzen? reflektierende Schicht 2 Warum sind in der Nacht alle Katzen
LED-Einleitung 2011LED
 2011LED LED-Einleitung LED-Einleitung architektonisches licht Effiziente LED-Technologie bildet die Basis für Beleuchtungslösungen der Zukunft, und die Zahl ihrer Anwendungsmöglichkeiten wächst ständig.
2011LED LED-Einleitung LED-Einleitung architektonisches licht Effiziente LED-Technologie bildet die Basis für Beleuchtungslösungen der Zukunft, und die Zahl ihrer Anwendungsmöglichkeiten wächst ständig.
Grundlagen des Farbensehens
 Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 1 Grundlagen des Farbensehens AB 1-1, S. 1 Arbeitsaufträge: 1. Beschriften Sie die Koordinatenachsen des Diagramms und schreiben Sie an das Absorptionsmaximum
Das Farbensehen der Vögel, Arbeitsmaterial 1 Grundlagen des Farbensehens AB 1-1, S. 1 Arbeitsaufträge: 1. Beschriften Sie die Koordinatenachsen des Diagramms und schreiben Sie an das Absorptionsmaximum
Der effektive Lichtstrom. Warum wir unsere LED Leuchtmittel auch mit Pupil Lumen beschreiben:
 Der effektive Lichtstrom Warum wir unsere LED Leuchtmittel auch mit Pupil Lumen beschreiben: Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen kurz aufzeigen, dass man als Anwender der LED Technik die Angabe Lumen pro
Der effektive Lichtstrom Warum wir unsere LED Leuchtmittel auch mit Pupil Lumen beschreiben: Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen kurz aufzeigen, dass man als Anwender der LED Technik die Angabe Lumen pro
GELB, ROT, BLAU, den Farben auf die Spur kommen! Farberlebnisse in der Frühkindlichen Bildung und den Übergängen. Referentin: Silke Sylvia Gerlach
 GELB, ROT, BLAU, den Farben auf die Spur kommen! Farberlebnisse in der Frühkindlichen Bildung und den Übergängen Referentin: Silke Sylvia Gerlach Inhalt 1. Phänomen Farbe 1. 1. Farbe aus Sicht der Physik;
GELB, ROT, BLAU, den Farben auf die Spur kommen! Farberlebnisse in der Frühkindlichen Bildung und den Übergängen Referentin: Silke Sylvia Gerlach Inhalt 1. Phänomen Farbe 1. 1. Farbe aus Sicht der Physik;
