download unter
|
|
|
- Astrid Holst
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Acta Albertina Ratisbonensia Bd S DAS GLETSCHERVORFELD DES ÖDENWINKELKEESES (HOHE TAUERN) ALS GEOGRAPHISCH-GLAZIOLOGISCHES EXKURSIONSZIEL (MIT EINER KARTE DES VORFELDES 1:5000) von Heinz Slupetzky * Zusammenfassung Das Gletschervorfeld des Ödenwinkelkeeses im Stubachtal (Hohe Tauern, Ostalpen) in der Glocknergruppe ist über einen Lehrweg vom Alpinzentrum Rudolfshütte (2.310 m) aus erreichbar/ der Weg ist auf der beiliegenden Karte eingetragen. Das Ödenwinkelkees ist ein schuttbedeckter Talgletscher im Kar des Ödenwinkels am Fuß einer m hohen, steilen Felswand. Er hat eine Fläche von 2,1 km2 und endet in m Seehöhe. Das Vorfeld, in dem zwei Moränenwälle von 1900 und 1925 zu finden sind, wird durch die 1850er- Moräne abgegrenzt. Der Gletscher schmolz von '1850 bis 1987 um 1,4 km zurück, von 1960 bis 1988 um 303 m. Die jährliche mittlere Rückzugsrate von 11 m hat sich in den vergangenen drei Jahren auf 3-4 m verringert, da der Massenzuwachs des Gletschers seit Mitte der 60er-Jahre bis Ende der 70er-Jahre mit einer Reaktionszeit von über 20 Jahren das Gletscherende erreicht und zu einer Aufwölbung und Erhöhung der Fließgeschwindigkeit geführt hat. Eine Besonderheit im Vorfeld sind Wälle und Streifen von einigen Metern bis zu mehreren Zehner von Metern Länge, bestehend aus kantigen Blöcken und Steinen, deren Entstehung auf den Zerfall der Gletscherzunge und das Absetzen der Obermoränendecke auf die Grundmoräne während des Abschmelzprozesses in Abhängigkeit vom Rückzug des inaktiven Eises zurückzuführen ist/ die Wälle sehen von der Ferne wie große Strukturböden aus. Abstract The glacier forefield of the Ödenwinkelkees in the Stubach valley (Hohe Tauern, Eastern Alps) in the Glöckner mountain group can be reached by a guided nature trail starting at the alpine hostel Alpinzentrum Rudolfshütte (2.130 m). The trail is shown on the enclosed map. The Ödenwinkelkees is a debris covered valley glacier in the cirque of the ödenwinkel at the foot of a steep, 600 to 800 m high rock wall. It covers an area of 2.1 km2 and terminates at an elevation of m. The proglacial area, where two moraine ridges of 1900 and 1925 can be found. is bordered by the moraine ridge of The glacier melted back 1.4 km between 1850 and 1987 and 303 m from 1960 to The mean annual rate of recession of 11 m was reduced to 3-4 m during the last three years. * Prof. Dr. Heinz Slupetzky, Institut für Geographie, Universität Salzburg, Hellbrunnerstr. 34, A-5020 Salzburg
2 150 download unter Slupetzkv. Heinz Ödenwinkelkees As a result of the mass gain of the glacier since the mid-sixties to the end of the seventies, a bulging and lifting of the glacier surface at its terminus after a delay of more than 20 years occured. Special features in the forefield are ridges and stripes ranging from a few meters up to tens of meters in length and consisting of angular rocks and stones. They are caused by the decay of the glacier tongue and the deposition of upper moraines on ground moraines during the ablation process due to the recession of the inactive ice. The ridges look like large patterned ground from the distance. Vorwort Wilhelm Kick hat sich neben seinem Beruf als Geodät bei der Deutschen Bundesbahn seit über drei Jahrzehnten mit der Erforschung von Gletschern, vor allem in Asien, beschäftigt. Eine stattliche Publikationsliste zeugt von der reichen wissenschaftlichen Ausbeute seiner Forschungsexpeditionen und der konsequenten Anwendung der Photogrammetrie zur exakten Erfassung von Gletscherschwankungen. Seine wissenschaftliche Tätigkeit hat in der Folge ihren Niederschlag in seiner Lehrtätigkeit und als Honorarprofessor am Geographischen Institut der Universität Regensburg gefunden. In diesen Rahmen fällt auch die Aufgabe, den Studierenden bei Exkursionen ein anschauliches Bild der Gletscher und ihrer Schwankungen zu bieten. Erstmals wurde im September 1972 unter Führung von Wilhelm Kick eine Exkursion zur Rudolfshütte im Stubachtal, Hohe Tauern, unternommen, wobei Kick schon 1969 das Gebiet während des 17. Gletscherkurses ( ) kennengelernt hatte. Weitere Exkursionen folgten 1974, 1977, 1980, 1984 und 1987, wobei der Verfasser als lokaler Gebietskenner und Leiter der Gletscherforschungen im Stubachtal zumeist für die Führungen zum Sonnblick- und ödenwinkel- sowie Unteren Rifflkees zur Verfügung stand. Zum Anlaß des 75. Geburtstages des Kollegen und Freundes Kick und der kürzlich erfolgten Fertigstellung einer Karte des Gletschervorfeldes des Ödenwinkelkeeses soll dieser Beitrag dem Jubilar sehr herzlich gewidmet sein. 1. Allgemeine Einführung Das Ödenwinkelkees liegt im obersten Stubachtal nahe dem Alpenhauptkamm. Das Stubachtal ist eines der Täler an der Nordabdachung der Hohen Tauern, das einen Stufenbau aufweist und gleichsohlig in das Salzachtal einmündet. Es liegt an der Grenze zwischen der Glocknergruppe im Osten und der Granatspitzgruppe im Westen. Das Tal gabelt sich im Oberlauf in zwei Quelläste, in das Tauernmoostal und das Weißbachtal. Einerseits sind der Stufenbau und die Abfolge von Becken und Schwellen bzw. Weitungen und Engstellen für das Tal charakteristisch, andererseits bestimmen die Gegensätze der begrenzenden Seitenkämme das morphologische Landschaftsbild. Im Stubach-Kapruner Kamm in der Glocknergruppe werden bis zum nördlich vorgelagerten Kitzsteinhorn Höhen über 3000 m überschritten; daher ist dieser Seitenkamm vergletschert, es gibt hier mehrere kleine Kargletscher. Der westliche Kamm fällt gegen Norden von m unter m ab, die Vergletscherung beschränkt sich
3 Im Alpinzentrum ist auch die Hochgebirgsforschungsstelle der Universität Salzburg untergrebracht. Sie hat die Funktion, Stützpunkt für die Forschungs- und Lehrtätigkeiten von Fachrichtungen, die sich im weitesten Sinn mit der Erforschung des Hochgebirges befas Acta Albertina Ratisbonensia download unter Bd. 46, auf den zentralen Teil der Granatspitzgruppe mit dem Stubacher Sonnblick Kees als größten Gletscher. Der Kaiser Tauern (2.518 m) am Alpenhauptkamm bildet die Grenze zwischen der Granatspitz- und der Glöckner Gruppe. Hier verläuft auch die Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg und (Ost-) Tirol. Ein Teil des Stubachtales ist in den Nationalpark Hohe Tauern - der Salzburger Anteil besteht durch Landesgesetz seit einbezogen, wobei das Gebiet vom Ödenwinkel bis zum Kitzsteinhorn in der Kernzone und das Gebiet der Granatspitzgruppe in der Außenzone liegt. Die morphologisch-topographischen und die hydrologischen Bedingungen im Stubachtal waren die Voraussetzung für eine kraftwerkstechnische Erschließung des Tales. Schon 1914 erwarben die K.U.K. Staatsbahnen die Wasserrechte wurde mit dem Bau der ersten Etappe, dem Kraftwerk Enzingerboden, begonnen, mit dem dazugehörigen Speicher Tauernmoos, dessen Sperre zwischen 1926 und 1929 hochgezogen wurde wurde mit dem Baubeginn des Kraftwerks Schneiderau und 1941 mit Uttendorf die Kraftwerkskette der österreichischen Bundesbahnen vorerst geschlossen. Mit der Errichtung des Speichers Weißsee, die im Jahr 1953 beendet wurde, war die erste Bauphase zu Ende. Die alte Tauernmoossperre wurde in einer zweiten Bauphase durch einen Neubau, der 1975 fertig war, ersetzt. Gegenwärtig ist ein weiterer Ausbau mit dem Kraftwerk Uttendorf II im Gang. Im Zuge des Kraftwerksausbaues zur Hydroelektrizitätsgewinnung wurde der bis dahin bestehende Fahrweg von Uttendorf zum Enzingerboden durch eine Straße erweitert. Auch Seilbahnanlagen wurden errichtet. Seit den 40er-Jahren bis Anfang der 80er-Jahre war die Stubach-Weißsee Seilbahn vom Enzingerboden in das Weißseegebiet in Betrieb; der Personenverkehr war 1951 aufgenommen worden. Im Dezember 1982 wurde eine neue Bahn, eine Einseilumlaufbahn, vom Enzingerboden (1.480 m) über den Grünsee zum Weißseee (2.310 m) eröffnet. Die alte Bahn wurde stillgelegt. Unweit der Bergstation der neuen Bahn liegt das Alpinzentrum Rudolfshütte des österreichischen Alpenvereins. Ursprünglich lag die alte Rudolfshütte nahe dem früher bestehenden natürlichen Weißsee. Diese war 1874 von der Sektion Austria des österreichischen Alpenvereins errichtet worden und bestand, nach mehreren Um- und Erweiterungsbauten, bis Dem ersten Vollstau des Speichers Weißsee in diesem Jahr mußte die alte Rudolfshütte weichen. Kurzzeitig bestand eine Übergangslösung von drei Baracken, dem "Austriadörf 1". Zwischen 1955 und 1958 wurde an der heutigen Stelle die neue Rudolfshütte (Alpenhotel Weißsee) gebaut. Dieses Gebäude wurde 1978/79 erweitert und modernisiert und bildet heute als Alpinzentrum Rudolfshütte eine alpine Ausbildungsstätte des österreichischen Alpenvereins und ist ein Ausgangspunkt für Touren und Übergänge in den mittleren Hohen Tauern.
4 152 download unter Slupetzky. Heinz Ödenwinkelkees sen, zu sein. Ein Anlaß für die Errichtung dieser Station waren die langjährigen Gletschermessungen im obersten Stubachtal. Auch heute bilden die glaziologischen Forschungen einen Hauptschwerpunkt an der Forschungsstation. Die ersten Gletschermessungen waren 1960 begonnen worden. Damals wurden am Sonnblick-, ödenwinkel- und Unteren Rifflkees vom Verfasser und seinem Bruder Werner die ersten Meßmarken zur Feststellung der Längenänderung angelegt. Seit 1963 werden die Nachmessungen innerhalb des Alpenvereins-Meßprogrammes durchgeführt, wobei jährlich bis zu 13 Gletscher in der Granatspitz- und Glocknergruppe vermessen werden (SLUPETZKY, 1963, 1968/ GLETSCHERMEß BERICHTE des ÖAV). Im Jahr 1963 konnte durch die Vermittlung von Richard Finsterwalder von zwei Diplomanden das ödenwinkel- und das Sonnblickkees terrestrisch-photogrammetrisch aufgenommen und Karten im Maßstab 1: hergestellt werden (LUDWIG & RENTSCH, 1964). Im gleichen Jahr wurde am (Stubacher) Sonnblickkees mit Massenbilanzmessungen begonnen. Sie wurden ab 1965 im Rahmen der Internationalen Hydrologischen Dekade (IHD ) und anschließend bis 1980 im Nachfolgeprogramm (IHP) durchgeführt. Auch wurde 1963 mit der Messung des Niederschlages mit einem Netz von Totalisatoren in den Einzugsgebieten der Speicher Weißsee und Tauernmoossee angefangen (AIGNER, 1984). Das Massenbilanz - bzw. glazialhydrologische Meßprogramm zur Berechnung des Eis- und Wasserhaushaltes im Einzugsgebiet des Speichers Weißsee wird noch heute, z.t. in eingeschränktem Umfang, mit Förderung durch die Hydrographiche Landesabteilung Salzburg bzw. des Hydrographischen Zentralbüros in Wien, weitergeführt. Mit einem Pegelnetz wird am Ödenwinkelkees und am Sonnblickkees seit 1965 bzw jährlich die Gletscherbewegung gemessen/ dies geschieht in Zusammenarbeit mit H. Puruckherr und Studenten von der Fachhochschule Bochum, Fachbereich Vermessungswesen. Die glaziologischen Forschungen im Stubachtal waren der Grund dafür, daß das Gebiet der Rudolfshütte mehr und mehr zum Tagungsort und Exkursionsziel gewählt wurde. Unter anderem fanden 1969 und 1972 Gletscherkurse statt. Auch werden immer wieder Exkursionen von geographischen Instituten des In- und Auslandes ins Weißseegebiet geführt (SLUPETZKY, 1988). Ein weiterer Anlaß, das obere Stubachtal und seine Gletscher zu besuchen, war die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern und, damit zusammenhängend, die Anlage von Gletscherlehrpfaden zum Sonnblick- und Ödenwinkelkees unter der Patronanz des österreichischen Alpenvereins. 2. Das Ödenwinkelkees Das Ödenwinkelkees ist der einzige Talgletscher und zugleich der größte des Stubachtales / er liegt nahe am Alpenhauptkamm in nord bis nordostexponierter Lage im ödenwinkelkar. Der Gletscher hat heute eine Fläche von 2,1 km2 (1987). Das Ödenwinkelkees nimmt eine gewisse Sonderstellung bei den Gletschertypen in den Hohen Tauern ein. Die flache, schuttbedeckte Zunge wurzelt am Fuß des steilen Talschlusses des Ödenwinkels, eine m hohe Wandflucht (Karrückwand) überragt das Firngebiet, die umrahmenden Berggipfel erreichen Höhen über m (Johannisberg m,
5 Acta Albertina Ratisbonensia download unter Bd Eiskögele m). Das Firngebiet zeigt eine Asymmetrie: Orographisch rechts bieten zwei Stufenflächen, durch Steilstufen bzw. Eisbrüche miteinander verbunden, die Möglichkeit zu relativ ungestörter Schneeakkumulation, orographisch links und am Fuß der Eiskögele-Nordwand lehnt sich das Firngebiet als Steilaufschwung an die Karrückwand an; hier ist das Kees lawinenernährt. Die höchsten Teile des Einzugsgebietes liegen westlich des Johannisberg bei m, und beim Eiskögele zwischen und m. Damit befindet (und befand) sich der Großteil des Nährgebietes in relativ niedriger Seehöhe und unterhalb der durchschnittlichen Schneegrenze des Gebietes. Die Schneegrenze lag um 1850 orographisch- bzw. expositionsbedingt sehr tief: zwischen und m (von orographisch links nach orographisch rechts ansteigend), wie aus der Höhenlage des Einsetzens der beiderseits abgelagerten Ufermoränen zu erschließen ist. Als die Schneegrenze in den 50er- und 60er-Jahren bis auf m anstieg, gelangte der größte Teil des Ödenwinkelkeeses ins Ablationsgebiet. Aus den Steilwänden der Karrückwand gehen ständig, ausgelöst durch den Frostwechsel, Steinschläge und Steinlawinen nieder. Nach dem Ausschmelzen unterhalb der Gleichgewichtslinie ist die Oberfläche des Gletschers schuttbedeckt. Die Obermoräne nimmt gegen das Gletscherende an Fläche und Dicke zu und verhüllt das untere Drittel der Zunge vollkommen. Die Obermoräne besteht im orographisch rechten Teil aus plattig zerfallenden Gesteinen aus der Schieferhülle und orographisch links aus grobblokkigen Gneisgesteinen aus dem Granatspitzkern. Das Ödenwinkelkees reicht in dem tief eingeschnittenen, zum Hauptkamm heranreichenden Hochtalende tief herab, das Gletscherende liegt heute in einer Seehöhe von m (1987). Die tiefe Lage wäre nicht ohne die Schutt- bzw. Obermoränenbedeckung, die wenige Dezimeter bis zu einem halben Meter beträgt, möglich, da diese die Ablation bis zum halben Betrag vermindert. Die Oberflächenneigung des Gletschers beträgt gegenwärtig an der Stirn 15-20, sie ist in den letzten Jahren steiler geworden, im Mittelteil 8-10 und im Nährgebiet 30-35, abgesehen von den flachen Böden orographisch rechts. 3. Das Gletschervorfeld des Ödenwinkelkeeses (vgl. Karte 1:5000) Seit Sommer 1988 erschließt ein Gletscherlehrweg das Vorfeld des Ödenwinkelkeeses. Begleitend dazu wird eine Broschüre "Gletscherwege im Stubachtal", ähnlich wie für den Gletscherweg "Obersulzbachtal" (SLUPETZKY, 1986), durch den österreichischen Alpenverein herausgebracht. Der Gletscherlehrweg führt vom Alpinzentrum Rudolfshütte über den Schafbichl (2.352 m) zunächst gegen Norden in Richtung Tauernmoossee, zweigt dann nach Südosten ab und führt zur Eisbodenlacke (2.067 m). Unweit davon wird durch eine neue Brücke die Überquerung des Ödbaches ermöglicht. Von hier verläuft der Weg an der orographisch rechten Seite durch das Vorfeld bis zum Gletscherende. Das Gletschervorfeld und die unmittelbare Umgebung sowie das Gletscherende des Ödenwinkelkeeses sind durch die neue Karte im Maßstab 1:5000 erfaßt (s. Beilage). Sie wurde im Rahmen
6 154 Slupetzky, Heinz Ödenwinkelkees eines Praktikums für Kartenoriginalherstellung und Reproduktionstechnik am Institut für Kartographie und Reproduktionstechnik der Technischen Universität Wien unter der Leitung von J. Aschenbrenner hergestellt; der Entwurf und die Kartographie stammen von H. Hammerle. Die 9-Farbenkarte hatte besonders zum Ziel, neben dem verwendeten Orthophoto durch eine naturgetreue Fels- bzw. Schuttdarstellung und Erfassung der wesentlichen Geländeformen eine Verstärkung des plastischen Geländeeindrucks zu erreichen. Für den glaziologischen bzw. glazialmorphologischen Karteninhalt ist die möglichst naturgetreue Darstellung der Moränenwälle, der Grundmoränen- und Schuttflächen im Vorfeld und der Verlauf des Gletscherbaches mit den fluviatil geprägten Flächen angestrebt worden. Zur Aktualisierung des Gletscherstandes wurde neben der Gletscherzunge von 1982 der Eisrand von 1987 eingetragen. Obwohl das Ödenwinkelkees in früherer Zeit nie im Mittelpunkt gletscherkundlichen Interesses stand, sind doch durch einige historische Quellen und die Gletrscherforschungen in den vergangenen drei Jahrzehnten die Kenntnisse über die Schwankungen des Gletschers erweitert worden. Über die postglazialen Veränderungen des Ödenwinkelkeeses ist nur wenig bekannt, abgesehen von den Neuzeitlichen Hochständen. Die Ausdehnung des Gletschers zur Zeit des Maximalstandes während letzterer Periode ist deutlich an dem Moränenkranz und an der Vegetationsbegrenzung der "1850"er-Moräne zu sehen. Bei der Eisbodenlacke (s. Karte) ist diese 1850er-Moräne älteren Ablagerungen aufgesetzt. Schon H. Kinzl (1929) hatte erkannt, daß "die Fünfzigermoräne über einen moränenartigen Wall von schlammiger Zusammensetzung hinaufgeschoben ist" (KINZL, 1929: 98). Dieser Stauchwall ist jedoch erstmals schon früher aufgeschoben worden, die späteren Neuzeitlichen Vorstöße haben diese Stelle nochmals erreicht und zum Teil wieder überfahren. Im Wall sind einige gestauchte Torfund Bodenhorizonte vorhanden, an der Basis liegt ein mehrere Dezimeter dickes Torfband, das überschoben wurde. Im Torfband ist ein 15 cm dicker Zirbenstamm gefunden worden. Eine Radiokarbondatierung des Holzes ergab ein 14C-Alter von Jahre (Probe VRI 154) vor heute, eine Probe aus einem gestauchten Torfband war Jahre (VRI 155) vor heute (1950) alt. Damit wird annähernd eine Gletschervorstoßphase eingegrenzt, die der Frosnitz- Schwankung ( v.h.) zuzuordnen ist. Der Zeitabschnitt vorher fällt in die warmzeitliche Phase zwischen der Venediger und der Frosnitz Schwankung zwischen und v. h. (PATZELT & BORTENSCHLAGER, 1973). Die damalige Waldgrenze war im Stubachtal um etwa 100 m höher gegenüber der "heutigen" (potentiellen) Waldgrenze, sie lag in der Größenordnung bei m oder wenig darüber. Am hangseitigen Ufer begrenzt ein stark bewachsener moränenartiger Wall die Eisbodenlacke. Es könnte sich um einen Vorstoß im frühen Postglazial (Venediger Schwankung? ) handeln, der nur wenig über die Ausdehnung des 1850er-Standes hinausgereicht hat. Damit ist von den bisher bekannten nacheiszeitlichen Gletscherhochstandsperioden beim Ödenwinkelkees nur eine sicher nachweisbar. Wie man heute weiß, schwankten das Klima und die Gletscher im (alpinen) Postglazial (nach v.h.) mit geringer Schwankungsbreite um gegenwärtige Verhältnisse (PATZELT & BORTENSCHLAGER, 1973). In der Nacheiszeit sind (mindestens) acht Gletscherhoch-
7 In den Hohen Tauern schmolzen alle Gletscher bald nach dem Hochstand zurück, über den Rückzug des Ödenwinkelkeeses in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gibt es nur wenig auswertbare Quellen. Von J. STÜDL (1870: 129) ist eine Skizze über den Mittelteil der Gletscherzunge und das Nährgebiet publiziert. Die ältesten Fotos sind vermutlich zwei von T. Unterreiner aus Windischmatrei aus der Zeit 1880 bis Sie zeigen den größten Teil des Ödenwinkelkeeses (vom Schafbichl aus aufgenommen), aber nicht das Gletscherende selbst. Die Zunge ist flach und gegenüber dem Hochstand deutlich, aber nicht zu stark eingesunken, die Vegetations Acta Albertina Ratisbonensia download unter Bd standsperioden nachgewiesen, wobei die Schneegrenze jeweils ca. 100 m abgesenkt war. In den dazwischenliegenden wärmeren Phasen lag die (potentielle) Waldgrenze 100 bis 150 m höher als dies bei gegenwärtigen Klimaverhältnissen der Fall ist. Die alpine Waldgrenze (und Schneegrenze) schwankte im Postglazial innerhalb eines Bereiches von m. Beim Ödenwinkelkees können die meisten nacheiszeitlichen Gletschervorstöße nur kürzer gewesen sein als die neuzeitlichen Stände (1850er-Stand), Moränenwälle müssen jeweils überfahren bzw. abgetragen worden sein. Die Vorstoßperiode vom 17. bis 19. Jahrhundert wird als neuzeitliche Gletscherschwankung bezeichnet. Der letzte allgemeine Vorstoß der Gletscher in den Hohen Tauern ereignete sich zwischen 1810 und Fast alle Tauerngletscher hatten zwischen 1850 und 1855 ihre größte Ausdehnung während dieser Vorstoßperiode erreicht. Auch das Ödenwinkelkees hatte in dieser Phase seine maximale Größe in historischer Zeit. Die über große Strecken noch vorhandenen Stirn- und Ufermoränen (vgl. die Karte und das dort abgebildete Foto) lassen die früheren Dimensionen des Gletschers erkennen. Verschiedene Quellen versetzen uns in die Lage, eine Vorstellung über den Vorstoß im 19. Jahrhundert zu erhalten. Wie eine alte Kartenaufnahme (Franziszeische Landesaufnahme) von 1807/08 zeigt, war das Ödenwinkelkees zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Vorstoß begriffen. Auf der Karte ist eine stark schuttbedeckte Gletscherzunge abgebildet. Das Gletscherende wäre nicht erkennbar gewesen, hätte der Topograph nicht zwei Gletscherbäche eingetragen, deren Beginn annähernd abschätzen läßt, wo der Eisrand lag. Die Gletscherstirn war damals ca m vom Maximalstand von 1850 entfernt. Die Eisbodenlacke ist noch nicht eingezeichnet (obwohl sonst auch kleine Seen in dieser Karte eingetragen sind); dies läßt die Vermutung zu, daß der See erst beim maximalen Vorstoß von 1850 abgedämmt wurde. In einer Karte von Franz KEIL (1860) ist der Höchststand der Gletscher der Glocknergruppe festgehalten. Die Umrisse des Ödenwinkelkeeses auf der Karte stimmen recht gut mit dem Moränenkranz in der Natur überein. Es kann daher als gesichert gelten, daß das Ödenwinkelkees seinen Höchststand in der Neuzeit um 1850 hatte. Der Stirnmoränenwall bei der Eisbodenlacke ist bis zu mehrere Meter hoch und sehr blockreich. Die Gletscherzunge war damals - wie heute - stark schuttbedeckt. Die dadurch verminderte Abschmelzung an der Zunge läßt den Schluß zu, daß das Kees vermutlich einige Jahre an der Moräne verharrte bzw. oszillierte, bis der Eisnachschub nachließ und der Rückschmelzprozeß einsetzte. Der Rückgang dürfte daher erst um 1860 begonnen haben.
8 156 download unter Slupetzkv. Heinz Ödenwinkelkees grenzen zum Gletschervorfeld und die Ufermoränenwälle waren zu dieser Zeit noch gut erhalten. Auf einem Foto von Eduard Stummer ist die Zunge des Ödenwinkelkeeses abgebildet. Es stammt vermutlich von Der Rückzug der Tauerngletscher wie auch des Ödenwinkelkeeses vollzog sich nicht kontinuierlich, sondern war durch Halte und kurze Vorstöße unterbrochen. Neben der 1850er-Moräne findet man zwei weitere Wälle (die auch auf der Karte 1:5000 dargestellt sind): Innerhalb des Vorfeldes ist ein moränenartiger Wall in 460 m Entfernung von der 1850er-Moräne vorhanden. Er ist hier nicht als ein Stirnmoränenwall, sondern als eine deutliche Geländestufe in der Grundmoränendecke ausgebildet, ausgenommen orographisch links, wo die Ablagerungen Wallcharakter haben. Dies läßt die Schlußfolgerung zu, daß das Gletscherende hier einige Zeit stationär war und nicht kräftiger vorstieß. Die Moräne muß um 1900 entstanden sein. 150 m innerhalb dieser 1900er-Moräne liegt der 1920er-Moränenwall. Er löst sich orographisch rechts vom Hang und zieht, den Rand der ehemaligen Gletscherzunge wiedergebend, in einer Krümmung gegen die Mitte des Vorfeldes. An der Gletscherstirn selbst ist kein Wall aufgeschoben worden. Höher oben sind Ufermoränenwälle anzutreffen. Noch wie Fotos aus dieser Zeit erkennen lassen lag der damalige Eisrand nahe dem orographisch rechten Moränenwall. In der geologischen Karte des Glocknergebietes von H. P. CORNELIUS und E.CLAR (1935) ist dieser Wall kartiert worden. Als Kartierungsgrundlage diente die Karte der Glocknergruppe des Deutschen und österreichischen Alpenvereins von 1929, die einen Gletscherstand von 1924 wiedergibt, der beim Ödenwinkelkees dem Maximalstand des 20er-Vorstoßes nahe kommt. Dieser "1920er"-Stand wurde daher zeitlich mit "um 1925" eingestuft. Auf der neuen Karte 1:5000 läßt sich die Längenänderung zwischen 1850 und 1920 ausmessen. In den letzten vier Jahrzehnten ist der Rückzug direkt bestimmt worden. Einerseits dienten dazu photogrammetrische Aufnahmen und Auswertungen. Im Zuge des Ausbaues der ÖBB-Kraftwerke fanden 1949, 1953 und 1959 Befliegungen statt. Aus den Jahren 1960, 1963, 1968, 1973 und 1982 gibt es terrestrisch-photogrammetrische Aufnahmen und Auswertungen (zumeist durch L. Mauelshagen und W. Schröter, Bonn und H. Slupetzky) sowie luftphotogrammeterische Aufnahmen durch das Bundesamt für Eichund Vermessungswesen in Wien. Andererseits können die seit 1960 laufenden direkten Messungen der Längenänderungen herangezogen werden; weiters wurde der Eisrand 1987 geodätisch eingemessen (durch Studenten der Fachhochschule Bochum, Fachbereich Vermessungswesen, unter der Leitung von Rolf Puruckherr und dem Verfasser). In Abb. 1 ist die Längenänderung des Ödenwinkelkeeses von 1850 bis heute dargestellt. Für die Zeit vor 1900 konnte eine Einzelmessung der Längenänderung von 1896/97 herangezogen werden. (Es sind dies die ersten Längenmessungen am Ödenwinkelkees und nicht, wie bis vor kurzem angenommen, die Messungen vom Verfasser ab 1960). Der Rückschmelzbetrag betrug in diesem Jahr 21 m (FRITSCH, 1898).
9 Acta Albertina Ratisbonensia Bd Abb. 1: Die Längenänderung des Ödenwinkelkeeses seit Der Rückzug von 1,4 km zwischen 1850 und 1987 wurde um 1900 und unterbrochen.
10 158 Slupetzkv. Heinz Ödenwinkelkees ÖDENWINKELKEES Jährliche Längenänderung MeU jah r I i i i I i i i i I i I I 1 1 Jährlicher Änderungsbetrag in M etern H. Slupetzky, Abb. 2: Die jährliche Längenänderung des Ödenwinkelkeeses. Der Gletscher schmolz jedes Jahr zurück, im Extremfall 27 m im Jahr Der durchschnittliche Längenverlust betrug 10,8 m.
11 Acta Albertina Ratisbonensia Bd ÖDENWINKELKEES Kumulative Längenänderung V. :...v Y I V. '...V.. '...V. Y. V. V. V. V...y J h : B Ä nderungsbetrag in M etern R Slupetzkyi Abb. 3: Die Längenänderung des Ödenwinkelkeeses seit Der Gletscher verlor bis m seiner Länge. Die mittlere jährliche Rückzugsrate von m hat sich ab 1986 auf 3-4 m verringert.
12 160 Slupetzkv. Heinz Ödenwinkelkees Das Ödenwinkelkees blieb nach dem maximalen Vorstoß von 1850 in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts vermutlich zunächst stationär. Anschließend muß ein rascher Verfall und Rückzug eingetreten sein. Zur Jahrhundertwende wurde der Rückzug unterbrochen, die Gletscherstirn blieb um 1900 ein bis zwei Jahrzehnte stationär und oszillierte in geringem Ausmaß. Nach einem Längenverlust von mindestens 150 m (es ist nicht bekannt, wie weit sich der Eisrand hinter dem späteren 19 25er-Stand zurückgezogen hatte, es kann jedoch nicht sehr weit gewesen sein, in der Größenordnung vermutlich 50 m) wölbte sich der Gletscher auf und stieß vor, hauptsächlich jedoch nur orographisch rechts. Bis 1930 blieb die Zunge bzw. Stirn noch relativ stabil und gewölbt, in den 40er- und 50er-Jahren folgte dem Einsinken und Verflachen der Zunge ein rascher Längenverlust. Mit Beginn der Längen-Meßreihe 1960 hatte sich der Gletscher um 1,1 km verkürzt. In den letzten drei jahrzehnten waren die jährlichen Rückzugsbeträge je nach Zerfallserscheinungen, vor allem in Abhängigkeit vom Ausschmelzeen und Unterhöhlen durch Gletschertore und Eistunnel, unterschiedlich hoch (Abb. 2). Im Durchscnitt betrug der jährliche Rückzugsbetrag 11,1 m. Erst 1986 und 1987 verringerte sich die Rückzugsrate auf nur 3-4 m im Jahr. Insgesamt verlor das Ödenwinkelkees zwischen 1960 und m an Länge (Abb. 3). Nachfolgend eine Übersicht des Rückganges: m m m m m m m m Höhenlage des Gletscherendes: m 2085 m 2095 m m Die Fläche des Ödenwinkelkeeses: ,73 km2 um ,24 km2 (RICHTER, 1888) 1926/27 3,11 km2 (PASCHINGER, 1929) ,46 km2 (nach LUDWIG & RENTSCH, 1964) , 236 km2 (ÖSTERR. GLETSCHERKATASTER) ,124 km ca. 2,100 km2
13 Acta Albertina Ratisbonensia Bd Reduktion der Gletscherfläche bis zum Kartenrand der Karte 1:5000 (ca. bis zur m Höhenlinie): Flächenverlust zwischen 1850 und ,321 km und ,162 km und km2 Fläche der Gletscherzunge (bis zum Kartenrand): ,040 km ,719 km ,558 km ,180 km2 Was die Volumensänderung betrifft, so hat die Gletscherzunge dort, wo derzeit das Gletscherende ist, 150 m an Dicke eingebüßt. Nach dem jahrzehntelangen Rückzug der Gletscher seit dem letzten allgemeinen Vorstoß um 1920 als Folge der Klimaerwärmung mit einem Höhepunkt in den 40er-Jahren setzte in den 50er-Jahren eine erste Tendenz zu einer Klimaabkühlung ein. Ab 1965 bis zur Wende der 70er-Jahre herrschten im Durchschnitt kühle Klimabedingungen. Die Alpengletscher rückten wieder in einer größeren Zahl - bis zu zwei Drittel - vor. Beim Ödenwinkelkees machte sich die Massenzunahme in einer Aufhöhung des Nährgebiets, später auch im Mittelteil der Zunge bemerkbar. Die Fließgeschwindigkeit verdoppelte bis verdreifachte sich. Unterhalb des Wandfußes im ödenwinkel ist die Gletscherzunge bis zu 14 m dicker geworden ( ), der Fließweg hat sich von 20 auf 40 m pro Jahr erhöht. Nahe dem Gletscherende ist der Fließweg von 1-1,5 m (1965) auf 7-8 m (1983) gestiegen. Ein Vergleich der Karten von 1963 und 1973 ergab eine Volumenszunahme von 3,248 Mio m3 (ROHRBACHER,1983). In den letzten Jahren ist die Massenwelle bis zum Gletscherende (an der orographisch rechten Seite) gelangt, die Gletscherstirn wurde steiler; entlang des rechten Eisrandes wurde eine frische Ufermoräne aufgeschoben. In der Zwischenzeit haben die warmen Sommer ab 1981 zu einem Massenverlust geführt. Im Nährgebiet des Ödenwinkelkeeses und auf der Gletscherzunge bis auf etwa m Seehöhe herab sinkt die Oberfläche wieder ein, nur unter m steigt die Oberfläche noch an. Damit hat die Massenwelle aus dem Nährgebiet das Gletscherende mit einer Verzögerung von über 20 Jahren erreicht. Dies stimmt mit den Längenmessungen überein, die eine Verringerung des Rückzuges in den letzten zwei Jahren ergaben (1986 und 1987). Für die nahe Zukunft wird aber eher kein Vorstoß, sondern eine stationäre Lage des Gletscherendes erwairtet.
14 162 Slupetzkv, Heinz Ödenwinkelkees Das Gletschervorfeld des Ödenwinkelkeeses wird - im Gegensatz zum Stubacher Sonnblickkees - durch Akkumulationen glazialen und fluvioglazialen Ursprungs geprägt. Es sind Ufer- und Endmoränen, Moränen der Rückzugsstadien, die Ablagerungen und Erosionserscheinungen durch den Gletscherbach usw. zu finden, ein Formenschatz, den Hans KINZL (1929) in seiner klassischen Arbeit dem sogenannten Gletschervorfeld zuordnete. Im Vorfeld des Ödenwinkelkeeses ist jedoch eine glazialmorphologische Besonderheit anzutreffen. Es sind blockfreie Wälle, Streifen und z.t. Ringe, die von der Ferne wie Strukturböden aussehen. Die Streifen können bis mehrere Zehner von Metern lang sein. Es handelt sich um einen Formenschatz, der auf den Eiszerfall des schuttbedeckten Gletschers zurückzuführen ist (SLUPETZKY, H., 1968). Durch das Abrutschen der Obermoräne bzw. des Schuttes an der Gletscherstirn oder in Spalten hinein an der inaktiven Zunge oder im Bereich sich ablösender Toteisblöcke wird die Obermoräne nicht gleichmäßig auf die Grundmoräne abgesetzt. Nach dem Wegschmelzen der Eisblöcke oder Rückschmelzen des Eisrandes bleibt das dazwischen oder davor abgelagerte, grobe Schuttmaterial netz- oder streifenartig liegen. In den letzten Jahrzehnten hat der pendelnde und verwilderte Gletscherbach die Netzstrukturen z.t. zugeschüttet und verdeckt. Infolge des Gletscherrückganges verlagert sich das Gletscherende langsam höher, dadurch kann der Gletscherbach, besonders bei Hochwasser, seitlich ausbrechen und die Streifen und Ringe zusedimentieren. Vor allem im Bereich der 1925er-Moräne sind die genannten Strukturen gut erkennbar. Beim Übergang von einer Vorstoßphase zur Stagnation zerfällt die Zunge in Radialspalten, Spaltennetze und Spalten oberhalb des Gletschertores parallel zum Eisrand, es kommt beim Abschmelzen und Verflachen zu einem verstärkten Zerfall, ganz besonders auch im Bereich des Gletschertores, wo das Eis durch den Gletscherbach unterhöhlt wird. Im Vorfeld des Ödenwinkelkeeses treten Säuerlingsfluren in verschiedenen Entwicklungsstadien auf, die sich an Hand der Gletscherstände zeitlich gut einordnen lassen. Auch kann man hier in nur m Seehöhe die Nivalflora sehen, die zu 90% die Pioniervegetation des Vorfeldes aufbaut (TEUFL, 1981). Danksagung J. Aschenbrenner und H. Hammerle bin ich für die Herstellung der Karte des Ödenwinkelkees-Vorfeldes zu großem Dank verpflichtet. J. Strobl vom Institut für Geographie in Salzburg danke ich für die Auswertung bzw. Berechnung der jüngsten Flächenänderungen des Ödenwinkelkeeses und Herrn K. Pangorl für Profilzeichnungen. Herr W. Gruber, Salzburg, hat dankenswerter Weise die Abbildungen reingezeichnet.
15 Acta Albertina Ratisbonensia Bd. 46, Die Haltepunkte am Gletscherlehrweg (seit 1988) 1. Der Ödenwinkel mit dem Ödenwinkelkees. Von diesem Punkt aus (auf der Karte 1:5000 liegt dieser Punkt außerhalb des Kartenrandes; das Übersichtsfoto ist vom Haltepunkt 1 aus aufgenommen) ist das gesamte Vorfeld mit den Gletscherständen zu überblicken. 2. Die Stirnmoräne von 1850 (und ältere Moränenwälle) 3. Der Gletscherbach 4. An dieser Stelle war das Ödenwinkelkees um m breit und rund 100 m dick. 5. Die Moräne von Blick zum Ödenwinkelkees 7. Die Stirnmoräne von Moränenschuttwall (Eiszerfalls-Formenschatz) 9. Ehemaliger Gletscherrand von Ehemaliger Gletscherrand von Ehemaliger Gletscherrand von Grundmoränenhügel 13. Ehemaliger Gletscherrand von Gletschermeßmarken 14. Eisdicke 1850: 150 m; Eisdicke 1965: 35 m. 15. Das heutige Gletscherende; Gletschertor In dem in Vorbereitung befindlichen Führer zum Gletscherweg werden weitere Angaben enthalten sein. Der neue Gletscherweg soll interessierten Laien wie Fachkundigen die Möglichkeit geben, ein Gletschervorfeld in den Hohen Tauern zu besuchen, um die großen Veränderungen kennenzulernen, die durch die Gletscher- und Klimaschwankungen verursacht wurden und werden.
16 164 Slupetzkv. Heinz Ödenwinkelkees Literatur AIGNER, CH. (1984): Die Niederschlagsmessungen im oberen Stubachtal aus den Totalisatorenmessungen zwischen 1970 und Hausarbeit am Institut für Geographie der Universität Salzburg; 70 S. CORNELIUS, H.P. & E. CLAR (1935): Erläuterungen zur geologischen Karte des Glocknergebietes 1: Herausgeg. v.d. geologischen Bundesanstalt Wien: FRITSCH, M. (1898): Bericht über die wissenschaftlichen Untersuchungen des D. u. ÖA-V. XV. Zusammenstellung der von Bergführern eingesandten Berichte über die Gletscherbeobachtungen in der Zillerthaler Gruppe und in den Hohen Tauern, in: Mitteilungen des Deutschen und österreichischen Alpenvereins, N.F. 14: ; Wien. GLETSCHERMEßBERICHT. Mitteilungen des österreichischen Alpenvereins, im jeweiligen Heft März/April; Innsbruck. KEIL, F. (1860): Orographisch-physikalische Karte des Groß-Glockners und seiner Umgebung, in: Petermanns Mitteilungen, Tafel 4, S. 77; Gotha. KINZL, H. (1929): Beiträge zur Geschichte der Gletscherschwankungen in den Ostalpen, in: Zeitschrift für Gletscherkunde 17: KINZL, H. (1949): Formenkundliche Beobachtungen im Vorfeld der Alpengletscher. in: Veröffentlichungen d. Museums Ferdinandeum, 26: 61-82; Innsbruck. LUDWIG, H. & H. RENTSCH (1964): Karte des Ödenwinkelkeeses 1: Dipl.-Arbeiten am Institut für Photogrammetrie, Topographie und Allgemeine Kartographie an der Techn. Hochschule in München. PASCHINGER, V. (1929): Das vergletscherte Areal der Glocknergruppe. in: Zeitschrift des Deutschen und österreichischen Alpenvereins, S PATZELT, G. & S. BORTENSCHLAGER (1973): Die postglazialen Gletscher- und Klimaschwankungen in der Venedigergruppe, in: Zeitschrift f. Geomorphologie N.F. Suppl.-Bd. 16.: 25-72; Berlin-Stuttgart. RICHTER, E. (1888): Die Gletscher der Ostalpen, in: Handbücher zur Deutschen Landes- und Volkskunde 3} Stuttgart. ROHRBACHER, S. (1983): Volumsänderungen von Gletschern an ausgewählten Beispielen. Hausarbeit am Institut für Geographie der Universität Salzburg; 45 S.
17 Acta Albertina Ratisbonensia Bd SLUPETZKY, H. (1968): Glaziologische und glazialmorphologische Untersuchungen im obersten Stubachtal (Hohe Tauern). Diss., Phil. Fak. Wien. SLUPETZKY, H. (1986): Gletscherweg Obersulzbachtal. Naturkundlicher Führer zum Nationalpark Hohe Tauern 4. Herausgeg. v. österreichischen Alpenverein, Innsbruck; 2.Aufläge 1988;80 S. SLUPETZKY, H. (1988): Hohe Tauern - Oberes Stubachtal-Rudolfshütte. Exkursionsführer zum 21. Deutschen Schulgeographentag in Salzburg (im Druck). SLUPETZKY, H. & W. SLUPETZKY (1963): Die Veränderungen des Sonnblick-, ödenwinkel- und Unteren Rifflkeeses in den Jahren in: Wetter und Leben, Jg. 15: SLUPETZKY, H. & W. SLUPETZKY (1968): Ergebnisse der Gletschermessungen im obersten Stubachtal (Hohe Tauern) in den Jahren in: Jahresbericht des Sonnblickvereins für die Jahre : 43-51; Wien. STÜDL, J. (1870): Die untere Ödenwinkelscharte, in: Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins Bd. I. STUMMER, E.: Lichtbildverzeichnis der geographischen Lehrsammlung. Angelegt ab (Lichtbildverzeichnis einer Salzburger Schule; Archiv des Instituts für Geographie der Universität Salzburg). TEUFL, J. (1981): Vegetationsgliederung in der Umgebung der Rudolsfhütte und des ödenwinkelkees-vorfeldes. Diss., Univ. Salzburg.
18 INSTITUT FÜR KARTOGRAPHIE UND REPRODUKTIONSTECHNIK ÖDEN WINKELKEES Gletschervorfeld Entwurf und Kartographie: H. HAMMERLE E isrand « G letscherw eg m it Haltepunkten Ö A V -W eg gesicherter Steig m H öhenlinie m H öhenlinie m H öhenlinie Bach Bach (Ü berlauf) TTTTYYYTTTYTTTYT Damm Staumauer alpiner Rasen
19 /V /V./V download unter Zwergsträucher, Krummholz Moränenwall Vermessungspunkt 1 : (1 cm = 50 m) m L l.i. l.l.j l I I I I I I I I I Grundlage für den Höhenlinienplan: Photogrammetrische Auswertung 1 :5 000 des Bildfluges des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Landesaufnahme) vom und terrestrisch-photogrammetrischer Aufnahmen vom und von L. MAUELSHAGEN und H. SLUPETZKY durch W. SCHRÖTER und L. MAUELSHAGEN, Bonn. Glazialmorphologische Betreuung: H. SLUPETZKY, Salzburg Gesamtherstellung im Rahmen des Praktikums Kartenoriginalherstellung und Reproduktionstechnik, SS 1987 unter der Leitung von F. KELNHOFER gemeinsam mit J. ASCHENBRENNER. Orthophoto vervielfältigt mit Genehmigung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Landesaufnahme) in Wien, ZI.: L /88. Ödenwinkel gegen Süden (Photo: H. SLUPETZKY, Sept. 1987)
20 download unter
21 download unter Druck und INSTITUT FÜR KARTOGRAPHIE UND REPRODUKTIONSTECHNIK, WIEN
BERICHTE ÜBER WISSENSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN
 Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 135. Jg. (Jahresband), S. 243-246, Wien 1993 BERICHTE ÜBER WISSENSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN NEUE HOCHGEBIRGSKARTEN AUS DEN HOHEN TAUERN (Granatspitz
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 135. Jg. (Jahresband), S. 243-246, Wien 1993 BERICHTE ÜBER WISSENSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN NEUE HOCHGEBIRGSKARTEN AUS DEN HOHEN TAUERN (Granatspitz
Äußeres Mullwitzkees. Gletschersteckbrief
 Äußeres Mullwitzkees Allgemeines Das Äußere Mullwitzkees bildet zusammen mit dem Inneren Mullwitzkees und dem Zettalunitzkees die Hauptvergletscherung an der Südseite des Rainer Horn. Inneres und Äußeres
Äußeres Mullwitzkees Allgemeines Das Äußere Mullwitzkees bildet zusammen mit dem Inneren Mullwitzkees und dem Zettalunitzkees die Hauptvergletscherung an der Südseite des Rainer Horn. Inneres und Äußeres
120 JAHRE FORSCHUNG IN 3100m SEEHÖHE. Wolfgang Schöner
 120 JAHRE FORSCHUNG IN 3100m SEEHÖHE Wolfgang Schöner 11.9m Schnee (Mai 1944) 245 Eistage 3100m 204 Tage mit Niederschlag 271 Nebeltage 133 Tage mit Starkwind Die Idee: Julius Hann (Univ. Prof. für Meteorologie
120 JAHRE FORSCHUNG IN 3100m SEEHÖHE Wolfgang Schöner 11.9m Schnee (Mai 1944) 245 Eistage 3100m 204 Tage mit Niederschlag 271 Nebeltage 133 Tage mit Starkwind Die Idee: Julius Hann (Univ. Prof. für Meteorologie
ZUR KARTE "NÖRDLICHES BOCKKARKEES 1979", 1 :10000
 Band 19, Heft 2 (1983), S. 163-171 MITTEILUNG ZEITSCHRIFT FÜR GLETSCHERKUNDE UND GLAZIALGEOLOGIE 1984 by Universitätsverlag Wagner, Innsbruck ZUR KARTE "NÖRDLICHES BOCKKARKEES 1979", 1 :10000 Von H. SLUPETZKY,
Band 19, Heft 2 (1983), S. 163-171 MITTEILUNG ZEITSCHRIFT FÜR GLETSCHERKUNDE UND GLAZIALGEOLOGIE 1984 by Universitätsverlag Wagner, Innsbruck ZUR KARTE "NÖRDLICHES BOCKKARKEES 1979", 1 :10000 Von H. SLUPETZKY,
Die Gletscher auf den topographischen Karten 1:5000 im Gebiet der Nationalpark-Forschungsstelle Rudolfshütte (Stubachtal, Hohe Tauern) von 1990
 Nationalpark Hohe Tauern, download unter www.biologiezentrum.at Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Nationalpark Hohe Tauern Bd. 3 (1997): 137-162 Die Gletscher auf den topographischen Karten 1:5000
Nationalpark Hohe Tauern, download unter www.biologiezentrum.at Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Nationalpark Hohe Tauern Bd. 3 (1997): 137-162 Die Gletscher auf den topographischen Karten 1:5000
Geht Frau Holle in Pension?
 Geht Frau Holle in Pension? Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen aus den Ostalpen 10. Gesamttiroler Seilbahntag Donnerstag, 07. April 2016 Zugspitzsaal, Ehrwald Günther Aigner
Geht Frau Holle in Pension? Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen aus den Ostalpen 10. Gesamttiroler Seilbahntag Donnerstag, 07. April 2016 Zugspitzsaal, Ehrwald Günther Aigner
Beilage zur Berliner Wetterkarte
 Beilage zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. zur Förderung der meteorologischen Wissenschaft c/o Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin C.-H.-Becker-Weg
Beilage zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. zur Förderung der meteorologischen Wissenschaft c/o Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin C.-H.-Becker-Weg
Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken
 Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation
Projektbeschreibung des ETH-Forschungsprojektes im Aletschgebiet von Franzi Glüer und Simon Löw für Naturwunder aus Eis Aletsch von Marco Volken Glückliche Gesichter nach einer Woche Arbeit mit der Installation
Tage mit Schneebedeckung: Der Verlauf der Schneedeckendauer in österreichischen Skiorten von 1916/17 bis 2015/16
 Tage mit Schneebedeckung: Der Verlauf der Schneedeckendauer in österreichischen Skiorten von 1916/17 bis 2015/16 Eine Skizze von Günther Aigner Foto: Kitzbühel Tourismus In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
Tage mit Schneebedeckung: Der Verlauf der Schneedeckendauer in österreichischen Skiorten von 1916/17 bis 2015/16 Eine Skizze von Günther Aigner Foto: Kitzbühel Tourismus In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig
 Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig In Folge der Bauarbeiten des City-Tunnel Leipzigs ereignet sich im Frühjahr 2006 eine der spektakulärsten Aktionen beim Bau der Station Bayerischer Bahnhof.
Portikusverschiebung am Bayerischen Bahnhof Leipzig In Folge der Bauarbeiten des City-Tunnel Leipzigs ereignet sich im Frühjahr 2006 eine der spektakulärsten Aktionen beim Bau der Station Bayerischer Bahnhof.
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013 Der vergangene Sommer machte mit Lufttemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius Schlagzeilen, die ZAMG berichtete ausführlich dazu. Neben den
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013 Der vergangene Sommer machte mit Lufttemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius Schlagzeilen, die ZAMG berichtete ausführlich dazu. Neben den
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002
 Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Rückgang der Alpengletscher im klimatischen Ausnahmejahr 2003
 Gletschertour 2003 Rückgang der Alpengletscher im klimatischen Ausnahmejahr 2003 Viele Alpengletscher - darunter der Schweizer Große Aletsch - verloren in den letzten Jahren zum Teil dramatisch an Eismasse.
Gletschertour 2003 Rückgang der Alpengletscher im klimatischen Ausnahmejahr 2003 Viele Alpengletscher - darunter der Schweizer Große Aletsch - verloren in den letzten Jahren zum Teil dramatisch an Eismasse.
Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick
 Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick Menschen im höheren Erwerbsalter sind europaweit ein bislang unzureichend genutztes Arbeitskräftepotenzial. Ihre
Erwerbsbeteiligung und Arbeitslosigkeit im höheren Erwerbsalter ein statistischer Überblick Menschen im höheren Erwerbsalter sind europaweit ein bislang unzureichend genutztes Arbeitskräftepotenzial. Ihre
Auszug aus der Theorie
 Auszug aus der Theorie Erosion Abtragung durch Fließwasser Gletscher Wind Meeresbrandung Niederschlag Exkurs: Wind und Orkane Der Begriff Erosion stammt von dem lateinischen Wort erodere = abnagen. Man
Auszug aus der Theorie Erosion Abtragung durch Fließwasser Gletscher Wind Meeresbrandung Niederschlag Exkurs: Wind und Orkane Der Begriff Erosion stammt von dem lateinischen Wort erodere = abnagen. Man
Topographische und Hochgebirgskartographie. Hochgebirgskartographie. Felsdarstellung. Felsdarstellung. freie (genetische) Felszeichnung
 Topographische und Hochgebirgskartographie Karel Kriz Institut für Geographie und Regionalforschung Kartographie und Geoinformation Universität Wien Hochgebirgskartographie Darstellungsformen - Höhenlinien
Topographische und Hochgebirgskartographie Karel Kriz Institut für Geographie und Regionalforschung Kartographie und Geoinformation Universität Wien Hochgebirgskartographie Darstellungsformen - Höhenlinien
Seit 30 Jahren: Deutlich kältere Winter auf Tirols Bergen
 Seit 30 Jahren: Deutlich kältere Winter auf Tirols Bergen Auf Tirols Bergen sind die Winter in den letzten 30 Jahren deutlich kälter geworden. Seit dem Winter 1984/85 ist die mittlere Wintertemperatur
Seit 30 Jahren: Deutlich kältere Winter auf Tirols Bergen Auf Tirols Bergen sind die Winter in den letzten 30 Jahren deutlich kälter geworden. Seit dem Winter 1984/85 ist die mittlere Wintertemperatur
Klimadiagramm. Spitzbergen. Gabriel Blaimschein. Matrikelnummer: NMS Lehramt Englisch und Geographie und Wirtschaftskunde
 Klimadiagramm Spitzbergen Gabriel Blaimschein Matrikelnummer: 1391658 NMS Lehramt Englisch und Geographie und Wirtschaftskunde Wetter Witterung Klima ANL4GW5DWV Mag. Alfons Koller Linz, 26. Mai 2015 Inhaltsverzeichnis
Klimadiagramm Spitzbergen Gabriel Blaimschein Matrikelnummer: 1391658 NMS Lehramt Englisch und Geographie und Wirtschaftskunde Wetter Witterung Klima ANL4GW5DWV Mag. Alfons Koller Linz, 26. Mai 2015 Inhaltsverzeichnis
spielerischer Einstieg ins Thema, Wissensstand der TN testen, Wasservorkommen verstehen
 Name ABC Quiz Wasserverteilung Ziel spielerischer Einstieg ins Thema, Wissensstand der TN testen, Wasservorkommen verstehen Material Quizfragen (s. u.) 3 große Schilder mit A, B und C Visualisierung Verteilung
Name ABC Quiz Wasserverteilung Ziel spielerischer Einstieg ins Thema, Wissensstand der TN testen, Wasservorkommen verstehen Material Quizfragen (s. u.) 3 große Schilder mit A, B und C Visualisierung Verteilung
Gletscherrückgänge in den Alpen in jüngerer Zeit
 Johannes Gutenberg Universität Mainz Geographisches Institut Großes Geländepraktikum/Projektstudie: Klimaökologie und Klimawandel am Aletsch- und Rhone-Gletscher im Wallis/Südschweiz Leitung: Prof. Dr.
Johannes Gutenberg Universität Mainz Geographisches Institut Großes Geländepraktikum/Projektstudie: Klimaökologie und Klimawandel am Aletsch- und Rhone-Gletscher im Wallis/Südschweiz Leitung: Prof. Dr.
b) Warum kann man von Konstanz aus Bregenz nicht sehen?
 Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Der Bodensee ein Arbeitsblatt für Schüler der 5. und 6. Klasse Der Bodensee ist mit einer Gesamtfläche von 571,5 km 2 der zweitgrößte See im Alpenvorland. Er besteht eigentlich aus zwei Seeteilen, dem
Abbildung 1: Zahl der Tagespflegepersonen nach Ort der Betreuung in Prozent (Bund, alte und neue Bundesländer; )
 Abbildung 1: Zahl der Tagespflegepersonen nach Ort der Betreuung in Prozent (Bund, alte und neue Bundesländer; 2006 2012) Die meisten Tagespflegepersonen (rund Dreiviertel) betreuen die Kinder in der eigenen
Abbildung 1: Zahl der Tagespflegepersonen nach Ort der Betreuung in Prozent (Bund, alte und neue Bundesländer; 2006 2012) Die meisten Tagespflegepersonen (rund Dreiviertel) betreuen die Kinder in der eigenen
KARTEN- INTERPRETATION IN STICHWORTEN
 KARTEN- INTERPRETATION IN STICHWORTEN Teil I Geographische Interpretation topographischer Karten von Armin Hüttermann 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung Berlin
KARTEN- INTERPRETATION IN STICHWORTEN Teil I Geographische Interpretation topographischer Karten von Armin Hüttermann 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung Berlin
Temperatur des Grundwassers
 Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
Temperatur des Grundwassers W4 WOLF-PETER VON PAPE Die Grundwassertemperatur ist nahe der Oberfläche von der Umgebungs- und Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Im Sommer dringt Sonnenwärme
a Allgäuer Alpen Iseler, 1876 m / Kühgund, 1907 m
 a Allgäuer Alpen Iseler, 1876 m / Kühgund, 1907 m A-a-8 Salewa Klettersteig C Steig 1-3 Std. Steig 290 Hm Zustieg 20 Min. Abstieg 1-2,5 Std. Schwierigkeit: schwierig; 1.Teil: großteils B, die Steilwand
a Allgäuer Alpen Iseler, 1876 m / Kühgund, 1907 m A-a-8 Salewa Klettersteig C Steig 1-3 Std. Steig 290 Hm Zustieg 20 Min. Abstieg 1-2,5 Std. Schwierigkeit: schwierig; 1.Teil: großteils B, die Steilwand
1. Witterung im Winter 1997/98
 1. Witterung im Winter 1997/98 von Dr. Karl Gabl Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Regionalstelle für Tirol und Vorarlberg Wie schon in den vorangegangenen Wintern wurden die Beobachtungen
1. Witterung im Winter 1997/98 von Dr. Karl Gabl Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Regionalstelle für Tirol und Vorarlberg Wie schon in den vorangegangenen Wintern wurden die Beobachtungen
Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Hessen
 Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Beginn des Vorfrühlings Haselnuss (Blüte) Der Blühbeginn der Haselnuss zeigt für ganz einen Trend zur Verfrühung um 0,55 Tage pro
Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Beginn des Vorfrühlings Haselnuss (Blüte) Der Blühbeginn der Haselnuss zeigt für ganz einen Trend zur Verfrühung um 0,55 Tage pro
Ticket nach Berlin Begleitmaterialien: Manuskript und Glossar
 Folge 1 Zugspitze Damit das Manuskript gut lesbar ist, haben wir kleinere grammatikalische Ungenauigkeiten korrigiert und grammatikalische Fehler in den Fußnoten kommentiert. Team Süd, das sind Kristina
Folge 1 Zugspitze Damit das Manuskript gut lesbar ist, haben wir kleinere grammatikalische Ungenauigkeiten korrigiert und grammatikalische Fehler in den Fußnoten kommentiert. Team Süd, das sind Kristina
Deutschen Hindukusch-Expedition 1935
 Beschreibung der erhaltenen Original-Abzüge und Diapositive von Aufnahmen der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935 aus dem Nachlass des Expeditionsleiters Professor Dr. Arnold Scheibe (1901 1989) Bearbeitet
Beschreibung der erhaltenen Original-Abzüge und Diapositive von Aufnahmen der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935 aus dem Nachlass des Expeditionsleiters Professor Dr. Arnold Scheibe (1901 1989) Bearbeitet
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
Die Gradtagzahlen des Jahres 2008 und ihre Abweichungen zum Zeitraum P.-H. Voß
 Die Gradtagzahlen des Jahres 2008 und ihre Abweichungen zum Zeitraum 1981-2000 P.-H. Voß Gradtagzahlen bzw. Gradtage werden zur überschlägigen Berechnung des Heizenergieverbrauchs sowie zur Witterungsbereinigung
Die Gradtagzahlen des Jahres 2008 und ihre Abweichungen zum Zeitraum 1981-2000 P.-H. Voß Gradtagzahlen bzw. Gradtage werden zur überschlägigen Berechnung des Heizenergieverbrauchs sowie zur Witterungsbereinigung
Das Bundesland Salzburg ein Quiz
 Teil 1 Arbeitsblatt Nr. 1 Das Bundesland Salzburg ein Quiz Nimm eine Salzburg-Karte zu Hilfe! 1. Suche in der Legende das Symbol für Höhlen und zeichne es in dieses Kästchen! 2. Welche Farbe hat die Karte,
Teil 1 Arbeitsblatt Nr. 1 Das Bundesland Salzburg ein Quiz Nimm eine Salzburg-Karte zu Hilfe! 1. Suche in der Legende das Symbol für Höhlen und zeichne es in dieses Kästchen! 2. Welche Farbe hat die Karte,
In 3 Tagen durch die. Brandenberger Alpen. (3 Tageswanderung/Weitwandern mit der Bahn)
 In 3 Tagen durch die Brandenberger Alpen (3 Tageswanderung/Weitwandern mit der Bahn) Alpengasthaus Buchacker Kaiserhaus Sonnwendjoch Rattenberg/ Kramsach Ausgangspunkt: Bahnhof Zielort: Bahnhof Rattenberg/Kramsach
In 3 Tagen durch die Brandenberger Alpen (3 Tageswanderung/Weitwandern mit der Bahn) Alpengasthaus Buchacker Kaiserhaus Sonnwendjoch Rattenberg/ Kramsach Ausgangspunkt: Bahnhof Zielort: Bahnhof Rattenberg/Kramsach
40 Natur Historischer Klimawandel
 40 Natur Historischer Klimawandel 41 Die Gletscher ein Kommen und Gehen Wie wichtig ist der Mensch für die Erde? Ohne den aktuellen globalen Raubbau an der Umwelt bagatellisieren zu wollen aber Klimawandel
40 Natur Historischer Klimawandel 41 Die Gletscher ein Kommen und Gehen Wie wichtig ist der Mensch für die Erde? Ohne den aktuellen globalen Raubbau an der Umwelt bagatellisieren zu wollen aber Klimawandel
Naturwissenschaften+ Korrekturschema. Projekt HarmoS. Steine in Bewegung. N d 9. N_9d_13_E1. Name: Schule: Klasse: IDK: ID:
 N d 9 Projekt HarmoS Naturwissenschaften+ Steine in Bewegung N_9d_13_E1 Korrekturschema Name: Schule: Klasse: IDK: ID: Steine in Bewegung Wohin bewegen sich Steine, die sich in Felswänden lösen? In der
N d 9 Projekt HarmoS Naturwissenschaften+ Steine in Bewegung N_9d_13_E1 Korrekturschema Name: Schule: Klasse: IDK: ID: Steine in Bewegung Wohin bewegen sich Steine, die sich in Felswänden lösen? In der
STUDIE. Analyse von Temperaturund Schneemessreihen. im Salzburger Land. Ein Vorschlag von Günther Aigner.
 STUDIE Analyse von Temperaturund Schneemessreihen im Salzburger Land Ein Vorschlag von Günther Aigner www.zukunft-skisport.at Ziel Temperaturmessreihen Auf der Basis von amtlichen Messreihen (ZAMG) kann
STUDIE Analyse von Temperaturund Schneemessreihen im Salzburger Land Ein Vorschlag von Günther Aigner www.zukunft-skisport.at Ziel Temperaturmessreihen Auf der Basis von amtlichen Messreihen (ZAMG) kann
Karten dokumentieren den Rückzug der Gletscher seit 1850
 Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Band 17, Wien 2006, S. 191-200 191 BRUNNER, Kurt (München)* Karten dokumentieren den Rückzug der Gletscher seit 1850 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung
Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Band 17, Wien 2006, S. 191-200 191 BRUNNER, Kurt (München)* Karten dokumentieren den Rückzug der Gletscher seit 1850 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung
Aktuelles zum Wettergeschehen
 Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
GESICHTER DER SCHWEIZ
 Geografische Bildpräsentationen für die Klassenstufen 5-7 swissfaces H. Gerber, Basel GESICHTER DER SCHWEIZ GLETSCHER DER ALPEN Teil 1 Werden und Vergehen der Gletscher Eine geographische Bildpräsentation
Geografische Bildpräsentationen für die Klassenstufen 5-7 swissfaces H. Gerber, Basel GESICHTER DER SCHWEIZ GLETSCHER DER ALPEN Teil 1 Werden und Vergehen der Gletscher Eine geographische Bildpräsentation
Orientieren mit Karte, Kompass, GPS
 Orientieren mit Karte, Kompass, GPS und an den Zeichen der Natur Wolfgang Heller www.taunusguide.de Von den Tauben und wohl auch von Vögeln wissen wir, dass sie so eine Art Kompass in der Nase haben. Ob
Orientieren mit Karte, Kompass, GPS und an den Zeichen der Natur Wolfgang Heller www.taunusguide.de Von den Tauben und wohl auch von Vögeln wissen wir, dass sie so eine Art Kompass in der Nase haben. Ob
Kraftwerk Berlin. Today, this formerly silenced Berlin power station is a vibrant place for exhibitions and events. A space resonating with energy.
 Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its
Kraftwerk At the centre of, on the Köpenicker Straße, is the former power station Mitte a piece of s industrial history. Built approximately at the same time as the Wall during the years 1960-1964, its
Messbericht Mobile Fluglärmmessung in Ludwigsfelde-Süd Oktober Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Umwelt
 Messbericht Mobile Fluglärmmessung in Ludwigsfelde-Süd Oktober 2014 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Umwelt fluglaerm@berlin-airport.de Ziel der Messung Die Fluglärmmessung mit der mobilen Messstelle
Messbericht Mobile Fluglärmmessung in Ludwigsfelde-Süd Oktober 2014 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Umwelt fluglaerm@berlin-airport.de Ziel der Messung Die Fluglärmmessung mit der mobilen Messstelle
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist
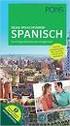 Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Klima. Stundenbild. Hochgebirge im Klimawandel
 Stundenbild Klima Hochgebirge im Klimawandel Was ist ein Hochgebirge? Wie reagiert das Eis der Hochgebirge auf den Klimawandel? Ein Klimazeuge aus der Jungsteinzeit? Hochgebirge sind ökologisch besonders
Stundenbild Klima Hochgebirge im Klimawandel Was ist ein Hochgebirge? Wie reagiert das Eis der Hochgebirge auf den Klimawandel? Ein Klimazeuge aus der Jungsteinzeit? Hochgebirge sind ökologisch besonders
Geotop Lange Wand bei Ilfeld
 Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Geotop bei Ilfeld n zum Vorschlag zur Aufnahme in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands 1. Geotop bei Ilfeld Am Grunde des Zechsteinmeeres: Beschreibung des Geotops Aufschluß 2. Kurzbeschreibung
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden
 Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden Uwe Büttner, Dipl.-Hydrologe, Landesamt für Umwelt und Geologie 1. Das Gebiet Hinsichtlich seiner Gewässernetzstruktur und Lage innerhalb des zentraleuropäischen
Oberstufe (11, 12, 13)
 Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Department Mathematik Tag der Mathematik 1. Oktober 009 Oberstufe (11, 1, 1) Aufgabe 1 (8+7 Punkte). (a) Die dänische Flagge besteht aus einem weißen Kreuz auf rotem Untergrund, vgl. die (nicht maßstabsgerechte)
Bodenerosion im vorderen Lungauer Riedingtal
 Bodenerosion im vorderen Lungauer Riedingtal am Beispiel von Gruber-, Jakober- und Zaunerkar Stefan Kraxberger & Damian Taferner Gliederung 1. Problemstellung 2. Gebietsbeschreibung 3. Datengrundlage und
Bodenerosion im vorderen Lungauer Riedingtal am Beispiel von Gruber-, Jakober- und Zaunerkar Stefan Kraxberger & Damian Taferner Gliederung 1. Problemstellung 2. Gebietsbeschreibung 3. Datengrundlage und
2. Die Entwicklung des Fluglärms in der Region Guntersblum
 2. Die Entwicklung des Fluglärms in der Region Guntersblum Wie in dem Schaubild zu sehen ist, nahm der Flughafen Frankfurt in den letzten 30 Jahren zunächst eine rasante Entwicklung. Mit der Entscheidung
2. Die Entwicklung des Fluglärms in der Region Guntersblum Wie in dem Schaubild zu sehen ist, nahm der Flughafen Frankfurt in den letzten 30 Jahren zunächst eine rasante Entwicklung. Mit der Entscheidung
Brizzisee m. Diemweg
 Brizzisee 2.920 m Durch den Ort, am Ortsende links über den Ochsenkopf, auf halber Höhe nach links Schäferhütte auf mäßig ansteigendem Weg zur Martin Busch Hütte. Von der Hütte steil hinauf zum Brizzisee.
Brizzisee 2.920 m Durch den Ort, am Ortsende links über den Ochsenkopf, auf halber Höhe nach links Schäferhütte auf mäßig ansteigendem Weg zur Martin Busch Hütte. Von der Hütte steil hinauf zum Brizzisee.
In situ Behandlung der Deponie Dorfweiher zur Beschleunigung biologischer Abbauprozesse
 In situ Behandlung der Deponie Dorfweiher zur Beschleunigung biologischer Abbauprozesse Daniel Laux, Landratsamt Konstanz Dr.-Ing. Martin Reiser, Universität Stuttgart Prof. Dr.-Ing. Martin Kranert, Universität
In situ Behandlung der Deponie Dorfweiher zur Beschleunigung biologischer Abbauprozesse Daniel Laux, Landratsamt Konstanz Dr.-Ing. Martin Reiser, Universität Stuttgart Prof. Dr.-Ing. Martin Kranert, Universität
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Norbert Geograph Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Norbert Geograph Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen
Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze mit hochalpinem Charakter.
 Aglsspitze SKITOUR Dauer Strecke 6:00 h 16.6 km Höhenmeter Max. Höhe 1810 hm 3190 m Kondition Technik Erlebnis Landschaft Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze
Aglsspitze SKITOUR Dauer Strecke 6:00 h 16.6 km Höhenmeter Max. Höhe 1810 hm 3190 m Kondition Technik Erlebnis Landschaft Hinein in die Bergwelt. Lange Frühjahrs- und Spätfrühjahrstour auf die Aglsspitze
STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998
 Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
2. Die Klimazonen Fülle die Tabelle aus. Name der Klimazone Wie ist dort der Sommer? Wie ist dort der Winter?
 1. Die Jahreszeiten Das Wetter Sieh dir das Bild an. Du kannst darauf sehen, wie die Erde zur Sonne stehen muss, damit bei uns in Europa Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist. Schreibe die jeweilige
1. Die Jahreszeiten Das Wetter Sieh dir das Bild an. Du kannst darauf sehen, wie die Erde zur Sonne stehen muss, damit bei uns in Europa Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist. Schreibe die jeweilige
BODEN, PFLANZEN, FUTTERMITTEL, MILCH UND GESAMTNAHRUNG
 16 BODEN, PFLANZEN, FUTTERMITTEL, MILCH UND GESAMTNAHRUNG D.Tait Max Rubner-Institut, Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch Leitstelle für Boden, Bewuchs, Futtermittel und Nahrungsmittel
16 BODEN, PFLANZEN, FUTTERMITTEL, MILCH UND GESAMTNAHRUNG D.Tait Max Rubner-Institut, Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch Leitstelle für Boden, Bewuchs, Futtermittel und Nahrungsmittel
BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2006 MATHEMATIK
 BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2006 MATHEMATIK (HAUPTTERMIN) Arbeitszeit: Hilfsmittel: 150 Minuten Tafelwerk Taschenrechner (nicht programmierbar, nicht grafikfähig) (Schüler, die einen CAS-Taschencomputer
BESONDERE LEISTUNGSFESTSTELLUNG 2006 MATHEMATIK (HAUPTTERMIN) Arbeitszeit: Hilfsmittel: 150 Minuten Tafelwerk Taschenrechner (nicht programmierbar, nicht grafikfähig) (Schüler, die einen CAS-Taschencomputer
Lebenserwartung und Mortalität im Alter - ein Überblick
 Lebenserwartung und Mortalität im Alter - ein Überblick Lebenserwartung älterer Menschen Die Lebenserwartung kann als das allgemeinste Maß betrachtet werden, das über den Gesundheitszustand einer Bevölkerung
Lebenserwartung und Mortalität im Alter - ein Überblick Lebenserwartung älterer Menschen Die Lebenserwartung kann als das allgemeinste Maß betrachtet werden, das über den Gesundheitszustand einer Bevölkerung
I. Überblick über Kinderunfälle im Straßenverkehr Unfallzahlen 2010 sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr:
 1 unfälle im Straßenverkehr im Jahr 2010 Der folgende Überblick informiert über die Eckdaten des Statistischen Bundesamt zum Thema unfälle im Straßenverkehr 2010. Als gelten alle Mädchen und Jungen unter
1 unfälle im Straßenverkehr im Jahr 2010 Der folgende Überblick informiert über die Eckdaten des Statistischen Bundesamt zum Thema unfälle im Straßenverkehr 2010. Als gelten alle Mädchen und Jungen unter
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Retentionskataster. Flussgebiet Orb mit Haselbach
 Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Retentionskataster Flussgebiet Orb mit Haselbach Flussgebiets-Kennzahl: 247852 / 2478524 Bearbeitungsabschnitt Orb: km + bis km 8+214 Bearbeitungsabschnitt Haselbach: km + bis km 1+83 Retentionskataster
Kapitel 4 Zur Geschichte des Vernagtferners Gletschervorstöße und Seeausbrüche im vergangenen Jahrtausend
 Kapitel 4 Zur Geschichte des Vernagtferners Gletschervorstöße und Seeausbrüche im vergangenen Jahrtausend Kurt Nicolussi Zusammenfassung Für den Vernagtferner, Ötztaler Alpen, wird der Kenntnisstand zu
Kapitel 4 Zur Geschichte des Vernagtferners Gletschervorstöße und Seeausbrüche im vergangenen Jahrtausend Kurt Nicolussi Zusammenfassung Für den Vernagtferner, Ötztaler Alpen, wird der Kenntnisstand zu
Enzingerboden. Uttendorf
 Uttendorf Enzingerboden Der Enzingerboden (1483 m) befindet sich im Oberpinzgau. Das Gebiet gehört zu Uttendorf, das zwischen Mittersill und Zell am See im Pinzgau liegt. Von Uttendorf führt eine befestigte
Uttendorf Enzingerboden Der Enzingerboden (1483 m) befindet sich im Oberpinzgau. Das Gebiet gehört zu Uttendorf, das zwischen Mittersill und Zell am See im Pinzgau liegt. Von Uttendorf führt eine befestigte
Visualisieren von Gletscherbewegungen
 Visualisieren von Gletscherbewegungen Kolloquium Kartenentwerfen 28. April 2010 Matthias Speich Inhalt Einführung / Rekapitulation Fliessdynamik Datengewinnung Anwendungsbereiche Methoden der Visualisierung
Visualisieren von Gletscherbewegungen Kolloquium Kartenentwerfen 28. April 2010 Matthias Speich Inhalt Einführung / Rekapitulation Fliessdynamik Datengewinnung Anwendungsbereiche Methoden der Visualisierung
Immobilienmärkte bleiben weiter in Fahrt
 GEWOS GmbH Pressemitteilung vom 25.09.2014 Neue GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA : Immobilienmärkte bleiben weiter in Fahrt Ein- und Zweifamilienhäuser in 2013 mit höchsten Umsätzen Eigentumswohnungen
GEWOS GmbH Pressemitteilung vom 25.09.2014 Neue GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA : Immobilienmärkte bleiben weiter in Fahrt Ein- und Zweifamilienhäuser in 2013 mit höchsten Umsätzen Eigentumswohnungen
Gletscherbericht. Im Gletscherjahr 2012/ /2013
 Gletscherbericht 2012/2013 Sammelbericht über die Gletschermessungen des Oesterreichischen Alpenvereins im Jahre 2013. Letzter Bericht: Bergauf 02/2013, Jg. 68 (138), S. 22 28. Dr. Andrea Fischer Im Gletscherjahr
Gletscherbericht 2012/2013 Sammelbericht über die Gletschermessungen des Oesterreichischen Alpenvereins im Jahre 2013. Letzter Bericht: Bergauf 02/2013, Jg. 68 (138), S. 22 28. Dr. Andrea Fischer Im Gletscherjahr
Bei der Diskussion über die. Bayerische Gletscher AKADEMIEFORSCHUNG
 GLETSCHERARCHIV Bayerische Gletscher DIGITALE AUFBEREITUNG HISTORISCHER DATEN UND EINE NEUE METHODE ZUM GEODÄTISCHEN MONITORING. Ein Hauptziel des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts
GLETSCHERARCHIV Bayerische Gletscher DIGITALE AUFBEREITUNG HISTORISCHER DATEN UND EINE NEUE METHODE ZUM GEODÄTISCHEN MONITORING. Ein Hauptziel des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts
ziehungen durch weitere Untersuchungen als geuend bestätigen, so könnte das einen Baustein zu roßwetterlagen abgeben. Sept. Okt. Nov. Dez.
 B. Die "Normallage" des arktischen Höhentiefs hat 1. R ein e k e an derselben Stelle (3) für die Monate Januar und Februar dargestellt. Die mittlere ab lute Topographie der 500- rucldläche, im Pola iet
B. Die "Normallage" des arktischen Höhentiefs hat 1. R ein e k e an derselben Stelle (3) für die Monate Januar und Februar dargestellt. Die mittlere ab lute Topographie der 500- rucldläche, im Pola iet
Der April in der 100-jährigen Beobachtungsreihe von Berlin-Dahlem 1908 bis 2007 von Jürgen Heise und Georg Myrcik
 Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Physikalische Grundlagen
 Physikalische Grundlagen Inhalt: - Bahn und Bahngeschwindigkeit eines Satelliten - Die Energie eines Satelliten - Kosmische Geschwindigkeiten Es wird empfohlen diese Abschnitte der Reihe nach zu bearbeiten.
Physikalische Grundlagen Inhalt: - Bahn und Bahngeschwindigkeit eines Satelliten - Die Energie eines Satelliten - Kosmische Geschwindigkeiten Es wird empfohlen diese Abschnitte der Reihe nach zu bearbeiten.
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg
 Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Die Ausgrabungen auf der Ortenburg www.archsax.sachsen.de Die Ausgrabungen auf der Ortenburg Im Januar 2002 wurden die 1999 begonnenen Grabungen auf der Ortenburg planmässig abgeschlossen. Die Untersuchungen
Inhaltsverzeichnis. Seite. Autor:
 Dokumentation Inhaltsverzeichnis Seite 3 Vorwort 4 Seen der Schweiz 5 Flüsse der Schweiz 6 Städte 7 Kantone 8 Reisen 9 Vielfältige Schweiz 10/11 Regionaler Teil - Beispiel Bündnerland 12 Abschluss: 101
Dokumentation Inhaltsverzeichnis Seite 3 Vorwort 4 Seen der Schweiz 5 Flüsse der Schweiz 6 Städte 7 Kantone 8 Reisen 9 Vielfältige Schweiz 10/11 Regionaler Teil - Beispiel Bündnerland 12 Abschluss: 101
Urbane Wälder in Leipzig
 LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
LUKAS DENZLER IDEEN RECHERCHEN GESCHICHTEN Urbane Wälder in Leipzig Fotos: Lukas Denzler / Februar 2016 Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), der ehemalige
Gletscherbericht. Dieser Bericht über die 2014/2015
 Gletscherbericht 2014/2015 Sammelbericht über die Gletschermessungen des Österreichischen Alpenvereins im Jahre 2015. Letzter Bericht: Bergauf 02/2015, Jg. 70 (140), S. 26 33. Andrea Fischer Dieser Bericht
Gletscherbericht 2014/2015 Sammelbericht über die Gletschermessungen des Österreichischen Alpenvereins im Jahre 2015. Letzter Bericht: Bergauf 02/2015, Jg. 70 (140), S. 26 33. Andrea Fischer Dieser Bericht
Name des Prüflings: Ausbildungsstätte: Anlegemaßstab 1:1000 Schreibzeug Taschenrechner (nicht programmiert) Lineal Dreieck
 Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen - Landesbetrieb - als Zuständige Stelle nach dem BBiG für die Ausbildungsberufe Kartographin und Kartograph im öffentlichen Dienst sowie Vermessungstechnikerin
Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen - Landesbetrieb - als Zuständige Stelle nach dem BBiG für die Ausbildungsberufe Kartographin und Kartograph im öffentlichen Dienst sowie Vermessungstechnikerin
10. UNTERRICHTSTUNDE: DIE KLIMATA DER USA / DIE MERKMALE DER VERSCHIEDENEN KLIMAZONEN
 10. UNTERRICHTSTUNDE 119 10. UNTERRICHTSTUNDE: DIE KLIMATA DER USA / DIE MERKMALE DER VERSCHIEDENEN KLIMAZONEN Ziele: Die Schüler sollen die verschiedenen Klimazonen in den USA erkennen. Materialien: Fotokopien,
10. UNTERRICHTSTUNDE 119 10. UNTERRICHTSTUNDE: DIE KLIMATA DER USA / DIE MERKMALE DER VERSCHIEDENEN KLIMAZONEN Ziele: Die Schüler sollen die verschiedenen Klimazonen in den USA erkennen. Materialien: Fotokopien,
Stadt Ballenstedt mit Förderung aus dem Programm zur Maßnahmen zur Vermeidung von Vernässung und Erosion im Land Sachsen-Anhalt
 Stadt Ballenstedt mit Förderung aus dem Programm zur Maßnahmen zur Vermeidung von Vernässung und Erosion im Land Sachsen-Anhalt Gewässerausbau im Interesse des Hochwasserschutzes und der Wasserrahmenrichtlinie
Stadt Ballenstedt mit Förderung aus dem Programm zur Maßnahmen zur Vermeidung von Vernässung und Erosion im Land Sachsen-Anhalt Gewässerausbau im Interesse des Hochwasserschutzes und der Wasserrahmenrichtlinie
am Fakultät für Geoinformation
 Exkursion Zugspitze am 28.11.2014 Fakultät für Geoinformation 1 Fakultät für Geoinformation Studiengang: Geoinformatik und Satellitenpositionierung 5. Semester Modul: Büroorganisation und Projektmanagment
Exkursion Zugspitze am 28.11.2014 Fakultät für Geoinformation 1 Fakultät für Geoinformation Studiengang: Geoinformatik und Satellitenpositionierung 5. Semester Modul: Büroorganisation und Projektmanagment
Die Wetterdaten sind hier abrufbar:
 Die Wetterdaten sind hier abrufbar: http://www.weatherlink.com/user/bgbuchen/ Die Werte im Detail: Summary anklicken. Als App: WeatherLink Mobile (Android und Apple) Viele weitere Wetter- und Klima-Links
Die Wetterdaten sind hier abrufbar: http://www.weatherlink.com/user/bgbuchen/ Die Werte im Detail: Summary anklicken. Als App: WeatherLink Mobile (Android und Apple) Viele weitere Wetter- und Klima-Links
Wintertemperatur- und Schneemessreihen
 Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen aus Österreichs alpinen Regionen WKO Fachschaft Seilbahnen DO & CO Stephansplatz. DO, 26. Nov 2015 Mag. Günther Aigner, Mag. Christian Zenkl
Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen aus Österreichs alpinen Regionen WKO Fachschaft Seilbahnen DO & CO Stephansplatz. DO, 26. Nov 2015 Mag. Günther Aigner, Mag. Christian Zenkl
Stabiler Büromarkt Wien. Vermietungsleistung im Q4 14 jedoch wieder niedriger.
 Wien Büro, Q4 214 Stabiler Büromarkt Wien. Vermietungsleistung im Q4 14 jedoch wieder niedriger. 1,83 Mio. m 15. m 43. m 6,6% 25,75/m/Monat Abbildung 1: Überblick Büromarktindikatoren Die Pfeile zeigen
Wien Büro, Q4 214 Stabiler Büromarkt Wien. Vermietungsleistung im Q4 14 jedoch wieder niedriger. 1,83 Mio. m 15. m 43. m 6,6% 25,75/m/Monat Abbildung 1: Überblick Büromarktindikatoren Die Pfeile zeigen
AG QUALITÄT im Fachbereich Mathematik der Universität Hannover Welfengarten1, Hannover
 AG QUALITÄT im Fachbereich Mathematik der Universität Hannover Welfengarten1, 30167 Hannover Gleispflege Auch ein "normales" Gleis muss im Rahmen der Instandhaltung der Bahn gepflegt werden. Diese Pflege
AG QUALITÄT im Fachbereich Mathematik der Universität Hannover Welfengarten1, 30167 Hannover Gleispflege Auch ein "normales" Gleis muss im Rahmen der Instandhaltung der Bahn gepflegt werden. Diese Pflege
Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland
 Klima-Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes am 3. Mai 2012 in Berlin: Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland Inhalt: A) Klimadaten zum Jahr 2011 Ein kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Klima-Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes am 3. Mai 2012 in Berlin: Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland Inhalt: A) Klimadaten zum Jahr 2011 Ein kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Drei Kreise Was ist zu tun?
 1 Drei Kreise Der Radius der Kreise beträgt drei Zentimeter. Zeichnet die Abbildung nach, falls ihr einen Zirkel zur Hand habt. Ansonsten genügt auch eine Skizze. Bestimmt den Flächeninhalt der schraffierten
1 Drei Kreise Der Radius der Kreise beträgt drei Zentimeter. Zeichnet die Abbildung nach, falls ihr einen Zirkel zur Hand habt. Ansonsten genügt auch eine Skizze. Bestimmt den Flächeninhalt der schraffierten
Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland
 Zahlen und Fakten zur DWD-Pressekonferenz am 28. April 2009 in Berlin: Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland Inhalt: Klimadaten zum Jahr 2008 Kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Zahlen und Fakten zur DWD-Pressekonferenz am 28. April 2009 in Berlin: Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland Inhalt: Klimadaten zum Jahr 2008 Kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
3. Aufzählung von Folgen des Gletschersterbens
 www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
www.planetschule.de Oberstufe (Z3) Natur und Technik Räume, Zeiten, Gesellschaften Ethik, Religionen, Gemeinschaft Regelunterricht, Projekttage Die Zukunftszenarien beschreiben den SuS die drohenden Gefahren
STATISTIKEN ZU MIGRATION IN TIROL
 STATISTIKEN ZU MIGRATION IN TIROL 1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG. TIROLERiNNEN MIT NICHT- ÖSTERREICHISCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT 1961-2009 (Unkommentierte Fassung - Stand 2. Februar 2010) PERSONEN OHNE ÖSTERR.STAATSANGEHÖRIGKEIT
STATISTIKEN ZU MIGRATION IN TIROL 1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG. TIROLERiNNEN MIT NICHT- ÖSTERREICHISCHER STAATSANGEHÖRIGKEIT 1961-2009 (Unkommentierte Fassung - Stand 2. Februar 2010) PERSONEN OHNE ÖSTERR.STAATSANGEHÖRIGKEIT
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland
 Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Demografischer Wandel
 TK Lexikon Gesundheit im Betrieb Demografischer Wandel Demografischer Wandel HI2243404 Zusammenfassung LI1615359 Begriff Die Bevölkerung in den industrialisierten Staaten, Ländern oder Kommunen nimmt seit
TK Lexikon Gesundheit im Betrieb Demografischer Wandel Demografischer Wandel HI2243404 Zusammenfassung LI1615359 Begriff Die Bevölkerung in den industrialisierten Staaten, Ländern oder Kommunen nimmt seit
a) Welches Volumen besaß die Cheops-Pyramide ursprünglich? Fertige hierzu eine maßstabsgetreue Schrägbildzeichnung an!
 Aufgabe 1: Die Pyramiden von Gizeh Nach der so genannten Frühzeit (2850-2600 v. Chr.) setzte gleich als erster kultureller Höhepunkt der Bau der großen Pyramiden, welches Grabmäler der altägyptischen Könige
Aufgabe 1: Die Pyramiden von Gizeh Nach der so genannten Frühzeit (2850-2600 v. Chr.) setzte gleich als erster kultureller Höhepunkt der Bau der großen Pyramiden, welches Grabmäler der altägyptischen Könige
3-Talsperren-Runde (Eschbachtalsperre, Wuppertalsperre, Panzertalsperre)
 3-Talsperren-Runde (Eschbachtalsperre, Wuppertalsperre, Panzertalsperre) Bei dieser Runde handelt es sich um eine längere Strecke, die typisch ist für ein Marathon-Training in der Remscheider Region. Man
3-Talsperren-Runde (Eschbachtalsperre, Wuppertalsperre, Panzertalsperre) Bei dieser Runde handelt es sich um eine längere Strecke, die typisch ist für ein Marathon-Training in der Remscheider Region. Man
1 Stunde / verbrauchte Zeit Std. Anlagen: Anlage 1 und 2 zu Aufgabe 8 und 9 Schreibpapier
 Abschlussprüfung für Auszubildende im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker / in Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker Prüfungs-Nr. Prüfungstermin: 12.
Abschlussprüfung für Auszubildende im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker / in Prüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Vermessungstechnikerin / Vermessungstechniker Prüfungs-Nr. Prüfungstermin: 12.
Nach einer Inspiration eines Textauszuges aus der österreichischen Bundeshymne:
 Freitag, 31. Dezember 2004 Sehr geehrte Damen und Herren Der Tourismusverband von Mühlbach am Hochkönig erteilte Anfang des Jahres 2004 Herrn Franz Gamsjäger den Auftrag, sich Gedanken über die Herstellung
Freitag, 31. Dezember 2004 Sehr geehrte Damen und Herren Der Tourismusverband von Mühlbach am Hochkönig erteilte Anfang des Jahres 2004 Herrn Franz Gamsjäger den Auftrag, sich Gedanken über die Herstellung
Mathematik - Oberstufe
 Mathematik - Oberstufe Pflicht- /Wahlteilaufgaben und Musterlösungen zu trigonometrischen Funktionen Zielgruppe: Oberstufe Gymnasium Schwerpunkt: Ableitung, Gleichungen, Aufstellen von trigonometrischen
Mathematik - Oberstufe Pflicht- /Wahlteilaufgaben und Musterlösungen zu trigonometrischen Funktionen Zielgruppe: Oberstufe Gymnasium Schwerpunkt: Ableitung, Gleichungen, Aufstellen von trigonometrischen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Rätsel: Großlandschaften in Deutschland - Material für Vertretungsstunden in Klassen 5-10 Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Rätsel: Großlandschaften in Deutschland - Material für Vertretungsstunden in Klassen 5-10 Das komplette Material finden Sie hier:
Frauen in der Spitzenpolitik in Österreich
 Präsident Prof. Dr. Werner Zögernitz Wien, 28.6.2013 in der Spitzenpolitik in Österreich Nach 4 Landtagswahlen und ebenso vielen Landesregierungsbildungen im Jahr 2013 sowie unmittelbar vor einer Nationalratswahl
Präsident Prof. Dr. Werner Zögernitz Wien, 28.6.2013 in der Spitzenpolitik in Österreich Nach 4 Landtagswahlen und ebenso vielen Landesregierungsbildungen im Jahr 2013 sowie unmittelbar vor einer Nationalratswahl
Fischwanderhilfe Donaukraftwerk Melk
 Impressum: Herausgeber: VERBUND Austrian Hydro Power AG Am Hof 6a 1010 Wien www.verbund.at Redaktion: Thomas Kaufmann Helmut Wimmer Thomas Bauer Fotos: Bauer/ Kaufmann (freiwasser), Haslinger, Frangez/IHG
Impressum: Herausgeber: VERBUND Austrian Hydro Power AG Am Hof 6a 1010 Wien www.verbund.at Redaktion: Thomas Kaufmann Helmut Wimmer Thomas Bauer Fotos: Bauer/ Kaufmann (freiwasser), Haslinger, Frangez/IHG
Redemittel zur Beschreibung von Schaubildern, Diagrammen und Statistiken
 Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Balkendiagramm Säulendiagramm gestapeltes Säulendiagramm Thema Thema des Schaubildes / der Grafik ist... Die Tabelle / das Schaubild / die Statistik / die Grafik / das Diagramm gibt Auskunft über... Das
Recapture Pocket, UT
 Recapture Pocket, UT Während der Vorbereitungen meiner Tour 2010 saß ich an einem Sonntagnachmittag vor dem Computer und plante meine beiden Bluff-Tage. Ich zoomte mich in Topo über die Karte, als mir
Recapture Pocket, UT Während der Vorbereitungen meiner Tour 2010 saß ich an einem Sonntagnachmittag vor dem Computer und plante meine beiden Bluff-Tage. Ich zoomte mich in Topo über die Karte, als mir
