Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar
|
|
|
- Friedrich Fürst
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar Klinische Ergebnisse nach Acetabulumfrakturen im Alter Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes 2014 vorgelegt von: Markus Michael Bauer, geb in Neunkirchen/Saar
2 1. ZUSAMMENFASSUNG EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG EPIDEMIOLOGIE UND FRAGESTELLUNG ÄTIOLOGIE, UNFALLMECHANISMUS, BIOMECHANIK DIAGNOSTIK KONVENTIONELLE RÖNTGENDIAGNOSTIK COMPUTERTOMOGRAPHIE KLASSIFIKATION VON ACETABULUMFRAKTUREN THERAPIE DER ACETABULUMFRAKTUR KONSERVATIVE THERAPIE OPERATIVE THERAPIE MATERIAL, PATIENTEN UND METHODEN PATIENTEN UNTERSUCHUNG DER PATIENTEN MERLE D AUBIGNÉ ERFASSUNG DER LEBENSQUALITÄT MIT DEN FRAGEBÖGEN SF12 UND EQ5D RADIOLOGIE EINTEILUNG IN GRUPPEN STATISTISCHE VERGLEICHE ERGEBNISSE PATIENTEN DER STUDIE / SEK. HÜFTGELENKERSATZ GESCHLECHTERVERTEILUNG ALTERSVERTEILUNG ART DER VERLETZUNG UNFALLMECHANISMUS SCHMERZEN UND FUNKTIONELLE ERGEBNISSE MERLE D AUBIGNÉ BEWEGUNGSUMFÄNGE PATIENTENBASIERTE FRAGEBÖGEN SF12 UND EQ-5D FRAKTURTYP NACH JUDET UND LETOURNEL UND OPERATIVE VERSORGUNG RADIOLOGISCHE ERGEBNISSE ROOF ARC PRÄOPERATIV COXARTHROSE NACH HELFET ZEITPUNKT DER IMPLANTATION EINER SEKUNDÄREN HÜFT TEP
3 5. DISKUSSION LITERATURVERZEICHNIS PUBLIKATION UND DANKSAGUNG ANHANG SF EQ-5D MERLE D AUBIGNÉ ERGEBNISSE VON SF12 UND EQ-5D
4 1. Zusammenfassung Die Acetabulumfraktur Herausforderung Knochenstruktur dar. des älteren Faktoren erschweren Menschen wie die die stellt eine osteoporotisch operative besondere veränderte Stabilisierung und leistungseinschränkende Komorbiditäten bedingen ein erhöhtes Risiko an perioperativen Komplikationen (Donegan et al., 2010). Bei der Wahl des am besten geeigneten Therapiekonzeptes muss dies berücksichtigt werden. Die Acetabulumfraktur des älteren Patienten ist zwar eine seltene Verletzung, man sieht jedoch seit Jahren eine stetige Zunahme ihrer Inzidenz (Ferguson, Patel, Bhandari, & Matta, 2009). Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Zunahme der Aktivitäten älterer Menschen ist mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen zu rechnen. Neben der Evaluation der klinischen Ergebnisse, war es das Ziel der vorliegenden Untersuchung zu prüfen, ob auch im fortgeschrittenen Alter eine Gelenkrekonstruktion durch Osteosynthese möglich und sinnvoll ist und inwieweit das Alter eine Rolle im Outcome spielt. Dazu wurden an der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes alle behandelten Acetabulumfrakturen bei Patienten, die älter als 60 Jahre waren, in einem Zeitraum von 6 Jahren ( ) retrospektiv aufgearbeitet und klinische Nachuntersuchungen durchgeführt. Es kamen insgesamt 48 Fälle zur Auswertung. Von diesen wurden 39 durch eine offene Reposition und Platten- / Schraubenosteosynthese (ORIF) operativ versorgt. Bei den übrigen 9 Patienten wurde ein primär konservatives Vorgehen gewählt. Bei 7 der 39 operativ versorgten Patienten war zu einem späteren Zeitpunkt die Implantation einer sekundären Hüfttotalendoprothese notwendig geworden. Zwei Patienten von 9 aus der Gruppe der konservativ behandelten mussten ebenfalls mit einer sekundären H-TEP versorgt werden. Es konnten bei 32 Patienten Nachuntersuchungsdaten in Form von Fragebögen (SF-12 und EQ-5D) erhoben werden. Von diesen 32 konnten 19 zusätzlich 4
5 persönlich untersucht werden. Von ihnen wurden die Bewegungsumfänge dokumentiert und ausgewertet, sowie die Daten für den Merle d Aubigné Score erhoben. Nach Auswertung des Merle d Aubigné Scores, sowie der Fragebögen SF-12 und EQ5-D konnten sehr gute funktionelle und klinische Ergebnisse bei den Patienten gefunden werden, die mit einer operativen Reposition und Stabilisierung mit Osteosynthese versorgt worden sind und bei denen im Verlauf keine sekundäre Hüfttotalendoprothese notwendig geworden ist. 5
6 Abstract: The aim of this study was to analyze the clinical outcome and incidence of hip arthritis in elderly patients with acetabular fractures. Because of poor bone quality in the elderly, even a low-energy trauma may lead to an acetabular fracture. An anatomical reconstruction of the acetabulum is necessary to achieve sufficient stability also for a potential hip arthroplasty. So far, there is very limited information on the outcome of acetabular fractures in the elderly. During a period of 6 years ( ), 48 patients older than 60 years were admitted to our department with an acetabular fracture. Thirty-nine patients were treated operatively and nine patients non-operatively. Thirty-two patients were followed up. Nineteen of them were assessed using EQ-5D, SF-12 and Merle d'aubigne questionnaires in addition to their clinical examination. Thirteen other patients were only examined using the questionnaires. Of the 32 patients that were followed up, 7 underwent total hip arthroplasty due to secondary post-traumatic hip arthritis after open reduction and internal fixation (ORIF). The range of motion of the operated hip was comparable to that of the non-operated contralateral side. However, the internal rotation was found to be slightly decreased at the operated side when compared to the non-operated contralateral side. Merle d'aubigne score and physical and mental SF-12 score components as well as quality of life were better in patients treated with ORIF compared to those patients that were treated by secondary hip arthroplasty. Regarding the different treatment strategies (ORIF vs primary hip arthroplasty vs nonoperative treatment) of acetabular fractures in the elderly, data from the literature are conflicting. Our results indicate that ORIF represents a good treatment option for acetabular fractures in the elderly. In patients that did not develop secondary hip arthritis, a good clinical outcome and quality of life was documented. 6
7 2. Einleitung und Fragestellung 2.1 Epidemiologie und Fragestellung Bei der Acetabulumfraktur handelt es sich um eine seltene Verletzung. In der Literatur wird ihre Inzidenz mit 3 pro Einwohner und Jahr angegeben (Laird & Keating, 2005). Dem gegenüber steht die große klinische Bedeutung dieser Verletzung des Hüftgelenkes als zentraler Kraftüberträger von der unteren Extremität auf den Beckenring und damit auf den Körperstamm. In der Gruppe der über 60-Jährigen sind Acetabulumfrakturen trotz steigender Inzidenz eine Seltenheit. Bei Letournel waren 12,7% der Patienten älter als 60 Jahre (Letournel, 1994). Die Quote der über 65-Jährigen beträgt bei Pohlemann 6,5% (Tscherne, 1998). Mit dem Anstieg der Lebenserwartung und der damit verbundenen Zunahme der Aktivitäten älterer Menschen ist in Zukunft mit einem Anstieg der Inzidenz dieser Verletzung im höheren Lebensalter zu rechnen. Diese These wird in der neueren Literatur bestätigt. Die Arbeitsgruppe um Ferguson fand in einem Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2007 eine Zunahme der Inzidenz der Acetabulumfraktur um das 2,4-fache von der ersten zur zweiten Hälfte der Studienperiode bei über 60-Jährigen (Ferguson et al., 2009). Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die klinischen Ergebnisse bei älteren Patienten, die nach Acetabulumfrakturen konservativ oder operativ stationär behandelt worden sind, zu evaluieren und zu prüfen, ob auch im fortgeschrittenen Alter eine Gelenkrekonstruktion mit Hilfe einer Osteosynthese sinnvoll ist und wie weit der Patient in seiner Lebensführung anschließend beeinträchtigt wird. 7
8 2.2 Ätiologie, Unfallmechanismus, Biomechanik Während bei jüngeren Patienten die Acetabulumfraktur in der Regel aus einem Hochenergietrauma resultiert (z.b. PKW- oder Motorradunfall), können im höheren Lebensalter auch schon Niedrigenergietraumata bei entsprechend geschwächter Knochenstruktur und bei entsprechender Richtung der einwirkenden Kraft zu Hüftgelenkbrüchen führen beispielsweise durch Stürze auf die Seite (Tscherne, 1998). Die Arbeitsgruppe Becken I der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie mit 10 teilnehmenden Klinken fand 1998 in einer Multicenterstudie als Unfallursache für Becken- und Acetabulumfrakturen in 69,1% Verkehrsunfälle, in 15,1% einfache Stürze und in 11% Stürze aus großer Höhe. (Tscherne, 1998) Bei Frakturen des Acetabulums erfolgt die Kraftüberleitung in den meisten Fällen im Sinne eines indirekten Frakturmechanismus über das Femur. Entscheidend für die Art der Fraktur ist dabei die Position des Hüftkopfes in der Gelenkpfanne im Moment der Krafteinwirkung. Dabei kommen als äußere Angriffspunkte für die Krafteinleitung verschiedene Strukturen in Frage. Der Trochanter mayor beispielsweise beim Seitaufprall oder beim Sturz auf die Seite - dabei wird die Kraft über den Schenkelhals auf den Femurkopf und dann in die Hüftpfanne geleitet. Bei gebeugtem Unterschenkel, in sitzender Position, kann das Knie Ort der Krafteinleitung sein. Bei einem Frontalaufprall im Kfz kann es beim Anschlag des Knies am Armaturenbrett zur sog. dash-board-injury kommen. Dabei wird der Hüftkopf in dorsaler Richtung ins Acetabulum gedrückt, was häufig zu Frakturen der hinteren Wand führt. Bei diesem Unfallmechanismus treten nicht selten sog. Kettenfrakturen des Oberschenkels entlang des Kraftvektors am Femurschaft und im Bereich der Patella auf. Bei gestrecktem Knie, z.b. bei einem Sturz aus großer Höhe wird die Kraft über den Fuß eingeleitet und führt daher zu Frakturen der unteren Extremität oder zu Pfannenfrakturen im Dombereich. 8
9 Die lumbosakrale Region kann in sehr seltenen Fällen Ort der Krafteinleitung sein, z.b. durch einen herabfallenden Gegenstand auf das dorsale Becken bei gebeugter Haltung - hier sind Frakturen des Os sacrum oder des Beckenrings häufig, seltener sind Frakturen der vorderen Wand (Tscherne, 1998). 2.3 Diagnostik Neben der sorgfältig erhobenen Anamnese zum Unfallhergang und der klinischen Untersuchung, ist die konventionelle Röntgendiagnostik ein wichtigstes Mittel zur Diagnose einer Acetabulumfraktur. Da es sich bei der Versorgung von Hüftpfannenbrüchen in der Regel nicht um eine Notfallmaßnahme handelt, werden sämtliche verfügbaren Mittel der erweiterten Diagnostik (CT, MRT) herangezogen. Hierbei hat insbesondere die Computertomographie eine herausragende Bedeutung. Sie dient der Klärung und Darstellung der genauen Frakturgeometrie. Dabei kann durch 2D CT und 3D CT-Rekonstruktionen eine räumliche Beziehung der einzelnen Fragmente zueinander dargestellt werden. Daneben können eventuell vorhandene Zusatzpathologien wie Impressionen und intraartikuläre Fragmente dargestellt werden. Eine sorgfältige Analyse des Frakturtyps ist für die Entscheidung zwischen konservativem Vorgehen und operativer Therapie, sowie für die Art der operativen Maßnahme und der Wahl des geeigneten Zugangsweges maßgeblich. 9
10 2.3.1 konventionelle Röntgendiagnostik Routinemäßig wird eine Becken ap-aufnahme in Rückenlage angefertigt. abbabb. 1 Abb. 1 Kennlinien in einer linken Hüftübersicht ap (links grafische, rechts radiologische Ansicht). Bilder aus: Tscherne, Pohlemann: Becken und Acetabulum, Springer Verlag, 1998 Dabei können die in Abb. 1 dargestellten Kennlinien identifiziert werden. Bei der ap-beckenübersicht ist der direkte Vergleich mit der unverletzten Gegenseite möglich. 10
11 Die Ala-Aufnahme entsteht durch Rotation der Röntgenröhre um 45 zur unverletzten Seite. Damit geht der Strahlengang um 45 von medial nach lateral, so dass die Ala des Os ilium plan zur Darstellung kommt. So lassen sich der Darmbeinflügel selbst und der vordere Pfeiler des Acetabulums beurteilen. Abb. 2 Ala Aufnahme einer linken Hüfte (links grafisch und rechts radiologisch). Darstellung der möglichen Kennlinien in der Ala - Projektion. Bilder aus: Tscherne, Pohlemann: Becken und Acetabulum, Springer Verlag,
12 Bei der Obturator-Aufnahme wird die Röntgenröhre um 45 in Richtung der verletzten Seite rotiert. Der Strahlengang geht jetzt in 45 Richtung von lateral nach medial. Damit kommt das Foramen obturatum plan zur Darstellung. Neben dem Foramen selbst, ist hierbei der hintere Pfeiler des Acetabulums gut zu beurteilen. Abb. 3 Obturator Projektion und zugehörige Kennlinien eines linken Acetabulums. Bilder aus: Tscherne, Pohlemann: Becken und Acetabulum, Springer - Verlag, 1998 Aus der Kombination dieser drei Standardaufnahmen kann die Lage und Ausdehnung einer Acetabulumfraktur beurteilt, sowie die Frakturklassifikation erhoben werden (Tscherne, 1998). 12
13 2.3.2 Computertomographie Nach der Diagnose einer Acetabulumfraktur wird zur weiteren präoperativen Planung und zur Feindiagnostik eine CT- Untersuchung mit 2D- und 3DRekonstruktion durchgeführt. Abb. 4 alterstyptische Acetabulumfraktur bei einem 89- Jährigen Patienten. Es handelt sich um eine Frakutur des vorderen Pfeilers mit hinterer Hemiquerfraktur links, zu erkennen im axialen CT. Bilder aus: Culemann: Aktuelle Behandlungsstrategien nach Azetabulumfrakturen, Thieme
14 Abb. 5 Versorgung über ilioinguinalen Zugang mit Rekonstruktionsplatte. (Patient aus Abb. 4) Bei der Verlaufskontrolle 2 Jahre postoperativ konnte der inzwischen 91-Jährige Patient ohne Gehhilfe frei laufen und versorgte seinen Haushalt noch selbst. Bilder aus: Culemann: Aktuelle Behandlungsstrategien nach Azetabulumfrakturen, Thieme Klassifikation von Acetabulumfrakturen Für den klinischen Alltag hat die Klassifikation nach Judet und Letournel die größte Bedeutung erlangt (Judet, Judet, & Letournel, 1964). Dabei werden fünf einfache und fünf kombinierte Frakturtypen unterschieden. Bei den einfachen Frakturtypen sieht man eine einzelne durch das Acetabulum verlaufende Hauptfrakturlinie. Die kombinierten Frakturformen zeichnen sich durch eine Kombination der einfachen Frakturlinien aus. 14
15 Einfache Frakturtypen: Hinterwandfraktur: Hintere Pfeilerfraktur: Vorderwandfraktur: Vordere Pfeilerfraktur: Querfrakturen: Kombinierte Frakturtypen: 15
16 T-Fraktur: Fraktur des hinteren Pfeilers mit Hinterwandfraktur: Querfraktur mit Hinterwandfrakur: Vordere Pfeilerfraktur mit hinterer Hemiquerfraktur: Zweipfeilerfraktur: Abb. 6 Darstellung der einzelnen Frakturtypen, Klassifikation nach Judet und Letournel. Bilder aus: Tscherne, Pohlemann: Becken und Acetabulum, Springer - Verlag, 1998 Neben der Judet und Letournel Klassifikation hat die AO-Klassifikation im klinischen Alltag nur einen geringen Stellenwert. Sie findet Anwendung im 16
17 Bereich spezieller wissenschaftlicher Auswertungen und ist im internationalen Vergleich von Acetabulumfrakturen von besonderer Bedeutung (Tile M, 1995). Abb. 7 Die häufigsten Acetabulumfrakrutren nach der AO Klassifikation. Grafik aus: Müller, Allgöwer: Manual der Osteosythese, Springer - Verlag, Therapie der Acetabulumfraktur Äußerst selten besteht bei Acetabulumfrakturen eine Indikation zur sofortigen, notfallmäßigen operativen Intervention. Für eine vollständige radiologische Diagnostik inklusive Computertomographie und für die operative Planung und Wahl des optimalen Zugangsweges stehen im Regelfall einige Tage Zeit zur Verfügung. Eine Notfalltherapie ist notwendig bei luxierten und nicht zu reponierenden Hüften oder bei primär reponierter Fraktur mit Reluxationstendenz. Dabei handelt es sich dann in der Regel um eine Extensionsbehandlung. 17
18 2.5.1 Konservative Therapie Ein konservatives Vorgehen ist bei undislozierten Frakturen ohne Luxationstendenz, bei Ausbrüchen von nur schmalen Randfragmenten und bei Frakturen ohne Beteiligung des lasttragenden acetabulären Doms möglich (roof arc > 45 ) (Matta, Anderson, Epstein, & Hendricks, 1986). Senkrechte durch das Zentrum des Hüftkopfes (1), Ausmessen des Winkels bis zur 1. sichtbaren Frakturlinie (2). Wenn beispielsweis ein Winkel von kleiner 45 (1 zu 2) gemessen wird, ergibt sich eine eindeutige Mitbeteiligung des lasttragenden Gelenkanteiles und daraus eine entsprechende OP Indikation. Liegt die erste zu messene Frakturlinie in allen 3 Projektionen ausserhalb dieser 45 Grenze kann eine konservative Therapie durchgeführt werden. Abb. 8 Pfannendachmessung nach Matta Grafik aus: Culemann: Aktuelle Behandlungsstrategien nach Azetabulumfrakturen, Thieme 2009 Ein reduzierter Allgemeinzustand mit kardialen und pulmonalen Vorerkrankungen, eine ausgeprägte Osteoporose, vorbestehende Coxarthrose, lokale Infektionen und eine bestehende Thrombose stellen relative Kontraindikationen gegen eine operative Rekonstruktion dar (Kuner, 1997). Die konservative Therapie ist besonders im höheren Lebensalter auch mit erheblichen Risiken verbunden bei den hüftgelenksnahen Femurfrakturen ist diese Tatsache schon lange akzeptiert (Antapur, Mahomed, & Gandhi, 2011). Mit der Immobilisation verbundene Risiken sind thrombembolische Komplikationen ebenso wie Pneumonien. Damit ist eine länger dauernde Immobilisation durch eine Extensionsbehandlung nicht mit dem häufig 18
19 reduzierten Allgemeinzustand zu vereinbaren. Die funktionelle Therapie bedeutet oft eine verlängerte Behandlungs- und Rehabilitationszeit, besonders wenn nach der Ausheilung in Fehlstellung eine frühsekundäre Implantation einer Hüftendoprothese angestrebt wird. Insgesamt sind die Ergebnisse der konservativen Therapie unbefriedigend (Spencer, 1989; Hesp & Goris, 1988) Operative Therapie Eine Indikation zur operativen Rekonstruktion ist bei einer Inkongruenz im Hüftgelenk gegeben. Bei instabilen Hüftgelenkfrakturen mit verbleibender Luxationstendenz ist ebenfalls ein operatives Vorgehen angezeigt. Häufig besteht eine Spalt- oder Stufenbildung im dachbildenden Domfragment, welche auch eine eindeutige OP-Indikation darstellt. Das Ziel ist dabei die möglichst exakte anatomische Rekonstruktion des Hüftgelenks (Matta, Mehne & Roffi, 1986; Tannast et al. 2010) Bei der operativen Versorgung des älteren Patienten ergeben sich Besonderheiten im Hinblick auf das Narkoserisiko, welches in Abhängigkeit des Allgemeinzustandes und der fortgeschrittenen kardiovaskulären Risiken erhöht ist (Das, Forrest & Howell, 2010). Des Weiteren ist die Qualität der Knochenstruktur im fortgeschrittenen Alter meist reduziert. So ist es bei einer vorbestehenden Osteoporose häufig notwendig, längere Platten oder Doppelplatten zu verwenden, um trotz des verminderten Haltes der Schrauben ein stabiles Ergebnis zu erzielen. In einigen Fällen ist der Einsatz spezieller Fixationstechniken nötig (sog. Federplatten - spring plates ) (Richter, Hutson & Zych, 2004). Zur Aufklärung des Patienten müssen alternative Behandlungsformen besprochen werden und die Gründe für ein operatives Vorgehen erläutert werden. Dabei muss der Patient präoperativ neben der selbstverständlichen Risikoaufklärung insbesondere auch auf die langen Rehabilitationszeiten 19
20 hingewiesen werden. Ebenso muss geklärt werden, ob der Patient in der Lage ist, eine postoperative Teilbelastung von üblicherweise kg für 8 Wochen einzuhalten. Sollte dies voraussichtlich nicht der Fall sein, ist die Versorgung mit einer sofort belastungsstabilen Osteosythese vorzuziehen. Die Wahl des geeigneten Zugangs stützt sich auf die exakte Bestimmung der Frakturlage und des ausmaßes nach der Klassifikation von Judet und Letournel. Für die Versorgung von dorsalen Acetabulumfrakturen, also Frakturen der hinteren Wand, des hinteren Pfeilers sowie bei Querfrakturen auch in Kombination mit der hinteren Wand hat sich der Kocher-Langenbeck-Zugang als Standard durchgesetzt. Dabei hat der Operateur eine gute Übersicht über die Außenseite des Os innominatum. Die Palpation auf die Innenseite des Beckens, erlaubt eine gute Repositionskontrolle (Tscherne, 1998). Im Jahr 1961 wurde von Letournel der ilio-inguinale Zugang eingeführt (Judet et al., 1964). Über ihn lassen sich ventrale Acetabulumfrakturen gut versorgen, da hierbei die Darstellung des gesamten vorderen Pfeilers möglich ist. Der hintere Pfeiler ist durch das Foramen ischadicum major nur begrenzt palpierbar. Das Hüftgelenk selbst kann nicht eingesehen werden. Die Gelenkrekonstruktion gelingt dennoch gut über die Reposition der einsehbaren Frakturlinien. Sowohl für den dorsalen als auch für den ventralen Zugangsweg sind verschiedene Erweiterungen dieser Standardzugänge beschrieben. Ihnen gemeinsam bleibt jedoch, dass lediglich ein Pfeiler des Gelenks ausreichend dargestellt werden kann. Eine Kombination von Einzelzugängen, simultane oder sequenzielle Doppelzugänge, erlauben ebenfalls nur eine eingeschränkte Exposition des Gelenks. 20
21 Einen nahezu kompletten Einblick auf das Os coxae kann man nur gewinnen, wenn man die gesamte Glutealmuskulatur vom Trochanter major ablöst. Dies kann entweder scharf erfolgen oder mit Hilfe einer Osteotomie des Trochanter major (chirurgische Hüftluxation nach Ganz) (Reinert et al., 1988; Routt & Swiontkowski, 1990). Der erweiterte ilio-femorale Zugang wurde von Judet und Letournel erstmalig eingesetzt (Letournel, 1984). Die sogenannte Maryland-Modifikation, ein Zugang durch Osteotomie des Trochanter major und des Os ilium an der Crista iliaca wurde erstmals 1988 beschrieben (Reinert et al., 1988). Vorteil der erweiterten lateralen Zugänge ist die besonders gute Einsehbarkeit des hinteren Pfeilers und der größten Teile des vordenen Pfeilers. Jedoch wirkt sich das hohe Maß der Weichteilexposition nachteilig auf die perioperative Morbidität aus (Gorczyca, Powell, & Tile, 1995). Insgesamt bleiben die erweiterten Zugänge zum Acetabulum heute besonderen Einzelfällen vorbehalten, wie beispielsweise Spätkorrekturen oder Korrekturen nach Pseudarthrosenbildung. Durch das hohe Maß an Traumatisierung und Gewebeschädigung besteht ein erhöhtes Risiko an periartikulären Ossifikationen, verlängerte Rehabilitationsdauer, erhöhter Blutverlust und längere OP Zeiten (Gorczyca et al., 1995). Zur osteosythetischen Versorgung kommen spezielle Implantate aus 3,5mm Stahl zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Rekonstruktionsplatten und winkelstabile Platten. Die verwendeten Schrauben (sog. Beckenschrauben) sind aufgrund ihrer Länge besonderen Torsionsbelastungen ausgesetzt. Sie sind deshalb mit einem größeren Kopf versehnen, sodass der Inbus tiefer eindringen kann. 3. Material, Patienten und Methoden 21
22 3.1 Patienten Im Zeitraum von März 2001 bis Dezember 2006 wurden insgesamt 139 Patienten mit Acetabulumfraktur an der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes behandelt. Von diesen waren 48 Patienten zum Unfallzeitpunkt älter als 60 Jahre. Die Daten und Krankheitsverläufe dieser 48 Patienten wurden retrospektiv aufgearbeitet. Die Patienten wurden entweder direkt in der Klinik aufgenommen, oder sind aus peripheren Krankenhäusern zur primären operativen Versorgung einer Acetabulumfraktur zugewiesen worden. Eingeschlossen wurden ebenfalls Patienten mit Mehrfachverletzung und Polytrauma. Ausgeschlossen wurden Patienten, deren Vorstellung zur Korrekturoperation nach Fehlverheilung erfolgte, sowie Patienten nach Pseudarthrosenbildung und bei operativer Versorgung später als 4 Wochen nach dem Unfall. 3.2 Untersuchung der Patienten Alle Patienten wurden angeschrieben und zum Nachuntersuchungstermin eingeladen. Alternaiv wurden die Patienten telefonisch kontaktiert oder die Kontaktaufnahme erfolgte über den Hausarzt. Die Nachuntersuchungen fanden in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes zunächst unter Anleitung, später auch selbstständig statt. Alle Patienten wurden dem zuständigen Ambulanzarzt zusätzlich vorgestellt. Die Anamneseerhebung und der Ablauf der körperlichen Untersuchung folgten einem standardisierten Untersuchungsbogen. Für die Hüftgelenke wurden die Bewegungsumfänge von Beugung/Streckung, Innen-/Aussenrotation sowie Abduktion/Adduktion nach der Neutral Methode dokumentiert. Da in dieser 22
23 Altersklasse mit einer vorbestehenden Einschränkung des Bewegungsausmaßes auch der nicht verletzten Hüfte zu rechnen ist, wird die Beweglichkeit der betroffenen Seite als Prozentwert im Vergleich zur unverletzten Seite erfasst (Modifikation nach Matta) (Matta, Mehne et al., 1986). 3.3 Merle d Aubigné Der Bewertung nach Merle d Aubigné ist ein häufig verwendeter Score, der die Bereiche Schmerzen, Mobilität und Gehfähigkeit erfasst. (D'Aubigne & Postel, 1954) Die Parameter werden durch eine sorgfältige Anamnese erhoben (siehe Anhang 9.3). 3.4 Erfassung der Lebensqualität mit den Fragebögen SF12 und EQ5D Zur Beurteilung der Lebensqualität nach Acetabulumfraktur wurden den Patienten zwei Fragebögen ausgehändigt, der Standard SF 12 sowie der Euroquol (EQ5D) (siehe Anhang 9.1 und 9.2). Der SF 12 ist die Kurzform des Health Survey Short Form 36 (SF 36). Dabei handelt es sich um ein internationales, krankheitsübergreifendes Standardverfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit psychischen, körperlichen und sozialen Aspekten (Kuhl, Farin & Follert, 2004). Es war allen Patienten möglich, diese Fragebögen ohne fremde Hilfe auszufüllen. Patienten, die aus verschiedenen Gründen nicht an der Nachuntersuchung teilnehmen konnten, wurden auf dem Briefweg gebeten die beiden Fragebögen auszufüllen und zurückzusenden. 23
24 Alle Fragebögen wurden anschließend in die Onlinedatenbank MemDoc eingegeben und auch über diese edv-technisch ausgewertet. 1 Diese internetbasierte Plattform wird beim Institut für Evaluative Forschung in orthopädischer Chirurgie der Medizinischen Fakultät der Universität Bern geführt. Zur Bewertung des SF12 werden durch einen standardisierten Rechenalgorithmus acht Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität gebildet. Diese werden dann zu zwei faktorenanalytisch begründeten Summenscores, einer körperlichen und einer psychischen Scala zusammengefasst (Kuhl et al., 2004). Analog dazu führt das Auswerteverfahren beim EQ-5D zu einem numerischen Wert, der auch für verschieden Subgruppen errechnet werden kann. 3.5 Radiologie Zur Beurteilung des radiologischen Ergebnisses wurden die prä- und postoperativen Aufnahmen, sowie diejenigen des Nachuntersuchungszeitpunktes herangezogen. Die Kriterien im Einzelnen waren: - das Ausmaß des roof arcs im prä- und postoperativen Bild (Abb. 8 im Kapitel 2.5.1) - die Größe einer Stufe und eines Spaltes im prä- und postoperativen Bild - das Vorhandensein einer Trümmerzone (0/50/100%) Außerdem erfolgte eine radiologische Einschätzung der Coxarthrose nach Helfet. 3.6 Einteilung in Gruppen 1 Memdoc, Universität Bern, E. Aghayev 24
25 Alle Patienten, die klinisch nachuntersucht werden konnten, wurden zur Auswertung in 2 Gruppen eingeteilt: Gruppe A: Umfasst Patienten, bei denen im Verlauf keine Hüfttotalendoprothese implantiert werden musste. Gruppe B: Beinhaltet diejenigen Patienten, bei denen auf Grund einer posttraumatischen Arthrose und konsekutiven Schmerzen eine sekundäre Hüfttotalendoprothese implantiert worden ist. 3.7 Statistische Vergleiche Zum Vergleich zwischen Patientensubkollektiven für kontinuierliche Variablen wurde der zweiseitige Wilcoxon-Rangsummentest benutzt. Das Level der Signifikanz wurde bei α=0.05 gesetzt. Die Analysen wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SAS 9,2 (SAS Institute Inc, NC) durchgeführt. 2 2 E. Aghayev, Institut für Evaluative Forschung in orthopädischer Chirurgie der Medizinischen Fakultät der Universität Bern) 25
26 4. Ergebnisse 4.1 Patienten der Studie / sek. Hüftgelenkersatz Von den 48 Patienten erhielten 39 eine primäre osteosynthetische Versorgung (offene Reposition, interne Fixation = ORIF). Neun Patienten wurden konservativ behandelt. In der Gruppe der primär operativ versorgten Patienten (39) wurde in 7 Fällen die Implantation einer sekundären Hüfttotalendoprothese (H-TEP) innerhalb des Nachuntersuchungszeitraums notwendig. Dies entspricht einem Anteil von 18 %. Unter den 9 konservativ behandelten Patienten erhielten im Verlauf 2 Personen eine Hüfttotalendoprothese (22 %). Patientenkollektiv: 48 Patienten 39 operativ 32 keine TEP 9 konservativ 7 sekundäre TEP 7 keine TEP 2 sekundäre TEP Abb. 9 Patientenkollektiv. Gruppe A grün, Gruppe B rot. Gruppe A (keine sekundäre H-TEP im Verlauf) beinhaltet 39 Patienten, darunter sind 32 nach primärer operativer Versorgung und 7 nach primär konservativen Therapieansatz. Die Gruppe B zählt 9 Patienten, in ihr finden sich 7 Fälle von primär operativer Therapie und 2 Fälle nach konservativem Therapieversuch. 26
27 Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Unfallereignis und sekundärer Hüft TEP betrug in der ORIF-Gruppe 5,8 Monate, bei den beiden primär konservativ behandelten Patienten dauerte es im Mittel 7,5 Monate. Im Rahmen der Studie gelang es, Nachuntersuchungsdaten von insgesamt 32 Patienten in Form der Fragebögen SF12 und Euroquol zu erheben. Von diesen 32 konnten 19 zusätzlich klinisch untersucht werden. Von ihnen wurden die Bewegungsumfänge dokumentiert und ausgewertet, sowie die Daten für den Merle d Aubigné Score erhoben. 10 Patienten waren zum Nachuntersuchungszeitpunkt verstorben. Die Gruppe nicht erreicht beinhaltet 6 Patienten, bei denen es weder über die Privatadresse noch über den Hausarzt gelungen war, einen Kontakt herzustellen. Somit konnten 32 Patienten in die Nachuntersuchung einbezogen werden dies entspricht einer Nachuntersuchungsrate von 84% der in Frage kommenden Patienten Patienten Fragebögen klinische Nachuntersuchung Abb. 10 Einteilung des Nachuntersuchungskollektivs 27 verstorben nicht erreicht
28 4.2 Geschlechterverteilung Von den 48 Gesamtkollektivs Patienten waren 8 des weiblich männlich weiblich (16,67%) und 40 männlich (83,33%). Abb. 11 Geschlechterverteilung 4.3 Altersverteilung Entsprechend den Einschlusskriterien sind alle Patienten zum Unfallzeitpunkt älter als 60 Jahre. Das mittlere Alter betrug 71,5 Jahre, im Median 69 (61/95) Anzahl der Patienten Alter de r Patie nten in Jahre n Abb. 12 Darstellung der Altersverteilung: Die einzelnen Stufen sind zusammengefasste Altersgruppen von je 5 Jahren, die Zahl an der Kurve gibt die jeweilige Gruppenstärke an. 28
29 4.4 Art der Verletzung Bei 32 Patienten lag eine isolierte Acetabulumfraktur vor. 12 Patienten hatten Verletzungen an mindestens einer weiteren Körperregion (Mehrfachverletzung). In 4 Fällen erlitten die Patienten eine Acetabulumfraktur im Rahmen eines Polytraumas Anzahl der Patienten isolierte Acetabulumverletzungen Mehrfachverletzungen Polytrauma Abb. 13 Einteilung des Nachuntersuchungskollektivs nach der Verletzungsart 4.5 Unfallmechanismus Mit 23 Patienten stellen die häuslichen Stürze den größten Anteil der Unfallursache dar. Dabei ist der Unfallmechanismus ein Niedrigenergietrauma mit Sturz direkt auf die betroffene Körperseite. 11 Patienten zogen sich die Acetabulumfraktur bei einem Sturz aus einer Höhe >1m zu, darunter Leiterstürze und ein Sturz vom Dach. Im Straßenverkehr (PKW, Fahrrad, Fußgänger) verunglückten 13 Patienten. Ein Patient erlitt eine Acetabulumfraktur im Rahmen eines Sturzereignisses beim Skifahren. 29
30 4.6 Frakturtyp nach Judet und Letournel und operative Versorgung In 40 der 48 Fälle ist der vordere Pfeiler mit betroffen. Dabei sind die größten Fraktionen die vorderen Pfeilerfrakturen mit hinterer Hemiquerfraktur (n=20) und die isolierten Frakturen des vorderen Pfeilers (n=15). In fünf Fällen lag eine Zweipfeilerfraktur vor. Somit sieht man in 83% der Fälle eine Mitbeteiligung des vorderen Pfeilers Patienten Q HPF u. HW 0 0 HW HPF VW VPF Q u. HW T VPF u.hintere hemiquer Frak turtyp nach Jude t und Letourne l Abb. 14 Darstellung der Verteilung des Frakturtyps nach der Klassifikation nach Judet und Letournel. 30 2PF
31 Unter den nachuntersuchten Patienten fanden sich in der Gruppe A (19 Patienten, operativ versorgt, keine sekundäre Hüft TEP) bei 9 Patienten Frakturen des vorderen Pfeilers mit hinterer Hemiquerfraktur, bei 7 vordere Pfeilerfrakturen, bei 1 Patienten eine Zweipfeilerfraktur, eine Querfraktur und eine Querfraktur mit hinterer Wand. Der Eingriff wurde im Durchschnitt nach 4,6 Tagen (2-19) von 4 verschiedenen Operateuren durchgeführt. Die Operationen dauerten im Durchschnitt 209 Minuten ( ). Der Mittlere Blutverlust betrug 580ml ( ). In 17 Fällen wurde über den ilioinguinalen Zugang operiert, 2mal wurde der Kocher-Langenbeck Zugang verwendet. In dieser Gruppe traten keine peri- und postoperativen Komplikationen auf. In der Gruppe B (5 Patienten, operativ versorgt, sekundäre Hüft TEP erhalten) fanden sich 2 Vorderpfeilerfrakturen, 2 Vorderpfeilerfrakturen mit hinterer Hemiquerfraktur und eine Querfraktur mit hinterer Wand. Die operative Versorgung fand nach durchschnittlich 5,8 Tagen (3-8) durch 3 verschiedene Operateure statt. Hier betrug die durchschnittliche OP Zeit 182 Minuten (120240), im Durchschnitt verloren die Patienten 580ml Blut ( ). Bei 4 Patienten wurde der ilioinguinale Zugang angewendet der Kocher-Langenbeck Zugang wurde einmal verwendet. In diesen Punkten (Frakturtyp, Zugang, OPDauer und Blutverlust) fanden sich keine statistisch signifikanten Unterschiede. Allerdings traten in der Gruppe B im Gegensatz zur Gruppe A Komplikationen bereits während der stationären Aufenthalts auf. Ein Patient entwickelte eine Infektion in Folge eines Seroms, bei einem weiteren Patienten kam es zu einer oberflächlichen Wundinfektion. Ein dritter Patient erlitt einen sekundären Repositionsverlust mit Spalt- und Stufenbildung von > 2mm. Bei keinem der Fälle war eine sekundäre chirurgische Intervention notwendig. 31
32 4.7 Schmerzen und funktionelle Ergebnisse Merle d Aubigné Insgesamt konnte von 19 der 39 durch Rekonstruktion versorgten Patienten mit Acetabulumfrakturen der Score nach Merle d Aubigné erhoben werden. Die Patienten, bei denen keine sekundäre Hüft TEP implantiert wurde (Gruppe A) erzielten im Durchschnitt 14,1 von 18 möglichen Punkten. Wenn aufgrund einer posttraumatischen Arthrose eine Hüftendoporthese implantiert wurde (Gruppe B), sinkt die durchschnittliche Punktzahl auf 10,6. Gruppe A n=14 Schmerzen 4.14 (0;6) Mobilität 5.21 (2*;6) 14,14 (8*;18) Gehfähigkeit 4.79 (2*;6) Schmerzen 2,80 (1;5) Mobilität 4.60 (2;6) 10,60 (8;15) Gehfähigkeit 3,20 (2;5) Durchschnitt Score Gruppe B n=5 Durchschnitt Score Zu berücksichtigen ist, dass in Gruppe A ein Patient zusätzlich im Unterschenkel als Unfallfolge amputiert werden musste (mit * markiert). 32
33 4.7.2 Bewegungsumfänge Die Bewegungsumfänge der Gruppe A zeigten sehr gute funktionelle Ergebnisse. Hier konnten 14 Patienten persönlich nachuntersucht werden. Es findet sich lediglich eine Einschränkung der Innenrotation auf der verletzten Seite im Vergleich zur unverletzten Gegenseite. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 90,89% 100,00% 92,59% 40% 30% 83,30% 84,89% Abduktion Adduktion 59,56% 20% 10% 0% Flexion Extension Innerotation Aussenrotation Abb. 15 Gruppe A: Prozentualer Vergleich zur unverletzten Seite. In der Gruppe B konnten 5 Patienten klinisch nachuntersucht werden. 33
34 Mit Ausnahme der Extension sind hier alle Bewegungungsrichtungen mit Einschränkungen behaftet (< 80 % des erreichten Bewegungsumfangs auf der unverletzten Gegenseite). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 100,00% 77,30% 73,33% 71,43% 40% 56,03% 30% 20% 26,19% 10% 0% Flexion Extension Innenrotation Aussenrotation Abduktion Adduktion Abb. 16 Gruppe B: Prozentualer Vergleich zur unverletzten Seite Patientenbasierte Fragebögen SF12 und EQ-5D Die Selbsteinschätzung unserer Patienten bezüglich ihres körperlichen Gesundheitszustandes erbrachte in der Gruppe A ausreichende bis gute Ergebnisse. Die Frage nach Beweglichkeit und der Fähigkeit zur Selbstversorgung ergab gute bis sehr gute Resultate. Konkret gaben in Gruppe A auf die Frage für sich selbst sorgen zu können 56% der Patienten an, keine Probleme zu haben. Dagegen waren dies in Gruppe B 40%. Von den 19 befragten Patienten aus Gruppe A gaben 32% an, keinerlei Probleme mit ihrer Beweglichkeit und Mobilität zu haben. Weitere 62% sahen bei sich nur geringe Probleme. Eine Patientin war bettlägerig. In Gruppe B gaben alle Patienten Beweglichkeit/Mobilität an. 34 größere Probleme bei der
35 Die Frage nach der Fähigkeit allgemeine Tätigkeiten zu verrichten (Bsp: Hausarbeit, Familien- und Freizeitaktivitäten), beantworteten in Gruppe A 28% damit keine Probleme zu haben. In Gruppe B waren dies 0%. In A gaben 63% an, dabei einige Probleme zu haben, in Gruppe B 100%. Die Tabelle im Anhang 9.4 zeigt durchschnittliche Werte für SF12 und EQ-5D gesamt und in den Subkollektiven. 4.8 Radiologische Ergebnisse Roof arc präoperativ Zur Auswertung kamen die präoperativen Röntgenaufnahmen aller 48 Patienten. Der durchschnittliche Roof arc betrug 20 (min 0; max 60 ). Von großer klinischer Bedeutung ist die Beurteilung des Roof arcs hinsichtlich der Überschreitung der 45 Grenze. In 42 Fällen wurde ein Winkel unter 45 gemessen. In 6 Fällen war der roof arc größer oder gleich Coxarthrose nach Helfet Aus Gruppe A (Osteosythese, keine Hüft TEP im Verlauf) konnten 14 Röntgenaufnahmen ausgewertet werden, die mindestens zwei Jahre nach der unfallchirurgischen Versorgung angefertigt wurden. Dabei sahen wir bei 11 der 14 Patienten keine Verschlechterung der röntgenologischen Kriterien nach Helfet des betroffenen Hüftgelenks im Vergleich zur gesunden Gegenseite. Lediglich bei 3 Patienten wurde eine Verschlechterung um ein Stadium beobachtet. 35
36 4.9 Zeitpunkt der Implantation einer sekundären Hüft TEP Bei insgesamt 9 Patienten war die Implantation einer sekundären Hüfttotalendoprothese notwendig geworden (Gruppe B). Darunter waren 7 aus der Gruppe der primär operativ versorgten und zwei konservativ behandelte Patienten. Die Zeitperiode zwischen Unfallereignis und TEP Implantation betrug im Mittel 6 Monate (min 2, max 10). 7,5 operativ 5,8 konservativ Monate Abb. 17 Darstellung des durchschnittlichen Zeitpunktes der Implantation einer sekundären Hüft TEP nach dem Unfall in den Gruppen operativ vs. konservativ. Zusammenfassung der Ergebnisse: Es konnten 48 Patienten in die Nachuntersuchung einbezogen werden. In 39 Fällen wurde eine operative Rekonstruktion durchgeführt, die übrigen 9 Patienten erhielten einen konservativen Therapieansatz. Zur Auswertung wurde das Gesamtkollektiv unterteilt in Gruppe A (mit sekundärer Hüft TEP, n=39) und Gruppe B (ohne sekundäre Hüft TEP, n=9). 36
37 32 Patienten konnten mittels Fragebögen nachuntersucht werden, von ihnen wurden 19 zusätzlich klinisch untersucht. Die Unfallursache war in 23 Fällen ein häuslicher Sturz, bei 11 Patienten ein Sturz aus einer Höhe >1m. In 83% fand sich eine Mitbeteiligung des vorderen Pfeilers. Der Merle d Aubigné Score ergab für Gruppe A 14,1 von 18, für Gruppe B 10,6 von 18 Punkten. Im SF12 Fragebogen beantworteten 56% der Patienten aus Gruppe A die Frage für sich selbst sorgen zu können damit keine Probleme zu haben. In der Gruppe B taten dies 40%. Bei den Bewegungsumfängen sahen wir bei den Patienten ohne sekundären Hüftgelenkersatz nur eine wesentliche Einschränkung in der Innenrotation. Mit Ausnahme der in beiden Gruppen unbeeinflussten Extension sind nach sekundärer Hüft TEP alle Bewegungungsrichtungen mit Einschränkungen behaftet. 37
38 5. Diskussion Bei der Versorgung von Patienten mit Acetabulumfrakturen nimmt die Gruppe der über 60jährigen eine Sonderstellung ein. In diesem Patientenkollektiv sind Faktoren wie Komorbidität, osteoporotisch geschwächte Knochenstruktur und verminderte physiologische Reserve von entscheidender prognostischer Bedeutung (Donegan et al., 2010). Umso wichtiger ist die Wahl des am besten geeigneten Therapiekonzeptes. Bei der Indikationsstellung im eigenen Patientenkollektiv (konservativ vs. operativ) wurden zunächst die gleichen Kriterien berücksichtigt, die auch bei jüngeren Patienten mit Acetabulumfrakturen zur Anwendung kommen (Culemann, Tosounidis & Pohlemann, 2005). Auch beim älteren Patienten wird dabei die konservative Therapie angestrebt. Voraussetzung dafür sind undislozierte Frakturen mit fehlender Luxationstendenz und eine gute Zentrierung des Hüftkopfes mit guter Überdachung. Die Bestimmung des Pfannendachwinkels nach Matta ist ein weiters Kriterium für ein konservatives Vorgehen (Matta, Anderson et al., 1986), welches dann möglich ist, wenn die erste zu messende Frakturlinie in allen 3 Projektionen (Ap-, Ala-, Obturatoraufnahme) außerhalb der 45 Grenze liegt. Unbedingt zu berücksichtigen ist jedoch die Tatsache, dass das konservative Vorgehen keineswegs frei von Komplikationen ist. So fand Spencer bei 25 konservativ behandelten Patienten in 30% ein inakzeptables Ergebnis, obwohl 17 dieser Patienten eine völlig undislozierte Acetabulumfraktur hatten (Spencer, 1989). Im Alter bedeutet eine längerfristige Immobilisierung häufig ein Verlust an physiologischer Reserve und damit eine schlechtere Prognose. 38
39 Auch die Differenzierung der operativen Versorgungsstrategie ist in der Literatur Diskussionsgegenstand. Dabei ist die Option, die Acetabulumfraktur mit einem primären endoprothetischen Hüftgelenkersatz zu versorgen, kritisch bewertet worden. Bei einer Nachuntersuchung von 53 Patienten, die nach einer Acetabulumfraktur einen endoprothetischen Hüftgelenkersatz erhielten, fand Romness in über 50% eine Lockerung der Pfanne in einem Nachbeobachtungszeitraum von 7 Jahren (Romness & Lewallen, 1990). Hier ist zu berücksichtigen, dass zur suffizienten Fixierung einer primären Prothese die Stabilität des vorderen Pfeilers vorausgesetzt werden muss. Gerade aber der vordere Pfeiler ist bei den älteren Patienten überdurchschnittlich häufig frakturiert und somit instabil (Ochs et al., 2010). Wenn damit eine kombinierte Osteosynthese des vorderen Pfeilers mit primärem Hüftgelenkersatz notwendig wird, muss mit einer deutlich verlängerten Operationszeit und einem aufwendigeren Rekonstruktionsverfahren gerechnet werden (Boraiah, Ragsdale, Achor, Zelicof & Asprinio, 2009; Ochs et al., 2010). Wenn im eigenen Patientengut ein konservatives Vorgehen nicht möglich war, wurde offen reponiert und die Fraktur mit einer Osteosythese rekonstruiert. Dabei wird die Stabilisierung des Acetabulums dadurch erreicht, dass lange infra- und supraacetabuläre Schrauben gelenknah gesetzt werden und somit beide Pfeiler biomechanisch verbunden sind (Culemann et al., 2010; Culemann, Marintschev, Gras & Pohlemann, 2011). Betrachtet man die Art der Fraktur nach der Klassifikation nach Judet und Letounel, so findet sich in der vorliegenden Nachuntersuchung eine Beteiligung des vorderen Pfeilers in 83% der Fälle. Von 48 Patienten hatten 15 eine einfache Fraktur des vorderen Pfeilers, unter den kombinierten Frakturtypen hatten 20 eine vordere Pfeilerfraktur mit hinterer Hemiquerfraktur und 5 Patienten erlitten Zweipfeilerfrakturen. In einer epidemiologischen Studie konnten Ferguson et al. die Häufung der Beteiligung des vorderen Pfeilers in der Altersgruppe der über 60-Jährigen ebenfalls nachweisen (Ferguson et al., 2009). In einer großen 39
40 retrospektiven Untersuchung im Rahmen der Arbeitsgruppe Becken der DGU/AO konnten Ochs et al ebenfalls die überdurchschnittlich häufige Beteiligung dieses Acetabulumanteils bei den Frakturen der älteren Patienten feststellen (Ochs et al., 2010). Die Ursache hierfür ist im altersbedingten Unterschied des Unfallmechanismus zu sehen. Anders als bei jüngeren Patienten ist die Acetabulumfraktur hier häufig Folge eines niedrig energetischen Traumas, wie etwa eines Sturzes im häuslichen Umfeld direkt auf die betroffene Seite. Dabei wirkt die Kraft von lateral auf das häufig gestreckte Bein und damit, bedingt durch die Anteversionsstellung des Schenkelhalses auf die ventralen Acetabulumanteile (Hessmann, Nijs & Rommens, 2002; Rommens & Hessmann, 1999). Auch in dieser Nachuntersuchung stellen die häuslichen Stürze mit 47,9% den größten Anteil am Unfallmechanismus. Weitere 27,1 % waren Verkehrsunfälle und 23% Stürze aus einer Höhe > 1m. Zur Darstellung des funktionellen Ergebnisses wurde in der vorliegenden Nachuntersuchung das Schema nach Merle d Aubigné angewendet. Dabei fließen sowohl subjektive als auch objektive Messgrößen in die Bewertung ein. Es sind die Faktoren mit der höchsten Praxisrelevanz für die Patienten - nämlich Schmerzen, Hüftbeweglichkeit und Gehfähigkeit. Wir fanden unter den Patienten nach offener Reposition und interner Fixation dann ein schlechteres funktionelles Gesamtergebnis, wenn im Verlauf der Nachuntersuchungsperiode eine sekundäre Hüft TEP implantiert werden musste (14,1 vs. 10,6 von 18 möglichen Punkten). Das bessere Ergebnis der Gruppe A, also denjenigen mit Rekonstruktion ohne sekundärer Hüft TEP, wird in allen Teilbereichen erzielt (Schmerzen: Gruppe A 4,14 - Gruppe B 2,8; Mobilität/Beweglichkeit Gruppe A 5,21 Gruppe B 4,6; Gehfähigkeit Gruppe A 4,79 - Gruppe B 3,2). Hier deutet sich an, dass ein unbefriedigendes Ergebnis innerhalb der ersten beiden Jahre nicht mehr durch die Implantation einer Hüft TEP kompensiert werden kann. 40
41 Im eigenen Patientengut mussten bei 7 von 39 operativ versorgten Acetabulumfrakturen im Verlauf eine sekundäre Hüfttotalendoprothese nach durchschnittlich 6 Monaten implantiert werden. Dies entspricht einem Anteil von 18%. In einer neueren Untersuchung aus dem Jahr 2010 an 93 operierten Patienten mit dem Mindestalter 55, war bei Carroll in 30% der Fälle die Versorgung mit Hüft TEP notwendig (Carroll et al., 2010). Die Fragebögen SF12 und EQ-5D sind als Methode zur Evaluation in der Beckenchirurgie bisher sehr selten in der Literatur erwähnt. Die Literaturrecherche nach der Anwendung des SF12 in der Becken- und Acetabulumchirurgie erbrachte eine einzige Literaturstelle von Cannada und Barr (Cannada & Barr, 2010). Diese Autoren wendeten den SF12 bei Frauen im geburtsfähigen Alter mit Beckenfrakturen an. In der klinischen Routine ist es nicht möglich, eine präoperative Dokumentation anzulegen. Zum einen würde dies einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand bedeuten, zum anderen könnten die notwendigen Behandlungsund präoperativen Maßnahmen verzögert werden. Deshalb konnten die Ergebnisse unserer Studie nur mit den bereits veröffentlichen Normalwerten bzw. den Werten in einer erkrankten Population verglichen werden (Jenkinson, Chandola, Coulter & Bruster, 2001; Kontodimopoulos, Pappa, Niakas & Tountas, 2007). Die statistische Auswertung der Fragebogenergebnisse erbrachte keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne sekundärer Hüft TEP, auch nicht beim Vergleich zwischen operativer und konservativer Therapie. Der tiefste p-wert von 0.06 wurde für den mentalen Gesundheitsscore erzielt. Hier lassen sich Hinweise auf ein besseres Ergebnis für Patienten nach osteosynthetischer Versorgung ohne die spätere Notwendigkeit eines sekundären Hüftgelenksersatzes erkennen. Beim Vergleich zwischen operativer und konservativer Behandlung, zeigte sich bei den Operierten eine bessere mentale Komponente und bei den konservativ behandelten Patienten eine bessere physische Komponente. 41
42 Die mentale Komponente des SF-12 Scores ergab in unserer Studie einen Durchschnitt von n=47. Damit bewerteten sich unsere Patienten nur wenig schlechter als der Normalwert für die Bevölkerung in den USA (n=52), aber besser als der von Jenkinson ermittelte Wert für chronische Erkrankungen, welche die täglichen Aktivitäten einschränken (n=43) (Jenkinson et al., 2001). Die Gruppe um Jenkinson erhob ihre Daten aus über Fragebögen im Vereinigten Königreich (UK). Dabei fanden sie für chronische Erkrankungen ohne Einschränkung der täglichen Aktivitäten einen Wert von 50 ebenso beim Fehlen von Erkrankungen. Für Patienten mit Knie- und Hüftproblemen gibt es für die mentale Komponente in der Literatur Angaben von Kontodimopoulos (Kontodimopoulos et al., 2007). Demnach erzielen solche Patienten einen Wert von n=45. Patienten ohne diese Probleme erreichen n=49. Insofern ist unser Ergebnis für die mentale Komponente zu den Angaben in der Literatur kongruent. Bei der physischen Komponente ergab sich in unserem Nachuntersuchungskollektiv ein Wert von n=35, dies ist weniger als der Normalwert in den USA (n=44) und tiefer als der von Kontodimopoulos ermittelte Durchschnitt in der griechischen Bevölkerung (Kontodimopoulos et al., 2007). In Jenkinsons Studie aus UK ergab sich für Patienten mit chronischen Erkrankungen, welche die tägliche Aktivität einschränken, ebenfalls ein Wert von n=35, welcher dem Ergebnis dieser Untersuchung entspricht. Hier ist unbedingt zu berücksichtigen, dass die genannten Studien über allen Altersgruppen im Erwachsenenalter entstanden sind und die physische Komponente gemäß den Richtlinien für die Interpretation des SF-12 im höheren Alter abnimmt. Insofern kann man die erzielten Ergebnisse als gut betrachten. Der in dieser Nachuntersuchung gefundene EQ-5D Wert beträgt 0,525. Im Jahr 2007 berichteten Madhu et al. von einem EG-5D Wert von 0,6 bei Patienten mit isolierten Beckenfrakturen (Madhu, Raman & Giannoudis, 2007). Eine andere Langzeitnachuntersuchung von Raman at al. weist einen Wert von 0,49 für ein Subkollektiv von 32 Patienten nach Acetabulumfrakturen auf (Raman, Senior, 42
43 Segura & Giannoudis, 2004). Man erkennt hier, dass die Ergebnisse unserer Patientengruppe denen anderer in der Literatur veröffentlichten Nachuntersuchungen entsprechen, und somit die Lebensqualität der Patienten nach Acetabulumfrakturen korrekt abbilden. Fazit: Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die klinischen Ergebnisse von Patienten, älter als 60 Jahre, mit Acetabulumfrakturen zu erfassen und zu bewerten. Insbesondere sollte auch ein Beitrag zur Klärung der Frage geleistet werden, ob das an Wiederherstellungschirurgie der Klinik für Unfall-, des Universitätsklinikums Handdes und Saarlandes angewendete Therapiekonzept der primären osteosynthetischen Rekonstruktion auch bei Patienten im höheren Lebensalter sinnvoll ist. Man findet insgesamt in der vorliegenden Nachuntersuchung gute bis sehr gute klinische Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass auch bei älteren Menschen die primäre osteosynthetische Versorgung zur Anwendung kommen sollte, und dass bei der Indikationsstellung zum operativen Eingriff die gleichen Kriterien wie bei jüngeren Patienten angewendet werden können. Da in Zukunft mit steigenden Fallzahlen von Acetabulumfrakturen bei älteren Patienten zu rechnen ist, wird es notwendig sein, weitere, auch größere Studien durchzuführen, um das Osteosyntheseverfahren weiter vergleichend gegen die Primärprothese zu bewerten. 43
44 6. Literaturverzeichnis 1. Antapur P, Mahomed N, Gandhi R (2011). Fractures in the elderly: when is hip replacement a necessity? Clin Interv Aging, 6: Boraiah S, Ragsdale M, Achor T, Zelicof S, Asprinio DE (2009). Open reduction internal fixation and primary total hip arthroplasty of selected acetabular fractures. J Orthop Trauma, 23: Cannada LK, Barr J (2010). Pelvic fractures in women of childbearing age. Clin Orthop Relat Res, 468: Carroll EA, Huber FG, Goldman AT, Virkus WW, Pagenkopf E, Lorich DG, et al. (2010). Treatment of acetabular fractures in an older population. J Orthop Trauma, 24: Culemann U, Holstein JH, Kohler D, Tzioupis CC, Pizanis A, Tosounidis G, et al. (2010). Different stabilisation techniques for typical acetabular fractures in the elderly - a biomechanical assessment. Injury, 41: Culemann U, Marintschev I, Gras F, Pohlemann T (2011). Infra-acetabular corridor-technical tip for an additional screw placement to increase the fixation strength of acetabular fractures. J Trauma, 70: Culemann U, Tosounidis G, Pohlemann T (2005). Fractures of the acetabulum - treatment strategies and actual diagnostics. Zentralbl Chir, 130:W D'Aubigne RM, Postel M (1954). Functional results of hip arthroplasty with acrylic prosthesis. J Bone Joint Surg Am, 36-A: Das S, Forrest K, Howell S (2010). General anaesthesia in elderly patients with cardiovascular disorders: choice of anaesthetic agent. Drugs & Aging, 27: Donegan DJ, Gay AN, Baldwin K, Morales EE, Esterhai JL Jr, Mehta S (2010). Use of medical comorbidities to predict complications after hip fracture surgery in the elderly. J Bone Joint Surg Am, 92: Ferguson TA, Patel R, Bhandari M, Matta JM (2009). Fractures of the acetabulum in patients aged 60 years and older: an epidemiological and radiological study. J Bone Joint Surg Br, 92:
45 12. Gorczyca JT, Powell JN, Tile M (1995). Lateral extension of the ilioinguinal incision in the operative treatment of acetabulum fractures. Injury, 26: Hesp WL, Goris RJ (1988). Conservative treatment of fractures of the acetabulum. Results after longtime follow-up. Acta Chir Belg, 88: Hessmann MH, Nijs S, Rommens PM (2002). Acetabular fractures in the elderly. Results of a sophisticated treatment concept. Unfallchirurg, 105: Jenkinson C, Chandola T, Coulter A, Bruster S (2001). An assessment of the construct validity of the SF-12 summary scores across ethnic groups. J Public Health Med, 23: Judet R, Judet J, Letournel E (1964). Fractures of the Acetabulum: Classification and Surgical Approaches for Open Reduction. Preliminary Report. J Bone Joint Surg Am, 46: Kontodimopoulos N, Pappa E, Niakas D, Tountas Y (2007). Validity of SF12 summary scores in a Greek general population. Health Qual Life Outcomes, 5: Kuhl HC, Farin E, Follert P (2004). Die Messung von Rehabilitationsergegebnissen mit dem IRES und dem SF-12 - Vor- und Nachteile unterschiedlich umfangreicher Erhebungsinstrumente in der Qualitätssicherung. Phys Med Reha Kuror, 14: Kuner EH (1997). Indication, technique and complications in the surgical treatment of acetabular fractures. Orthopade, 26: Laird A, Keating JF (2005). Acetabular fractures: a 16-year prospective epidemiological study. J Bone Joint Surg Br, 87: Letournel E (1984). Lateral approach in the treatment of acetabular fractures. Acta Orthop Belg, 50: Letournel E (1994). Fractures of the acetabulum. A study of a series of 75 cases Clin Orthop Relat Res, Madhu TS, Raman R, Giannoudis PV (2007). Long-term outcome in patients with combined spinal and pelvic fractures. Injury, 38: Matta JM, Anderson LM, Epstein HC, Hendricks P (1986). Fractures of the acetabulum. A retrospective analysis. Clin Orthop Relat Res,
46 25. Matta JM, Mehne DK, Roffi R (1986). Fractures of the acetabulum. Early results of a prospective study. Clin Orthop Relat Res, Ochs BG, Marintschev I, Hoyer H, Rolauffs B, Culemann U, Pohlemann T, et al. (2010). Changes in the treatment of acetabular fractures over 15 years: Analysis of 1266 cases treated by the German Pelvic Multicentre Study Group (DAO/DGU). Injury, 41: Raman R, Senior C, Segura P, Giannoudis PV (2004). Management of scrotal swelling after pelvic and acetabular fractures. Br J Nurs, 13: Reinert CM, Bosse MJ, Poka A, Schacherer T, Brumback RJ, Burgess AR (1988). A modified extensile exposure for the treatment of complex or malunited acetabular fractures. J Bone Joint Surg Am, 70: Richter H, Hutson JJ, Zych G (2004). The use of spring plates in the internal fixation of acetabular fractures. J Orthop Trauma, 18: Rommens PM, Hessmann MH (1999). Acetabulum fractures. Unfallchirurg, 102: Romness DW, Lewallen DG (1990). Total hip arthroplasty after fracture of the acetabulum. Long-term results. J Bone Joint Surg Br, 72: Routt ML Jr., Swiontkowski MF (1990). Operative treatment of complex acetabular fractures. Combined anterior and posterior exposures during the same procedure. J Bone Joint Surg Am, 72: Spencer RF (1989). Acetabular fractures in older patients. J Bone Joint Surg Br, 71: Tannast M, Kruger A, Mack PW, Powell JN, Hosalkar HS, Siebenrock KA (2010). Surgical dislocation of the hip for the fixation of acetabular fractures. J Bone Joint Surg Br, 92: Tile M HD, Kellam JF et al. (1995). Comprehensive Classification of Fractures in the Pelvis and Acetabulum. Berne: Maurice E. Müller Foundation 36. Tscherne HPT (1998). Unfallchirurgie, Becken und Acetabulum. Berlin Heidelberg New York: Springer 46
47 7. Publikation und Danksagung Publikation: Tosounidis G, Culemann U, Bauer M, Holstein JH, Garcia P, Kurowski R, Pizanis A, Aghayev E, Pohlemann T (2011). Osteosynthese bei Acetabulumfrakturen im Alter. Ist eine Rekonstruktion sinnvoll? Der Unfallchirurg, 114: Danksagung: Zuerst möchte ich Herrn Professor Dr. med. T. Pohlemann, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg/Saar, als meinem Doktorvater für die Überlassung des Themas danken. Ich bedanke mich bei allen Patienten der Studie, die das Gelingen der Arbeit erst ermöglicht haben. Herzlich danken möchte ich auch meinen Betreuern Herrn Dr. G. Tosounidis und Herrn PD Dr. U. Culemann, die stetes bereit waren, mir mit wichtigem und hilfreichem Rat zur Seite zu stehen. Meinen Eltern danke ich für die fortlaufende Unterstützung und dafür, dass sie mir die Möglichkeit gaben diesen Beruf zu ergreifen. 47
48 9. Anhang 9.1 SF 12 48
5 Nachuntersuchung und Ergebnisse
 Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Therapie bei ipsilateraler Hüft- u. Knie-TEP Anzahl n HTEP-Wechsel Femurtotalersatz konservative Therapie Diagramm 4: Verteilung der Therapieverfahren bei ipsilateraler HTEP und KTEP 4.7. Komplikationen
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W.
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Martin-Luther-Universität Halle Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Otto Behandlungsergebnisse von Tibiakopffrakturen in Abhängigkeit
Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3
![Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3 Patienten Prozent [%] zur Untersuchung erschienen 64 65,3](/thumbs/98/135702962.jpg) 21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
21 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Ergebnisse 4.1.1 Untersuchungsgruppen In einer prospektiven Studie wurden die Patienten erfasst, die im Zeitraum von 1990 bis 1994 mit ABG I- und Zweymüller SL-Hüftendoprothesen
Sakrumfraktur und Osteoporose
 Die Ursache der Sakrumfrakturen stellen im allgemeinen Hochrasanzunfälle dar, wie sie im Straßenverkehr bei Fußgängern oder bei Stürzen aus größerer Höhe auftreten. Hierbei stellt die Sakrumfraktur einen
Die Ursache der Sakrumfrakturen stellen im allgemeinen Hochrasanzunfälle dar, wie sie im Straßenverkehr bei Fußgängern oder bei Stürzen aus größerer Höhe auftreten. Hierbei stellt die Sakrumfraktur einen
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Notwendigkeit von abgefragten Parametern
 Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Informationsveranstaltung Qualitätssicherung Unfallchirurgie / Orthopädie Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart Notwendigkeit von abgefragten Parametern Prof. Dr. Hanns-Peter-Scharf Orthopädische Universitätsklinik
Klassifikation von Azetabulumfrakturen
 Klassifikation von Azetabulumfrakturen Manfred Römer, Bernd Wittner Zusammenfassung Die Frakturmorphologie der Azetabulumfrakturen ist sehr vielfältig, entsprechend komplex ist die Klassifikation dieser
Klassifikation von Azetabulumfrakturen Manfred Römer, Bernd Wittner Zusammenfassung Die Frakturmorphologie der Azetabulumfrakturen ist sehr vielfältig, entsprechend komplex ist die Klassifikation dieser
Femoroacetabuläres Impingement
 Femoroacetabuläres Impingement Femoroacetabuläres Impingement Einklemmung zwischen den beiden Gelenkpartnern des Hüftgelenks Femur Acetabulum Ausgelöst entweder durch zu viel Knochen am Femur oder Acetabulum
Femoroacetabuläres Impingement Femoroacetabuläres Impingement Einklemmung zwischen den beiden Gelenkpartnern des Hüftgelenks Femur Acetabulum Ausgelöst entweder durch zu viel Knochen am Femur oder Acetabulum
Endoprothetik / Gelenkersatz
 Endoprothetik / Gelenkersatz Die Anzahl der orthopädischen Erkrankungen wird in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des demographischen Wandels mit steigender Lebenserwartung aber auch infolge zivilisationsbedingter
Endoprothetik / Gelenkersatz Die Anzahl der orthopädischen Erkrankungen wird in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des demographischen Wandels mit steigender Lebenserwartung aber auch infolge zivilisationsbedingter
Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff?
 Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Definition. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin Typische Ursachen
 Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Definition Der Oberschenkelknochen besteht aus vier Anteilen: dem Kniegelenk, dem Schaft, dem Hals und dem Kopf, der zusammen mit dem Beckenknochen das Hüftgelenk bildet. Bei einem Oberschenkelhalsbruch
Zusammenfassung. 5 Zusammenfassung
 5 Zusammenfassung Die Diskussion über den optimalen Operationszeitpunkt der frakturierten Hüfte wird seit langem kontrovers geführt. Ziel dieser Arbeit war zu überprüfen, ob die in Deutschland derzeit
5 Zusammenfassung Die Diskussion über den optimalen Operationszeitpunkt der frakturierten Hüfte wird seit langem kontrovers geführt. Ziel dieser Arbeit war zu überprüfen, ob die in Deutschland derzeit
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Medizin
 Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
Aus der Universitätsklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. W. Hein) Morbus Scheuermann: Klinische und radiologische
3. Ergebnisse Geschlechts- und Altersverteilung
 23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
23 3. Ergebnisse 3.1. Geschlechts- und Altersverteilung In der vorliegenden Studie wurden 100 übergewichtige Patienten mittels Gastric Banding behandelt, wobei es sich um 22 männliche und 78 weibliche
Definition. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann der Bruch folgende vier Knochenanteile betreffen: = Schultergelenkanteil des Oberarms
 Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Definition Die proximale Humerusfraktur ist ein Bruch des schulternahen Oberarmknochens, der häufig bei älteren Patienten mit Osteoporose diagnostiziert wird. Entsprechend der Anatomie des Oberarms kann
Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart
 Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart Traumaversorgung rund um die Hüfte E. Ramms, Assistenzärztin Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Traumaversorgung rund ums
Fortbildung für Rettungsdienst- Mitarbeiter Sana Klinik Bethesda Stuttgart Traumaversorgung rund um die Hüfte E. Ramms, Assistenzärztin Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Traumaversorgung rund ums
Der Sturz im Alter. Klinik für Unfall-, Hand und Wiederherstellungschirurgie. Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz
 Der Sturz im Alter Klinik für Unfall-, Hand und Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz Der Sturz im Alter Deutschland bis 2050 Statistisches Bundesamt 2007 Frakturen im Alter Kombination aus 2 Faktoren!
Der Sturz im Alter Klinik für Unfall-, Hand und Direktor: Prof. Dr. Steffen Ruchholtz Der Sturz im Alter Deutschland bis 2050 Statistisches Bundesamt 2007 Frakturen im Alter Kombination aus 2 Faktoren!
Wiederaufweitung des Spinalkanales. Prozent der normalen Spinalkanalweite
 23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
23 3 Ergebnisse Die ermittelten Daten bezüglich der werden anhand von Tabellen und Graphiken dargestellt und auf statistische Signifikanz geprüft. In der ersten Gruppe, in der 1 Wirbelfrakturen mit präoperativem
Unfallchirurgischer Alltag
 Die chirurgische Versorgung hüftnaher Frakturen: Therapieoptionen und Behandlungsziele Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas HAUSNER 1,2,3 (1) UKH Lorenz Böhler, Unfallchirurgie, Wien (2) Ludwig Boltzmann Institut
Die chirurgische Versorgung hüftnaher Frakturen: Therapieoptionen und Behandlungsziele Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas HAUSNER 1,2,3 (1) UKH Lorenz Böhler, Unfallchirurgie, Wien (2) Ludwig Boltzmann Institut
3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben
 3. ERGEBNISSE 3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben In der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
3. ERGEBNISSE 3.1 Patientenzahlen, Altersverteilung, allgemeine Angaben In der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005
 Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der unteren Extremität SS 2005 Prof.
Hauptvorlesung Unfallchirurgie SS 2005 Prof. Dr. med. C. Krettek, FRACS Direktor der Unfallchirurgischen Klinik der MHH Hauptvorlesung Unfallchirurgie Verletzungen der unteren Extremität SS 2005 Prof.
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
4. Diskussion Das Ziel der Behandlung der Azetabulumfrakturen ist die Wiederherstellung der schmerzlosen, freien Beweglichkeit des Hüftgelenkes mit
 44 4. Diskussion Das Ziel der Behandlung der Azetabulumfrakturen ist die Wiederherstellung der schmerzlosen, freien Beweglichkeit des Hüftgelenkes mit voller Belastbarkeit. Als Gelenkfrakturen unterliegen
44 4. Diskussion Das Ziel der Behandlung der Azetabulumfrakturen ist die Wiederherstellung der schmerzlosen, freien Beweglichkeit des Hüftgelenkes mit voller Belastbarkeit. Als Gelenkfrakturen unterliegen
Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt.
 3 Ergebnisse 3.1 Ergebnisse der Nachuntersuchung Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt. 3.1.1 Bewegungsumfänge Das Winkelmaß des
3 Ergebnisse 3.1 Ergebnisse der Nachuntersuchung Im Folgenden werden die während der Nachuntersuchungen ermittelten Daten der beiden Studiengruppen dargestellt. 3.1.1 Bewegungsumfänge Das Winkelmaß des
Inzidenz 1998 : 5 8 % aller Frakturen
 Die Beckenverletzung nimmt über die letzten 150 Jahre an Häufigkeit zu! Inzidenz ~ 1900 : < 1 % aller Frakturen Inzidenz 1998 : 5 8 % aller Frakturen H.Tscherne, T.Pohlemann (Hrsg.) : Becken und Acetabulum,
Die Beckenverletzung nimmt über die letzten 150 Jahre an Häufigkeit zu! Inzidenz ~ 1900 : < 1 % aller Frakturen Inzidenz 1998 : 5 8 % aller Frakturen H.Tscherne, T.Pohlemann (Hrsg.) : Becken und Acetabulum,
Langzeitergebnisse der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Spina bifida H. Wolko, D. Class, R. Firsching Universitätsklinik für Neurochirurgie
 1 Langzeitergebnisse der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Spina bifida H. Wolko, D. Class, R. Firsching Universitätsklinik für Neurochirurgie 2 Gliederung Kindheit vs. Erwachsenenalter Veränderungen
1 Langzeitergebnisse der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Spina bifida H. Wolko, D. Class, R. Firsching Universitätsklinik für Neurochirurgie 2 Gliederung Kindheit vs. Erwachsenenalter Veränderungen
Traumatologie am Schultergürtel
 Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Traumatologie am Schultergürtel 54 instruktive Fälle Bearbeitet von Rainer-Peter Meyer, Fabrizio Moro, Hans-Kaspar Schwyzer, Beat René Simmen 1. Auflage 2011. Buch. xvi, 253 S. Hardcover ISBN 978 3 642
Wie ist der Verletzungsmechanismus bei der VKB- Ruptur?
 Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch www.gelenkchirurgie.ch Riss
Praxis für Orthopädie Dr. med. Karl Biedermann Facharzt FMH für orthopädische Chirurgie Central Horgen Seestrasse 126 CH 8810 Horgen Tel. 044 728 80 70 info@gelenkchirurgie.ch www.gelenkchirurgie.ch Riss
Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn?
 Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn? Dr. med. Alexander Eickhoff Assistenzarzt Bevölkerungsentwicklung 60 % Stürze ca. 6 Mio. p. a. > 30% der über 65 Jährigen betroffen 10 % behandlungsbedürftige
Teilbelastung nach hüftgelenksnaher Fraktur- Sinn oder Unsinn? Dr. med. Alexander Eickhoff Assistenzarzt Bevölkerungsentwicklung 60 % Stürze ca. 6 Mio. p. a. > 30% der über 65 Jährigen betroffen 10 % behandlungsbedürftige
Mitralklappen-Clipping bei Hochrisikopatienten mit degenerativer oder funktioneller Mitralklappeninsuffizienz
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten
 4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
Navigation - Klinische Ergebnisse
 AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
AE-Kurs Knie Ofterschwang Pleser M, Wörsdörfer O. Klinikum Fulda gag A. Gesamtergebnisse Fulda B. Navitrack TM -Multicenterstudie (Teilergebnisse Fulda) C. Ergebnisse: randomisierte Studie zum Einfluss
2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft November 2013, Hamburg
 Klinikum rechts der Isar 2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft 29. 30. November 2013, Hamburg Periprothetische Frakturen des Kniegelenkes Indikationen zum Knie TEP-Wechsel R. von Eisenhart-Rothe,
Klinikum rechts der Isar 2. Jahreskongress der Deutschen Kniegesellschaft 29. 30. November 2013, Hamburg Periprothetische Frakturen des Kniegelenkes Indikationen zum Knie TEP-Wechsel R. von Eisenhart-Rothe,
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Gesundheitsbezogene Lebensqualität, körperliche Beschwerden, psychische Komorbidität und Interventionen bei Dyspepsie
 Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
DIE DISTALE RADIUSFRAKTUR BEIM ÄLTEREN MENSCHEN. Konservativ behandeln oder operieren?
 DIE DISTALE RADIUSFRAKTUR BEIM ÄLTEREN MENSCHEN Konservativ behandeln oder operieren? Jochen, Miriam Kalbitz, Florian Gebhard Die distale Radiusfraktur ist die häufigste Fraktur des älteren Patienten.
DIE DISTALE RADIUSFRAKTUR BEIM ÄLTEREN MENSCHEN Konservativ behandeln oder operieren? Jochen, Miriam Kalbitz, Florian Gebhard Die distale Radiusfraktur ist die häufigste Fraktur des älteren Patienten.
Typische Ursachen. Symptomatik
 Definition Der Unterschenkelbruch bezeichnet den gemeinsamen Knochenbruch von Schienund Wadenbein. Natürlich können Schienbein und Wadenbein auch isoliert gebrochen sein. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin
Definition Der Unterschenkelbruch bezeichnet den gemeinsamen Knochenbruch von Schienund Wadenbein. Natürlich können Schienbein und Wadenbein auch isoliert gebrochen sein. Zeichnung: Hella Maren Thun, Grafik-Designerin
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes
 Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
Die Verletzungen und Brüche des Oberarmes Bruch des körpernahen Oberarmes (proximale Humerusfraktur) Etwa 5% aller Knochenbrüche im Erwachsenenalter und 4% bei Kindern und Jugendlichen, betreffen den körpernahen
Qualitätssicherung im Modul 17/1 und 17/2 - ein Vergleich
 Qualitätssicherung im Modul 17/1 und 17/2 - ein Vergleich Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Kreiskrankenhaus Backnang Dr.med I.P..Hoellen Gemeinsames der Module 17/1 und 17/2 Altersabhängig
Qualitätssicherung im Modul 17/1 und 17/2 - ein Vergleich Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Kreiskrankenhaus Backnang Dr.med I.P..Hoellen Gemeinsames der Module 17/1 und 17/2 Altersabhängig
Die hintere Kreuzbandläsion Indikationen zur konservativen und operativen Therapie
 Die hintere Kreuzbandläsion Indikationen zur konservativen und operativen Therapie L.-P. Götz Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam Anatomie und Biomechanik
Die hintere Kreuzbandläsion Indikationen zur konservativen und operativen Therapie L.-P. Götz Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam Anatomie und Biomechanik
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 7 Ergebnisse der Titangruppe Von den 46 Patienten, die ein Titancage als Distanzhalter erhielten, waren 26 männlich (56,5%) und 20 weiblich (43,5%). Auch bei diesen wurde eine Einteilung in 6 Altersgruppen
7 Ergebnisse der Titangruppe Von den 46 Patienten, die ein Titancage als Distanzhalter erhielten, waren 26 männlich (56,5%) und 20 weiblich (43,5%). Auch bei diesen wurde eine Einteilung in 6 Altersgruppen
7 Ergebnisse 7.1 Ergebnisse der Anamnesebögen und der Patientenbefragungen
 7 Ergebnisse 7.1 Ergebnisse der Anamnesebögen und der Patientenbefragungen Die Operationsverfahren nach und wurden in beiden Einrichtungen (Orthopädische Klinik Ohrdruf, Orthopädische Gemeinschaftspraxis
7 Ergebnisse 7.1 Ergebnisse der Anamnesebögen und der Patientenbefragungen Die Operationsverfahren nach und wurden in beiden Einrichtungen (Orthopädische Klinik Ohrdruf, Orthopädische Gemeinschaftspraxis
3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17,8%) am Leben und 88 (82,2%) verstorben (Tab. 3.1.).
 18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation
 Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2014 17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation Qualitätsindikatoren Erstellt am: 19.05.2015-24/2015020001 AQUA Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung
Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2014 17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation Qualitätsindikatoren Erstellt am: 19.05.2015-24/2015020001 AQUA Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung
3 Ergebnisse. 3.1 Klinische Ergebnisse Patientengruppe Zirkonium. Knee-Society-Score
 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Ergebnisse 3.1.1 Patientengruppe Zirkonium Knee-Society-Score Bei den 31 mit einer oberflächenkeramisierten Femurkomponente aus einer Zirkonium-Niob- Legierung versorgten Kniegelenken
3 Ergebnisse 3.1 Klinische Ergebnisse 3.1.1 Patientengruppe Zirkonium Knee-Society-Score Bei den 31 mit einer oberflächenkeramisierten Femurkomponente aus einer Zirkonium-Niob- Legierung versorgten Kniegelenken
Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Hüft-Endoprothesen. Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG
 Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Hüft-Endoprothesen Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG 0 Geschäftsstelle Qualitätssicherung
Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Hüft-Endoprothesen Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel (Modul 17/3) Jahresauswertung 2014 BASISAUSWERTUNG 0 Geschäftsstelle Qualitätssicherung
Die Thrombin-Therapie beim Aneurysma spurium nach arterieller Punktion
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Was ist Arthrose? Thomas Kreuder. Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. am Evangelischen Krankenhaus Witten
 Was ist Arthrose? Thomas Kreuder Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Evangelischen Krankenhaus Witten ARTHROSE IST GELENKVERSCHLEISS Also: Nicht jedes Zipperlein ist gleich Arthrose ABER wenn
Was ist Arthrose? Thomas Kreuder Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Evangelischen Krankenhaus Witten ARTHROSE IST GELENKVERSCHLEISS Also: Nicht jedes Zipperlein ist gleich Arthrose ABER wenn
Klausur Unfallchirurgie
 Klausur Unfallchirurgie 08.03.2010 I) Eine 42-jährige Frau stellt sich nach einem Sturz auf Eisglätte in Ihrer Notaufnahme vor. Welche Aussage zum klinischen Bild ist richtig? 1. Es handelt sich um eine
Klausur Unfallchirurgie 08.03.2010 I) Eine 42-jährige Frau stellt sich nach einem Sturz auf Eisglätte in Ihrer Notaufnahme vor. Welche Aussage zum klinischen Bild ist richtig? 1. Es handelt sich um eine
PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR
 SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
SCHULTER- UND ELLENBOGENCHIRURGIE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR Diagnostik und Therapieentscheidung Tobias Helfen TRAUMA 2 KLINISCHE DIAGNOSTIK 3 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Primär: konventionelles Röntgen in
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft?
 Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Anzahl der OP - Diagnosen
 2 Material und Methoden 2.1 Patientenkollektiv In der Zeit vom 01.01.1988 31.12.2001 sind in der Klinik für Unfall und Wiederherstellungschirurgie des Campus Benjamin Franklin der Charitè zu Berlin, ehemals
2 Material und Methoden 2.1 Patientenkollektiv In der Zeit vom 01.01.1988 31.12.2001 sind in der Klinik für Unfall und Wiederherstellungschirurgie des Campus Benjamin Franklin der Charitè zu Berlin, ehemals
5. Zusammenfassung Patienten Spender. 5.3.Transplantation
 5. Zusammenfassung In der vorliegenden Arbeit wurde die kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantation in der Dünndarmdrainagetechnik mit systemisch und portal venöser Anastomose bei 35 Patienten im Transplantationszentrum
5. Zusammenfassung In der vorliegenden Arbeit wurde die kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantation in der Dünndarmdrainagetechnik mit systemisch und portal venöser Anastomose bei 35 Patienten im Transplantationszentrum
Skiunfälle der Saison 2000/2001
 Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
Skiunfälle der Saison 2000/2001 H. Gläser Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Sportversicherung (ASU Ski) Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2000/2001 läßt wie schon in den vergangenen Jahren
Gegliedertes Weiterbildungsprogramm ZB Spezielle Unfallchirurgie
 Gegliedertes Weiterbildungsprogramm ZB Spezielle Unfallchirurgie KMG Klinikum Güstrow GmbH Friedrich-Trendelenburg-Allee 1 18273 Güstrow Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Chefarzt Dr. med. Gunter
Gegliedertes Weiterbildungsprogramm ZB Spezielle Unfallchirurgie KMG Klinikum Güstrow GmbH Friedrich-Trendelenburg-Allee 1 18273 Güstrow Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Chefarzt Dr. med. Gunter
Bewertung von Qualitätsindikatoren
 Bewertung von Qualitätsindikatoren Seminar TU Berlin Peter Heumann Unfallkrankenhaus Berlin - Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Beispiel : Hüftgelenksnahe Knochenbrüche (Oberschenkelhalsfraktur,
Bewertung von Qualitätsindikatoren Seminar TU Berlin Peter Heumann Unfallkrankenhaus Berlin - Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Beispiel : Hüftgelenksnahe Knochenbrüche (Oberschenkelhalsfraktur,
Chirurgie im Alter. Volker Schumpelick, Stefan Willis
 Volker Schumpelick, Stefan Willis Innerhalb eines Jahrhunderts hat sich die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung verdoppelt, schon heute ist jeder Dritte definitionsgemäû alt, und in 50 Jahren werden
Volker Schumpelick, Stefan Willis Innerhalb eines Jahrhunderts hat sich die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung verdoppelt, schon heute ist jeder Dritte definitionsgemäû alt, und in 50 Jahren werden
17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation
 Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2012 17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation Qualitätsindikatoren Erstellt am: 30.05.2013-24/2013020004 AQUA Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung
Bundesauswertung zum Erfassungsjahr 2012 17/2 Hüft-Endoprothesen- Erstimplantation Qualitätsindikatoren Erstellt am: 30.05.2013-24/2013020004 AQUA Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung
Klausur Unfallchirurgie
 Klausur Unfallchirurgie 07.03.2011 I) Welche Beschreibung der pathologischen Ursache charakterisiert das sog. Klaviertastenphänomen am besten? A) Hochstand des lateralen Schlüsselbeinendes bei Verletzung
Klausur Unfallchirurgie 07.03.2011 I) Welche Beschreibung der pathologischen Ursache charakterisiert das sog. Klaviertastenphänomen am besten? A) Hochstand des lateralen Schlüsselbeinendes bei Verletzung
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. WS 2006/2007, 2. Februar 2007
 Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
Klausur Unfall- und Wiederherstellungschirurgie WS 2006/2007, 2. Februar 2007 Name: Vorname: Matrikelnummer: Bitte tragen Sie die richtigen Antworten in die Tabelle ein. Die Frage X beantworten Sie direkt
TEIL-PROTHESE BEI ARTHROSE DES KNIEGELENKES
 TEIL-PROTHESE BEI ARTHROSE DES KNIEGELENKES SYMPTOME Seit einiger Zeit wissen Sie, dass mit Ihrem Knie etwas nicht stimmt. Sei es nach einer früheren Verletzung oder einer Arthrose aus unbekannten Gründen
TEIL-PROTHESE BEI ARTHROSE DES KNIEGELENKES SYMPTOME Seit einiger Zeit wissen Sie, dass mit Ihrem Knie etwas nicht stimmt. Sei es nach einer früheren Verletzung oder einer Arthrose aus unbekannten Gründen
Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula.
 Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula. J Hallbauer 1,3, K Klos 1, A Gräfenstein 4, F Wipf 5, C Beimel 6, GO Hofmann 1, 2, T Mückley 4 1
Ist Winkelstabilität in jedem Fall vorteilhaft? Eine biomechanische Untersuchung an der distalen Fibula. J Hallbauer 1,3, K Klos 1, A Gräfenstein 4, F Wipf 5, C Beimel 6, GO Hofmann 1, 2, T Mückley 4 1
Erste Studie zur Wundinfektion nach Hautkrebsoperationen in der täglichen Praxis eines Krankenhauses
 Medieninformation 13. März 219, Linz Erste Studie zur Wundinfektion nach Hautkrebsoperationen in der täglichen Praxis eines Krankenhauses Wundinfektionen nach Operationen zählen zu den meist gefürchteten
Medieninformation 13. März 219, Linz Erste Studie zur Wundinfektion nach Hautkrebsoperationen in der täglichen Praxis eines Krankenhauses Wundinfektionen nach Operationen zählen zu den meist gefürchteten
Eignen sich die Klassifikationen von Essex-Lopresti und Sanders für die reliable Einteilung der Kalkaneusfraktur durch verschiedene Ärzte?
 Eignen sich die Klassifikationen von Essex-Lopresti und Sanders für die reliable Einteilung der Kalkaneusfraktur durch verschiedene Ärzte? J. v. Heyden1, N. P. Südkamp2, P. C. Strohm2, F. Mayer3 Zentrum
Eignen sich die Klassifikationen von Essex-Lopresti und Sanders für die reliable Einteilung der Kalkaneusfraktur durch verschiedene Ärzte? J. v. Heyden1, N. P. Südkamp2, P. C. Strohm2, F. Mayer3 Zentrum
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG e.v. German Cardiac Society
 Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Der Oberschenkelhalsbruch
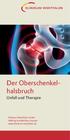 KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
KLINIKUM WESTFALEN Der Oberschenkelhalsbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich
Case-Report K. Perner
 421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
421 Case-Report K. Perner Fall 1: Als Folge einer OS-Fraktur in der Jugend kam es beim Patienten zu einer bajonettförmigen Deformierung des rechten Femurs im proximalen Drittel. Die daraus resultierende
Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung
 Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung 15.11.2018 Google.ch Zu oft zu teuer Operation 42 500 000 in 0.45 Sek!!! Presse: unnötige Eingriffe Aargauer Zeitung 10.7.2017 2015 19451 Hüft TP in der Schweiz
Hüft-TP zu oft? zu teuer? Hausarztfortbildung 15.11.2018 Google.ch Zu oft zu teuer Operation 42 500 000 in 0.45 Sek!!! Presse: unnötige Eingriffe Aargauer Zeitung 10.7.2017 2015 19451 Hüft TP in der Schweiz
Dissertation Zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. W. Hein) Zentrum für Rückenmarkverletzte Am Klinikum
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Orthopädie und Physikalische Medizin An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. W. Hein) Zentrum für Rückenmarkverletzte Am Klinikum
8.2 Nicht parametrische Tests Vergleich CT/2D/3D. Abb. 28 Mann-Whitney-U-Test
 41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
41 8. Interpretationen der Studienergebnisse Im vorliegenden Kapitel werden die Studienergebnisse mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf signifikante Unterschiede untersucht. Hierfür wurden die vorliegenden
Behandlungsstrategie bei Azetabulumfraktur
 Trauma Berufskrankh 2012 14[Suppl 2]:125 134 DOI 10.1007/s10039-012-1861-1 Online publiziert: 24. Mai 2012 Springer-Verlag 2012 T. Pohlemann P. Mörsdorf U. Culemann A. Pizanis Klinik für Unfall-, Hand-
Trauma Berufskrankh 2012 14[Suppl 2]:125 134 DOI 10.1007/s10039-012-1861-1 Online publiziert: 24. Mai 2012 Springer-Verlag 2012 T. Pohlemann P. Mörsdorf U. Culemann A. Pizanis Klinik für Unfall-, Hand-
Osteotomien um das Hüftgelenk. Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern
 Osteotomien um das Hüftgelenk Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern > Beckenosteotomien Hüftdysplasie Acetabuläre Retroversion > Osteotomien
Osteotomien um das Hüftgelenk Martin Beck, Prof. Dr.med.. Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Luzerner Kantonsspital Luzern > Beckenosteotomien Hüftdysplasie Acetabuläre Retroversion > Osteotomien
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 5.5 Patientengruppen Von den 102 Patienten wurden 56 mittels Carboncage und 46 mit Hilfe von Titancages versorgt. Diese beiden Patientengruppen sollen nun erst getrennt voneinander betrachtet und später
5.5 Patientengruppen Von den 102 Patienten wurden 56 mittels Carboncage und 46 mit Hilfe von Titancages versorgt. Diese beiden Patientengruppen sollen nun erst getrennt voneinander betrachtet und später
Von 21 Fraktursystemen in diesem Bereich gehen 23 Berstungsfrakturen aus. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
 6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
6 6 Ergebnisse 6. Ergebnisse aus den Kumulativskizzen 6.. Frakturen mit Zentrum occipipital Occipital sind 4 Fraktursysteme mit 6 Berstungsfrakturen aufgetreten. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufen alle durch
Wenn die Hüfte schmerzt..
 Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
Wenn die Hüfte schmerzt.. von der Spreizhose bis zur Hüftprothese Dr. W. Cordier Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Josef - Wuppertal - Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie Spreizhose Hüftprothese
3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit
 13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
13 3 Ergebnisse 3.1 Klinische Befunde 3.1.1 Alter und Geschlecht in Abhängigkeit von der Überlebenszeit Es wurden die klinischen Daten von 33 Patienten ausgewertet. Es handelte sich um 22 Frauen (66,7
Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun Jahre follow up.
 Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun follow up. E. Heinen, M. Beyer, I. Hellrung, I. Riedner-Walter PRAXIS für ENDOKRINOLOGIE, Nürnberg
Verlauf der BMD - Messung Benchmarking zur Qualitätskontrolle in der Behandlung der Osteoporose? Bis zu neun follow up. E. Heinen, M. Beyer, I. Hellrung, I. Riedner-Walter PRAXIS für ENDOKRINOLOGIE, Nürnberg
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel. S. Kirschner
 Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel S. Kirschner Ergebnisse in Qualitätsindikatoren Knietotalendoprothesen-Erstimplantation Knieendoprothesenwechsel
Knie-Totalendoprothesen- Erstimplantation und Knie-Endoprothesenwechsel und - komponentenwechsel S. Kirschner Ergebnisse in Qualitätsindikatoren Knietotalendoprothesen-Erstimplantation Knieendoprothesenwechsel
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Komm. Direktorin PD Dr. med. Gabriele Hänsgen) Vergleich der Wirksamkeit von Orthovoltbestrahlung
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Komm. Direktorin PD Dr. med. Gabriele Hänsgen) Vergleich der Wirksamkeit von Orthovoltbestrahlung
Abbildungsverzeichnis... XV. Tabellenverzeichnis... XVIII. Abkürzungen... XXIII. Symbolverzeichnis...XXIV
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XV Tabellenverzeichnis... XVIII Abkürzungen... XXIII Symbolverzeichnis...XXIV 1. Einleitung...1 1.1. Hintergrund und Fragestellung...1 1.2. Methodik...2 1.3.
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XV Tabellenverzeichnis... XVIII Abkürzungen... XXIII Symbolverzeichnis...XXIV 1. Einleitung...1 1.1. Hintergrund und Fragestellung...1 1.2. Methodik...2 1.3.
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt
 In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
In Fehlstellung verheilter femoraler Slope nach distaler Femurfraktur Gelenkersatz versus Gelenkerhalt N. Südkamp, M. Feucht Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Femoraler Slope...? Femoraler Slope
Femoroacetabuläres Impingement
 Femoroacetabuläres Impingement 1. Einführung 2. Krankheitsbilder 3. Anatomie 4. Leistenschmerz 5. FAI Femoroacetabuläres Impingement 5.1 Formen 5.1.1 Cam - Impingement 5.1.2 Pincer - Impingement 5.2 Ursachen
Femoroacetabuläres Impingement 1. Einführung 2. Krankheitsbilder 3. Anatomie 4. Leistenschmerz 5. FAI Femoroacetabuläres Impingement 5.1 Formen 5.1.1 Cam - Impingement 5.1.2 Pincer - Impingement 5.2 Ursachen
Information zu Ihrer Hüft-Operation. Kurzschaft
 Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Information zu Ihrer Hüft-Operation Kurzschaft Wie funktioniert unsere Hüfte? Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und das zweitgrößte Gelenk im menschlichen Körper. Der Oberschenkel - knochen und das Becken
Klausur Unfallchirurgie
 Klausur Unfallchirurgie 24.01.2011 I) Welche Zuordnung der versch. Verletzungen mit den jeweiligen Klassifikationen, die diese Verletzungen beschreiben, trifft nicht zu. 1. Oberarmkopffrakturen - Neer
Klausur Unfallchirurgie 24.01.2011 I) Welche Zuordnung der versch. Verletzungen mit den jeweiligen Klassifikationen, die diese Verletzungen beschreiben, trifft nicht zu. 1. Oberarmkopffrakturen - Neer
Dossierbewertung A18-80 Version 1.0 Enzalutamid (Prostatakarzinom)
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Enzalutamid gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgt auf Basis eines
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Enzalutamid gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgt auf Basis eines
Mobil das Leben genießen
 Mobil das Leben genießen Die Hüfte eine Problemzone im höheren Alter: Erkrankungen und Verletzungen im Hüftbereich stellen ein großes Problem bei älter werdenden Menschen dar. Natürliche Abnützungserscheinungen
Mobil das Leben genießen Die Hüfte eine Problemzone im höheren Alter: Erkrankungen und Verletzungen im Hüftbereich stellen ein großes Problem bei älter werdenden Menschen dar. Natürliche Abnützungserscheinungen
KLINIKUM WESTFALEN. Der Speichenbruch. Unfall und Therapie. Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen
 KLINIKUM WESTFALEN Der Speichenbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich über Ihr
KLINIKUM WESTFALEN Der Speichenbruch Unfall und Therapie Klinikum Westfalen GmbH Hellmig-Krankenhaus Kamen www.klinikum-westfalen.de Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ich freue mich über Ihr
Auszug aus den Ergebnissen der Qualitätssicherung 2016
 Lesehilfe Daten Kommentar zur Erläuterung Hier können Sie sehen, zu welchem Thema eine Überprüfung seitens QS- NRW stattfand. Die "Qualitätssicherung in in Nordrhein- Westfalen" besteht seit 2002 und setzt
Lesehilfe Daten Kommentar zur Erläuterung Hier können Sie sehen, zu welchem Thema eine Überprüfung seitens QS- NRW stattfand. Die "Qualitätssicherung in in Nordrhein- Westfalen" besteht seit 2002 und setzt
Der richtige Zeitpunkt für die Operation ist in der Regel dann gekommen, wenn alle anderen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind.
 Die Schulterprothese Das Kunstgelenk der Schulter hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt. Während es in den Anfangszeiten vor allem ein Platzhalter war zur Schmerzreduktion, ist es
Die Schulterprothese Das Kunstgelenk der Schulter hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt. Während es in den Anfangszeiten vor allem ein Platzhalter war zur Schmerzreduktion, ist es
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Die Magnetresonanztomographie beim Trauma des oberen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Die Magnetresonanztomographie beim Trauma des oberen
1. Bitte geben Sie den Kliniknamen an (Sie können auch gerne ein Pseudonym verwenden)!
 1. Bitte geben Sie den Kliniknamen an (Sie können auch gerne ein Pseudonym verwenden)! 2. Bitte geben Sie die Klinikgröße, Fachrichtung, Bettenzahl, Stellenschlüssel sowie den Versorgungsauftrag an! Klinikgröße
1. Bitte geben Sie den Kliniknamen an (Sie können auch gerne ein Pseudonym verwenden)! 2. Bitte geben Sie die Klinikgröße, Fachrichtung, Bettenzahl, Stellenschlüssel sowie den Versorgungsauftrag an! Klinikgröße
Möglichkeiten und sinnvolle Grenzen der präoperativen Diagnostik des multimorbiden Dialysepatienten aus internistisch-kardiologischer Sicht
 Möglichkeiten und sinnvolle Grenzen der präoperativen Diagnostik des multimorbiden Dialysepatienten aus internistisch-kardiologischer Sicht Dr. med. Michael Liebetrau 1 Kardiovaskuläre Risikofaktoren 2
Möglichkeiten und sinnvolle Grenzen der präoperativen Diagnostik des multimorbiden Dialysepatienten aus internistisch-kardiologischer Sicht Dr. med. Michael Liebetrau 1 Kardiovaskuläre Risikofaktoren 2
Azetabulumfrakturen. Axel Gänsslen Michael Müller Michael Nerlich. Unter Mitarbeit von
 Azetabulumfrakturen Axel Gänsslen Michael Müller Michael Nerlich Unter Mitarbeit von Friedrich Anderhuber Florian Baumann Arne Berner Hans-Gunther Clement Thomas Dienstknecht Stephan Grechenig Wolfgang
Azetabulumfrakturen Axel Gänsslen Michael Müller Michael Nerlich Unter Mitarbeit von Friedrich Anderhuber Florian Baumann Arne Berner Hans-Gunther Clement Thomas Dienstknecht Stephan Grechenig Wolfgang
.. Muller Geradschaft. Hüftschaft zementiert Operationstechnik
 .. Hüftschaft zementiert Operationstechnik .. Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Indikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes 4 Kontraindikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes
.. Hüftschaft zementiert Operationstechnik .. Inhalt Einleitung und Produktbeschreibung 4 Indikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes 4 Kontraindikationen für den Einsatz des Müller Geradschaftes
Unfallchirurgie & Orthopädie
 Unfallchirurgie & Orthopädie Information für Patienten & Interessierte Unser oberstes Ziel ist die schnellstmögliche Genesung unserer Patienten. Hierzu verfügen wir über insgesamt 45 stationäre Betten,
Unfallchirurgie & Orthopädie Information für Patienten & Interessierte Unser oberstes Ziel ist die schnellstmögliche Genesung unserer Patienten. Hierzu verfügen wir über insgesamt 45 stationäre Betten,
Operationstechnik. Krallenplatten 3.5. Reposition und Fixation kleiner Knochenfragmente.
 Operationstechnik Krallenplatten 3.5. Reposition und Fixation kleiner Knochenfragmente. Inhaltsverzeichnis Einführung Krallenplatten 3.5 / Indikationen 2 AO Prinzipien 3 Operationstechnik Klinische Problemstellung
Operationstechnik Krallenplatten 3.5. Reposition und Fixation kleiner Knochenfragmente. Inhaltsverzeichnis Einführung Krallenplatten 3.5 / Indikationen 2 AO Prinzipien 3 Operationstechnik Klinische Problemstellung
