Protokoll Arthropoda I. Onychophora, Chelicerata, Crustacea
|
|
|
- Hermann Melsbach
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Protokoll Arthropoda I Onychophora, Chelicerata, Crustacea Till Biskup Matrikelnummer: Dezember 1999 Einführung Die Arthropoda, deren Name sich von den beiden griechischen Wörtern αρθρoν (Glied, Gelenk) und πoύς (Fuß) ableitet und deren namensgebendes Merkmal damit die gegliederten Extremitäten sind, wie sie sich allerdings erst bei den Euarthropoda finden, sind schon alleine durch die ungeheure Artenzahl, die sie vereinen, von großer Bedeutung in der Zoologie. Etwa drei Viertel [5] aller zur Zeit beschriebenen Tierarten sind Arthropoda. Erstaunlicherweise wird die Zahl der Arten sehr konstant in der Literatur mit über einer Million angegeben. Damit sind die Arthropoda das artenreichste Taxon überhaupt, neuere Hochrechnungen gehen allerdings von alleine bis zu dreißig Millionen (!) Insektenarten aus [8]. Als wahrscheinlich stark abgeleitete Schwestergruppe der Annelida bilden die Arthropoda den Höhepunkt in der Evolution wirbelloser Tiere [8], was neben ihrer Artenvielfalt auch besondere Bestätigung in der Eroberung beinahe aller Lebensräume zu finden scheint. Sie schließen sich in ihrer Organisation eng an die Annelida an [6] und gelten als höchstentwickeltes Taxon der Protostomia [7]. Als Grund für die zahlenmäßige Überlegenheit sieht [7] die hohe funktionelle Organisation der Arthropoda, ein großer Teil ihrer evolutionären Radiation beruhe auf der Spezialisierung der gegliederten Extremitäten. Diese besondere Stellung der Arthropoda im System der Lebewesen rechtfertigt es meiner Ansicht nach auch, sich ein wenig detaillierter mit ihrer Organisation zu beschäftigen, wie es im folgenden geschehen soll. Aufgaben 1. Nennen Sie die Abwandlungen der Arthropoda gegenüber dem Grundmuster der Articulata! 2. Welches sind die Argumente dafür, daß die Onychophora zu den Arthropoden gestellt werden? 3. Erfassen Sie tabellarisch die Abfolge der Tagmata und Extremitäten bei Limulus und Flußkrebs! 1 Abwandlungen der Arthropoda gegenüber dem Grundmuster der Articulata Wie schon bei der Besprechung der Annelida erwähnt, ist die Bezeichnung Articulata und mit ihr die Zusammenfassung der beiden Taxa Annelida und Arthropoda relativ alt. Maßgeblich dürfte dazu die Gemeinsamkeit der Gliederung des Körpers in Segmente beigetragen haben. 1
2 Zu einer sinnvollen und fundierten Beschreibung der Abwandlungen der Arthropoda gegenüber dem Grundmuster der Articulata, also der Autapomorphien der Arthropoda, bedarf es zunächst einer Rekapitulation des Grundmusters der Articulata, auf die aufbauend ich dann bei der Besprechung der die Arthropoda auszeichnenden Merkmale in die Tiefe gehen möchte. 1.1 Grundmuster der Articulata Halten wir uns zunächst an [1], können wir drei den Annelida und Arthropoda gemeinsame Merkmale festhalten. Erstes und wichtigstes Charakteristikum ist die Segmentierung des Körpers, die Gliederung des Körpers in eine Reihe gleichförmiger Segmente (Metamere) mit einer Wiederholung bestimmter paariger Organe in der Längsachse. [1, S. 58] Als diese sich wiederholenden paarigen Organe sind die mit Mesenterien und Dissepimenten, Trennwänden in der Körpermedianen beziehungsweise zwischen den Segmenten, ausgestatteten Coelomsäcke, Nephridien, Ganglien eines ventralen Strickleiternervensystems sowie die sich zwischen den Dissepimenten befindenden lateralen Kanäle des geschlossenen Blutgefäßsystems. Durchbrochen wird die im Grundmuster homonome Segmentierung anatomisch frontal von Prostomium (Annelida) beziehungsweise Acron (Arthropoda), caudal von Pygidium (Annelida) respektive Telson (Arthropoda). Diese beiden Abschnitte, der erste am Vorder, der andere am Hinterende des Tieres, sind ohne Segmentcharakter. Als weiteres Kriterium führt [1] die teloblastische Genese der Metamere auf, die er als Bildung der Segmente in einer Wachstumszone am Hinterende vor dem Pygidium [1, S. 58] definiert. Unter Teloblastie 1 hat man sich dabei die Bildung von Geweben aus Teloblasten, Bildungszellen, die durch inäquale Teilungen meist kleinere Tochterzellen, sogenannte Blasteme, abschnüren, ohne jedoch selbst von deren Differenzierung beeinflußt zu werden. Infolge dieses Zellteilungsmodus bleiben die Teloblasten in einer konstanten Lage am Ende der aus ihnen gebildeten Zellreihen. Schließlich seien noch die Längsmuskeln in Bändern genannt. Während wir im Grundmuster der Spiralia noch einen primär einheitlichen Muskelschlauch finden, separiert sich die Längsmuskulatur bei den Articulata in wenige Muskelbänder (Rouse & Fauchald 1997). Der einzigartige Merkmalskomplexes aus Segmentierung und Teloblastie begründet die Monophylie des Taxons Articulata (Nielsen (1997): Euarticulata), da er innerhalb der Spiralia nur bei Annelida und Arthropoda zu finden ist. Das hieraus abgeleitete Postulat einer einmaligen Evolution des Phänomens in der Stammlinie der Articulata wird allerdings, wie nicht verschwiegen werden soll, von molekularen Analysen (Ghiselin 1988, Eernisse et al. 1992, Eernisse 1997) nicht unterstützt. Trotzdem gilt die Monophylie der Articulata aufgrund der genannten Autapomorphien, zu denen [5] noch das dorsale, kontraktile Längsgefäß und das ventral gelegene Strickleiternervensystem als Gemeinsamkeiten von Annelida und Arthropoda hinzurechnet, als relativ gesichert. 1.2 Autapomorphien der Arthropoda nach [1] Wie wir noch bei der Behandlung der Onychophora im Detail sehen werden, ist die Aufstellung von Autapomorphien der Arthropoda eng mit der Problematik der Eingliederung dieser Gruppe verknüpft. Die Adelphotaxa Beziehung zwischen Onychophora und Euarthropoda besitzt fundamentale Bedeutung für das Verständnis der Evolution der Arthropoda [1, S. 87]. Daher möchte ich in Übereinstimmung mit [1] und [6] die Besprechung der Autapomorphien der Arthropoda in mit den Onychophora gemeinsame und im Gegensatz dazu erst in der Stammlinie der Euarthropoda evolvierte Merkmale untergliedern. 1 gr. τ ɛλoς, Ende, Ziel; βλαστóς, Sproß, Trieb 2
3 Während [8], stellvertretend für andere allgemeiner gehaltene Darstellungen, die Arthropoda für durch eine Reihe genauer gesagt drei Merkmale gut begründbarer Autapomorphien charakterisierbar hält, namentlich die Cuticula aus α Chitin und Proteinen, die regelmäßig gehäutet wird, das fehlen äußerer Bewegungscilien, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Ausbildung der festen Cuticula, und die deutliche Gliederung in Kopf und Rumpf, stellt [6] sehr ausführlich die Herausbildung einer weit größeren Zahl an Autapomorphien in drei Etappen an unterschiedlichen Punkten des Stammbaumes dar. Aufgrund der schon in der Einleitung angesprochenen großen Bedeutung, die den Arthropoda innerhalb des Tierreiches zukommt, und um auch selbst das Verständnis einiger Strukturen zu vertiefen, sei im Folgenden etwas detaillierter auf diese Merkmale und ihre Herausbildung in mehreren Stufen, wie sie in [6] dargestellt wird, eingegangen. Diese Etappen der Herausbildung der typischen Arthropoden Merkmale lassen sich besonders gut anhand der Protarthropoda 2 erkennen. Autapomorphien an der Basis der Arthropoda Alle in der ersten Etappe evolvierten Merkmale betreffen sowohl die Protarthropoda als auch die Euarthropoda, sind also in der gemeinsamen Stammlinie dieser beiden evolviert worden. Als erstes sind hier die Ostien des Herzens zu nennen, ursprünglich segmentale, seitliche Öffnungen, die mit Ventilklappen ausgestattet sind [5] und und der Rückführung des Blutes, genauer der Hämolymphe [5] in das Herz dienen, somit die Aufgabe der nicht vorhandenen Venen übernehmen. Das Herz entspricht dabei dem Rückengefäß der Annelida, das Gefäßsystem der Arthropoda ist, im Gegensatz zu dem der Annelida, stets offen. Daß das keinen Nachteil darstellen muß, werden wir noch bei der Besprechung des Atmungssystems sehen. Der zweite wichtige Schritt in dieser ersten Entwicklungsstufe ist das Komplexgehirn, dessen Entwicklung erst die spätere Ausbildung der für die höheren Arthropoda charakteristischen komplexen Sinnesorgane ermöglicht. Seine Entstehung geht auf die Verschmelzung des ursprünglichen Gehirns mit mehreren Rumpfganglien zurück. Als direkte Folge dieser Art der Herausbildung ergibt sich seine anatomische Unterscheidbarkeit in mehrere Bereiche, wobei das Archicerebrum als der erste Gehirnabschnitt das ursprüngliche Gehirn repräsentiert. Es ist der dem Prostomium (Acron, Kopflappen) angehörende Gehirnabschnitt, der bei Annelida fast immer durch das Oberschlundganglion repräsentiert wird. Ihm sind die Augen als wichtigste Sinnesorgane zugeordnet, außerdem ist es das Assoziationszentrum des Gehirns. Angegliedert an das Archicerebrum sind drei Rumpfganglien, namentlich Prosocerebrum [5], Deutero und Tritocerebrum, wobei Archicerebrum und Prosocerebrum auch als Protocerebrum zusammengefaßt werden, da das erste, dem Präantennalsegment zugehörige Rumpfganglion wenig ausgeprägt ist. Die sich anschließenden Ganglien des zweiten und dritten Rumpfsegmentes, das Deutero und Tritocerebrum, innervieren das erste und zweite Antennenpaar. Eine weitere Neuerrungenschaft der Stammart aller Arthropoda ist die Auflösung und Umbildung der Coelomhöhlen. Hatten wir als Charakteristikum der Annelida noch den Besitz paariger Coelomhöhlen festgehalten, finden sich diese bei Arthropoda nur noch während der Embryogenese. Die Wand der Coelomhöhlen wandelt sich größtenteils in Organe und Gewebe um: Die Außenwand bildet die Muskulatur von Körper und Beinen, aus der inneren Wand entwickelt sich die Darmmuskulatur, der Fettkörper und exkretorisches Gewebe. Eine sich in diesem Zusammenhang herausbildende Struktur, auf die in der Literatur durchweg hingewiesen wird, ist das Pericardialseptum, das den dorsal gelegenen Pericardialsinus mit dem Herzen von der übrigen Leibeshöhle, dem Perivisceralsinus [1], fast vollständig trennt. Dieses den Körper horizontal durchspannende Septum [1] entsteht dadurch, daß sich die dorsalen Wandbezirke der Coelomhöhlen in der Embryogenese von der 2 Onychophora, aus dem Übergangsgebiet zwischen Anneliden und Arthropoden stammende, rezente Gruppe [6] 3
4 Körperwand zurückziehen und meist unterhalb des Herzens stehenbleiben. Das Pericard 3 der Arthropoda ist also bedingt durch seine Entstehung kein Coelomteil, da es außerhalb des Coeloms liegt. Trotz der Auflösung und Umbildung des Coeloms verbleiben Reste dieser Struktur, die als echtes Coelom angesprochen werden können. Als Beispiele seien hier die Sacculi, um die Nephridien angeordnete Endbläschen, die der Primärharnproduktion dienen [1], sowie die Gonaden und ihre zugehörigen Gonodukte genannt. Während die Coelomepithelzellen bei den Nephridialsacculi als Podocyten 4 ausgebildet sind, entstehen die Gonaden durch Abschnürung des Coeloms mehrerer Segmente, die Gonodukte aus Coelomteilen und eingegliederten Nephridien im Endabschnitt. Auch wenn die vorausgegangene Beschreibung der inneren Organisation der Arthropoda vielleicht anderes erwarten läßt, so besitzen diese Tiere dennoch eine definierte Leibeshöhle, die aus zwischen Organen und Körperwand sich befindenden Coelomhöhlen hervorgeht und nicht selten unter Ausbildung eines sogenannten Mixocoels mit Resten der primären Leibeshöhle verschmilzt [5]. Als letztes schon in dieser frühen Etappe der Entwicklung der Arthropoda sich evolvierendes Merkmal sei die Cuticula genannt, jene Struktur, die durch ihren großen Einfluß auf den gesamten Bauplan wahrscheinlich wesentlich für den Erfolg der Arthropoda als Tiergruppe beigetragen hat. Sie ist als α Chitin Protein Cuticula 5 ausgebildet [1] und wird von der unter ihr liegenden, früher oft fälschlich [8] als Hypodermis bezeichneten Epidermis abgeschieden. Die Chitinketten sind kovalent an ein Protein gebunden, benachbarte Stränge verlaufen antiparallel. Bei Crustacea finden sich oft Einlagerungen aus Calciumcarbonat [5], die die Festigkeit der Cuticula zusätzlich erhöhen. Funktionsbedingt ist die größtenteils harte und sklerotisierte 6 Cuticula an der Verbindung gegeneinander beweglicher Teile weichhäutig und biegsam [5]. Nach der Lage und Funktion dieser Strukturen kann man Intersegmentalhäute zwischen freien Segmenten und Gelenkhäute an den Gelenken der Extremitäten und Flügel unterscheiden. Als Funktion kommen der Cuticula vor allem der Schutz des Körpers vor mechanischen und chemischen Eingriffen sowie die Gewährung von Form und Halt als Exoskelett zu. Nicht zu unterschätzen ist außerdem ihre Bedeutung als Ansatzstelle der vielfältigen quergestreiften Muskulatur [5]. Da eine solche harte und relativ unflexible Außenhaut jeglichem Wachstum schnell ein Ende bereitet, wird sie regelmäßig gehäutet. Erst diese hormonell gesteuerten Häutungen ermöglichen Größenzunahme und Veränderung der Körpergestalt, wie wir sie in extremer Form bei der Metamorphose holometaboler Insecta während der Larvalentwicklung finden. Der Vorgang beginnt mit dem Aufplatzen der alten Cuticula entlang von Häutungsnähten, gefolgt vom Abstreifen derselben. Schon vorher hat die Epidermis eine neue, farblose und unsklerotisierte Cuticula gebildet, die sich insbesondere in ihrer Größe von der alten unterscheidet und daher an vielen Stellen in Falten liegt. Um diese auszufüllen, schlucken die Tiere Luft oder Wasser. Abschließend wird sie binnen weniger Stunden sklerotisiert und pigmentiert. Ein Phänomen, das sowohl von [1] als auch von [8] als Autapomorphie aufgeführt ist und das sehr wahrscheinlich 7 mit der Evolution der Cuticula im Zusammenhang steht, soll hier noch kurz angesprochen werden: das Fehlen lokomotorischer Cilien an der Körperoberfläche. Allerdings kommen abgewandelte Cilien ohne Zentralmikrotubulus unter anderem in Sinneszellen vor. Cilien im Inneren des Arthropodenkörpers sind allgemein selten, Beispie- 3 der das Herz umgebende Blutraum [6] 4 Füßchenzelle, Zelltyp mit vielen Füßchen und an diesen sitzenden seitlichen Ausläufern; der Exkretion dienende Filtrationsstruktur [4] 5 im Original Kutikula 6 gr. σκληρóς, hart, trocken 7 während [8] nicht sicher zu sein scheinen, steht der Wahrheitsgehalt dieser Aussage bei [1] nicht zur Diskussion 4
5 le für ihr Auftreten sind die Nephridien der Onychophora und allgemein die Geißeln von Spermien [8]. Da letztere aber teils erheblich vom sonst bei Cilien universellen sogenannten 9+2 Muster abweichen, ist ihre Beweglichkeit oft eingeschränkt [2]. Autapomorphien an der Basis der Euarthropoda Die im folgenden beschriebenen vier Merkmalskomplexe werden von [6] an die Basis der Euarthropoda gestellt, finden sich also nicht bei den Protarthropoda (Onychophora). Ein erstes, von [5] als Demonstration der höheren Organisation der Arthropoda gegenüber den vorangegangenen Gruppen angesprochenes Merkmal sind die Facettenaugen, paarig ausgebildete Seitenaugen, die aus bis zu eintausend Ommatidien, röhrenförmigen Einzelaugen, bestehen. Es sei hier aber nicht verschwiegen, daß neben diesen hochkomplexen Sehorganen bei Euarthropoda meist drei, aber bis zu vier kleine Scheitelaugen, sogenannte Ocellen, ausgebildet werden, die je nach Herkunft in Lateral und Median Ocellen unterschieden werden, wobei erstere sich aus Ommatidien ableiten, bei letzteren die Funktion bis heute nicht gänzlich geklärt ist [4]. Weiteres gemeinsames Merkmal aller Euarthropoda ist das Plattenskelet 8 des Rumpfes, das als gegliedere Panzerung dem Körper maximalen Schutz bei Erhaltung der Beweglichkeit bietet. Die in Sklerite und biegsame Membranen gegliederte Cuticula bietet hier gleichzeitig die Ansatzstelle der quergestreifte Muskulatur. Als Sklerite jedes Segmentes treten das Tergit, die Rückenplatte, und das Sternit, die Bauchplatte auf. Nur gelegentlich findet sich dagegen Pleurite als feste Seitenstücke. In den Grundplan der Euarthropoda gehören vermutlich, zumindest an den mit Extremitäten ausgestatteten Segmenten, des weiteren Pleurotergite, seitliche Falten, die eine laterale Überdachung des Körperraumes bilden und eine Arbeitskammer für die Extremitäten, die ventrolateral in der Pleuralregion eingelenkt sind [5], schaffen. Damit sind wir schon bei der nächsten Autapomorphie der Euarthropoda, den gegliederten Extremitäten, die mit festen röhrenförmigen Gliedern der Cuticula bedeckt sind, welche wiederum zur Gewährleistung der Beweglichkeit untereinander durch weiche cuticularisierte Zonen verbunden sind. Zur Aufgabe der Extremitäten insbesondere primitiver Euarthropoda rechnet [6] neben der Lokomotion auch den Nahrungstransport, der in einer median zwischen den Beinen sich befindenden Nahrungsrinne kopfwärts von statten gegangen sein soll. Zur Verhinderung eines Transportes über den Mund hinaus soll das Labrum (die Oberlippe) gedient haben, eine eher belustigende Vorstellung. Ein letzter Merkmals Neuerwerb auf dieser Stufe ist die Reduktion der Nephridien, genauer deren Beschränkung auf ein oder zwei Paare im Vorderkörper. Teilweise fehlen sie auch gänzlich und werden dann durch die im folgenden noch zu nennenden Malpighischen Gefäße ersetzt. Autapomorphien der Hauptzweige der Euarthropoda nach deren Aufspaltung Die hier abschließend besprochenen Autapomorphien stellen alle Charakteristika der höheren Arthropoda, die in mehreren Linien parallele Umbildungen erfuhren, dar. Hierzu zählt zuallererst die heteronome Körpergliederung. Während die Segmente der primitiven Arthropoda mit Ausnahme der Kopfregion noch fast völlig gleichgestaltet (homonom) waren, finden sich nun zwei grundlegende Entwicklungslinien innerhalb der Arthropoda: (1) die Vergrößerung der am Vorderkörper ansitzenden Extremitäten und der vorderen Segmente sowie (2) die Verkleinerung und schließlich vollständige Reduktion der Extremitäten des Hinterkörpers. Die Folge dieser Entwicklung ist die morphologische Zweiteilung in gliedmaßentragenden Thorax und extremitätenloses Abdomen, wie sie von [8] als eines der drei wesentlichen Charakteristika der ganzen Gruppe der Arthropoda gesehen wird, und die in ihrer extremsten Ausprägung dazu führen kann, daß Thorax und Abdomen 8 laut Duden teilweise noch im med. Fachschrifttum gebrauchte Nebenform von: Skelett [Duden Rechtschreibung, Mannheim 1973] 5
6 durch einen tiefen Einschnitt getrennt sind. Dieser Befund trifft beispielsweise auf manche Chelicerata und Insecta zu. Von besonderer Wichtigkeit für die Systematik der Arthropoda ist die Ausgestaltung und Homologisierbarkeit der Mundgliedmaßen. Sie entwickeln sich aus den hinteren drei der fünf (oder sechs) dem Kopf angehörenden Extremitätenpaare, die zur Nahrungsaufnahme umgestaltet werden. Allgemein finden wir ein Paar Mandibeln und zwei Paar Maxillen. Während die Mundgliedmaßen bei den als primitiv angesehenen Trilobita noch weitgehende Ähnlichkeit mit den Rumpfextremitäten aufweisen, ist dieser Eindruck bei Antennata, Crustacea, Protarthropoda und teils auch Arachnida ein gänzlich anderer: Hier kommt es zur Umwandlung aller oder eines Teiles dieser Extremitäten zu spezialisierten Mundgliedmaßen. Im Zusammenhang mit der allen Hauptlinien der Arthropoda gelingenden Eroberung des Landes steht die mehrfach konvergente Herausbildung von Tracheensystemen. Die durch Hauteinstülpungen entstehenden Tracheen bilden ein reichverzweigtes Luftkanalsystem, das bis in die einzelnen Gewebe reicht und dadurch das Blut weitestgehend von der Aufgabe des Transportes der Atemgase entbindet, was sich nicht zuletzt darin niederschlägt, daß letzteres keine Atmungspigmente enthält. Als Exkretionsorgane mit wasersparender Exkretion seien hier noch die Malpighischen Gefäße angesprochen, die wohl im Zusammenhang mit der Reduktion der Nephridien und der Eroberung des Landes entstanden. Letzteres wird insbesondere mit dem Rückgang der Exkretion flüssiger Stoffe in Zusammenhang gebracht. Sie entstehen als Blindschläuche des Darmes an der Grenze zwischen Mittel und Enddarm. Ihre phylogenetische Herausbildung ist bei Antennata und Chelicerata sicher konvergent zu interpretieren, vereinzelt treten sie auch bei Crustacea auf. Als abschließende Autapomorphie sei hier noch kurz auf die superfizielle 9 Furchung eingegangen. Ausgangspunkt ist ein centrolecithales 10 Ei, dessen angehäufter Dotter in der Eimitte um den zentral bleibenden Kern herum liegt. Sie beginnt mit der Entstehung einer größeren Zahl ohne Zelltrennung in der Plasma Dotter Masse liegender Kerne, deren Mehrzahl zur Ei Peripherie wandert (daher wohl die Bezeichnung superficiell). Hier grenzen sie sich durch Cytoplasmabezirke voneinander ab und bilden als eine äußere Schicht das Blastoderm, aus dem sich durch Bildung eines ventralen Keimstreifens der weitere Embryo entwickelt. Bei primitiven und vielen viviparen Arten kommt es dagegen laut [8] zu einer totalen Furchung. [1] verbucht diesen Merkmalskomplex unter dem Titel Abänderungen der Spiralia Quartett Furchung (Scholtz 1997) und Verlust der Trochophora Larve. Er läßt sich in vier Teile gliedern: (1) Eine radial orientierte Position der Furchungsprodukte, der Energiden oder Zellen, ersetzt die ursprüngliche Spiralfurchung. (2) Das Grundmuster wird durch eine superficielle Furchung mit Anordnung der Blastomere wie oben beschrieben, also in der Mitte des Keimes, repräsentiert. Allerdings muß offen bleiben, wie dieser Furchungstyp entstand. Zur Diskussion stehen hier einerseits eine intralecithale Furchung, bei der die Furchungsprodukte nicht durch Zellmembranen voneinander getrennt sind, andererseits eine holoblastische Furchung, bei der die Eizelle schon in der frühen Furchung vollständig in Blastomeren aufgeteilt wird [4]. (3) Im Ergebnis der superficiellen Furchung existiert ein Blastodermstadium mit zentraler Dottermasse und peripher liegenden Zellen. Schließlich wird (4) die aus dem Grundmuster der Articulata stammende Trochophora Larve reduziert. 1.3 Charakteristische Organisationsmerkmale der Arthropoda (im Unterschied zu den Annelida) Nach dieser Menge an Informationen halte ich es für angebracht, an dieser Stelle noch einmal auf die Charakteristika der Arthropoda einzugehen, wie sie von [7] aufgelistet werden, die 9 lat. superficialis, oberflächlich 10 von gr. κ ɛντρoν, Mittelpunkt, und λ ɛκιθoς, Dotter 6
7 sie vor den Annelida auszeichnen. 1. Die gleichförmige, homonome Körpergliederung geht gänzlich verloren. Die Segmente werden gruppenweise zu funktionellen Einheiten (Tagmata) zusammengefaßt, viele Tagmata lassen ihre metamere Gliederung oft nur noch anhand der Körperanhänge erkennen. 2. Ausbildung von Tagmata und Organkonzentration Da die Tagmata die ursprüngliche Segmentgliederung weitgehend verwischen, kann es infolgedessen zu einer Organkonzentration auf bestimmte Körperabschnitte kommen. 3. Metamere seitliche Körperanhänge bilden gegliederte Extremitäten. Diese als Arthropodien bezeichneten Strukturen stehen den als ungegliederte Lappen in Erscheinung tretenden Parapodien der Annelida gegenüber. 4. Ausbildung eines Cuticularskeletts Als Sekretionsprodukt der Epidermis dem Körper Halt gebend ermöglichte die Cuticula den Arthropoden den Übergang zum Landleben. 2 Argumente für die Eingliederung der Onychophora in die Arthropoda Den auf den ersten Blick etwas archaisch und fremd anmutenden Onychophora scheint in der aktuellen Diskussion des phylogenetischen Systems der Arthropoda eine große Bedeutung zuzukommen. Sie nehmen eine Schlüsselstellung zum Verständnis des Übergangsfeldes zwischen Anneliden und Euarthropoden ein, zumal ihre Organisation durch die mosaikartige Verteilung von Anneliden und Arthropoden Merkmalen gekennzeichnet 11 ist. Onychophora Arthropoda Chelicerata Euarthropoda Mandibulata Crustacea Tracheata Abbildung 1: Diagramm der phylogenetischen Verwandtschaft innerhalb der Arthropoda, aus [1] 11 beide Zitate aus [8], S
8 2.1 Autapomorphien der Onychophora Bevor ich näher auf die konkrete Frage nach Argumenten für eine Einordnung der Onychophora in die Arthropoda eingehe, die, liest man in [1] nach, für manchen schon entschieden zu sein scheint, möchte ich zunächst die Autapomorphien dieses Taxons darstellen, wie sie schon Hennig in [3] definierte. Zunächst fällt bei der Betrachtung eines Tieres dieses Taxons eine äußere Segmentierung auf, die allerdings durch eine sekundäre Ringelung, als Scheinringelumg bezeichnet, verwischt ist. Aufgrund dieser Scheinringelung ist die Zahl der äußeren Segmente auch nur noch anhand der Extremitätenzahl erkennbar, indem man von der als ursprünglich geltenden Situation ausgeht, daß jedes Segment ein Paar Extremitäten trägt. Als weitere Autapomorphie, die allerdings gleich einen ganzen Merkmalskomplex repräsentiert, nennt [3] den Kopfabschnitt. Dieser ist nur unscharf vom übrigen Körper abgegrenzt und daher ist die Frage, wie viele Rumpfsegmente mit dem Prostomium vereinigt sind, umstritten. Dieser Kopfabschnitt trägt nun ein Paar fühlerförmiger Anhänge, an deren Basis sich die Blasenaugen der Tiere befinden, zwei Paar Kieferhaken, vielleicht als Krallen eines reduzierten Extremitätenpaares, dasjenigen des ersten postoralen Segmentes, auch Tritocerebralsegment genannt, tragen sowie ein Paar Oralpapillen, die vermutlich Derivate der Extremitäten des zweiten postoralen Segmentes verkörpern. Diese Papillen stellen die Mündung der nicht unbeträchtlichen Schleimdrüsen, von [8] als körperlange Wehrdrüsen angesprochen, die sich aus den Nephridien des zweiten postoralen Segmentes evolviert haben, dar. Außerdem finden wir noch als Anpassung an die terrestrische Lebensweise Tracheenbüschel, deren Stigmen, bis zu 75 pro Segment, über den ganzen Körper verstreut liegen. Außer den hier aufgeführten Merkmalen nennt [8] als auffallende Autapomorphien noch die einästigen, im Gegensatz zu allen Euarthropoda [7] ungegliederten Stummelbeine ohne Gelenkhäute, auch als Lobopodien [7] bezeichnet, sowie die zahlreichen Kommissuren des Nervensystems. Um die eingangs schon angesprochene mosaikartige Verteilung von Anneliden und Arthropoden Merkmalen [8, S. 420] in der Organisation der Onychophora noch einmal deutlich werden zu lassen, seien im folgenden noch die Synapomorphien der Onychophora zu den Annelida und Arthropoda dargestellt. 2.2 Symplesiomorphien mit den Annelida Da [7] als einziger zu diesem Thema etwas zu sagen hat, folge ich hier ihren Ausführungen. Als Synapomorphien zu den Annelida sind danach die blasenförmig eingestülpten, im Vergleich zu den bei den Euarthropoda auftretenden Komplexaugen einfach gestalteten Einzellinsenaugen, die segmental angeordneten Nephridien sowie der durchgehend ausgebildete Hautmuskelschlauch zu nennen. Letzterer wird allerdings von [1] als Synapomorphie zu den Euarthropoda vereinnahmt. 2.3 Symplesiomorphien mit den Euarthropoda Viele Merkmale der Onychophora stellen Symplesiomorphien zu den Euarthropoda dar, was an sich schon ein relativ starker Hinweis darauf ist, daß sie mit diesen zu einem gemeinsamen Taxon Arthropoda zusammengefaßt werden können. Übereinstimmend nach [7] und [8] kann als eines dieser Symplesiomorphien die sklerotisierte α Chitin Protein Cuticula genannt werden, die zeitlebens im Abstand weniger Wochen gehäutet werden muß. Des weiteren führt [7] das Mixocoel, das von Ostien durchbrochene Herz, das weitgehend offene Blutgefäßsystem, die mit einem Sacculus statt mit Wimperntrichtern beginnenden Nephridien sowie das aus den drei Teilen Proto, Deutero und Tritocerebrum aufgebaute Gehirn auf. [8] steuert noch das Hämocoel mit Pericardialseptum und eine arthropodenartige Entwicklung bei. 8
9 Im [1] findet sich schließlich in Ansätzen die Aufteilung der Autapomorphien auf mehrere an verschiedenen Stellen des Stammbaums sich evolvierende Merkmalskomplexe wieder, wie sie nach [6] schon in der ersten Aufgabe dargestellt wurden. Folgerichtig stellt [1] fest, daß nur die in einer gemeinsamen Stammlinie der Onychophora und Euarthropoda evolvierten Merkmale zu einer Begründung der Monophylie dieser beiden Taxa herangezogen werden kann. Er nennt hier (1) den geschichteten Hautmuskelschlauch, der von außen nach innen betrachtet aus je einer Schicht Ringmuskeln, Diagonalmuskeln und einem dicken Bündel Längsmuskeln besteht, un (2) die mit Sacculi ausgestatteten Nephridien, die bezüglich ihrer Ausdehnung über den ganzen Rumpf und ihr Nephrostom mit Cilien als ursprünglich angesehen werden. 2.4 Zusammenfassung Zwar weist die Organisation der Onychophora einen nicht unbeträchtlichen Grad von Eigendifferenzierung auf [8], was anhand der Autapomorphien dieses Taxons deutlich wird, auf der anderen Seite sprechen die in ihrer Bedeutung für die Organisation des Körpers wesentlichen Symplesiomorphien mit den Arthropoda, die nach [1] die einzig mögliche Begründung einer Monophylie beider Taxa liefern können, eine deutliche Sprache. Allgemein kann man wohl davon sprechen, daß derzeit in der Phylogenetischen Systematik relative Einigkeit darüber herrscht, die Onychophora als erste Stufe der Arthropodisierung [8, S. 428] an die Basis der Arthropoda zu stellen, mit der sich daraus ergebenden Konsequenz einer Adelphotaxa Beziehung zwischen Onychophora und den als Euarthropoda, richtige Arthropoda, zusammengefaßten anderen Gruppen. Diese Hypothese der Monophylie der Arthropoda (unter Einschluß der Onychophora) scheint auch durch molekularbiologische rrna Sequenz Analysen Bestätigung zu finden [7]. 3 Abfolge der Tagmata und Extremitäten bei Limulus und Flußkrebs Besondere Bedeutung innerhalb des Phylogenetischen Systems der Arthropoda kommt nach [7] der Homologisierung der Extremitäten, insbesondere der vorderen, zu. Hilfestellung leistet hierbei der Extremitätentyp, wie etwa Mandibel oder Maxille. Als zentrale Frage erhebt sich jedoch die Cephalisation und ihr Ablauf, insbesondere der Umfang, in dem einzelne Segmente an ihr beteiligt sind. So ist die Grenze zwischen dem Kopf, je nach Taxon Prosoma oder Caput genannt, und den sich anschließenden Tagmata, dem Ophistosoma oder Thorax, bei Chelicerata und Mandibulata an verschiedenen Stellen anzusetzen. Eine weitere die Homologisierung erschwerende Besonderheit weisen dekapode Krebse, zu denen auch der Flußkrebs gehört, auf: Bei ihnen überdeckt eine Duplikatur des Kopfhinterrandes, der sogenannte Carapax 12, die Region der thorakalen Laufbeine und schafft so eine dem Prosoma der Chelicerata funktionsanaloge Struktur, die aber aufgrund der an ihr beteiligten Segmente weder dem Cheliceraten Prosoma noch dem Insekten Kopf homolog ist. Wie ähnlich sich bisweilen beispielsweise Chelicerata und Crustacea trotz der phylogenetisch unterschiedlichen Entstehung der Strukturen sein können, wird meines Erachtens auch eindrucksvoll am hier diskutierten Vergleich von Limulus und Flußkrebs deutlich. Noch ein Wort zu Artnamen des Flußkrebses möchte ich hier, mich auf [4] stützend, anfügen: In Europa heimisch sind insgesamt fünf Arten, von denen zwei nähere Erwähnung verdienen. Als früher in fast allen Gewässern verbreiteter Flußkrebs wird der Edelkrebs Astacus astacus, zuweilen auch als Europäischer Flußkrebs bezeichnet, auch dem Laien bekannt sein, nicht zuletzt als Indikator für sehr sauberes Wasser. Allerdings wurden seine Populationen durch Wasserverschmutzung und die Krebspest stark dezimiert, so daß er heute nur noch sehr selten auftritt. Ein zweiter, im Gegensatz zu Astacus astacus weit verbreiteter 12 span. carapacho, Rückenschale, Panzer 9
10 Flußkrebs ist der auch im Praktikum präparierte Oronectes limosus, der Amerikanische Flußkrebs, der 1890 in Deutschland ausgesetzt wurde und sich seitdem stark vermehrte. Eine Wiederansiedlung von Astacus astacus wird anscheinend unter anderem dadurch erschwert, daß Oronectes limosus am Erreger der Krebspest, Aphanomyces astaci, nicht selbst erkrankt, ihn aber weiterhin in sich trägt und daher potentiell auf Astacus mit dementsprechenden Folgen übertragen kann. Limulus Flußkrebs Segment Extremität Tagma Extremität Tagma Ac 1 2 An 3 Ch An 4 Lb Md Caput 5 Lb Mx Prosoma 6 Lb Mx 7 Lb Mp Cephalo 8 Lb Mp/K thorax 9 Cl Mp/K 10 Op/G Lc/K 11 Sb/K Lb/K Thorax 12 Sb/K Ophisto Lb/K 13 Sb/K soma Lb/K 14 Sb/K Lb 15 Sb/K Gp 16 T Gp 17 Sb 18 Sb Pleon 19 Sb 20 Up 21 T Ac Acron (Prostomium) An Antennen Ch Cheliceren Cl Chilaria G Geschlechtsöffnung Gp Gonopoden K Kiemen Lb Laufbeine Md Mandibeln Lc zu Chelae umgebildete Laufbeine Mp Maxillipeden Mx Maxillen Op Operculum Sb Schwimmbeine T Telson Up Uropoden Tabelle 1: Vergleich der Extemitäten von Limulus und Flußkrebs, aus [7], leicht verändert 3.1 Tagmata und Extremitäten der Chelicerata nach [7] Betrachtet man die Extremitäten der Chelicerata, so fällt, besonders auch bei einem Blick in die vergleichende Tabelle, auf, daß sie weder Antennen noch Mandibeln besitzen. Ihr vorderstes Gliedmaßenpaar sind die Cheliceren 13, scherentragende Extremitäten, die ihnen auch ihren Namen eingetragen haben. Das zweite Extremitätenpaar erfährt innerhalb der Chelicerata eine vielfältige Ausgestaltung. So ist es bei den Xiphosuren, deren einzige rezente Art der hier im Vordergrund stehende Limulus polyphemus ist, ein normales Laufbeinpaar. Bei den anderen Vertretern der Chelicerata werden diese Gliedmaßen als Pedipalpen, spezialisierte Kiefertaster, angesprochen. Diese können wiederum, wie etwa bei Skorpionen und Pseudoskorpionen als die wohlbekannten mächtigen Scheren ausgebildet sein, oder aber sie schließen den Mundvorraum nach hinten ab, was sich anatomisch in der Verbreiterung ihres basalen Gliedes auswirkt. 13 gr. χήλη, Schere; κ ɛρας, Horn 10
11 Wenden wir nun unseren Blick von den Kopfextremitäten ab, hin zur etwas allgemeineren Betrachtung der gesamten Körpergliederung, so finden wir auch hier ursprünglich eine große Variationsbreite, die sich allerdings innerhalb der Chelicerata zunehmend verliert. Wichtigstes Merkmal dürfte hier die durchgängige Zweiteilung des Körpers in das Prosoma, den Vorderkörper, und das Ophistosoma 14 sein. Während ersteres immer aus sechs Segmenten besteht, die so miteinander verschmolzen sind, daß eine Unterscheidung getrennter Abschnitte mit Mundwerkzeugen und Laufbeinen, etwa analog der Kopf/Thorax Gliederung der Insecta, niemals möglich ist. Das Ophistosoma weist hingegen mannigfache Differenzierungen bezüglich Segmentzahl und verschmelzung auf. Besteht es bei den Scorpiones, die laut [7] als erste Tiere im Silur 15 zum Landleben übergingen, aus dreizehn Segmenten, deren fünf letztere ähnlich wie bei den ausgestorbenen Eurypterida zu schmalen, das mit Giftblase und Endstachel bewehrte Telson tragenden Ringen verengt sind, trägt das Ophistosoma bei Limulus kiementragende, plattenförmige Schwimmbeine. Dieses Merkmal wird als ursprünglich angesehen und daher als ein weiteres Argument für die basale Stellung der Xiphosura und damit des als lebendes Fossil [4] geltenden Limulus innerhalb der Chelicerata gewertet. Bei den Arachnida ist das Ophistosoma, das wie bei den Scorpiones aus dreizehn Segmenten aufgebaut ist, sackförmig. Die Abfolge der einzelnen Segmente ist anhand der Embryonalentwicklung und der Gliederung der dorsalen Längsmuskeln anatomisch nachvollziehbar. Werfen wir abschließend noch einen Blick in die Gruppe der Milben (Acari), den Zwergformen der Arachnida, treffen wir hier einen aus Pro und Ophistosoma verschmolzenen, als ungegliederter Sack erscheinenden Körper an. Auf zwei spezielle Bildungen des Ophistosomas von Limulus sei hier noch kurz eingegangen: Die Chilaria 16 als erste Extremität des Hinterleibes ist ein stark reduziertes, eingliedriges Extremitätenpaar, das auf sie folgende Operculum stellt eine die Geschlechtsöffnung verschließende, entsprechend plattenförmig ausgebildete Struktur dar. 3.2 Tagmata und Extremitäten der Crustacea Die Crustacea gehören, wie aus Abb. 1 hervorgeht, innerhalb der Euarthropoda zu den Mandibulata, ihr Adelphotaxon innerhalb dieser Gruppe sind die Tracheata. Im Unterschied zu den Chelicerata besizen die Crustacea Mandibeln, Maxillen und Antennen als Kopfextremitäten, von letzteren jeweils zwei Paare. Diese fünf Paar Kopfextremitäten sind neben den sechs Ganglienpaaren auch das einzige Indiz für eine ursprüngliche Kopfmetamerie, da das Caput im Gegensatz zu Thorax und Pleon respektive Abdomen weder innerlich noch äußerlich Segmentgrenzen erkennen läßt. Ein wichtiger Punkt bei der Abgrenzung der Crustacea zu ihrem Adelphotaxon, den Tracheata, ist die Tatsache, daß bei den Insecta, dem bei weitem größten Taxon innerhalb der Tracheata, ja der gesamten Arthropoda, die beiden Gelenke an den Grenzen zwischen Caput und Thorax sowie diesem und dem Abdomen immer an der gleichen Segmentgrenze lokalisiert ist, während sich diese bei den Crustacea bei analogen Tagmata variabel gestaltet [7]. Extremitäten des Flußkrebses Ein finaler Höhepunkt der Besprechung der eher basalen und gegenüber den Tracheata in der Artenzahl deutlich zurücktretenden Gruppen der Arthropoda sei hier mit der Besprechung der Extremitäten des Flußkrebses, im wesentlichen nach [5], gesetzt. Während die erste Antenne, aufgrund ihrer verglichen mit der auf sie folgenden zweiten Antenne geringen Größe auch als Antennula bezeichnet, an ihrer auf den drei aufeinanderfolgenden Stammgliedern aufsitzenden Außengeißel chemorezeptorische Sinnesborsten und 14 gr. óπισθɛν, hinten 15 nach der Zeitskala der absoluten Geochronologie die Periode zwischen Ordivizium und Devon, etwa 418 bis 400 Millionen Jahre vor heute [4] 16 gr. χɛ ιλoς, Lippe, Rand 11
12 an ihrem ersten Stammglied die Statocyste, das Gleichgewichtsorgan des Tieres, trägt, ist die zweite Antenne das wichtigste Tastorgan des Krebses. An ihrem ersten Stammglied mündet das Antennennephridium, außerdem besitzt auch sie wie die erste Antenne zwei Geißeln, den Endopodit als lange Geißel sowie den auch als Scaphocerit bezeichneten Exopodit, den als dreieckige Schuppe ausgebildeten äußeren Ast. Die auf sie folgenden Mandibeln sind die ersten Mundgliedmaßen. Sie weisen eine innen gezähnte, massive Kaulade, die dem Coxa Enditen (dem inneren Anhang des Hüftgliedes) entspricht, sowie den Palpus (Taster) auf. Als nächstes folgen die zwei Maxillenpaare, Strukturen, die wesentlich zarter als die Mandibeln gebaut und nach innen gerichtet mit blattförmigen Kauladen ausgestattet sind. Unmittelbar an diese schließen sich die Maxillipeden, zu deutsch Kieferfüße, an. Mit ihnen beginnt gleichzeitig der Thorax, der allerdings funktionell mit dem Caput zum Cephalothorax zusammengefaßt ist. Vom ersten zum dritten Maxillipeden Paar wird der Spaltfußcharakter immer deutlicher, sie tragen als lateralen Anhang ein Epipodit, das beim ersten Maxilliped für die Erneuerung des Atemwassers in der Atemhöhle sorgt, bei den beiden folgenden die Kieme verkörpert. Als zusätzliche Funktion der Maxillipeden und Maxillen sei hier noch das Festhalten der Nahrung und deren Weiterleitung an die Mandibeln genannt. Als auffälligste Struktur folgen hierauf die Peraeopoden, zumindest bei Decapoda fünf Paar Schreitfüße, die aus sieben oder durch Verwachsung teilweise auch nur aus sechs Giedern bestehen, von denen zwei auf den Protopoditen, die anderen fünf auf den Endopoditen entfallen. Ein Exopodit fehlt durchgängig. Die zum Teil mächtige Ausmaße erreichende Chela (Schere) entsteht durch Verlängerung des vorletzten Gliedes der Extremität, das sich fingerförmig über die ansatzstelle des letzten Gelenkes hinaus vorschiebt. Beim Flußkrebs finden wir am ersten Peraeopoden Paar eine große, an den beiden folgenden Laufbein Paaren kleine Scheren. Die Pleopoden, die Beine des Hinterleibes, unterstützen die Schwimmbewegungen der Krebse und dienen darüber hinaus bei Organismen, bei denen eines der fünf Paare reduziert ist, zum Festhalten der befruchteten Eier und Embryonen. Bei Tieren sind die beiden vorderen der fünf Paare zu Begattungsorganen, den Gonopoden, umgebildet. Ab dem zweiten Paar dieser Extremitäten tritt auch der Spaltfußcharakter wieder deutlich zutage. Als Extremitäten des letzten Segmentes sind die Uropoden an der Bildung des Schwanzfächers, genauer seiner beiden Seiten, beteiligt. Daraus leitet sich auch ihre breite, plattenartige Form ab. Als mittlere Platte des Schwanzfächers dient schließlich das Telson, das an seiner Unterseite den After trägt, aber im Gegensatz zu den Uropoden nicht als Extremität, aber mangels einer Coelomanlage auch nicht als echtes Segment, sondern lediglich als postsegmentaler Körperabschnitt [4] angesprochen werden kann. Literatur [1] Ax, Peter: Das System der Metazoa II. Ein Lehrbuch der Phylogenetischen Systematik (Gustav Fischer, 1999). [2] Czihak, G., H. Langer und H. Ziegler (Hg.): Biologie. Ein Lehrbuch (Springer, 1996), sechste Aufl. [3] Hennig, Willi: Wirbellose Bd. II (Gustav Fischer, 1994). [4] Herder Verlag (Hg.): Lexikon der Biologie (Herder und Spektrum Akad. Verl., und 1994/95). [5] Storch, Volker und Ulrich Welsch: Kükenthals Zoologisches Praktikum (Gustav Fischer, 1996), 23. Aufl. [6] Storch, Volker und Ulrich Welsch: Systematische Zoologie (Gustav Fischer, 1997). [7] Wehner, R. und W. Gehring: Zoologie (Thieme, 1995), 23. Aufl. [8] Westheide, W. und R. Rieger (Hg.): Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose (Gustav Fischer, 1996). 12
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer) Euarthropoda
 Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer) Euarthropoda Beschrieben Arten weltweit >1 Million beschrieben Arten >10 Millionen zu erwarten Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer) Euarthropoda Chelicerata Myriapoda Crustacea
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer) Euarthropoda Beschrieben Arten weltweit >1 Million beschrieben Arten >10 Millionen zu erwarten Stamm: Arthropoda (Gliederfüßer) Euarthropoda Chelicerata Myriapoda Crustacea
Articulata (Gliedertiere) : Annelida + Arthropoda
 Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) Onychophora (Stummelfüßer) Trilobita (+++) Chelicerata (Pfeilschwänze; Spinnentiere) Crustacea (Krebse) Tracheata (Tausendfüßer; Insekten) Weitaus artenreichster Tierstamm:
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler) Onychophora (Stummelfüßer) Trilobita (+++) Chelicerata (Pfeilschwänze; Spinnentiere) Crustacea (Krebse) Tracheata (Tausendfüßer; Insekten) Weitaus artenreichster Tierstamm:
Protokoll Articulata Annelida
 Protokoll Articulata Annelida Till Biskup Matrikelnummer: 155567 03. Dezember 1999 Einführung Die Bezeichnung Articulata ist relativ alt, Georges Cuvier führte sie 1817 in seinem Hauptwerk Le règne animal
Protokoll Articulata Annelida Till Biskup Matrikelnummer: 155567 03. Dezember 1999 Einführung Die Bezeichnung Articulata ist relativ alt, Georges Cuvier führte sie 1817 in seinem Hauptwerk Le règne animal
Protokoll Arthropoda II. Myriapoda, Insecta
 Protokoll Arthropoda II Myriapoda, Insecta Till Biskup Matrikelnummer: 155567 17. Dezember 1999 Einführung Jeder der für das gemeinsame Taxon von Chilopoda, Progoneata und Insecta gebräuchliche Name, ob
Protokoll Arthropoda II Myriapoda, Insecta Till Biskup Matrikelnummer: 155567 17. Dezember 1999 Einführung Jeder der für das gemeinsame Taxon von Chilopoda, Progoneata und Insecta gebräuchliche Name, ob
Bestimmungsübungen SS 2007
 Bestimmungsübungen SS 2007 Arthropoda, Gliederfüßer Rüdiger Wagner Universität Kassel Was sind Gliederfüßer? Die Arthropoden sind der höchstentwickelte Stamm der Protostomier. Die Gliederung des Körpers
Bestimmungsübungen SS 2007 Arthropoda, Gliederfüßer Rüdiger Wagner Universität Kassel Was sind Gliederfüßer? Die Arthropoden sind der höchstentwickelte Stamm der Protostomier. Die Gliederung des Körpers
Struktur und Funktion der Insekten
 Struktur und Funktion der Insekten Prof. Dr. Bernd Grünewald Institut für Bienenkunde Oberursel Polytechnische Gesellschaft FB Biowissenschaften, Goethe-Universität b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de www.institut-fuer-bienenkunde.de
Struktur und Funktion der Insekten Prof. Dr. Bernd Grünewald Institut für Bienenkunde Oberursel Polytechnische Gesellschaft FB Biowissenschaften, Goethe-Universität b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de www.institut-fuer-bienenkunde.de
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018
 Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Tardigrada Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Tardigrada Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Entwicklung. Ontogenese: Individualentwicklung. Phylogenese: Stammesgeschichtliche Entwicklung. Ontogenese - Individualentwicklung
 Entwicklung Ontogenese: Individualentwicklung Phylogenese: Stammesgeschichtliche Entwicklung Eizelle Ontogenese - Individualentwicklung 1. Befruchtung Zygote Embryonalphase mit Furchung, Keimblattbildung,
Entwicklung Ontogenese: Individualentwicklung Phylogenese: Stammesgeschichtliche Entwicklung Eizelle Ontogenese - Individualentwicklung 1. Befruchtung Zygote Embryonalphase mit Furchung, Keimblattbildung,
Entwicklung der Tiere
 Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Entwicklung der Tiere Entwicklung beginnt, wie immer, mit einer ersten Zelle. Diese Zelle ist die befruchtete, diploide Zygote, deren Kern durch Verschmelzung der Kerne einer männlichen und einer weiblichen
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS. Fachoberschule/Berufsoberschule, Biologie, Vorklasse. Insektenbestimmung. Stand:
 Insektenbestimmung Stand: 12.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtung Sozialwesen) Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen 1. Teil: ca. 40 Minuten 2. Teil:
Insektenbestimmung Stand: 12.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Vorklasse Biologie (Ausbildungsrichtung Sozialwesen) Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen 1. Teil: ca. 40 Minuten 2. Teil:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Materialübersicht
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vergleichende Entwicklung bei Insekten mit 1 Farbfolie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 1 Materialübersicht
- Kopf. - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare. - Hinterleib. - Körpergliederung. - Außenskelett ( Chitin ) - Facettenaugen aus vielen Einzelaugen
 Gliederung des Insektenkörpers ( 8. Klasse 1 / 32 ) - Kopf - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare - meist 2 Flügelpaare - Hinterleib Kennzeichen des Insektenkörpers ( 8. Klasse 2 / 32 ) - Körpergliederung - Außenskelett
Gliederung des Insektenkörpers ( 8. Klasse 1 / 32 ) - Kopf - 3 Brustringe: - 3 Beinpaare - meist 2 Flügelpaare - Hinterleib Kennzeichen des Insektenkörpers ( 8. Klasse 2 / 32 ) - Körpergliederung - Außenskelett
Funktionelle Organisation der Tiere
 Zoologie Funktionelle Organisation der Tiere BIO-ZOO-02-V-2 Vorlesung (1./2. Sem.) Jan Pielage Zoologie & Neurobiologie Prof. Jan Pielage, Zoologie/Neurobiologie, Vorlesung Zoologie, Sommersemester 2016
Zoologie Funktionelle Organisation der Tiere BIO-ZOO-02-V-2 Vorlesung (1./2. Sem.) Jan Pielage Zoologie & Neurobiologie Prof. Jan Pielage, Zoologie/Neurobiologie, Vorlesung Zoologie, Sommersemester 2016
Der Fisch in uns. Diese Merkmale unterscheiden sich nicht im Grundbauplan. entwickelt. Es sind abgeleitete Homologien.
 Beispielaufgabe 1 - 2 - Der Fisch in uns Menschen und Fische sind sich eigentlich nicht sehr ähnlich. Doch wenn man genau hinguckt, findet man tatsächlich Hinweise darauf, dass Menschen mit den Fischen
Beispielaufgabe 1 - 2 - Der Fisch in uns Menschen und Fische sind sich eigentlich nicht sehr ähnlich. Doch wenn man genau hinguckt, findet man tatsächlich Hinweise darauf, dass Menschen mit den Fischen
Autotrophe Ernährung. Heterotrophe Ernährung. Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien
 2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
2 2 Autotrophe Ernährung Ernährungsweise von grünen Pflanzen und manchen Bakterien Sie stellen energiereiche organische Verbindungen (z.b. Zucker) zum Aufbau körpereigener Stoffe selbst her. Die Energie
Der Fisch in uns. Diese Merkmale unterscheiden sich nicht im Grundbauplan. entwickelt. Es sind abgeleitete Homologien.
 Beispielaufgabe 1 - 2 - Der Fisch in uns Menschen und Fische sind sich eigentlich nicht sehr ähnlich. Doch wenn man genau hinguckt, findet man tatsächlich Hinweise darauf, dass Menschen mit den Fischen
Beispielaufgabe 1 - 2 - Der Fisch in uns Menschen und Fische sind sich eigentlich nicht sehr ähnlich. Doch wenn man genau hinguckt, findet man tatsächlich Hinweise darauf, dass Menschen mit den Fischen
- 2 - Inzwischen ist anerkannt, dass sich der moderne Mensch aus einer Urform entwickelt hat. Ich soll nun also herausfinden
 Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
- 2 - Inzwischen ist anerkannt, dass sich der moderne Mensch aus einer Urform entwickelt hat.
 Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Beispielaufgabe 3 - 2 - Der Neandertaler in uns 1856 entdeckten Arbeiter bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle 10 km östlich von Düsseldorf, im sogenannten Neandertal, Knochen. Sie hielten diese Knochen
Fokus Naturwissenschaften 26. April 2010
 Fokus Naturwissenschaften 26. April 2010 Der Signalkrebs Sektion eines großen Arthropoden Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Biologie 3 3. Querverbindungen 4 4. Beschaffung 5 5. Praktische Hinweise
Fokus Naturwissenschaften 26. April 2010 Der Signalkrebs Sektion eines großen Arthropoden Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Biologie 3 3. Querverbindungen 4 4. Beschaffung 5 5. Praktische Hinweise
Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist:
 Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist:
 Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Beispielaufgabe 4 - 2 - Das Land der Schliefer Liest man in einem Reiseführer über Spanien, erfährt man, dass der Name des Landes durch eine Verwechslung entstanden ist: Der Name Spanien geht auf die Phönizier
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018
 Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Annelida Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Vorlesung: Spezielle Zoologie WS 2017/2018 Modul: Zoologische Systematik und Artenkenntnis Annelida Dr. Wolfgang Jakob ITZ, Ecology & Evolution Bünteweg 17d D-30559 Hannover Phone: +49 511-953 8481 Email:
Eumetazoa ??? (+ diverse andere Klassen: Nematomorpha-Saitenwürmer; Gastrotricha Bauchhärlinge; Kinorhyncha; Acanthocephala Kratzer)
 Arthropoda Gliederfüßler Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Nemathelminthes Rundwürmer Protostomia Eumetazoa Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Hemichordata Plathelminthes
Arthropoda Gliederfüßler Annelida Ringelwürmer Mollusca Weichtiere Nemathelminthes Rundwürmer Protostomia Eumetazoa Deuterostomia Chordata Chordatiere Echinodermata Stachelhäuter Hemichordata Plathelminthes
R EKONSTRUKTION DER PHYLOGENESE
 R EKONSTRUKTION DER PHYLOGENESE 19 tizieren sind (z. B. Eihüllen, Kiefer oder vier Extremitäten), denn sie teilen diese Merkmale mit den anderen Gruppen der Wirbeltiere. Bei jedem Taxon interessieren uns
R EKONSTRUKTION DER PHYLOGENESE 19 tizieren sind (z. B. Eihüllen, Kiefer oder vier Extremitäten), denn sie teilen diese Merkmale mit den anderen Gruppen der Wirbeltiere. Bei jedem Taxon interessieren uns
Articulata. Polychaeta Oligochaeta Hirudinea
 Zu den (Gliedertiere) zählt man die Stämme der Anneliden und der Arthropoden. Zu den Stämmen, Unterstämmen und ihren Klassen sollen im nun folgenden Schriftstück die Hauptunterschiede herausgestellt werden,
Zu den (Gliedertiere) zählt man die Stämme der Anneliden und der Arthropoden. Zu den Stämmen, Unterstämmen und ihren Klassen sollen im nun folgenden Schriftstück die Hauptunterschiede herausgestellt werden,
Entomologisches Praktikum
 Entomologisches Praktikum Gerhard Seifert 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage 310 Abbildungen 1995 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York VIII Vorwort v Einleitung l Die Bedeutung der Insekten und
Entomologisches Praktikum Gerhard Seifert 3., neubearbeitete und erweiterte Auflage 310 Abbildungen 1995 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York VIII Vorwort v Einleitung l Die Bedeutung der Insekten und
2 Belege für die Evolutionstheorie
 2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes.
 Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2013
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 201 Montag, den 0. September 201, 11.00 12.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 201 Montag, den 0. September 201, 11.00 12.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
1 Einleitung. 1.1 Systematische Einordnung der Clitellata
 1 Einleitung Clitellaten unterscheiden sich von anderen Anneliden durch die besondere Form der Reproduktion und durch die limnische oder terrestrische Lebensweise der meisten Clitellatentaxa. Der für Clitellaten
1 Einleitung Clitellaten unterscheiden sich von anderen Anneliden durch die besondere Form der Reproduktion und durch die limnische oder terrestrische Lebensweise der meisten Clitellatentaxa. Der für Clitellaten
ist die Verwandtschaft oft durch Ähnlichkeiten zu erkennen. Betrachtet man etwa das Bild rechts, weiß man sofort wer mit wem verwandt
 Einführungstext - 2 - Verwandt oder doch nur ähnlich? Mit wem bin ich eigentlich verwandt? Wer sind meine Vorfahren? Betreibt man Ahnenforschung im herkömmlichen Sinn, so möchte man mit diesen Fragen herausfinden,
Einführungstext - 2 - Verwandt oder doch nur ähnlich? Mit wem bin ich eigentlich verwandt? Wer sind meine Vorfahren? Betreibt man Ahnenforschung im herkömmlichen Sinn, so möchte man mit diesen Fragen herausfinden,
- 2 - Der Affe in uns
 Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2013
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 01 Mittwoch, den 17. Juli 01, 1.00 1.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 01 Mittwoch, den 17. Juli 01, 1.00 1.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften
 Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Aktionspotential Passive und aktive elektrische Membraneigenschaften V m (mv) 20 Overshoot Aktionspotential (Spike) V m Membran potential 0-20 -40 Anstiegsphase (Depolarisation) aktive Antwort t (ms) Repolarisation
Zelldifferenzierung Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A)
 Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
Struktur und Funktion von Pflanzenzellen (A) Abb. 1: Querschnitt durch ein Laubblatt (Rasterelektronenmikroskop) Betrachtet man den Querschnitt eines Laubblattes unter dem Mikroskop (Abb. 1), so sieht
- 2 - Der Affe in uns
 Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Beispielaufgabe 2 - 2 - Der Affe in uns Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist das Ergebnis eines langen und natürlichen Entwicklungsprozesses (Evolution). Auch die heutigen Menschen haben sich über mehrere
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8
 Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
Grundwissen 8. Klasse gemäß Lehrplan Gymnasium Bayern G8 Biologie 1. Einfache Organisationsstufen von Lebewesen Prokaryoten Einzellige Lebewesen, die keinen Zellkern und keine membranumhüllten Zellorganellen
2.3.1 Belege für die Aussage: Zwischen Arten bestehen abgestufte Ähnlichkeiten
 2.3 Belege, die die Evolutionstheorie stützen 2.3.1 Belege für die Aussage: Zwischen Arten bestehen abgestufte Ähnlichkeiten 2.3.1.1 Homologe Organe s. AB (Vorderextremitäten versch. Wirbeltiere) Lassen
2.3 Belege, die die Evolutionstheorie stützen 2.3.1 Belege für die Aussage: Zwischen Arten bestehen abgestufte Ähnlichkeiten 2.3.1.1 Homologe Organe s. AB (Vorderextremitäten versch. Wirbeltiere) Lassen
Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis
 Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis Nachdem das Muskelgewebe in adulten Tieren von Nematostella identifiziert und beschrieben war, wurde die Entstehung der Muskulatur in
Entwicklung der Muskulatur in der Seeanemone Nematostella vectensis Nachdem das Muskelgewebe in adulten Tieren von Nematostella identifiziert und beschrieben war, wurde die Entstehung der Muskulatur in
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2015
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
Anatomie Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Die SuS lesen Texte, welche die der Biene abhandeln und erarbeiten verschiedene Arbeitsaufträge dazu. Ziel Die SuS können Körperteile der Biene richtig benennen. Die
Lehrerinformation 1/8 Arbeitsauftrag Die SuS lesen Texte, welche die der Biene abhandeln und erarbeiten verschiedene Arbeitsaufträge dazu. Ziel Die SuS können Körperteile der Biene richtig benennen. Die
MUSEUMS RALLYE. Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten und textbezogene Aufgaben. Thema: Evolution, Analogie und Homologie
 MUSEUMS RALLYE im Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten und textbezogene Aufgaben Thema: Evolution, Analogie und Homologie Ein Projekt des P-Seminars Biologie des Caspar-Vischer Gymnasiums Kulmbach Liebe
MUSEUMS RALLYE im Arbeiten mit wissenschaftlichen Texten und textbezogene Aufgaben Thema: Evolution, Analogie und Homologie Ein Projekt des P-Seminars Biologie des Caspar-Vischer Gymnasiums Kulmbach Liebe
Kennzeichen des Lebens. Zelle. Evolution. Skelett (5B1) (5B2) (5B3) (5B4)
 Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
Kennzeichen des Lebens (5B1) 1. Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Reaktion 2. aktive Bewegung 3. Stoffwechsel 4. Energieumwandlung 5. Fortpflanzung 6. Wachstum 7. Aufbau aus Zellen Zelle
VORANSICHT. Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Insekten. Das Wichtigste auf einen Blick
 III Tiere Beitrag 19 (Kl. 7/8) 1 von 26 Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Ein Beitrag von Gerd Rothfuchs, Etschberg Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart
III Tiere Beitrag 19 (Kl. 7/8) 1 von 26 Unterwegs auf sechs Beinen Körperbau, Sinnesorgane und Entwicklung von Ein Beitrag von Gerd Rothfuchs, Etschberg Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart
Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung. 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit
 Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit 3.) Aktive Bewegung 4.) Fortpflanzung und Entwicklung
Allgemeines - Die biologischen Kennzeichen der Lebewesen: 1.) Stoffwechsel und Energiewandlung 5.) Aufbau aus Zellen 2.) Information + Reizbarkeit 3.) Aktive Bewegung 4.) Fortpflanzung und Entwicklung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Harte Schale, weicher Kern. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Harte Schale, weicher Kern Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 24 Wirbellose Tiere (Kl. 6/7) Tiere Beitrag
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Harte Schale, weicher Kern Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 2 von 24 Wirbellose Tiere (Kl. 6/7) Tiere Beitrag
- beschreiben Aufbau und beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts und vergleichen es mit dem eines anderen Wirbeltiers.
 Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum für das Fach Biologie Jahrgangsstufe 5 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 5.1 Inhaltsfelder Angepasstheit von Tieren an verschiedene Lebensräume (Aspekt
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft?
 Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Beurteilung von HD Aufnahmen - Mysterium oder nachvollziehbare Wissenschaft? Die Beurteilung von HD Aufnahmen im Screeningverfahren erscheint häufig willkürlich und wenig nachvollziehbar. Es gibt verschiedene
Buch: Biologie, Wildermuth, S. 54, Objekte: diverse Tiermodelle und Skelette
 TIERE - ANIMALIA Datum Bereich Ziel Sozialform Zeitaufwand Lernorte: Links Material/Hilfsmittel xx. yy. zzzz Schwerpunktbereich Naturwissenschaften: Land und Forstwirtschaft, Grundlagen der Biologie Sie
TIERE - ANIMALIA Datum Bereich Ziel Sozialform Zeitaufwand Lernorte: Links Material/Hilfsmittel xx. yy. zzzz Schwerpunktbereich Naturwissenschaften: Land und Forstwirtschaft, Grundlagen der Biologie Sie
Allgemein. Allgemein. Grundwissenskatalog Biologie 8. Definiere den Begriff Art! Erkläre die Begriffe Gattung und binäre Nomenklatur!
 Allgemein Definiere den Begriff Art! Alle Lebewesen, die in wesentlichen Merkmalen überein- stimmen und miteinander fruchtbare Nachkommen er- zeugen, fasst man zu einer Art zusammen. Allgemein Erkläre
Allgemein Definiere den Begriff Art! Alle Lebewesen, die in wesentlichen Merkmalen überein- stimmen und miteinander fruchtbare Nachkommen er- zeugen, fasst man zu einer Art zusammen. Allgemein Erkläre
BEGRÜNDEN. Sagen, warum etwas so ist. Wortschatzkiste
 BEGRÜNDEN Sagen, warum etwas so ist. Der Begriff/ Vorgang/ Hintergrund/Verlauf/Prozess/ der Text/ der Versuch/Verfasser Die Ursache/Grundlage/Aussage/Bedeutung/Struktur/Erklärung/ die Formel/ die Quelle
BEGRÜNDEN Sagen, warum etwas so ist. Der Begriff/ Vorgang/ Hintergrund/Verlauf/Prozess/ der Text/ der Versuch/Verfasser Die Ursache/Grundlage/Aussage/Bedeutung/Struktur/Erklärung/ die Formel/ die Quelle
Medical Fitnesscoach (IST)
 Leseprobe Medical Fitnesscoach (IST) Studienheft Grundlagen der Massage Autorin Dr. med. Ulrich Maschke Angelika Görs (Diplom-Sportlehrerin) Jörn Becker (Heilpraktiker, staatl. geprüfter Masseur und med.
Leseprobe Medical Fitnesscoach (IST) Studienheft Grundlagen der Massage Autorin Dr. med. Ulrich Maschke Angelika Görs (Diplom-Sportlehrerin) Jörn Becker (Heilpraktiker, staatl. geprüfter Masseur und med.
und im Bau der Extremitäten hervortritt. Die mittleren Backzähne ihm entgegenarbeitende erste untere Molar als Reißzähne" mit
 SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
SP a" CD f Q Ol o 2 p et- 199 Sinopa rapax Leidy. Mit 4 Abbildungen. Die Raubtiere der Gegenwart bilden, wenn man von den Omnivoren Bären absieht, trotz aller Mannigfaltigkeit eine einheitliche Gruppe,
Wirbeltiere. Kennzeichen der Fische. Kennzeichen der Amphibien (Lurche) Kennzeichen der Reptilien
 Wirbeltiere Allen Wirbeltieren sind folgende Merkmale gemeinsam: Geschlossener Blutkreislauf Innenskelett mit Wirbelsäule und Schädel Gliederung des Körpers in Kopf, Rumpf und Schwanz Man unterscheidet
Wirbeltiere Allen Wirbeltieren sind folgende Merkmale gemeinsam: Geschlossener Blutkreislauf Innenskelett mit Wirbelsäule und Schädel Gliederung des Körpers in Kopf, Rumpf und Schwanz Man unterscheidet
Procyte Eucyte Organell Aufgabe Zellorganell Autotrophe Stellen Nährstoffe selbst her Organismen Pflanzen Fotosynthese Bakterien Chemosynthese
 Procyte (die) Eucyte (die) Zellorganell (das; -organellen) Organell Zellkern Ribosomen Mitochondrien Chloroplasten Endoplasmatisches Retikulum (ER) Golgiapparat (Dictyosom) Membran Zellwand Vakuole Aufgabe
Procyte (die) Eucyte (die) Zellorganell (das; -organellen) Organell Zellkern Ribosomen Mitochondrien Chloroplasten Endoplasmatisches Retikulum (ER) Golgiapparat (Dictyosom) Membran Zellwand Vakuole Aufgabe
Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen
 4 Ergebnisse 101 4.2.2. Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen Anhand der TEM- Aufnahmen sollte untersucht werden, welche Schäden Albendazolsulfoxid allein beziehungsweise
4 Ergebnisse 101 4.2.2. Ergebnisse der transmissionselektronenmikroskopischen (TEM) Untersuchungen Anhand der TEM- Aufnahmen sollte untersucht werden, welche Schäden Albendazolsulfoxid allein beziehungsweise
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014 Montag, den 29. September 2014, 10.00 11.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!)
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014 Montag, den 29. September 2014, 10.00 11.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!)
Atmung und Energie. Biologie und Umweltkunde. Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM)
 Atmung und Energie Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B3.2 Charakteristische Merkmale von Tiergruppen W3 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen
Atmung und Energie Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung B3.2 Charakteristische Merkmale von Tiergruppen W3 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen
Kükenthal - Zoologisches Praktikum. Click here if your download doesn"t start automatically
 Kükenthal - Zoologisches Praktikum Click here if your download doesn"t start automatically Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch, Ulrich Welsch Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch,
Kükenthal - Zoologisches Praktikum Click here if your download doesn"t start automatically Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch, Ulrich Welsch Kükenthal - Zoologisches Praktikum Volker Storch,
Rekonstruktion von Evolutionärer Geschichte
 Rekonstruktion von Evolutionärer Geschichte Populations- und Evolutionsbiologie 21.1.04 Florian Schiestl Phylogenetische Systematik Phylogenie: (gr. Phylum=Stamm) die Verwandtschaftsbeziehungen der Organismen,
Rekonstruktion von Evolutionärer Geschichte Populations- und Evolutionsbiologie 21.1.04 Florian Schiestl Phylogenetische Systematik Phylogenie: (gr. Phylum=Stamm) die Verwandtschaftsbeziehungen der Organismen,
Das Blut fließt nicht wie beim geschlossenen Blutkreislauf in Gefäßen (Adern) zu den Organen, sondern umspült diese frei.
 Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Grundwissen Biologie 8. Klasse 6 Eucyte Zelle: kleinste lebensfähige Einheit der Lebewesen abgeschlossene spezialisierte Reaktionsräume Procyte Vakuole Zellwand pflanzliche Zelle Zellkern tierische Zelle
Der Blutkreislauf Veränderung von Wissen über die Zeit
 Der Blutkreislauf Veränderung von Wissen über die Zeit Jahrgangsstufen 5 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- 40 min Benötigtes
Der Blutkreislauf Veränderung von Wissen über die Zeit Jahrgangsstufen 5 Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Natur und Technik (Schwerpunkt Biologie) --- 40 min Benötigtes
(Sonderabdruck aus dem»zoologischen Anzeiger«Bd. XLV. Nr. 2 vom 2. Oktober 1914.)
 Mary J, Rh (Sonderabdruck aus dem»zoologischen Anzeiger«Bd. XLV. Nr. 2 vom 2. Oktober 1914.) Über einige Pontoniiden. Von Dr. Heinrich Balss, München. (Mit 13 Figuren.) 1. Ein neuer Bewohner von Korallriffen.
Mary J, Rh (Sonderabdruck aus dem»zoologischen Anzeiger«Bd. XLV. Nr. 2 vom 2. Oktober 1914.) Über einige Pontoniiden. Von Dr. Heinrich Balss, München. (Mit 13 Figuren.) 1. Ein neuer Bewohner von Korallriffen.
Kopf und ein Fühler (rot) Hinterleib (gelb) Brust und ein gegliedertes Bein (blau) Code 1 : Die Farbgebung ist richtig
 Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Bienen N_9d_55_17 Honigbienen haben eine ökologische Funktion: Während des Flugs von Blüte zu Blüte sammeln sie nicht nur Nektar, der ihnen zur Herstellung von Honig dient, sondern transportieren auch
Wie teilt man Lebewesen ein? 1. Versuch Aristoteles ( v.chr.)
 Taxonomie Kladistik Phylogenese Apomorphien& Co. Fachwissenschaft & Methodik bei der Ordnung und Einteilung von Lebewesen Bildquellen: http://www.ulrich-kelber.de/berlin/berlinerthemen/umwelt/biodiversitaet/index.html;
Taxonomie Kladistik Phylogenese Apomorphien& Co. Fachwissenschaft & Methodik bei der Ordnung und Einteilung von Lebewesen Bildquellen: http://www.ulrich-kelber.de/berlin/berlinerthemen/umwelt/biodiversitaet/index.html;
Was fliegt denn da? Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Einiges zur Stammesgeschichte der Spinnentiere (Arthropoda, Chelicerata)
 Einiges zur Stammesgeschichte der Spinnentiere (Arthropoda, Chelicerata) H.F. PAULUS Abstract: Some remarks on the phylogeny of chelicerates (Arthropoda, Chelicerata). WEYCOLDT & PAULUS (1979) and SHULTZ
Einiges zur Stammesgeschichte der Spinnentiere (Arthropoda, Chelicerata) H.F. PAULUS Abstract: Some remarks on the phylogeny of chelicerates (Arthropoda, Chelicerata). WEYCOLDT & PAULUS (1979) and SHULTZ
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 6. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2014
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 014 Mittwoch, den 16. Juli 014, 1.00 1.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 014 Mittwoch, den 16. Juli 014, 1.00 1.00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße. Was ist eine Zufallsgröße und was genau deren Verteilung?
 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße Von Florian Modler In diesem Artikel möchte ich einen kleinen weiteren Exkurs zu meiner Serie Vier Wahrscheinlichkeitsverteilungen geben
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße Von Florian Modler In diesem Artikel möchte ich einen kleinen weiteren Exkurs zu meiner Serie Vier Wahrscheinlichkeitsverteilungen geben
Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen!
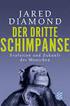 Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen! Du bist ein junger Wissenschaftler/ eine junge Wissenschaftlerin. Auf einer Reise hast du viele verschiedene Arten
Wer ist mit wem verwandt? EVOLUTION befasst sich auch mit Verwandtschaftsverhältnissen! Du bist ein junger Wissenschaftler/ eine junge Wissenschaftlerin. Auf einer Reise hast du viele verschiedene Arten
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Formatvorgaben für die Ausarbeitung
 Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Formatvorgaben für die Ausarbeitung - Ihre Ausarbeitung sollte 7-10 Seiten (exklusive Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis) umfassen. - Der Rand sollte beidseitig ca. 2,5 cm betragen.
Biologie. I. Grundlegende Begriffe im Überblick:
 I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
I. Grundlegende Begriffe im Überblick: Biologie äußere : die Verschmelzung der Zellkerne von männlicher und weiblicher Keimzelle erfolgt außerhalb des Körpers Bestäubung: die Übertragung von männlichen
Biologie und Umweltkunde
 DG Biologie und Umweltkunde, RG mit DG, Themenbereiche RP, Seite 1von 4 Biologie und Umweltkunde Hauptfach 8stündig Zweig: DG 1. Anatomie und Physiologie der Pflanzen Grundorgane der Pflanzen (Wurzel,
DG Biologie und Umweltkunde, RG mit DG, Themenbereiche RP, Seite 1von 4 Biologie und Umweltkunde Hauptfach 8stündig Zweig: DG 1. Anatomie und Physiologie der Pflanzen Grundorgane der Pflanzen (Wurzel,
Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze
 Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze Datum: 30.6.10 Einleitung: In sehr trockenen und heißen Gebieten ist die Öffnung der Stomata tagsüber sehr riskant. Der Wasserverlust durch Transpiration
Protokoll zum diurnalen Säurerythmus einer CAM-Pflanze Datum: 30.6.10 Einleitung: In sehr trockenen und heißen Gebieten ist die Öffnung der Stomata tagsüber sehr riskant. Der Wasserverlust durch Transpiration
Abiturprüfung Biologie, Grundkurs
 Seite 1 von 5 Abiturprüfung 2009 Biologie, Grundkurs Aufgabenstellung: Thema: Parasiten als Indikatoren der Primaten-Evolution I.1 Begründen Sie, warum der Vergleich von Aminosäure-Sequenzen und Basen-Sequenzen
Seite 1 von 5 Abiturprüfung 2009 Biologie, Grundkurs Aufgabenstellung: Thema: Parasiten als Indikatoren der Primaten-Evolution I.1 Begründen Sie, warum der Vergleich von Aminosäure-Sequenzen und Basen-Sequenzen
BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL.
 XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
XXIII. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI 926. BEMERKUNGEN ÜBER DIE KÖRPERHAUT VON MIDEOPSIS ORBICULARIS O. P. MÜLL. Von Dr. LADISLAUS SZALAY. (Mit 3 Textfiguren.) In dem Moment, als eine Hydracarine aus
Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen
 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 1 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen Verwandt? Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 2 Inhalt Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen...1 Inhalt... 2 Ordnung
Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 1 Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen Verwandt? Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen 2 Inhalt Kapitel 01.02: Einteilung der Lebewesen...1 Inhalt... 2 Ordnung
Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie Seiten
 Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Zeitreise in die Erdgeschichte
 Zeitreise in die Erdgeschichte Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung W1 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und benennen. 1a N1 Ausgehend von
Zeitreise in die Erdgeschichte Zuordnung zum Kompetenzmodell (KM) Aufgabe(n) KM Beschreibung W1 Ich kann Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und benennen. 1a N1 Ausgehend von
Abiturprüfung Biologie, Leistungskurs
 Seite 1 von 5 Abiturprüfung 2008 Biologie, Leistungskurs Aufgabenstellung: Thema: Das MERRF-Syndrom II.1 Begründen Sie, warum x-chromosomale Vererbung des MERRF-Krankheitsbildes, wie in Material C dargestellt,
Seite 1 von 5 Abiturprüfung 2008 Biologie, Leistungskurs Aufgabenstellung: Thema: Das MERRF-Syndrom II.1 Begründen Sie, warum x-chromosomale Vererbung des MERRF-Krankheitsbildes, wie in Material C dargestellt,
Attached! Proseminar Netzwerkanalyse SS 2004 Thema: Biologie
 Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehr- und Forschungsgebiet Theoretische Informatik Prof. Rossmanith Attached! Proseminar Netzwerkanalyse SS 2004 Thema: Biologie Deniz Özmen Emmanuel
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Lehr- und Forschungsgebiet Theoretische Informatik Prof. Rossmanith Attached! Proseminar Netzwerkanalyse SS 2004 Thema: Biologie Deniz Özmen Emmanuel
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution
 1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
Form und Funktion der Tiere. Mechanismen der Sensorik und Motorik
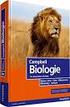 Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
Form und Funktion der Tiere Mechanismen der Sensorik und Motorik Bewegung und Lokomotion 49.25 Die energetischen Kosten der Fortbewegung. Diese Grafik vergleicht die Energie pro Kilogramm Körpermasse pro
4. Plastiden und die Vakuole sind pflanzentypische Organellen. Charakterisieren Sie beide hinsichtlich des Aufbaus und der Funktion.
 Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Beispiele für Klausurfragen 1. Pflanzen unterscheiden sich im Aufbau der Zellen von den anderen Organismengruppen. a) Welcher stammesgeschichtliche Hintergrund liegt diesem Aufbau zugrunde? b) Charakterisieren
Die Larven der Steinfliegen
 Die Larven der Steinfliegen Seminararbeit aus Angewandte Biologie (BUn) im Rahmen des Science Fair Projekts Wasser und mehr verfasst von Elena Scharrer, 6a 21.4.2017 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...
Die Larven der Steinfliegen Seminararbeit aus Angewandte Biologie (BUn) im Rahmen des Science Fair Projekts Wasser und mehr verfasst von Elena Scharrer, 6a 21.4.2017 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung...
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse
 Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Die roten Fäden durch die Biologie Natur und Technik/ Biologie Grundwissen: 8. Klasse Steuerung und Regelung Struktur und Funktion Variabilität und Angepasstheit Stoff- und Energieumwandlung Steuerung
Fragen.
 Fragen. 1. Beschreiben Sie mir den Wiederkäuermagen! 2. Nennen Sie mir doch einmal einige Wiederkäuer! 3. Bau des Flußkrebses (im allgemeinen)? 4. Was ist über die Verdauungsdrüse der Krebse zu sagen?
Fragen. 1. Beschreiben Sie mir den Wiederkäuermagen! 2. Nennen Sie mir doch einmal einige Wiederkäuer! 3. Bau des Flußkrebses (im allgemeinen)? 4. Was ist über die Verdauungsdrüse der Krebse zu sagen?
BIOLOGIE. Dr. Karl v. Frisch I. BAND BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG. Frisch, Karl von Biologie digitalisiert durch: IDS Luzern
 BIOLOGIE Dr. Karl v. Frisch I. BAND BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG Frisch, Karl von Biologie 1952-1953 digitalisiert durch: IDS Luzern INHALTSÜBERSICHT Einleitung 7 Seite I. ZELLENLEHRE 1. Die als sichtbare
BIOLOGIE Dr. Karl v. Frisch I. BAND BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG Frisch, Karl von Biologie 1952-1953 digitalisiert durch: IDS Luzern INHALTSÜBERSICHT Einleitung 7 Seite I. ZELLENLEHRE 1. Die als sichtbare
Was versteht man unter Polyneuropathie?
 7 2 Was versteht man unter Polyneuropathie? Udo Zifko 2.1 Unser Nervensystem: Anatomie und Physiologie 8 2.1.1 Länge des Nervs 8 2.1.2 Dicke des Nervs 10 2.1.3 Struktur des Nervs 10 2.2 Arten der Polyneuropathie
7 2 Was versteht man unter Polyneuropathie? Udo Zifko 2.1 Unser Nervensystem: Anatomie und Physiologie 8 2.1.1 Länge des Nervs 8 2.1.2 Dicke des Nervs 10 2.1.3 Struktur des Nervs 10 2.2 Arten der Polyneuropathie
Krebse mit und ohne große Scheren
 B&U 4 PLUS Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu4.veritas.at
B&U 4 PLUS Infos für Lehrerinnen und Lehrer Allgemeine Informationen B&U PLUS ist ein frei zugängliches, speziell auf die Inhalte der Schulbuchreihe B&U abgestimmtes ONLINE-Zusatzmaterial ( http://bu4.veritas.at
Natur und Technik. Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik. Schuljahr 2016/17 Datum:
 Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Schuljahr 2016/17 Datum: 29.06.2017 Klasse: 1 Mithilfe des Blicks durch ein Mikroskop
Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Schuljahr 2016/17 Datum: 29.06.2017 Klasse: 1 Mithilfe des Blicks durch ein Mikroskop
ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010
 ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010 Frosch- und Vogelperspektive diese Begriffe haben es längst in unseren Sprachgebrauch geschafft. Doch sagen sie nur etwas über den Standpunkt aus, von dem diese beiden
ANDERE AUGEN 24 HaysWorld 02/2010 Frosch- und Vogelperspektive diese Begriffe haben es längst in unseren Sprachgebrauch geschafft. Doch sagen sie nur etwas über den Standpunkt aus, von dem diese beiden
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Bruchgleichungen: Diagnosematerial, Übungsmaterial und Vertiefungsmaterial
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bruchgleichungen: Diagnosematerial, Übungsmaterial und Vertiefungsmaterial Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Bruchgleichungen: Diagnosematerial, Übungsmaterial und Vertiefungsmaterial Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt
 55 11216 Didaktische FWU-DVD differenziertes Arbeitsmaterial Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt Biologie Klasse 5 8 Trailer ansehen Schlagwörter Ameisen; Bestäubung; Bienen; Blütenpflanzen; Evolution;
55 11216 Didaktische FWU-DVD differenziertes Arbeitsmaterial Insekten Körperbau, Entwicklung, Vielfalt Biologie Klasse 5 8 Trailer ansehen Schlagwörter Ameisen; Bestäubung; Bienen; Blütenpflanzen; Evolution;
