Informationen für die Studierenden
|
|
|
- Hannelore Giese
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Modul BA135, Kasuistik II: Im Praxiskontext Teilmodul BA135a, Kasuistik und Prozessgestaltung Informationen für die Studierenden Im Folgenden werden die Leitidee von Modul BA135 sowie die Zielsetzungen von Teilmodul BA135a dargelegt und die Rahmenbedingungen und die Arbeitsweise werden erläutert. Anschliessend finden sich detaillierte Angaben zu den Aufgabenstellungen und Teilaufgaben sowie Hinweise zum zeitlichen Ablauf. Abschliessend sind Angaben zur Qualifikation aufgeführt. Leitidee und Ziele In diesem Modul wird ein Fall aus der Praxis der kasuistischen Reflexion zugänglich gemacht. Ein Fall kann sich auf einen einzelnen Klienten/eine Klientin, auf eine Familie, eine Gruppe, ein Gemeinwesen/Stadtteil beziehen oder auch auf ein Projekt. Das Modul trägt über erfahrungsbezogene Lern- und Bildungsprozesse zu einer Stärkung der professionellen Handlungs- und Reflexionskompetenz bei. Die Studierenden lernen durch kasuistisches Arbeiten allgemeine Strukturbedingungen von Praxisfeldern, organisationale Rahmenbedingungen und die Anforderungen an eine Prozessgestaltung bei der Planung und Durchführung von Interventionen zu erkennen und angemessen zu berücksichtigen. Der Fokus bei der Prozessgestaltung liegt in der Kooperation mit Klientinnen und Klienten; zu berücksichtigen ist aber auch die Kooperation auf der Fachebene (intra- und interprofessionell). Die Studierenden üben sich darin, praxisfeldbezogenes Erfahrungswissen mit relevantem Fachwissen zu relationieren, sie gewinnen Sicherheit in der begründeten Auswahl von Methoden und lernen, wie im Modell eines reflektierenden Praktikers / einer reflektierenden Praktikerin im Rahmen der Intervention neue, für die Fallarbeit relevante bzw. über sie hinausweisende Erkenntnisse generiert werden können. Im ersten Teilmodul 135a üben sich die Studierenden darin - die organisationalen Rahmenbedingungen der Fallarbeit zu beschreiben und sie verstehen zu können - einen Fall in sinnvoller Struktur (gemäss Organisationsauftrag) darzustellen und das Passungsverhältnisses zwischen der abstrakten Fallfolie der Organisation und einem konkreten Fall erkennen zu können - als reflektierende Akteure bzw. Akteurinnen in der Kooperation mit Klientinnen und Klienten eine Teilaufgabe aus dem Prozessgestaltungmodell zu planen und durchzuführen und dabei ausgewählte Methoden einzusetzen sowie das eigene Vorgehen anschliessend differenziert reflektieren. Rahmenbedingungen und Arbeitsweise Das Teilmodul BA135a wird zeitlich parallel zum ersten Praxismodul besucht. Die Studierenden arbeiten in einer festen Gruppe (à ca. 10 Studierenden). Die Gruppenbildung 1 Mai 2017/uh, sk, mg
2 erfolgt vor Semesterbeginn mittels der E-Learning-Plattform OLAT. Kurz vor Semesterbeginn ist dort die Einteilung von Studierenden und Dozierenden ersichtlich. In diesem Teilmodul sind über das Semester verteilt und aufeinander aufbauend Aufgabenstellungen zu folgenden drei Themenbereichen zu bearbeiten: 1. Organisationale Rahmenbedingungen von Fallarbeit in Ihrer Organisation 2. Konkrete Fallbezogene Aufgabenstellung in der Organisation (Auswahl eines Falles) 3. Fallbearbeitung in Kooperation Die ersten beiden sind Vorarbeit für die dritte, anspruchsvollste und aufwändigste Aufgabe. Die einzelnen Aufgaben sind fortlaufend als schriftliche Einzelarbeit zu bearbeiten und auf OLAT zu dokumentieren. Diese individuelle schriftliche Aufgabenbearbeitung ist eingebettet in den mündlichen Austausch mit der/dem Dozierenden und den Mitstudierenden im Rahmen von vier en in der Kursgruppe. In diesen über das Semester verteilten en stellen die Studierenden jeweils Teilaufgaben zur Diskussion vor. Die Dozierenden unterstützen sie durch Anleitung und Beratung und regen den fachlichen Austausch unter den Studierenden an. Der/die DozentIn gibt den Studierenden individuelle schriftliche Rückmeldungen via OLAT und teilt fortlaufend mit, welchen Überarbeitungsbedarf es noch gibt und wann eine Teilaufgabe zufriedenstellend bearbeitet ist. Schliesslich üben sich die Studierenden selber darin, sich gegenseitig schriftliche Rückmeldungen zu geben. Zweimal (zu Anfang und gegen Ende der Aufgabenbearbeitung) geben sie einer Kommilitonin/einem Kommilitonen über OLAT ein Feedback zum Bearbeitungstand einer Teilaufgabe. Um die Arbeitsfähigkeit in der Kursgruppe sicherzustellen, wird im Rahme der ersten geklärt, wie die Gruppe und die Studierenden-Tandems, die sich Rückmeldungen geben, zusammenarbeiten. Dazu wird eine Arbeitsvereinbarung getroffen. Die Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen erfordert ein hohes Mass an Eigenständigkeit und Selbstorganisation. Ganz entscheidend ist eine gute zeitliche Planung, die insbesondere eine angemessene Koordination der Prozesse in der Praxis (u.a. auch in Bezug auf die Kompetenzerwerbsplanung) und der Hochschule erfordert. Die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben hat sich gemäss Studierendenevaluation stets als äusserst hilfreich erwiesen. Das erfolgreiche Abschliessen des Moduls BA135A wird durch ein Testat bestätigt. Dieses Testat wird erteilt, wenn alle Aufgabenstellungen bearbeitet und von der/dem Dozierenden als ausreichend bewertet wurden. Schon während des Semesters erhalten die Studierenden zu den Teilaufgaben sukzessive Rückmeldungen zur Bearbeitungsqualität und überarbeiten beanstandete Teilaufgaben fortlaufend. Zu Beginn von Kalenderwoche 03 ( ) müssen alle Teilaufgaben erfüllt sein (näheres dazu siehe Erläuterungen zu Qualifikation am Ende dieses Dokumentes). Das Testat ist die Bedingung für die Teilnahme an Teilmodul BA 135b. 2 Mai 2017/uh, sk, mg
3 Aufgabenstellungen, Zielsetzungen und organisatorischen Hinweise Hinweis: In grau unterlegt sind jeweils die Leistungsanforderungen beschrieben. Angaben bezüglich Umfang sind als Richtwerte zu verstehen. Bei Unklarheiten fragen Sie bei den Dozierenden nach. SW 1 (KW38) Erste Olten: Basel: Uhr Auftaktsitzung in der Kursgruppe Aufgabenstellung - Besprechung der Aufgabenstellungen für die Einzelarbeit -Anforderung und Organisation der schriftliche Rückmeldung für die Testat- Bedingungen Arbeitsweise - Arbeitsvereinbarung in der Gruppe - Arbeitsweise auf OLAT - Datenschutz und Vertraulichkeit - Organisation der schriftlichen Rückmeldung (Dozierende, unter den Studierenden) Verortung der Praxisorganisationen der Studierenden Die Gruppe erarbeitet mögliche Vergleichsdimensionen für soziale Organisationen (z.b. Organisationsauftrag, Freiwilligkeitsgrad, u.a.). Die Studierenden stellen Ihre Organisation vor, indem sie diese auf den ausgewählten Dimensionen verorten. 1. Aufgabenstellung: Organisationale Rahmenbedingungen von Fallarbeit Zielsetzung dieser Aufgabenstellung ist, dass die Studierenden die organisationalen Rahmenbedingungen der Fallarbeit beschreiben und verstehen können. SW 1 3 (KW 38 40) zu bearbeiten bis OL BS a) Organisationale Rahmenbedingungen Beschreiben Sie die für die Fallarbeit relevanten Rahmenbedingungen in ihrer Praxisorganisation. Dazu gehören z.b.: Praxisfeld, Adressaten bzw. Adressatinnen/ Zielgruppe, Organisationstypus, rechtliche Grundlagen, Finanzierung, Organisationsauftrag, evtl. Einbettung der Abteilung in die Gesamtorganisation, Zuständigkeiten, Leitbild-Grundsätze, etc.). Umfang: ca. ½ - 1 S., stichwortartige Angaben sind ausreichend; mit Quellenangaben 1b) Organisationspraktiken Legen Sie dar, auf welche Art und Weise die Organisation (bzw. Abteilung) ihren Auftrag wahrzunehmen will. Dazu gehören Organisationspraktiken wie z.b. Abläufe/Verfahren, Konzepte, Methoden und Instrumente, u.a.m. Arbeiten Sie die Handlungslogik der Organisation heraus (wie werden die Handlungsweisen in der Organisation begründet, warum gibt es bestimmte Vorgaben/Regeln?). Befragen Sie Ihre/n PA zu den Routinen, die grundsätzlich für die Prozessgestaltung in ihrer Organisation gelten. Umfang: ca. 1-1 ½ S., Fliesstext, mit Quellenangaben 1c) Relevantes Fachwissen Stellen Sie mindestens zwei Bezüge her zwischen diesen Sachverhalten, die sie in der 3 Mai 2017/uh, sk, mg
4 Organisation vorgefunden haben (siehe 1a, 1b) und ausgewähltem Fachwissen, das Sie z.b. im Studium bereits erworben haben. Erläutern Sie dabei die wichtigsten Grundaussagen/Aspekte dieses theoretischen Bezugs (mit Quellenangaben) und stellen Sie anschliessend die Relevanz in der Praxis dar. Umfang: ca. 1 ½ S., Fliesstext, mit Quellenangaben Hinweis: Bei der gesamten Aufgabenstellung (1a bis 1c) sind die Anonymisierungs- Anforderungen mit der Praxisorganisation zu klären. SW 4 (KW 41) zu bearbeiten bis OL BS Aufgabenstellung zur Rückmeldung der Studierenden untereinander (Hinweis: Feedback jeweils in den Ordner der Mitstudierenden einfügen!) 1e) Vergleich von Organisationen und Organisationspraktiken -Wurden die Organisationspraktiken für Sie nachvollziehbar dargelegt? Wo haben Sie allenfalls Klärungsbedarf, Fragen? -Inwiefern passen Organisationsauftrag und Organisationspraktiken aus Ihrer Sicht zusammen? 1f) Fachwissen in der Praxis -Welche Art von (wissenschaftlichem) Wissen wurde hier dargelegt? (Orientierungswissen, Beschreibungswissen, Wertewissen, Erklärungs- und Begründungswissen, Interventionswissen, Erfahrungswissen, Organisationswissen, etc.)? Woher stammt es (Hochschule, Praxis, anderes)? -Wurde die Relevanz der ausgewählten Wissensbestände für Sie nachvollziehbar schlüssig erläutert? 2. Fallbezogene Aufgabenstellung: Fall in der Organisation Zielsetzung dieser Aufgabenstellung ist, dass die Studierenden einen Fall in sinnvoller Struktur (gemäss Organisationsauftrag) darstellen können und sie das Passungsverhältnis zwischen der abstrakten Fallfolie der Organisation und einem konkreten Fall erkennen können. SW 4 5 (KW 41-42) 2a) Wahl eines Falles und klient(inn)enbezogener Auftrag - Wählen Sie einen aktuellen Fall in der Organisation aus. -Recherchieren und notieren Sie, welches die klientenbezogenen Aufträge sind und von wem und von wann sie stammen (dabei ist unbedingt auch der Auftrag des Klienten/der Klientinnen selber zu notieren). - Erläutern Sie, Inwiefern diese klientenbezogenen Aufträge zum Organisationsauftrag passen - Klären Sie, welche anderen Professionen (in der eigenen Organisation oder anderen Hilfesystemen) und konkreten Professionelle an diesem Fall beteiligt sind (bzw. auch, wer schon beteiligt ist, wer evtl. noch beteiligt werden sollte). Umfang: ca. 1 S., Stichworte und Fliesstext Hinweis: Falls in der Organisation nur Kurzzeitberatungen stattfinden, wählen Sie exemplarisch einen Fall, um idealtypisch Auftrag und Kooperationen auf der Fachebene darzulegen. 4 Mai 2017/uh, sk, mg
5 Bearbeitung unbedingt vor der nächsten heraufladen! 2b) Situationserfassung Erstellen Sie eine Situationserfassung zu diesem Fall: -Stellen Sie die wichtigsten Informationen (Daten, Fakten) zum Fall prägnant und in einer sinnvollen Struktur (passend zum Organisationsauftrag) schriftlich dar. Beachten Sie dabei die Anforderungen an eine Situationserfassung (Bewertungen sind als solche zu deklarieren, etc.). -Beschreiben Sie falls es kein neuer Fall ist die Vorgeschichte des Falls in der Organisation. Befragen Sie allenfalls Ihre/n PA zum bisherigen Vorgehen. Anmerkung: Falls Sie nur sehr kurz mit einem Fall zu tun haben, legen Sie bitte dar, welche Informationen Sie vorgängig jeweils bekommen (und von wem) und welche Informationen zur Situation Sie selber beim Erstkontakt erfassen. Umfang: ca. 1-2 S, Stichworte und Fliesstext. Hinweis: Falldaten sind grundsätzlich zu anonymisieren. Klären Sie Datenschutz- Bestimmungen (insbesondere Einverständnis der Klient(inn)en) mit Ihrer Praxisorganisation. SW 5 (KW 42) Zweite Olten: Basel: Uhr Aufgabenstellung für die 2c) Fallpräsentation -Jede/r Studierende stellt den ausgewählten Fall mit allen relevanten Informationen und in seiner Einbettung in die Organisation mündlich vor (Kriterien: Prägnant, in kurzer Zeit und mit Hilfe einer Visualisierung entsprechend den Möglichkeiten vor Ort). Es geht um eine nachvollziehbare, gehaltvolle und prägnante Präsentation, wie sie im Rahmen z.b. einer Fallbesprechung erforderlich ist und hier geübt werden kann. Dabei muss deutlich werden, was und wie hier ein Fall konstituiert wird. Zeit für die Fallpräsentation: max. 3-5 Minuten - Anschliessend hinterfragen die Studierenden diese Fallpräsentation kritisch (ist sie nachvollziehbar? ausreichend vollständig und prägnant?) und erarbeiten sich dabei Kriterien zur Beurteilung einer Fallpräsentation. (Hinweis: Ziel dabei ist nicht, einen Fall zu lösen und Interventionsmöglichkeiten zu entwerfen.) Hinweis: Falls ein/e Studierende die Fallpräsentation nicht bei der zweiten Gruppensitzung realisieren konnte, organisiert er/sie eine Gruppensitzung mit einer Studierendengruppe und lädt ein Video oder Foto der Fallpräsentation auf OLAT hoch. 5 Mai 2017/uh, sk, mg
6 3. Aufgabenstellung: Fallbearbeitung in Kooperation Zielsetzung dieser Aufgabenstellung ist, dass die Studierenden als reflektierende Akteure bzw. Akteurinnen in der Kooperation mit Klientinnen und Klienten eine Teilaufgabe aus dem Prozessgestaltungsmodell planen und durchführen und dabei ausgewählte Methoden einsetzen sowie das eigene Vorgehen anschliessend differenziert reflektieren können. SW 6 8/9 (KW 43 45) Bearbeitung hochladen vor der nächsten 3a) Wahl eines passenden Ausschnittes für die Prozessgestaltung Klären Sie auf der Grundlage von Aufgabe 2a, welchen Prozessgestaltungausschnitt d.h. welche(n) Prozessschritte(e) Sie auswählen und begründen Sie diese Auswahl. Legen Sie dar, auf welche konkreten Vorarbeiten in der Prozessgestaltung aufgebaut werden kann (z.b. Ergebnisse aus Analyse / Diagnose konkret nennen!). Umfang: ca. ½ - 1 S, Fliesstext 3b) Vorüberlegungen zum methodischen Vorgehen und zur Kooperation -Erörtern Sie, welche Methoden/Vorgehensweisen in Bezug auf die ausgewählten Prozessschritte in Frage kommen (mindestens zwei unterschiedliche Ideen; mit Quellenangaben!). Wählen Sie geeignete Methoden aus; begründen und reflektieren Sie diese Methodenauswahl kritisch (u.a. inwiefern diese zur Organisation passen, sie für die Klientin/die Adressatengruppe förderlich sind). -Stellen Sie ausserdem konkrete Überlegungen an, wie Sie die Kooperation mit der Klientin (bzw. Adressatengruppe) gestalten wollen, worauf es zu achten gilt, etc. Umfang: ca. 1 ½ - 2 S, Fliesstext SW 9 (KW 46) Dritte Olten: Basel: Uhr SW (KW 47 50) Aufgabenstellung für die 3c) Diskussion der fallbezogenen Vorüberlegungen Jede/r Studierende stellt die eigenen Überlegungen zur Prozessgestaltung mündlich vor. Die Gruppe diskutiert diese wohlwollend-kritisch und erarbeitet Hinweise zur Modifikation. Hinweis: -Falls ein/e Studierende die eigenen fallbezogenen Überlegungen an dieser nicht zur Diskussion stellen konnte, organisiert er / sie Gruppensitzung mit einer Studierendengruppe, um eine Rückmeldung zu bekommen. -Ausserdem holt er eine schriftliche Rückmeldungen der/des Dozierenden über OLAT ein, bevor sie/er mit der Umsetzung beginnt. 3d) Dokumentation der Rückmeldung Fassen Sie die Rückmeldungen der Gruppe und des/der Dozentin kurz zusammen; nennen Sie dabei drei wesentliche Aspekte. Umfang: ca. ¼ bis ½ S. Hinweis: Fast immer ergibt sich aufgrund dieser Rückmeldungen Notwendigkeit, die Aufgaben 3a und 3b zu überarbeiten. 6 Mai 2017/uh, sk, mg
7 3e) Planung des Vorgehens Legen Sie nun dar, wie Sie methodisch ganz konkret vorgehen werden, was Sie beachten wollen, wie Sie die Methode an die Erfordernisse des Falles anpassen werden etc. Es soll klar werden, wann Sie was wo und mit wem tun werden. Begründen Sie, weshalb Sie sich für dieses Vorgehen entscheiden. Reflektieren Sie, welche Wirkungen Sie erwarten/welche Nebenfolgen allenfalls eintreten könnten (und was Sie diesbezüglich vorkehren). Umfang: ca. 1-1 ½ S, Fliesstext 3f) Realisierung des geplanten Prozessgestaltungsausschnitts in Kooperation Setzen Sie das Vorgehen in Kooperation mit der Klientin bzw. dem Klient/der Adressatengruppe bzw. Adressat(inn)engruppe (im Rahmen des Praxismoduls) um. Dokumentieren Sie diese Umsetzung inhalts- und prozessbezogen, in prägnanter Weise und vollständig (wo möglich mit Dokumenten zur Umsetzung als Anhang zum besseren Verständnis). Umfang: ca. 1½ S., Fliesstext SW 14 (KW 5) SW 14 /15 (KW 51/01) SW 15 (KW 02) Vierte Olten: Basel: Uhr Aufgabenstellung für die Rückmeldung der Studierenden untereinander 3g) Rückmeldung zur Fallbearbeitung in der Organisation (Feedback jeweils in den Ordner der Mitstudierenden einfügen!) Woran erkennen Sie die unter 1a und 1b dokumentierten organisationalen Aspekte (Organisationsauftrag, Organisationspraktiken) in der nun beschriebenen Auswahl des Prozessausschnitts, der Planung des methodischen Vorgehens und der konkreten Umsetzung (3a bis 3f)? Wo entdecken Sie ggf. Widersprüche, Unklarheiten oder Paradoxien, die es sich zu reflektieren lohnt? 3h) Reflexion -Reflektieren Sie Ihr Vorgehen abschliessend in Hinblick auf mindestens drei ausgewählte Aspekte (z.b. Differenzen zwischen Planung und Realisierung, unerwartete besondere Anforderungen, Gestaltung der Kooperation, etc.). Dabei soll Gelungenes ebenso benannt werden wie Irritationen/Stolpersteine. Benennen Sie dabei stets die Ebene der Reflexion (Klientinnen/Klienten eigene Person organisationale Rahmenbedingungen Methodenwissen). -Leiten Sie insgesamt mindestens zwei Folgerungen daraus ab. -Die Dozierenden können bei Bedarf zusätzliche Reflexionsaufgaben stellen. Umfang: ca. 1½ S., Fliesstext Aufgabenstellung für die 3i) Reflexion und Evaluation -Jede/r Studierende stellt ausgewählte Aspekte der Umsetzung vor. - Unterschiede zwischen den Organisationen und Organisationspraxen werden herausgearbeitet. - Es werden relevante Aspekte für die Reflexion herausgearbeitet und mögliche Folgerungen diskutiert. -Gemeinsam werden Erkenntnisse zur Theorie-Praxis-Relationierung erarbeitet und der Stellenwert von Theoriewissen in der Praxis wird diskutiert. -Die Gruppe wertet gemeinsam den Kurs und die Zusammenarbeit aus. 7 Mai 2017/uh, sk, mg
8 Qualifikation SW 15/16 (KW 02/03) Montag, SW 16 (KW 03) Freitag, Alle Aufgabenstellungen sind abgeschlossen, die Dokumentation liegt vor. Alle fortlaufenden Rückmeldungen der Dozierenden zu Überarbeitungsbedarf sind umgesetzt worden. Über OLAT teilt die Dozentin/der Dozent mit (bzw. haben bereits mitgeteilt), ob alle Voraussetzungen für die Erteilung des Attests erfüllt sind. 8 Mai 2017/uh, sk, mg
Kasuistik im Bachelor-Studium Soziale Arbeit. Das Modul 136 «Im Kontext von Disziplin und Profession»
 Kasuistik im Bachelor-Studium Soziale Arbeit Das Modul 136 «Im Kontext von Disziplin und Profession» Relationierung von Theorie und Praxis Praxis(ausbildung) (Module) Professionelles Handlungswissen Alltagswissen
Kasuistik im Bachelor-Studium Soziale Arbeit Das Modul 136 «Im Kontext von Disziplin und Profession» Relationierung von Theorie und Praxis Praxis(ausbildung) (Module) Professionelles Handlungswissen Alltagswissen
Kooperative Prozessgestaltung in der eigenen Praxisorganisation. Praxistagung vom 10. September Ursula Hochuli Freund Raphaela Ursprung
 Kooperative Prozessgestaltung in der eigenen Praxisorganisation Praxistagung vom 10. September 2014 Ursula Hochuli Freund Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots Die Bedeutung des Konzepts Kooperative
Kooperative Prozessgestaltung in der eigenen Praxisorganisation Praxistagung vom 10. September 2014 Ursula Hochuli Freund Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots Die Bedeutung des Konzepts Kooperative
Verbindliche Vorgaben zum Prüfungsteil 1: Projektarbeit
 Verbindliche Vorgaben zum Prüfungsteil 1: Projektarbeit Der Prüfungsteil 1 besteht aus: 1. der schriftlichen Projektarbeit 2. der Präsentation der Projektarbeit und 3. dem Fachgespräch über die schriftliche
Verbindliche Vorgaben zum Prüfungsteil 1: Projektarbeit Der Prüfungsteil 1 besteht aus: 1. der schriftlichen Projektarbeit 2. der Präsentation der Projektarbeit und 3. dem Fachgespräch über die schriftliche
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft. Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit. Modul-Handbuch
 Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft Wahlpflichtbereich Soziale Arbeit Modul-Handbuch Stand 01.02.2014 Modul I: Einführung und Grundlagen Soziale Arbeit 1 Semester 3. Semester 6 180 h 1 Einführung
Was gehört dazu? Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Stephan Kösel (Olten) Wilhelm Bach (Basel)
 Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Stephan Kösel (Olten) Wilhelm Bach (Basel) Was gehört dazu? Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration Studienzentrum Hochschule für Soziale
Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Stephan Kösel (Olten) Wilhelm Bach (Basel) Was gehört dazu? Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration Studienzentrum Hochschule für Soziale
Kooperative Diagnostik: Ausgestaltung und Herausforderungen
 Kooperative Diagnostik: Ausgestaltung und Herausforderungen Praxistagung vom 08. September 2015 Kathrin Schreiber Ziele dieses Angebots Bedeutung und Stellenwert von Diagnostik in der Sozialen Arbeit ist
Kooperative Diagnostik: Ausgestaltung und Herausforderungen Praxistagung vom 08. September 2015 Kathrin Schreiber Ziele dieses Angebots Bedeutung und Stellenwert von Diagnostik in der Sozialen Arbeit ist
Life Sciences und Facility Management
 Merkblatt zur Projektarbeit im 3. Semester FM 1 Rahmenbedingungen Grundlagen Projekt-, Literatur-, Semester-, Bachelor- und Masterarbeiten durchführen (A235-01) Mitgeltende Weisungen Merkblatt zur Manuskripterstellung
Merkblatt zur Projektarbeit im 3. Semester FM 1 Rahmenbedingungen Grundlagen Projekt-, Literatur-, Semester-, Bachelor- und Masterarbeiten durchführen (A235-01) Mitgeltende Weisungen Merkblatt zur Manuskripterstellung
Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln!
 Inwiefern ist professionelles Handeln kooperatives Handeln? Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln! Praxistagung vom 28. Januar 2015 Kathrin Schreiber Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots
Inwiefern ist professionelles Handeln kooperatives Handeln? Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln! Praxistagung vom 28. Januar 2015 Kathrin Schreiber Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG IN BERATUNG IM PSYCHOSOZIALEN BEREICH EINSCHÄTZUNGSBOGEN ZU PRÜFUNGSTEIL 2 BERATUNGSKONZEPT
 SCHRIFTLICHE PRÜFUNG IN BERATUNG IM PSYCHOSOZIALEN BEREICH EINSCHÄTZUNGSBOGEN ZU PRÜFUNGSTEIL BERATUNGSKONZEPT KANDIDAT/IN DATUM Der/Die Kandidat/in beschreibt ein persönliches Beratungskonzept, das über
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG IN BERATUNG IM PSYCHOSOZIALEN BEREICH EINSCHÄTZUNGSBOGEN ZU PRÜFUNGSTEIL BERATUNGSKONZEPT KANDIDAT/IN DATUM Der/Die Kandidat/in beschreibt ein persönliches Beratungskonzept, das über
Was gehört dazu? Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Claudia Roth (Olten) Ursula Hellmüller (Basel)
 Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Claudia Roth (Olten) Ursula Hellmüller (Basel) Was gehört dazu? Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration Studienzentrum Hochschule für
Praxisausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Claudia Roth (Olten) Ursula Hellmüller (Basel) Was gehört dazu? Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration Studienzentrum Hochschule für
Vorwort Vorwort zur dritten Auflage Inhaltsverzeichnis Einleitung... 15
 Vorwort... 5 Vorwort zur dritten Auflage... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 1 Einleitung... 15 Teil I 2 Soziale Arbeit... 23 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit... 23 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und
Vorwort... 5 Vorwort zur dritten Auflage... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 1 Einleitung... 15 Teil I 2 Soziale Arbeit... 23 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit... 23 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und
Inhaltsverzeichnis. Teil I Vorwort Einleitung... 13
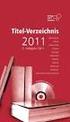 Vorwort..................................... 5 1 Einleitung................................ 13 Teil I............................... 19 2 Soziale Arbeit.............................. 21 2.1 Gegenstand
Vorwort..................................... 5 1 Einleitung................................ 13 Teil I............................... 19 2 Soziale Arbeit.............................. 21 2.1 Gegenstand
Planung einer Spiel- und Lernumgebung mit Schwerpunkt NMG
 Planung einer Spiel- und Lernumgebung mit Schwerpunkt NMG 1. Zielsetzung Die Studierenden zeigen ihre Kompetenzen in der Unterrichtsplanung in NMG für Kindergarten, Basis- oder Unterstufe auf, indem sie
Planung einer Spiel- und Lernumgebung mit Schwerpunkt NMG 1. Zielsetzung Die Studierenden zeigen ihre Kompetenzen in der Unterrichtsplanung in NMG für Kindergarten, Basis- oder Unterstufe auf, indem sie
Standards zur Unterrichtsqualität. Auf der Basis des kompetenzorientierten Leitbilds
 Standards zur Unterrichtsqualität Auf der Basis des kompetenzorientierten Leitbilds Agogis Unterrichtsstandards transparent gemacht Als grösste Bildungsanbieterin der Höheren Berufsbildung im Sozialbereich
Standards zur Unterrichtsqualität Auf der Basis des kompetenzorientierten Leitbilds Agogis Unterrichtsstandards transparent gemacht Als grösste Bildungsanbieterin der Höheren Berufsbildung im Sozialbereich
Vorwort 5. 1 Einleitung 13
 Vorwort 5 1 Einleitung 13 Teil I 19 2 Soziale Arbeit 21 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit 21 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und Sozialarbeit... 22 2.1.2 Soziale Arbeit als neuer Leitbegriff 25
Vorwort 5 1 Einleitung 13 Teil I 19 2 Soziale Arbeit 21 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit 21 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und Sozialarbeit... 22 2.1.2 Soziale Arbeit als neuer Leitbegriff 25
erstellen einen Bildungsbericht auf der Grundlage von konkreten Lernleistungen.
 1 Konzept Vertiefungsarbeit BBK Vertiefungsarbeit 1. Ausgangslage Der Zertifikatslehrgang schliesst mit einer Vertiefungsarbeit ab. In dieser Vertiefungsarbeit dokumentieren Sie exemplarisch einen Ausbildungszyklus,
1 Konzept Vertiefungsarbeit BBK Vertiefungsarbeit 1. Ausgangslage Der Zertifikatslehrgang schliesst mit einer Vertiefungsarbeit ab. In dieser Vertiefungsarbeit dokumentieren Sie exemplarisch einen Ausbildungszyklus,
Leitfaden zur Erstellung von Reporten
 Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden zur Erstellung von Reporten für den Prüfungsbereich Fachaufgabe in der Wahlqualifikation ( Report-Variante ) Stand: November 2017 1 von 8 Inhaltsverzeichnis
Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden zur Erstellung von Reporten für den Prüfungsbereich Fachaufgabe in der Wahlqualifikation ( Report-Variante ) Stand: November 2017 1 von 8 Inhaltsverzeichnis
Beurteilungsraster für die VWA
 Beurteilungsraster für die VWA Thema der VWA:... Prüfungskandidat/in:... Prüfer/in:... Der Beurteilungsraster für die vorwissenschaftliche Arbeit stellt eine unverbindliche Orientierungshilfe für die Bewertung
Beurteilungsraster für die VWA Thema der VWA:... Prüfungskandidat/in:... Prüfer/in:... Der Beurteilungsraster für die vorwissenschaftliche Arbeit stellt eine unverbindliche Orientierungshilfe für die Bewertung
Teamprojekt Tutorien Lernziele und Beurteilungskriterien
 Teamprojekt Tutorien Lernziele und Beurteilungskriterien 1. Grundlegendes Das Teamprojekt Tutorien besteht aus dem Abhalten eines Tutoriums, dem Besuch der Lehrveranstaltung, zu der das Tutorium angeboten
Teamprojekt Tutorien Lernziele und Beurteilungskriterien 1. Grundlegendes Das Teamprojekt Tutorien besteht aus dem Abhalten eines Tutoriums, dem Besuch der Lehrveranstaltung, zu der das Tutorium angeboten
Leitfaden zur Erstellung von Reporten
 Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden zur Erstellung von Reporten für den Prüfungsbereich Fachaufgabe in der Wahlqualifikation ( Report-Variante ) Stand: November 2017 1 von 8 Inhaltsverzeichnis
Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden zur Erstellung von Reporten für den Prüfungsbereich Fachaufgabe in der Wahlqualifikation ( Report-Variante ) Stand: November 2017 1 von 8 Inhaltsverzeichnis
Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz. Kooperative. Prozessgestaltung. in der Sozialen Arbeit. Ein methodenintegratives Lehrbuch
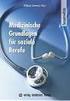 Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit Ein methodenintegratives Lehrbuch 3., überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Vorwort 5 Vorwort zur dritten Auflage
Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit Ein methodenintegratives Lehrbuch 3., überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Vorwort 5 Vorwort zur dritten Auflage
Leitfaden zum Transfermodul
 Hochschuldidaktisches Zertifikatsprogramm der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW Professionell lehren an der FHöV NRW Transfermodul Leitfaden zum Transfermodul Stand 09.01.2018 Inhalt 1. Ziele
Hochschuldidaktisches Zertifikatsprogramm der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW Professionell lehren an der FHöV NRW Transfermodul Leitfaden zum Transfermodul Stand 09.01.2018 Inhalt 1. Ziele
Zertifikat Hochschullehre. Bewertungskriterien des Lehrportfolios
 Zertifikat Hochschullehre Bewertungskriterien des Lehrportfolios Bewertungskriterien des Lehrportfolios Bitte lesen Sie diese Bewertungskriterien aufmerksam durch und nehmen diese beim Schreiben Ihres
Zertifikat Hochschullehre Bewertungskriterien des Lehrportfolios Bewertungskriterien des Lehrportfolios Bitte lesen Sie diese Bewertungskriterien aufmerksam durch und nehmen diese beim Schreiben Ihres
Didaktik Workshop FS10
 Didaktik Workshop FS10 Datum: März - August 2010 Leitung: Maria Papanikolaou Martina Dalla Vecchia 2010 1 Teaser Nachfolgendes Konzept wurde erstellt von Martina Dalla Vecchia im Rahmen des Didaktik- Workshops
Didaktik Workshop FS10 Datum: März - August 2010 Leitung: Maria Papanikolaou Martina Dalla Vecchia 2010 1 Teaser Nachfolgendes Konzept wurde erstellt von Martina Dalla Vecchia im Rahmen des Didaktik- Workshops
Multiperspektivische Fallarbeit
 Multiperspektivische Fallarbeit Prof. Dr. Christine Huth-Hildebrandt Dezember 15 Fallarbeit 1. Anamnese HvS: Beobachtungs- und Beschreibungswissen 2. Diagnose HvS: Erklärungs- und Begründungswissen 3.
Multiperspektivische Fallarbeit Prof. Dr. Christine Huth-Hildebrandt Dezember 15 Fallarbeit 1. Anamnese HvS: Beobachtungs- und Beschreibungswissen 2. Diagnose HvS: Erklärungs- und Begründungswissen 3.
Hinweise zur Anfertigung der Projektarbeiten. Fakultät Wirtschaft Studiengang BWL-Bank
 Hinweise zur Anfertigung der Projektarbeiten Fakultät Wirtschaft Studiengang BWL-Bank Stand: Januar 2013 2 Inhalt 1. Formaler Rahmen und Ziel 2. Thema 3. Gestaltung und Umfang 4. Zeitlicher Ablauf und
Hinweise zur Anfertigung der Projektarbeiten Fakultät Wirtschaft Studiengang BWL-Bank Stand: Januar 2013 2 Inhalt 1. Formaler Rahmen und Ziel 2. Thema 3. Gestaltung und Umfang 4. Zeitlicher Ablauf und
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten. Form:
 Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
Beurteilungsbogen für schriftliche Hausarbeiten Name der_des Student_in: Veranstaltung und Semester: Hausarbeitstitel: Länge: Datum: Form: Deckblatt 2 Auflistung aller notwendigen Informationen 1 Angemessene
1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden?
 Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
Leitfaden zur Lerndokumentation 1 Die Lerndokumentation 1.1 Was soll mit der Lerndokumentation erreicht werden? a. Zum Ersten dokumentieren die Lernenden während der beruflichen Grundbildung ihre Arbeit
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit. Studienabschnitt. 1./2. Semester
 BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
BA Modul 1: Einführung in die Sozialpädagogik und die Pädagogik der frühen Kindheit 1./2. Semester 12 LP 360 h Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ SWS 1 Einführung in die Soziale Arbeit V 4 LP 2 2 Einführung
Lernthema 6: Reflexion Berufsfachschule (BFS)
 Lernthema 6: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 6: Arbeiten dokumentieren Nach jedem Fachkurs schätzen Sie ein, wie weit Sie die Leistungsziele zur Dokumentation eigener Arbeiten erfüllt haben. Zusätzlich
Lernthema 6: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 6: Arbeiten dokumentieren Nach jedem Fachkurs schätzen Sie ein, wie weit Sie die Leistungsziele zur Dokumentation eigener Arbeiten erfüllt haben. Zusätzlich
Anhang zu den Ausführungsbestimmungen Prozesseinheiten
 Kauffrau/Kaufmann - Basisbildung Kauffrau/Kaufmann - Erweiterte Grundbildung Prüfungskommission Anhang zu den Ausführungsbestimmungen Prozesseinheiten Vorgaben der Prüfungskommission für die ganze Schweiz
Kauffrau/Kaufmann - Basisbildung Kauffrau/Kaufmann - Erweiterte Grundbildung Prüfungskommission Anhang zu den Ausführungsbestimmungen Prozesseinheiten Vorgaben der Prüfungskommission für die ganze Schweiz
Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand )
 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand 01.08.2012) Erläuterung Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Dokumentation
Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Dokumentation einer Unterrichtseinheit (Stand 01.08.2012) Erläuterung Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Dokumentation
Fachschule für Heilerziehungspflege Carl-Burger-Schule - BBS Mayen
 der Betreuungsbesuche Fachschule für Heilerziehungspflege Carl-Burger-Schule - BBS Mayen Name der Schülerin/ des Schülers: Einrichtung: Praxisanleitung: Kontakt (Telefon/E-mail): Übersicht der Betreuungsbesuche/Vermerke:
der Betreuungsbesuche Fachschule für Heilerziehungspflege Carl-Burger-Schule - BBS Mayen Name der Schülerin/ des Schülers: Einrichtung: Praxisanleitung: Kontakt (Telefon/E-mail): Übersicht der Betreuungsbesuche/Vermerke:
Semester: Workload: 600 h ECTS Punkte: 20
 Modulbezeichnung: Masterarbeit Modulnummer: DLMMTH Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 600 h ECTS Punkte: 20 Zugangsvoraussetzungen: Gemäß
Modulbezeichnung: Masterarbeit Modulnummer: DLMMTH Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 600 h ECTS Punkte: 20 Zugangsvoraussetzungen: Gemäß
MA of-education Gymnasium/Oberschule BiPEB Großes Fach BiPEB Kleines Fach IP 1 Semester 1. Semester
 Stand 06.10.2015 Modulbeschreibungen für den Master of Education Kunst-Medien-Ästhetische Bildung: Grundschule kleines Fach M12b flicht/ Wahlpflicht Studien- und rüfungsleistungen rüfungsformen Vertiefung
Stand 06.10.2015 Modulbeschreibungen für den Master of Education Kunst-Medien-Ästhetische Bildung: Grundschule kleines Fach M12b flicht/ Wahlpflicht Studien- und rüfungsleistungen rüfungsformen Vertiefung
Qualifikation Praxismodul I für Vollzeitstudierende. im 2. Semester des Studiengangs. Bachelor of Science in Pflege. ohne speziellen Auftrag
 Qualifikation Praxismodul I für Vollzeitstudierende im. Semester des Studiengangs ohne speziellen Auftrag Verfasserin/Rückfragen an: Andrea Renz, MScN, Dozentin FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Qualifikation Praxismodul I für Vollzeitstudierende im. Semester des Studiengangs ohne speziellen Auftrag Verfasserin/Rückfragen an: Andrea Renz, MScN, Dozentin FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Referenzrahmen Schulqualität. Leitfaden für den Einsatz der Reflexionsbögen
 für den Einsatz der als Instrument für die Selbstvergewisserung und für die interne Bestandsaufnahme Die Frage nach der Wirksamkeit des täglichen professionellen Handelns ist grundlegend für eine Schule,
für den Einsatz der als Instrument für die Selbstvergewisserung und für die interne Bestandsaufnahme Die Frage nach der Wirksamkeit des täglichen professionellen Handelns ist grundlegend für eine Schule,
Persönliches Beratungskonzept. Leitfaden zur Erarbeitung
 Persönliches Beratungskonzept Leitfaden zur Erarbeitung Inhaltsverzeichnis 1 Personale und fachliche Voraussetzungen: Qualifikation, Kernkompetenzen...4 2 Menschenbild Ethische Grundsätze rechtliche Grundlagen...4
Persönliches Beratungskonzept Leitfaden zur Erarbeitung Inhaltsverzeichnis 1 Personale und fachliche Voraussetzungen: Qualifikation, Kernkompetenzen...4 2 Menschenbild Ethische Grundsätze rechtliche Grundlagen...4
Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Unterrichtsfach Deutsch
 Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Modul: Vermittlungsperspektiven der Germanistik (MLS 1 ) Studiengänge: Master-Studiengang für ein Lehramt an Haupt-,
Modulhandbuch zum Master-Studium für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen Modul: Vermittlungsperspektiven der Germanistik (MLS 1 ) Studiengänge: Master-Studiengang für ein Lehramt an Haupt-,
Informationen zum praxisbezogenen Studienprojekt
 Informationen zum praxisbezogenen Studienprojekt Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit (Stand: März 2018) 1. Das praxisbezogene Studienprojekt im Studiengang Soziale Arbeit
Informationen zum praxisbezogenen Studienprojekt Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit (Stand: März 2018) 1. Das praxisbezogene Studienprojekt im Studiengang Soziale Arbeit
Auswertung der Lehrveranstaltung»Konvergenz von Fernsehen und Internet I+II«- Seminar von Martin Emmer, Christian Strippel
 Auswertung der Lehrveranstaltung»Konvergenz von Fernsehen und Internet I+II«- Seminar 28600+28601 von Martin Emmer, Christian Strippel Liebe Dozentin, lieber Dozent, anbei erhalten Sie die Ergebnisse der
Auswertung der Lehrveranstaltung»Konvergenz von Fernsehen und Internet I+II«- Seminar 28600+28601 von Martin Emmer, Christian Strippel Liebe Dozentin, lieber Dozent, anbei erhalten Sie die Ergebnisse der
Arbeitsaufwand (workload) Moduldauer (laut Studienverlaufsplan) (laut Studienverlaufsplan)
 2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
2. BA. Studiengang Erziehungswissenschaft - Beifach Modul 1: Einführung in die Erziehungswissenschaft 300 h 1 Semester 1./2. Semester 10 LP 1. Lehrveranstaltungen/Lehrformen Kontaktzeit Selbststudium VL:
Auswertung zur Lehrveranstaltung "Debatten zur Kultur- und Medientheorie" - Seminar von Prof. Dr. Haarmann
 IfPuK Lehrveranstaltungsevaluation SoSe 2016 - Prof. Dr. Haarmann, LV 28624 Auswertung zur Lehrveranstaltung "Debatten zur Kultur- und Medientheorie" - Seminar 28624 von Prof. Dr. Haarmann Liebe Dozentin,
IfPuK Lehrveranstaltungsevaluation SoSe 2016 - Prof. Dr. Haarmann, LV 28624 Auswertung zur Lehrveranstaltung "Debatten zur Kultur- und Medientheorie" - Seminar 28624 von Prof. Dr. Haarmann Liebe Dozentin,
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit Einschreibung Studienjahr 2013/2014
 Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit Einschreibung Studienjahr 2013/2014 16. April 2013, Olten 18. April 2013, Basel 19. April 2013, Olten 22. April 2013, Olten 23. April 2013, Olten 26. April 2013, Basel
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit Einschreibung Studienjahr 2013/2014 16. April 2013, Olten 18. April 2013, Basel 19. April 2013, Olten 22. April 2013, Olten 23. April 2013, Olten 26. April 2013, Basel
Eidgenössische Berufsprüfung Spezialistin/Spezialist für angewandte Kinästhetik. Leitfaden zum Prüfungsteil 3
 Eidgenössische Berufsprüfung Spezialistin/Spezialist für angewandte Kinästhetik Leitfaden zum Prüfungsteil 3 Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorbereitung und Durchführung einer Anleitungssituation
Eidgenössische Berufsprüfung Spezialistin/Spezialist für angewandte Kinästhetik Leitfaden zum Prüfungsteil 3 Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorbereitung und Durchführung einer Anleitungssituation
E-Learning als Element innovativer Lehr-Lern-Zyklen
 E-Learning als Element innovativer Lehr-Lern-Zyklen Der Einsatz von E-Learning-Elementen am Beispiel des Moduls Einführung in die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens im berufsintegrierenden Bachelorstudiengang
E-Learning als Element innovativer Lehr-Lern-Zyklen Der Einsatz von E-Learning-Elementen am Beispiel des Moduls Einführung in die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens im berufsintegrierenden Bachelorstudiengang
Modul Projektarbeit: Kontext, Studienordnung, Rahmenbedingungen, Termine. Fakultät Medien Gabriele Hooffacker
 Modul Projektarbeit: Kontext, Studienordnung, Rahmenbedingungen, Termine Fakultät Medien Gabriele Hooffacker Viele Fragen... Wir sollen bereits zu unserer ersten Veranstaltung eine Idee mitbringen, welches
Modul Projektarbeit: Kontext, Studienordnung, Rahmenbedingungen, Termine Fakultät Medien Gabriele Hooffacker Viele Fragen... Wir sollen bereits zu unserer ersten Veranstaltung eine Idee mitbringen, welches
E-Didakik Beispiele: Gruppenarbeit und Peer- Feedback mit Wikis
 E-Didakik Beispiele: Gruppenarbeit und Peer- Feedback mit Wikis David Appel, E-Didaktik und E-Learning Support Ausgangspunkt detaillierte Analyse Wer sind die Zielpersonen, wer nutzt das Angebot? Welche
E-Didakik Beispiele: Gruppenarbeit und Peer- Feedback mit Wikis David Appel, E-Didaktik und E-Learning Support Ausgangspunkt detaillierte Analyse Wer sind die Zielpersonen, wer nutzt das Angebot? Welche
Geplante Anleitung in der praktischen Altenpflegeausbildung
 Geplante Anleitung in der praktischen Altenpflegeausbildung Vorgespräch Phase, in der Auszubildende die Praxisanleitung beobachten Phase, in der Auszubildende die Maßnahme unter Anleitung durchführen Phase,
Geplante Anleitung in der praktischen Altenpflegeausbildung Vorgespräch Phase, in der Auszubildende die Praxisanleitung beobachten Phase, in der Auszubildende die Maßnahme unter Anleitung durchführen Phase,
Prof. Dr. habil. Norbert Bach Unternehmensführung 2 - Methoden und Techniken Erfasste Fragebögen = 45
 Prof. Dr. habil. Norbert Bach Unternehmensführung - Methoden und Techniken Erfasste Fragebögen = Globalwerte Globalindikator + - mw=,8 + mw=,9 A. Qualität der Vorlesung im Allgemeinen - + mw=,8 B. Didaktische
Prof. Dr. habil. Norbert Bach Unternehmensführung - Methoden und Techniken Erfasste Fragebögen = Globalwerte Globalindikator + - mw=,8 + mw=,9 A. Qualität der Vorlesung im Allgemeinen - + mw=,8 B. Didaktische
Modulkatalog. Philosophische Fakultät. Grundlagen der Moralphilosophie. Programmformat: Minor 30. Studienstufe: Master. Gültig ab: Herbstsemester 2019
 Modulkatalog Grundlagen der Moralphilosophie Programmformat: Minor 30 Studienstufe: Master Gültig ab: Herbstsemester 2019 [Erstellt am 01.04.2019] Modulgruppen des Programms Allgemeine Ethik Moral und
Modulkatalog Grundlagen der Moralphilosophie Programmformat: Minor 30 Studienstufe: Master Gültig ab: Herbstsemester 2019 [Erstellt am 01.04.2019] Modulgruppen des Programms Allgemeine Ethik Moral und
Kurzbeschreibung Hintergrund und Zielsetzung
 Modul W2527: Peer-Mentoring II: Gestaltung eines Academic Mentoring Sommersemester 2017 Prof. Dr. H.-Hugo Kremer Kurzbeschreibung Hintergrund und Zielsetzung Im Anschluss an die Assessmentphase bietet
Modul W2527: Peer-Mentoring II: Gestaltung eines Academic Mentoring Sommersemester 2017 Prof. Dr. H.-Hugo Kremer Kurzbeschreibung Hintergrund und Zielsetzung Im Anschluss an die Assessmentphase bietet
QUALIFIKATIONSVERFAHREN Fachfrau Betreuung Kind 2017
 QUALIFIKATIONSVERFAHREN Fachfrau Betreuung Kind 2017 Informationen zur Aufgabenstellung IPA Die Aufgabenstellung erfolgt Anfangs Januar 2017 an die zuständige Berufsbildner/ Fachvorgesetzten durch die
QUALIFIKATIONSVERFAHREN Fachfrau Betreuung Kind 2017 Informationen zur Aufgabenstellung IPA Die Aufgabenstellung erfolgt Anfangs Januar 2017 an die zuständige Berufsbildner/ Fachvorgesetzten durch die
Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik
 1 Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik Inhaltsbereiche der Mathematik der Grundschule unter didaktischer Perspektive Stochastik in der Grundschule: Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit Kurs
1 Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik Inhaltsbereiche der Mathematik der Grundschule unter didaktischer Perspektive Stochastik in der Grundschule: Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit Kurs
eportfolio - ERNA Reflexionsmodul Interdisziplinarität I
 eportfolio - ERNA Reflexionsmodul Interdisziplinarität I Aisha Boettcher, M.Sc. Kristin Maria Käuper, M.Sc. Teilprojekt im Rahmen der BMBF Initiative Aufstieg durch Bildung Offene Hochschule Agenda Wer?
eportfolio - ERNA Reflexionsmodul Interdisziplinarität I Aisha Boettcher, M.Sc. Kristin Maria Käuper, M.Sc. Teilprojekt im Rahmen der BMBF Initiative Aufstieg durch Bildung Offene Hochschule Agenda Wer?
Modul BA 131 und BA 132
 Konzept für die Ausbildungssupervision Hochschule für Soziale Arbeit Definition Supervision Supervision ist die Betrachtung und Reflexion professionellen Handelns und institutioneller Strukturen. Im Mittelpunkt
Konzept für die Ausbildungssupervision Hochschule für Soziale Arbeit Definition Supervision Supervision ist die Betrachtung und Reflexion professionellen Handelns und institutioneller Strukturen. Im Mittelpunkt
Vorlesung "Grundlagen der Schaltungstechnik (V)"
 Technische Universität Ilmenau Zentralinstitut für Bildung (ZIB), Evaluation EvaSys Administratorin Prof. Dr. Ralf Sommer (PERSÖNLICH) Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Mikro-
Technische Universität Ilmenau Zentralinstitut für Bildung (ZIB), Evaluation EvaSys Administratorin Prof. Dr. Ralf Sommer (PERSÖNLICH) Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Institut für Mikro-
Stefan Kratzenstein Bewegungswissenschaftliche Perspektiven Erfasste Fragebögen = 17. Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
 Stefan Kratzenstein 009 Bewegungswissenschaftliche Perspektiven Erfasste Fragebögen = 7 Globalwerte Globalindikator. Aussagen zur Lehrveranstaltung mw=, mw=,. Aussagen zur Lehrperson mw=,. Aussagen zur
Stefan Kratzenstein 009 Bewegungswissenschaftliche Perspektiven Erfasste Fragebögen = 7 Globalwerte Globalindikator. Aussagen zur Lehrveranstaltung mw=, mw=,. Aussagen zur Lehrperson mw=,. Aussagen zur
Kompetenzprofil der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW: Stufe Master
 Kompetenzprofil der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW: Stufe Master Allgemeine Qualifikationsdeskriptoren in Anlehnung an die "Dublin Descriptors" auf Stufe Master Wissen und Verstehen: MA-Level-Abschlüsse
Kompetenzprofil der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW: Stufe Master Allgemeine Qualifikationsdeskriptoren in Anlehnung an die "Dublin Descriptors" auf Stufe Master Wissen und Verstehen: MA-Level-Abschlüsse
» Fallstudie Schriftliche Einzelarbeit, ca Seiten. » Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus:
 » Fallstudie Schriftliche Einzelarbeit, ca. 9-12 Seiten» Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus: Präsentation der Fallstudie Fachgespräch zur Fallstudie Informationsveranstaltung
» Fallstudie Schriftliche Einzelarbeit, ca. 9-12 Seiten» Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus: Präsentation der Fallstudie Fachgespräch zur Fallstudie Informationsveranstaltung
Münsteraner Fragebogen zur Evaluation - Zusatzmodul Basistexte (MFE-ZBa)
 Zusatzmodul Basistexte (MFE-ZBa) Völlig 1. Die zu bearbeitenden Basistexte waren verständlich. Die Basistexte hatten einen klaren Bezug zu den während der Sitzungen behandelten Themen. Der/Die Lehrende
Zusatzmodul Basistexte (MFE-ZBa) Völlig 1. Die zu bearbeitenden Basistexte waren verständlich. Die Basistexte hatten einen klaren Bezug zu den während der Sitzungen behandelten Themen. Der/Die Lehrende
Im Kolloqium wählen Sie eine dieser Säule aus und stellen in Ihrer Präsentation dar, wie sich diese Gegebenheiten auf die anderen Säulen auswirken.
 Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Gymnasium Tiergarten Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente
 Gymnasium Tiergarten Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente 21.03.18 Die besondere Lernleistung 1. Definition 2. Formen 3. Anforderungen
Gymnasium Tiergarten Herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente 21.03.18 Die besondere Lernleistung 1. Definition 2. Formen 3. Anforderungen
Kompetenzprofil für Praxisausbildende in der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
 Kompetenzprofil für Praxisausbildende in der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Die Praxisausbildung ist ein konstitutives Element der Ausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit
Kompetenzprofil für Praxisausbildende in der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Die Praxisausbildung ist ein konstitutives Element der Ausbildung an der Hochschule für Soziale Arbeit
Lernthema 21: Reflexion Berufsfachschule (BFS)
 Lernthema 21: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 21: Geotechnische und hydrogeologische Arbeiten ausführen Nach jedem Fachkurs schätzen Sie ein, wie weit Sie die Leistungsziele zur Unterstützung von geotechnischen
Lernthema 21: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 21: Geotechnische und hydrogeologische Arbeiten ausführen Nach jedem Fachkurs schätzen Sie ein, wie weit Sie die Leistungsziele zur Unterstützung von geotechnischen
Intercampus XI: Motivation und Lernerfolg durch innovative Lehr-, Lern- und Prüfungsformen aus Lehrenden- und Studierendensicht
 Intercampus XI: Motivation und Lernerfolg durch innovative Lehr-, Lern- und Prüfungsformen aus Lehrenden- und Studierendensicht Prof. Dr. Beatrix Dietz, Frauke Fuhrmann Hochschule für Wirtschaft und Recht
Intercampus XI: Motivation und Lernerfolg durch innovative Lehr-, Lern- und Prüfungsformen aus Lehrenden- und Studierendensicht Prof. Dr. Beatrix Dietz, Frauke Fuhrmann Hochschule für Wirtschaft und Recht
3. THEMATISCHES BOLOGNA SEMINAR SCHWERPUNKT: EMPLOYABILITY FORUM 1: CURRICULUMSENTWICKUNG & QUALIFIKATIONSPROFILE
 3. THEMATISCHES BOLOGNA SEMINAR SCHWERPUNKT: EMPLOYABILITY FORUM 1: CURRICULUMSENTWICKUNG & QUALIFIKATIONSPROFILE ERFOLGSFAKTOR CURRICULUM LEBENSZYKLUS CURRICULUM IM EINKLANG MIT DER STRATEGIE Susanna
3. THEMATISCHES BOLOGNA SEMINAR SCHWERPUNKT: EMPLOYABILITY FORUM 1: CURRICULUMSENTWICKUNG & QUALIFIKATIONSPROFILE ERFOLGSFAKTOR CURRICULUM LEBENSZYKLUS CURRICULUM IM EINKLANG MIT DER STRATEGIE Susanna
Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform
 Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform o Grundinformationen zur Praxisausbildung im VZ/TZ-Modus o Hinweise zur Stellensuche o Informationen zur Praxisplattform Modulleitung: Marc Goldoni (OL) Wilhelm
Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform o Grundinformationen zur Praxisausbildung im VZ/TZ-Modus o Hinweise zur Stellensuche o Informationen zur Praxisplattform Modulleitung: Marc Goldoni (OL) Wilhelm
Stand: Semester: Dauer: Modulnummer: MMTH. Minimaldauer 1 Semester. Modultyp: Regulär angeboten im: WS, SS. Pflicht
 Modulbezeichnung: Masterarbeit Modulnummer: MMTH Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 900 h ECTS Punkte: 30 Zugangsvoraussetzungen: keine
Modulbezeichnung: Masterarbeit Modulnummer: MMTH Semester: -- Dauer: Minimaldauer 1 Semester Modultyp: Pflicht Regulär angeboten im: WS, SS Workload: 900 h ECTS Punkte: 30 Zugangsvoraussetzungen: keine
Praxisausbildung im Bachelor-
 Praxisausbildung im Bachelor- Studium in Sozialer Arbeit Einführung in die Vollzeit/Teilzeit Praxisausbildung in Organisationen Willi Bach Marc Goldoni Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration
Praxisausbildung im Bachelor- Studium in Sozialer Arbeit Einführung in die Vollzeit/Teilzeit Praxisausbildung in Organisationen Willi Bach Marc Goldoni Fachstelle Praxisausbildung und Wissensintegration
Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar
 Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar Liebe Studentinnen und Studenten, die Universität Oldenburg möchte die Situation der Lehre kontinuierlich verbessern. Dieser Fragebogen ist ein wichtiger
Fragebogen zur Lehrveranstaltungsevaluation Seminar Liebe Studentinnen und Studenten, die Universität Oldenburg möchte die Situation der Lehre kontinuierlich verbessern. Dieser Fragebogen ist ein wichtiger
Die vorwissenschaftliche Arbeit B E N O T U N G U N D B E U R T E I L U N G
 Die vorwissenschaftliche Arbeit B E N O T U N G U N D B E U R T E I L U N G 3 Teilgebiete der Benotung -alle drei Teilgebiete müssen positiv sein -in allen drei Teilgebieten müssen Kompetenzen nachgewiesen
Die vorwissenschaftliche Arbeit B E N O T U N G U N D B E U R T E I L U N G 3 Teilgebiete der Benotung -alle drei Teilgebiete müssen positiv sein -in allen drei Teilgebieten müssen Kompetenzen nachgewiesen
Leistungsbewertung Chemie. Sekundarstufe 1
 Leistungsbewertung Chemie Sekundarstufe 1 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Chemie in der Sekundarstufe I Die Leistungserwartungen in der Sekundarstufe I beziehen sich auf die im Unterricht erworbenen
Leistungsbewertung Chemie Sekundarstufe 1 Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Chemie in der Sekundarstufe I Die Leistungserwartungen in der Sekundarstufe I beziehen sich auf die im Unterricht erworbenen
UNTERNEHMENSPROJEKTE
 UNTERNEHMENSPROJEKTE Master of Science in Business Administration für Nicht- Wirtschaftswissenschaftler HOCHSCHULE MAINZ FACHBEREICH WIRTSCHAFT (Stand: 10.2014) Erläuterungen zu den Unternehmensprojekten
UNTERNEHMENSPROJEKTE Master of Science in Business Administration für Nicht- Wirtschaftswissenschaftler HOCHSCHULE MAINZ FACHBEREICH WIRTSCHAFT (Stand: 10.2014) Erläuterungen zu den Unternehmensprojekten
Herzlich willkommen GYMNASIUM TIERGARTEN. Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente im Abitur 2016
 GYMNASIUM TIERGARTEN Herzlich willkommen Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente im Abitur 2016 10.03.15 Informationen zur BLL / Lingnau 1 Die besondere
GYMNASIUM TIERGARTEN Herzlich willkommen Informationsveranstaltung: Die besondere Lernleistung im Rahmen der 5. Prüfungskomponente im Abitur 2016 10.03.15 Informationen zur BLL / Lingnau 1 Die besondere
Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten. Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I. Erweiterungsstudiengang
 Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I Erweiterungsstudiengang Interkulturelle Pädagogik Interkulturelle Pädagogik Modul Nr. 1 Bildungsforschung
Modulhandbuch Pädagogische Hochschule Weingarten Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen WHRPO I Erweiterungsstudiengang Interkulturelle Pädagogik Interkulturelle Pädagogik Modul Nr. 1 Bildungsforschung
Leitfaden zur Vorbereitung einer Masterarbeit Themenfindung und Erstellung eines Exposés
 Professur für Wirtschaftsinformatik II www.wi2.uni-trier.de Leitfaden zur Vorbereitung einer Masterarbeit Themenfindung und Erstellung eines Exposés Erstellt von der Professur für Wirtschaftsinformatik
Professur für Wirtschaftsinformatik II www.wi2.uni-trier.de Leitfaden zur Vorbereitung einer Masterarbeit Themenfindung und Erstellung eines Exposés Erstellt von der Professur für Wirtschaftsinformatik
Praxistagung Januar 2016
 Praxistagung Januar 2016 Intervision auf der Basis des Reflexionsmodelles Schlüsselsituationen (IMS): Eine Anleitung, wie durch einen strukturiert geführten Dialog, Qualität und Professionalität im Praxisalltag
Praxistagung Januar 2016 Intervision auf der Basis des Reflexionsmodelles Schlüsselsituationen (IMS): Eine Anleitung, wie durch einen strukturiert geführten Dialog, Qualität und Professionalität im Praxisalltag
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit
 Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit Praxisausbildung Elisabeth Kaufmann Wilhelm Bach Hochschule für Soziale Arbeit FHNW vierfache Leistungsauftrag Ausbildung (Lehre) Weiterbildung Forschung und Entwicklung
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit Praxisausbildung Elisabeth Kaufmann Wilhelm Bach Hochschule für Soziale Arbeit FHNW vierfache Leistungsauftrag Ausbildung (Lehre) Weiterbildung Forschung und Entwicklung
EDi Evaluation im Dialog
 iskussion Ei Evaluation im ialog Sommersemester 2015 Veranstaltung Evaluieren geht über Studieren Werner Beispieldozent Befragung der Studierenden am 25.05.2015 (N=6) Fragebogen für Seminare und Veranstaltungen
iskussion Ei Evaluation im ialog Sommersemester 2015 Veranstaltung Evaluieren geht über Studieren Werner Beispieldozent Befragung der Studierenden am 25.05.2015 (N=6) Fragebogen für Seminare und Veranstaltungen
» Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus:
 » Fallstudie Schriftliche Einzelarbeit, ca. 9-12 Seiten» Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus: Präsentation der Fallstudie Fachgespräch zur Fallstudie Informationsveranstaltung
» Fallstudie Schriftliche Einzelarbeit, ca. 9-12 Seiten» Die Fallstudie ist die Grundlage für die Präsenzprüfung bestehend aus: Präsentation der Fallstudie Fachgespräch zur Fallstudie Informationsveranstaltung
Andreas Kattler Übung zur Vorlesung Methoden und Statistik (WS18/19) Erfasste Fragebögen = 19; Rücklaufquote: 61.3%
 Andreas Kattler Übung zur Vorlesung Methoden und Statistik (WS8/9) Erfasste Fragebögen = 9; Rücklaufquote:.% Legende Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert Fragetext Linker Pol % % %
Andreas Kattler Übung zur Vorlesung Methoden und Statistik (WS8/9) Erfasste Fragebögen = 9; Rücklaufquote:.% Legende Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert Fragetext Linker Pol % % %
Wegleitung zu Modulprüfung
 Wegleitung zu Modulprüfung Persönliches Management Version 22.04.2010 01.11.201 Seite 1 Richtziele Der Kandidat / die Kandidatin kann sein / ihr fachliches und persönliches Entwicklungspotenzial einschätzen.
Wegleitung zu Modulprüfung Persönliches Management Version 22.04.2010 01.11.201 Seite 1 Richtziele Der Kandidat / die Kandidatin kann sein / ihr fachliches und persönliches Entwicklungspotenzial einschätzen.
Praxisordnung Bachelor Studiengang Soziale Arbeit Modul 17 Studienbegleitendes Praktikum/Praxisprojekt
 1 Praxisordnung Bachelor Studiengang Soziale Arbeit Modul 17 Studienbegleitendes Praktikum/Praxisprojekt Kapitel I Regelungen zu Umfang, Zielen, Aufgaben und Formen des Studienbegleitenden Praktikums/Praxisprojekt
1 Praxisordnung Bachelor Studiengang Soziale Arbeit Modul 17 Studienbegleitendes Praktikum/Praxisprojekt Kapitel I Regelungen zu Umfang, Zielen, Aufgaben und Formen des Studienbegleitenden Praktikums/Praxisprojekt
Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform
 Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform o Grundinformationen zur Praxisausbildung im VZ/TZ-Modus o Hinweise zur Stellensuche o Informationen zur Praxisplattform Modulleitung: Marc Goldoni, Stephan
Willkommen zur Eröffnung der Praxisplattform o Grundinformationen zur Praxisausbildung im VZ/TZ-Modus o Hinweise zur Stellensuche o Informationen zur Praxisplattform Modulleitung: Marc Goldoni, Stephan
Kriterien für die Planung und Reflexion von Projekten und Aktivitäten
 Blatt 2.13.: Informations- und Arbeitsblätter zum BPJ am Käthe- Kollwitz Berufskolleg Hagen. Stand 20.07.2011 Seite 1 von 5 Kriterien für die Planung und Reflexion von Projekten und Aktivitäten Vor der
Blatt 2.13.: Informations- und Arbeitsblätter zum BPJ am Käthe- Kollwitz Berufskolleg Hagen. Stand 20.07.2011 Seite 1 von 5 Kriterien für die Planung und Reflexion von Projekten und Aktivitäten Vor der
Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden für die Reporterstellung
 Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden für die Reporterstellung Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/- frau für Büromanagement vom 11. Dezember 2013 soll der Prüfling lt.
Kaufmann/-frau für Büromanagement Leitfaden für die Reporterstellung Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/- frau für Büromanagement vom 11. Dezember 2013 soll der Prüfling lt.
Lehrstuhl für Schulpädagogik mit Schwerpunkt Mittelschule Prof. Dr. Thomas Eberle Stand: Juni 2014
 1 Modulbezeichnung Hauptschulpädagogik 6 ECTS 2 Lehrveranstaltungen Seminar aus dem Bereich Hauptschulpädagogik (UnivIS-Kennzeichnung Seminar aus dem Bereich Hauptschulpädagogik (UnivIS-Kennzeichnung Seminar
1 Modulbezeichnung Hauptschulpädagogik 6 ECTS 2 Lehrveranstaltungen Seminar aus dem Bereich Hauptschulpädagogik (UnivIS-Kennzeichnung Seminar aus dem Bereich Hauptschulpädagogik (UnivIS-Kennzeichnung Seminar
Praktische Anleitesituation in der Altenpflegeausbildung Protokoll
 Praktische Anleitesituation in der Altenpflegeausbildung Protokoll Name des/der Auszubildenden: Einrichtung: Praktischer Ausbildungsabschnitt: Der/die Auszubildende wird angeleitet von: - Name der Pflegefachkraft,
Praktische Anleitesituation in der Altenpflegeausbildung Protokoll Name des/der Auszubildenden: Einrichtung: Praktischer Ausbildungsabschnitt: Der/die Auszubildende wird angeleitet von: - Name der Pflegefachkraft,
INTEGRIERTES FACHPRAKTIKUM DEUTSCH - INFORMATIONEN ZUM PRAKTIKUMSBERICHT
 INTEGRIERTES FACHPRAKTIKUM DEUTSCH - INFORMATIONEN ZUM PRAKTIKUMSBERICHT Leitung des Praktikums Prof. Dr. Wolfgang Boettcher Dr. Ralph Köhnen Dr. Thomas Lischeid Dr. Annette Mönnich Prof. Dr. Gerhard Rupp
INTEGRIERTES FACHPRAKTIKUM DEUTSCH - INFORMATIONEN ZUM PRAKTIKUMSBERICHT Leitung des Praktikums Prof. Dr. Wolfgang Boettcher Dr. Ralph Köhnen Dr. Thomas Lischeid Dr. Annette Mönnich Prof. Dr. Gerhard Rupp
Kompetenzprofil des Bachelor-Studiums der HSA FHNW
 Kompetenzprofil des Bachelor-Studiums der HSA FHNW Ausdifferenzierung und Operationalisierung Inhalt I. Kompetenzprofil der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW (Bachelor, Master, PhD)... 2 II: Ausdifferenzierung
Kompetenzprofil des Bachelor-Studiums der HSA FHNW Ausdifferenzierung und Operationalisierung Inhalt I. Kompetenzprofil der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW (Bachelor, Master, PhD)... 2 II: Ausdifferenzierung
MODULBESCHREIBUNG. letze Änderung: :00:11 Status: aktiviert Abhängige: M_BA
 Fachmodul Übersetzungen: Interne Informationen: Kurzzeichen: MODULBESCHREIBUNG en Preparation for Bachelor project Modul-Id: 18518 (Vorgänger) letze Änderung: 2018-04-23 16:00:11 Status: aktiviert Abhängige:
Fachmodul Übersetzungen: Interne Informationen: Kurzzeichen: MODULBESCHREIBUNG en Preparation for Bachelor project Modul-Id: 18518 (Vorgänger) letze Änderung: 2018-04-23 16:00:11 Status: aktiviert Abhängige:
Reflexionsbogen ausserschulisches Berufsfeldpraktikum Ziel 1
 Reflexionsbogen ausserschulisches Berufsfeldpraktikum Ziel 1 Ich verfüge über die Fähigkeit ein berufliches Handlungsfeld im Rahmen der Berufswelt zu erkunden und seine Relevanz für mein Studium und meinen
Reflexionsbogen ausserschulisches Berufsfeldpraktikum Ziel 1 Ich verfüge über die Fähigkeit ein berufliches Handlungsfeld im Rahmen der Berufswelt zu erkunden und seine Relevanz für mein Studium und meinen
