Einführung in die EPR-Spektroskopie. Björn Corzilius Wintersemester 2018/2019
|
|
|
- Siegfried Otto
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einführung in die EPR-Spektroskopie Björn Corzilius Wintersemester 2018/2019
2 Allgemeine Hinweise WS 2018/19 Vorlesung Dienstags 17:00-18:15 Uhr B2 Übung Dienstag 16:00-17:00 Uhr B2 2 SWS / 4 CP Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physikalischer & Theoretischer Chemie Weitere Vorlesungen aus dem Modul: Einführung in die Festkörper-NMR Spektroskopie Einführung in die Hochauflösende NMR Spektroskopie 2 Veranstaltungen für das Modul benötigt, 3 möglich; EPR ist verpflichtend zur Anerkennung Übungen zur Vorlesung: Übungsaufgaben auf der Webseite ( unter teaching Abgabe des bearbeiteten Übungsblattes in der darauf folgenden Übungsstunde Tutorin: Victoria Aladin (valadin@solidstatednp.com) Leistungsnachweis für EPR Spektroskopie: Klausur (oder mündliche Abschlussprüfung) Anmeldung ab letzter Semesterwoche im Sekretariat bei Frau Schneider N140/Raum17 1
3 Literatur Allgemein Chechik, Carter, Murphy: EPR, Oxford Chemistry Primers Lund et al.: Principles and Applications of ESR Spectroscopy, Springer 2011 Wertz & Bolton: ESR: Elementary Theory and Practical Applications, 1986 Weil & Bolton: EPR: Elementary Theory and Practical Applications, 2007 Carrington & McLachlan: Introduction to MR, Halper 1970 Eaton, Eaton, Weber: Quantitative EPR, Springer, 2010 Theorie Schweiger, Jeschke: Principles of pulse electron paramagnetic resonance, Oxford Press 2001 Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer 1980 Poole & Farach: Theorie of Magnetic Resonance, Wiley 1987 Levitt: Spin Dynamics, Wiley 2001 Skripte Jeschke: Vorlesungsskript Einführung in die ESR-Spektroskopie Buch-Kapitel Methods in Physical Chemistry, Wiley-VCH 2007 Haken & Wolf: Molekülphysik und Quantenchemie, Springer 1991 Organische Radikale Gersen, Huber: ESR Spectroscopy of Organic Radicals, 2003 Übergangsmetalle & Lanthanoide Abragam & Bleaney: EPR of Transition Ions, Oxford 1970 Pilbrow: Transition Ion EPR, Clarendon 1991 Anwendungen Drescher & Jeschke: EPR Spectroscopy Applications in Chemistry and Biology, Springer 2012 Misra: Multifrequency EPR: Theory and Applications, Wiley
4 Inhalt Allgemeines + Historisches Theoretische Grundlagen Pauli'sche Spinmatrizen Spin-Hamilton Operator Das EPR-Spektrometer Organische Radikale in Lösung Hyperfein-Wechselwirkung g-wert Organische Radikale im Festkörper Anisotrope Wechselwirkungen Übergangsmetallkomplexe im Festkörper S > 1/2 Nullfeldaufspaltung Puls-EPR Methoden Bloch-Gleichungen Kohärenz und Relaxation Hyperfein-Spektroskopie ENDOR ESEEM/HYSCORE Dipolare Spektroskopie PELDOR/DEER DQEPR RIDME Dynamische Kernpolarisation Overhauser DNP in Flüssigkeiten Solid State DNP 3
5 EPR und NMR Gemeinsame Geschichte und gemeinsame Zukunft? 4
6 1896: Zeeman-Effekt Natrium D-Linien Anomaler Zeeman-Effekt (Spin noch unbekannt) Pieter Zeeman *1865 (Zonnemaire, NL) 1943 (Amsterdam, NL) Niederländischer Physiker 1902 Nobelpreis für Physik Professor in Leiden und Amsterdam 5
7 Spin-Aufspaltung im starken Magnetfeld 6
8 1922: Stern Gerlach-Experiment Otto Stern *1888 (Sohrau, Ober-Schlesien) 1969 (Berkeley, Kalifornien) Habilitierte 1915 in Frankfurt Ab 1921 Privatdozent 1943 Nobelpreis für Physik Walter Gerlach *1889 (Biebrich) 1979 (München) Ab 1920 an Goethe-Uni (Extraordinarius Professor) 7
9 Stern Gerlach-Experiment 8
10 Stern Gerlach-Experiment ohne Magnetfeldgradient db 0 /dz mit Magnetfeldgradient Erwartung Beobachtung 9
11 1925: Postulation des Eigendrehimpulses George Uhlenbeck Hendrik Kramers Samuel Goudsmit Quantenmechanisches Modell des Spins durch Pauli und Dirac Magnetisches Spin-Moment µ = S gµ B S 10
12 Die quantenmechanische Rotation ( ) = E ( ) Hˆ ψ ϕ ψ ϕ J J J Randbedingungen: Ansonsten destruktive Interferenz! ( 0) J ( 2 ) ( ) ( ) ψ J ϕ = = ψ ϕ = π ψ J ϕ ψ J ϕ = ϕ ϕ ϕ= 0 ϕ= 2π 11
13 Symmetrie im 2D-Raum (ohne Spin!) Identität erreicht nach Winkel: φ = 2π φ = π φ = 2/3π Erlaubte Rotationsquantenzahlen: J = 0, 1, 2, 3, J = 0, 2, 4, 6, J = 0, 3, 6, 9, 12
14 Rotation mit Spin ortho-wasserstoff para-wasserstoff i 1 = 1/2 i 2 = 1/2 I = 1 drei mögliche Spin-Wellenfunktionen: i 1 = 1/2 i 2 = 1/2 I = 0 eine mögliche Spin-Wellenfunktionen: αα> ββ> ( αβ>+ βα>)/2 1/2 ( αβ> βα>)/2 1/2 Erlaubte Rotationsquantenzahlen: J = 1, 3, 5, 7, J = 0, 2, 4, 6, 13
15 Der Spin Rotationssymmetrie Spin-0 Spin-1 Spin-2 Spin-3 Spin-4 Spin Bosonen Fermionen Spin-1/2 720 Möbius-Band 14
16 Die Richtungsquantelung der Rotation Spin-Quantenzahl Spin-Drehimpuls S S ( 1) = S S + magnetische Spin-Quantenzahl S {, 1,, 1, } m = S S + S S z-komponente des Spin-Drehimpulses S e = S = m z z S halbzahlige S: Kramers-Systeme ganzzahlige S: nicht-kramers-systeme 15
17 Spin-Moment: Elektronenspin vs. Kernspin B 0 m I = +1/2 Elektron S = 1/2 γ e = 28.8 GHz/T m S = +1/2 m S = 1/2 m I = 1/2 γ = i qi 2m Proton I = 1/2 γ n = 42.6 MHz/T i g e geµ B γ e = g e = 2me γ = e gnµ n n gn 2m = p i 16
18 Wechselwirkung Dipol Feld Drehmoment M = µ m B potentielle Energie E m = µ B m 17
19 Zeeman-Aufspaltung ( S) = eµ B S 0 E m g mb ω E 2π = h = g e µ B h B 0 18
20 Rabi s 1. MR-Experiment: Aufbau Blende Blende Blende Blende Gradientenfeld Homogenes Magnetfeld Gradientenfeld Molekularstrahl RF senkrecht zu B 0 Detektor Spin-Übergänge in einem Spin-selektierten Molekularstrahl 19
21 1938: Rabi-Experiment Isidor Isaac Rabi *1898 (Rymanów, Galizien) 1988 (New York) Professor an Columbia University 1944 Nobelpreis für Physik Erstes NMR-Experiment ( 7 Li, 0.2 T, 3.5 MHz) 20
22 Rabi-Oszillationen 90 Puls 180 Puls Grundlage der (gepulsten) Magnetresonanz 21
23 1944: Zavoisky-Experiment Yevgeny Zavoisky *1907 (Mogilyov-Podolsk) 1976 (Moskau) Sovietischer Physiker Wissenschaftler in Kazan Detektion der EPR-Induktion 22
24 1946: Detektion der Kerninduktion Felix Bloch *1905 (Zürich) 1983 (Zürich) Edward Mills Purcell *1912 (Taylorville, Illinois) 1997 (Cambridge, Massachusetts) Professor in Stanford und Berkeley 1952 Nobelpreis für Physik Erste Detektion der NMR in flüssiger und fester Phase Professor an MIT und Harvard 1952 Nobelpreis für Physik Detektion der Kerninduktion Geburt der heutigen NMR 23
25 Protein-Strukturparameter durch MR Short/medium-distance Long-distance Å Å One-bond couplings (through bond/space) Connectivity/Assignments Chemical shift analysis Secondary structure elements Multi-bond couplings (through space) Solid-state + Solution NMR Secondary/tertiary structure, Solid-state inter-sheet/turn arrangement, NMR Electron electron couplings between spin-tags EPR (Jeschke, Prisner, ) Subunit arrangement, folding, ligand binding, Image: KcsA tetramer Endeward et al., JACS 2008 Paramagnetic shift analysis + relaxation enhancement (Bertini, Jaroniec, ) Solution + Solid-state NMR Local structure, folding, ligand binding, Image: Cobalt MMP-12, Balayssac et al., JACS
26 Protein-Strukturparameter durch MR Short/medium-distance Chemical shift analysis Long-distance Å Å One-bond couplings (through bond/space) Connectivity/Assignments geringer Solid-state between spin-tags + Solution EPR (Jeschke, Prisner, ) NMR Subunit arrangement, Secondary structure elements folding, ligand binding, Multi-bond couplings (through space) aufgrund kleiner NMR Secondary/tertiary structure, Solid-state inter-sheet/turn arrangement, NMR leidet an Electron electron couplings Empfindlichkeit Image: KcsA tetramer Endeward et al., JACS 2008 Paramagnetic shift analysis + relaxation enhancement thermischer Polarisation Solution + Solid-state NMR (Bertini, Jaroniec, ) Local structure, folding, ligand binding, Image: Cobalt MMP-12, Balayssac et al., JACS
27 Das Empfindlichkeits-Problem Spin-Polarisation N N γ B P N N kt α β 0 = = tanh α + β 2 β Absorption Netto-Signal P 0.01 % SNR ~ N 0.5 ~ P α fach längere Aufnahme i.v.z. vollst. Polarisation Stimulierte Emission 26
28 Wege zur Steigerung der Empfindlichkeit 9.4 T 263 GHz 100 K Spin-Polarisation N N γ B P N N kt α β 0 = = tanh α + β T 400 MHz 20 K % 150 mk T DNP! e 9.4 T 400 MHz 100 K 22.5 T 950 MHz 100 K B % % % 27
29 Wege zur Steigerung der Empfindlichkeit 9.4 T 263 GHz 100 K 150 mk DNP! Spin-Polarisation N N γ B P N N kt α β 0 = = tanh α + β 2 Polarisationsmittel + Mikrowellen = DNP e 9.4 T 400 MHz 100 K T B T 400 MHz 20 K % 22.5 T 950 MHz 100 K 6.3 % % % 28
30 Dynamische Kernpolarisation 1953 Postuliert durch Overhauser in leitfähigen Festkörpern Overhauser, Phys. Rev. 92, 411 (1953) Overhauser Effekt im gleichen Jahr von Carver und Slichter nachgewiesen Carver and Slichter, Phys. Rev. 92, 212 (1953) Erstmals DNP in nicht-leitenden FKs unabhängig von Jeffries, Uebersfeld und Abragam am Ende der 1950er Jeffries, Phys. Rev. 106, 164 (1957) Abraham et al., Phys. Rev. 106, 165 (1957) Erb, Motchane, and Uebersfeld, CR. Hebd. Acad. Sci. 246, 2121 (1958) Abragam and Proctor, CR. Hebd. Acad. Sci. 246, 2253 (1958). Spielwiese für Physiker während der 1960er und 70er Jahre Carver and Slichter, Phys. Rev. 92, 212 (1953) Seit 10 Jahren Renaissance im Hochfeld! 29
Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physik. & Theor. Chemie
 1. Einführung Seite 1 Allgemeine Hinweise WS 2016 Vorlesung Dienstags 17:00-18:15 Uhr B2 2 SWS / 4 CP Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physik. & Theor. Chemie
1. Einführung Seite 1 Allgemeine Hinweise WS 2016 Vorlesung Dienstags 17:00-18:15 Uhr B2 2 SWS / 4 CP Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physik. & Theor. Chemie
Einführung in die EPR-Spektroskopie. Björn Corzilius Wintersemester 2017/2018
 Einführung in die EPR-Spektroskopie Björn Corzilius Wintersemester 2017/2018 Allgemeine Hinweise WS 2017/18 Vorlesung Dienstags 17:00-18:15 Uhr B2 2 SWS / 4 CP Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen
Einführung in die EPR-Spektroskopie Björn Corzilius Wintersemester 2017/2018 Allgemeine Hinweise WS 2017/18 Vorlesung Dienstags 17:00-18:15 Uhr B2 2 SWS / 4 CP Modul: Einführung in die Theorie der Magnetischen
Vorlesung: Einführung in die EPR Spektroskopie
 Vorlesung: Einführung in die EPR Spektroskopie SS 2013 Dienstags 16-18 Uhr ct H2 2SWS / 4 CP Modul Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physik. & Theor. Chemie Weitere
Vorlesung: Einführung in die EPR Spektroskopie SS 2013 Dienstags 16-18 Uhr ct H2 2SWS / 4 CP Modul Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz Wahlpflichtmodul in Physik. & Theor. Chemie Weitere
3. Feinstruktur von Alkalispektren: Die gelbe D-Linie des Na ist ein Dublett, sollte aber nur eine Linie sein.
 13. Der Spin Experimentelle Fakten: 2. Normaler Zeeman-Effekt ist die Ausnahme: Meist sieht man den anormalen Zeeman-Effekt (Aufspaltung beobachtet, für die es keine normale Erklärung gab wegen Spin).
13. Der Spin Experimentelle Fakten: 2. Normaler Zeeman-Effekt ist die Ausnahme: Meist sieht man den anormalen Zeeman-Effekt (Aufspaltung beobachtet, für die es keine normale Erklärung gab wegen Spin).
Elektronenspinresonanz-Spektroskopie
 Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (ESR-Spektroskopie) engl.: Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy (EPR-Spectroscopy) Stephanie Dirksmeyer, 671197 Inhalt 1. Grundidee 2. physikalische Grundlagen
Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (ESR-Spektroskopie) engl.: Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy (EPR-Spectroscopy) Stephanie Dirksmeyer, 671197 Inhalt 1. Grundidee 2. physikalische Grundlagen
Festkörper-EPR-Messungen an Mn 2+ -dotierten Mg-Kristallen
 -1- EPR in Festkörpern Festkörper-EPR-Messungen an Mn + -dotierten Mg-Kristallen Die EPR-Spektren von Mn + bestehen aus einer großen Zahl von Linien. Das zweiwertige Mangan als d 5 - Ion hat einen 6 S
-1- EPR in Festkörpern Festkörper-EPR-Messungen an Mn + -dotierten Mg-Kristallen Die EPR-Spektren von Mn + bestehen aus einer großen Zahl von Linien. Das zweiwertige Mangan als d 5 - Ion hat einen 6 S
Versuch A8: Elektronenspinresonanz an paramagnetischen Molekülen (ESR)
 Fortgeschrittenenpraktikum Physik, FU-Berlin Versuch A8: Elektronenspinresonanz an paramagnetischen Molekülen (ESR) Jonas Lähnemann Antonia Oelke 29. Mai 2006 Elektronenspinresonanz an paramagnetischen
Fortgeschrittenenpraktikum Physik, FU-Berlin Versuch A8: Elektronenspinresonanz an paramagnetischen Molekülen (ESR) Jonas Lähnemann Antonia Oelke 29. Mai 2006 Elektronenspinresonanz an paramagnetischen
VL 17. VL16. Hyperfeinstruktur Hyperfeinstruktur Kernspinresonanz VL Elektronenspinresonanz Kernspintomographie
 VL 17 VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz VL 17 17.1. Elektronenspinresonanz 17.2. Kernspintomographie Wim de Boer, Karlsruhe Atome und Moleküle, 21.06.2012 1 Magnetische
VL 17 VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz VL 17 17.1. Elektronenspinresonanz 17.2. Kernspintomographie Wim de Boer, Karlsruhe Atome und Moleküle, 21.06.2012 1 Magnetische
VL 17. VL16. Hyperfeinstruktur Hyperfeinstruktur Kernspinresonanz VL Elektronenspinresonanz Kernspintomographie
 VL 17 VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz VL 17 17.1. Elektronenspinresonanz 17.2. Kernspintomographie Wim de Boer, Karlsruhe Atome und Moleküle, 21.06.2012 1 Magnetische
VL 17 VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz VL 17 17.1. Elektronenspinresonanz 17.2. Kernspintomographie Wim de Boer, Karlsruhe Atome und Moleküle, 21.06.2012 1 Magnetische
Der Stern-Gerlach-Versuch
 Der Stern-Gerlach-Versuch Lukas Mazur Physik Fakultät Universität Bielefeld Physikalisches Proseminar, 08.05.2013 1 Einleitung 2 Wichtige Personen 3 Motivation 4 Das Stern-Gerlach-Experiment 5 Pauli-Prinzip
Der Stern-Gerlach-Versuch Lukas Mazur Physik Fakultät Universität Bielefeld Physikalisches Proseminar, 08.05.2013 1 Einleitung 2 Wichtige Personen 3 Motivation 4 Das Stern-Gerlach-Experiment 5 Pauli-Prinzip
Einführung in die ENDOR- Spektroskopie
 Einführung in die ENDOR- Spektroskopie Institut für Chemie und Biochemie Freie Universität Berlin Stand: 1996 Inhalt (1) 1. Einführung 2. Grundlagen 2.1. ENDOR-Spektroskopie 2.2. TRIPLE-Resonanz 2.3. Spektrometer-Aufbau
Einführung in die ENDOR- Spektroskopie Institut für Chemie und Biochemie Freie Universität Berlin Stand: 1996 Inhalt (1) 1. Einführung 2. Grundlagen 2.1. ENDOR-Spektroskopie 2.2. TRIPLE-Resonanz 2.3. Spektrometer-Aufbau
Zusammenfassung des Seminarsvortrags Nuclear magnetic resonance
 Zusammenfassung des Seminarsvortrags Nuclear magnetic resonance Andreas Bünning 9. Januar 2012 Betreuer: Dr. Andreas Thomas Seite 1 3 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN 1 Motivation Die nuclear magnetic resonance,
Zusammenfassung des Seminarsvortrags Nuclear magnetic resonance Andreas Bünning 9. Januar 2012 Betreuer: Dr. Andreas Thomas Seite 1 3 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN 1 Motivation Die nuclear magnetic resonance,
Zentralabstand b, Spaltbreite a. Dreifachspalt Zentralabstand b, Spaltbreite a. Beugungsgitter (N Spalte, N<10 4, Abstand a)
 Doppelspalt (ideal) Doppelspalt (real) Zentralabstand b, Spaltbreite a Dreifachspalt Zentralabstand b, Spaltbreite a Beugungsgitter (N Spalte, N
Doppelspalt (ideal) Doppelspalt (real) Zentralabstand b, Spaltbreite a Dreifachspalt Zentralabstand b, Spaltbreite a Beugungsgitter (N Spalte, N
Der Gesamtbahndrehimpuls ist eine Erhaltungsgrösse (genau wie in der klassischen Mechanik).
 phys4.017 Page 1 10.4.2 Bahndrehimpuls des Elektrons: Einheit des Drehimpuls: Der Bahndrehimpuls des Elektrons ist quantisiert. Der Gesamtbahndrehimpuls ist eine Erhaltungsgrösse (genau wie in der klassischen
phys4.017 Page 1 10.4.2 Bahndrehimpuls des Elektrons: Einheit des Drehimpuls: Der Bahndrehimpuls des Elektrons ist quantisiert. Der Gesamtbahndrehimpuls ist eine Erhaltungsgrösse (genau wie in der klassischen
Physikalische Chemie I SS 2018
 Physikalische Chemie I SS 2018 Vorlesung für BA Chemie und BA Nanoscience Prof. Dr. K. Hauser Fachbereich Chemie Karin.Hauser@uni-konstanz.de Advance Organizer Polymerchemie Kolloidchemie Molekülanalytik
Physikalische Chemie I SS 2018 Vorlesung für BA Chemie und BA Nanoscience Prof. Dr. K. Hauser Fachbereich Chemie Karin.Hauser@uni-konstanz.de Advance Organizer Polymerchemie Kolloidchemie Molekülanalytik
VL 12. VL11. Das Wasserstofatom in der QM II Energiezustände des Wasserstoffatoms Radiale Abhängigkeit (Laguerre-Polynome)
 VL 12 VL11. Das Wasserstofatom in der QM II 11.1. Energiezustände des Wasserstoffatoms 11.2. Radiale Abhängigkeit (Laguerre-Polynome) VL12. Spin-Bahn-Kopplung (I) 12.1 Bahnmagnetismus (Zeeman-Effekt) 12.2
VL 12 VL11. Das Wasserstofatom in der QM II 11.1. Energiezustände des Wasserstoffatoms 11.2. Radiale Abhängigkeit (Laguerre-Polynome) VL12. Spin-Bahn-Kopplung (I) 12.1 Bahnmagnetismus (Zeeman-Effekt) 12.2
Vorlesung "Grundlagen der Strukturaufklärung"
 Vorlesung "Grundlagen der trukturaufklärung" für tudenten des tudiengangs "Bachelor Chemie" ommersemester 2003 Zeit: Montag, 9:00 bis 12:00 und Dienstag, 12:00 bis 14:00 Ort: MG 088 (Montags) und MC 351
Vorlesung "Grundlagen der trukturaufklärung" für tudenten des tudiengangs "Bachelor Chemie" ommersemester 2003 Zeit: Montag, 9:00 bis 12:00 und Dienstag, 12:00 bis 14:00 Ort: MG 088 (Montags) und MC 351
n r 2.2. Der Spin Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls
 2.2. Der Spin 2.2.1. Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls Dies entspricht einem Kreisstrom. n r r I e Es existiert ein entsprechendes magnetisches
2.2. Der Spin 2.2.1. Magnetische Momente In einem klassischen Atommodell umkreist das Elektron den Kern Drehimpuls Dies entspricht einem Kreisstrom. n r r I e Es existiert ein entsprechendes magnetisches
3.7 Elektronenspinresonanz, Bestimmung des g-faktors
 1 Einführung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 3 - Atomphysik 3.7 Elektronenspinresonanz, Bestimmung des g-faktors Die Elektronenspinresonanz (ESR) ist ein Verfahren, das in vielen
1 Einführung Physikalisches Praktikum für Anfänger - Teil 1 Gruppe 3 - Atomphysik 3.7 Elektronenspinresonanz, Bestimmung des g-faktors Die Elektronenspinresonanz (ESR) ist ein Verfahren, das in vielen
9. Molekularer Magnetismus Paramagnetische Eigenschaften molekularer Systeme Methode: EPR
 9. Molekularer Magnetismus 9.1. Paramagnetische Eigenschaften molekularer ysteme Methode: EPR 9.1.1. Paramagnetismus Makroskopische Betrachtung B = H + 4π M diamagnetische Probe B i < B o µ r < 1 χ v
9. Molekularer Magnetismus 9.1. Paramagnetische Eigenschaften molekularer ysteme Methode: EPR 9.1.1. Paramagnetismus Makroskopische Betrachtung B = H + 4π M diamagnetische Probe B i < B o µ r < 1 χ v
Elektronenparamagnetischer Rezonanzspektroskopie (EPR-Spektroskopie)
 Elektronenparamagnetischer Rezonanzspektroskopie (EPR-Spektroskopie) Inhalt Einführung Anwendungsgebiete der EPR-Spektroskopie Physikalische Grundlagen des EPR-Experiments - Der Elektronenspin - Die Magnetisierung
Elektronenparamagnetischer Rezonanzspektroskopie (EPR-Spektroskopie) Inhalt Einführung Anwendungsgebiete der EPR-Spektroskopie Physikalische Grundlagen des EPR-Experiments - Der Elektronenspin - Die Magnetisierung
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik
 Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2016 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 2. Vorlesung, 17. 3. 2016 Wasserstoffspektren, Zeemaneffekt, Spin, Feinstruktur,
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2016 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 2. Vorlesung, 17. 3. 2016 Wasserstoffspektren, Zeemaneffekt, Spin, Feinstruktur,
Drehimpuls Allgemeine Behandlung
 Drehimpuls Allgemeine Behandlung Klassisch: = r p = r mv β m p Kreuprodukt weier Vektoren: = r p = r p sinβ 1 i Drehimpuls Allgemeine Behandlung 1 k j 1 Einheitsvektoren Vektordarstellung: = xi + yj+ k
Drehimpuls Allgemeine Behandlung Klassisch: = r p = r mv β m p Kreuprodukt weier Vektoren: = r p = r p sinβ 1 i Drehimpuls Allgemeine Behandlung 1 k j 1 Einheitsvektoren Vektordarstellung: = xi + yj+ k
VL Spin-Bahn-Kopplung Paschen-Back Effekt. VL15. Wasserstoffspektrum Lamb Shift. VL16. Hyperfeinstruktur
 VL 16 VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2. Paschen-Back Effekt VL15. Wasserstoffspektrum 15.1. Lamb Shift VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz
VL 16 VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2. Paschen-Back Effekt VL15. Wasserstoffspektrum 15.1. Lamb Shift VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Hyperfeinstruktur 16.2. Kernspinresonanz
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV) NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen
 NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
2. Magnetresonanztomographie (MRT, MRI) 2.3. Spin und Magnetisierung
 2. Magnetresonanztomographie (MRT, MRI) 2.3. Spin und Magnetisierung Übergang zwischen den beiden Energieniveaus ω l = γb 0 γ/2π Larmor-Frequenz ν L 500 400 300 200 100 ν L = (γ/2π)b 0 [MHz/T] 1 H 42.57
2. Magnetresonanztomographie (MRT, MRI) 2.3. Spin und Magnetisierung Übergang zwischen den beiden Energieniveaus ω l = γb 0 γ/2π Larmor-Frequenz ν L 500 400 300 200 100 ν L = (γ/2π)b 0 [MHz/T] 1 H 42.57
Welche Prinzipien bestimmen die quantenmechanischen Zustände, beschrieben durch ihre Quantenzahlen, die die Elektronen eines Atoms einnehmen?
 phys4.021 Page 1 12. Mehrelektronenatome Fragestellung: Betrachte Atome mit mehreren Elektronen. Welche Prinzipien bestimmen die quantenmechanischen Zustände, beschrieben durch ihre Quantenzahlen, die
phys4.021 Page 1 12. Mehrelektronenatome Fragestellung: Betrachte Atome mit mehreren Elektronen. Welche Prinzipien bestimmen die quantenmechanischen Zustände, beschrieben durch ihre Quantenzahlen, die
Festkorperspektroskopie
 Hans Kuzmany Festkorperspektroskopie Eine Einführung Mit 222 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong 1. Einleitung 1 2. Grundlagen der Festkörperphysik 4 2.1
Hans Kuzmany Festkorperspektroskopie Eine Einführung Mit 222 Abbildungen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong 1. Einleitung 1 2. Grundlagen der Festkörperphysik 4 2.1
Feynman Vorlesungen über Physik
 Feynman Vorlesungen über Physik Band llhouantenmechanik. Definitive Edition von Richard R Feynman, Robert B. Leighton und Matthew Sands 5., verbesserte Auflage Mit 192 Bildern und 22Tabellen Oldenbourg
Feynman Vorlesungen über Physik Band llhouantenmechanik. Definitive Edition von Richard R Feynman, Robert B. Leighton und Matthew Sands 5., verbesserte Auflage Mit 192 Bildern und 22Tabellen Oldenbourg
5. Kernspinresonanz (NMR) . r B = - γ r B. r I.
 Prof. Dieter Suter Spektroskopie SS 96 5. Kernspinresonanz (NMR) 5.1 Einleitung Wie bereits diskutiert erzeugt ein Magnetfeld eine Aufspaltung von Spinzuständen gemäß dem amiltonoperator m = - r µ m. r
Prof. Dieter Suter Spektroskopie SS 96 5. Kernspinresonanz (NMR) 5.1 Einleitung Wie bereits diskutiert erzeugt ein Magnetfeld eine Aufspaltung von Spinzuständen gemäß dem amiltonoperator m = - r µ m. r
TC1 Grundlagen der Theoretischen Chemie
 TC1 Grundlagen der Theoretischen Chemie Irene Burghardt (burghardt@chemie.uni-frankfurt.de) Topic: Helium-Atom Vorlesung: Mo 10h-12h, Do9h-10h Übungen: Do 8h-9h Web site: http://www.theochem.uni-frankfurt.de/tc1
TC1 Grundlagen der Theoretischen Chemie Irene Burghardt (burghardt@chemie.uni-frankfurt.de) Topic: Helium-Atom Vorlesung: Mo 10h-12h, Do9h-10h Übungen: Do 8h-9h Web site: http://www.theochem.uni-frankfurt.de/tc1
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2003/2004 Struktur
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2003/2004 Struktur
Seminar: ESR-Spektroskopie Spektroskopie in Flüssigkeiten. Florian Hupka Timo Wattjes
 Seminar: SR-Spektroskopie Spektroskopie in Flüssigkeiten Florian Hupka Timo Wattjes 30.05.2005 Inhaltserzeichnis inführung in die SR Wechselwirkungen in der SR lektron-zeeman Zeeman- Wechselwirkung Kern-Zeeman
Seminar: SR-Spektroskopie Spektroskopie in Flüssigkeiten Florian Hupka Timo Wattjes 30.05.2005 Inhaltserzeichnis inführung in die SR Wechselwirkungen in der SR lektron-zeeman Zeeman- Wechselwirkung Kern-Zeeman
Messung der Magnetischen Momente von p und n. Hauptseminar WS 2006/2007 Bahnbrechende Experimente der Kern- und Teilchenphysik bis 1975
 Messung der Magnetischen Momente von p und n Hauptseminar WS 2006/2007 Bahnbrechende Experimente der Kern- und Teilchenphysik bis 1975 Till-Lucas Hoheisel 6.12.06 Inhalt: 1. Erste Messung des mag. Moments
Messung der Magnetischen Momente von p und n Hauptseminar WS 2006/2007 Bahnbrechende Experimente der Kern- und Teilchenphysik bis 1975 Till-Lucas Hoheisel 6.12.06 Inhalt: 1. Erste Messung des mag. Moments
14. Atomphysik. Inhalt. 14. Atomphysik
 Inhalt 14.1 Aufbau der Materie 14.2 Der Atomaufbau 14.2.1 Die Hauptquantenzahl n 14.2.2 Die Nebenquantenzahl l 14.2.3 Die Magnetquantenzahl m l 14.2.4 Der Zeemann Effekt 14.2.5 Das Stern-Gerlach-Experiment
Inhalt 14.1 Aufbau der Materie 14.2 Der Atomaufbau 14.2.1 Die Hauptquantenzahl n 14.2.2 Die Nebenquantenzahl l 14.2.3 Die Magnetquantenzahl m l 14.2.4 Der Zeemann Effekt 14.2.5 Das Stern-Gerlach-Experiment
Literatur Physikalische Chemie Atkins, depaula Wiley VCH Lehrbuch der Physikalische Chemie Wedler Wiley VCH Physikalische Chemie Engel, Ried Pearson
 PCIII Lehramt Skript Teil 1 Seite 1 Allgemeine Hinweise Vorlesung PCIII LA SS 2019 Donnerstag von 12:15-13:45 N100/015 Übungsgruppe Dr. Alberto Collauto Donnerstag 14:00-15:00 N100/015 Übungen selber bearbeiten
PCIII Lehramt Skript Teil 1 Seite 1 Allgemeine Hinweise Vorlesung PCIII LA SS 2019 Donnerstag von 12:15-13:45 N100/015 Übungsgruppe Dr. Alberto Collauto Donnerstag 14:00-15:00 N100/015 Übungen selber bearbeiten
Theoretical Biophysics - Quantum Theory and Molecular Dynamics. 9. Vorlesung. Pawel Romanczuk WS 2017/18
 Theoretical Biophysics - Quantum Theory and Molecular Dynamics 9. Vorlesung Pawel Romanczuk WS 2017/18 http://lab.romanczuk.de/teaching 1 Zusammenfassung letzte VL Wasserstoffatom Quantenmechanisches Zweikörperproblem
Theoretical Biophysics - Quantum Theory and Molecular Dynamics 9. Vorlesung Pawel Romanczuk WS 2017/18 http://lab.romanczuk.de/teaching 1 Zusammenfassung letzte VL Wasserstoffatom Quantenmechanisches Zweikörperproblem
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV)
 H 3 C 10 O G F D E 8 5 I H GF E D CB A 10 8 5 3 2 1 125 MHz 13 C NMR Spektrum 500 MHz 1 H NMR Spektrum NMR -_1 32 1 H 3 C 10 8 5 10 O G F D E 8 5 Dieder-Winkel: H 10 -H : 5, H -H : 80 H H 8 : 2, H -H :
H 3 C 10 O G F D E 8 5 I H GF E D CB A 10 8 5 3 2 1 125 MHz 13 C NMR Spektrum 500 MHz 1 H NMR Spektrum NMR -_1 32 1 H 3 C 10 8 5 10 O G F D E 8 5 Dieder-Winkel: H 10 -H : 5, H -H : 80 H H 8 : 2, H -H :
Optische Spektroskopie mit Lasern: Grundlagen und Anwendungen. Wann: Mi Fr Wo: P1 - O1-306
 Laserspektroskopie Was: Optische Spektroskopie mit Lasern: Grundlagen und Anwendungen Wann: Mi 13 15-14 00 Fr 10 15-12 00 Wo: P1 - O1-306 Wer: Dieter Suter Raum P1-O1-216 Tel. 3512 Dieter.Suter@uni-dortmund.de
Laserspektroskopie Was: Optische Spektroskopie mit Lasern: Grundlagen und Anwendungen Wann: Mi 13 15-14 00 Fr 10 15-12 00 Wo: P1 - O1-306 Wer: Dieter Suter Raum P1-O1-216 Tel. 3512 Dieter.Suter@uni-dortmund.de
Bildgebende Systeme in der Medizin
 Hochschule Mannheim 11/10/2011 Page 1/20 Bildgebende Systeme in der Medizin Magnet Resonanz Tomographie I: Kern-Magnet-Resonanz Spektroskopie Multinuclear NMR Lehrstuhl für Computerunterstützte Klinische
Hochschule Mannheim 11/10/2011 Page 1/20 Bildgebende Systeme in der Medizin Magnet Resonanz Tomographie I: Kern-Magnet-Resonanz Spektroskopie Multinuclear NMR Lehrstuhl für Computerunterstützte Klinische
Vorlesung 14: Roter Faden: Wiederholung Lamb-Shift. Hyperfeinstruktur. Folien auf dem Web:
 Vorlesung 14: Roter Faden: Wiederholung Lamb-Shift Anomaler Zeeman-Effekt Hyperfeinstruktur Folien auf dem Web: http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~deboer/ h i k h / d / Siehe auch: http://www.uni-stuttgart.de/ipf/lehre/online-skript/
Vorlesung 14: Roter Faden: Wiederholung Lamb-Shift Anomaler Zeeman-Effekt Hyperfeinstruktur Folien auf dem Web: http://www-ekp.physik.uni-karlsruhe.de/~deboer/ h i k h / d / Siehe auch: http://www.uni-stuttgart.de/ipf/lehre/online-skript/
14. Atomphysik Physik für E-Techniker. 14. Atomphysik
 14. Atomphysik 14.1 Aufbau der Materie 14.2 Der Atomaufbau 14.2.1 Die Hauptquantenzahl n 14.2.2 Die Nebenquantenzahl l 14.2.3 Die Magnetquantenzahl m l 14.2.4 Der Zeemann Effekt 14.2.5 Das Stern-Gerlach-Experiment
14. Atomphysik 14.1 Aufbau der Materie 14.2 Der Atomaufbau 14.2.1 Die Hauptquantenzahl n 14.2.2 Die Nebenquantenzahl l 14.2.3 Die Magnetquantenzahl m l 14.2.4 Der Zeemann Effekt 14.2.5 Das Stern-Gerlach-Experiment
Musterlösung 02/09/2014
 Musterlösung 0/09/014 1 Streuexperimente (a) Betrachten Sie die Streuung von punktförmigen Teilchen an einer harten Kugel vom Radius R. Bestimmen Sie die Ablenkfunktion θ(b) unter der Annahme, dass die
Musterlösung 0/09/014 1 Streuexperimente (a) Betrachten Sie die Streuung von punktförmigen Teilchen an einer harten Kugel vom Radius R. Bestimmen Sie die Ablenkfunktion θ(b) unter der Annahme, dass die
10. Der Spin des Elektrons
 10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
10. Elektronspin Page 1 10. Der Spin des Elektrons Beobachtung: Aufspaltung von Spektrallinien in nahe beieinander liegende Doppellinien z.b. die erste Linie der Balmer-Serie (n=3 -> n=2) des Wasserstoff-Atoms
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik
 Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
Struktur der Materie II (L), Kern und Teilchenphysik Dr. Martin zur Nedden, Humboldt Universität zu Berlin Vorlesung für das Lehramt Physik, Folien zur Vorlesung Berlin, Wintersemester 2002/2003 Struktur
Übungen zur Physik der Materie 1 Blatt 10 - Atomphysik
 Übungen zur Physik der Materie 1 Blatt 10 - Atomphysik Sommersemester 018 Vorlesung: Boris Bergues ausgegeben am 14.06.018 Übung: Nils Haag (Nils.Haag@lmu.de) besprochen am 0.06.018 Hinweis: Dieses Übungsblatt
Übungen zur Physik der Materie 1 Blatt 10 - Atomphysik Sommersemester 018 Vorlesung: Boris Bergues ausgegeben am 14.06.018 Übung: Nils Haag (Nils.Haag@lmu.de) besprochen am 0.06.018 Hinweis: Dieses Übungsblatt
Chemisches Grundpraktikum II (270002) Kernresonanzspektroskopie. NMR-Spektroskopie
 hemisches Grundpraktikum II (270002) Kernresonanzspektroskopie NMR-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance). Kählig, SS 2010 Von der Substanz zur Struktur Substanz NMR - Spektren Struktur N N 1 Spektroskopie
hemisches Grundpraktikum II (270002) Kernresonanzspektroskopie NMR-Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance). Kählig, SS 2010 Von der Substanz zur Struktur Substanz NMR - Spektren Struktur N N 1 Spektroskopie
NMR-Literatur. Einführungen
 NMR-Literatur Einführungen NMR-Spektroskopie, H. Günther, 3. Auflage, Thieme-Verlag, 1991. Ein- und Zweidimensionale NMR-Spektroskopie, H. Friebolin, 2. Verlagsgesellschaft, 1992. Auflage, VCH- NMR Fourier
NMR-Literatur Einführungen NMR-Spektroskopie, H. Günther, 3. Auflage, Thieme-Verlag, 1991. Ein- und Zweidimensionale NMR-Spektroskopie, H. Friebolin, 2. Verlagsgesellschaft, 1992. Auflage, VCH- NMR Fourier
NMR-Spektroskopie Nuclear Magnetic Resonance - Spektroskopie H2N HO2C CH3
 NMR-Spektroskopie Nuclear Magnetic Resonance - Spektroskopie anwendbar auf Atomkerne mit magnetischem Moment z.b. 1 H, 13 C, und andere Kerne O H 2 N NH HO 2 C Si CH 3 6. 5. 4. 3. 2. 1.. ppm Folie 1 Bedeutung
NMR-Spektroskopie Nuclear Magnetic Resonance - Spektroskopie anwendbar auf Atomkerne mit magnetischem Moment z.b. 1 H, 13 C, und andere Kerne O H 2 N NH HO 2 C Si CH 3 6. 5. 4. 3. 2. 1.. ppm Folie 1 Bedeutung
Atome im elektrischen Feld
 Kapitel 3 Atome im elektrischen Feld 3.1 Beobachtung und experimenteller Befund Unter dem Einfluss elektrischer Felder kommt es zur Frequenzverschiebung und Aufspaltung in optischen Spektren. Dieser Effekt
Kapitel 3 Atome im elektrischen Feld 3.1 Beobachtung und experimenteller Befund Unter dem Einfluss elektrischer Felder kommt es zur Frequenzverschiebung und Aufspaltung in optischen Spektren. Dieser Effekt
VL Landé-Faktor (Einstein-deHaas Effekt) Berechnung des Landé-Faktors Anomaler Zeeman-Effekt
 VL 14 VL13. Spin-Bahn-Kopplung (II) 13.1. Landé-Faktor (Einstein-deHaas Effekt) 13.2. Berechnung des Landé-Faktors 13.3. Anomaler Zeeman-Effekt VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2.
VL 14 VL13. Spin-Bahn-Kopplung (II) 13.1. Landé-Faktor (Einstein-deHaas Effekt) 13.2. Berechnung des Landé-Faktors 13.3. Anomaler Zeeman-Effekt VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2.
NMR Spektroskopie. 1nm Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio
 NMR Spektroskopie 1nm 10 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio Anregungsmodus electronic Vibration Rotation Nuclear Spektroskopie X-ray UV/VIS Infrared/Raman NMR
NMR Spektroskopie 1nm 10 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio Anregungsmodus electronic Vibration Rotation Nuclear Spektroskopie X-ray UV/VIS Infrared/Raman NMR
Teil 2 NMR-Spektroskopie. Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17
 Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Einführung: NMR, was ist das? NMR = Nuclear Magnetic Resonance oder zu deutsch: Kernspinresonanz
Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Einführung: NMR, was ist das? NMR = Nuclear Magnetic Resonance oder zu deutsch: Kernspinresonanz
Anwendung der NMR-Spektroskopie in der Anorganischen Chemie
 Anwendung der NMR-Spektroskopie in der Anorganischen Chemie Literatur Canet D.: NMR-Konzepte und Methoden, Springer-Verlag, New-York 1994 Farrar T.C., Becker E.D.: Pulse and Fourier Transform NMR, Introduction
Anwendung der NMR-Spektroskopie in der Anorganischen Chemie Literatur Canet D.: NMR-Konzepte und Methoden, Springer-Verlag, New-York 1994 Farrar T.C., Becker E.D.: Pulse and Fourier Transform NMR, Introduction
Experimentelle Elementarteilchenphysik
 Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
Experimentelle Elementarteilchenphysik Hermann Kolanoski Humboldt-Universität zu Berlin Woraus besteht das Universum, wie ist es entstanden, wohin wird es sich entwickeln? Was ist Materie, was ist um uns
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV) C NMR Spektroskopie
 6. 3 C NMR Spektroskopie Die Empfindlichkeit des NMR Experiments hängt von folgenden physikalischen Parametern (optimale Abstimmung des Spektrometers vorausgesetzt) ab: Feldstärke B o, Temperatur T, gyromagnetisches
6. 3 C NMR Spektroskopie Die Empfindlichkeit des NMR Experiments hängt von folgenden physikalischen Parametern (optimale Abstimmung des Spektrometers vorausgesetzt) ab: Feldstärke B o, Temperatur T, gyromagnetisches
Magnetresonanztomographie (MRT) * =
 γ * γ π Beispiel: - Protonen ( H) Messung - konstantes B-Feld (T) in -Richtung - Gradientenfeld (3mT/m) in -Richtung - bei 0: f 00 4,6 MH Wie stark ist Frequenveränderung Df der Spins bei 0 mm? f (0mm)
γ * γ π Beispiel: - Protonen ( H) Messung - konstantes B-Feld (T) in -Richtung - Gradientenfeld (3mT/m) in -Richtung - bei 0: f 00 4,6 MH Wie stark ist Frequenveränderung Df der Spins bei 0 mm? f (0mm)
Festkörperelektronik 4. Übung
 Festkörperelektronik 4. Übung Felix Glöckler 23. Juni 2006 1 Übersicht Themen heute: Feedback Spin Drehimpuls Wasserstoffatom, Bohr vs. Schrödinger Wasserstoffmolekülion, kovalente Bindung Elektronen in
Festkörperelektronik 4. Übung Felix Glöckler 23. Juni 2006 1 Übersicht Themen heute: Feedback Spin Drehimpuls Wasserstoffatom, Bohr vs. Schrödinger Wasserstoffmolekülion, kovalente Bindung Elektronen in
10. Das Wasserstoff-Atom Das Spektrum des Wasserstoff-Atoms. im Bohr-Modell:
 phys4.016 Page 1 10. Das Wasserstoff-Atom 10.1.1 Das Spektrum des Wasserstoff-Atoms im Bohr-Modell: Bohr-Modell liefert eine ordentliche erste Beschreibung der grundlegenden Eigenschaften des Spektrums
phys4.016 Page 1 10. Das Wasserstoff-Atom 10.1.1 Das Spektrum des Wasserstoff-Atoms im Bohr-Modell: Bohr-Modell liefert eine ordentliche erste Beschreibung der grundlegenden Eigenschaften des Spektrums
Christian Geppert (Autor) Methodische Entwicklungen zur spektroskopischen 1H-NMR- Bildgebung
 Christian Geppert (Autor) Methodische Entwicklungen zur spektroskopischen 1H-NMR- Bildgebung https://cuvillier.de/de/shop/publications/2537 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Christian Geppert (Autor) Methodische Entwicklungen zur spektroskopischen 1H-NMR- Bildgebung https://cuvillier.de/de/shop/publications/2537 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
2.3. Atome in äusseren Feldern
 .3. Atome in äusseren Feldern.3.1. Der Zeeman-Effekt Nobelpreis für Physik 19 (...researches into the influence of magnetism upon radiation phenomena ) H. A. Lorentz P. Zeeman Die Wechselwirkung eines
.3. Atome in äusseren Feldern.3.1. Der Zeeman-Effekt Nobelpreis für Physik 19 (...researches into the influence of magnetism upon radiation phenomena ) H. A. Lorentz P. Zeeman Die Wechselwirkung eines
NMR Vortag im Rahmen des Fortgeschrittenen-Praktikums
 NMR Vortag im Rahmen des Fortgeschrittenen-Praktikums Martin Fuchs 1 Motivation Die Nuclear Magnetic Resonance, oder zu deutsch Kernspinresonanz ist vor allem durch die aus der Medizin nicht mehr wegzudenkende
NMR Vortag im Rahmen des Fortgeschrittenen-Praktikums Martin Fuchs 1 Motivation Die Nuclear Magnetic Resonance, oder zu deutsch Kernspinresonanz ist vor allem durch die aus der Medizin nicht mehr wegzudenkende
Molekulare Biophysik. NMR-Spektroskopie (Teil 1)
 Molekulare Biophysik NMR-Spektroskopie (Teil 1) Das Vorlesungs-Programm 2/94 Vorlesung Molekulare Biophysik : NMR-Spektroskopie Tag 1 Theoretische Grundlagen der NMR-Spektroskopie (1) Tag 2 Theoretische
Molekulare Biophysik NMR-Spektroskopie (Teil 1) Das Vorlesungs-Programm 2/94 Vorlesung Molekulare Biophysik : NMR-Spektroskopie Tag 1 Theoretische Grundlagen der NMR-Spektroskopie (1) Tag 2 Theoretische
Bz e Kraft auf Magnetisches Moment. => Zuständen
 Kap. 7 Der pin. Der pin it ein interner Freiheitgrad eine Teilchen und hängt weder von den räumlichen Koordinaten noch von Impul ab. Der pin legt die tatitik (Fermion oder Boon) fet. (QMII). tern Gerlach
Kap. 7 Der pin. Der pin it ein interner Freiheitgrad eine Teilchen und hängt weder von den räumlichen Koordinaten noch von Impul ab. Der pin legt die tatitik (Fermion oder Boon) fet. (QMII). tern Gerlach
: Quantenmechanische Lösung H + 2. Molekülion und. Aufstellen der Schrödingergleichung für das H + 2
 H + 2 Die molekulare Bindung : Quantenmechanische Lösung Aufstellen der Schrödingergleichung für das H + 2 Molekülion und Lösung Wichtige Einschränkung: Die Kerne sind festgehalten H Ψ(r) = E Ψ(r) (11)
H + 2 Die molekulare Bindung : Quantenmechanische Lösung Aufstellen der Schrödingergleichung für das H + 2 Molekülion und Lösung Wichtige Einschränkung: Die Kerne sind festgehalten H Ψ(r) = E Ψ(r) (11)
z n z m e 2 WW-Kern-Kern H = H k + H e + H ek
 2 Molekülphysik Moleküle sind Systeme aus mehreren Atomen, die durch Coulomb-Wechselwirkungen Elektronen und Atomkerne ( chemische Bindung ) zusammengehalten werden. 2.1 Born-Oppenheimer Näherung Der nichtrelativistische
2 Molekülphysik Moleküle sind Systeme aus mehreren Atomen, die durch Coulomb-Wechselwirkungen Elektronen und Atomkerne ( chemische Bindung ) zusammengehalten werden. 2.1 Born-Oppenheimer Näherung Der nichtrelativistische
2. Grundlagen und Wechselwirkungen 2.1 Magnetismus und magnetisches Moment
 Prof. Dieter Suter / Prof. Roland Böhmer Magnetische Resonanz SS 03 2. Grundlagen und Wechselwirkungen 2.1 Magnetismus und magnetisches Moment 2.1.1 Felder und Dipole; Einheiten Wir beginnen mit einer
Prof. Dieter Suter / Prof. Roland Böhmer Magnetische Resonanz SS 03 2. Grundlagen und Wechselwirkungen 2.1 Magnetismus und magnetisches Moment 2.1.1 Felder und Dipole; Einheiten Wir beginnen mit einer
Hochauflösende NMR in Festkörpern
 Hochauflösende NMR in Festkörpern Strukturaufklärung in Phosphatgläsern Anne Wiemhöfer Agnes Wrobel Gliederung Auftretende Wechselwirkungen in der Festkörper NMR Flüssig- vs. Festkörper-NMR NMR Techniken
Hochauflösende NMR in Festkörpern Strukturaufklärung in Phosphatgläsern Anne Wiemhöfer Agnes Wrobel Gliederung Auftretende Wechselwirkungen in der Festkörper NMR Flüssig- vs. Festkörper-NMR NMR Techniken
Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung
 Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung Elementaranalyse Massenspektrometrie andere spektroskopische Methoden Röntgen- Strukturanalyse Kernmagnetische Resonanz - Spektroskopie H 3 C H 3
Bestimmung der Struktur einer (un)bekannten Verbindung Elementaranalyse Massenspektrometrie andere spektroskopische Methoden Röntgen- Strukturanalyse Kernmagnetische Resonanz - Spektroskopie H 3 C H 3
3. Geben Sie ein Bespiel, wie man Bra und Ket Notation nützen kann.
 Fragen zur Vorlesung Einführung in die Physik 3 1. Was ist ein quantenmechanischer Zustand? 2. Wenn die Messung eines quantenmechanischen Systems N unterscheidbare Ereignisse liefern kann, wie viele Parameter
Fragen zur Vorlesung Einführung in die Physik 3 1. Was ist ein quantenmechanischer Zustand? 2. Wenn die Messung eines quantenmechanischen Systems N unterscheidbare Ereignisse liefern kann, wie viele Parameter
Ferienkurs Experimentalphysik Lösung zur Übung 2
 Ferienkurs Experimentalphysik 4 01 Lösung zur Übung 1. Ermitteln Sie für l = 1 a) den Betrag des Drehimpulses L b) die möglichen Werte von m l c) Zeichnen Sie ein maßstabsgerechtes Vektordiagramm, aus
Ferienkurs Experimentalphysik 4 01 Lösung zur Übung 1. Ermitteln Sie für l = 1 a) den Betrag des Drehimpulses L b) die möglichen Werte von m l c) Zeichnen Sie ein maßstabsgerechtes Vektordiagramm, aus
Allgemeine Hinweise Vorlesung PC III WS 2017
 1. Stunde Seite 1 Allgemeine Hinweise Vorlesung PC III WS 2017 Vorlesung Di 17.10 und 24.10: 9:15-10:45 OSZ/H6 Danach (ab 3.11): 14:15-15:45 Chemie H1 Übungsgruppen: Gruppe 1: Fr 11-12 H1 Gruppe 2: Fr
1. Stunde Seite 1 Allgemeine Hinweise Vorlesung PC III WS 2017 Vorlesung Di 17.10 und 24.10: 9:15-10:45 OSZ/H6 Danach (ab 3.11): 14:15-15:45 Chemie H1 Übungsgruppen: Gruppe 1: Fr 11-12 H1 Gruppe 2: Fr
Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 2004): 2. Erhaltungsgrößen. Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers
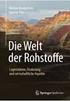 Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 4):. Erhaltungsgrößen Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 4 1 Parität (1) Paritätsoperator:
Notizen zur Kern-Teilchenphysik II (SS 4):. Erhaltungsgrößen Prof. Dr. R. Santo Dr. K. Reygers http://www.uni-muenster.de/physik/kp/lehre/kt-ss4/ Kern- Teilchenphysik II - SS 4 1 Parität (1) Paritätsoperator:
Polarisationstransfer
 Polarisationstransfer Schon früh in der Geschichte der NMR-Spektroskopie hat man Experimente durchgeführt, bei denen auf einzelne Signale, d.h. bestimmte Spinübergänge, selektiv mit einer B 2 -Frequenz
Polarisationstransfer Schon früh in der Geschichte der NMR-Spektroskopie hat man Experimente durchgeführt, bei denen auf einzelne Signale, d.h. bestimmte Spinübergänge, selektiv mit einer B 2 -Frequenz
Grundlagen der magnetischen Kernresonanz
 Grundlagen der magnetischen Kernresonanz 26.05.2014 Spin und gyromagnetisches Verhältnis Zeeman-Effekt Spin-Präzession Magnetisierung Teilchen haben Spin S Erfüllt Eigenwertgleichungen ˆ S 2 Ψ = s(s +
Grundlagen der magnetischen Kernresonanz 26.05.2014 Spin und gyromagnetisches Verhältnis Zeeman-Effekt Spin-Präzession Magnetisierung Teilchen haben Spin S Erfüllt Eigenwertgleichungen ˆ S 2 Ψ = s(s +
Physik IV Molekülphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik
 Physik IV Molekülphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik Organisatorisches 1. Kontakt E-mail: bauer@physik.uni-kiel.de RaumNo: LS19/302 2. Infos zur Vorlesung http://www.ieap.uni-kiel.de/solid/ag-bauer
Physik IV Molekülphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik Organisatorisches 1. Kontakt E-mail: bauer@physik.uni-kiel.de RaumNo: LS19/302 2. Infos zur Vorlesung http://www.ieap.uni-kiel.de/solid/ag-bauer
VL Spin-Bahn-Kopplung Paschen-Back Effekt. VL15. Wasserstoffspektrum Lamb Shift 15.2 Hyperfeinstruktur. VL16.
 VL 16 VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2. Paschen-Back Effekt VL15. Wasserstoffspektrum 15.1. Lamb Shift 15.2 Hyperfeinstruktur VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Magnetische Resonanz
VL 16 VL14. Spin-Bahn-Kopplung (III) 14.1. Spin-Bahn-Kopplung 14.2. Paschen-Back Effekt VL15. Wasserstoffspektrum 15.1. Lamb Shift 15.2 Hyperfeinstruktur VL16. Hyperfeinstruktur 16.1. Magnetische Resonanz
g-faktor Elektron
 g-faktor des Elektrons 06.1.13 1 Gliederung 1. Historie. Theoretische Grundlagen g-faktor des Elektrons ii. Penning Falle i. 3. experimentelle Realisation i. Aufbau ii. QND Messung iii. Quantensprung Spektroskopie
g-faktor des Elektrons 06.1.13 1 Gliederung 1. Historie. Theoretische Grundlagen g-faktor des Elektrons ii. Penning Falle i. 3. experimentelle Realisation i. Aufbau ii. QND Messung iii. Quantensprung Spektroskopie
Linienform- und Breite
 Linienform- und Breite a) Wodurch ist die Breite eienr Absorptions- (Emissions-) Linie gegeben? welche Anteile gibt es, welcher Anteil dominiert im Normalfall? Dopplerbreite, Stossverbreiterung, natuerliche
Linienform- und Breite a) Wodurch ist die Breite eienr Absorptions- (Emissions-) Linie gegeben? welche Anteile gibt es, welcher Anteil dominiert im Normalfall? Dopplerbreite, Stossverbreiterung, natuerliche
(a) Welches ist die wichtigste Erkenntnis, die sich aus den Ergebnissen des Experiments ableiten lässt.
 Übungen zur moderne Experimentalphysik I (Physik IV, Atome und Kerne) KIT, Sommersemester 2017 Prof. Dr. Guido Drexlin, Dr. Kathrin Valerius Vorlesungen Di 9:45 + Do 8:00, Gerthsen-Hörsaal Sprechstunde
Übungen zur moderne Experimentalphysik I (Physik IV, Atome und Kerne) KIT, Sommersemester 2017 Prof. Dr. Guido Drexlin, Dr. Kathrin Valerius Vorlesungen Di 9:45 + Do 8:00, Gerthsen-Hörsaal Sprechstunde
Einführung in die Festkörper NMR-Spektroskopie Treffpunkt Gebäude NA, Ebene 04, Raum 156 (NMR) / 158 (Büro)
 Programm: Dienstag, 22. Mai 2018: 10.00 Einführung in die Festkörper NMR-Spektroskopie Treffpunkt Gebäude NA, Ebene 04, Raum 156 (NMR) / 158 (Büro) Was ist NMR-Spektroskopie? Grundlagen der Funktionsweise
Programm: Dienstag, 22. Mai 2018: 10.00 Einführung in die Festkörper NMR-Spektroskopie Treffpunkt Gebäude NA, Ebene 04, Raum 156 (NMR) / 158 (Büro) Was ist NMR-Spektroskopie? Grundlagen der Funktionsweise
Ferienkurs Experimentalphysik Übung 2 - Musterlösung
 Ferienkurs Experimentalphysik 4 00 Übung - Musterlösung Kopplung von Drehimpulsen und spektroskopische Notation (*) Vervollständigen Sie untenstehende Tabelle mit den fehlenden Werten der Quantenzahlen.
Ferienkurs Experimentalphysik 4 00 Übung - Musterlösung Kopplung von Drehimpulsen und spektroskopische Notation (*) Vervollständigen Sie untenstehende Tabelle mit den fehlenden Werten der Quantenzahlen.
3.7 Gekoppelte Spinsysteme
 - 47-3.7 Gekoppelte Spinsysteme 3.7. Matrixdarstellung von Operatoren in Systemen mit mehreren Spins Um Rechnungen für Systeme aus mehr als einem Spin durchführen zu können, müssen wir die Matrixdarstellungen
- 47-3.7 Gekoppelte Spinsysteme 3.7. Matrixdarstellung von Operatoren in Systemen mit mehreren Spins Um Rechnungen für Systeme aus mehr als einem Spin durchführen zu können, müssen wir die Matrixdarstellungen
Einleitung nichtrel. Wasserstoatom (spinlos) rel. Wasserstoatom (für spin 1 2 -Teilchen) Orbitale des (rel.) Wasserstoatoms Ausblick und oene Fragen
 Florian Wodlei Seminar aus höherer QM Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital? Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital? 2 Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital?
Florian Wodlei Seminar aus höherer QM Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital? Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital? 2 Überblick 1 Einleitung Motivation Was ist ein Orbital?
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil I. Peter Schmieder AG NMR
 Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil I Das Programm 2/108 Wintersemester 2007/2008 10 Termine: 24.10.07, 31.10.07, 07.11.07, 14.11.07,
Vorlesung Mehrdimensionale NMR-Spektroskopie- Grundlagen und Anwendungen in der Strukturaufklärung Teil I Das Programm 2/108 Wintersemester 2007/2008 10 Termine: 24.10.07, 31.10.07, 07.11.07, 14.11.07,
1. Allgemeine Grundlagen Quantenmechanik
 1. Allgemeine Grundlagen 1.3. Quantenmechanik Klassische Mechanik vs Quantenmechanik Klassische (Newton sche) Mechanik klassischer harmonischer Oszillator Quantenmechanik quantenmechanischer harmonischer
1. Allgemeine Grundlagen 1.3. Quantenmechanik Klassische Mechanik vs Quantenmechanik Klassische (Newton sche) Mechanik klassischer harmonischer Oszillator Quantenmechanik quantenmechanischer harmonischer
Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen
 Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen Seminar 5. 0. 200 Teil : NMR Spektroskopie. Einführung und Physikalische Grundlagen.2 H NMR Parameter: a) Chemische
Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen Seminar 5. 0. 200 Teil : NMR Spektroskopie. Einführung und Physikalische Grundlagen.2 H NMR Parameter: a) Chemische
11.2 Störungstheorie für einen entarteten Energie-Eigenwert E (0)
 Skript zur 6. Vorlesung Quantenmechanik, Freitag den. Juni,.. Störungstheorie für einen entarteten Energie-Eigenwert E () n Sei E n () eing-fachentartetet Eigenwert desoperatorsĥ undsei ψ nα, () α =,...,g
Skript zur 6. Vorlesung Quantenmechanik, Freitag den. Juni,.. Störungstheorie für einen entarteten Energie-Eigenwert E () n Sei E n () eing-fachentartetet Eigenwert desoperatorsĥ undsei ψ nα, () α =,...,g
A 52 GRUNDLAGEN DER NMR (DER KERN-ZEEMAN-EFFEKT) Ziel des Versuches
 Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 52 GRUNDLAGEN DER NMR (DER KERN-ZEEMAN-EFFEKT) Ziel des Versuches Die NMR-Spektroskopie ist eine wichtige Charakterisierungsmethode
Versuchsanleitungen zum Praktikum Physikalische Chemie für Anfänger 1 A 52 GRUNDLAGEN DER NMR (DER KERN-ZEEMAN-EFFEKT) Ziel des Versuches Die NMR-Spektroskopie ist eine wichtige Charakterisierungsmethode
Molecular Dynamics of Proteorhodopsin in Lipid Bilayers by Solid-State NMR
 Molecular Dynamics of Proteorhodopsin in Lipid Bilayers by Solid-State NMR Yang, Aslimovsk, Glaubitz Moderne Anwendungen der Magnetischen Resonanz Lena Kalinowsky Motivation/Ziel Temperatur Hydrathülle
Molecular Dynamics of Proteorhodopsin in Lipid Bilayers by Solid-State NMR Yang, Aslimovsk, Glaubitz Moderne Anwendungen der Magnetischen Resonanz Lena Kalinowsky Motivation/Ziel Temperatur Hydrathülle
zum Ende seines Lebens infolge schlechter Durchblutung des Gehirn an schwerem Gedächtnisschwund.
 Kapitel 12 Der Zeeman-Effekt In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Einfluss eines externen Magnetfelds auf das Spektrum eines Atoms. Wir werden sehen, dass infolge dieser Beeinflussung die Entartung
Kapitel 12 Der Zeeman-Effekt In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Einfluss eines externen Magnetfelds auf das Spektrum eines Atoms. Wir werden sehen, dass infolge dieser Beeinflussung die Entartung
Der Spin des Elektrons
 Kapitel 13 Der Spin des Elektrons Wie in Abbschnitt 12.4 angedeutet, ist in der Realität die Aufspaltung der Spektrallinien im homogenen externen Magnetfeld nicht alleine durch den normalen Zeeman-Effekt
Kapitel 13 Der Spin des Elektrons Wie in Abbschnitt 12.4 angedeutet, ist in der Realität die Aufspaltung der Spektrallinien im homogenen externen Magnetfeld nicht alleine durch den normalen Zeeman-Effekt
