Vorlastsensitivität verschiedener klinisch gebräuchlicher Parameter nach definierter Volumengabe bei postoperativen herzchirurgischen Patienten
|
|
|
- Barbara Bader
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Fakultät für Medizin der Technischen Universität München Vorlastsensitivität verschiedener klinisch gebräuchlicher Parameter nach definierter Volumengabe bei postoperativen herzchirurgischen Patienten Christian Oliver Wolfgang Schmidt Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Medizin genehmigten Dissertation. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. D. Neumeier Prüfer der Dissertation: 1. Priv.-Doz. Dr. U. J. Pfeiffer. Univ.-Prof. A. Kastrati Die Dissertation wurde am bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Medizin am angenommen.
2 Vorlastsensitivität verschiedener klinisch gebräuchlicher Parameter nach definierter Volumengabe bei postoperativen herzchirurgischen Patienten
3 Inhaltsverzeichnis Seite Abkürzungsverzeichnis 5 Abbildungsverzeichnis 7 Tabellenverzeichnis 9 1. Einleitung Definition und Bedeutung von Vorlast Klassische Parameter Zentralvenöser Druck (ZVD) Pulmonalkapillärer Verschlußdruck (PCWP) End-diastolic area (EDA) Neuere Parameter Intrathorakales Blutvolumen (ITBV) Globales enddiastolisches Volumen (GEDV) Totales Blutvolumen (TBV) Rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen (RVEDV) Rechtsherzenddiastolisches Volumen (RHEDV) Linksherzenddiastolisches Volumen (LHEDV) Schlagvolumenvariation (SVV) Systolic pressure variation (SPV) 19. Untersuchungsziel 0 3. Material und Methodik Allgemeines zur dargestellten Untersuchung 1 3. Patienten der Studie 1 3
4 Seite 3.3 Verwendete Geräte und Materialien PICCO-System COLD-System Überwachungsmonitor-System Transösophageale Echokardiographie-Sonde (TEE-Sonde) Einmalmaterial Aufbau und Ablauf der Studie Studienaufbau Studienablauf Statistische Auswertung und Ergebnisse Diskussion Klinische Problematik bei Verwendung von Vorlastparametern 7 5. Methodenkritik Risiken der Anwendung Genauigkeit bezüglich pathophysiologischer Variabilität Sensitivität der einzelnen Parameter Klinische Relevanz Schlußfolgerungen 8 6. Zusammenfassung Literaturverzeichnis Danksagung 101 4
5 Abkürzungsverzeichnis a / art arteriell A Adrenalin ACBP aortokoronarer Bypass AKE Aortenklappenersatz BMI body-mass-index COLD circulation, oxygenation, lungwater, diagnosis d delta-wert DD, dd dye-dilution ddown delta down DIL Diltiazem DOB Dobutamin DOP Dopamin DSt downslope time dup delta up EDA end-diastolic area (Einheit: cm²) EDV enddiastolisches Volumen (Einheit: ml) EF ejection fraction (Einheit: %) EVLW extravasales Lungenwasser (Einheit: ml) FD Farbstoff-Dilution Fr french GEDV globales enddiastolisches Blutvolumen (Einheit: ml) HR heart rate (Einheit: 1/min) HZV Herzzeitvolumen (Einheit: l/min) I Indexwert (Einheit:.../m²) ICG Indocyaningrün IPPV intermittent positive pressure ventilation ITBV intrathorakales Blutvolumen (Einheit: ml) ITTV intrathorakales Thermovolumen (Einheit: ml) KOF Körperoberfläche (Einheit: m²) LAEDV linksatriales enddiastolisches Volumen (Einheit: ml) LHEDV linksherzenddiastolisches Volumen (Einheit: ml) LVEDV linksventrikuläres enddiastolisches Volumen (Einheit: ml) MKE Mitralklappenersatz MKR Mitralklappenrekonstruktion MTt mean transit time n Anzahl n Wert nach Volumen 5
6 NA Noradrenalin NIT Nitrat P Signifikanzniveau P(i)CCO pulse contour cardiac output pa pulmonalarteriell PBV pulmonales Blutvolumen (Einheit : ml) PCWP pulmonary capillary wedge pressure (Einheit: mm Hg) PEEP positive endexpiratory pressure (Einheit: cm H O) PF Propofol PTV pulmonales Thermovolumen (Einheit: ml) r Korrelation RAEDV rechtsatriales enddiastolisches Volumen (Einheit: ml) RHEDV rechtsherzenddiastolisches Volumen (Einheit: ml) RVEDV rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen (Einheit: ml) SIMV synchronisierte intermittierende mandatorische Ventilation SPV systolic pressure variation (Einheit: %) SV Schlagvolumen (Einheit: ml) SVV Schlagvolumenvariation (Einheit: %) TBV totales Blutvolumen (Einheit: ml) TD, td Thermodilution TDD, tdd Thermo-dye-Dilution TEE transesophageal echocardiography TKR Trikuspidalklappenrekonstruktion v Wert vor Volumen y Regressionsgerade ZVD zentralvenöser Druck (Einheit: mm Hg) ZVK Zentralvenenkatheter 6
7 Abbildungsverzeichnis Seite Abbildung 3.1: Körperoberfläche (KOF in m²) der Patienten 3 Abbildung 3.: Body-mass-index (BMI in kg/m²) der Patienten 4 Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Dilutionskurve und deren Analyse nach Transitzeiten 5 Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Mischkammern im kardiopulmonalem System (für Thermodilution) 6 Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Mischkammern im kardiopulmonalem System (für Thermo-dye-Dilution) 8 Abbildung 3.6: Berechnungsformeln und schematische Darstellung der DSt-Volumina 30 Abbildung 3.7: Berechnungsformeln und schematische Darstellung der MTt-Volumina 30 Abbildung 4.1: Gegenüberstellung der Durchschnittswerte aller Patienten von HZVI a und HZVI pa vor bzw. nach Volumengabe 44 Abbildung 4.: Gegenüberstellung der Durchschnittswerte aller Patienten von SVI a und SVI pa vor bzw. nach Volumengabe 45 Abbildung 4.3: Gegenüberstellung von HZVI a vor bzw. nach Volumengabe bei den einzelnen untersuchten Patienten 45 Abbildung 4.4: Gegenüberstellung von HZVI pa vor bzw. nach Volumengabe bei den einzelnen untersuchten Patienten 46 Abbildung 4.5: Gegenüberstellung von SVI a vor bzw. nach Volumengabe bei den einzelnen untersuchten Patienten 46 Abbildung 4.6: Gegenüberstellung von SVI pa vor bzw. nach Volumengabe bei den einzelnen untersuchten Patienten 47 7
8 Seite Abbildung 4.7 bis Abbildung 4.18: Lineare Regressionsanalysen zwischen den jeweiligen delta-werten der Einzelparameter (wo mögl. als Index) und delta HZVI (arteriell) 48 Abbildung 4.19 bis Abbildung 4.30: Lineare Regressionsanalysen zwischen den jeweiligen delta-werten der Einzelparameter (wo mögl. als Index) und delta HZVI (pulmonalarteriell) 54 Abbildung 4.31 bis Abbildung 4.4: Lineare Regressionsanalysen zwischen den jeweiligen delta-werten der Einzelparameter (wo mögl. als Index) und delta SVI (arteriell) 60 Abbildung 4.43 bis Abbildung 4.54: Lineare Regressionsanalysen zwischen den jeweiligen delta-werten der Einzelparameter (wo mögl. als Index) und delta SVI (pulmonalarteriell) 66 8
9 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 3.1: Auflistung verschiedener Daten der einzelnen Patienten 3 Tabelle 3.: Volumengabe, Injektatvolumen und gefäßwirksame Medikamente während der Messungen 37 Tabelle 4.1: Darstellung der Ergebnisse vor Volumengabe 39 Tabelle 4.: Darstellung der Ergebnisse nach Volumengabe 40 Tabelle 4.3: Darstellung der delta-werte 40 Tabelle 4.4: Tabelle 4.5: Tabelle 4.6: Tabelle 4.7: Signifikanzprüfung zwischen den Werten vor und nach Volumengabe 41 Korrelation verschiedener Parameter (delta-werte) zu HZVI a (delta-wert) 4 Korrelation verschiedener Parameter (delta-werte) zu HZVI pa (delta-wert) 4 Korrelation verschiedener Parameter (delta-werte) zu SVI a (delta-wert) 43 Tabelle 4.8: Korrelation verschiedener Parameter (delta-werte) zu SVI pa (delta-wert) 43 9
10 1. Einleitung 1. 1 Definition und Bedeutung von Vorlast Als Vorlast oder englisch preload wird die mechanische Vorbelastung des Herzens bezeichnet. Gemeint ist dabei die Dehnung bzw. Länge der Herzmuskelfasern des linken Ventrikels zu Beginn der Ventrikelkontraktion. In der Klinik, und hier vor allem bei der Intensivbehandlung kritisch kranker Patienten sowie beim peri- bzw. postoperativen Patientenmonitoring, spielt die Vorlast eine sehr wichtige Rolle, um die aktuelle Volumensituation einschätzen zu können und somit Verschiebungen in Richtung Hypo- oder Hypervolämie frühzeitig erkennen und adäquat behandeln zu können. Der Grund für die zentrale Bedeutung der Vorlast liegt darin, daß ein Zusammenhang zwischen der Herzfüllung und der Auswurfleistung des Herzens besteht. Dieser Zusammenhang wurde von dem Deutschen Frank und dem Engländer Starling am isolierten Herzen (Frank) und später am Herz-Lungen-Präparat (Starling) beschrieben und ist heute nicht nur in der Physiologie unter dem Begriff Frank-Starling- Mechanismus (114) bekannt. Der entscheidende Parameter ist hierbei die Vordehnung der Muskelfasern des Herzens, die durch die enddiastolische Herzfüllung bestimmt wird. Entweder kann die Vorlast des Herzens (preload), also die enddiastolische Füllung verändert sein, oder die Nachlast (afterload), also der Aortendruck, gegen den das Herz das Schlagvolumen (SV) auswirft. Beide Veränderungen führen am isolierten Herzen zu einem erhöhten enddiastolischen Volumen, wobei eine erhöhte Nachlast vorübergehend ein verkleinertes Schlagvolumen zur Folge hat und dann erst der am isolierten Herzen gleichbleibende venöse Rückstrom ein erhöhtes enddiastolisches Volumen verursacht, das den Auswurf eines normalen Schlagvolumens gegen den erhöhten Aortendruck ermöglicht. Als physiologische Grundlage des Frank-Starling-Mechanismus ist anzusehen, daß durch die Vordehnung der Herzmuskelfasern unter Vermittlung von Troponin C die Empfindlichkeit für Kalziumionen erhöht wird, welche für die Kontraktion eines Muskels von entscheidender Bedeutung sind (60, S ). Der Frank-Starling-Mechanismus wird immer dann wirksam, wenn die Füllung der Ventrikel verändert ist. Er ermöglicht die langfristige Anpassung der Förderleistung von rechtem und linkem Ventrikel. Schon minimale Unterschiede in der Förderleistung könnten sonst in kurzer Zeit zu extremen Druckanstiegen im Körperund Lungenkreislauf führen. Der Mechanismus wird zum Beispiel auch zwangsläufig wirksam beim Übergang vom Liegen zum Stehen, der Orthostase. Hierbei sinkt der venöse Rückstrom, und die Auswurfleistung des Herzens wird verschlechtert. Umgekehrt steigen beim Hinlegen der venöse Rückstrom und das Schlagvolumen. Es wird also deutlich, daß der Begriff des Frank-Starling-Mechanismus sehr eng mit dem Begiff Vorlast verknüpft ist, und die Vorlast wiederum beim Volumenmanagement eines Patienten eine entscheidende Rolle spielt. Entscheidend 10
11 im Hinblick auf diese Arbeit ist hierbei folgende Überlegung: Der Füllungsdruck des Vorhofs ist abhängig vom präkardialen Druck und Volumen (preload), wobei das präkardiale Volumen als Teil des Niederdrucksystems in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gesamtvolumenstatus steht (1, S ) (3, S 3-16) (57, S ). Mit Parametern, die es ermöglichen, die kardiale Vorlast zu bestimmen, kann so gleichzeitig eine Aussage über den gesamten Volumenstatus getroffen werden. 1. Klassische Parameter Zu den klassischen Parametern, die seit vielen Jahren routinemäßig auf Intensivstationen zur Beurteilung des Volumenstatus eines Patienten herangezogen werden, gehören der zentralvenöse Druck (ZVD) sowie der pulmonalkapilläre Verschlußdruck (PCWP). Diese genannten Größen sind den sogenannten direkten Parametern bezüglich der Einschätzung der Volumensituation zuzurechnen; die Vorstellung hierbei ist, daß bei diesen Größen eine alleinige Veränderung des zirkulierenden Volumens direkt, also ohne Zwischenschaltung weiterer Mechanismen eine Auswirkung zeigt. So stellten etwa Henry et al. (48, S 91-94) die unmittelbare Wechselbeziehung zwischen aktuellem Blutvolumen einerseits und den Drücken im Niederdrucksystem andererseits durch ihre Untersuchungen dar. Auch andere Autoren wie Arndt (, S ) konnten im Tierversuch zeigen, daß sich die Drücke vor allem volumenpassiv einstellen. Von diesen direkten Parametern sind die sogenannten indirekten Parameter zu unterscheiden, wobei sich hier eine alleinige Veränderung des zirkulierenden Volumens über mehrere Schritte auswirkt. Da es sich bei diesen Größen, zu nennen wäre zum Beispiel das Herzzeitvolumen oder auch das Urinzeitvolumen, aber nicht um die klassischerweise zur Abschätzung der Vorlast bzw. des Volumenstatus gebräuchlichen Meßmethoden handelt, soll die Darstellung auf die direkten Parameter beschränkt bleiben. Als weiterer Vorlast- bzw. Volumenparameter soll in diesem Abschnitt auch auf die sogenannte end-diastolic-area (EDA) eingegangen werden, die mittels transösophagealer Echokardiographie bestimmt werden kann. Zwar handelt es sich hierbei im Vergleich zu den oben angesprochenen Methoden um einen nicht so oft benutzten und nicht so sehr verbreiteten Vorlastparameter, der jedoch in jüngerer Zeit - insbesondere auf kardiochirurgischen Intensivstationen - immer mehr an Bedeutung gewinnt in Bezug auf die Einschätzung des Volumenstatus von Patienten. 11
12 1.. 1 Zentralvenöser Druck (ZVD) Der Druck, der in den intrathorakalen Venen bzw. im rechten Vorhof vorliegt, wird als zentralvenöser Druck oder zentraler Venendruck (ZVD) bezeichnet. Bei geöffneter Trikuspidalklappe, also in der diastolischen Phase der Herzaktion, entspricht dieser Druck auch dem Druck im rechten Ventrikel. Seit den 60er Jahren hat sich die Messung des zentralvenösen Drucks im zunehmenden Maße als einer der Leitparameter zur Überwachung der Volumenregulation in der Klinik durchgesetzt und etabliert (16, S ). Bis heute ist der ZVD aufgrund seiner Charakterisierung der Füllungszustände des rechten Ventrikels eine der wichtigsten Führungsgrößen zur Volumensteuerung in der Intensivmedizin geblieben (11, S 937) (1, S 88-90). Vorteile des zentralvenösen Drucks, der mittels Einbringung eines Katheters im Bereich der oberen oder unteren Hohlvene bestimmt wird, sind die relativ einfache und schnelle Meßmethodik unter der Voraussetzung der richtigen Anwendung und Kenntnis der Technik, sowie die kontinuierliche Verfügbarkeit der Meßdaten. Einschränkend für die Verwertbarkeit dieses Parameters hinsichtlich seiner Aussagekraft zum Volumenstatus ist die Tatsache, daß dieser nur den Füllungsdruck für den Bereich vor dem rechten Herzen wiedergibt und somit von verschiedenen Einflußfaktoren abhängig ist. An Faktoren, die diesen Druckwert beeinflußen sind vor allem folgende zu nennen: zirkulierendes Blutvolumen, aktuelle Herzfunktion, Verteilung des Blutvolumens, sowohl zentraler als auch peripherer Gefäßtonus, momentane Körperposition, intrathorakaler Druck und Compliance der Lunge (66, S 6-45) (89, S ). Auch Jacobson (54, S ) bezeichnet den ZVD als die Funktion vierer meßbarer, unabhängiger Größen: 1. Volumen und Blutfluß in den zentralen Venen;. Dehnbarkeit und Kontraktilität der rechten Herzkammer während der Füllungsphase; 3. Tonus in den zentralen Venen; 4. intrathorakaler Druck. Hierbei ist zu bemerken, daß gerade bei Intensivpatienten, bei denen die Erhebung des aktuellen Volumenstatus bzw. der aktuellen Vorlastsituation von großer Bedeutung ist, durch das klinische Behandlungskonzept auf zum Teil mehrere der oben genannten Faktoren eingewirkt wird. In diesem Zusammenhang ist insbesondere an maschinelle Beatmung, Einsatz von Vasokonstriktoren und Vasodilatanzien, die Herzfunktion beeinflussende Medikamente als auch Lagerungsmanöver zu denken. Desweiteren unterliegt der ZVD interindividuell schon beim Gesunden relativ starken Schwankungen, wobei Werte zwischen bis 8 mm Hg als Norm angesehen werden können. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Interpretation des ZVD-Wertes hinsichtlich seiner Aussagekraft auf die Volumensituation eines Patienten grundsätzlich nur im gerade aufgeführten Kontext möglich ist. 1
13 1.. Pulmonalkapillärer Verschlußdruck (PCWP) Der zweite wichtige Parameter zur Beurteilung des Volumenstatus stand 1970 mit der Einführung des Swan-Ganz-Katheters zur Verfügung, der es gestattete den pulmonalkapillären Verschlußdruck, auch als pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) bezeichnet, zu messen (116, S ). Ebenso wurde es möglich, zusätzlich zum ZVD den pulmonalarteriellen Druck, die gemischt-venöse Sauerstoffsättigung sowie das Herzzeitvolumen (HZV) mittels Thermodilution zu bestimmen. Da die systemische Hämodynamik weitestgehend durch die Füllung des linken Ventrikels determiniert wird, war der PCWP als neuer Leitparameter äußerst geeignet, zuverlässige Informationen über diesen intensivmedizinisch essentiellen Parameter zu erlangen, da gezeigt werden konnte, daß bei spontan atmenden oder auch IPPV-beatmeten Patienten eine enge Korrelation des PCWP mit dem linksatrialen Druck besteht (14, S ) (7, S ) (51, S 3-34) (53, S ) (79, S ) (16, S ). Die Messung des PCWP erfolgt durch Aufblasen des Ballons des Swan-Ganz- Katheters mit Wedgen in einem kleineren Pulmonalarterienast. Dabei liegt die Vorstellung zugrunde, daß der Ballon die Arterie nach stromaufwärts komplett verschließt und sich dann über das Katheterlumen der Druck der Flüssigkeitssäule stromabwärts messen läßt (78, S ). Die Indikationen für die Einschwemmung des Swan-Ganz-Katheters sind umstritten (99, S ) (111, S ), wobei eigentlich nur darüber Einigkeit besteht, daß dieser Katheter aufgrund möglicher Komplikationen und nicht unerheblicher Kosten nicht leichtfertig zum Einsatz gebracht werden sollte. Mögliche Indikationen sind bei Friesinger et al. aufgeführt (30, S ). Im Gegensatz zur einfachen und relativ risikoarmen Methodik der ZVD-Messung ist die Einschwemmung eines Ballonkatheters zur PCWP-Messung über das rechte Herz in eine Pulmonalarterie unter Monitor- oder Bildwandlerkontrolle wesentlich aufwendiger und risikoreicher hinsichtlich möglicher Komplikationen. So kommen hier neben den bei Einführung eines zentralvenösen Katheters bestehenden Komplikationen eine höhere Inzidenz ernsterer Arhythmien sowie vor allem bei längerer Liegedauer Endokard- und Herzklappenvegetationen, Endokarditis, Ausbildung muraler und katheterständiger Thromben, Thrombosen der Vena jugularis interna oder subclavia bis hin zur überaus gefährlichen Pulmonalarterienruptur vor (66, S 6-45). Weiterhin kann die Messung nicht kontinuierlich, sondern nur im Intervall durchgeführt werden. Von Vorteil ist jedoch der Ort der Messung, weil dadurch direkt die enddiastolischen Füllungszustände im Bereich des linken Herzens bestimmt werden können, die die systemische Kreislauffunktion determinieren, während dies bei der rechtsherzspezifischen ZVD-Messung nicht möglich ist (6, S ) (14, S ) (7, S ) (53, S ) (61, S ) (16, S ). Außerdem besteht die Möglichkeit unter zusätzlichem Einsatz eines HZV-Computers das Herzzeitvolumen mittels Thermodilutionsmethode zu bestimmen. 13
14 Allerdings handelt es sich bei der PCWP-Messung analog zu der ZVD-Messung um eine Druckbestimmung, die somit wiederum von verschiedenen Faktoren wie Compliance und Kapazität der pulmonalen Gefäße, Kontraktilität des linken Ventrikels, intrathorakale Druckverhältnisse oder auch linksventrikuläre Nachlast beeinflußbar ist (, S 161). Zusätzlich sind gerade die etablierten und häufig durchgeführten Messungen der Füllungsdrücke sehr oft mit einer großen Fehlerquote behaftet (51, S 3-34) (67, S 70-77) (79, S ) (131, S ); außerdem werden die Volumenverhältnisse unter kontrollierter Beatmung, die beim Intensivpatienten für die vital essentielle Oxygenierung sorgt, nicht korrekt wiedergegeben (51, S 3-34) (58, S ) (67, S 70-77) (79, S ) (119, S 71-75). Desweiteren ist die geringe Sensitivität und der große Normbereich zu erwähnen, welcher von 6 bis 1 mm Hg (104, S 9-97) oder auch von bis 1 mm Hg (19, S 58) reicht, wodurch erst bei sehr großen Volumenverschiebungen von der Norm abweichende Werte auftreten (46, S ) (10, S 61-9) (110, S 30-34) End-diastolic area (EDA) Dieser Parameter wird mittels transösophagealer Echokardiographie (TEE) ermittelt, welche eine eher neuartige Methode im Bereich des hämodynamischen Monitorings darstellt. Es handelt sich um ein bildgebendes Verfahren, mit dem Morphologie, Größe und Funktion des Herzens und seiner angrenzenden Strukturen dargestellt werden können. Die ersten Ansätze zur TEE stammen aus den 70er und frühen 80er Jahren (1, S ) (8, S ) (50, S ). Diese als semiinvasiv zu bezeichnende Technik wird vor allem in der Anästhesie, sowie in der Intensivmedizin angewendet. Das Einsatzgebiet der TEE umfaßt einerseits die peri- und postoperative Überwachung von vor allem kardiochirurgischen Patienten (Kardioanästhesie) (9, S ) (44, S 01-05) (56, S 70-77) (107, S ) (115, S ) (14, S ) und hier wiederum besonders von klappenchirurgischen Patienten (Mitralklappe, Trikuspidalklappe, Aortenklappe), andererseits aber auch die Diagnostik verschiedener kardiovaskulärer Störungen. Bezüglich der vorliegenden Untersuchung liegt die Indikation für die TEE eindeutig in der Möglichkeit des Online-Monitorings. So kann mittels TEE die globale Kontraktilität des rechten und linken Ventrikels, die Funktion von nativen, rekonstruierten und künstlichen Herzklappen, regionale Wandbewegungen sowie der Füllungszustand des rechten und linken Ventrikels beurteilt werden. Entscheidend für die Abschätzung der momentanen Volumensituation eines Patienten ist in dieser Aufzählung der letzte Punkt, also der Füllungszustand der Ventrikel. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn bei hohem oder stark wechselndem intrathorakalen Druck der Füllungszustand des Herzens aufgrund von zentralem Venendruck und pulmonalkapillärem Verschlußdruck nur schlecht eingeschätzt 14
15 werden kann. Auch bei wechselnder Compliance des (linken) Ventrikels, wie dies bei herzchirurgischen Eingriffen oder beim Auftreten von Myokardischämien häufig vorkommt, läßt sich der Füllungszustand des Herzens mit Hilfe der TEE zuverlässiger beurteilen, als dies aufgrund der Füllungsdrücke allein möglich wäre (66, S 6-45). So läßt sich mittels TEE öfter eine Hypovolämie nachweisen, die aufgrund der Füllungsdrücke allein nicht offensichtlich war. Der hierbei entscheidende Parameter ist die enddiastolische Ventrikelgröße oder englisch end-diastolic area (EDA) bzw. genauer left ventricular end-diastolic area (LVEDA) in der sogenannten Kurzachsendarstellung. Eine Abnahme der EDA im Verlauf des Monitorings weist auf eine Hypovolämie, umgekehrt eine Zunahme auf eine Hypervolämie hin, immer im Vergleich zu den initial beobachteten Füllungszuständen. Die für die Füllungszustände der Ventrikel als zumindest in klinischer Hinsicht als goldener Standard anzusehende Methode der transösophagealen Echokardiographie (66, S 6-45) stellt eine Methode mit relativ geringem Risiko dar, wobei sich wesentliche Komplikationen bei ca. 0,% der Untersuchungen ereignen. Diese reichen von Zahnschäden und Schleimhautläsionen bis hin zu Perforationen, Rhythmusstörungen und Myokardischämien. Ein wesentlicher Nachteil ist allerdings, daß mit der TEE das für die Vorlast- bzw. Volumeneinschätzung nicht unerhebliche Herzzeitvolumen (HZV) nicht zuverlässig gemessen werden kann. Als weiterer Nachteil ist die Untersucherabhängigkeit aufzuführen, da es sich für unterschiedliche Untersucher als äußerst schwierig erweist, die exakt gleichen Schnitte durch den linken Ventrikel einzustellen, wodurch Abweichungen bei den Ergebnissen resultieren können. Zusammenfassend ist zu sagen, daß die TEE im Vergleich zum invasiven Monitoring (intravasale Blutdruckmessung, Pulmonalarterienkatheter) zusätzliche Informationen über die kardialen Funktionen liefert. Somit wird mittels TEE im allgemeinen nicht versucht, das invasive Monitoring zu ersetzen, sondern es zu komplettieren Neuere Parameter Obwohl die gerade aufgeführten Parameter - hier vor allem ZVD und PCWP - immer noch als Standardmeßwerte bei der intraoperativen und intensivmedizinischen Volumenregulation angesehen werden können, finden in den letzten Jahren auch neuere mit anderen Meßmethoden erhaltene Parameter vermehrt Eingang in die Klinik. In diesem Zusammenhang ist von den Methoden vor allem die Thermo- bzw. Thermo-dye-Dilution, also die Temperatur- bzw. die kombinierte Temperatur- Farbstoffverdünnung sowie die Pulskonturanalyse hervorzuheben, mit Hilfe derer eine ganze Reihe weiterer und zum Teil auch für die Einschätzung des Volumenstatus eines Patienten interessanter Parameter gewonnen werden können. 15
16 Im Folgenden sollen kurz die mit diesen Methoden in der vorliegenden Untersuchung erhobenen Parameter vorgestellt werden, während das eigentliche Prinzip der Thermo- bzw. Thermo-dye-Dilution und der Pulskonturanalyse weiter unten gezeigt werden Intrathorakales Blutvolumen (ITBV) Die Messung des intrathorakalen Blutvolumens mittels Indikatordilution wird bereits seit über 30 Jahren durchgeführt (75, S ). Es setzt sich aus den enddiastolischen Herzvolumina (globales enddiastolisches Volumen, GEDV) und dem pulmonalen Blutvolumen (PBV) zusammen, wobei anzumerken ist, daß das GEDV /3 bis 3/4 vom ITBV entspricht. Bezüglich seiner Rolle als hämodynamischer Parameter ist festzuhalten, daß das ITBV, belegt durch zahlreiche Untersuchungen, ein wesentlich besserer Indikator des kardialen Preloads ist als etwa zentralvenöser Druck oder pulmonalkapillärer Verschlußdruck (3, S ) (34, S 40-59) (51, S 3-34) (58, S ) (67, S 70-77) (79, S ) (83, S 1-76) (84, S 5-83) (85, S 03-07) (86, S 368) (94, S ) (119, S 71-75) (16, S ) (131, S ). Auch konnte gezeigt werden, daß bei beatmeten Intensivpatienten das ITBV den Status des zirkulierenden Blutvolumens anzeigt, wogegen die klinisch bisher als Standard gebrauchten kardialen Füllungsdrücke (ZVD, PCWP) keinen Zusammenhang zur Kreislauffüllung aufweisen (88, S ). Die Messung des ITBV ist prinzipiell durch mehrere Methoden möglich, wie zum Beispiel Szintigraphie, Plethysmographie, Röntgendensitrometrie oder Spirometrie, die sich aufgrund ihres hohen meßmethodischen Aufwands oder ihrer Invasivität nicht für den bettseitigen klinischen Einsatz eignen. So wurde in der vorliegenden Studie das ITBV mittels Thermo- bzw. Thermo-dye-Dilution ermittelt, was für die Klinik hinsichtlich Kosten und Durchführbarkeit sicher die geeignete Meßart darstellt. Das ITBV wurde in dieser Untersuchung zum einen über die Thermo-dye-Dilution (ITBV tdd), zum anderen auch über die alleinige arterielle Thermodilution (ITBV td) bestimmt. Bei der hier verwendeten Thermo-dye-Dilution ergibt sich das intrathorakale Blutvolumen aus dem Produkt von arteriell gemessenen Herzzeitvolumen und mittels Fiberoptik gemessener mittlerer Durchgangszeit des Farbstoffs Indocyaningrün vom Ort der zentralvenösen Injektion bis zum Ort der arteriellen Messung ( ITBV = HZV a * MTt FD a). Dagegen kommt es bei der verwendeten arteriellen Thermodilution zu einer Abschätzung des ITBV aus dem mittels Thermodilutionsmessung erhaltenen globalen enddiastolischen Volumen (GEDV), wobei ein spezifischer Koeffizient a und eine spezifische Konstante b eingerechnet werden (ITBV = a * GEDV + b). 16
17 1. 3. Globales enddiastolisches Volumen (GEDV) Das globale enddiastolische Volumen (GEDV) ist die Summe aus allen enddiastolischen Volumina der Vorhöfe und Ventrikel. Somit läßt sich die Aussage treffen, daß das GEDV dem Vorlastvolumen des Gesamtherzens entspricht. Dieser Parameter ist hinsichtlich der Spezifität und Sensitivität als Indikator der kardialen Vorlast mit dem gerade aufgeführten ITBV vergleichbar (87, S 38-39). Die Ermittlung des GEDV erfolgte in dieser Studie durch die arterielle Thermodilution, wobei die Differenz aus mittlerer Durchgangszeit der Kältewelle vom Ort der Injektion bis zum Ort der Messung und der exponentiellen Abfallzeit der arteriellen Thermodilutionskurve mit dem arteriellen Herzzeitvolumen multipliziert wird (GEDV = HZV a * (MTt TDa DSt TDa)) Totales Blutvolumen (TBV) Das TBV ist an sich eigentlich kein neuer Parameter im Vergleich zu den klassischen Größen; dennoch wurde der Indikator in diesen Abschnitt eingegliedert, da er zum einen, wie auch andere an dieser Stelle vorgestellte Parameter, mit einem Indikatorverfahren gemessen werden kann, zum anderen bisher kaum als Vorlastanzeiger in der Klinik in Erscheinung getreten ist. Das zirkulierende Blutvolumen (TBV) errechnet sich bei der Farbstoffverdünnungsmethode (Dye-Dilution) aus dem langsam abfallenden Teil der arteriellen Indocyaningrünfarbstoffkurve zwischen circa 80 und 40 Sekunden nach der (zentralvenösen) Injektion. Diese Methode wurde 1968 von Bradley et al (13, S ) beschrieben und später von Haneda und Horiuchi (45, S 49-56) bestätigt. Allerdings konnte sich das TBV nie als gebräuchlicher Volumenregulationsparameter durchsetzen, wohl auch wegen des zum Teil nicht unerheblichen Aufwands, da neben der Farbstoffverdünnung meist Messungen mit radioaktiven Markersubstanzen durchgeführt wurden, was vor allem großen Zentren vorbehalten blieb (108, S ) (109, S ) (110, S 30-34) Rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen (RVEDV) Rechtsherzenddiastolisches Volumen (RHEDV) Linksherzenddiastolisches Volumen (LHEDV) All diese Parameter, bei denen es sich jeweils um enddiastolische Herzvolumina handelt, wurden in der vorliegenden Untersuchung mit Hilfe der pulmonalarteriellen Thermodilution ermittelt; sie stellen mit Ausnahme des rechtsventrikulären enddiastolischen Volumen (RVEDV), welches noch öfter in hämodynamischen 17
18 Studien als Parameter auftaucht, sowohl in der Klinik wenig gebräuchliche als auch in der Literatur eher selten beschriebene Größen dar. Das RVEDV ergibt sich aus dem Produkt von pulmonalarteriell ermittelten Herzzeitvolumen und logarithmischer Abfallzeit der pulmonalarteriellen Thermodilutionskurve (RVEDV = HZV pa * DSt TD pa). Die Rolle des RVEDV als Indikator des Volumenstatus und somit auch als Parameter der kardialen Vorlast ist in der Literatur uneinheitlich beschrieben (8, S 100) (6, S 18-4) (15, S ). Das rechtsherzenddiastolische Volumen (RHEDV) stellt das enddiastolische Volumen des rechten Vorhofs und des rechten Ventrikels dar und enthält bei zentralvenöser Injektion zusätzlich einen venösen Anteil aus der Vena cava. Es errechnet sich aus dem Produkt von pulmonalarteriell ermittelten Herzzeitvolumen und der mittleren Durchgangszeit des Indikators Kälte vom zentralvenösen Ort der Injektion bis zur Spitze des pulmonalarteriellen Thermodilutionskatheters (RHEDV = HZV pa * MTt TD pa). Wellhöfer et al (18, S 3-41) befanden das RHEDV unter normalen Umständen als sensitiven Wert der kardialen Vorlast und auch Rasinski et al (96, S 108) zeigten, daß das RHEDV ein brauchbarer Indikator der rechtsventrikulären Vorlast ist, wiederum begrenzt auf normale Umstände (d. h. das Rechtsherzvolumen ist zum Beispiel nicht als Folge einer Rechtsherzinsuffizienz erhöht). Schließlich stellt das linksherzenddiastolische Volumen (LHEDV) eine bisher eher selten benutzte und beschriebene Größe dar. Das LHEDV ist ein die postpulmonalen Volumenverhältnisse repräsentierender Parameter, der sich aus der Differenz von global enddiastolischen Volumen (GEDV) und rechtsherzenddiastolischen Volumen (RHEDV) errechnet (LHEDV = GEDV RHEDV). Lingstädt (65, S 94-95) befand in seiner Arbeit über die Sensitivität linksherzspezifischer Parameter das LHEDV als zur Steuerung der Vorlast geeignet, wobei es auch eine gute Sensitivität im klinischen Alltag zeigte Schlagvolumenvariation (SVV) Seit einiger Zeit ist als neue Methode des hämodynamischen Monitorings die sogenannte Pulskonturanalyse einsetzbar (15, S ) (35, S ) (100, S ). Das so gemessene Herzzeitvolumen basiert auf der Analyse der arteriellen Pulskurve, was zuerst von Wesseling et al. beschrieben worden ist (19, S 16-5). Der Parameter Schlagvolumenvariation (SVV) wird ebenso mit Hilfe dieser Technik ermittelt. Er gibt an, um wieviel Prozent das kardiale Schlagvolumen um einen über 30 Sekunden bestimmten Mittelwert variiert. Hierzu wird bei dieser Methode das maximale (SV max) und das minimale Schlagvolumen (SV min) bestimmt und aus den Maximal- und Minimalwerten Mittelwerte gebildet. Somit ergibt sich die SVV aus der Differenz zwischen dem Mittelwert SV max und dem Mittelwert SV min, 18
19 dividiert durch den Mittelwert aus allen Schlagvolumina der letzten 30 Sekunden und zuletzt multipliziert mit dem Faktor 100, um einen Prozentwert zu erhalten (SVV = ((SV max SV min) / SV mittel) * 100). SVV hängt bei überdruckbeatmeten Patienten im wesentlichen von der vaskulären Füllung des Patienten ab. Bei einer starken Variation des SVV, also einem relativ hohen Prozentwert, induziert durch die Inspiration bei der Überdruckbeatmung, kann man davon ausgehen, daß die vaskuläre Füllung nicht ausreichend ist. Somit stellt auch die SVV einen Parameter zur Einschätzung des Volumenstatus bzw. der Veränderung der Volumenverhältnisse dar Systolic pressure variation (SPV) Auch dieser Parameter wird durch die Methode der Pulskonturanalyse gebildet, was bedeutet, daß die systolische Blutdruckkurve die Ausgangsgröße darstellt. Als systolic pressure variation (SPV) wird hierbei die Differenz zwischen den maximalen und minimalen Werten des systolischen Blutdrucks während eines Atemhubs mit Überdruck bezeichnet. SPV beinhaltet zwei Komponenten: zum einen das sogenannte delta up (dup), welches die Differenz zwischen dem maximalen Wert des systolischen Blutdrucks während eines Überdruck-Beatmungszyklus und dem Wert des systolischen Blutdrucks während der kurzen Apnoephase (funktionelle Residualkapazität) ist; zum anderen das sogenannte delta down (ddown), welches die Differenz zwischen dem systolischen Blutdruck während der kurzen Apnoephase und dem minimalen Wert des systolischen Blutdrucks während eines Beatmungszyklus ist. In Anwesenheit einer Hypovolämie sind die hämodynamischen Effekte einer Überdruck-Beatmung wesentlich deutlicher ausgeprägt, was sich in einer charakteristischen Erhöhung von SPV und der ddown-komponente darstellt (8, S ). Dies kann als Indikator einer verminderten Vorlast genutzt werden. In verschiedenen klinischen und experimentellen Studien konnte gezeigt werden, daß SPV eine sensitive Größe ist, um die Vorlast- bzw. Volumensituation einschätzen zu können; so etwa bei Blutverlust (8, S ) (101, S 95-93), Hypotension (91, S ) (9, S ), Herzfehlern (93, S ), bei Intensivpatienten (68, S ), PEEP-Beatmung (90, S 647), sowie beim Volumenmanagement von Patienten nach Gefäßoperationen (0, S 46-53). Dennoch ist SPV trotz all dieser Studien bisher immer noch ein experimenteller und in der Klinik kaum eingesetzter Hämodynamik- bzw. Vorlastparameter. 19
20 . Untersuchungsziel Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, welcher von den gerade aufgeführten Parametern nach definierter Volumengabe bei postoperativen herzchirurgischen Patienten die Vorlastveränderung am besten anzeigt bzw. welche Größe die iatrogen herbeigeführte Volumenveränderung beim Patienten am besten wiedergibt. Hierzu wurden verschiedene Methoden kombiniert, um somit möglichst viele, klassische ebenso wie relativ neue Parameter miteinander vergleichen zu können. Besonderer Wert wurde in diesem Zusammenhang auf Praxisnähe und klinische Anwendbarkeit gelegt; zum einen ist die Situation, in der die Untersuchung durchgeführt wurde - eine Intensivstation mit maschinell beatmeten Patienten - nicht als theoretisch zu bezeichnen, zum anderen waren die eingesetzten Methoden nicht mit einem in der alltäglichen Praxis unangemessenen finanziellen oder organisatorischen Aufwand verbunden. Im Einzelnen stellten sich die Ziele der vorliegenden Untersuchung folgendermaßen dar: a) Wie sensitiv reagieren die bisher immer noch bevorzugt verwendeten Parameter ZVD und PCWP auf rasche Volumenveränderung bei beatmeten Intensivpatienten? b) Wie verhält sich die mittels transösophagealer Echokardiographie ermittelte Größe EDA hinsichtlich dieser Fragestellung? c) Gibt es zu den gerade aufgeführten Parametern alternative Größen aus den Bereichen der Thermodilution, der Thermo-dye-Dilution oder der Pulskonturanalyse, welche eine veränderte Volumensituation besser widerspiegeln? d) Sollte zukünftig an etablierten Methoden festgehalten werden, oder sollten neue Methoden propagiert werden, um ältere Parameter zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen? 0
21 3. Material und Methodik 3. 1 Allgemeines zur dargestellten Untersuchung Im Vorfeld der Untersuchung wurde ein Antrag wegen Durchführung einer klinischen Studie gemäß den Richtlinien zum Antrag an die Ethikkommision bei Forschungsvorhaben am Menschen vom Mai 1994 bei der zuständigen Ethikkommision eingereicht, in dem die Funktionsweise der verwendeten Geräte, mögliche Risiken für den Patienten sowie das Ziel der Studie genau erläutert wurden. Diesem Antrag folgte die Bestätigung der ethisch-rechtlichen Unbedenklichkeit von seiten der Ethikkommision. Die klinische Studie wurde in der herzchirurgischen Intensivstation einer Universitätsklinik durchgeführt, in der fast ausschließlich Patienten nach kardiochirurgischen Eingriffen behandelt werden. Der Zeitraum, in dem die Studienpatienten untersucht wurden, betrug circa zwei Monate. 3. Patienten der Studie Es wurden insgesamt 0 Patienten in die Studie aufgenommen. Jeder Patient wurde am Vortag anhand eines Patientenaufklärungsbogens sowohl über Sinn und Zweck der geplanten Untersuchung, als auch über mögliche, hiermit verbundene Risiken ausführlich informiert und mußte sein Einverständnis mit seiner Unterschrift dokumentieren. Selbstverständlich war ein späteres Zurückziehen der Einverständniserklärung durch den Patienten ohne Beeinflussung der weiteren klinischen Behandlung ohne weiteres möglich. Alle Patienten mußten gewisse Einschlußkriterien erfüllen, um präoperativ als mögliche Studienteilnehmer ausgewählt zu werden. So durfte keine arterielle bzw. periphere arterielle Verschlußkrankheit vorliegen, sowie das 18. Lebensjahr nicht unter- und das 90. Lebensjahr nicht überschritten sein. Weiterhin wurden Schwangere und sehr adipöse Patienten mit einem Körpergewicht von über 10 kg ausgeschlossen, um mögliche Abknickungen des, über eine in der Arteria femoralis plazierten Schleuse, liegenden Thermo-dye-Dilutionskatheters und damit verbundene Fehlmessungen zu verhindern. Postoperativ wurden Patienten ausgeschlossen, die sich hämodynamisch instabil zeigten, wobei der Verlauf folgender Parameter ausschlaggebend war: arteriell gemessene Blutdruckwerte, elektrokardiographisch gemessene Frequenz bzw. sich hierbei zeigende Ischämiezeichen des Myokards, pulmonalarteriell gemessenes Herzzeitvolumen und in der transösophagealen Echokardiographie sich darstellende Ventrikeldyskinesien; desweiteren ist der postoperative Katecholaminverbrauch als 1
22 weiterer Parameter aufzuführen, wobei Patienten mit sehr hoher sowie stark wechselnder Katecholamindosierung nicht in die Studie aufgenommen wurden, da die Konstanthaltung der Katecholamingabe während des Meßzeitraums eine wichtige Grundvoraussetzung darstellte, um Messungen später verwerten zu können. Das Patientenkollektiv umfaßte 1 männliche und 8 weibliche Teilnehmer, also eine Gesamtheit von insgesamt 0 Patienten. Das Alter streute zwischen 48 und 88 Jahren, woraus sich ein Mittelwert von 65,8 Jahren mit einer Standardabweichung von +/- 11,00 ergibt. Als weitere Patientendaten sind das Körpergewicht und die Körpergröße aufzuführen, wobei das Körpergewicht zwischen 56 kg und 114 kg lag, mit einem Mittelwert von 79,8 kg (Standardabweichung +/- 14,76) und die Körpergröße zwischen 153 cm und 19 cm variierte, mit einem Mittelwert von 178,8 cm (Standardabweichung +/- 8,53). Zusätzlich wurde die Körperoberfläche (KOF) und der sogenannte body-massindex (BMI) aus den Angaben Körpergewicht und Körpergröße berechnet; zum einen, um mit Hilfe der KOF die jeweiligen Indexwerte der gemessenen Vorlastparameter zu bestimmen und somit Patienten besser miteinander vergleichen zu können, zum anderen, um über den BMI die jedem Teilnehmer zu infundierende Volumenmenge exakt angeben zu können. Somit ergaben sich KOF-Werte zwischen 1,6 m² und,34 m², was einem Mittelwert von 1,91 m² (Standardabweichung +/- 0,19) entspricht, und BMI-Werte zwischen kg/m² und 39,45 kg/m², was einem Mittelwert von 7,38 kg/m² (Standardabweichung +/- 4,8) entspricht. Einen für herzchirurgische Patienten klinisch wichtigen, weil die Pumpleistung des Herzmuskels charakterisierenden Parameter, stellt die sogenannte Ejektionsfraktion (EF) dar, die in dieser Patientengruppe präoperativ beim Großteil, nicht jedoch bei allen Teilnehmern ermittelt worden war. So fehlte bei insgesamt 5 Patienten eine präoperative Bestimmung der EF; bei den verbleibenden 15 variierten die EF-Werte zwischen 38 % und 89 %, mit einem Mittelwert von 66,45 % (Standardabweichung +/- 15,45). Ein weiterer, an dieser Stelle relevanter Punkt ist die Aufschlüsselung der kardiochirurgischen Eingriffe, die bei den Teilnehmern dieser Studie kurz vor Meßbeginn durchgeführt worden waren. Diese ergibt sich wie folgt: Bei insgesamt 1 Patienten (60 %) handelte es sich um eine aortokoronare Bypass-Operation, bei 4 Patienten (0 %) um einen Aortenklappenersatz, bei einem Patienten (5 %) um eine Mitralklappenrekonstruktion, bei einem Patienten (5 %) um eine Kombination aus aortokoronarer Bypass-Operation und Aortenklappenersatz, bei einem Patienten (5 %) um eine Kombination aus Mitralklappenersatz und Trikuspidalklappenrekonstruktion sowie bei einem Patienten (5 %) um eine Kombination aus Mitralklappenrekonstruktion und Trikuspidalklappenrekonstruktion. Diese Verteilung hinsichtlich der bei den Studienteilnehmern ausgeführten Operationen gibt einen guten Querschnitt für das Patientengut wieder, das in operativen herzchirurgischen Intensivstationen betreut bzw. hämodynamisch überwacht werden muß.
23 Tabelle 3.1: Auflistung verschiedener Daten der einzelnen Patienten Pat. - Nr. Alter Geschlecht Gewicht Größe KOF BMI EF OP 1 71 w ,7 3,86 79 ACBP 88 w ,69 18,078 keine Angabe AKE 3 60 m ,91 3,36 keine Angabe AKE 4 55 w ,91 34, ACBP 5 56 m ,1 30,99 keine Angabe ACBP 6 76 m 8 180,0 5,31 89 ACBP 7 77 m ,96 8, ACBP/AKE 8 74 m , ACBP 9 67 m ,8 3,875 keine Angabe ACBP m ,86 6,97 38 ACBP m ,09 31, ACBP 1 60 w ,77 5, MKE/TKR w ,6, MKR/TKR m ,34 8,1 83 MKR w ,67 9,476 keine Angabe AKE w ,85 30, ACBP m ,87, ACBP m ,89 5, ACBP w ,3 39, AKE 0 48 m ,97 8, ACBP ACBP : aortokoronarer Bypass MKR : Mitralklappenrekonstruktion AKE : Aortenklappenersatz TKR : Trikuspidalklappenrekonstruktion MKE : Mitralklappenersatz Abbildung 3.1: Körperoberfläche (KOF in m²) der Patienten KOF-Diagramm,5 m² 1,5 1 0,5 0 KOF Patient 3
24 Abbildung 3.: Body-mass-index (BMI in kg/m²) der Patienten BMI-Diagramm kg/m² BMI Patient 3. 3 Verwendete Geräte und Materialien PiCCO-System PiCCO leitet sich von PCCO ab, was wiederum als Abkürzung des englischen pulse contour cardiac output dient, übersetzt also für das Pulskontur-Herzzeitvolumen steht. Bei dem eingesetzten PiCCO-System (Fa. Pulsion Medical Systems, München) handelt es sich um ein medizintechnisches Gerät, das verschiedene hämodynamisch in der Klinik interessierende Parameter anzeigt und somit vor allem perioperativ und in der Intensivmedizin Anwendung findet. Zu erwähnen ist an erster Stelle, daß in diesem System zwei verschiedene Meßmethoden integriert sind: zum einen die sogenannte Thermodilutionstechnik, durch die unterschiedliche Meßwerte diskontinuierlich dargestellt werden, zum anderen die sogenannte Pulskonturtechnik, durch die unterschiedliche Meßwerte kontinuierlich dargestellt werden können. Zunächst soll hier kurz auf die Methodik und die Möglichkeiten der Thermodilution eingegangen werden. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines zentralvenösen Katheters und eines arteriellen, z. B. eines über die Arteria femoralis in der Aorta abdominalis plazierten Katheters beim Patienten. Den wichtigsten bzw. den Ausgangsparameter, weil aus der sogenannten Thermodilutionskurve errechnet, stellt das arteriell gemessene Herzzeitvolumen (HZV a) dar. Es wird bei der Thermodilution prinzipiell nach der Stewart-Hamilton-Methode berechnet. Zur Durchführung der Thermodilution wird ein bekanntes Volumen einer auf unter 10 C gekühlten Lösung (z. B. sterile 4
25 isotonische Kochsalzlösung) möglichst schnell zentralvenös injiziert. Der sich infolge dieser Injektion eines Bolus kalter Lösung stromabwärts ergebende Temperaturverlauf ist abhängig vom Fluß und dem von der Kältewelle durchlaufenen Volumen. Mit dem Gerät kann die Temperaturverlaufskurve (=Thermodilutionskurve) stromabwärts im arteriellen System gemessen werden. Das Herzzeitvolumen (HZV) errechnet sich aus der Thermodilutionskurve wie folgt: HZV = (T b T i ) * V i * K / delta T b * dt T b : Bluttemperatur vor Injektion des Kältebolus T i : Temperatur der injizierten Lösung (Injektat) V i : Injektatvolumen delta T b * dt: Fläche unter der Thermodilutionskurve K : Korrekturkonstante, welche sich aus spezifischen Gewichten und spezifischen Wärmen von Blut und Injektat zusammensetzt Durch Multiplikation des Herzzeitvolumens mit bestimmten charakteristischen Zeiten aus der arteriellen Thermodilutionskurve lassen sich spezifische Volumina berechnen. Hierzu wird vom PiCCO-System aus der Thermodilutionskurve die mittlere Durchgangszeit (MTt, von englisch mean transit time ) und die exponentielle Abfall- oder auch Auswaschzeit (DSt, von englisch downslope time ) ermittelt. Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Dilutionskurve und deren Analyse nach Transitzeiten At : Anflutungszeit DSt : Abfall-/ Auswaschzeit MTt : mittlere Durchgangszeit 5
26 Das Produkt aus HZV und MTt ergibt das von dem Indikator Kälte durchlaufene Volumen, also das Volumen zwischen dem Ort der Injektion und dem Ort der Messung. Dieses Volumen wurde in der anglo-amerikanischen Literatur oft auch das needle to needle volume genannt. Das Produkt aus HZV und DSt ergibt das größte Einzelvolumen auf der Meßstrecke, welches von dem Indikator durchlaufen wurde. Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Mischkammern im kardiopulmonalen System (für Thermodilution) RAEDV : RVEDV : PBV : LAEDV : LVEDV : EVLW : rechtsatriales enddiastolisches Volumen rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen pulmonales Blutvolumen linksatriales enddiastolisches Volumen linksventrikuläres enddiastolisches Volumen extravasales Lungenwasser Da die Thermodilution beim PiCCO nur zur Kalibrierung der Pulskonturanalyse eingesetzt wurde, werden die durch die Methode der Thermodilution in dieser Studie erhobenen Parameter weiter unten bei der Beschreibung des COLD-Systems aufgezählt, welches ebenfalls mittels alleiniger Thermodilution messen kann. Die zweite und für diese Untersuchung entscheidende Möglichkeit des PiCCO, ist die Option der Pulskonturanalyse, die nach folgendem Prinzip arbeitet: Während der systolischen Phase des Herzschlages wird Blut in die Aorta ausgeworfen. Zeitgleich fließt Blut von der Aorta durch die Peripherie. Insgesamt vergrößert sich das Volumen des Aortenbogens, da das Volumen, welches während der Auswurfphase in den Aortenbogen gepumpt wird, größer ist als das Volumen, welches die Aorta verläßt. In der darauf folgenden diastolischen Phase fließt der größte Anteil des im Aortenbogen verbleibenden Blutes in die Peripherie. Dieses Verhalten ist entscheidend für die Kontraktion des Aortenbogens, die vom Blutdruck 6
27 und vom Volumen abhängt. Insbesondere stellt die Volumenänderung in Abhängigkeit der Druckänderung die sogenannte Compliance-Funktion dar. Da das Verhältnis des Blutflusses aus dem Aortenbogen und dem Druck (aortennah oder in einer größeren Arterie) durch die Compliance-Funktion bestimmt wird, ist es möglich, die Compliance-Funktion durch die zeitgleiche Messung des Herzzeitvolumens und des Blutdrucks zu bestimmen. Während der Kalibrierung der Pulskurve sind der Blutdruck P und das transkardiopulmonal gemessene Herzzeitvolumen erforderlich, um die Compliance-Funktion für den jeweiligen Patienten zu erkennen. Somit werden patientenspezifische Krankheiten wie etwa Arteriosklerose mit einbezogen. Nachdem die patientenspezifische Compliance-Funktion bestimmt wurde, berechnet das PiCCO den durch den Auswurf des linken Herzens bedingten Blutfluß. Vergleicht man das Produkt der Fläche A unter dem Blutfluß und der Herzfrequenz HR mit dem transkardiopulmonalen Herzzeitvolumen HZVa, ermöglicht das transkardiopulmonale Herzzeitvolumen außerdem die Bestimmung einer Kalibrations-Konstanten cal., bedingt durch folgende Beziehung: HZVa = cal. * A * HR Wenn die Kalibrierung durchgeführt wurde, können der Blutfluß und folglich die Fläche A unter der Flußkurve, wie auch die Herzfrequenz HR, lediglich durch die Nutzung des Blutdrucks dargestellt werden. Schließlich wird das kontinuierliche Herzzeitvolumen durch folgende Beziehung bestimmt: PCCO = cal. * A * HR Zur Berechnung des Kalibrierfaktors ist die Ermittlung eines HZV als Referenz nötig. Für diese Referenzmessung kann prinzipiell jede anerkannte Methode benutzt werden, wobei in dieser Untersuchung die arterielle Thermodilution über PiCCO gewählt wurde. Dies geschah über Thermodilutionsmessungen mit demselben, auch vom COLD-System genutzten Thermo-dye-Dilutionskatheter. Folgende Parameter wurden als für diese Untersuchung wichtig anzusehend mit dem PiCCO-System bestimmt: - durch Pulskonturanalyse: Schlagvolumenvariation (SVV) Systolische Druckvariation (SPV) COLD-System COLD steht als Abkürzung für die aus dem Englischen stammenden Begriffe circulation, oxygenation, lung water und diagnosis, also übersetzt für 7
28 Kreislauf, Sauerstoff-Sättigung, Lungenwasser und Diagnosesystem. Was bei dieser Untersuchung im Vordergrund stand, war circulation, also das Kreislaufmonitoring, während die anderen, gerade aufgeführten Möglichkeiten des Geräts nicht von Interesse waren. Verwendet wurde das COLD Z-01-System (Fa. Pulsion Medical Systems, München), welches bei der Option des Kreislaufmonitorings die Bestimmung verschiedener, hämodynamisch wichtiger Parameter erlaubt. Voraussetzung auf Seiten des Patienten ist das Vorhandensein eines zentralvenösen Katheters (ZVK) sowie eines arteriellen und / oder pulmonalarteriellen Katheters. Da durch Hinzunahme des pulmonalarteriellen Katheters ( Pulmonalis-Katheter ) die Bestimmung einer Reihe weiterer Volumina ermöglicht wird, wurde bei der vorliegenden Arbeit sowohl ein arterieller als auch ein pulmonalarterieller Katheter eingesetzt. Grundlegendes Prinzip der hier interessierenden Fluß- und Volumenmessung ist die auch kombinierte Verwendung spezifischer Indikatoren für den intravasalen und extravasalen Raum im kardiopulmonalen System. Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Mischkammern im kardiopulmonalen System (für Thermo-dye-Dilution) RAEDV : rechtsatriales enddiastolisches Volumen M : Messung RVEDV : rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen PBV : pulmonales Blutvolumen LAEDV : linksatriales enddiastolisches Volumen LVEDV : linksventrikuläres enddiastolisches Volumen EVLW : extravasales Lungenwasser I (-T, D) : Kälteinjektion / Farbstoffinjektion TDpa : pulmonalarterielle Thermodilution TDa : arterielle Thermodilution FDa : arterielle Farbstoffdilution 8
29 Ein zentralvenös injizierter Indikator durchmischt sich immer mit dem größten verfügbaren Volumen - auf die Herzkammervolumina bezogen mit dem enddiastolischen Volumen (EDV). Nach entsprechender Verdünnung des Indikators ist eine Wieder-Konzentration nicht möglich. Der Indikator Kälte (physikalisch = negative Wärme) durchmischt sich nach schlagartiger zentralvenöser Injektion mit dem EDV des rechten Vorhofs, wird dann weitertransportiert in den rechten Ventrikel, wo er weiter in dessen EDV verdünnt wird. Die injizierte Kälte läuft dann vergleichbar einer Welle mit der Transportgeschwindigkeit des Herzzeitvolumens durch die Lunge und das EDV des linken Vorhofs und Ventrikels. Die bis zur arteriellen Temperatur-Meßstelle noch durchlaufenen Gefäßvolumina (z. B. Aorta, A. iliaca) spielen aufgrund der geringen arteriellen Gefäßcompliance lediglich als kleine Volumenkonstante eine Rolle. Kälte kann infolge von direkter Wärmeleitung (Konvektion) und über Teilchentransport (Diffusion) in Abhängigkeit von der für den Austausch zur Verfügung stehenden Oberfläche und Zeit auch extravasale Räume erfassen. Da die Wärmeaustauschfläche im Gefäßsystem der Lunge mehr als 1000 mal größer ist als die in den Herzkammern und den großen Gefäßen, diffundiert die das kardiopulmonale System durchlaufende Kältewelle auch in den extravasalen Raum der Lunge - vorwiegend den Lungenwasserraum (EVLW) zusätzlich zu ihrer Ausbreitung im intrathorakalen intravasalen Raum. Der verwendete Indikator Indocyaningrün ist ein seit Jahrzehnten bekannter und untoxischer Farbstoff, welcher sich sofort nach Injektion in die Blutbahn an Plasmaproteine mit einem Molekulargewicht > , vorwiegend an ß- Lipoproteine, bindet. Da Plasmaproteine auch beim schwerwiegendsten Kapillarleck in der Lunge bei einer Passage durch das kardiopulmonale System zu mehr als 99,9 % intravasal bleiben, kann mit ICG der intravasale Raum markiert werden. Zusammenfassend ist zu sagen, daß mit dieser Methode folgende Indikatorverdünnungskurven erfasst werden können: - Thermodilution (Kälteverdünnung) in der A. pulmonalis - Thermodilution im arteriellen System (z. B. A. femoralis) - Farbstoffdilution im arteriellen System Das Herzzeitvolumen (HZV) wird hierbei genauso wie beim oben beschriebenen PiCCO-System nach der Thermodilutionsmethode, also auch nach der oben gezeigten Stewart-Hamilton-Methode berechnet. Durch Multiplikation des Herzzeitvolumens mit bestimmten charakteristischen Zeiten aus den hier allerdings maximal drei Indikatorverdünnungskurven - der Thermodilutionskurve in der A. pulmonalis sowie der Thermo- und Farbstoffdilutionskurve im arteriellen System - lassen sich spezifische Volumina berechnen. Dazu berechnet das Gerät aus jeder Indikatorverdünnungskurve die mittlere Durchgangszeit (MTt) und die exponentielle Abfall- oder auch Auswaschzeit (DSt) (siehe oben). 9
30 Abbildung 3.6: Berechnungsformeln und schematische Darstellung der DSt- Volumina RVEDV: PBV: PTV: EVLW : rechtsventrikuläres enddiastolisches Volumen pulmonales Blutvolumen pulmonales Thermovolumen extravasales Lungenwasser nach der DSt-Methode Abbildung 3.7: Berechnungsformeln und schematische Darstellung der MTt- Volumina RHEDV: rechtsherzenddiastolisches Volumen GEDV: globales enddiastolisches Volumen ITBV: intrathorakales Blutvolumen LHEDV: linksherzenddiastolisches Volumen ITTV: intrathorakales Thermovolumen EVLW: extravasales Lungenwasser nach dem MTt-Verfahren 30
Anästhesie spez. Monitoring PiCCO
 UniversitätsSpital Zürich u Bildungszentrum Schule für Anästhesie-, Intensiv-, Notfall- und Operationspflege Anästhesie spez. Monitoring PiCCO Lehrbeauftragte: Frau Margrit Wyss Bischofberger Fachmodule
UniversitätsSpital Zürich u Bildungszentrum Schule für Anästhesie-, Intensiv-, Notfall- und Operationspflege Anästhesie spez. Monitoring PiCCO Lehrbeauftragte: Frau Margrit Wyss Bischofberger Fachmodule
Die Hämodynamik. Grundlagen der Hämodynamik und Monitoring mittels Picco.
 Die Hämodynamik Grundlagen der Hämodynamik und Monitoring mittels Picco. Definition der Hämodynamik. Die Hämodynamik beschreibt den Blutfluss im Cardiopulmonalen System sowie in den nachfolgenden Blutgefäßen,
Die Hämodynamik Grundlagen der Hämodynamik und Monitoring mittels Picco. Definition der Hämodynamik. Die Hämodynamik beschreibt den Blutfluss im Cardiopulmonalen System sowie in den nachfolgenden Blutgefäßen,
6 Nebenwirkungen der Beatmung
 344 6 Nebenwirkungen der Beatmung Neben den positiven Effekten der maschinellen Beatmung, nämlich der Verbesserung des Gasaustausches mit gesteigerter O 2 -Transportkapazität und der Reduzierung der Atemarbeit,
344 6 Nebenwirkungen der Beatmung Neben den positiven Effekten der maschinellen Beatmung, nämlich der Verbesserung des Gasaustausches mit gesteigerter O 2 -Transportkapazität und der Reduzierung der Atemarbeit,
Philips PiCCO Modul / IntelliVue KONTINUIERLICHES HERZZEITVOLUMEN VORLASTVOLUMEN KONTINUIERLICHE VOLUMENREAGIBILITÄT EXTRAVASALES LUNGENWASSER
 Philips PiCCO Modul / IntelliVue KONTINUIERLICHES HERZZEITVOLUMEN VORLASTVOLUMEN KONTINUIERLICHE VOLUMENREAGIBILITÄT EXTRAVASALES LUNGENWASSER Platzierungsorte für Thermodilutions-Katheter A. axillaris
Philips PiCCO Modul / IntelliVue KONTINUIERLICHES HERZZEITVOLUMEN VORLASTVOLUMEN KONTINUIERLICHE VOLUMENREAGIBILITÄT EXTRAVASALES LUNGENWASSER Platzierungsorte für Thermodilutions-Katheter A. axillaris
Hämodynamisches Monitoring nach Herzoperationen. PD Dr. J. Weipert
 Hämodynamisches Monitoring nach Herzoperationen PD Dr. J. Weipert Anforderungen an das Monitoring postoperativ - Überwachung der Extubationsphase - Kontrolle der Volumen- und Flüssigkeitszufuhr - Behandlung
Hämodynamisches Monitoring nach Herzoperationen PD Dr. J. Weipert Anforderungen an das Monitoring postoperativ - Überwachung der Extubationsphase - Kontrolle der Volumen- und Flüssigkeitszufuhr - Behandlung
Titel: Hämodynamik Doc. No. 1 Datum: 06/07/2016 Revision No. Autor: Seite 1 von 6 Intensivstation, Lindenhofspital, Bern
 Autor: Barbara Affolter, Hans-Martin Vonwiller Seite 1 von 6 1/6 Autor: Barbara Affolter, Hans-Martin Vonwiller Seite 2 von 6 1.0 Einführung 1.1 Hämodynamik ist die strömungsphysikalische Beschreibung
Autor: Barbara Affolter, Hans-Martin Vonwiller Seite 1 von 6 1/6 Autor: Barbara Affolter, Hans-Martin Vonwiller Seite 2 von 6 1.0 Einführung 1.1 Hämodynamik ist die strömungsphysikalische Beschreibung
Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler. Technische Universität München. Deutsches Herzzentrum München
 Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler Technische Universität München Deutsches Herzzentrum München (Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Hess, Ph. D.) Intrathorakale Volumenparameter, gemessen
Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler Technische Universität München Deutsches Herzzentrum München (Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. Hess, Ph. D.) Intrathorakale Volumenparameter, gemessen
Dopplersonographie der Vena femoralis und Hydratationszustand bei Hämodialysepatienten. Dissertation
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor Prof. Dr. med. B. Osten) und der Medizinischen Klinik I des Krankenhauses St. Elisabeth
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor Prof. Dr. med. B. Osten) und der Medizinischen Klinik I des Krankenhauses St. Elisabeth
Mechanik der Herzaktion (HERZZYKLUS)
 Mechanik der Herzaktion (HERZZYKLUS) Lernziele: 36, 37,40 Kontraktionsformen des Myokards Preload (Vorlast) Afterload (Nachlast) auxoton 1 Mechanik der Herzaktion (HERZZYKLUS) Ventrikelsystole Anspannungsphase
Mechanik der Herzaktion (HERZZYKLUS) Lernziele: 36, 37,40 Kontraktionsformen des Myokards Preload (Vorlast) Afterload (Nachlast) auxoton 1 Mechanik der Herzaktion (HERZZYKLUS) Ventrikelsystole Anspannungsphase
kleine kardiovaskuläre Hämodynamik
 Mittwochsfortbildung im St. Marienhospital Lüdinghausen 27. Januar 2010 Themen des Vortrages: Wozu benötige ich eine hämodynamische Beurteilung Hämodynamische Parameter: Meßmethoden Normalwerte Hämodynamische
Mittwochsfortbildung im St. Marienhospital Lüdinghausen 27. Januar 2010 Themen des Vortrages: Wozu benötige ich eine hämodynamische Beurteilung Hämodynamische Parameter: Meßmethoden Normalwerte Hämodynamische
Management auf der Intensivstation
 Management auf der Intensivstation Inhalte Beurteilung & Monitoring Inotropika & Vasoaktiva Left ventricular assist devices (LVAD s): IABP Impella 2.5 2 Was erwartet uns? Trends in treatment of STEMI,
Management auf der Intensivstation Inhalte Beurteilung & Monitoring Inotropika & Vasoaktiva Left ventricular assist devices (LVAD s): IABP Impella 2.5 2 Was erwartet uns? Trends in treatment of STEMI,
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.- Prof. Dr. med. R. M. Schmid) Eine prospektive klinische Studie zur Erfassung und Prädiktion
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.- Prof. Dr. med. R. M. Schmid) Eine prospektive klinische Studie zur Erfassung und Prädiktion
Blutkreislauf, Arbeit des Herzens
 Blutkreislauf, Arbeit des Herzens Physikalische Grundprinzipien der Hämodynamik Blutmenge im Körper 80 ml Blut pro kg Körpergewicht 8 % des Körpergewichtes Erwachsener: 5-6 l Blutvolumen Blutverlust: 10
Blutkreislauf, Arbeit des Herzens Physikalische Grundprinzipien der Hämodynamik Blutmenge im Körper 80 ml Blut pro kg Körpergewicht 8 % des Körpergewichtes Erwachsener: 5-6 l Blutvolumen Blutverlust: 10
Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff?
 Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Aus der Klinik für Thorax- Herz-Gefäßchirurgie Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg / Saar Ist der Ersatz der Porzellanaorta bei Aortenstenose ein Hochrisikoeingriff? Dissertation zur Erlangung
Aspekte der hämodynamischen Stabilisierung im septischen Schock
 Aspekte der hämodynamischen Stabilisierung im septischen Schock Stefan John Medizinische Klinik 4 Nephrologie / Intensivmedizin Klinikum Nürnberg Universität Erlangen - Nürnberg Klinikum Nürnberg 20.04.2010
Aspekte der hämodynamischen Stabilisierung im septischen Schock Stefan John Medizinische Klinik 4 Nephrologie / Intensivmedizin Klinikum Nürnberg Universität Erlangen - Nürnberg Klinikum Nürnberg 20.04.2010
Hämodynamisches Monitoring. Theoretische und praktische Aspekte
 Hämodynamisches Monitoring Theoretische und praktische Aspekte Hämodynamisches Monitoring A. Physiologische Grundlagen B. Monitoring C. Optimierung des HZV D. Messung der Vorlast E. Einführung in die PiCCO-Technolgie
Hämodynamisches Monitoring Theoretische und praktische Aspekte Hämodynamisches Monitoring A. Physiologische Grundlagen B. Monitoring C. Optimierung des HZV D. Messung der Vorlast E. Einführung in die PiCCO-Technolgie
Ist der ZVD passé? Sylvia Köppen
 Sylvia Köppen 08.12.2017 Der Parameter ZVD selbst ist unter Druck geraten und sein Image hat gelitten. Definition: der ZVD ist der Blutdruck im rechten Vorhof des Herzens und in den Hohlvenen (Vv. cava
Sylvia Köppen 08.12.2017 Der Parameter ZVD selbst ist unter Druck geraten und sein Image hat gelitten. Definition: der ZVD ist der Blutdruck im rechten Vorhof des Herzens und in den Hohlvenen (Vv. cava
Vergleich invasiver versus nicht-invasiver Cardiac Index Messung
 Michael Möderndorfer Matrikel Nummer 0311418 Vergleich invasiver versus nicht-invasiver Cardiac Index Messung Diplomarbeit Medizinische Universität Graz Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin
Michael Möderndorfer Matrikel Nummer 0311418 Vergleich invasiver versus nicht-invasiver Cardiac Index Messung Diplomarbeit Medizinische Universität Graz Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin
Akute und langfristige hämodynamische Auswirkungen einer MitraClip-Implantation auf eine vorbestehende sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
 Akute und langfristige hämodynamische Auswirkungen einer MitraClip-Implantation auf eine vorbestehende sekundäre Rechtsherzinsuffizienz Dr. Mark Hünlich, Göttingen Die Mitralklappeninsuffizienz ist nach
Akute und langfristige hämodynamische Auswirkungen einer MitraClip-Implantation auf eine vorbestehende sekundäre Rechtsherzinsuffizienz Dr. Mark Hünlich, Göttingen Die Mitralklappeninsuffizienz ist nach
UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF. Titel der Dissertation
 UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie Klinikdirektoren: Prof. Dr. med. Alwin E. Goetz Prof. Dr. med. C. Zöllner Titel der Dissertation Funktionelles hämodynamisches
UNIVERSITÄTSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie Klinikdirektoren: Prof. Dr. med. Alwin E. Goetz Prof. Dr. med. C. Zöllner Titel der Dissertation Funktionelles hämodynamisches
3. Physiologie und Pathophysiologie des venösen Blutflusses
 3. Physiologie und Pathophysiologie des venösen Blutflusses 3.1 Der venöse Rückstrom Während der Impuls für den arteriellen Blutstrom phasenweise und mit hohem Druck durch die Kontraktion des linken Ventrikels
3. Physiologie und Pathophysiologie des venösen Blutflusses 3.1 Der venöse Rückstrom Während der Impuls für den arteriellen Blutstrom phasenweise und mit hohem Druck durch die Kontraktion des linken Ventrikels
HZV-Monitoring. HZV-Monitoring 2. Linksherzmonitorring 3. Pulmonaler Kapillardruck ( Wedge -Druck, PCWP): 3 Totaler pulmonaler Widerstand (TPR): 3
 -Monitoring -Monitoring 2 Linksherzmonitorring 3 Pulmonaler Kapillardruck ( Wedge -Druck, PCWP): 3 Totaler pulmonaler Widerstand (TPR): 3 und PVR/ PAP mittel 4 Rechtsherzmonitoring 4 Vorlast: 4 Kontraktilität:
-Monitoring -Monitoring 2 Linksherzmonitorring 3 Pulmonaler Kapillardruck ( Wedge -Druck, PCWP): 3 Totaler pulmonaler Widerstand (TPR): 3 und PVR/ PAP mittel 4 Rechtsherzmonitoring 4 Vorlast: 4 Kontraktilität:
Anästhesie bei Bauchaortenaneurysma
 Anästhesie bei Bauchaortenaneurysma BAA-Operationen im AKA Anzahl 140 120 100 80 110 86 84 113 100 100 125 109 60 40 20 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Ursachen für BAA Arteriosklerose Marfan
Anästhesie bei Bauchaortenaneurysma BAA-Operationen im AKA Anzahl 140 120 100 80 110 86 84 113 100 100 125 109 60 40 20 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Ursachen für BAA Arteriosklerose Marfan
Physiologie des Herz- PDF created with pdffactory trial version
 Physiologie des Herz- Kreislaufsystems Fakten über das Herz ca. 3 Milliarden Schläge im Leben pumpt ca. 250 Millionen Liter Blut durch den Körper wiegt in etwa 300 g das Herz bildet zusammen mit den Blutgefäßen
Physiologie des Herz- Kreislaufsystems Fakten über das Herz ca. 3 Milliarden Schläge im Leben pumpt ca. 250 Millionen Liter Blut durch den Körper wiegt in etwa 300 g das Herz bildet zusammen mit den Blutgefäßen
PiCCO plus. Aufbau. Zentraler Venenkatheter Injektattemperatur- Sensorgehäuse PV4046 (enthalten in PV8115) AUX Adapterkabel PC81200
 Aufbau Zentraler Venenkatheter Injektattemperatur- Sensorgehäuse PV4046 (enthalten in PV8) AUX Adapterkabel PC800 Injektattemperatur- Sensorkabel PC8009 Druckkabel PMK-06 Temperaturverbindungskabel PC800
Aufbau Zentraler Venenkatheter Injektattemperatur- Sensorgehäuse PV4046 (enthalten in PV8) AUX Adapterkabel PC800 Injektattemperatur- Sensorkabel PC8009 Druckkabel PMK-06 Temperaturverbindungskabel PC800
Mitralklappen-Clipping bei Hochrisikopatienten mit degenerativer oder funktioneller Mitralklappeninsuffizienz
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.- Prof. Dr. R. M. Schmid) Eine prospektive, klinische Studie zur Validierung von Prädiktoren
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.- Prof. Dr. R. M. Schmid) Eine prospektive, klinische Studie zur Validierung von Prädiktoren
Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität München
 Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilian-Universität München (Direktor: Prof. Dr. med. Bernhard Zwissler) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Chirurgische Forschung der Universität München
Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilian-Universität München (Direktor: Prof. Dr. med. Bernhard Zwissler) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Chirurgische Forschung der Universität München
Beyond PAC modernes erweitertes hämodynamisches Monitoring. Hämodynamisches Monitoring. Hämodynamik. Inotropie. Vorlast.
 Beyond PAC modernes erweitertes hämodynamisches Monitoring OA Univ. Prof. Dr. Stefan Dunzendorfer Intensivstation Universitätsklinik für Innere Medizin I Medizinische Universität Innsbruck Hämodynamisches
Beyond PAC modernes erweitertes hämodynamisches Monitoring OA Univ. Prof. Dr. Stefan Dunzendorfer Intensivstation Universitätsklinik für Innere Medizin I Medizinische Universität Innsbruck Hämodynamisches
DISSERTATION. Veränderte postoperative Volumentherapie nach Eingriffen am oberen Gastrointestinaltrakt mit Hilfe des COLD-Systems?
 Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie der Medizinischen Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Veränderte postoperative Volumentherapie nach Eingriffen
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie der Medizinischen Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Veränderte postoperative Volumentherapie nach Eingriffen
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Habilitationsschrift
 Aus dem CharitéCentrum für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Nephrologie (CC13) Medizinische Klinik für Nephrologie Direktor: Prof. Dr. Walter Zidek Habilitationsschrift Hämodynamische Monitoringverfahren
Aus dem CharitéCentrum für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Nephrologie (CC13) Medizinische Klinik für Nephrologie Direktor: Prof. Dr. Walter Zidek Habilitationsschrift Hämodynamische Monitoringverfahren
Tabelle 1. Prä- und intraoperative Daten in beiden Gruppen.
 6. Ergebnisse 6.1 Patientendaten Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Gruppen bei den prä- und intraoperativen Parametern. Der Kreatininwert war präoperativ signifikant höher und der
6. Ergebnisse 6.1 Patientendaten Es gab keine wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Gruppen bei den prä- und intraoperativen Parametern. Der Kreatininwert war präoperativ signifikant höher und der
Aus der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. N. Roewer
 Aus der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. N. Roewer METAANALYSE ZUR IN-VIVO-BESTIMMUNG VON BLUTVOLUMINA Inaugural-Dissertation zur Erlangung
Aus der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie der Universität Würzburg Direktor: Professor Dr. med. N. Roewer METAANALYSE ZUR IN-VIVO-BESTIMMUNG VON BLUTVOLUMINA Inaugural-Dissertation zur Erlangung
Echokardiographie. Definition: Verschiedene Verfahren: Lernhilfen zur Blockpraktikum Kardiologie WS 2015/2016 Mahabadi/Schmidt/Baars
 Definition: Def.: Echokardiographie : Echokardiographie Sonographisches Verfahren zur Beurteilung von Herz und Perikard Liefert detaillierte Informationen über Struktur und Funktion der Herzwände und klappen,
Definition: Def.: Echokardiographie : Echokardiographie Sonographisches Verfahren zur Beurteilung von Herz und Perikard Liefert detaillierte Informationen über Struktur und Funktion der Herzwände und klappen,
3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene
 3 Ergebnisse 3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene 3.1.1 Altersabhängige Genexpression der AGE-Rezeptoren Es wurde untersucht, ob es am menschlichen alternden Herzen
3 Ergebnisse 3.1 Altersabhängige Expression der AGE-Rezeptoren auf mrna und Proteinebene 3.1.1 Altersabhängige Genexpression der AGE-Rezeptoren Es wurde untersucht, ob es am menschlichen alternden Herzen
4 Ergebnisse. 4.1 Klinische Daten
 4 Ergebnisse 4.1 Klinische Daten In der Anlage (siehe Kap. 8) ist ein tabellarischer Überblick über die gewonnenen Daten der untersuchten Gruppen dargestellt. Im Folgenden werden einzelne für diese Arbeit
4 Ergebnisse 4.1 Klinische Daten In der Anlage (siehe Kap. 8) ist ein tabellarischer Überblick über die gewonnenen Daten der untersuchten Gruppen dargestellt. Im Folgenden werden einzelne für diese Arbeit
Optimierung der kardialen Vorlast - tierexperimentelle Untersuchung zur Schlagvolumenvariation und systolischen Druckvariation am Schweinemodell
 Optimierung der kardialen Vorlast - tierexperimentelle Untersuchung zur Schlagvolumenvariation und systolischen Druckvariation am Schweinemodell DISSERTATION Zur Erlangung des akademischen Grades doctor
Optimierung der kardialen Vorlast - tierexperimentelle Untersuchung zur Schlagvolumenvariation und systolischen Druckvariation am Schweinemodell DISSERTATION Zur Erlangung des akademischen Grades doctor
Technische Universität München. II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar. 1. Univ.-Prof. Dr. R. M. Schmid
 Technische Universität München II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. M. Schmid) Analyse einer prospektiv angelegten Datenbank zur transpulmonalen
Technische Universität München II. Medizinische Klinik und Poliklinik Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. R. M. Schmid) Analyse einer prospektiv angelegten Datenbank zur transpulmonalen
Fakultät für Medizin der Technischen Universität München
 Fakultät für Medizin der Technischen Universität München Validierung eines neuen Pulskontur-Algorithmus an perioperativen Patienten mit größeren Schwankungen des Herzzeitvolumens Zeno Richard Ehrmann Vollständiger
Fakultät für Medizin der Technischen Universität München Validierung eines neuen Pulskontur-Algorithmus an perioperativen Patienten mit größeren Schwankungen des Herzzeitvolumens Zeno Richard Ehrmann Vollständiger
Aus der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
 Aus der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kommissarischer Direktor: Prof. Dr.
Aus der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Kommissarischer Direktor: Prof. Dr.
Die Thrombin-Therapie beim Aneurysma spurium nach arterieller Punktion
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Katecholamine in der Intensivmedizin
 Katecholamine in der Intensivmedizin Dr. Hendrik Bachmann Intensivstation II am Klinikum Bamberg Schock-Definition Verschiedene Perspektiven: Beobachtungskonzept: Schock = Hypotonie und Tachykardie Hämodynamikkonzept:
Katecholamine in der Intensivmedizin Dr. Hendrik Bachmann Intensivstation II am Klinikum Bamberg Schock-Definition Verschiedene Perspektiven: Beobachtungskonzept: Schock = Hypotonie und Tachykardie Hämodynamikkonzept:
Zerebrovaskuläre Reservekapazität 2.Messung
 4 Ergebnisse 4.1 Reproduzierbarkeit Die Normalpersonen waren im Vergleich mit der Patienten- und Kontrollgruppe mit 29 ± 11 Jahren signifikant jünger (p < 0,001). Bei Vergleich der zerebralen Reservekapazität
4 Ergebnisse 4.1 Reproduzierbarkeit Die Normalpersonen waren im Vergleich mit der Patienten- und Kontrollgruppe mit 29 ± 11 Jahren signifikant jünger (p < 0,001). Bei Vergleich der zerebralen Reservekapazität
FORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN. Herausgegeben vom Minister für Wissenschaft und Forschung
 FORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN Nr. 2782/Fachgruppe Medizin Herausgegeben vom Minister für Wissenschaft und Forschung Priv. - Doz. Dr. med. habil. Bernd Reil Oberarzt der Klinik für Kiefer-
FORSCHUNGSBERICHTE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN Nr. 2782/Fachgruppe Medizin Herausgegeben vom Minister für Wissenschaft und Forschung Priv. - Doz. Dr. med. habil. Bernd Reil Oberarzt der Klinik für Kiefer-
Hämodynamisches Management Teil 1: Hämodynamisches Monitoring
 Begleitende Vorlesungsreihe zum Blockpraktikum Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin Hämodynamisches Management Teil 1: Hämodynamisches Monitoring Steffen Rex Klinik für Anästhesiologie srex@ukaachen.de
Begleitende Vorlesungsreihe zum Blockpraktikum Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin Hämodynamisches Management Teil 1: Hämodynamisches Monitoring Steffen Rex Klinik für Anästhesiologie srex@ukaachen.de
Evaluierung einer gering invasiven kontinuierlichen Pulskontur-Methode zur Messung des Cardiac Output an herzchirurgischen Patienten
 Evaluierung einer gering invasiven kontinuierlichen Pulskontur-Methode zur Messung des Cardiac Output an herzchirurgischen Patienten Kerstin C. Höke Technische Universität München Fakultät für Medizin
Evaluierung einer gering invasiven kontinuierlichen Pulskontur-Methode zur Messung des Cardiac Output an herzchirurgischen Patienten Kerstin C. Höke Technische Universität München Fakultät für Medizin
Klinische Erprobung des Respiratory Systolic Variation Tests zur Vorhersage der Volumenreagibilität nach großen abdominalchirurgischen Eingriffen.
 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie des Zentrums für Anästhesiologie und Intensivmedizin Direktor: Prof. Dr. med. Alwin E. Goetz Klinische Erprobung des Respiratory
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie des Zentrums für Anästhesiologie und Intensivmedizin Direktor: Prof. Dr. med. Alwin E. Goetz Klinische Erprobung des Respiratory
Diastolisches versus systolisches Pumpversagen
 Diastolisches versus systolisches Pumpversagen Dr. Velik-Salchner Corinna Univ.- Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin Medizinische Universität Innsbruck Fallbeispiel 2a, aufrecht sitzend,, SpO 2 85%
Diastolisches versus systolisches Pumpversagen Dr. Velik-Salchner Corinna Univ.- Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin Medizinische Universität Innsbruck Fallbeispiel 2a, aufrecht sitzend,, SpO 2 85%
Die prognostische Aussagekraft der Indocyaningrün- Plasmaeliminationsrate (ICG-PDR) bei herzchirurgischen Patienten
 Aus der Klink für Anaesthesiologie der Ludwig-Maximilans-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. Bernhard Zwißler Die prognostische Aussagekraft der Indocyaningrün- Plasmaeliminationsrate (ICG-PDR)
Aus der Klink für Anaesthesiologie der Ludwig-Maximilans-Universität München Direktor: Prof. Dr. med. Bernhard Zwißler Die prognostische Aussagekraft der Indocyaningrün- Plasmaeliminationsrate (ICG-PDR)
5. Diskussion 5.1. Nachweis und Quantifizierung der septischen Kardiomyopathie
 5. Diskussion 5.1. Nachweis und Quantifizierung der septischen Kardiomyopathie Schwerpunkte der Promotionsarbeit stellen der Nachweis und die Darstellung der Quantifizierbarkeit der septischen und SIRS-
5. Diskussion 5.1. Nachweis und Quantifizierung der septischen Kardiomyopathie Schwerpunkte der Promotionsarbeit stellen der Nachweis und die Darstellung der Quantifizierbarkeit der septischen und SIRS-
Kardiale Vorlast und zentraler Venendruck
 Medizin aktuell Anaesthesist 29 8:6 12 DOI 1.17/s11-9-13-3 Online publiziert: 22. April 29 Springer Medizin Verlag 29 A. Weyland 1 F. Grüne 2 1 Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin
Medizin aktuell Anaesthesist 29 8:6 12 DOI 1.17/s11-9-13-3 Online publiziert: 22. April 29 Springer Medizin Verlag 29 A. Weyland 1 F. Grüne 2 1 Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin
Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 Aus der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin (Akademischer Vertreter: Prof. Dr. N. Weiler) im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität
Aus der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin (Akademischer Vertreter: Prof. Dr. N. Weiler) im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel an der Christian-Albrechts-Universität
Dissertation Zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (kommissarischer Direktor: Prof. Dr. P. Presek) Einfluß einer β 1 -Blockade auf die Barorezeptorsensitivität
Aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (kommissarischer Direktor: Prof. Dr. P. Presek) Einfluß einer β 1 -Blockade auf die Barorezeptorsensitivität
standardisierten Fragebogen, dokumentiert. Ebenso wurde bei den 14 Patienten mit CSA spiroergometrisch eine Verbesserung der ventilatorischen
 4 DISKUSSION Anhand der Ergebnisse dieser Studie ergaben sich keine signifikanten Änderungen bei den nächtlich untersuchten kardiorespiratorischen Polygraphieparametern im Akutversuch einer kardialen Resynchronisation
4 DISKUSSION Anhand der Ergebnisse dieser Studie ergaben sich keine signifikanten Änderungen bei den nächtlich untersuchten kardiorespiratorischen Polygraphieparametern im Akutversuch einer kardialen Resynchronisation
I care Lernkarten Pflege Box 1: Grundlagen, Pflegetechniken und therapeutische Pflegeaufgaben
 I care Lernkarten Pflege Box 1: Grundlagen, Pflegetechniken und therapeutische Pflegeaufgaben Bearbeitet von Von Walter Anton, und Jasmin Schön 1. Auflage 2018. Lernkarten. 450 Karteikarten. In Box ISBN
I care Lernkarten Pflege Box 1: Grundlagen, Pflegetechniken und therapeutische Pflegeaufgaben Bearbeitet von Von Walter Anton, und Jasmin Schön 1. Auflage 2018. Lernkarten. 450 Karteikarten. In Box ISBN
Technische Universität München Fakultät für Medizin
 Technische Universität München Fakultät für Medizin Klinische Untersuchung zur Vereinfachung der Pulskonturanalyse und zur Bestimmung möglicher Fehlerquellen im Vergleich zur transpulmonalen Thermodilution
Technische Universität München Fakultät für Medizin Klinische Untersuchung zur Vereinfachung der Pulskonturanalyse und zur Bestimmung möglicher Fehlerquellen im Vergleich zur transpulmonalen Thermodilution
4. Ergebnisse. 1. Intraoperative Patientengruppe
 4. Ergebnisse Bei den Untersuchungen wurden insgesamt 33560 Signale von beiden menschlichen Untersuchern zweifelsfrei identifiziert. Hiervon waren 7022 MES und 26538 Artefakte. 1. Intraoperative Patientengruppe
4. Ergebnisse Bei den Untersuchungen wurden insgesamt 33560 Signale von beiden menschlichen Untersuchern zweifelsfrei identifiziert. Hiervon waren 7022 MES und 26538 Artefakte. 1. Intraoperative Patientengruppe
Aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. (Direktor: Prof.Dr.
 Aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof.Dr. Peter Presek) Belastungsinduzierte Zunahme der Herzfrequenz, Kontraktilität und
Aus dem Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof.Dr. Peter Presek) Belastungsinduzierte Zunahme der Herzfrequenz, Kontraktilität und
Technische(Universität(München(
 Technische(Universität(München( ( II.MedizinischeKlinikundPoliklinik KlinikumrechtsderIsar (Direktor:Univ.=Prof.Dr.R.M.Schmid) Klinische(Studie(zur(Indizierung(des(Herzzeitvolumens((HZV)(und(des(globalen(
Technische(Universität(München( ( II.MedizinischeKlinikundPoliklinik KlinikumrechtsderIsar (Direktor:Univ.=Prof.Dr.R.M.Schmid) Klinische(Studie(zur(Indizierung(des(Herzzeitvolumens((HZV)(und(des(globalen(
Echobasierte hämodynamische zielorientierte Therapiekonzepte
 Echobasierte hämodynamische zielorientierte Therapiekonzepte S. Treskatsch Universitätsklinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin Campus Benjamin Franklin U N I V E R S I T Ä
Echobasierte hämodynamische zielorientierte Therapiekonzepte S. Treskatsch Universitätsklinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin Campus Benjamin Franklin U N I V E R S I T Ä
2 Einleitung. Wall stress = (Druck Radius) / (2 Wanddicke)
 2 Einleitung Drei Hauptdeterminanten beschreiben die mechanische Herzfunktion: die Herzfrequenz, der Frank-Starling Mechanismus und die Kontraktilität. Das Produkt der Herzfunktion ist das Herzzeitvolumen:
2 Einleitung Drei Hauptdeterminanten beschreiben die mechanische Herzfunktion: die Herzfrequenz, der Frank-Starling Mechanismus und die Kontraktilität. Das Produkt der Herzfunktion ist das Herzzeitvolumen:
1 Messung eines konstanten Volumenstroms mit konstanter Dichte
 INHALTE I Inhalte 1 Konstanter Volumenstrom 1 1.1 Auswertung der Messwerte........................ 1 1.2 Berechnung des Volumenstroms...................... 1 1.3 Fehlerbetrachtung.............................
INHALTE I Inhalte 1 Konstanter Volumenstrom 1 1.1 Auswertung der Messwerte........................ 1 1.2 Berechnung des Volumenstroms...................... 1 1.3 Fehlerbetrachtung.............................
Aus der Klinik für Nephrologie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION
 Aus der Klinik für Nephrologie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Eignung volumetrischer hämodynamischer Parameter für die Steuerung des Flüssigkeitsentzuges während
Aus der Klinik für Nephrologie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Eignung volumetrischer hämodynamischer Parameter für die Steuerung des Flüssigkeitsentzuges während
Evidenz: Pulsoxymeter: keine Evidenz für Outcome-Verbesserung; Pulmonalarterienkatheter (PAK) ist umstritten.
 Welches Monitoring macht die Qualität? Dr. Michael Zürrer, Ärztegemeinschaft für Anästhesie und Intensivmedizin Hirslanden, Zürich Vortrag an der Jahrestagung SIGA-FSIA 18. April 2009 KKL Luzern Monitoring:
Welches Monitoring macht die Qualität? Dr. Michael Zürrer, Ärztegemeinschaft für Anästhesie und Intensivmedizin Hirslanden, Zürich Vortrag an der Jahrestagung SIGA-FSIA 18. April 2009 KKL Luzern Monitoring:
Hämodynamisches Monitoring und Leberfunktionsüberwachung. mittels Doppelindikatorverdünnungsmethode bei Patienten vor
 Hämodynamisches Monitoring und Leberfunktionsüberwachung mittels Doppelindikatorverdünnungsmethode bei Patienten vor und nach orthotoper Herztransplantation Tobias Seebauer Technischen Universität München
Hämodynamisches Monitoring und Leberfunktionsüberwachung mittels Doppelindikatorverdünnungsmethode bei Patienten vor und nach orthotoper Herztransplantation Tobias Seebauer Technischen Universität München
Pulsdruckvariation beim kontrolliert beatmeten Patienten nach. kardialer Bypass-Operation
 Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. B. Zwißler Einfluss des Tidalvolumens auf Schlagvolumenvariation und Pulsdruckvariation beim kontrolliert
Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Direktor: Prof. Dr. B. Zwißler Einfluss des Tidalvolumens auf Schlagvolumenvariation und Pulsdruckvariation beim kontrolliert
Mittelwert, Standardabweichung, Median und Bereich für alle durchgeführten Messungen (in Prozent)
 3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
3. Ergebnisse 3.1 Kennwerte, Boxplot Die Kennwerte der deskriptiven Statistik sind in der Tabelle 1 für alle Messungen, in der Tabelle 2 für die Messungen, bei denen mit der Referenzmethode eine festgestellt
5. Statistische Auswertung
 5. Statistische Auswertung 5.1 Varianzanalyse Die Daten der vorliegenden Versuchsreihe zeigen eine links steile, rechts schiefe Verteilung. Es wird untersucht, ob sich die Meßdaten durch Transformation
5. Statistische Auswertung 5.1 Varianzanalyse Die Daten der vorliegenden Versuchsreihe zeigen eine links steile, rechts schiefe Verteilung. Es wird untersucht, ob sich die Meßdaten durch Transformation
Perioperative Volumentherapie: Less is more?
 Arbeitskreis für klinische Ernährung Herbsttagung 2008 Perioperative Volumentherapie: Less is more? Dr. med. Aarne Feldheiser Universitätsklinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin
Arbeitskreis für klinische Ernährung Herbsttagung 2008 Perioperative Volumentherapie: Less is more? Dr. med. Aarne Feldheiser Universitätsklinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin
Hämodynamisches Monitoring das PiCCO-System
 Hämodynamisches Monitoring das PiCCO-System Bremen, 18. Februar 2009 Tilmann Schwab Kardiologie / Intensivmedizin The degree of monitoring and diagnostic procedure must be balanced between invasivness
Hämodynamisches Monitoring das PiCCO-System Bremen, 18. Februar 2009 Tilmann Schwab Kardiologie / Intensivmedizin The degree of monitoring and diagnostic procedure must be balanced between invasivness
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Klinik für Anaesthesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie Klinikum Bogenhausen, Städtisches Klinikum München GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Klinik für Anaesthesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie Klinikum Bogenhausen, Städtisches Klinikum München GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen
4.1 Klinische Wertigkeit des neuen LiDCO-Verfahrens
 Seite 52 4.1 Klinische Wertigkeit des neuen LiDCO-Verfahrens Die Lithiumdilutionsmethode zur Bestimmung des HZV nutzt den etablierten und akzeptierten methodischen Ansatz der Indikatordilution zur Bestimmung
Seite 52 4.1 Klinische Wertigkeit des neuen LiDCO-Verfahrens Die Lithiumdilutionsmethode zur Bestimmung des HZV nutzt den etablierten und akzeptierten methodischen Ansatz der Indikatordilution zur Bestimmung
Pressemitteilung: Abdruck frei nur mit Quellenhinweis Pressetext DGK 04/2016
 Assoziation von subklinischer Lungenfunktionseinschränkung mit echokardiographisch und laborchemisch detektierter linksventrikulärer Dysfunktion: Ergebnisse der Populations-basierten Gutenberg Gesundheitsstudie
Assoziation von subklinischer Lungenfunktionseinschränkung mit echokardiographisch und laborchemisch detektierter linksventrikulärer Dysfunktion: Ergebnisse der Populations-basierten Gutenberg Gesundheitsstudie
vorgelegt von Nils Christian Kronas aus Hamburg
 Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (Direktor: Prof. Dr. med. B. Zwissler) in Kooperation mit dem Walter-Brendel-Zentrum für Experimentelle Medizin (Vorstand:
Aus der Klinik für Anästhesiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (Direktor: Prof. Dr. med. B. Zwissler) in Kooperation mit dem Walter-Brendel-Zentrum für Experimentelle Medizin (Vorstand:
Herzkreislauf/Atmung 2) Blutdruckregulation in Ruhe und bei körperlicher Aktivität. Kurzpräsentationen. Entstehung Bedeutung Messung Normalwerte
 Herzkreislauf/Atmung ) Blutdruckregulation in Ruhe und bei körperlicher Aktivität Kurzpräsentationen Orthostase-Reaktion: Definition, Tests? Name: Frau Kaltner Borg-Skala: Vorstellung, Hintergrund? Name:
Herzkreislauf/Atmung ) Blutdruckregulation in Ruhe und bei körperlicher Aktivität Kurzpräsentationen Orthostase-Reaktion: Definition, Tests? Name: Frau Kaltner Borg-Skala: Vorstellung, Hintergrund? Name:
LVLD Gruppe 1 (alle Patienten) 8,8 8,6. Abbildung: 30: Zeitlicher Verlauf des LVLD (Median + Perzentile 25/75) bei allen Patienten (Gruppe 1)
 Linksventrikuläre enddiastolische lange Achse (LVLD) Die enddiastolisch von der Herzbasis bis zur Herzspitze gemessene Länge des linken Ventrikels wies im Zeitverlauf keine statistisch signifikante Veränderung
Linksventrikuläre enddiastolische lange Achse (LVLD) Die enddiastolisch von der Herzbasis bis zur Herzspitze gemessene Länge des linken Ventrikels wies im Zeitverlauf keine statistisch signifikante Veränderung
Hämodynamisches Monitoring
 Hämodynamisches Monitoring Die Messung des Herzzeitvolumens als Maß für die globale Perfusion und die Herzarbeit stellt eine wichtige Größe zur differenzierten Therapieentscheidung und überwachung dar.
Hämodynamisches Monitoring Die Messung des Herzzeitvolumens als Maß für die globale Perfusion und die Herzarbeit stellt eine wichtige Größe zur differenzierten Therapieentscheidung und überwachung dar.
3.1 Hämodynamische Parameter (Fahrradergometrie während
 3 Ergebnisse 3.1 Hämodynamische Parameter (Fahrradergometrie während RNV) Die während der Fahrradergometrie maximal erreichte Wattzahl ist in Tabelle 3.1 für alle Patienten zusammengefasst. Bei einem Patienten
3 Ergebnisse 3.1 Hämodynamische Parameter (Fahrradergometrie während RNV) Die während der Fahrradergometrie maximal erreichte Wattzahl ist in Tabelle 3.1 für alle Patienten zusammengefasst. Bei einem Patienten
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor medicinae (Dr. med.)
 Das niedrig - invasive kontinuierliche Monitoring des Herzzeitvolumens mit der arteriellen Pulskonturanalyse bei kritisch kranken Patienten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor medicinae
Das niedrig - invasive kontinuierliche Monitoring des Herzzeitvolumens mit der arteriellen Pulskonturanalyse bei kritisch kranken Patienten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor medicinae
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
 5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
Auswertung und Lösung
 Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
Dieses Quiz soll Ihnen helfen, Kapitel 4.7 und 4.8 besser zu verstehen. Auswertung und Lösung Abgaben: 71 / 265 Maximal erreichte Punktzahl: 8 Minimal erreichte Punktzahl: 0 Durchschnitt: 5.65 Frage 1
Intensivmedizin: Hämodynamik
 Intensivmedizin: Hämodynamik Weiterbildungskurs für Innere Medizin 2017 Prof. Dr. Wolfgang Huber II. Medizinische Klinik Intensivstation 2/11 Klinikum Rechts der Isar Die 4 hämodynamischen Zielgrößen Vorlast
Intensivmedizin: Hämodynamik Weiterbildungskurs für Innere Medizin 2017 Prof. Dr. Wolfgang Huber II. Medizinische Klinik Intensivstation 2/11 Klinikum Rechts der Isar Die 4 hämodynamischen Zielgrößen Vorlast
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN
 NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
NICHTINVASIVE MESSUNG DES DES PERIPHEREN SAUERSTOFFVERBRAUCHS PÄDIATRISCHER PATIENTEN NACH HERZ-CHIRURGISCHEN EINGRIFFEN J. Gehrmann, Th. Brune, D. Kececioglu*, G. Jorch, J. Vogt* Zentrum für Kinderheilkunde,
Verfasser: Prof. A. Hagendorff
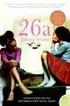 Förderung durch die DEGUM Bericht über die Studie: Analyse der Schlaganfall-Gefährdung bei Patienten mit Indikationsstellung zur transösophagealen Echokardiographie anhand der Vorhofohr- Flussgeschwindigkeiten
Förderung durch die DEGUM Bericht über die Studie: Analyse der Schlaganfall-Gefährdung bei Patienten mit Indikationsstellung zur transösophagealen Echokardiographie anhand der Vorhofohr- Flussgeschwindigkeiten
Kursus für Klinische Hämotherapie
 Kursus für Klinische Hämotherapie 27. September 2011, Hannover Kritische Indikation zur Transfusion von Erythrozyten bei massivem Blutverlust Prof. Dr. O. Habler Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin
Kursus für Klinische Hämotherapie 27. September 2011, Hannover Kritische Indikation zur Transfusion von Erythrozyten bei massivem Blutverlust Prof. Dr. O. Habler Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin
QSB Notfallmedizin - 3. Klinisches Jahr 2006/2007, mittwochs Uhr / HS Chirurgie. Das Akute Abdomen
 Das Akute Abdomen - Chirurgie - Gynäkologie und Geburtshilfe - Anästhesiologie Messungen zur Einschätzung des Schweregrades des Schockes: Herzfrequenz Arterieller Druck Zentraler Venendruck Pulmonaler
Das Akute Abdomen - Chirurgie - Gynäkologie und Geburtshilfe - Anästhesiologie Messungen zur Einschätzung des Schweregrades des Schockes: Herzfrequenz Arterieller Druck Zentraler Venendruck Pulmonaler
2.6 Herz-Kreislauf Computersimulation
 2.6 Herz-Kreislauf Computersimulation KURSRAUM 23G22 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG... 4 1.1. ALLGEMEINES... 4 1.2. SPEZIFISCHE LERNZIELE:... 4 1.3. PHYSIOLOGISCHE RICHTWERTE:... 5 1.4. GLOSSAR... 5
2.6 Herz-Kreislauf Computersimulation KURSRAUM 23G22 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG... 4 1.1. ALLGEMEINES... 4 1.2. SPEZIFISCHE LERNZIELE:... 4 1.3. PHYSIOLOGISCHE RICHTWERTE:... 5 1.4. GLOSSAR... 5
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Aus der Universitätsklinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. W. Otto) Nachweis einer Wiederaufweitung des Spinalkanales
Pathophysiologische Untersuchungen während der Etappenlavage bei Patienten mit sekundärer Peritonitis. Dissertation
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefässchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle) Pathophysiologische Untersuchungen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefässchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle) Pathophysiologische Untersuchungen
Technische Universität München
 Technische Universität München Fakultät für Medizin Klinik für Anaesthesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie Klinikum Bogenhausen, Städtisches Klinikum München GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus
Technische Universität München Fakultät für Medizin Klinik für Anaesthesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie Klinikum Bogenhausen, Städtisches Klinikum München GmbH Akademisches Lehrkrankenhaus
Echokardiographie: Das Flaggschiff der Bildgebung in der Herzinsuffizienz
 Echokardiographie: Das Flaggschiff der Bildgebung in der Herzinsuffizienz Caroline Morbach Academic Core Lab Ultrasound-based Cardiovascular Imaging Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz und Medizinische
Echokardiographie: Das Flaggschiff der Bildgebung in der Herzinsuffizienz Caroline Morbach Academic Core Lab Ultrasound-based Cardiovascular Imaging Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz und Medizinische
EKG und periphere Zirkulation - Hintergrund
 EKG und periphere Zirkulation - Hintergrund Das Herz ist eine Doppelpumpe, die Blut durch den Körper und die Lunge pumpt. Das Blut tritt mit einem niedrigen Druck in die Vorhofkammern des Herzens ein und
EKG und periphere Zirkulation - Hintergrund Das Herz ist eine Doppelpumpe, die Blut durch den Körper und die Lunge pumpt. Das Blut tritt mit einem niedrigen Druck in die Vorhofkammern des Herzens ein und
Dissertation zur Erlangung des Akademischen Grades Dr. med. vorgelegt der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Diagnostische Radiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. P. Spielmann) Aus der Klinik für Diagnostische
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Diagnostische Radiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. P. Spielmann) Aus der Klinik für Diagnostische
Hämodynamisches Monitoring auf der Intensivstation: Pulmonalarterienkatheter versus PiCCO
 376 Übersicht Review article Hämodynamisches Monitoring auf der Intensivstation: Pulmonalarterienkatheter versus PiCCO Hemodynamic monitoring in the intensive care unit: pulmonary artery catheter versus
376 Übersicht Review article Hämodynamisches Monitoring auf der Intensivstation: Pulmonalarterienkatheter versus PiCCO Hemodynamic monitoring in the intensive care unit: pulmonary artery catheter versus
Aus der Klinik für Anästhesiologie Universtitäts-Krankenhaus Eppendorf Direktor Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Schulte am Esch
 Aus der Klinik für Anästhesiologie Universtitäts-Krankenhaus Eppendorf Direktor Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Schulte am Esch Vergleichende Untersuchung des hämodynamischen Monitorings bei OPCAB Operationen
Aus der Klinik für Anästhesiologie Universtitäts-Krankenhaus Eppendorf Direktor Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Schulte am Esch Vergleichende Untersuchung des hämodynamischen Monitorings bei OPCAB Operationen
Nosokomiale Infektionen bei neuen Verfahren in der Intensivmedizin. Teodor Bachleda Markus Plimon
 Nosokomiale Infektionen bei neuen Verfahren in der Intensivmedizin Teodor Bachleda Markus Plimon ECMO - extrakorporale Membranoxygenierung Veno-venöse ECMO (vv-ecmo) respiratorische Unterstützung (akutes
Nosokomiale Infektionen bei neuen Verfahren in der Intensivmedizin Teodor Bachleda Markus Plimon ECMO - extrakorporale Membranoxygenierung Veno-venöse ECMO (vv-ecmo) respiratorische Unterstützung (akutes
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer. 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck
 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
Kreislaufphysiologie II.
 Kreislaufphysiologie II. Lernziele: 43. Hämodynamik: funkzionälle Kategorisation der Blutgefäße. 44. Funktion der Aorta und Arterien prof. Gyula Sáry Blutgefäße: elastische, abzweigende Röhre In Hagen-Poiseuille
Kreislaufphysiologie II. Lernziele: 43. Hämodynamik: funkzionälle Kategorisation der Blutgefäße. 44. Funktion der Aorta und Arterien prof. Gyula Sáry Blutgefäße: elastische, abzweigende Röhre In Hagen-Poiseuille
