GESUNDHEITSFÖRDERNDE ARBEITSORIENTIERUNG IN DER SCHULE Genese und Perspektiven einer innovativen Aufgabenstellung
|
|
|
- Carsten Ritter
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 GESUNDHEITSFÖRDERNDE ARBEITSORIENTIERUNG IN DER SCHULE Genese und Perspektiven einer innovativen Aufgabenstellung Inaugural-Dissertation vorgelegt von Klaus Beer Gutachter: Prof. Dr. Rainer Müller Prof. Dr. Dietrich Milles Bremen 2008 Prüfungsdatum:
2 Die Reform der Schule geht vom Prinzip der Entwicklung und der schaffenden Tätigkeit aus. (Adolph Diesterweg, 1835) Nach meiner Ansicht giebt es keine noch so schwere Verantwortlichkeit, die derjenigen eines Mannes verglichen werden könnte, der in unseren bedeutungsvollen Zeiten sich amtlich berufen lässt, die Schulangelegenheiten eines deutschen Landes zu leiten, und der sich mit heitrer Stirn und kühlem Herzen begnügt, die Dinge gehen zu lassen, wie sie gehen. (Alois Geigel, 1875) Das Kapital ist [ ] rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird: ( Karl Marx, 1867) Vom ethischen Standpunkt aus betrachtet liegt die tragische Schwäche der jetzigen Schule darin, dass sie sich bemüht, zukünftige Mitglieder des Gemeinwesens in einer Umgebung zu erziehen, in der die Bedingungen des sozialen Geistes vollständig fehlen. (John Dewey, 1900) Lehren Der nicht versteht, muß erst das Gefühl haben, dass er verstanden wird. Der hören soll, muß erst das Gefühl haben, dass er gehört wird. (Bertolt Brecht 1932) Das Arbeiterkind steht faktisch und symbolisch für alle Kinder, die der Ausbeutung, der Unterdrückung und der Ausgrenzung unterliegen. Sollte die Situation entstehen, daß du überhaupt keine politische Handlungsmöglichkeiten und nur schmale Auswege siehst, so [ ] nimm einen Text Brechts zur Hand. Ich empfehle Dir die Keuner- Geschichten[ ]. (Oskar Negt, 1995) - 2 -
3 Inhaltsverzeichnis: Seite 0. Vorwort 4 1. Problemaufriss und Zielsetzung Arbeit und Gesundheit als pädagogische Orientierung Gesundheit und Gesundheitsförderung in pädagogischen Konzeptionen Arbeit und Erwerbsarbeit in pädagogischen Konzeptionen Arbeits- und gesundheitswissenschaftliche Konzepte in der Schule Konzeptionen in der pädagogischen Aufgabe zwischen Schule und Betrieb Ansätze in der Arbeitslehre und der beruflichen Bildung Ansätze der gesunden Schule Schule in gesellschaftlicher Wirklichkeit Arbeitserziehung und Schule in der Entwicklung Traditionen der Arbeitserziehung Frühe Konzeptionen und Pestalozzis gesellschaftliche Arbeitsamkeit Philantropische Fürsorge oder schaffende Tätigkeit in der frühen 113 Industrialisierung Sozialkritische Positionen Kontrolle und Inklusion in der preußisch- deutschen Gesellschaft Sozialreformerische Arbeitsschulen Differenzierung der Arbeitserziehung zum Anfang des 20. Jahrhunderts Arbeitsschule im Arbeiter- und Bauernstaat und der Weimarer Republik Arbeit als nationalsozialistische Erziehung Verdrängung und Wiederauferstehung der Reform Berufs- und tätigkeitsbezogene Qualifizierung nach dem 2. Weltkrieg Gesellschaftlich begründeter Arbeiterschutz in historischer Tradition Kontrolle der Arbeitsentwicklung Abweichung und Integration Unfall- und Arbeiterschutz Nützliches Arbeiten und gesundes Arbeiten Praxis der gesundheitsfördernden Arbeitsorientierung Praktische Ansätze in der Schnittstelle von Arbeitslehre und 220 Gesundheitswissenschaft 4.2 Problemlagen und Problemlösungen
4 4.3. Checkliste der gesundheitsfördernden Arbeitsorientierung Unterrichtsbeispiele Zusammenfassung Abstract Literaturverzeichnis/ Quellenverzeichnis 254 Anhang
5 0. Vorwort Gesundheit und Bildung sind in unserer Gesellschaft in eine schwere Krise geraten. Obwohl beide Bereiche zu den elementarsten Bedingungskontexten unserer Gesellschaft gezählt werden, liefern ihre dokumentierten Brüche, etwa in der Gesundheitsreformdiskussion oder der Pisa- Folgendiskussion wichtige Hinweise auf erhebliche Defizite unserer Gesellschaft insgesamt. Nach Artikel 2 des Grundgesetzes hat in der Bundesrepublik Deutschland jeder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses Recht richtet sich nicht nur gegen unmittelbare Bedrohungen, etwa durch kriminelle Handlungen. Eingeschlossen sind auch Gefährdungen der Gesundheit, die in solchen Bedingungen entstehen, für die eine gesellschaftliche Verantwortung gegeben ist. Vor allem wenn Leben und körperliche Unversehrtheit durch Personen oder Institutionen bedroht werden, die der verfassungsmäßigen Ordnung unterliegen, muss der Staat eingreifen. An diese grundgesetzliche Verpflichtung ist insbesondere die Schule gebunden, die als staatliche Einrichtung besonders aufgerufen ist, die Grundgedanken unserer Verfassung zu verfolgen. Das allgemeine Menschenrecht, das auch vom Europarat 2002 in Art. 2 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten festgehalten wird, begründet den Schutz vor willkürlichen und absichtlichen Gefährdungen. Die Frage ist, ob und inwieweit Maßnahmen der Sicherung und des Schutzes im Sinne der Förderung und der Erhaltung von Leben und Gesundheit eingeschlossen sind. Betrachtet man den Auftrag der Schule, liegt es nahe, auch Förderung und Erhaltung als Verpflichtung anzusehen. Denn in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit und Entwicklung der eigenen Fähigkeiten eingeschlossen. Ein gesundheitlicher Schutz des Schulkindes bezieht sich also auf einen fördernden Entwicklungsprozess und einen pädagogischen Auftrag. Demgegenüber sind in der Schule jene zwei Tendenzen wirksam, die in der modernen gesellschaftlichen Entwicklung auszumachen sind und in denen die grundgesetzliche Verpflichtung aufweicht: die Individualisierung der Verantwortung und die Normalisierung des Risikos. Mit diesen beiden Tendenzen treten die Aspekte der Förderung und Erhaltung der Gesundheit, der Entwicklung und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen in den Hintergrund. Als Individualisierung der Verantwortung sind hier Vorgänge zu verstehen, in denen sozialstaatliche Probleme und Fragen von der staatlichen Ebene auf eine individuelle Ebene verschoben bzw. verdrängt werden. Der einzelne Bürger wird somit in seiner doppelten Rolle als Subjekt und als Teil der Gesellschaft ausgenutzt. So wird unter Verweis auf subjektive Verantwortlichkeit und unter dem Deckmantel der Bürgerbeteiligung alles das hervorgehoben, was die strukturelle Verantwortung von Staat und Gesellschaft entlastet, während alles das betont wird, was dem einzelnen Bürger übertragen werden kann. Diese Individualisierung als vermehrte Aufgabe kollektiver Verantwortung sehen wir aktuell bei der Begleichung und Verhinderung der Kosten im Gemeinwesen: - 5 -
6 Eigenbeteiligung in der Sozialversicherung, Betonung des Gesundheitsverhalten, Zurückstellung verhältnispräventiver Maßnahmen usw. Als Normalisierung des Risikos verstehe ich hier Vorgänge, in denen gesellschaftlich zu verantwortende Missstände als Implikationen der notwendigen Naturbeherrschung gefasst und der gesellschaftlichen Gewöhnung überantwortet werden. In langer Tradition vergesellschafteter Risiken werden immer größere Ausmaße möglicher gesundheitlicher Risiken als normal hingestellt: Bestandteile des Trinkwassers, toxisch wirkende Einträge in die Atemluft, Wohngifte, Verunreinigungen im Tierfutter, Restgifte im Essen, Pflanzenschutzmittel, UV-Strahlungen usw. Die aktuelle gesellschaftliche Bewertung dieser Vorgänge als Entsolidarisierung bewirkt nicht nur eine De- Skandalisierung oder besser Dethematisierung 1 solcher Missstände, sondern verhindert auch eine notwendige Politisierung, eine kritische und praxisverändernde Auseinandersetzung über den Umgang mit diesen Risiken und Missständen. Beide Tendenzen wirken zusammen und ergänzen sich dyssynergetisch. In jedem Fall werden die gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen, die Aufgaben der Gesundheitsförderung und damit auch die Bildungsaufgaben hintan gestellt. So werden einerseits alle möglichen Risiken auf eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortlichkeit abgeschoben, von dort allerdings wieder als individuelle Problemlage an die betroffenen Bürger zurückdelegiert. Die Ausbildung notwendiger Bewältigungskompetenzen wird damit jedoch ebenfalls auf eine tendenziell individuelle Angelegenheit reduziert. Es ist davon auszugehen, dass es entscheidend für den grundgesetzlichen Auftrag der Schule ist, diesen circulus vitiosus zu erkennen und zu durchbrechen. Wie verankern wir öffentliche (nicht individuelle) Gesundheitsförderung und gesundheitspolitische Bildungsaufgaben im Alltag der Schulen? 2 Aus der in Artikel 7 GG festgehaltenen Aufsicht des Staates ergibt sich zwingend, die Bildungsaufgaben gesamtgesellschaftlich festzulegen. Für die schulische Praxis ist hierbei wichtig, den jungen heranwachsenden Staatsbürger umfassend entscheidungs- und handlungsfähig zu machen. Ein solcher neu zu findender Erziehungs- und Bildungskonsens muss sich einerseits 1 Dieser Begriff wurde von Rainer Müller und Dietrich Milles in den 1980er Jahren eingeführt (Müller 1985; Milles, Müller 1987). 2 Sinnfällig ist dieses hier in folgendem Gedicht von Bertolt Brecht als beständige Aufgabe gefasst: Glückliche Begegnung An den Junitagen im Junggehölz Hören die Himbeersucher vom Dorfe Lernende Frauen und Mädchen der Fachschule Aus ihren Lehrbüchern laut Sätze lesen Über Dialektik und Kinderpflege. Von den Lehrbüchern aufblickend Sehen die Schülerinnen die Dörfler Von den Sträuchern die Beeren lesen
7 in dem besonderen Raum der Institution Schule curricular etablieren und sich andererseits auf die gesellschaftliche Wirklichkeit insgesamt einlassen. Dies gelingt, so wird hier angenommen, in der Sache durch den breiten Einbezug gesellschaftlicher Arbeitsvorgänge, durch den Blick auf den Produktionsbezug, und in der Didaktik durch die enge Verbindung zwischen Unterricht und Produktion. Hierfür gibt es einen traditionellen Ansatzpunkt in der Berufsvorbereitung, die in allen Schulformen vorgesehen ist. Und hierfür gibt es vielfältige historische Vorbilder und Erfahrungen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts ist mit der Realbildung auch eine Arbeitsorientierung in die Schulen gelangt. Der Münchener Oberschulrat Georg Kerschensteiner formulierte: Eine öffentliche Schule, die auf geistige wie manuelle Berufe vorzubereiten hat, ist daher schlecht organisiert, wenn sie keine Einrichtung hat, die praktischen Neigungen und Fähigkeiten des Zöglings zu entwickeln. 3 Diese zentrale Idee der Arbeitsschule, wie sie insbesondere von John Dewey um die Wende zum 20. Jahrhundert ausgearbeitet wurde, ist leider in den vielen historischen und politischen Wirren und Sackgassen unserer neueren Bildungslandschaft weitgehend verloren gegangen. Es ist ein zentrales Anliegen vorliegender Arbeit, diese Idee wieder zu thematisieren. Schule soll sich den komplexen Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens öffnen und Elemente gemeinsamer produktiver Arbeit entfalten. In der langen Geschichte der Arbeitslehre ist heute hieraus vor allem die Aufgabe geblieben, die Schülerinnen und Schüler [...] auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten (KMK 8./ ). Diese Aufgabe steht nun, auch in der europäischen Dimension, wieder vor der Frage, wer die Anforderungen der Arbeitswelt und damit eigentlich die schulischen Aufgaben definiert. Die vorliegende Schrift versucht, die häufig gegebenen einfachen Antworten zu problematisieren oder zu hinterfragen. Einfache Antworten beziehen sich auf die Praktika, die zur Berufsvorbereitung dienen sollen und die vor allem erste Eindrücke einer an sich fremden Welt vermitteln. Einfache Antworten beziehen sich auch auf die Anforderungsprofile derjenigen Betriebe und Branchen, die berufliche Ausbildung betreiben und überhaupt den Weg von der Schule in die Erwerbstätigkeit (school to work transition) markieren. Einfach sind die Antworten auch dann, wenn die produktive Tätigkeit auf die Erledigung von Arbeitsaufträgen reduziert und ein weiterer, komplexerer Begriff von Arbeit in der Gesellschaft ausgeblendet wird. Zwei Aspekte komplexer Arbeitsorientierung werden demgegenüber im Folgenden heraus gestellt. Damit soll zugleich ein sinnvoller Anknüpfungspunkt an die Tradition der Arbeitsschule vorgeschlagen werden. Zum einen soll u.a., der Tradition John Deweys folgend, die schulische Arbeit selbst als produktive Arbeit begriffen und die Schule selbst zu einem naturgemäßen Teil des Gesamtlebens" (Dewey) gemacht werden. Zum anderen soll die Kategorie 3 Kerschensteiner, G.: Begriff der Arbeitsschule. München, 1912 (1969), S.19f Tillmann, K.J.: Sozialisationstheorien. Eine Einführung in den Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und Subjektwerdung. Reinbek, 281 S., 1. Auflage 1989, 13. Auflage 2003, S
8 Gesundheit als zentrale und übergeordnete Wertigkeit unter einem pädagogischen Verwertungsinteresse thematisiert werden, damit die jeweiligen Interessengegensätze oder gar Spaltungen im gesellschaftlichen Bezug überwunden werden bzw. nicht blockierend wirken können. Dieses Anliegen wird durch aktuelle Entwicklungen in der schulischen Wirklichkeit, d.h. im unterrichtlichen Alltag, den bildungsadministrativen Vorgaben, aber auch in der pädagogischen Fachdiskussion angeregt. Insbesondere die PISA-Studie (Program for International Student Assessment) rüttelte 2001 die eingeschlafene Bildungs-Diskussion auf 4. Die Studie stellte dem deutschen Schulwesen in vielen Bereichen ein vernichtendes Urteil aus. Mit einfacher Logik wurde nach den sog. Basiskompetenzen gefragt. Solche Basiskompetenzen, wie Lesen, wurden in der Studie auf das spätere Leben, vor allem die berufliche Ausbildung, Weiterbildung und Praxis bezogen. In der Bewertung der Lesekompetenz waren nur noch Luxemburg, Mexiko und Brasilien schlechter! Besonders schwer taten sich deutsche Schüler bei anspruchsvollen Aufgaben, die mit Reflektieren, Bewerten, Transfer und Anwenden bisherigen Wissens verbunden waren. Mit diesem schockierenden Ergebnis waren, bei aller methodischen Kritik an der Untersuchung, notwendige Reformen begründet. Die Diskussion wandte sich vor allem gegen frühzeitige Selektionsvorgänge und betonte schulspezifische Integrationsaufgaben. Allerdings führte die fachspezifische Anordnung der Studie nicht zu einer Gewichtung der Aufgaben, die über das unmittelbare Schulsystem hinausgehen und die, wie insbesondere arbeitsbezogene Bildungsaufgaben, den Anschluß zur Kompetenz in Lebens- und Arbeitswelten herstellen. Es kommt m.e. nicht von ungefähr, dass mittlerweile der Reformdruck, der mit der PISA-Studie aufkam, wieder abflacht ist. Die Orientierung auf die Arbeitswelt als Unterrichtsthemenfeld der Schule kann hoffentlich die notwendigen Reformbemühungen auch in dieser Hinsicht vorantreiben. In der schulischen Wirklichkeit sind, mit initiiert durch den gesellschaftlichen Wandel, arbeitsweltbezogene Themen verdrängt worden. Dies hat sicherlich mit enttäuschten Reformillusionen vieler Pädagogen, besonders der reformpädagogischen Lehrerjahrgänge der 70iger Jahre, zu tun. Die verfügungsmachtbestimmten Herrschaftsverhältnisse in der Arbeitswelt erwiesen sich als stabiler und die vielfältigen Versuche, gesellschaftliche Reformen über die Thematisierung der Arbeitswelt (z.b. im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt) oder Problematisierung sozialer Ungleichheit (z.b. nach dem literarischen Motto Ihr da oben, wir hier unten ) in der Schule zu initiieren, versandeten. Die Thematisierung gesellschaftlicher Disparitäten oder die beabsichtigte unterrichtliche Behandlung von Opfern des gesellschaftlichen Fortschrittes geriet aus dem bildungspolitisch-pädagogischen Blickfeld. Viele Lehrer resignierten oder gingen in eine innere Emigration, die 4 In diesem Kontext sei vorab auf den Sputnik-Schock im Oktober 1957 verwiesen, der erhebliche Anstrengungen im Bildungssektor der USA, aber dann auch in der BRD auslöste, vergleichbar, wie sie heute, allerdings nicht so ausgeprägt, in der Folge der PISA Studie unternommen werden! - 8 -
9 gesellschaftspolitische Thematisierung und Problematisierung von der Arbeitswelt aus war offenbar nicht mehr durchsetzbar. Diese breite Einschätzung bestimmt bis heute eine fatale und lähmende, dennoch nicht hinnehmbare Entwicklung 5. Auf der anderen Seite gibt es ein sehr breites und anfänglich euphorisches Bemühen, gesundheitliche Aspekte und Inhalte in die Schule zu bringen. Mit deutlichem Bezug auf die WHO-Programmatik (siehe. Kap. 3) wurde Schule als beispielhaftes setting genommen, in dem Gesundheitsförderung praktiziert werden sollte. Mittlerweile finden wir breite regionale und auch verschiedentlich unterstützte Aktivitäten. So bietet die Bertelsmann-Stiftung an, den Anschub gesundheitsfördernder Maßnahmen in der Schule durch Bündelung und Koordination der Ressourcen zu unterstütze. Das Ziel des Programms, das von August 2002 bis Dezember 2007 läuft, ist die Entwicklung zur "guten gesunden Schule", die ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfolgreich umsetzt, auf die Entwicklung von Qualität und Gesundheitsbildung Wert legt und damit einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung leistet. Der Deutsche Bildungsserver bietet einen reichen Überblick über solche Bemühungen. Diese Bemühungen gehen jedoch in einem wichtigen Kern von allgemeinen Problemlagen aus, die eine Bedeutung für Public Health haben, die aber nicht in den traditionellen und elementaren Aufgaben der Schule verankert sind. Diese Problemlagen sind vor allem Ernährung und Bewegung, die sich aufgrund der modernen Lebensstile in den Industrieländern dramatisch verschärft haben. Insofern alle wirkungsvollen Bekämpfungen dieser Probleme besonders bei Kindern und Jugendlichen ansetzen, konzentrieren sich entsprechende Bemühungen auf die Schulen. In den Schulen selbst sind jedoch genau entgegengesetzt die bekannten Möglichkeiten, namentlich im Sportunterricht und der Hauswirtschaftslehre, eingeschränkt worden. Darüber hinaus sind gerade die Möglichkeiten in der Schule sehr stark auf die Vermittlung gesundheitsförderlichen Verhaltens fokussiert. Diese beiden Beispiele zeigen, dass die besondere Verbindung von Public Health und Schule nicht aus der Schule selbst heraus entwickelt, sondern über allgemeine Public-Health-Positionen in das Setting hinein getragen wurden. Tatsächlich finden wir in der schulischen Praxis vor allem Ansätze in den Schulfächern Biologie und Sport, weil hier auch die stärkste Wirkung auf das Gesundheitsverhalten angenommen wird. Zugleich erfahren wir jedoch in dem schulischen Alltag, dass die Ansätze zur Verhaltensänderung allein nicht ausreichen, sondern dass vielmehr die räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Bedingungen der Schule und vor allem die Sozialisationsdefizite der Schüler nicht durch Verhaltensänderungen anzugehen sind. Oder anders, dass selbst zur 5 Bereits 1976 formulierten der Bremer Sozialpsychologe Wilfried Gottschalch u.a: Immer wieder wurde gefragt, wieweit von der Arbeit im Sozialisationssektor emanzipierende Wirkung ausgehen kann. Unsere Erwartungen sind in dieser Hinsicht nicht allzu groß Und weiter: Feundliche Lehrer können diesen Prozeß mildern, verändern können sie ihn nicht. Das wäre nur auf dem Wege durchgreifender politischer Aktionen möglich. In: Gottschalch, Wilfried; Neumann-Schönwetter, Marina; Soukup, Gunther: Sozialisationsforschung. Frankfurt/M. 1976, S. 9/19-9 -
10 nachhaltigen Änderung des Verhaltens auch die Berücksichtigung weiterer Wirkungszusammenhänge, vor allem auch sozialer Natur, nötig ist. Die Berücksichtigung weiterer Wirkungszusammenhänge in dem pädagogischen Auftrag der Schule ist daher das eigentliche Anliegen vorliegender Arbeit. Hierfür bietet Public Health Anregungen und Anstoß, jedoch keine Lösung. Eine weitere Anregung über die Thematisierung hinaus ist in der WHO- Programmatik zur Gesundheitsförderung verankert und zielt auf Netzwerke. Gerade die Schule, die konkret in den schwierigen Bedingungen überfordert ist, kann auf diesen Aspekt nutzbringend zurückgreifen. Die Verbindungen zu außerschulischen Institutionen herstellen, die regionale und kommunale Verankerung der Schule fördern und die Eltern einzubeziehen, das sind wichtige Impulse, die durch Ansätze der Gesundheitsförderung in die Schule gegeben werden. Verknüpfungen und Vernetzungen sorgen auch für eine nachhaltige Sicherung und Praxis gesundheitsförderlicher Maßnahmen. Schließlich werden insbesondere auch die Chancen erkannt, die in der Verbindung zwischen solchen Netzwerken und dem eigentlichen schulischen Auftrag bestehen. So soll mit Gesundheit Schule gemacht werden (Nilshorn, Schminder 2005). Diese Weiterung wird gerne als Gesundheitsmanagement bezeichnet. Diese neue Ausrichtung meint nach einem Grundlagen-Papier des Hessischen Kultusministers 2008: Schulen und Institutionen der Bildungsverwaltung befinden sich in einem Wandlungsprozess, der Veränderungen innerhalb der Organisationen, der Ziele und Schwerpunkte, der Strukturen und Arbeitsprozesse und damit der Aufgaben und Rollen für handelnde Personen bedingt. Damit diese Prozesse steuerbar und für alle Beteiligten gestaltbar werden, sind neue Steuerungskonzepte und -instrumente nötig, um hierbei auch die Gesundheit der Betroffenen nicht zu gefährden. Arbeitsbedingte Erkrankungen und Krisen, Mobbing, innere Kündigung, Fehlzeiten oder Frühpensionierungen aufgrund krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit können sensible Indikatoren für eine misslingende Steuerung sein und Leistungsbereitschaft, Wohlbefinden, konstruktive Konfliktfähigkeit oder aktive Krisenbewältigung können Anzeichen sein, die auf ein erfolgreiches Management hinweisen. Gesundheit ist jedoch nicht nur ein Indikator, sondern auch eine Ressource, die als Bedingung und Potenzial für Entwicklung, für Lern- und Leistungsfähigkeit und damit auch für eine gelingende Bewältigung von Veränderungen wirkt und mit der deshalb gut und verantwortungsvoll umgegangen werden muss. Gesundheitsförderung braucht ein Management, damit Gesundheitsförderung zum integralen Bestandteil der Bildungsorganisationen wird, und Organisationen brauchen Gesundheitsförderung, damit diese sich für und mit den Betroffenen gesundheitsverträglich entwickeln und managen lassen. Gesundheitsförderung erfordert deshalb ein eigenes (Gesundheits-) Management, damit Gesundheit zum Gegenstand der Voraussetzungen, Strukturen, Prozesse und Ergebnisse von Bildungsorganisationen wird. Gesundheitsmanagement nutzt Erkenntnisse der Gesundheitswissenschaft, der Arbeitsmedizin/-psychologie, der Kindheits- und
11 Jugendforschung sowie der Organisationssoziologie, um die Gesundheit sowie die Lern- und Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bildungsverwaltung zu fördern und zu erhalten. Gesundheitsförderung mit ihren Impulsen Vernetzung und Management kann die Bedingungen der Schule breit und vielschichtig wahrnehmen. Allerdings sind diese Chancen noch sehr eingeschränkt aufgegriffen worden. Es geht in den entsprechenden Projekten und Maßnahmen nach wie vor in erster Linie um die Verbindung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst nebst entsprechenden Möglichkeiten der Suchtberatung o.ä.. Vor allem geht es inhaltlich vor allem um Ernährung als Unterrichtsthema oder um Pausenbrot als Maßnahme. Der bislang wenig entwickelte inhaltliche Bezug zu Institutionen und Partnern außerhalb der Schule und die damit verbundenen Möglichkeiten der Vernetzung können durch die Arbeitsorientierung entscheidend voran gebracht werden. Denn dabei geht es eben nicht mehr nur um gesundheitswissenschaftliche Inhalte, die in die Schule mit der Absicht der Vermittlung getragen werden, bzw. um gesundheitlich ausgewiesene Angebote, sondern auch um Wechselwirkungen zwischen schulischem Arbeitsalltag, Lernzielen und pädagogischem Auftrag der Schule insgesamt. Einbezogen werden können auch Belastungen von Schülern und Lehrern. Die nachfolgenden Argumente dienen daher auch dazu, dem vielfach kritisierten Leistungsstand der deutschen Bildung neue Impulse zu verleihen. Denn der Bezug auf Arbeit und Gesundheit ermöglicht, die humanistischen und die neuen realen Bildungsziele nicht als Gegensatz zu konzipieren. So können sowohl die persönliche Fähigkeit, die Entwicklung eigener Fertigkeiten und Erfahrungen, aber auch der Selbstwert auf der einen Seite sowie die instrumentelle Fähigkeit, die Wissensbestandteile oder auch Aufgabenerfüllung in der Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt werden. Arbeit und Gesundheit können für die Allgemeinbildung wieder genutzt und als positive Steuerungselemente der Bildung neu entdeckt werden. Sie stecken eben in den wichtigen Lebens- Arbeits-, und Lernprozessen und verbinden sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Entwicklungen, Erfahrungen, Analysen und Perspektiven. Doch sie sind so nicht an den Bildungsapparat mit der Bitte um Vermittlung und Verbreitung heranzutragen (z.b. entlang der Aufforderung Gesundheit auf den Stundenplan ), sondern tatsächlich nur in dem höchst eigenen Geschäft aller Betroffenen herzustellen und zu verankern. Arbeit und Gesundheit ist zunächst auch eine Angelegenheit der Institution Schule, nicht des Unterrichtsstoffes oder der Unterrichtsverpflichtung allein. 6 Gleichwohl ist es selbstverständlich wichtig, die Lehrinhalte in den Fachunterricht einzubauen. Daher konkretisiert sich die eigentliche Aufgabenstellung darin, im jeweiligen Fachunterricht die Verbindungen zwischen dem Lernort Schule und den anschließenden beruflichen Anforderungen herzustellen. Es gibt traditionelle 6 vgl. dazu: Bremer Lehrer Zeitung - BLZ, Themenschwerpunkt Gesundheit, Ausgabe 6, Bremen
12 Unterrichtsfächer, in denen gesundheitsrelevante Inhalte eine Rolle spielten und spielen. Hierzu gehört in erster Linie der Biologie- und dann, oft eher selbstverständlich und nicht weiter betont, der Sportunterricht. Meines Erachtens jedoch ist besonders das Lernfeld Arbeitslehre gefordert, den Komplex Arbeit und Gesundheit aufzugreifen und hier solche Inhalte querthemenorientiert aufzubereiten, in denen die produktive Schule und die Qualifizierungsangebote der Arbeitswelt begriffen und im Lernprozess angeeignet werden können. Daher folgt die Argumentation hier nicht den gängigen Bemühungen um eine gesunde Schule im Sinne der WHO-Programmatik, sondern den historischen Strängen der Arbeitsschule und der Arbeitslehre. Das Anliegen der vorliegenden Arbeit folgt aber nicht nur zentralen Aufgabenstellungen schulischer Bildung, sondern zugleich biografischen Schwerpunkten meiner bisherigen Auseinandersetzung mit der Dialektik von Arbeit und Bildung. Dies scheint mir, im Rückblick wie in der systematischen Gewichtung, zugleich ein wichtiger erwerbsbiographischer Folgepunkt: Arbeit und Gesundheit sind pädagogisch umfassend vermutlich nur wirklichkeitsbezogen und erfahrungsbasiert zu vermitteln! Mit den vorgestellten inhaltlichen Bezugspunkten verbindet sich ein langjähriger eigener Erfahrungshintergrund, der in die nachfolgende Argumentation eingeht. In meiner persönlichen Entwicklung nahmen gegen Ende der Schulzeit und mit Beginn der Berufsausbildung die politisch motivierten Fragestellungen und Auseinandersetzungen, auch mit literarischen Vorlagen, zu. Beispielhaft hierfür möchte ich die Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht hervorheben, weil Brecht für mindestens eine ganze Schülergeneration einen Mittelpunkt gesellschaftspolitischer Bildungsaufgaben darstellte. Brecht hat erst relativ spät und hauptsächlich über eine politische Argumentationslinie die Arbeitswelt in den Blick genommen. Beispiel hierfür ist etwa das Gedicht Kohlen für Mike (1926), das solidarisches Verhalten von Bremsern auf Dampfloks lobt, die Kohlen in den Garten der Witwe eines verstorbenen Eisenbahners warfen. Selbst in dem Stück Mutter Courage (1939) wird die Hauptfigur von der Auseinandersetzung mit Armut und Herrschaft her gezeichnet: die Verhältnisse, die nicht so sind, sind durch zweifelhaften Krieg und zweifelhafte Überlebensstrategien gekennzeichnet, nicht aber durch den eigentlich ideologisch behaupteten Aufbau einer neuen Gesellschaft aus den Fähigkeiten der arbeitenden Menschen. Selbst in der Auseinandersetzung mit dem Zweck der Produktion blieb Brecht, wie hier nachfolgend in der Kriegsfibel, unklar; unter Bilder von Arbeitern in einem Eisenwerk schrieb er: Was macht ihr Brüder? Einen Eisenwagen. Und was aus diesen Platten dicht daneben? Geschosse, die durch Eisenwände schlagen. 7 Eine erste poltisch- literarische Begegnung mit der Lage der lernenden Schüler bildete: Liebel, Manfred; Wellendorf, Franz: Schülerselbstbefreiung.- Frankfurt am Main
13 Und warum all das, Brüder? Um zu leben. 8 In dieser Logik, die irritieren und auf die Widersprüchlichkeit der Lebensbedingungen aufmerksam machen will, stehen die Notlagen und die Schwierigkeiten des arbeitenden Menschen unter Bedingungen, die sie nicht verantworten, im Mittelpunkt. Aber es gibt noch keinen Hinweis auf eine positive Lösung. Dies resultiert aus dem Umstand, so meine Hypothese, dass Brecht seine positive gestaltende Wertorientierung nur aus politischer Ideologie ableitete. Möglich wäre aber auch eine Orientierung an Gesundheit. Die Orientierung an Gesundheit schließt auch eine politische Gestaltungsdimension ein, aber diese wäre eben nicht aus einer historischen Gesetzmäßigkeit oder aus einer vorgestellten idealen Gesellschaftsordnung abgeleitet. Eine Orientierung an Gesundheit kann sich doch auf lebendige Wirkungszusammenhänge und lebendige Kräfte beziehen. Eine solche Orientierung auf Gesundheit fehlt im Werk Bertolt Brechts fast vollständig. Das gesellschaftspolitische Engagement und die ideologische Dimension könnten durch einen Bezug auf Gesundheit und Arbeit vereinheitlicht und angereichert werden. Denn auch der Bezug zur Arbeitswelt bleibt bei Brecht durchgängig marginal. Eigentlich bekannt und zentral im Werk von Bertolt Brecht ist lediglich das Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters (1935) aus den Svendborger Gedichten. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute. [ ] Hier gibt es zwar einen unmittelbaren Bezug auf arbeitende Menschen. Doch der eigentliche Zweck des Gedichts liegt in der irritierenden Nachfrage, was denn Herrschaft legitimiert und wer in welcher Weise profitiert. Es ist im Grunde nach wie vor ein klarer Bezug auf die gesellschaftliche Distribution, auf die ungerechte Verteilung der Güter, bzw. auf den Umstand, dass aus dem Besitz der Güter keine eigentlichen politischen Ansprüche abzuleiten sind. Wie aus dem Aufbau Thebens oder dem Herbeischleppen der Felsbrocken eine andere Gesellschaft aufzubauen wäre, bleibt verborgen. Das Interessante an Brecht war mir seinerzeit die konsequente Politisierung in seiner Auseinandersetzung. Brecht nahm die gesellschaftliche Wirklichkeit als gestaltete und zu gestaltende und er wollte diese Gestaltung von unten her organisiert wissen. Daher stellte er Themen sozialer Ungerechtigkeit in den Mittelpunkt. Allerdings berief er sich hierbei zwar auf marxistische Theorie und Arbeiterbewegung, sein tatsächlicher und thematischer Bezug zur Arbeitswelt war jedoch, obwohl klar, eher spärlich. 8 Das als dialektisches Stück in die Widersprüchlichkeit der Arbeiterrealität hineinweisende Gedicht zeigt die Mühen auf, denen sich derjenige unterwerfen muss, der die Welt verstehen und verändern will!
14 Was jedoch in meiner Auseinandersetzung mit Brecht enthalten war, weitgehend ohne dies bewusst zu reflektieren, bezog sich auf die Arbeitsmethode Brechts: Bertolt Brecht verstand sein literarisches Schaffen und sein Theater selbst als Arbeit und er bezog die Reflexion über das Produzieren von Gedicht, Prosa und Stück in sein inhaltliches Anliegen ein. Aussage und Arbeit waren nicht getrennt. War sein politisches Anliegen in der Tat verbunden mit seiner Arbeitsweise? Immer wieder wurde, insbesondere aus der Bundesrepublik, von Literaturkritikern angemerkt, die politische Position wäre dem Literaten im Grunde aufgesetzt. Die 1954 formulierten Thesen zum Sozialistischen Realismus auf dem Theater sprechen eine andere Sprache: Ein Großteil des Vergnügens, die jede Kunst zu verschaffen hat, ist beim sozialistischen Realismus das Vergnügen an der Meisterungsmöglichkeit des menschlichen Schicksals durch die Gesellschaft. 9 In diesem Sinne gibt er der literarischen Arbeit einen produktiven Sinn. So gibt es bei Brecht zwar eher dogmatische Auseinandersetzungen mit Arbeitswelt und Arbeitern, aber doch eine prinzipielle Orientierung auf produktive Bewältigung: Das sozialistische Kunstwerk geht von den Gesichtspunkten der proletarischen Klasse aus und wendet sich an alle Menschen guten Willens. Es zeigt ihnen das Weltbild und die Absichten der proletarischen Klasse, welche sich anschickt, die Produktivität der Menschen durch eine neue Gestaltung der Gesellschaft ohne Ausbeutung in bisher unerhörter Ausdehnung zu steigern. 10 Diese Orientierung ist bei Bertolt Brecht im Grunde nur auf die eigene Schaffenskraft angewandt durchdacht worden. Dies macht sein Werk schließlich viel wichtiger als die vordergründigen Bekenntnisse zu einer sozialistische Gesellschaft oder proletarischen Klasse. In gewisser Weise hat mich die besondere Fragestellung, wie Arbeitsweise und Produktivität positiv auf gesellschaftliche Reformvorgänge wirken können, während meiner intellektuellen Entwicklung nicht losgelassen. Persönlich-biographische Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit dem Thema ergaben sich für mich bereits als Schüler anlässlich von Schuluntersuchungen, deren gestaltende Bedeutung mir nicht erklärlich waren. Als Auszubildender beschäftigte mich das Formblatt zur Berufseignungsuntersuchung des Hausarztes, und auch hier drängte sich mir die Frage auf, welche Zielrichtung dieses Formblatt praktisch verfolgt. Als Student erfuhr ich das Durchleuchtungsinteresse des Staates an seinen zukünftigen Beschäftigten und damit eine deutliche Kehrseite der Politisierung. Unmittelbaren Eindruck auf mich hinterließen Unfälle von Mitschülern in der Schule, vor allem Stürze, ein Sportunfall und ein Armbruch während eines Landheimaufenthaltes. Die besondere Bedeutung des Unfalls als zugespitztes Ereignis, das direkt und intensiv die Frage nach Schuld und Verschulden 9 Brecht, Bertolt: Sozialistischer Realismus auf dem Theater (1954).- In: Ges. Werke 26, Frankfurt a.m. 1967, S ebd
15 aufwirft, erkannte ich auch in Verkehrsunfällen auf dem Schulweg, so in einem Autounfall, einem schweren Unfall eines Schulfreundes mit der Straßenbahn sowie einem Unfall mit einem Lkw. Mir leuchtete ein, dass diese Frage nach Schuld und Verschulden nicht einfach nur auf menschliches Fehlverhalten zurückgeführt werden konnte. Gesundheitsprobleme begleiteten mich auch während der Lehrzeit im Baugewerbe. Zu einem Wegeunfall mit dem Motorrad, einem Sturz in eine Baugrube und häufigen Schnittverletzungen am Moniereisen (Spitzname: der Mohikaner, wegen der vielen stark blutenden Hautschnitte) gesellten sich Verblitzungen der Augen beim E- Schweißen, Verbrennungen beim Umgang mit der Sauerstofflanze, Schädelverletzungen durch herabfallende Steine, Quetschungen durch Gerüstarbeiten, Verletzungen im Hand- und Armbereich durch Arbeiten mit einem Betontransportbehälter, mehrfache Verletzungen durch hervorstehende Nägel in Brettern und Bohlen sowie Rückenbeschwerden durch erhebliche Transportarbeiten von gesacktem Zement über mehrere Stockwerke. Besonders berührt hat mich der Tod eines türkischen Kollegen beim Umtransport von Betonfertigteilen (Wandelementen). Weiter erlebte ich Quetschungen durch Arbeitsunfälle mit dem Hammer, Schnittwunden und Augenverletzung durch Arbeiten mit der Trennscheibe, Fußverletzungen durch Transport von Baustahlmatten, Sehnenscheidenentzündung durch Akkordarbeiten als Eisenflechter, bronchiale Reizhustenphasen durch Trockenverarbeitung von Faserasbestzementplatten im Turnhallenbau, Elektrounfälle bei Ausschalarbeiten und bei der Einrichtung von Baustellen sowie zwei Kran-Unfälle (Auslegerbruch, Umsturz bei Kranarbeiten am Hang). Dazu kamen Erfahrungen mit arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren: im Umgang mit Bitumenanstrich, Umgang mit Faserzementasbestrohren, Arbeiten an der Kreissäge, Arbeiten am Schalungsreinigungsgerät, Arbeiten mit Druckluftstemmgeräten, Arbeiten mit schweren Schlagbohrwerkzeugen, Arbeiten an der Betonpumpe, Arbeiten mit dem Flaschen - und Flächenrüttler, Arbeiten mit der Explosionsramme, Arbeiten mit dem Schussgerät, Konsum von Alkohol und Konsum von Tabakwaren unter Kollegen sowie die Arbeiten auf Hochgerüsten. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir auch Erfahrungen mit der gesundheitlichen Versorgung am Beispiel des Drahtunfalls eines schottischen Wanderarbeiters und die knappen Instruktionen von Leiharbeitern über Gesundheitsgefahren (Körperschutzausrüstung) am Bau. In meiner akademischen Ausbildung an der Universität standen die Abgrenzungen von Normalität und die Bestimmung bürgerlicher Souveränität am Beginn meines Erkenntnisinteresses. Am Beispiel der Psychiatrie-Kritik, wie sie vor allem in Italien im Rahmen der Antipsychiatrie-Bewegung 11 entfaltet und dann in Deutschland, v.a. Heidelberg, rezipiert wurde, setzte ich mich mit den Grundideen gesundheitlicher Versorgung auseinander. Es ging dabei nicht nur um die gesellschaftliche Ausgrenzung belasteter und belastender Personen 11 Basaglia, Franco: Die Entscheidung des Psychiaters Bilanz eines Lebenswerks.- Bonn
16 aus der Gesellschaft, sondern umgekehrt um die Frage, welche Integrationskraft und Reformfähigkeit von einer Gesellschaft erwartet werden kann. Dies war seinerzeit in erster Linie eine Frage der sozialen und politischen Gerechtigkeit. Im Zuge dieses sozialen und politischen Interesses setzte ich mich mit Traditionen der Arbeiterbewegung und darauf aufbauenden Reformprojekten auseinander. Diese Auseinandersetzung schloss auch, zunächst nicht in erster Linie, den Zusammenhang von Schule-, ( Berufs- ) Bildung und Erwerbsarbeit im Kontext dessen ein, was früher hygienische Volksbelehrung, dann auch Gewerbehygiene, Arbeitsschutz und heute betriebliche bzw. schulische Gesundheitsförderung heißt. Dieser thematische Zusammenhang wurde vor allem durch eigene, oft schmerzvolle Erfahrungen als Werkstudent auf dem Bau sowie Erfahrungen mit chronischen Verschleißprozessen als Folge von Erwerbsarbeit aus der Bauzeit (Tennisellenbogen und Sehnenscheidenentzündung als Folge der Akkordarbeit als Eisenflechter, Rückenschmerzen durch Steintransport über Gerüste u.a. Gesundheitsverschleißfragen zum zentralen Thema der Studienzeit. Besonders betroffen hat mich der arbeitsbedingte Tod eines Kommilitonen während des Studiums, der als Schiffbauer auf einer Bremer Werft tätig war und Schweißnähte zu röntgen hatte. Verstehen wollte ich auch den Herzinfarkt eines Freundes, der mit 32 Jahren als Bauingenieur und Abteilungsleiter im Hafenbauamt nicht zuletzt wegen starker Arbeitsbelastung- Stress am Arbeitsplatz- verstarb. Meines Erachtens gehören realitäre Erfahrungen zu einer kompetenten Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Arbeitsgesellschaft. Dies muss nicht eine vergleichbare Ansammlung persönlicher gesundheitsschädigender Ereignisse sein. Immer jedoch gehört die Arbeitsweltdimension, möglichst von Erwerbsarbeitspraxis, zu den Aufgabenstellungen der Gesundheitsförderung wie zu der Arbeitsorientierung. Die zentrale Frage ist, wie diese Komplexität von Erfahrungsdimensionen in die pädagogische Arbeit und schulische Bildung eingebracht werden kann
17 1. Problemaufriss und Zielsetzung Erwachsene Menschen verbringen ein Drittel des Tages in direktem oder indirektem Bezug zur Arbeit. Auch bei großer Arbeitslosigkeit, flexiblen Formen der Arbeitstätigkeiten und Arbeitsvorgängen außerhalb des Arbeitsmarktes steht die zentrale Bedeutung produktiver Arbeit für das moderne gesellschaftliche Leben außer Frage. Jegliche schulische Bildung hat dieser Bedeutung Rechnung zu tragen. Es gibt ältere Ansätze, in denen die Bedeutung der Arbeitswelt sogar in den Mittelpunkt der schulischen Bildung gestellt wurde. Solche Ansätze sind aus politischen Gründen, vor allem im Zuge der Ost-West-Spaltung nach dem Zweiten Weltkrieg, diskreditiert oder hochgehalten worden. Leider ist dabei der substanzielle Gehalt der Arbeitsorientierung immer weiter aus den pädagogischen Konzeptionen heraus gedrängt worden. Heute gibt die Gesundheitsförderung neue Impulse für ein komplexeres Verständnis und eine vielseitigere Bewertung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie für die damit geforderten Lern- und Qualifikationsprozesse. Die neueren Ansätze der Gesundheitsförderung zeigen jedoch gerade dort Schwächen, wo die gesellschaftliche Bedeutung produktiver Arbeit gefragt ist. So stehen mit großem Abstand die Grundschule im Zentrum gesundheitsbezogener Projekte (vgl. Paulus, Witteriede 2008; auch folgendes Unterkapitel), die ihrerseits kaum einen Bezug zur Arbeitswelt zeigen, sondern sich vielmehr durch die Separation der Lernbedingungen auszeichnen. Dies verweist darauf, dass die gesundheitsbezogenen Projekte vor allem auf die Vermittlung und Anwendung gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse zielen, während gerade die zentrale Bedeutung produktiver Arbeit nicht gut erschlossen ist. Es ist die zentrale Absicht vorliegender Arbeit, die Substanz der älteren Arbeitsorientierung mit den Impulsen der neueren Gesundheitsförderung zu verbinden Arbeit und Gesundheit als pädagogische Orientierung Der Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit ist keine selbstverständliche pädagogische Orientierung. Der 7. Fachtag "Gesundheit und Schule" am Landesinstitut für Schule in Bremen, der im Oktober 2000 stattfand, stellte die alltäglichen Anforderungen zu Hause und im Beruf in den Vordergrund. Dann folgen Überforderung, Stress und sogar Angst. Der Fachtag sollte in Kooperation mit dem "Opus Bremer Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen" Perspektiven im Umgang mit diesen Belastungen aufzeigen. Die in verschiedenen Arbeitsgruppen diskutierten unterschiedlichen Möglichkeiten konzentrierten auf die Förderung der eigenen (seelischen) Gesundheit und die Stärkung der Lebenskompetenz. Diese soll früh beginnen und bedarf in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Erwachsenenbildung erhöhte
18 Aufmerksamkeit. Peter Paulus (Universität Lüneburg) stellte Chancen für die seelische Gesundheit vor. Demnach sollen die betroffenen Menschen aus sich selbst heraus leben. Annelie Keil (Universität Bremen) verstand Gesundheit als Provokation und will die Kunst stärken, das Leben zu leben. Der Fachtag zeigte deutlich die Stärken und Schwächen der gesundheitsbezogenen Konzepte in der Schule. Der Betonung komplexer Zusammenhänge und entsprechender Bewältigungskompetenzen stehen verhaltensorientierte Zielsetzungen gegenüber. Gesundheit wird so in der Schule im Wesentlichen von außen thematisiert und wird den curricularen Zusammenhängen eher aufgesetzt. Praktisch taucht Gesundheit im Unterricht am Rande auf, v.a. über Hauswirtschaft-Ernährung, implizit im Sportunterricht. Eine nahe liegende Möglichkeit ergibt sich aus dem Fach oder dem Lernfeld Arbeitslehre. Hier ist in langer Diskussion und vielfältiger Bemühung der Bezug zur Arbeitswelt aufgegriffen worden. Dies geschah, wie zu zeigen sein wird, allerdings in sehr unterschiedlichen und gar kontroversen Ansätzen. Wie steht es um die Arbeitslehre heute? Der allgemeine Befund ist nicht gut. Insgesamt kann man eher von einem Zurückdrängen und Marginalisieren der Arbeitslehre sprechen auch im Widerspruch zu den Anforderungen an qualifizierte Arbeit und somit auch an entsprechende Bildung. Arbeit und Arbeitswelt wird ansonsten im Unterricht zwar in Beispielen oder Texten angesprochen, allerdings in gewisser Distanz. Dies ist sowohl positiv der traditionellen humanistischen Bildung geschuldet, die von der Ausbildung innerer Fähigkeiten ausging, als auch negativ einer linken Schulkritik, die sich gegen eine funktionale Verwertung lebendiger Arbeitskräfte verwahrte. Praktische Verbindungen konnten bislang hauptsächlich über Berufsvorbereitung und Betriebspraktika etabliert werden. Im Schuljahr bzw. im 10. Schuljahr werden in der Regel solche Inhalte und Maßnahmen angeboten, die auf den Beruf vorbereiten. Doch auch in diesen Bezügen zur Arbeitswelt ist eine weitere Schwierigkeit enthalten. Denn es dominiert eine alte Tradition, die sich hauptsächlich auf den vorhandenen Arbeitsmarkt bezieht, vor allem Sicherheit und technische Abläufe in den Mittelpunkt stellt und dabei Gesundheitsförderung nur als flankierenden Aspekt anspricht. Das Kernproblem besteht dann darin, dass Arbeit im Wesentlichen als Job verstanden wird und die Arbeitsorientierung dann der Arbeitsmarktpolitik untergeordnet wird. Wie ist also aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen? Im Folgenden soll dargelegt werden, dass wirkmächtige Traditionen nicht einfach ignoriert werden sollten, sondern mit Zielsetzungen versehen und neu definiert werden können. Diese Möglichkeit eröffnet die Verbindung von Gesundheitsförderung und Arbeitsorientierung. Wie bereits angesprochen gehen wichtige Impulse von der Gesundheitsförderung aus. Bernhard Badura, der sich immer wieder mit der Schnittstelle von Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz beschäftigte, verweist auf die gemeinsam zugrunde liegende Qualifizierung, die sich nicht nur als Aufgabe für den Einzelnen stellt, sondern auch für die jeweilige Institution und
19 Organisation. Auch unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs wird deutlich, dass Standortvorteile für Deutschland im Wesentlichen in qualifizierter Arbeit bestehen. Bildung und Lernprozesse, die den Einzelnen wie die Organisation fordern, haben in Gesundheit einen anerkannten Wertmaßstab. Badura und Mitarbeiter unterscheiden diesbezüglich zwischen pathogenen und salutogenen Merkmalen, die auf einer allgemeinen Organisationsebene, auf personaler Ebene und Verhaltensebene verortet sind. (siehe nachfolgende Übersicht). Sie nehmen Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Ebenen an, die in dem Schema nicht deutlich erfasst werden und insgesamt auch genauer zu erforschen sind
20 Übersicht 1: Merkmale einer gesunden und ungesunden Organisation Organisation Person Verhalten Pathogene Merkmale Autoritärer Führungsstil Steile Hierarchie Misstrauenskultur Intransparenz von Entscheidungen Geringe Handlungs- und Mitwirkungsspielräume Hohe Arbeitsteilung, Spezialisierung Keine / unzureichende Weiterbildungsmöglichkeit Ungesunde Organisation Pathogene Merkmale Verbreitete Hilflosigkeits- / Angstgefühle Niedriges Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Geringe Arbeitszufriedenheit Geringe Motivation Innere Kündigung Soziale Kompetenz wenig ausgeprägt und verbreitet Management-Kompetenz wenig ausgeprägt und verbreitet Schlechte körperliche Gesundheit Ungesunde Organisation Pathogene Merkmale Absentismus hoch Hohe Fluktuation Geringe Flexibilität, geringe Innovationsbereitschaft Individuelles Konkurrenzstreben Hoher Genussmittelkonsum (Rauchen etc.) Riskanter Lebensstil (Ernährung, Bewegung etc.) Ungesunde Organisation Salutogene Merkmale Partizipativer Führungsstil Flache Hierarchie Vertrauenskultur Transparenz von Entscheidungen Prozessorientierte Arbeitsorganisation Teamarbeit Weiterbildungsmöglichkeiten Institutionalisierte Gesundheitsförderung Gesunde Organisation Salutogene Merkmale Psychos. Wohlbefinden (wenig Angst / Hilflosigkeit) Hohes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Hohe Arbeitszufriedenheit Hohe Motivation Hohe Bindung an Unternehmen Soziale Kompetenz stark ausgeprägt und verbreitet Management-Kompetenz stark ausgeprägt u. verbreitet Gute körperliche Gesundheit Gesunde Organisation Salutogene Merkmale Hohe Anwesenheitsquote Niedrige Fluktuation Hohe Flexibilität, hohe Innovationsbereitschaft Gegenseitige Unterstützung Geringer Genussmittelkonsum Gesundheitsförderlicher Lebensstil (Ernährung, Bewegung etc.) Gesunde Organisation (Badura et.al. 1999, S.31) Die neue Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang von Gesundheitsförderung und Arbeitsorientierung muss sich kritisch mit den eigenen Erfahrungen und dem kollektiven Gedächtnis auseinandersetzen. Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Theorien der Zivilisation (Norbert Elias, Michel Foucault, Philip Aries), der Aufarbeitung des Faschismus durch Vertreter der Frankfurter Schule, (Theodor W. Adorno, Alexander Mitscherlich, Herbert Marcuse), der Kulturhistorischen Schule (Lew S. Wygotski, Alexander R. Lurija und Alexej Leontjew), der Schule als Sozialisationsagentur und der Sozialisation in der Schule (Franz Wellendorf und Klaus Hurrelmann), der Theorie des unterrichtlichen Lernens (Wolfgang Klafki, Jean Piaget und P.J. Galperin) der Handlungstheorie (Walter Volpert, Winfried Hacker), der materialistisch orientierten Behindertenpädagogik / Psychologie (Wolfgang Jantzen, Klaus Holzkamp) der gestaltungs- und tätigkeitsorientierten technischen Bildung (Felix Rauner, Wolfgang Christian), dem erwerbsarbeitsorientierten Technikdidaktikansatz (Bodo Wessels) und dem komplexen, pragmatischen und relativen Gesundheitsförderungskonzept (Rainer Müller) belegen, dass der Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit in der Arbeitslehre neu durchdacht werden muss. Lineare Ableitungen, in denen Bildungskonzepte aus der beruflichen Praxis (Handwerk) oder aus dem
21 Arbeitsmarkt gefolgert werden, tragen ebenso wenig wie Konzepte der gesundheitlichen Aufklärung, die sich aus der Vernunftbegabung des Menschen oder der kulturellen Einordnung legitimieren. Mit dem Aufkommen der Gesundheitswissenschaften hat die Schule also ein altes Thema neu entdeckt und die alte Gesundheitspädagogik drängt in starkem Maße wieder in die Schule. Gerade deshalb ist es erforderlich, die Grenzen der alten Konzepte aufzudecken und die Chancen neuerer Ansätze zu diskutieren. Ausgangspunkt können die Leitfragen für eine Bewegte und gesunde Schule 12 sein, die zu einer Bestandsaufnahme anhalten: Wie sieht es an meiner Schule aus? 1. Wertschätzungskultur Wie steht es um die gelebte Wertschätzungskultur an Ihrer Schule? Wo beweist sie sich im Umgang mit Alltagskonflikten? Welche Schritte zur Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft sind institutionalisiert? Sind Zeiträume als Begegnungs- und Konfliktaustragung zur Bewahrung der Wertschätzungskultur verbindlich organisiert? 2. Lebenszeit Wird mit eigener Lebenszeit und der Lebenszeit anderer stets verantwortungsvoll umgegangen? Gibt es hausgemachte "Zeitfresser"? Wie wird im Schulalltag der schonende Umgang mit Zeitressourcen belegt? 3. Rhythmisierung Gibt es eine kind- und erwachsenengerechte Rhythmisierung im Schulalltag? Bildet sich dieses Ziel im Stundenplan, im gelebten Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Arbeit und Pausen in der Alltagsroutine belastungsreduzierend ab? 4. Schulleitung Steht die Schulleitung hinter der Idee der Bewegten Schule? Demonstriert sie ihr Engagement in der wirkungsvollen Verbesserung der Arbeitsplatzsituation in der Schule und in ablesbaren Aktivitäten, die Schule als Lern- und Lebensraum weiterzuentwickeln? Beweist sie ihren Willen zur Qualitätsverbesserung durch die Förderung von ressourcenorientierten Beteiligungsmodellen zur Steuerung schulinterner Unterrichtsentwicklung? Hat sie die Courage, die von der Schulgemeinschaft im Schulprogramm definierten Bildungsziele zielführend und konfliktbearbeitend zu vertreten? 5. Unterrichtsqualität Gelingt es dem Kollegium, in zentralen Fragen der Unterrichtsqualität sich auf Kompetenzbereiche und Minimalstandards zu einigen? Wird die Möglichkeit zur kollegialen Hospitation inhaltlich und organisatorisch ernst genommen, so dass Unterricht der hospitierenden Lehrkraft auch ausfallen kann? Wird Fortbildung als Investition gesehen um mit der nötigen Konsequenz, für neu entstehende Belastungen in gleichem Maße Entlastung herzustellen? 12 Nach: v
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997)
 Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union (1997) Diese Deklaration wurde von allen Mitgliedern des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung
Stress dich gesund: raus aus dem Hamsterrad!
 Stress dich gesund: raus aus dem Hamsterrad! Artwork: TELOS 02094klrv Immer schneller die Tretmühle? Aus unserem Testlabor Stresssignale am Arbeitsplatz frühzeitig erkennen! Vorbeugen ist besser als heilen!
Stress dich gesund: raus aus dem Hamsterrad! Artwork: TELOS 02094klrv Immer schneller die Tretmühle? Aus unserem Testlabor Stresssignale am Arbeitsplatz frühzeitig erkennen! Vorbeugen ist besser als heilen!
Gesundheit endet nicht am Schultor
 Gesundheit endet nicht am Schultor Eltern und Schule Hand in Hand für die Gesundheit der Kinder von Michael Töpler, M.A. Übersicht Einleitung 1. Eltern Hauptteil 1. Gesundheit in der Schule 2. Schule 3.
Gesundheit endet nicht am Schultor Eltern und Schule Hand in Hand für die Gesundheit der Kinder von Michael Töpler, M.A. Übersicht Einleitung 1. Eltern Hauptteil 1. Gesundheit in der Schule 2. Schule 3.
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule
 Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen
 Prof. Dr. Eberhard Göpel Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen Osnabrück, 19.4.2012 Übersicht 1. Zum Gesundheitsbegriff 2. Zum historisch kulturellen Wandel der
Prof. Dr. Eberhard Göpel Prävention und Gesundheitsförderung: Kompetenzentwicklung in Gesundheitsberufen Osnabrück, 19.4.2012 Übersicht 1. Zum Gesundheitsbegriff 2. Zum historisch kulturellen Wandel der
FAKULTÄT FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN Institut für Evangelische Theologie
 - Das Portfolio ist als Reflexionsportfolio angelegt. Sie reflektieren anhand von Leitfragen, inwiefern das Praktikum geholfen hat, berufsbezogene Kompetenzen anzubahnen und zu entwickeln. Die den Kompetenzen
- Das Portfolio ist als Reflexionsportfolio angelegt. Sie reflektieren anhand von Leitfragen, inwiefern das Praktikum geholfen hat, berufsbezogene Kompetenzen anzubahnen und zu entwickeln. Die den Kompetenzen
SELBSTWIRKSAMKEIT & WAHLMÖGLICHKEITEN
 Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper Erziehungswissenschaftliche Fakultät AG 9: Medienpädagogik, Forschungsmethoden und Jugendforschung oliver.boehm-kasper@uni-bielefeld.de Forum I SELBSTWIRKSAMKEIT & WAHLMÖGLICHKEITEN
Prof. Dr. Oliver Böhm-Kasper Erziehungswissenschaftliche Fakultät AG 9: Medienpädagogik, Forschungsmethoden und Jugendforschung oliver.boehm-kasper@uni-bielefeld.de Forum I SELBSTWIRKSAMKEIT & WAHLMÖGLICHKEITEN
Verknüpfung von Arbeitsschutzmanagementsystemen
 Verknüpfung von Arbeitsschutzmanagementsystemen mit dem BGM Güstrow, 07. April 2017 Worum wird es gehen? www.bgw-online.de Die BGW wir über uns Gesetzliche Unfallversicherung für alle nicht staatlichen
Verknüpfung von Arbeitsschutzmanagementsystemen mit dem BGM Güstrow, 07. April 2017 Worum wird es gehen? www.bgw-online.de Die BGW wir über uns Gesetzliche Unfallversicherung für alle nicht staatlichen
Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November. Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung
 Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Formulierungen des Leitbildes die Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates das Konzept
Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Formulierungen des Leitbildes die Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates das Konzept
01./ , Erkner, Forum 10
 01./02.11. 2016, Erkner, Forum 10 Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen im Unternehmen Sabine Peistrup/Anke
01./02.11. 2016, Erkner, Forum 10 Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen im Unternehmen Sabine Peistrup/Anke
GYMNASIUM HARKSHEIDE AUSBILDUNGSKONZEPT ALLGEMEINES. Wir wollen Referendarinnen und Referendare 1 vorbereiten.
 GYMNASIUM HARKSHEIDE AUSBILDUNGSKONZEPT ALLGEMEINES Wir wollen Referendarinnen und Referendare 1 vorbereiten. an unserer Schule bestmöglich auf den Beruf Im Austausch mit allen Lehrerinnen und Lehrern
GYMNASIUM HARKSHEIDE AUSBILDUNGSKONZEPT ALLGEMEINES Wir wollen Referendarinnen und Referendare 1 vorbereiten. an unserer Schule bestmöglich auf den Beruf Im Austausch mit allen Lehrerinnen und Lehrern
Leitbild. Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund. Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung
 Leitbild Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung Grundsätze Wir sind ein interdisziplinär arbeitendes, sozialwissenschaftliches
Leitbild Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund Grundsätze Leistungen Kompetenzen Organisation Personal Kooperation Führung Grundsätze Wir sind ein interdisziplinär arbeitendes, sozialwissenschaftliches
Hilfsmittel Leitfragen * Formulierung von Hospitations-, Praktikums- und Fortbildungsangeboten durch den Betrieb
 Die Kompetenzraster zum Bildungsplan WBS (7-9 und 10) sind als Anknüpfungsmöglichkeit für eine erweiterte Kooperation zwischen Schule(n) und Ausbildungsabteilungen von Firmen und Betrieben aus der Wirtschaft
Die Kompetenzraster zum Bildungsplan WBS (7-9 und 10) sind als Anknüpfungsmöglichkeit für eine erweiterte Kooperation zwischen Schule(n) und Ausbildungsabteilungen von Firmen und Betrieben aus der Wirtschaft
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober. Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung
 Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
Manfred Prisching SOZIOLOGIE. Themen - Theorien - Perspektiven. 3., ergänzte und überarbeitete Außage BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
 Manfred Prisching SOZIOLOGIE Themen - Theorien - Perspektiven 3., ergänzte und überarbeitete Außage BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Inhalt Vorwort 9 I. Das soziologische Denken 13 1. Die "Gesellschaft",
Manfred Prisching SOZIOLOGIE Themen - Theorien - Perspektiven 3., ergänzte und überarbeitete Außage BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR Inhalt Vorwort 9 I. Das soziologische Denken 13 1. Die "Gesellschaft",
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Berufs- und sonderpädagogisches Handeln und Lernen
 Die PS-BS setzt sich für alle Schüler folgende Ziele: erfolgreicher Ausbildungsabschluss erfolgreicher Schulabschluss positive Persönlichkeitsentwicklung Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische
Die PS-BS setzt sich für alle Schüler folgende Ziele: erfolgreicher Ausbildungsabschluss erfolgreicher Schulabschluss positive Persönlichkeitsentwicklung Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische
Der neue ORS im Überblick. Hintergründe zum neuen ORS
 Der neue ORS im Überblick Hintergründe zum neuen ORS Orientierung Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, in welche Richtung er segeln will. Wilhelm von Oranien- Nassau Nutzung des ORS
Der neue ORS im Überblick Hintergründe zum neuen ORS Orientierung Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, in welche Richtung er segeln will. Wilhelm von Oranien- Nassau Nutzung des ORS
Gesundheitsförderung im Setting Schule gesund leben lernen
 Gesundheitsförderung im Setting Schule gesund leben lernen 1 Ziele: Entwicklung der Organisation Schule zu einer gesunden Lebenswelt gesundes Lehren und gesundes Lernen Verbesserung der Erziehungs- und
Gesundheitsförderung im Setting Schule gesund leben lernen 1 Ziele: Entwicklung der Organisation Schule zu einer gesunden Lebenswelt gesundes Lehren und gesundes Lernen Verbesserung der Erziehungs- und
W 5 Gesundheitsförderndes Führen
 W 5 Gesundheitsförderndes Führen ein Workshop der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Region Ost Dr. J. Bischoff Herzlich Willkommen! Workshopschwerpunkte: Modernes Gesundheitsverständnis
W 5 Gesundheitsförderndes Führen ein Workshop der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Region Ost Dr. J. Bischoff Herzlich Willkommen! Workshopschwerpunkte: Modernes Gesundheitsverständnis
Einführung. (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland)
 Einführung Februar 2005 Bundesregierung und Spitzenverbände der Wirtschaft rufen gemeinsam mit KMK die gemeinsame Arbeitsgruppe Schule und Wirtschaft ins Leben. (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs
Einführung Februar 2005 Bundesregierung und Spitzenverbände der Wirtschaft rufen gemeinsam mit KMK die gemeinsame Arbeitsgruppe Schule und Wirtschaft ins Leben. (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs
Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur
 Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur Präambel Die Kantonsschule Rychenberg gibt sich ein Leitbild, das für alle Akteure an unserer Schule verbindlich ist und an dem wir uns auch messen lassen
Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur Präambel Die Kantonsschule Rychenberg gibt sich ein Leitbild, das für alle Akteure an unserer Schule verbindlich ist und an dem wir uns auch messen lassen
Externe Evaluation Schule Hochdorf
 Externe Evaluation Schule Hochdorf Herbst 2016 Externe Schulevaluation Die externe Schulevaluation stellt in den teilautonomen Schulen im Kanton Luzern eine vergleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität
Externe Evaluation Schule Hochdorf Herbst 2016 Externe Schulevaluation Die externe Schulevaluation stellt in den teilautonomen Schulen im Kanton Luzern eine vergleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität
Zukunftsaufgabe betriebliche Gesundheitsvorsorge
 Internationales Institut für Management Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie Zukunftsaufgabe betriebliche Gesundheitsvorsorge Vortrag auf dem Workshop Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Internationales Institut für Management Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie Zukunftsaufgabe betriebliche Gesundheitsvorsorge Vortrag auf dem Workshop Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Die Seminare im Überblick
 Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
Die Seminare im Überblick Seminar 1: Teamarbeit in der Rehabilitation Mit Anderen zu kooperieren, in einem Team zusammenzuarbeiten ist nicht neu. Dennoch scheint in vielen Stellenanzeigen die Forderung
Das Fach Geschichte stellt sich vor. Ziele und Inhalte
 Das Fach Geschichte stellt sich vor Ziele und Inhalte Das Ziel des Faches Geschichte ist durch die Vorgaben der Lehrpläne und Richtlinien eindeutig festgelegt: Schülerinnen und Schüler sollen in der kritischen
Das Fach Geschichte stellt sich vor Ziele und Inhalte Das Ziel des Faches Geschichte ist durch die Vorgaben der Lehrpläne und Richtlinien eindeutig festgelegt: Schülerinnen und Schüler sollen in der kritischen
Lehrbuch der Erwachsenenbildung
 Werner Lenz Lehrbuch der Erwachsenenbildung & Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Mainz Inhalt Einleitung 11 1. Leben in der Industriegesellschaft 13 1.1 Leid und Zufriedenheit 13 1.2 Konsum contra
Werner Lenz Lehrbuch der Erwachsenenbildung & Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Mainz Inhalt Einleitung 11 1. Leben in der Industriegesellschaft 13 1.1 Leid und Zufriedenheit 13 1.2 Konsum contra
Angebote zur Gesundheitsprävention durch die MMBG/HWBG
 Angebote zur Gesundheitsprävention durch die / Legden, 30.06.2010 Gliederung 1. Gesundheit gesunder Betrieb 2. aktuelle betriebliche Situation Fakten 3. modernes Gesundheitsverständnis 4. Konsequenzen
Angebote zur Gesundheitsprävention durch die / Legden, 30.06.2010 Gliederung 1. Gesundheit gesunder Betrieb 2. aktuelle betriebliche Situation Fakten 3. modernes Gesundheitsverständnis 4. Konsequenzen
Leitbild. des Deutschen Kinderschutzbundes
 Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Henriette Brandt. Mobbing am Arbeitsplatz
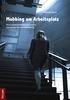 Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz Handlungsmöglichkeiten und Grenzen betrieblicher Gesundheitsförderung Tectum Verlag Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz.
Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz Handlungsmöglichkeiten und Grenzen betrieblicher Gesundheitsförderung Tectum Verlag Henriette Brandt Mobbing am Arbeitsplatz.
Inhalt unseres Schulprogramms
 Inhalt unseres Schulprogramms 1. Informationen zur 2. Unsere pädagogische Grundorientierung 2.1 Zielsetzung 2.2 Unsere Leitwerte 2.2.1 Vertrauen 2.2.2 Offenheit 2.2.3 Transparenz (Kommunikation) 2.2.4
Inhalt unseres Schulprogramms 1. Informationen zur 2. Unsere pädagogische Grundorientierung 2.1 Zielsetzung 2.2 Unsere Leitwerte 2.2.1 Vertrauen 2.2.2 Offenheit 2.2.3 Transparenz (Kommunikation) 2.2.4
In 7 Schritten zum agilen BGM
 In 7 Schritten zum agilen BGM Doris Venzke Gesundheit im Unternehmen GbR BGW-BeraterIn Heidelberg, 24.04.2018 Klärung von Begrifflichkeiten Betriebliche Gesundheitsförderung punktuelle, zeitlich befristete
In 7 Schritten zum agilen BGM Doris Venzke Gesundheit im Unternehmen GbR BGW-BeraterIn Heidelberg, 24.04.2018 Klärung von Begrifflichkeiten Betriebliche Gesundheitsförderung punktuelle, zeitlich befristete
Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung
 Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung Präsentation auf der 3. Fachkonferenz des Kommunalen Netzwerkes für Arbeitsmarktintegration und Gesundheitsförderung am 29. November 2007 in Frankfurt am
Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung Präsentation auf der 3. Fachkonferenz des Kommunalen Netzwerkes für Arbeitsmarktintegration und Gesundheitsförderung am 29. November 2007 in Frankfurt am
Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung
 Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Grundschule Fleestedt
 Evaluationsbericht der Grundschule Fleestedt, Seevetal Juni 2015 - Seite 1 Evaluationsbericht Juni 2015: LÜNEBURGER FRAGEBOGEN Grundschule Fleestedt Befragte Anzahl Rückläufer Rücklaufquote Aussagekraft
Evaluationsbericht der Grundschule Fleestedt, Seevetal Juni 2015 - Seite 1 Evaluationsbericht Juni 2015: LÜNEBURGER FRAGEBOGEN Grundschule Fleestedt Befragte Anzahl Rückläufer Rücklaufquote Aussagekraft
Gute Qualität und gute Arbeit Voraussetzungen und Bedingungen für eine gelingende Umsetzung der Qualitätsentwicklung
 7. Qualitätsnetzwerk Konferenz in der Berufsbildung Qualitätsmanagement umsetzen: QIBB in der Praxis Rainer Zech Gute Qualität und gute Arbeit Voraussetzungen und Bedingungen für eine gelingende Umsetzung
7. Qualitätsnetzwerk Konferenz in der Berufsbildung Qualitätsmanagement umsetzen: QIBB in der Praxis Rainer Zech Gute Qualität und gute Arbeit Voraussetzungen und Bedingungen für eine gelingende Umsetzung
Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1
 Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung-
 Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung- Andrea Herrmann Bern 2017 Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung Inklusive Schule kann gelingen Inklusive Haltung Unterricht
Entwicklung der inklusiven Schule - Qualitätssicherung- Andrea Herrmann Bern 2017 Freie Hansestadt Bremen Die Senatorin für Kinder und Bildung Inklusive Schule kann gelingen Inklusive Haltung Unterricht
Leitbild. der Kindertagesstätten im Caritasverband Worms e. V.
 der Kindertagesstätten im Caritasverband Worms e. V. Mit der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen nehmen wir eine gesellschaftliche und pastorale Verantwortung wahr. Auf der Grundlage eines christlichen
der Kindertagesstätten im Caritasverband Worms e. V. Mit der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen nehmen wir eine gesellschaftliche und pastorale Verantwortung wahr. Auf der Grundlage eines christlichen
Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums
 Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums Der Evaluationsbogen orientiert sich an den Formulierungen des Kerncurriculums; die hier vorgegebenen
Evaluation der Ausbildung im Hinblick auf die vermittelten Kompetenzen und Standards des Kerncurriculums Der Evaluationsbogen orientiert sich an den Formulierungen des Kerncurriculums; die hier vorgegebenen
Qualifizierung für ältere Beschäftigte bei der Fraport AG
 Qualifizierung für ältere Beschäftigte bei der Fraport AG Heidelberger Bildungsgespräche, 11. Mai 2006 Forum 50 plus, Die Bildungskarte für Deutschland Hans-Günther Mainusch, Psychologischer Dienst Seite
Qualifizierung für ältere Beschäftigte bei der Fraport AG Heidelberger Bildungsgespräche, 11. Mai 2006 Forum 50 plus, Die Bildungskarte für Deutschland Hans-Günther Mainusch, Psychologischer Dienst Seite
Arbeitsbelastungsstudie an niedersächsischen Schulen 2016
 Arbeitsbelastungsstudie an niedersächsischen Schulen 2016 Qualität der Arbeitsbedingungen und psychische Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern in Niedersachsen Herausforderungen der Arbeitsbelastung
Arbeitsbelastungsstudie an niedersächsischen Schulen 2016 Qualität der Arbeitsbedingungen und psychische Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern in Niedersachsen Herausforderungen der Arbeitsbelastung
Erzieherisch wirksam handeln
 Studienseminar Koblenz Berufspraktisches Seminar Pflichtmodul 09 Erzieherisch wirksam handeln 19.03.2018 Ankommen/ Anknüpfen Erzieherisch handeln in der Schule In früherer Zeit fiel der Schule in der
Studienseminar Koblenz Berufspraktisches Seminar Pflichtmodul 09 Erzieherisch wirksam handeln 19.03.2018 Ankommen/ Anknüpfen Erzieherisch handeln in der Schule In früherer Zeit fiel der Schule in der
Positionspapier Inklusion in Bildungseinrichtungen des Fachbereichs Bildungseinrichtungen
 1. Präambel Der Fachbereich Bildungseinrichtungen ist das federführende Fachgremium der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), das sich mit der Förderung von Sicherheit und Gesundheit in den
1. Präambel Der Fachbereich Bildungseinrichtungen ist das federführende Fachgremium der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), das sich mit der Förderung von Sicherheit und Gesundheit in den
Fortbildungskonzept der Peter-Lenné-Schule
 der Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Natur und Umwelt 1. Einleitung 1.1 Bedeutung der Fortbildung 1.2 Fortbildung ist Pflicht 2. Fortbildungsgrundsätze 3. Organisation von Fortbildung 3.1 Allgemeines
der Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Natur und Umwelt 1. Einleitung 1.1 Bedeutung der Fortbildung 1.2 Fortbildung ist Pflicht 2. Fortbildungsgrundsätze 3. Organisation von Fortbildung 3.1 Allgemeines
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) Theoretische Grundlagen
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) Theoretische Grundlagen
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Frühjahr 2008 Didaktik der Grundschule Grundschulpädagogik
 Frühjahr 2008 Didaktik der Grundschule Grundschulpädagogik Die Grundschule soll allen Kindern grundlegende Bildung ermöglichen. 1. Erörtern Sie diesen Anspruch unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen
Frühjahr 2008 Didaktik der Grundschule Grundschulpädagogik Die Grundschule soll allen Kindern grundlegende Bildung ermöglichen. 1. Erörtern Sie diesen Anspruch unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen
Gemeinsam mehr bewegen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement Regionalgeschäftsführerin Maritta Goll
 Gemeinsam mehr bewegen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement Regionalgeschäftsführerin Maritta Goll 06.10.2014 Definition Gesundheit Definition Gesundheit Gesundheit ist der Zustand des vollständigen
Gemeinsam mehr bewegen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement Regionalgeschäftsführerin Maritta Goll 06.10.2014 Definition Gesundheit Definition Gesundheit Gesundheit ist der Zustand des vollständigen
Eßkamp Oldenburg LEITBILD
 Eßkamp 126 26127 Oldenburg LEITBILD Wir schaffen ein respektvolles Lernklima im Lebe nsraum Schule. Unser Lehren und Lerne n berücksichtigt die individuelle Situation aller Schülerinnen und Schüler. Unsere
Eßkamp 126 26127 Oldenburg LEITBILD Wir schaffen ein respektvolles Lernklima im Lebe nsraum Schule. Unser Lehren und Lerne n berücksichtigt die individuelle Situation aller Schülerinnen und Schüler. Unsere
Integration Suchtkranker in die Arbeitswelt (Neue) Herausforderungen für professionelles Handeln
 Integration Suchtkranker in die Arbeitswelt (Neue) Herausforderungen für professionelles Handeln Prof. Dr. Thomas Geisen Institut Integration und Partizipation Ursachen _Arbeitswelt (Co-)Produzent von
Integration Suchtkranker in die Arbeitswelt (Neue) Herausforderungen für professionelles Handeln Prof. Dr. Thomas Geisen Institut Integration und Partizipation Ursachen _Arbeitswelt (Co-)Produzent von
Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung. Unterrichtsform Punkte I II III IV
 Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Univ.-Prof. Dr. Peter Paulus Dipl.-Päd. Susanne M. Nagel-Prinz. Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG), Leuphana Universität Lüneburg
 Univ.-Prof. Dr. Peter Paulus Dipl.-Päd. Susanne M. Nagel-Prinz Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG), Leuphana Universität Lüneburg Transfertagung im nifbe Regionalnetzwerk NordOst Lüneburg,
Univ.-Prof. Dr. Peter Paulus Dipl.-Päd. Susanne M. Nagel-Prinz Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG), Leuphana Universität Lüneburg Transfertagung im nifbe Regionalnetzwerk NordOst Lüneburg,
Auswertung der Befragungsergebnisse zur Selbstevaluation zur Musikalischen Grundschule (SEVA-MuGS) befragte Gruppen
 Dimension I: Stand der Entwicklung zur Musikalischen Grundschule Feld 1: Verankerung der Musikalischen Grundschule Die Schule ist eine aktive Musikalische Grundschule. An der Schule werden musikalische
Dimension I: Stand der Entwicklung zur Musikalischen Grundschule Feld 1: Verankerung der Musikalischen Grundschule Die Schule ist eine aktive Musikalische Grundschule. An der Schule werden musikalische
2.1 Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Hochschulstudiums
 Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Studiums 19 Arbeit an der Bachelor- oder Masterarbeit erworben werden. Die Studierenden müssen schon während des Studiums schrittweise an die entsprechenden
Überfachliche Kompetenzen als Gegenstand des Studiums 19 Arbeit an der Bachelor- oder Masterarbeit erworben werden. Die Studierenden müssen schon während des Studiums schrittweise an die entsprechenden
Die Rolle einer guten Produktionsqualifikation und des lebenslangen Lernens für den Automobilstandort Europa
 Felix Rauner Die Rolle einer guten Produktionsqualifikation und des lebenslangen Lernens für den Automobilstandort Europa Fachtagung Lernen in der Produktion im Rahmen der IAA Frankfurt, 20.09.2007 1 Eine
Felix Rauner Die Rolle einer guten Produktionsqualifikation und des lebenslangen Lernens für den Automobilstandort Europa Fachtagung Lernen in der Produktion im Rahmen der IAA Frankfurt, 20.09.2007 1 Eine
Leitbild des Albert-Schweitzer- Gymnasiums Ruhla
 Leitbild des Albert-Schweitzer- Gymnasiums Ruhla Das ist im Thüringer Wald gelegen und somit eine Schule im Grünen. Das offen gestaltete Gelände sowie die historischen Schulgebäude mit ihrer direkten Verbindung
Leitbild des Albert-Schweitzer- Gymnasiums Ruhla Das ist im Thüringer Wald gelegen und somit eine Schule im Grünen. Das offen gestaltete Gelände sowie die historischen Schulgebäude mit ihrer direkten Verbindung
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung.
 Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Bernd Schorb, Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft eine notwendige und problematische Verbindung. Exposé aus Medienpädagogik Themenfeld Wechselverhältnis Medientheorie Medienpädagogik Artikel
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
GYMNASIUM EBINGEN. Herzlich willkommen am Gymnasium Ebingen GYMNASIUM EBINGEN
 Impressum Herausgeber: Gymnasium Ebingen Gymnasiumstraße 15 72458 Albstadt Schulleiter Dr. Christian Schenk, Oberstudiendirektor Stellv. Schulleiter Axel Bulach, Studiendirektor Telefon: 07431 53028 Fax:
Impressum Herausgeber: Gymnasium Ebingen Gymnasiumstraße 15 72458 Albstadt Schulleiter Dr. Christian Schenk, Oberstudiendirektor Stellv. Schulleiter Axel Bulach, Studiendirektor Telefon: 07431 53028 Fax:
Politische Bildung im LehrplanPLUS. Schnittstellen für die Kooperation mit Partnern der außerschulischen Jugendarbeit
 Politische Bildung im LehrplanPLUS. Schnittstellen für die Kooperation mit Partnern der außerschulischen Jugendarbeit STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Corinna Storm, Grundsatzabteilung,
Politische Bildung im LehrplanPLUS. Schnittstellen für die Kooperation mit Partnern der außerschulischen Jugendarbeit STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Corinna Storm, Grundsatzabteilung,
Partizipation. Warum ist Schülerbeteiligung wichtig?! Welche Formen gibt es?
 Partizipation Warum ist Schülerbeteiligung wichtig?! Welche Formen gibt es? Impulsreferat Norma Grube Hospitation Gelebte Partizipation Schülerfirmen in der Ganztagsschule Eldenburg Gymnasium Lübz Wieso
Partizipation Warum ist Schülerbeteiligung wichtig?! Welche Formen gibt es? Impulsreferat Norma Grube Hospitation Gelebte Partizipation Schülerfirmen in der Ganztagsschule Eldenburg Gymnasium Lübz Wieso
LehrplanPLUS Gymnasium Geschichte Klasse 6. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Kompetenzorientierung
 Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Gymnasium Geschichte Klasse 6 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der neue Lehrplan für das Fach Geschichte ist kompetenzorientiert ausgerichtet. Damit ist die Zielsetzung verbunden, die Lernenden
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule
 Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
Kompetenzen Workshop Fairer Handel
 Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
Wiesbadener Erklärung
 Wiesbadener Erklärung 18. Dezember 2001 Gemeinsame Erziehungsverantwortung in Schule und Elternhaus stärken - 2 - I. Das Hessische Kultusministerium und der Landeselternbeirat von Hessen sehen in der Erziehungsverantwortung
Wiesbadener Erklärung 18. Dezember 2001 Gemeinsame Erziehungsverantwortung in Schule und Elternhaus stärken - 2 - I. Das Hessische Kultusministerium und der Landeselternbeirat von Hessen sehen in der Erziehungsverantwortung
Die Umsetzung des integrativen Ansatzes der Gesellschaftslehre
 Die Umsetzung des integrativen Ansatzes der Gesellschaftslehre Das konzeptionelle Selbstverständnis der Gesellschaftslehre basiert auf zwei Grundpfeilern: Orientierung an Schlüsselfragen: Gesellschaftlichen
Die Umsetzung des integrativen Ansatzes der Gesellschaftslehre Das konzeptionelle Selbstverständnis der Gesellschaftslehre basiert auf zwei Grundpfeilern: Orientierung an Schlüsselfragen: Gesellschaftlichen
Differenzierung im Sportunterricht
 Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
congenial coaching und consulting Betriebliche Gesundheit im Unternehmen Bausteine für den zukünftigen Unternehmenserfolg
 congenial coaching und consulting Investing in PeoplE Betriebliche Gesundheit im Unternehmen Bausteine für den zukünftigen Unternehmenserfolg Was gehen Sie eigentlich die Probleme Ihrer Mitarbeiter an?
congenial coaching und consulting Investing in PeoplE Betriebliche Gesundheit im Unternehmen Bausteine für den zukünftigen Unternehmenserfolg Was gehen Sie eigentlich die Probleme Ihrer Mitarbeiter an?
Erfolgsfaktor Gesundheit Gesundheit und Führung Ursula Müller 1
 Erfolgsfaktor Gesundheit Gesundheit und Führung 28.03.2011 Ursula Müller 1 Überblick Definition von Gesundheit Gesundheitsmodell Salutogenese Gesundheitsfelder und Wechselwirkung Rolle der Führungskraft
Erfolgsfaktor Gesundheit Gesundheit und Führung 28.03.2011 Ursula Müller 1 Überblick Definition von Gesundheit Gesundheitsmodell Salutogenese Gesundheitsfelder und Wechselwirkung Rolle der Führungskraft
Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg
 Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg Grundlagen und Ziele interkultureller Öffnung Die komplementäre Perspektive: Diversity Management Interkulturelle
Grundlagen und Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung Flensburg Grundlagen und Ziele interkultureller Öffnung Die komplementäre Perspektive: Diversity Management Interkulturelle
Luxemburger Deklaration
 Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union 1 Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union* Betriebliche Gesundheitsförderung
Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union 1 Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union* Betriebliche Gesundheitsförderung
Qualitätsleitbild der Realschule Balingen. Präambel: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
 Qualitätsleitbild der Realschule Balingen Präambel: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Qualitätsbereich I: Unterricht Leitsatz 1 Ganzheitliche Bildung ist unserer Schule
Qualitätsleitbild der Realschule Balingen Präambel: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Qualitätsbereich I: Unterricht Leitsatz 1 Ganzheitliche Bildung ist unserer Schule
PÄDAGOGISCHES LEITBILD BRÜCKENANGEBOTE
 PÄDAGOGISCHES LEITBILD BRÜCKENANGEBOTE Die Frauenfeld sind eine öffentliche Berufswahlschule, an der fachliche, lebenspraktische, persönliche und soziale Kompetenzen gefördert werden. Ziele Alle Jugendlichen
PÄDAGOGISCHES LEITBILD BRÜCKENANGEBOTE Die Frauenfeld sind eine öffentliche Berufswahlschule, an der fachliche, lebenspraktische, persönliche und soziale Kompetenzen gefördert werden. Ziele Alle Jugendlichen
Leseförderung an der St.-Augustinus-Schule
 Leseförderung an der St.-Augustinus-Schule DER FACHBEREICH SPRACHEN INFORMIERT » «Lesen ist für den Geist das, was Gymnastik für den Körper ist. Joseph Addison (1672 bis 1719) LESEFÖRDERUNG AN DER ST.-AUGUSTINUS-SCHULE
Leseförderung an der St.-Augustinus-Schule DER FACHBEREICH SPRACHEN INFORMIERT » «Lesen ist für den Geist das, was Gymnastik für den Körper ist. Joseph Addison (1672 bis 1719) LESEFÖRDERUNG AN DER ST.-AUGUSTINUS-SCHULE
Erfahrungspotenziale älterer MitarbeiterInnen integrieren U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N B E R L I N
 Erfahrungspotenziale älterer MitarbeiterInnen integrieren s U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N B E R L I N Demografischer Wandel Der demographischer Wandel in den nächsten Jahrzehnten nimmt Einfluss
Erfahrungspotenziale älterer MitarbeiterInnen integrieren s U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N B E R L I N Demografischer Wandel Der demographischer Wandel in den nächsten Jahrzehnten nimmt Einfluss
Kindheits- und Jugendforschung
 Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Gruppenbericht. Test GmbH Mustergruppe
 Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
Kennzahlenportfolio Betriebliches Gesundheitsmanagement
 Kennzahlenportfolio Betriebliches Gesundheitsmanagement 24 Früh- und 23 Spätindikatoren für das betriebliche Gesundheitsmanagement Wie wirksam ist unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wirklich?
Kennzahlenportfolio Betriebliches Gesundheitsmanagement 24 Früh- und 23 Spätindikatoren für das betriebliche Gesundheitsmanagement Wie wirksam ist unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wirklich?
GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL
 GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL KRITERIENKATALOG TFBS 2016/2017 Das ist eine Fußzeile Struktur Ansprechperson und Steuerung Kriterium Nachhaltigkeit 1. Es gibt eine/n definierte/n Gesundheitsreferenten/in
GÜTESIEGEL GESUNDE SCHULE TIROL KRITERIENKATALOG TFBS 2016/2017 Das ist eine Fußzeile Struktur Ansprechperson und Steuerung Kriterium Nachhaltigkeit 1. Es gibt eine/n definierte/n Gesundheitsreferenten/in
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Gesundheitsförderung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe
 Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe Günter Wottke (Dipl. Soz. Päd. BA) Abteilungsleiter Soziale Dienste Kinder- und Jugendamt Heidelberg Inklusion - Grundsätzliches
Voraussetzungen für gelingende Inklusion im Bildungssystem aus Sicht der Jugendhilfe Günter Wottke (Dipl. Soz. Päd. BA) Abteilungsleiter Soziale Dienste Kinder- und Jugendamt Heidelberg Inklusion - Grundsätzliches
Saarbrücken 2011 Rödler 2011
 Saarbrücken 2011 Rödler 2011 Inklusion in eine sich spaltenden Gesellschaft Schulkampf in Hamburg Positionen Annäherung an eine spannungsvolle und ideologisch aufgeladene Diskussion Allgemeine Pädagogik
Saarbrücken 2011 Rödler 2011 Inklusion in eine sich spaltenden Gesellschaft Schulkampf in Hamburg Positionen Annäherung an eine spannungsvolle und ideologisch aufgeladene Diskussion Allgemeine Pädagogik
Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts
 Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts 1 Die Leuphana Universität Lüneburg wagt eine radikale Neuausrichtung und eine
Humanistisch. Nachhaltig. Handlungsorientiert. Eine öffentliche Universität für die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts 1 Die Leuphana Universität Lüneburg wagt eine radikale Neuausrichtung und eine
Gesund älter werden im Quartier: Chancen und Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention
 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen Gesund älter werden im Quartier: Chancen und Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention Jutta Hansen Fachtagung Duisburg 1. Juni Inklusion bedeutet,
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen Gesund älter werden im Quartier: Chancen und Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention Jutta Hansen Fachtagung Duisburg 1. Juni Inklusion bedeutet,
Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung Multiplikatorenkonzept und Nachhaltigkeit. Lana Hirsch
 Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung Multiplikatorenkonzept und Nachhaltigkeit Lana Hirsch 17.01.2019 Definition des Kriteriums Multiplikatorenkonzept Ein Multiplikatorenkonzept
Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung Multiplikatorenkonzept und Nachhaltigkeit Lana Hirsch 17.01.2019 Definition des Kriteriums Multiplikatorenkonzept Ein Multiplikatorenkonzept
Kinder stärken, gemeinsam für mehr Gesundheit. Herzlich Willkommen. Gemeinsam für mehr Gesundheit
 Kinder stärken, gemeinsam für mehr Gesundheit Herzlich Willkommen Gemeinsam für mehr Gesundheit Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen Gut 7% der 13-Jährigen haben vierzig Mal oder öfter Alkohol konsumiert
Kinder stärken, gemeinsam für mehr Gesundheit Herzlich Willkommen Gemeinsam für mehr Gesundheit Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen Gut 7% der 13-Jährigen haben vierzig Mal oder öfter Alkohol konsumiert
DER ENTWICKLUNGSBERICHT IM VORBEREITUNGSDIENST - 1 -
 DER ENTWICKLUNGSBERICHT IM VORBEREITUNGSDIENST - 1 - Inhalt Stand: Januar 2012 1. Der Entwicklungsbericht 2. Aufgabenstellungen 2.1 Schulische und individuelle Bedingungen 2.2 Umgang mit Ausbildungsangeboten
DER ENTWICKLUNGSBERICHT IM VORBEREITUNGSDIENST - 1 - Inhalt Stand: Januar 2012 1. Der Entwicklungsbericht 2. Aufgabenstellungen 2.1 Schulische und individuelle Bedingungen 2.2 Umgang mit Ausbildungsangeboten
Zur pädagogischen Transformation in der politischen Bildung
 Ludwig Henkel Zur pädagogischen Transformation in der politischen Bildung Ein integrativer Ansatz für die Praxis in der Berufsschule PETER LANG Frankfurt am Main Bern New York Paris??? -1 INHALTSVERZEICHNIS
Ludwig Henkel Zur pädagogischen Transformation in der politischen Bildung Ein integrativer Ansatz für die Praxis in der Berufsschule PETER LANG Frankfurt am Main Bern New York Paris??? -1 INHALTSVERZEICHNIS
I. Bedeutung des Wettbewerbs Mobben stoppen. Begrüßung. Der Wettbewerb Mobben Stoppen ist eine ganz außergewöhnliche Initiative:
 1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 15.11.2011, 15:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
1 - Es gilt das gesprochene Wort - - Sperrfrist: 15.11.2011, 15:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs
Grundriss der Sportpädagogik
 Robert Prohl Grundriss der Sportpädagogik 2., stark überarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Robert Prohl Grundriss der Sportpädagogik 2., stark überarbeitete Auflage Limpert Verlag Wiebelsheim Inhalt 1. Einführung: Was bedeutet Sportpädagogik? 9 1.1 Funktionen einer wissenschaftlichen Betrachtung
Bericht der Schulinspektion 2013 Zusammenfassung Schule Fünfhausen-Warwisch
 Bericht der Schulinspektion 2013 Schule Fünfhausen-Warwisch Inspektion vom 17.04.2013 (2.Zyklus) Präambel Die Qualitätsurteile, die in der nachfolgenden dargestellt und begründet werden, sind das Ergebnis
Bericht der Schulinspektion 2013 Schule Fünfhausen-Warwisch Inspektion vom 17.04.2013 (2.Zyklus) Präambel Die Qualitätsurteile, die in der nachfolgenden dargestellt und begründet werden, sind das Ergebnis
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sylvia Löhrmann
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Unser Leitbild. Individuelle Wohnangebote für Menschen mit Behinderung
 Unser Leitbild. Individuelle Wohnangebote für Menschen mit Behinderung Selbstverständnis und Identität Wir sind gegen Benachteiligung. Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Behinderung
Unser Leitbild. Individuelle Wohnangebote für Menschen mit Behinderung Selbstverständnis und Identität Wir sind gegen Benachteiligung. Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Behinderung
Leitbild Schule Teufen
 Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
Leitbild Schule Teufen 1 wegweisend Bildung und Erziehung 2 Lehren und Lernen 3 Beziehungen im Schulalltag 4 Zusammenarbeit im Schulteam 5 Kooperation Schule und Eltern 6 Gleiche Ziele für alle 7 Schule
