Natur Land. Naturschutz Partner zum Leben
|
|
|
- Ursula Tiedeman
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Natur Land Naturschutz Partner zum Leben
2 FACHBEITR ÄGE Der Europa-Knotenfuß im Bundesland Salzburg Der Europa-Knotenfuß (Streptopus amplexifolius) ist bei uns hauptsächlich in feucht-schattigen Wäldern, Grünerlengebüschen und Hochstaudenfluren zu finden. Eine gewisse Auffälligkeit verleihen ihm im fruchtenden Zustand die zinnoberroten Beeren, wie auch das Foto auf der vorderen Umschlagseite dieser Ausgabe von zeigt. Die Pflanze besitzt eine starke Ähnlichkeit mit Vertretern der Gattung Weißwurz oder Salomonssiegel (Polygonatum). Früher waren daher beide Gattungen zunächst der Familie der Liliengewächse im weiteren Sinn (Liliaceae s. lat.) und in der Folge den Spargelgewächsen (Asparagaceae s. lat.) bzw. den Mäusedorngewächsen im weiteren Sinn (Ruscaceae s. lat.) zugeordnet worden. Fischer et al. (2008) stellen die Gattung Knotenfuß zu den Goldsiegel- oder Trauerglockengewächsen (Uvulariaceae), weisen aber darauf hin, dass die Stellung und Abgrenzung dieser Familie noch sehr strittig ist. Phylogenetisch besteht trotz der starken Unterschiede im Erscheinungsbild anscheinend eine nahe Verwandtschaft zu den Herbstzeitlosengewächsen (Colchicaceae). setzt sich aus den lateinischen Wörtern amplexus (umfassend, umschlingend) und -folius (-blättrig) zusammen und beschreibt die stängelumfassenden Laubblätter (Genaust 2005). Steckbrief Eine gewisse Verwechslungsmöglichkeit besteht im vegetativen und blühenden Zustand mit Weißwurz-Arten mit breit-elliptischen Blättern (z. B. Wald- oder Mehrblüten-Weißwurz Polygonatum multiflorum). Eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zum Europa-Knotenfuß, der im tabellarischen Steckbrief detailliert beschrieben ist, sind aber bei diesen Arten die nicht stängelumfassenden Blätter. Weiters sind die Perigonblätter der Blüten zu mehr als zwei Dritteln miteinander verwachsen, während dies bei Streptopus amplexifolius nur bis zu etwa einem Drittel der Fall ist. Im Gegensatz zur leuchtend roten Frucht des Europa-Knotenfußes besitzen diese breitblättrigen heimischen Weißwurz-Arten im reifen Zustand (schwarz)blaue Beeren (vgl. Fischer et al. 2008). Die Gattung Knotenfuß (Streptopus) enthält weltweit sieben bis zehn Arten, die in gemäßigten Gebieten der Nordhemisphäre mit Schwerpunkten in China und Nord-Amerika verbreitet sind. Einziger in Mitteleuropa vorkommender Vertreter ist der Europa-Knotenfuß. Der wissenschaftliche Name der Gattung leitet sich von den griechischen Wörtern streptós (gedreht, gewunden) und poús (Fuß) ab und bezieht sich auf die gebogenen oder gedrehten Blütenstiele. Das Art-Epitheton amplexifolius für den Europa-Knotenfuß Der verzweigte Stängel und die charakteristischen Blütenmerkmale des Europa-Knotenfußes sind gut erkennbar. 33
3 Steckbrief Europa-Knotenfuß Weitere deutsche Namen Wissenschaftlicher Name Synonyme Stängelumfassender Knotenfuß, Knotenstiel Streptopus amplexifolius (L.) DC. Uvularia amplexifolia L., Convallaria amplexifolia (L.) E.H.L. Krause, Tortipes amplexifolius (L.) Small, Streptopus distortus Michx., Uvularia distorta (Michx.) Pers. Chromosomen 2n = 32 Höhe Rhizom Stängel Laubblätter Blütenstand Blüte Blütenfarbe Blütezeit Bestäubung Frucht Ausbreitung Lebensdauer Keimung Höhenstufen Lebensräume Verbreitung Vorkommen in Österreich (20) cm schräg bzw. schief, knotig aufrecht, unten relativ dick, etwas hin und her gebogen ( Zickzack -Verlauf), oberwärts oft verzweigt, gleichmäßig bis zur Spitze beblättert, meist überhängend wechselständig, zweizeilig angeordnet, mit herzförmigem Grund stängelumfassend sitzend, länglich-eiförmig, lang zugespitzt, 3-6 cm breit, 7-12 cm lang, länger als das Internodium, nach oben gleichmäßig kleiner werdend, Oberseite dunkelgrün, Unterseite hellgrün, wächsern mehrere Blüten am Stängel, hängende glockige Einzelblüten (sehr selten zwei Blüten), scheinbar blattgegenständig, Blütenstiel bis 5 cm lang, dünn, gegliedert, mit dem folgenden Stängel-Internodium verwachsen, knapp unter dem nächst-oberen Laubblatt waagrecht abzweigend, deutlich gekniet (abgeknickt), Tragblattrest an der etwa rechtwinkeligen Knickstelle sechs fast freiblättrige, lanzettliche Perigonblätter, die nur am Grund bis zu ca. einem Drittel ihrer Länge miteinander verwachsen sind, 8-10 mm lang, Perigonzipfel zurückgebogen, zwitterblütig, sechs Staubblätter, oberständiger Fruchtknoten, ein Griffel cremeweiß bis gelblich-grün oder grünlich-weiß (V) VI - VII Insekten- und Selbstbestäubung im reifen Zustand leuchtend zinnoberrote, walzliche Beere, mm lang, (7) 8-10 (12) mm breit, hängend, dreifächerig, vielsamig Verdauungsausbreitung (Endozoochorie) perennierend (ausdauernd) Kältekeimung montan subalpin (alpin); bis etwa m Seehöhe schattig-feuchte bodensaure Fichtenwälder, frische Nadel-(Laub-)Mischwälder, Schluchtwälder, Grünerlengebüsche, Hochstaudenfluren, feucht-schattige Felshänge; meist auf kalkarmen Böden zerstreut bis selten in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien und des Burgenlands (Zusammengestellt nach Aeschimann et al. 2004, Eggenberg & Möhl 2007, Fischer et al. 2008, Haeupler & Muer 2000, Hess et al. 1984, Lauber & Wagner 2001, Lippert 1981, Oberdorfer 1983, Rothmaler 2002, Seybold 1998) 34
4 Ökologisches Verhalten Die Tabelle der Zeigerwerte gibt das ökologische Verhalten des Europa- Knotenfußes nach der neunstufigen Skala gemäß Ellenberg et al. (1992) und der fünfstufigen Skala nach Landolt für die Flora der Schweiz (aus Lauber & Wagner 2001) wieder. Streptopus amplexifolius ist eine Halbschattenpflanze, die nur ausnahmsweise im vollen Licht steht. Nach Ellenberg et al. (1992) benötigt sie an ihren Wuchsorten meist mehr als 10 % der relativen Beleuchtungsstärke, die bei voller Belaubung der sommergrünen Pflanzen bei diffuser Beleuchtung (Nebel, gleichmäßig bedeckter Himmel) herrscht. Als Kühlezeiger gehört der Europa-Knotenfuß zu jenen Pflanzenarten, deren Hauptverbreitungsgebiet in der subalpinen Stufe liegt. Auch nach Aeschimann et al. (2004) bevorzugt er in der Höhenverbreitung die subalpine Stufe, kann aber in der montanen und in der alpinen Stufe ebenfalls auftreten. Nach den Kontinentalitätszahlen befindet sich sein Verbreitungsschwerpunkt in Gebieten mit subozeanischem Klima. Seybold (1998) gibt die allgemeine Verbreitung dieser Art als zirkumpolar, in Europa als präalpin an. Das Areal erstreckt sich von Nordspanien, Süditalien und Bulgarien nordwärts bis Mitteldeutschland und Polen und umfasst nahezu den gesamten Alpenbogen (vgl. Aeschimann et al. 2004). Weiters kommt der Europa- Knotenfuß im Himalaja, in Ostasien, in Kanada und den USA sowie in Grönland vor (Seybold 1998). Nach der Arealdiagnose in Rothmaler (2002) besiedelt er in Ostasien und Amerika von der montanen Stufe der meridionalen Zone bis in die Ebenen der borealen Zone die Ozeanitätsstufen c1-5. In Europa ist er in den Gebirgen der submeridionalen und der südlichen temperaten Zone mit den Ozeanitätsstufen c2-3 zu finden. Zeigerwerte Ellenberg et al. Landolt Lichtzahl (L) 5 3 Temperaturzahl (T) 3 2 Kontinentalitätszahl (K) 4 2 Feuchtezahl (F) 5 4 Reaktionszahl (R) 6 3 Stickstoffzahl (N) 6 3 Salzzahl (S) 0 Nach Landolt handelt es sich bei Streptopus amplexifolius um einen Feuchtezeiger (vgl. auch Aeschimann et al. 2004), während Ellenberg et al. (1992) ihn als Frischezeiger (Feuchtezahl 5) charakterisieren. Demnach liegt das Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden, hingegen fehlt er auf nassen oder öfter austrocknenden Böden. Die Reaktionszahl 5 (Ellenberg et al. 1992) weist ihn als Mäßigsäurezeiger aus, der auf stark sauren sowie neutralen bis alkalischen Böden selten auftritt. Auch nach Landolt präferiert die Art schwach saure Böden (ph 4,5 7,5). Während Rothmaler (2002) den Europa-Knotenfuß als kalkmeidend einstuft, geben ihn andere Autoren für meist kalkarme Böden an (vgl. z. B. Oberdorfer 1983, Seybold 1998). Nach Aeschimann et al. (2004) erstreckt sich der geologische Untergrund von karbonatischen über Mischgesteine bis hin zu silikatischen Gesteinen. Dementsprechend besteht auch eine relativ weite Amplitude bezüglich der Bodenreaktion, wobei als Schwerpunkt der neutrale Bereich angegeben wird. Bezüglich der Nährstoffversorgung klassifizieren Ellenberg et al. (1992) die Standorte der Art als zwischen den mäßig stickstoffreichen und den stickstoffreichen stehend. Auch nach Landolt kommt sie weder auf sehr nährstoffarmen noch auf stark gedüngten Böden vor. Streptopus amplexifolius gilt als nicht salzertragend. Ein Salzeinfluss ist an seinen natürlichen Wuchsorten in der Regel auch nicht zu erwarten, außer diese werden von stärker frequentierten Straßen mit entsprechend hohem Streusalzeintrag aus dem Winterdienst durchschnitten. Der Europa-Knotenfuß zählt zu den Geophyten oder Kryptophyten, d.h. zu den krautigen, sommergrünen Pflanzen, deren Knospen unter der Erdoberfläche überwintern (vgl. Ellenberg et al. 1992, Fischer et al. 2008, Lauber & Wagner 2001). Seybold (1998) weist für Baden-Württemberg auf das auffällige Phänomen hin, dass oft nur Einzelpflanzen gefunden werden. Dies deckt sich auch mit eigenen Beobachtungen im Bundesland Salzburg. Seybold (1998) schließt daraus, dass die Fähigkeit zur vegetativen Nahausbreitung fehlt, aber auch bei der generativen Vermehrung Probleme vorliegen. Letzteres könnte mit der endozoochoren Ausbreitung, also über die Darmpassage von Tieren, zusammenhängen. Tierfraß spielt möglicherweise generell als Ursache für das zerstreute Auftreten der Art eine Rolle, da Seybold (1998) als Gefährdungsgrund erwähnt, dass Gämsen die ganzen Pflanzen fressen. Nach eigenen Beobachtungen dürfte auch Rehwild fallweise für Verluste von mehr oder weniger großen oberirdischen Teilen der Pflanzen verantwortlich sein. In der Literatur wird Streptopus amplexifolius übrigens zumeist als nicht giftig eingestuft, nach Fischer et al. (2008) ist die Giftigkeit fraglich. Pflanzensoziologische Einnischung Der Europa-Knotenfuß kommt in verschiedenen Lebensräumen von 35
5 der montanen bis in die subalpine Stufe vor. Aeschimann et al. (2004) beispielsweise nennen ihn schwerpunktmäßig für Hochstaudenfluren, Grünerlengebüsche, Fichten- und Fichten-Mischwälder, Buchen-Ahornwälder, Ahorn- sowie Schluchtwälder. Ein (sporadisches) Auftreten ist in Felsenbereichen, Geröll- und Karstfluren, an Bachrändern, in Zwergstrauchheiden im weiteren Sinn, Gebüschen an Felswänden und feuchten Eschenwäldern bzw. hohen Weidenbeständen sowie auf Waldschlägen und an Forstwegen möglich. Als pflanzensoziologisches Optimum geben Aeschimann et al. (2004) die Klasse der Betulo-Alnetea viridis (subalpin-subarktische Laubgebüsche) an. Generell gilt Streptopus amplexifolius als charakteristische Art für die Ordnung der subalpinen Hochstaudenfluren und -gebüsche (Adenostyletalia; vgl. Ellenberg et al. 1992, Fischer et al. 2008, Oberdorfer 1983, Rothmaler 2002). Diese Standorte sind durch tiefgründige, nährstoffreiche Böden mit guter Wasserversorgung und basischer bis schwach saurer Reaktion gekennzeichnet (Karner & Mucina 1993). In den Alpen lässt sich diese Ordnung in den gehölzfreien bis gehölzarmen Verband der subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae) und in den von Gehölzen dominierten Verband der subalpinen Hochstaudengebüsche (Alnion viridis) gliedern. Karner & Mucina (1993) geben den Europa-Knotenfuß allerdings nicht als Kenntaxon auf Ordnungsniveau an, sondern lediglich als Kennart für das Alnion viridis und neben der Grün-Erle (Alnus alnobetula = A. viridis) als transgressive Kennart für das Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) an. Diese Pflanzengesellschaft ist von der Alpenmilchlattich-Hochstaudenflur (Cicerbitetum alpinae) floristisch nur durch die Straucharten unterschieden (Karner & Mucina 1993). Das bevorzugte Vorkommen von Streptopus amplexifolius gemeinsam mit Gehölzen deckt sich mit den ökologischen Ansprüchen als Halbschattenpflanze. Die Art tritt auch regelmäßig im Verband der basenarmen Fichten- und Fichtenwälder (Vaccinio- Piceion) auf (vgl. Aeschimann et al. 2004, Fischer et al. 2008, Oberdorfer 1983, Rothmaler 2002). Willner & Grabherr (2007a) führen sie unter den diagnostischen Arten für die hochmontane bis subalpine Gesellschaft des Gebirgsfarn- Fichtenwalds (Athyrio alpestris- Piceetum) an. Dabei handelt es sich um mäßig wüchsige Fichtenwälder über sehr frischen, mäßig basen- und nährstoffarmen Böden (meist Braunerde). Für Deutschland ordnen Haeupler & Muer (2000) Streptopus amplexifolius auch den zwergstrauchreichen Tannen- Fichtenwäldern (Verband Abieto- Piceion) zu. Blühendes Exemplar des Europa-Knotenfußes in einem Gebirgsfarn-Fichtenwald im Obersulzbachtal (Neukirchen am Großvenediger) (Bilder: G. Nowotny). 36 Der Europa-Knotenfuß kommt weiters in Laub- und Laubmischwäldern vor. Oberdorfer (1983) nennt diesbezüglich das Aceri-Fagetum, den hochmontan-subalpinen Bergahorn- Buchenwald. Nach Wallnöfer et al. (1993) gehört Streptopus amplexifo-
6 lius der diagnostischen Artenkombination für den übergeordneten Unterverband der Bergahorn-reichen Hochlagen-Buchenwälder (Acerenion pseudoplatani) an. Dieser wurde von Willner & Grabherr (2007a) in den Unterverband der alpischdinarischen Karbonat-Buchen- und Fichten-Tannen-Buchenwälder (Lonicero alpigenae-fagenion) eingegliedert. Das Aceri-Fagetum entspricht hier dem hochmontanen Karbonat-Buchenwald (Saxifrago rotundifoliae-fagetum). Diese Gesellschaft umfasst hochmontane (subalpine) Buchenwälder mit meist nur geringem Nadelholzanteil, bisweilen aber stärkerer Beteiligung des Berg-Ahorns (Acer pseudoplatanus). Die Laubbäume sind oft säbelwüchsig und können an Standorten mit extremer winterlicher Schneebelastung (z. B. Leelagen nahe der Waldgrenze, Lawinenbahnen) sogar eine krummholzartige, niederliegende Form (Legbuchengebüsch) annehmen (Willner & Grabherr 2007a). In den Tabellen zu dieser Pflanzengesellschaft (Willner & Grabherr 2007b) scheint der Europa-Knotenfuß für die Subassoziationen Saxifrago rotundifoliae- Fagetum adenostyletosum alliariae auf durchschnittlichen, tonreichen Böden und Saxifrago rotundifoliae- Fagetum petasitetosum auf feuchteren Standorten auf. In der Montanstufe ist die Art in Wäldern des Verbands der Linden- Ahorn- bzw. Edellaubwälder im engeren Sinn (Tilio-Acerion) zu finden. Dieser Verband umfasst die Schluchtwälder und Bergahornreichen Hangschutt- und Blockhaldenwälder auf mineralreichen Silikat- und Karbonatgesteinen (Wallnöfer et al. 1993). Streptopus amplexifolius wird als Trenntaxon für das Ulmo-Aceretum pseudoplatani (Hochstauden-Schluchtwald bzw. -Bergahornwald oder Ulmen- Ahornwald) angeführt. Diese Pflanzengesellschaft besiedelt Standorte auf feinerdereichen Böden über Felsschutthalden von der montanen bis in die subalpine Stufe (Wallnöfer et al. 1993). Nach Willner & Grabherr (2007a) zählt der Europa-Knotenfuß zu den diagnostischen Arten des Waldgeißbart-Lindenmischwalds (Arunco-Tilietum cordatae), eine sub- bis tiefmontane Pflanzengesellschaft, die aber nur für Tirol angegeben wird. Dem Verband des Tilio-Acerions sind auch die Wälder zuzuordnen, in denen Morton (1958) im Salzbergtal bei Hallstatt (Oberösterreich) Vegetationsaufnahmen mit Streptopus amplexifolius erstellte. Mehrfach scheint darin das Moschuskraut (Adoxa moschatellina) auf, das nach Wallnöfer et al. (1993) zu den wenigen typischen Tilio-Acerion- Kennarten zählt. Morton (1958) betont, dass der Europa-Knotenfuß eine gewisse Bandbreite bezüglich seiner Standorte aufweist, dass aber schattige, bodennasse, von feuchter Luft erfüllte Waldbereiche insbesondere von Sprühwasser beeinflusste Bachufer bevorzugt werden, wo er gemeinsam mit Adoxa moschatellina vorkommt. Ein eigener Fund in einem von Hochstauden und Sträuchern dominierten Schluchtwaldbereich am Untersulzbachfall im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger (Nowotny 1993) ist ebenfalls diesem Verband zuzurechnen. Streptopus amplexifolius kommt demnach in verschiedenen Pflanzengesellschaften vor, wobei seine Standorte in der Regel durch feinerdereiche Böden und schattige, kühle, frische bis feuchte Verhältnisse gekennzeichnet sind, die auch andere Hochstaudenarten begünstigen. Verbreitung im Bundesland Salzburg Die Karte im Verbreitungsatlas der Salzburger Gefäßpflanzen (Wittmann et al. 1987) zeigte für den Europa-Knotenfuß zwar eine mehr oder weniger landesweite Verbreitung, aber ein sehr lückiges Areal. Nachweise für Vorkommen dieser Art lagen für insgesamt 65 Quadranten der mitteleuropäischen Florenkartierung im Bundesland Salzburg vor, wobei für vier Quadranten Angaben aus der Zeit vor 1900 stammten. Für den zentralen Bereich des Lungaus ergab sich ein geschlossenes Verbreitungsbild, allerdings stammten die Funde für neun Quadranten aus der Zeit von 1900 bis 1944 und gingen im Wesentlichen auf Vierhapper (1935) zurück. Seit 1987 hat sich der Kenntnisstand über die Verbreitung von Streptopus amplexifolius in Salzburg erheblich verbessert. Eine Auswertung der privaten Datenbank von HR Mag. Peter Pilsl ergab Meldungen für 21 zusätzliche Quadranten. Dabei sind auch publizierte Daten von Eichberger et al. (2006, 2012) sowie auf ihre Plausibilität geprüfte Angaben von Gewährsleuten großteils Mitglieder der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft (sabotag) enthalten. Zudem werden durch diese Nachweise mehrfach auch bereits im Verbreitungsatlas enthaltene Punkte bestätigt (vgl. z. B. Strobl 1988). Von der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur wurden für acht Quadranten Fundmeldungen beigesteuert, wobei es sich bei zwei davon um Bestätigungen älterer Angaben (vor 1945) handelt. Zu berücksichtigen ist bei diesen Daten aber, dass sie auch auf Herbarmaterial und damit teilweise auf älteren Belegen beruhen. Angaben für 36 Quadranten in der aktuellen Verbreitungskarte stammen aus der Biotopkartierung des Landes Salzburg, wobei zusätzlich zahlreiche bereits aus anderen Quellen vorhandene Punkte durch Biotopdaten untermauert wurden. Für fünf Lungauer Quadranten, für die nur ältere Angaben von Vierhapper (1935) vorlagen, wurden neuere Nachweise geliefert. Die Biotopkartierung, die in den Jahren 1992 bis 2008 landesweit im Erhebungsmaßstab 1:5.000 durchgeführt wurde (Nowotny & Hinterstoisser 1994, Nowotny 2009), stellt aufgrund der exakten geogra- 37
7 in den Hohen und Niederen Tauern, aber auch aus den Kalkalpen und teilweise aus den Schiefergebirgen der Grauwackenzone liegen neue Beobachtungen vor. Allerdings bestehen jedoch noch einige Lücken, wo eine gezielte Suche erfolgversprechend sein könnte. Für eine Art, deren Vorkommensschwerpunkt in der hochmontanen bis subalpinen Stufe liegt, wenig überraschend ist die geringe Nachweisdichte im Flachgau (politischer Bezirk Salzburg-Umgebung). Gefährdung und Schutz Aktuell bekannte Verbreitung des Europa-Knotenfußes (volle Symbole) im Bundesland Salzburg, zusammengestellt nach Wittmann et al (Kreise, voll Nachweise ab 1945, leer bis 1944), Angaben aus der Biotopkartierung (Dreiecke, vgl. Text) und ergänzenden Funddaten aus der privaten Datenbank Pilsl sowie der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur (Quadrate, vgl. Text). phischen Verortung grundsätzlich ideale Grundlagen für floristische Auswertungen zur Verfügung (vgl. Leitner et al. 2015). Bei einem Projekt dieser Größenordnung, an dem zahlreiche externe Personen beteiligt sind, besteht naturgemäß auch eine gewisse Fehleranfälligkeit (z. B. falsche Artbestimmung durch das Kartierungspersonal, Verwechslungen bei der Dateneingabe). Daher können Daten nicht ohne Plausibilitätsprüfung übernommen werden. Erfahrene Kartiererinnen und Kartierer sollten Streptopus amplexifolius im Gelände eigentlich problemlos korrekt ansprechen können, dennoch sind insbeson dere bei rein vegetativen Exemplaren Verwechslungen (beispielsweise mit Polygonatum multiflorum) nicht völlig auszuschließen. Es wurden daher nur Angaben übernommen, 38 für deren Richtigkeit auf Basis der Biotoptypen eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Die landesweite Biotopkartierung und die intensive floristische Erforschung des Bundeslandes, insbesondere durch die Aktivitäten der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft (sabotag), erbrachten seit dem Erscheinen des Verbreitungsatlasses der Salzburger Gefäßpflanzen (Wittmann et al. 1987) Angaben für 57 weitere Quadranten. Für sieben Quadranten, für die nur Funddaten aus der Zeit vor 1945 vorlagen, erfolgten aktuelle Nachweise. Der Kenntnisstand über die Verbreitung des Europa- Knotenfußes in Salzburg erfuhr damit nahezu eine Verdoppelung. Zu einer erheblichen Verdichtung des Verbreitungsbildes kam es vor allem Streptopus amplexifolius ist nach der Roten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (Wittmann et al. 1996) im Bundesland Salzburg nicht gefährdet. Österreichweit wird lediglich eine regionale Gefährdung in der Böhmischen Masse angegeben (Niklfeld & Schratt-Ehrendorfer 1999). Hohla et al. (2009) stufen hingegen die Art in der aktuellen Roten Liste für Oberösterreich für die Böhmische Masse als sehr selten (sehr wenige Vorkommen oder sehr kleine Populationen), aber aktuell ungefährdet (potenziell gefährdet) ein. Unter Berücksichtigung des aktuellen Verbreitungsbildes und der besiedelten Lebensräume ist für Salzburg derzeit weiterhin von keiner Gefährdung auszugehen. Obwohl ihr eine gewisse Attraktivität nicht abzusprechen ist, unterliegt die Art im Bundesland Salzburg keinen gesetzlichen Schutzbestimmungen (vgl. Thomasser et al. 2010). Mit Ausnahme des Hochwasserabflussbereichs eines dreißigjährlichen Hochwasserereignisses (HQ 30) entlang von Fließgewässern unterliegen die Biotope, in denen der Europa-Knotenfuß vorkommt, nicht dem gesetzlichen Lebensraumschutz gemäß 24 des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 idgf. Allerdings tritt er in verschiedenen Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat- (FFH-)Richtlinie auf (vgl. Ellmauer
8 & Traxler 2000). Die wichtigsten davon sind der Mitteleuropäische subalpine Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius (Natura 2000-Code 9140), Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) (Natura 2000-Code 9180*) und Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) (Natura 2000-Code 9410). Auch in Hochmontan-subalpinen Hochstaudenfluren (Natura 2000-Code 6432) kann Streptopus amplexifolius fallweise zu finden sein. Dank Ohne die Zusammenstellung und freundliche Übermittlung von Verbreitungsangaben aus der Biotopkartierungsdatenbank durch Frau Isolde Althaler, BSc, aus seiner privaten floristischen Fund- und Literaturdatenbank durch Herrn HR Mag. Peter Pilsl (Salzburg) und aus der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur durch Herrn Dr. Helmut Wittmann (Salzburg) wäre die Erstellung der aktuellen Verbreitungskarte nicht möglich gewesen, wofür ich meinen herzlichen Dank ausspreche. Literatur AESCHIMANN, D., LAUBER, K., MOSER, D.M. & THEURILLAT, J.-P., 2004: Flora alpina. Band 2 Gentianaceae Orchidaceae. Verlag Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, 1188 pp. EGGENBERG, S. & MÖHL, A., 2007: Flora Vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen Zustand. 1. Aufl., Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 680 pp. Eichberger, CH., Strobl, W. & Arming, C., 2006: Floristische Beiträge aus Salzburg VIII. Sauteria 14, Landschaft im Wandel, Verlag Alexander Just, Dorfbeuern/Salzburg: Eichberger, Ch., Arming, C. & Pflugbeil, G., 2012: Floristische und vegetationskundliche Beiträge aus Salzburg, XV. Mitt. Ges. Salzburger Landesk. (MGSL) 152: ELLENBERG, H., WEBER, H.E., DÜLL, R., WIRTH, V., WERNER, W. & PAULISSEN, D., 1992: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2. verb. u. erw. Aufl., Scripta Geobotanica XVIII, Verlag Erich Goltze, Göttingen, 258 pp. Ellmauer, T. & Traxler, A., 2000: Handbuch der FFH-Lebensraumtypen Österreichs. UBA-Monographien Bd. 130, 208 pp. FISCHER, M.A., OSWALD, K. & ADLER, W., 2008: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 3. Aufl., Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz, 1392 pp., ca. 800 Abb. GENAUST, H., 2005: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. 3. vollst. überarb. u. erw. Aufl., Nikol Verlagsgesellschaft mbh & Co. KG, Hamburg, 701 pp. Haeupler, H. & Muer, T., 2000: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 759 pp. HESS, H.E., LANDOLT, E. & HIRZEL, R., 1984: Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 2. überarb. Aufl., Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 657 pp. Hohla, M., Stöhr, O., Brandstätter, G., Danner, J., Diewald, W., Essl, F., Fiereder, H., Grims, F., Höglinger, F., Kleesadl, G., Kraml, A., Lenglachner, F., Lugmair, A., Nadler, K., Niklfeld, H., Schmalzer, A., Schratt-Ehrendorfer, L., Schröck, C., Strauch, M. & Wittmann, H., 2009: Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. Stapfia 91, Land Oberösterreich, Linz, 324 pp. Karner, P. & Mucina, L., 1993: Mulgedio- Aconitetea. In: Grabherr, G. & Mucina, L. (Hrsg.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II Natürliche waldfreie Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York: Lauber, K. & Wagner, G., 2001: Flora Helvetica. 3. überarb. Aufl., Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, 1615 pp. LEITNER, B., WITTMANN, H. & NOWOTNY, G., 2015: Der Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe L.) im Bundesland Salzburg (Österreich) eine Komplettanalyse historischer und aktueller Daten einer bedrohten Pflanzenart. Mitt. Haus der Natur 22: Lippert, W., 1981: Fotoatlas der Alpenblumen. Gräfe und Unzer, München, 260 pp. Morton, F., 1958: Über das Vorkommen von Streptopus amplexifolius (L.) DC im Hallstätter Salzbergtale (Vorarbeiten zu einer Pflanzengeographie des Salzkammergutes XLI.). Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt, Nr. 197, 9 pp. Niklfeld, H. & Schratt-Ehrendorfer, L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. In: Niklfeld, H. (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2. neubearb. Aufl., Grüne Reihe des BMUJF Bd. 10, Austria Medien Service, Graz: Nowotny, G., 1993: Die Pflanzenwelt im Bereich des Untersulzbachfalles und des Knappenweges. In: Seemann, R. (Red.): Geolehrpfad Knappenweg Untersulzbachtal. Naturkundlicher Führer zum Nationalpark Hohe Tauern, Band 10, Österreichischer Alpenverein (Hrsg.), Innsbruck: Nowotny, G., 2009: Die Biotopkartierung liegt landesweit vor. Ein Naturschutz-Großprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden., 16. Jg., Heft 1: Nowotny, G. & Hinterstoisser, H., 1994: Biotopkartierung Salzburg. Kartierungsanleitung. Naturschutz-Beiträge 14/94, Hrsg. vom Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 13, 247 pp. Oberdorfer, E., 1983: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. überarb. u. erg. Aufl., Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1051 pp. ROTHMALER, W. (Begr.), 2002: Exkursionsflora von Deutschland. Band 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 9., völlig neu bearb. Aufl., Hrsg: Jäger, E.J. & Werner, K., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 948 pp., 1202 Abb. SEYBOLD, S., 1998: 15. Streptopus Michaux 1803 Knotenfuß. In: Sebald, O., Seybold, S., Philippi, G. & Wörz, A. (Hrsg.): Die Farn und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 7: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklassen Alismatidae, Liliidae Teil 1, Commelinidae Teil 1) Butomaceae bis Poaceae. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim): Strobl, W., 1988: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, II. Mitt. Ges. Salzburger Landesk. (MGSL) 128: Thomasser, A., Bedek, W., Nowotny, G., Pilsl, P., Stöhr, O. & Wittmann, H., 2010: Geschützte Pflanzen in Salzburg. Erkennen und Bewahren. SLK Natur&Umwelt, Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH, Salzburg, 74 pp. VIERHAPPER, F, 1935: Vorarbeiten zu einer pflanzengeographischen Karte Österreichs. XIV. Vegetation und Flora des Lungau (Salzburg). Abh. zool.-bot. Ges. Wien 16(1): Wallnöfer, S., Mucina, L. & Grass, V., 1993: Querco-Fagetea. In: Mucina, L., Grabherr, G. & Wallnöfer, S. (Hrsg.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil III Wälder und Gebüsche. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York: Willner, W. & Grabherr, G., 2007a: Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 1 Textband. Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München, 302 pp. Willner, W. & Grabherr, G., 2007b: Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Ein Bestimmungswerk mit Tabellen. 2 Tabellenband. Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München, 290 pp. Wittmann, H., Pilsl, P. & Nowotny, G., 1996: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen des Bundeslandes Salzburg. 5. neubearb. Aufl., Naturschutz-Beiträge 8/96, Amt d. Salzburger Landesregierung, Ref. 13/02, 83 pp. Wittmann, H., Siebenbrunner, A., Pilsl, P. & Heiselmayer, P., 1987: Verbreitungsatlas der Salzburger Gefäßpflanzen. Sauteria 2, Abakus Verlag, Salzburg, 403 pp. Mag. Günther Nowotny 39
Von der Stiftung Naturschutz
 Von der Stiftung Naturschutz Hamburg und der Stiftung Loki Schmid wurde diese attraktive, in Feuchtlebensräumen beheimatete Art zur Blume des Jahres 2010 gewählt ein Prädikat, das auch in Österreich übernommen
Von der Stiftung Naturschutz Hamburg und der Stiftung Loki Schmid wurde diese attraktive, in Feuchtlebensräumen beheimatete Art zur Blume des Jahres 2010 gewählt ein Prädikat, das auch in Österreich übernommen
Gefährdete und geschützte Gefäßpflanzen
 Stadt Wolfsburg, Ortsteil Ehmen: B-Plan Sülpke B, 5. Änderung Gefährdete und geschützte Gefäßpflanzen Zweite Begehung im August 2017 Auftraggeber: Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung
Stadt Wolfsburg, Ortsteil Ehmen: B-Plan Sülpke B, 5. Änderung Gefährdete und geschützte Gefäßpflanzen Zweite Begehung im August 2017 Auftraggeber: Stadt Wolfsburg Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung
Bericht. Salzburg, am 24. November 2014
 GREENTEAM ARMING & EICHBERGER OG Mag a. Claudia ARMING Dr. Christian EICHBERGER Schallmooser Hauptstr. 37 A-5020 Salzburg claudia.arming@sbg.ac.at; 0676 93 656 93 christian.eichberger@sbg.ac.at; 0699 88
GREENTEAM ARMING & EICHBERGER OG Mag a. Claudia ARMING Dr. Christian EICHBERGER Schallmooser Hauptstr. 37 A-5020 Salzburg claudia.arming@sbg.ac.at; 0676 93 656 93 christian.eichberger@sbg.ac.at; 0699 88
Die vordere Umschlagseite dieser
 FACHBEITRÄGE Der Schwalbenwurz-Enzian im Bundesland Salzburg Die vordere Umschlagseite dieser Ausgabe von NaturLand Salzburg ziert ein Foto des im Spätsommer bis Herbst blühenden Schwalbenwurz-Enzians
FACHBEITRÄGE Der Schwalbenwurz-Enzian im Bundesland Salzburg Die vordere Umschlagseite dieser Ausgabe von NaturLand Salzburg ziert ein Foto des im Spätsommer bis Herbst blühenden Schwalbenwurz-Enzians
David Aeschimann, Konrad Lauber, Daniel Martin Moser, Jean-Paul Theurillat. Flora alpina
 David Aeschimann, Konrad Lauber, Daniel Martin Moser, Jean-Paul Theurillat Ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen Mit Farbfotografien von Konrad Lauber und Skizzen von Andre Michel Band 1 Lycopodiaceae-Apiaceae
David Aeschimann, Konrad Lauber, Daniel Martin Moser, Jean-Paul Theurillat Ein Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen Mit Farbfotografien von Konrad Lauber und Skizzen von Andre Michel Band 1 Lycopodiaceae-Apiaceae
Pflanzensoziologische Tabellenarbeit
 Pflanzensoziologische Tabellenarbeit VEG-1, Sommersemester 2010 Dr. Heike Culmsee Vegetationsanalyse & Phytodiversität Vegetationsökologische Grundlagen Zusammenhang der Begriffe Flora, Standort, Phytozönose
Pflanzensoziologische Tabellenarbeit VEG-1, Sommersemester 2010 Dr. Heike Culmsee Vegetationsanalyse & Phytodiversität Vegetationsökologische Grundlagen Zusammenhang der Begriffe Flora, Standort, Phytozönose
Natur Land. Naturschutz Partner zum Leben
 Natur Land Naturschutz Partner zum Leben Die Kriech-Nelkenwurz im Bundesland Salzburg Eine markante Pflanze in Felsschuttfluren der höchsten Lagen in unseren hauptsächlich von silikatischen Gesteinen aufgebauten
Natur Land Naturschutz Partner zum Leben Die Kriech-Nelkenwurz im Bundesland Salzburg Eine markante Pflanze in Felsschuttfluren der höchsten Lagen in unseren hauptsächlich von silikatischen Gesteinen aufgebauten
Zur Unterscheidung von Dipsacus pilosus L. und Dipsacus strigosus WILLDENOW ex ROEMER et SCHULTES
 Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2007) 12: 71-75 71 Zur Unterscheidung von Dipsacus pilosus L. und Dipsacus strigosus WILLDENOW ex ROEMER et SCHULTES Wolfgang Ahrens Dipsacus strigosus WILLDENOW
Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2007) 12: 71-75 71 Zur Unterscheidung von Dipsacus pilosus L. und Dipsacus strigosus WILLDENOW ex ROEMER et SCHULTES Wolfgang Ahrens Dipsacus strigosus WILLDENOW
Notizen Dessau. Interessante Funde Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora,
 Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
Notizen Dessau Nr. 4 Interessante Funde 2015 Eryngium planum, Leontodon saxatilis, Rumex scutatus, Vicia parviflora, Eryngium planum L. Das Grundstück Mannheimer Straße Ecke Junkers-Straße ist bis auf
Gradientenanalyse & Indikatorwerte nach Ellenberg
 Gradientenanalyse & Indikatorwerte nach Ellenberg Vegetationsanalyse 1 Sommer 2010 Dr. Heike Culmsee, Uni Göttingen Syntaxonomie versus Gradientenanalyse? Methoden zur Gliederung und Ordnung der Vegetation:
Gradientenanalyse & Indikatorwerte nach Ellenberg Vegetationsanalyse 1 Sommer 2010 Dr. Heike Culmsee, Uni Göttingen Syntaxonomie versus Gradientenanalyse? Methoden zur Gliederung und Ordnung der Vegetation:
Namenliste Gehölze, International standard ENA M. H. A. Hoffman 8. Auflage, 2010 Wageningen UR, Wageningen
 Quellen Der grosse Zander Band 1 und 2 Walter Erhardt et al., 2008 Eugen Ulmer, Stuttgart Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen 19. Auflage Walter Erhardt et al., 2014 Eugen Ulmer, Stuttgart Namenliste
Quellen Der grosse Zander Band 1 und 2 Walter Erhardt et al., 2008 Eugen Ulmer, Stuttgart Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen 19. Auflage Walter Erhardt et al., 2014 Eugen Ulmer, Stuttgart Namenliste
HERBARIUM SEK II. Hinweise zur Erstellung und Bewertung
 HERBARIUM SEK II Hinweise zur Erstellung und Bewertung Allgemeine Hinweise 1. Termin der Abgabe: legt Fachlehrer fest, 2. Anzahl der geforderten Arten: legt Fachlehrer fest, z.b.: 10 Blütenpflanzen aus
HERBARIUM SEK II Hinweise zur Erstellung und Bewertung Allgemeine Hinweise 1. Termin der Abgabe: legt Fachlehrer fest, 2. Anzahl der geforderten Arten: legt Fachlehrer fest, z.b.: 10 Blütenpflanzen aus
NATURA 2000 Artenvielfalt der Bergwälder Gerald Gimpl 21. November 2017, Oktogon am Himmel
 Gimpl NATURA 2000 Artenvielfalt der Bergwälder Gerald Gimpl 21. November 2017, Oktogon am Himmel Kontakt: Kuratorium Wald, Alser Straße 37/16, 1080 Wien Tel 01/406 59 38 15, gerald@wald.or.at Alpenschutz
Gimpl NATURA 2000 Artenvielfalt der Bergwälder Gerald Gimpl 21. November 2017, Oktogon am Himmel Kontakt: Kuratorium Wald, Alser Straße 37/16, 1080 Wien Tel 01/406 59 38 15, gerald@wald.or.at Alpenschutz
Modulcode Modulbezeichnung Zuordnung. Workload SWS ECTS (maximal) Kurse 1 Botanik. Fiebich Vorlesung ,0 2,50 75 (Wintersemester)
 Modulkatalog Modulverantwortlich Prof. Dr. Gesina Modulart Pflicht Angebotshäufigkeit Winter Regelbelegung / Empf. Semester 1. Semester Credits (ECTS) 8 Leistungsnachweis Prüfungsleistung Angeboten in
Modulkatalog Modulverantwortlich Prof. Dr. Gesina Modulart Pflicht Angebotshäufigkeit Winter Regelbelegung / Empf. Semester 1. Semester Credits (ECTS) 8 Leistungsnachweis Prüfungsleistung Angeboten in
Polytrichum commune Goldenes Frauenhaar, Gewöhnliches Widertonmoos (Polytrichaceae), Moos des Jahres 2010
 Polytrichum commune Goldenes Frauenhaar, Gewöhnliches Widertonmoos (Polytrichaceae), Moos des Jahres 2010 1 Einleitung CORINNE BUCH Das Moos des Jahres wird von der Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft
Polytrichum commune Goldenes Frauenhaar, Gewöhnliches Widertonmoos (Polytrichaceae), Moos des Jahres 2010 1 Einleitung CORINNE BUCH Das Moos des Jahres wird von der Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft
Androsacion alpinae Alpine Silikatschuttflur. Lebensraumbeschrieb
 Lebensraum 3.3.2.2 Alpine Silikatschuttflur Lebensraumbeschrieb PLZ, Ort Flurname Koordinaten Höhe Exposition Datum der Aufnahme Ausprägung und Ökologie Geologie, Bodenkunde und Entstehung Nutzung, Störung
Lebensraum 3.3.2.2 Alpine Silikatschuttflur Lebensraumbeschrieb PLZ, Ort Flurname Koordinaten Höhe Exposition Datum der Aufnahme Ausprägung und Ökologie Geologie, Bodenkunde und Entstehung Nutzung, Störung
KostProbe Seiten. So bestimmst du Blütenpflanzen
 Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Hier haben wir etwas für Sie: So bestimmst du Blütenpflanzen Arbeitsblatt Lösungen Sie suchen sofort einsetzbare, lehrwerkunabhängige Materialien, die didaktisch perfekt aufbereitet sind? Dazu bieten Ihnen
Jahrb. Bochumer Bot. Ver
 Stachys sylvatica (Wald-Ziest), S. palustris (Sumpf-Ziest) und ihre Hybride S. ambigua (Zweifelhafter Ziest) in Nordrhein-Westfalen, mit Anmerkungen zu S. alpina (Alpen-Ziest) F. WOLFGANG BOMBLE 1 Einleitung
Stachys sylvatica (Wald-Ziest), S. palustris (Sumpf-Ziest) und ihre Hybride S. ambigua (Zweifelhafter Ziest) in Nordrhein-Westfalen, mit Anmerkungen zu S. alpina (Alpen-Ziest) F. WOLFGANG BOMBLE 1 Einleitung
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT
 FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
FAKTENBLATT 3 ENTWICKLUNG UND ZUSTAND DER BIODIVERSITÄT IN DER SCHWEIZ UND IM KANTON BERN Weshalb verändert sich die Biodiversität? Die Biodiversität verändert sich zum einen durch langfristige und grossräumige
Esche & Co. Zum Pollenflug im Zeitraum März bis Mai. Die Gemeine Esche. Newsletter Nr
 Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Newsletter Nr. 7-2008 Esche & Co Die windblütige Esche ist vielen Pollenallergiker bekannt. Doch wenn es um den Unterschied zwischen Gemeiner Esche, Manna-Esche und Eschen-Ahorn geht, sind die Begriffe
Hybridisierung in der Gattung Salix in Brandenburg. Michael Ristow
 Hybridisierung in der Gattung Salix in Brandenburg Michael Ristow Warum sind Weiden schwierig zu bestimmen? - Artenzahl - Merkmale sind ohne Übung nicht immer leicht einzuschätzen - Große Variabilität
Hybridisierung in der Gattung Salix in Brandenburg Michael Ristow Warum sind Weiden schwierig zu bestimmen? - Artenzahl - Merkmale sind ohne Übung nicht immer leicht einzuschätzen - Große Variabilität
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer
 150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
Fauna und Flora von Salzburg: Interessante Pflanzenfunde 2014 Michael Kurz
 Fauna und Flora von Salzburg: Interessante Pflanzenfunde 2014 Michael Kurz Imprint owner of the media and publisher: NATURKUNDLICHE GESELLSCHAFT ZVR-no. 056544907 contact: Mag. Michael Kurz address: Josef-Waach-Str.
Fauna und Flora von Salzburg: Interessante Pflanzenfunde 2014 Michael Kurz Imprint owner of the media and publisher: NATURKUNDLICHE GESELLSCHAFT ZVR-no. 056544907 contact: Mag. Michael Kurz address: Josef-Waach-Str.
Liliaceae Liliengewächse (Liliales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Liliaceae Liliengewächse (Liliales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie 1 Systematik und Verbreitung Zur Familie der Liliaceae aus der Ordnung Liliales (Magnoliopsida, Monokotyledoneae)
1 Liliaceae Liliengewächse (Liliales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie 1 Systematik und Verbreitung Zur Familie der Liliaceae aus der Ordnung Liliales (Magnoliopsida, Monokotyledoneae)
WINALP-Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald
 -Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald Jörg Ewald*, Karl Mellert**, Birgit Reger* * Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ** Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Einführung:
-Typen als Befundeinheiten für Klimarisiken im Bergwald Jörg Ewald*, Karl Mellert**, Birgit Reger* * Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ** Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Einführung:
Zur Anwendung der Datei
 Zur Anwendung der Datei Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich Band (Jahr): 125 (1995) PDF erstellt am: 27.10.2017
Zur Anwendung der Datei Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich Band (Jahr): 125 (1995) PDF erstellt am: 27.10.2017
STATION 1: MISCHWALD
 STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 Zürich 2014
 Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 Zürich 2014 Prüfung zusammengestellt von Matthias Baltisberger und Constanze Conradin Prüfung: Zürich, Dienstag, 5.8.2014 Name Vorname 1. Biogeographische Regionen der
Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 Zürich 2014 Prüfung zusammengestellt von Matthias Baltisberger und Constanze Conradin Prüfung: Zürich, Dienstag, 5.8.2014 Name Vorname 1. Biogeographische Regionen der
Rubiaceae Rötegewächse (Gentianales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie
 1 Rubiaceae Rötegewächse (Gentianales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie 1 Systematik und Verbreitung Zu der großen Familie der Rötegewächse aus der Ordnung Gentianales (Magnoliopsida,
1 Rubiaceae Rötegewächse (Gentianales) Dr. VEIT M. DÖRKEN, Universität Konstanz, FB Biologie 1 Systematik und Verbreitung Zu der großen Familie der Rötegewächse aus der Ordnung Gentianales (Magnoliopsida,
Verbreitungsbilder einiger Leguminosen im Allgäu.
 Mitt. Natwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 34 - Folge 2: 45-50 (Juli 1996) ISSN 0344-5054 Verbreitungsbilder einiger Leguminosen im Allgäu. Von Johann BAUER, Marktoberdorf Durch eine immer gründlichere
Mitt. Natwiss. Arbeitskr. Kempten Jahrgang 34 - Folge 2: 45-50 (Juli 1996) ISSN 0344-5054 Verbreitungsbilder einiger Leguminosen im Allgäu. Von Johann BAUER, Marktoberdorf Durch eine immer gründlichere
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG
 UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG Artemisia tournefortiana Reichenb. als neue Autobahn- Pflanze Artemisia tournefortiana Reichenb. new at highways in Germany Dietmar Brandes http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021461
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BRAUNSCHWEIG Artemisia tournefortiana Reichenb. als neue Autobahn- Pflanze Artemisia tournefortiana Reichenb. new at highways in Germany Dietmar Brandes http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00021461
IV. Literatur. Literatur... VI.
 Inhalt Einleitung.............................. 1. \X/arum machen wir botanische Exkursionen, wie sollten sie durchgeführt werden?......... 2. Die l\uswahl der Exkursionen 2 3. Die thematischen Schwerpunkte
Inhalt Einleitung.............................. 1. \X/arum machen wir botanische Exkursionen, wie sollten sie durchgeführt werden?......... 2. Die l\uswahl der Exkursionen 2 3. Die thematischen Schwerpunkte
Hochstaudenfluren mit Senecio cacaliaster
 Hochstaudenfluren mit Senecio cacaliaster Tall-herb communities with Senecio cacaliaster Dietmar Brandes, Braunschweig An den Nordhängen der Karnischen Alpen fallen im Bereich der Plöckenpaßstraße sehr
Hochstaudenfluren mit Senecio cacaliaster Tall-herb communities with Senecio cacaliaster Dietmar Brandes, Braunschweig An den Nordhängen der Karnischen Alpen fallen im Bereich der Plöckenpaßstraße sehr
Notizen zur Flora der Steiermark
 Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
Notizen zur Flora der Steiermark Nr. 4 1978 Inhalt HAEELLNER J.: Zur Unterscheidung der steirischen Fu/naria-Arten... 1 TRACEY R.: Festuca ovina agg. im Osten Österreichs- Bestimmungsschlüssel und kritische
Draba subgen. Erophila Hungerblümchen (Brassicaceae)
 Draba subgen. Erophila Hungerblümchen (Brassicaceae) CORINNE BUCH & ARMIN JAGEL 1 Einleitung Zu den bekannten Arten, die in warmen Wintern manchmal schon kurz nach dem Jahreswechsel blühen, zählen Frühjahrsgeophyten
Draba subgen. Erophila Hungerblümchen (Brassicaceae) CORINNE BUCH & ARMIN JAGEL 1 Einleitung Zu den bekannten Arten, die in warmen Wintern manchmal schon kurz nach dem Jahreswechsel blühen, zählen Frühjahrsgeophyten
Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 (Teil Zusatzkenntnisse) Zürich 2016
 Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 (Teil Zusatzkenntnisse) Zürich 2016 Matthias Baltisberger 9 Fragen, maximale Punktzahl 88.5 Prüfung: Zürich, Dienstag, 26.7.2016 Name Vorname 1. Biogeographische Regionen
Zertifikat Feldbotanik Stufe 600 (Teil Zusatzkenntnisse) Zürich 2016 Matthias Baltisberger 9 Fragen, maximale Punktzahl 88.5 Prüfung: Zürich, Dienstag, 26.7.2016 Name Vorname 1. Biogeographische Regionen
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume. Acer platanoides. Diplomarbeit von Jennifer Burghoff. Fachbereich Gestaltung. Kommunikationsdesign
 Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
Eine Exkursion in das Reich der deutschen Bäume SPITZ AHORN Acer platanoides Diplomarbeit von Jennifer Burghoff WS 06/07 Hochschule Darmstadt Fachbereich Gestaltung Kommunikationsdesign Eine Exkursion
1 Einleitung Das Holz der Eberesche Eigenschaften und Aussehen des Holzes Verwendung des Holzes...
 Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Aktuelles über das Projekt Flora von Österreich": Eine Wiki-Internet-Flora
 Sauteria 16, 2008 Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at 13. Österreichische Botanikertreffen 265-269 Aktuelles über das Projekt Flora von Österreich":
Sauteria 16, 2008 Verlag Alexander Just: Dorfbeuern - Salzburg - Brüssel; download unter www.biologiezentrum.at 13. Österreichische Botanikertreffen 265-269 Aktuelles über das Projekt Flora von Österreich":
Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009
 Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009 Verbreitung: Der Bergahorn ist die am meisten verbreitete Ahornart in Deutschland. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Norddeutschen
Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) Baum des Jahres 2009 Verbreitung: Der Bergahorn ist die am meisten verbreitete Ahornart in Deutschland. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Norddeutschen
Moorpflanzen. Moorpflanzen Webcode: teich662
 Moorpflanzen Webcode: teich662 Andromeda polifolia Kahle Rosmarinheide Ericaceae, Heidekrautgewächse Heimat: Nordeuropa, Sibirien, N-Asien, N- Amerika. Wuchsform: Zwergstrauch, dünne Triebe. Blatt: Immergrün,
Moorpflanzen Webcode: teich662 Andromeda polifolia Kahle Rosmarinheide Ericaceae, Heidekrautgewächse Heimat: Nordeuropa, Sibirien, N-Asien, N- Amerika. Wuchsform: Zwergstrauch, dünne Triebe. Blatt: Immergrün,
Grenzgänger: Heilpflanzen des Waldgrenz- Ökotons am Hochschwab, Steiermark
 Grenzgänger: Heilpflanzen des Waldgrenz- Ökotons am Hochschwab, Steiermark Universität Wien, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie Studien: Kultur- und Sozialanthropologie und Naturschutzbiologie,
Grenzgänger: Heilpflanzen des Waldgrenz- Ökotons am Hochschwab, Steiermark Universität Wien, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie Studien: Kultur- und Sozialanthropologie und Naturschutzbiologie,
UTB Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage. Uni-Taschenbücher 986
 Uni-Taschenbücher 986 UTB Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart Wilhelm Fink Verlag München Gustav Fischer Verlag Stuttgart Francke Verlag München Paul Haupt Verlag
Uni-Taschenbücher 986 UTB Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart Wilhelm Fink Verlag München Gustav Fischer Verlag Stuttgart Francke Verlag München Paul Haupt Verlag
DIE PILZE ÖSTERREICHS VERZEICHNIS UND ROTE LISTE 2016 Teil: Makromyzeten
 ISBN 978-3-9504410-0-0 DIE PILZE ÖSTERREICHS VERZEICHNIS UND ROTE LISTE 2016 Teil: Makromyzeten Dieses Buch ist ein Verzeichnis und die Rote Liste 2016 der in Österreich bisher festgestellten Basidienpilze
ISBN 978-3-9504410-0-0 DIE PILZE ÖSTERREICHS VERZEICHNIS UND ROTE LISTE 2016 Teil: Makromyzeten Dieses Buch ist ein Verzeichnis und die Rote Liste 2016 der in Österreich bisher festgestellten Basidienpilze
Lebensraumansprüche. Das große Rasenstück Albrecht Dürer Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel
 Kurs Vernetzungsberatung Lebensraumansprüche Luc Lienhard FLORA Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel Geschichte Das große Rasenstück Albrecht Dürer 1503 1 Die Schweiz vor 20 Millionen Jahren Luzern vor
Kurs Vernetzungsberatung Lebensraumansprüche Luc Lienhard FLORA Biologe, Büro NATUR&GESCHICHTE, Biel Geschichte Das große Rasenstück Albrecht Dürer 1503 1 Die Schweiz vor 20 Millionen Jahren Luzern vor
Herzlichen Glückwunsch! Das Thema der heutigen Show: Knabenkräuter
 Knabenkräuter: Infoblatt 1 Herzlichen Glückwunsch! Das Casting-Team der Millionenshow hat dich ausgewählt und lädt dich ein dein Wissen zu testen. Mit etwas Glück kannst du die Millionenfrage knacken.
Knabenkräuter: Infoblatt 1 Herzlichen Glückwunsch! Das Casting-Team der Millionenshow hat dich ausgewählt und lädt dich ein dein Wissen zu testen. Mit etwas Glück kannst du die Millionenfrage knacken.
Die heimischen Ginsterarten
 Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT
 FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT MARIA STEJSKAL-TIEFENBACH, THOMAS ELLMAUER FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD INHALT Wald in Österreich Waldtypen und Wald-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT MARIA STEJSKAL-TIEFENBACH, THOMAS ELLMAUER FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD INHALT Wald in Österreich Waldtypen und Wald-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis
 Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (Kiel. Not. Pflanzenkd.) 41: 98 104 (2015/2016) Neues von Rubus plicatus und Rubus integribasis Hans-Oluf Martensen Kurzfassung Vom häufigen Rubus plicatus sind vom Typischen
SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE
 Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Bodeneigenschaften und Höhere Pflanzen von Hans-Helmut Poppendieck Biozentrum Klein-Flottbek
 Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung Loki Schmidt zum Schutze gefährdeter Pflanzen und Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg Workshop: Bodenschutz eine Aufgabe des Naturschutzes? 24.01.2006
Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung Loki Schmidt zum Schutze gefährdeter Pflanzen und Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg Workshop: Bodenschutz eine Aufgabe des Naturschutzes? 24.01.2006
Tragopogon Bocksbart (Asteraceae) in Nordrhein-Westfalen
 Tragopogon Bocksbart (Asteraceae) in Nordrhein-Westfalen F. WOLFGANG BOMBLE 1 Einleitung Die Gattung Tragopogon (Bocksbart) gehört zu den zungenblütigen Korbblütlern (Asteraceae Unterfamilie Cichorioideae).
Tragopogon Bocksbart (Asteraceae) in Nordrhein-Westfalen F. WOLFGANG BOMBLE 1 Einleitung Die Gattung Tragopogon (Bocksbart) gehört zu den zungenblütigen Korbblütlern (Asteraceae Unterfamilie Cichorioideae).
Naturnahe, reich strukturierte Bergwälder bilden aufgrund ihrer Vielzahl an ökologischen Nischen Lebensraum für viele Vogelarten.
 Naturnahe, reich strukturierte Bergwälder bilden aufgrund ihrer Vielzahl an ökologischen Nischen Lebensraum für viele Vogelarten. Welche 2 Vögel gibt es hier im Gebirge nicht? Streiche die falschen Vögel
Naturnahe, reich strukturierte Bergwälder bilden aufgrund ihrer Vielzahl an ökologischen Nischen Lebensraum für viele Vogelarten. Welche 2 Vögel gibt es hier im Gebirge nicht? Streiche die falschen Vögel
NRW. Merkblatt zur Artenförderung. Pfaffenhütchen. Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF)
 Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Pfaffenhütchen Bedrohung und Förderung des Pfaffenhütchens - Euonymus europaeus Obwohl
Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen (LÖBF) NRW. Merkblatt zur Artenförderung Pfaffenhütchen Bedrohung und Förderung des Pfaffenhütchens - Euonymus europaeus Obwohl
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. Art Ab 15. Februar. März April Mai Juni Juli.
 Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Trage den Beginn und die Dauer der Blütezeit ein. Benutze dafür die Blumensteckbriefe. F r ü h l i n g s k a l e n d e r der Frühblüher Krokus Art Ab 15. Februar März April Mai Juni Juli Leberblümchen
Kaukasischer Beinwell (Symphytum caucasicum M. BIEB.) und Hidcote-Beinwell (Symphytum hidcotense P. D. SELL) im Aachener Raum
 Kaukasischer Beinwell (Symphytum caucasicum M. BIEB.) und Hidcote-Beinwell (Symphytum hidcotense P. D. SELL) im Aachener Raum F. WOLFGANG BOMBLE & BRUNO G. A. SCHMITZ Kurzfassung Es werden zwei neophytische
Kaukasischer Beinwell (Symphytum caucasicum M. BIEB.) und Hidcote-Beinwell (Symphytum hidcotense P. D. SELL) im Aachener Raum F. WOLFGANG BOMBLE & BRUNO G. A. SCHMITZ Kurzfassung Es werden zwei neophytische
Zur Bestandesentwicklung der Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris GAUDIN) im Bundesland Salzburg
 Zur Bestandesentwicklung der Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris GAUDIN) im Bundesland Salzburg Abstract On the development of the stand of Gladiolus palustris GAUDIN in the Federal State of Salzburg (Austria)
Zur Bestandesentwicklung der Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris GAUDIN) im Bundesland Salzburg Abstract On the development of the stand of Gladiolus palustris GAUDIN in the Federal State of Salzburg (Austria)
Flora von Niederrohrdorf
 Ziele Übersicht schaffen über die Pflanzenarten in Niederrohrdorf aktuell vorkommende Arten nicht mehr vorkommende bzw. nicht mehr aufgefundene Arten Aktuell gefährdete Arten Grundlagen für Schutz- und
Ziele Übersicht schaffen über die Pflanzenarten in Niederrohrdorf aktuell vorkommende Arten nicht mehr vorkommende bzw. nicht mehr aufgefundene Arten Aktuell gefährdete Arten Grundlagen für Schutz- und
Baldellia ranunculoides Gewöhnlicher Igelschlauch (Alismataceae), Wasserpflanze des Jahres 2013
 Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 5 167-172 2014 Baldellia ranunculoides Gewöhnlicher Igelschlauch (Alismataceae), Wasserpflanze des Jahres 2013 PETER GAUSMANN 1 Einleitung Von den in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen
Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 5 167-172 2014 Baldellia ranunculoides Gewöhnlicher Igelschlauch (Alismataceae), Wasserpflanze des Jahres 2013 PETER GAUSMANN 1 Einleitung Von den in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen
Aufruf zur Mithilfe bei der Meldung und Bekämpfung von Neophyten
 Aufruf zur Mithilfe bei der Meldung und Bekämpfung von Neophyten Neophytensind Pflanzen, die unter bewusster oder unbewusster, direkter oder indirekter Mithilfe des Menschen nach 1492 zu uns gelangt sind.
Aufruf zur Mithilfe bei der Meldung und Bekämpfung von Neophyten Neophytensind Pflanzen, die unter bewusster oder unbewusster, direkter oder indirekter Mithilfe des Menschen nach 1492 zu uns gelangt sind.
Im Jahr 2011 wurde von der Salzburger
 Die Gewöhnliche Natternzunge im Bundesland Salzburg Die mühevolle Suche nach einem schwer nachweisbaren Farn Im Jahr 2011 wurde von der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft (sabotag) das Vorkommen
Die Gewöhnliche Natternzunge im Bundesland Salzburg Die mühevolle Suche nach einem schwer nachweisbaren Farn Im Jahr 2011 wurde von der Salzburger Botanischen Arbeitsgemeinschaft (sabotag) das Vorkommen
Pflanzenporträt: Magnolia spp. Magnolien (Magnoliacae)
 Pflanzenporträt: Magnolia spp. Magnolien (Magnoliacae) VEIT DÖRKEN & ARMIN JAGEL Früh im Jahr blühen die Magnolien und zwar die meisten von ihnen schon vor der Blattentwicklung (Abb. 1 & 2). Da sie außerdem
Pflanzenporträt: Magnolia spp. Magnolien (Magnoliacae) VEIT DÖRKEN & ARMIN JAGEL Früh im Jahr blühen die Magnolien und zwar die meisten von ihnen schon vor der Blattentwicklung (Abb. 1 & 2). Da sie außerdem
1. Die Gattung Prunus in Mitteleuropa 2. Verbreitung der Vogel-Kirsche 3. Morphologie der Vogel-Kirsche
 Die Vogelkirsche (Prunus avium) Verwandtschaft, Verbreitung und Biologie ten ogisch-botanischer art. Aas ǀ Ökolo Fotos von - O. Holdenrieder, - M. Lauerer, -. Aas 1. Die attung Prunus in Mitteleuropa 2.
Die Vogelkirsche (Prunus avium) Verwandtschaft, Verbreitung und Biologie ten ogisch-botanischer art. Aas ǀ Ökolo Fotos von - O. Holdenrieder, - M. Lauerer, -. Aas 1. Die attung Prunus in Mitteleuropa 2.
Prüfung Feldbotanikkurs 2009/10: Musterfragen
 Morphologie/Blütenbiologie Benennen/skizzieren von morphologischen Elementen Frage a) Beschrifte nebenstehende Abbildung b) Skizziere eine Spirre (Blütenstand) c) Nenne einen morphologischen Unterschied
Morphologie/Blütenbiologie Benennen/skizzieren von morphologischen Elementen Frage a) Beschrifte nebenstehende Abbildung b) Skizziere eine Spirre (Blütenstand) c) Nenne einen morphologischen Unterschied
Artbeschreibung. Vorkommen und Bestandssituation
 Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides (L.) Rchb. Artbeschreibung Die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) gehört zur Pflanzenfamilie der Korbblütengewächse (Abb. 1). Die ausdauernde Art erreicht eine
Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides (L.) Rchb. Artbeschreibung Die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) gehört zur Pflanzenfamilie der Korbblütengewächse (Abb. 1). Die ausdauernde Art erreicht eine
NEOPHYTEN UND INVASIVE ARTEN
 Quelle: Eigene Bilder NEOPHYTEN UND INVASIVE ARTEN Gliederung 1 1. Thema der Bachelorarbeit 2. Begriffsklärung 3. Relevanz des Themas 4. Fragestellung 5. Methodik 1) Thema der Bachelorarbeit 2 Auswirkungen
Quelle: Eigene Bilder NEOPHYTEN UND INVASIVE ARTEN Gliederung 1 1. Thema der Bachelorarbeit 2. Begriffsklärung 3. Relevanz des Themas 4. Fragestellung 5. Methodik 1) Thema der Bachelorarbeit 2 Auswirkungen
BEWOHNER DER AU STELLEN SICH VOR Artenportraits ausgewählter Pflanzen
 BEWOHNER DER AU STELLEN SICH VOR Artenportraits ausgewählter Pflanzen Lena Nicklas Gipskraut auf einer Schotterbank am Inn. Foto: Anna Schöpfer Klein: Detailaufnahme zweier Blüten des Gipskrauts. Kriechendes
BEWOHNER DER AU STELLEN SICH VOR Artenportraits ausgewählter Pflanzen Lena Nicklas Gipskraut auf einer Schotterbank am Inn. Foto: Anna Schöpfer Klein: Detailaufnahme zweier Blüten des Gipskrauts. Kriechendes
Farn- und Samenpflanzen in Europa
 Farn- und Samenpflanzen in Europa Mit Bestimmungsschlüsseln bis zu den Gattungen 8 Hans Oluf Martensen und Wilfried Probst 51 Abbildungen, 21 Übersichten und 233 illustrierte Bestimmungstabellen mit über
Farn- und Samenpflanzen in Europa Mit Bestimmungsschlüsseln bis zu den Gattungen 8 Hans Oluf Martensen und Wilfried Probst 51 Abbildungen, 21 Übersichten und 233 illustrierte Bestimmungstabellen mit über
Libellen Österreichs
 Libellen Österreichs Bearbeitet von Rainer Raab, Andreas Chovanec, Josef Pennerstorfer, Kurt Hostettler, Gerold Laister, Christoph Lange, Heidemarie Lang, Gerhard Lehmann, Johann Waringer 1. Auflage 2006.
Libellen Österreichs Bearbeitet von Rainer Raab, Andreas Chovanec, Josef Pennerstorfer, Kurt Hostettler, Gerold Laister, Christoph Lange, Heidemarie Lang, Gerhard Lehmann, Johann Waringer 1. Auflage 2006.
Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en
 Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart CIP-Kurztitelaufnahme
Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennam en Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart CIP-Kurztitelaufnahme
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
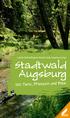 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Pflanzen und Tiere am Flughafen
 Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass am Flughafen besondere Pflanzen wachsen und dass dort seltene Tiere wohnen. Sie merken sich einige
Lehrerkommentar OST Ziele Arbeitsauftrag Material Sozialform Zeit Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass am Flughafen besondere Pflanzen wachsen und dass dort seltene Tiere wohnen. Sie merken sich einige
Sachkunde: Baum-Ratespiel
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 3 Methodisch-didaktische Hinweise... 3 Abstract... 4 Die Lärche... 4 Eberesche (Vogelbeerbaum)... 5 Gemeine Hasel (Haselnussbaum)... 5 Buche (Rotbuche)... 6 Platane
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 3 Methodisch-didaktische Hinweise... 3 Abstract... 4 Die Lärche... 4 Eberesche (Vogelbeerbaum)... 5 Gemeine Hasel (Haselnussbaum)... 5 Buche (Rotbuche)... 6 Platane
Naturschutzbund Tirol
 Naturschutzbund Tirol 14.02.2011 Kontakt Die Kramsacher Loar Abb 1: Die unter Wasser stehende Loar in Blickrichtung Osten. Abb.2: Die trockengefallene Loar in Blickrichtung Osten. 1 von 5 04.11.17 06:36
Naturschutzbund Tirol 14.02.2011 Kontakt Die Kramsacher Loar Abb 1: Die unter Wasser stehende Loar in Blickrichtung Osten. Abb.2: Die trockengefallene Loar in Blickrichtung Osten. 1 von 5 04.11.17 06:36
Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen
 Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Zweite, verbesserte Auflage 1983 Springer Basel AG CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Genaust, Helmut: Etymologisches
Helmut Genaust Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen Zweite, verbesserte Auflage 1983 Springer Basel AG CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Genaust, Helmut: Etymologisches
Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Online-Ergänzung. Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9.
 Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9. Klasse CLAAS WEGNER MAX BENTRUP CAROLINE MÜLLER Online-Ergänzung MNU 66/6 (1.9.2013) Seiten
Wehrlose Pflanzen? Von wegen! Wie sich Pflanzen vor Fraßfeinden schützen eine Unterrichtseinheit für die 7. 9. Klasse CLAAS WEGNER MAX BENTRUP CAROLINE MÜLLER Online-Ergänzung MNU 66/6 (1.9.2013) Seiten
Bärlappe in der Grenzregion De wolfsklauwen in de grensstreek
 Eco Top 30. Sept. 2017 Bärlappe in der Grenzregion De wolfsklauwen in de grensstreek Kreis Viersen, NRW Dipl. Biol. Norbert Neikes Biologische Station Krickenbecker Seen Copyright Biologische Station Krickenbecker
Eco Top 30. Sept. 2017 Bärlappe in der Grenzregion De wolfsklauwen in de grensstreek Kreis Viersen, NRW Dipl. Biol. Norbert Neikes Biologische Station Krickenbecker Seen Copyright Biologische Station Krickenbecker
Klimawandel: lokales und regionales Naturschutzmanagement
 Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen Klimawandel: lokales und regionales Naturschutzmanagement Expertenrunde am 31.03.2011 in Hannover Dipl.-Ing.
Regionales Management von Klimafolgen in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen Klimawandel: lokales und regionales Naturschutzmanagement Expertenrunde am 31.03.2011 in Hannover Dipl.-Ing.
19. ÖGA Jahrestagung. Innsbruck
 Indikatoren der Biodiversität t in Agrarlandschaften Johannes Rüdisser, Erich Tasser & Ulrike Tappeiner Innsbruck 25. 9. 2009 Begriffe Biodiversität... beschreibt die komplexe Vielfalt lebender Systeme:
Indikatoren der Biodiversität t in Agrarlandschaften Johannes Rüdisser, Erich Tasser & Ulrike Tappeiner Innsbruck 25. 9. 2009 Begriffe Biodiversität... beschreibt die komplexe Vielfalt lebender Systeme:
Fossiler Zapfen von Picea omorika (PANCIC) PURKYNE
 Carinthia II 183./103. Jahrgang S. 479-483 Klagenfurtl993 Fossiler Zapfen von Picea omorika (PANCIC) PURKYNE Von Adolf FRITZ Mit 5 Abbildungen In der geologisch-paläontologischen Sammlung des Landesmuseums
Carinthia II 183./103. Jahrgang S. 479-483 Klagenfurtl993 Fossiler Zapfen von Picea omorika (PANCIC) PURKYNE Von Adolf FRITZ Mit 5 Abbildungen In der geologisch-paläontologischen Sammlung des Landesmuseums
Stumpfblättriger Ampfer ( Rumex obtusifolius)
 Stumpfblättriger Ampfer ( Rumex obtusifolius) Werner Roth DLR Eifel 06/04/2005 beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel (DLR Eifel) Beratungsbezirk Landesweite Koordination Morphologie Physiologie
Stumpfblättriger Ampfer ( Rumex obtusifolius) Werner Roth DLR Eifel 06/04/2005 beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel (DLR Eifel) Beratungsbezirk Landesweite Koordination Morphologie Physiologie
Die zwei Seiten von Beweidung und botanischem Artenschutz
 Die zwei Seiten von Beweidung und botanischem Artenschutz Dr. Jörg Weise HGON und BVNH Herbsttagung 30./31.10.2010 in Echzell Ausgangssituation Pflegeproblem von Nutzökosystemen Zuviel Pflege Zuwenig Pflege
Die zwei Seiten von Beweidung und botanischem Artenschutz Dr. Jörg Weise HGON und BVNH Herbsttagung 30./31.10.2010 in Echzell Ausgangssituation Pflegeproblem von Nutzökosystemen Zuviel Pflege Zuwenig Pflege
Die ersten Frühblüher
 Die ersten Frühblüher im Botanischen Garten Berlin Ein Erkundungsgang für die Grundschule im frühen Frühling Impressum Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin & Botanikschule Berlin, 2018 Autor:
Die ersten Frühblüher im Botanischen Garten Berlin Ein Erkundungsgang für die Grundschule im frühen Frühling Impressum Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin & Botanikschule Berlin, 2018 Autor:
Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von
 Atalanta (Dezember 1992) 23(3/4):589-591, Würzburg, ISSN 0171-0079 Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von Gerhard Schadewald
Atalanta (Dezember 1992) 23(3/4):589-591, Würzburg, ISSN 0171-0079 Eine zweite Art der Gattung Phlogophora Treitschke, 1825: Phlogophora lamii spec. nov. (Lepldoptera, Noctuidae) von Gerhard Schadewald
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora. Fotodokumentation einiger Zielarten
 Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana
 Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Gehölze Gewöhnliche Haselnuss Corylus avellana Blütenfarbe: grünlich Blütezeit: März bis April Wuchshöhe: 400 600 cm mehrjährig Die Hasel wächst bevorzugt in ozeanischem
30 Millionen Datensätze zeigen die Pflanzenvielfalt Deutschlands. Vorstellung des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands
 30 Millionen Datensätze zeigen die Pflanzenvielfalt Deutschlands Vorstellung des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands
30 Millionen Datensätze zeigen die Pflanzenvielfalt Deutschlands Vorstellung des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands
Die gemäßigten Zonen (Waldländer) VORSCHAU. natürliche Vegetation: Buchen, Eichen, Linden, Pappeln, Birken
 Paris/Frankreich 50 m Typisches Klimadiagra Verbreitung der Waldländer Die gemäßigten Zonen (Waldländer) T = 10 N = 560-300 natürliche Vegetation: Buchen, Eichen, Linden, Pappeln, Birken intensive Landwirtschaft,
Paris/Frankreich 50 m Typisches Klimadiagra Verbreitung der Waldländer Die gemäßigten Zonen (Waldländer) T = 10 N = 560-300 natürliche Vegetation: Buchen, Eichen, Linden, Pappeln, Birken intensive Landwirtschaft,
Aktion Feld-Rittersporn. Jetzt finden und mitmachen! feldrittersporn
 Aktion Feld-Rittersporn Jetzt finden und mitmachen! Jetzt finden und mitmachen! Aktion Feld-Rittersporn www.natur.sachsen.de/ feldrittersporn Was sind Ackerwildkräuter? Ackerwildkräuter werden auch Segetalpflanzen
Aktion Feld-Rittersporn Jetzt finden und mitmachen! Jetzt finden und mitmachen! Aktion Feld-Rittersporn www.natur.sachsen.de/ feldrittersporn Was sind Ackerwildkräuter? Ackerwildkräuter werden auch Segetalpflanzen
Projekt «Tagfalterschutz BL» Objektblätter und Aktionspläne
 Hintermann & Weber AG Öko-Logische Beratung Planung Forschung Projekt «Tagfalterschutz BL» Objektblätter und Aktionspläne unterstützt durch: Im Auftrag von Pro Natura Baselland Reinach, im Juli 2006, Stefan
Hintermann & Weber AG Öko-Logische Beratung Planung Forschung Projekt «Tagfalterschutz BL» Objektblätter und Aktionspläne unterstützt durch: Im Auftrag von Pro Natura Baselland Reinach, im Juli 2006, Stefan
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus)
 Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Die seltenen und unbekannten FFH-Käfer
 Die seltenen und unbekannten FFH-Käfer Mag. Wolfgang Paill Mag. Christian Mairhuber ÖKOTEAM Institut für Faunistik & Tierökologie, Graz Inhalt (Carabus variolosus (Carabidae) seit 1.5.2004) Rhysodes sulcatus
Die seltenen und unbekannten FFH-Käfer Mag. Wolfgang Paill Mag. Christian Mairhuber ÖKOTEAM Institut für Faunistik & Tierökologie, Graz Inhalt (Carabus variolosus (Carabidae) seit 1.5.2004) Rhysodes sulcatus
Einkeimblättrige (Monocotyledonae)
 Einkeimblättrige (Monocotyledonae) Merkmale Blütenhülle meist einfach und 3- zählig (Perigon) Blä$er einfach und meist wechselständig Bla$spreiten o7 lanze$lich und meist parallelnervig, o7 mit Bla$scheiden
Einkeimblättrige (Monocotyledonae) Merkmale Blütenhülle meist einfach und 3- zählig (Perigon) Blä$er einfach und meist wechselständig Bla$spreiten o7 lanze$lich und meist parallelnervig, o7 mit Bla$scheiden
Vermehrung von Pflanzen
 Vermehrung von Pflanzen Klassenstufe: Sekundarstufe I Benötigte Zeit: 30 Minuten Materialien: - 1 Ananas - 1 Messer - Schneidebrett - 1 Plastikbeutel - Blumenerde - 1 Pflanztopf Zusatzaufgabe: - 2 Pflanzsets
Vermehrung von Pflanzen Klassenstufe: Sekundarstufe I Benötigte Zeit: 30 Minuten Materialien: - 1 Ananas - 1 Messer - Schneidebrett - 1 Plastikbeutel - Blumenerde - 1 Pflanztopf Zusatzaufgabe: - 2 Pflanzsets
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressefahrt in den Nationalpark Kalkalpen mit Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer Nationalparkdirektor Dr. Erich Mayrhofer Dip.Ing. Hans Kammleitner, Forstmeister und Anton Sonnberger,
I N F O R M A T I O N zur Pressefahrt in den Nationalpark Kalkalpen mit Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer Nationalparkdirektor Dr. Erich Mayrhofer Dip.Ing. Hans Kammleitner, Forstmeister und Anton Sonnberger,
Legende zur Hessen-Liste 1
 Legende zur Hessen-Liste 1 Anlage D: Legende zur Hessen-Liste 27.11.2015 Tabelle Arten / KRS_Art Artengruppe Deutscher Name Wiss. Name Kategorie Deutscher Name der Art Wissenschaftlicher Name der Art s.
Legende zur Hessen-Liste 1 Anlage D: Legende zur Hessen-Liste 27.11.2015 Tabelle Arten / KRS_Art Artengruppe Deutscher Name Wiss. Name Kategorie Deutscher Name der Art Wissenschaftlicher Name der Art s.
Zwiebel- und Knollenpflanzen. ,!7ID8A0-biagfd! Taschenatlas. Frank M. von Berger. Tulpe, Krokus & Co.
 Frank M. von Berger In diesem Buch finden Sie 200 Pflanzen in Wort und Bild kompakt beschrieben. Sie erfahren alles über die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Pflanzen und ihre Standort ansprüche. Hinweise
Frank M. von Berger In diesem Buch finden Sie 200 Pflanzen in Wort und Bild kompakt beschrieben. Sie erfahren alles über die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Pflanzen und ihre Standort ansprüche. Hinweise
verbotene Pflanze Problempflanze
 Merkblatt Exoten im Garten - was tun? Invasive Neophyten sind aus anderen Kontinenten, welche als Zierpflanzen, Bienenweide oder mit Getreide eingeschleppt wurden. Problem: Sie vermehren sich stark, breiten
Merkblatt Exoten im Garten - was tun? Invasive Neophyten sind aus anderen Kontinenten, welche als Zierpflanzen, Bienenweide oder mit Getreide eingeschleppt wurden. Problem: Sie vermehren sich stark, breiten
