Dokumentationsunterlagen zur Refugio- Fachveranstaltung am
|
|
|
- Gabriel Kopp
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Dokumentationsunterlagen zur Refugio- Fachveranstaltung am
2 Unterlagen Einladung(skarte) Begrüßung Roy Hummel Begründung für die Notwendigkeit einer Trauma-pädagogik und deren Entwicklungspsychopathologische Grundlagen Dr. Phil. Marc Schmid Das Konzept Refugio die Traumapädagogik Thomas Lang Anregungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. med. Markus Löble Die Trägerperspektive Georg Kolb
3 Begrüßungsrede zur Fachveranstaltung in Refugio am ; Seite 1 Roy Hummel / Gesamtleiter Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen und heiße Sie alle zu unserer kleinen Fachveranstaltung herzlich Willkommen. Besonders begrüßen möchte ich Dr. Marc Schmid von den Universitären Kliniken Basel Dr. Markus Löble von den Kliniken Christophsbad Göppingen, Herrn Hilger und Herrn Braun vom Kreisjugendamt Göppingen, Frau Mittner vom KVJS/Landesjugendamt und Herrn Georg Kolb von der Stiftung St. Stephanus. Liebe Gäste, mit der heutigen Veranstaltung möchten wir Ihnen einen Mix aus Fachlichkeit, Besichtigung und Austausch anbieten und Sie zugleich einladen, Refugio kennen zu lernen. Gut sieben Monate sind nun seit der Eröffnung von Refugio vergangen, knapp 50 Aufnahmeanfragen sind eingegangen und fünf der sechs vorhandenen Plätze sind aktuell belegt. Die sechste Belegung ist derzeit in Planung. Aus der Bedarfsperspektive betrachtet, müssen unbedingt noch weitere ähnliche Angebote entwickelt werden, da sie eine echte Chance für Kinder mit hoch unsicherem Bindungsverhalten und/oder Traumatisierungen sind. Zugleich muss aber bedacht werden, dass adäquate Angebote eine Neuausrichtung im konzeptionellen und strukturellen Denken innerhalb der Einrichtungen erfordern. Angebote wie Refugio entstehen nicht über Nacht, wirken sich erheblich auf die gesamte Einrichtung aus und binden sehr viele Ressourcen.
4 Begrüßungsrede zur Fachveranstaltung in Refugio am ; Seite 2 Roy Hummel / Gesamtleiter Hierzu ein paar stichwortartige Anmerkungen aus meiner Perspektive, also aus der Leitungsperspektive: Für den Aufbau einer Wohngruppe wie Refugio sollten Sie viel Zeit für die Entwicklung und Umsetzung einplanen, genügend Ressourcen vorhalten und insbesondere ein besonnenes Personalmanagement betreiben. Sparen sie nicht an Personal, sorgen sie für ausreichend fachliche und v. a. emotionale Unterstützung, betrachten Sie die Mitarbeiter als Teil der Konzeption. Denn nur stabile Mitarbeiter können eine Stabilisierung der Kinder erreichen. Als Leitung sollten Sie nicht zu Panikattacken und Aktionismus neigen sowie über ein gewisses Reflexionsvermögen verfügen, denn die extreme Unberechenbarkeit der Kinder kann schnell zu einer Handlungsunsicherheit führen, die sich über die Mitarbeiter auf den Fachdienst und letztendlich auch auf Leitung übertragen kann. Seien Sie sich der besonderen Bedeutung der Pädagogen und des Fachdienstes bewusst. Die alltäglichen intensiven Belastungen in einem traumapädagogischen Setting erfordern eine hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion und sind eine echte Herausforderung für die Mitarbeiter, vor deren Leistungen ich sehr großen Respekt habe. Sehr geehrte Damen und Herren, im Laufe des Tages werden Sie noch einiges über die Arbeit in Refugio und darüber hinaus hören und bemerken, dass Begriffe wie Sicherheit und Stabilität untrennbar mit der Traumapädagogik verbunden sind. Verkürzt und aus der Leitungsperspektive betrachtet, könnte man auch sagen: Traumapädagogik ist der strukturierte Umgang mit Unberechenbarkeiten um Sicherheit und Stabilität zu bewirken. Bevor ich nun zum Schluss komme, möchte ich mich bei allen Mitwirkenden am heutigen Tag, insbesondere bei den Referenten, dem Refugio-Team, den Hausmeistern und unserer Verwaltungskraft Frau Aparicio, herzlich bedanken und darauf hinweisen, dass alle Vorträge des Vormittags zum Download auf unsere Website eingestellt werden. Ich wünsche uns allen einen anregenden Tag und viele gute Gespräche. Danke.
5 ZUR INFORMATION Die Refugio-Konzeption ist zum Download in unserer Website eingestellt: Ebenso die Flyer-Version: Hinweis: Hyperlink mit rechter Maustaste anklicken und auf Hyperlink öffnen klicken, somit kommen Sie direkt zur Konzeption oder zum Flyer.
6 Begründung für die Notwendigkeit einer Traumapädagogik und deren Entwicklungspsychopathologische Grundlagen Göppingen 6. November 2009 Marc Schmid
7 Gliederung 1. Warum entwickelte sich eine Traumapädagogik? Traumatische Erlebnisse bei Heimkindern Heimkinder als Hochrisikopopulation für psychische Störungen Gefahr von weiteren Beziehungsabbrüchen im Jugendhilfesystem 2. Folgen von komplexer Traumatisierung Was ist ein Trauma (Typ-I vs. Typ-II) Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung Besondere Bedeutung der Dissoziation Besondere Bedeutung der Emotionsregulation Körper und Somatisierung 3. Sozial-pädagogische Ansatzpunkte bei traumatisierten Kindern 4. Zusammenfassung und Diskussion
8 Trauma und Jugendhilfe (I) 80% der Traumatisierungen von Kindern finden in deren unmittelbarem familiären Umfeld statt. In Misshandlungsfamilien akkumulieren sich psychosoziale Risiken (Finkelohr et al. 2007,2009; Euser et al. 2009). Die Indikation für eine stationäre Jugendhilfe geht mit einer Akkumulation von psychosozialen Risikofaktoren einher. Stabile Zahl von Inobhutnahmen - in Deutschland jährlich über d.h. ca. 70 am Tag! (Statistisches Bundesamt 2005). Psychosoziale und psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe steigt eher durch den Ausbau der ambulanten Hilfen. Kinderdorf-Effekte-Studie: Durchschnitt der Neuaufnahmen hat 5 oder mehr psychosoziale Belastungsfaktoren auf Achse-V des Multiaxialen Diagnose Systems (Klein et al. 2003). Ca % der Kinder in GB und USA erlebten traumatische Erlebnisse oder wurden vernachlässigt (Meltzer et al. 2002, Burns et al. 2004).
9 Häufigkeit von Traumata (Jaritz et al. 2008) Art der Traumatisierung Häufigkeit (%) Vernachlässigung 72% Vernachlässigung (Basics) 31% Körperliche Misshandlung 35% Emotionale Misshandlung 31% Sexueller Missbrauch 15% Zeuge von körperlicher oder sexueller Gewalt 50% Schwere Unfälle 5% Irgendein psychosoziales Trauma (Basics o. Unfälle) 75%
10 Selbsturteil der MAZ.-Jugendlichen Ergebnisse im Essener Trauma Inventar (ETI) 28% N = % 18% Mindestens ein traumatisches Erlebnis Kein traumatisches Erlebnis V.a. PTSD 82% berichten traumatische Erlebnisse 28% PTSD Symptome
11 Bedeutung von Trauma für die Entwicklungspsychopathologie Irgendeine Diagnose Angststörung Depressive Störung Verhaltensstörung 0 Kein Ereignis (32,3%) Ein Ereignis (30,8%) Zwei (22,4%) Drei (7,1%) Vier oder mehr (7,5%) % N = 1420 Copeland et al.2007
12 Häufigkeiten Ergebnisse CBCL-Global-Skala Häufigkeiten (%) 25 Über 70% im klinisch auffälligen Bereich! Über 30% im klinisch hoch auffälligen Bereich! 20 CBCL N = Normpopulation Heimkinder >80 Klinisch auffälliger Bereich T-Wertpunkte
13 Komorbidität bei Heimjugendlichen in der Schweiz (MAZ.) Fünf oder mehr Diagnosen Vier Diagnosen 8% 5% Keine Diagnosen 22% Drei Diagnosen 15% Keine Diagnosen Eine Diagnose Zwei Diagnosen Drei Diagnosen Vier Diagnosen Fünf oder mehr Diagnosen Zwei Diagnosen 19% Eine Diagnose 31% 47% erfüllen die Kriterien für mehr als eine psychische Störung nach DSM-IV-TR N =
14 Trauma-Entwicklungsheterotypie Schmid, Fegert, Petermann in press Bipolare Störungen im Kindesalter Emotionale Störungen Angststörungen Oppositionelles Verhalten Bindungsstörungen Affektive Störungen Störung des Sozialverhaltens ADHS Dissoziative und Somatoforme Störungen Substanz missbrauch Störungen der Persönlichkeits -entwicklung Selbstverletzung Suizidalität Regulationsstörungen Traumafolgestörungen + biologische Faktoren Geburt Vorschulalter Schulalter Pubertät Adoleszenz
15 Gliederung 1. Warum entwickelte sich eine Traumapädagogik? Traumatische Erlebnisse bei Heimkindern Heimkinder als Hochrisikopopulation für psychische Störungen Gefahr von weiteren Beziehungsabbrüchen im Jugendhilfesystem 2. Folgen von komplexer Traumatisierung Was ist ein Trauma (Typ-I vs. Typ-II) Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung Besondere Bedeutung der Dissoziation Besondere Bedeutung der Emotionsregulation Körper und Somatisierung 3. Sozial-pädagogische Ansatzpunkte bei traumatisierten Kindern 4. Zusammenfassung und Diskussion
16 Viele Beziehungsabbrüche I 14% 7% 3% 6% keine vorherige Fremdplatzierung 1 Platzierung 2 Platzierungen 3 Platzierungen 4 Platzierungen 22% 5 Platzierungen 48% Über 50% waren früher bereits einmal fremdplatziert 30% weisen zwei oder mehr Fremdplatzierungen auf
17 Viele Beziehungsabbrüche II Je größer die psychosoziale Belastung der Jugendlichen, desto wahrscheinlicher Abbrüche oder schwierige Verläufe (Baur et al. 1998). Nur 2 von 72 Heimkindern zeigen kein auffälliges Bindungsverhalten (Schleiffer 2001). 20% der stationären Hilfen enden im ersten Jahr. Je mehr Beziehungsabbrüche und gescheiterte Hilfen in der Vorgeschichte, desto schlechter die Wirksamkeit der aktuellen Jugendhilfemaßnahme (EVAS 2004). Gehen auch mit höherer Delinquenz einher.
18 Beziehungsabbrüche III Klienten mit positiven Beziehungserfahrungen und Bindungsrepräsentationen haben besseren Verlauf (Zersen et al. 2006, Skodol et al. 2007). Im Sinne der Replikationshypothese können viele Abbrüche auch als unbewusste Wiederholung von innerfamiliären Beziehungserfahrungen betrachtet werden. Viele Beziehungsabbrüche sind auf Ohnmachts-, Selbstinsuffizienz- und Selbstunwirksamkeitsgefühle des pädagogischen Teams bei der Betreuung von besonders stark psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen zurückzuführen, die Ausstoßungstendenzen auslösen können (vgl. Replikationshypothese).
19
20 Fazit Mindestens 75% der Kinder und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe durchlebten traumatische Ereignisse. Viele dieser Kinder und Jugendlichen sind mehrfach und sequentiell traumatisiert. Die stationären Wohngruppen: Nehmen zwar einen besonderen pädagogischen Bedarf bei außerordentlich stark traumatisierten Kindern wahr. Spezifische pädagogische Konzepte für diese psychisch hoch belasteten - und alle psychosozialen Helfer herausfordernden - Kinder und Jugendlichen bilden aber die absolute Ausnahme. Die hohe Abbruchquote in der JH verstärkt die Beziehungsstörung und damit die gesamte Symptomatik der Kinder und Jugendlichen und reduziert deren Chancen auf einen erfolgreichen Jugendhilfeverlauf und letztlich auf gesellschaftliche Teilhabe. Konzepte für die suffiziente langfristig beziehungserhaltende Begleitung dieser Kinder müssen entwickelt werden.
21 Gliederung 1. Warum entwickelte sich eine Traumapädagogik? Traumatische Erlebnisse bei Heimkindern Heimkinder als Hochrisikopopulation für psychische Störungen Gefahr von weiteren Beziehungsabbrüchen im Jugendhilfesystem 2. Folgen von komplexer Traumatisierung Was ist ein Trauma (Typ-I vs. Typ-II) Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung Besondere Bedeutung der Dissoziation Besondere Bedeutung der Emotionsregulation Körper und Somatisierung 3. Sozial-pädagogische Ansatzpunkte bei traumatisierten Kindern 4. Zusammenfassung und Diskussion
22 Trauma Überwältigendes Erlebnis, welches mit einer ernsthaften Bedrohung für die Sicherheit und körperliche Unversehrtheit des Klienten selbst oder einer nahe stehenden Person einhergeht und sich darin auszeichnet, dass in der Situation intensive Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen empfunden wurden.
23 Trauma: Traumatisches Lebensereignis Extreme physiologische Erregung Flucht Freeze Fight Traumasymptome
24 Bei einer Traumatisierung laufen parallel zwei unterschiedliche physiologische Prozesse ab Übererregungs-Kontinuum Fight oder Flight Alarmszustand Wachsamkeit Angst/Schrecken Adrenalin System wird aktiviert Erregung Serotonerges System verändert sich Impulsivität, Affektivität, Aggressivität Physiologisch Blutdruck (Pulsrate ) Atmung Muskeltonus Schmerzwahrnehmung Dissoziatives-Kontinuum Freeze ohnmächtige / passive Reaktion Gefühlslosigkeit / Nachgiebigkeit Dissoziation Opioid System wird aktiviert Euphorie, Betäubung Veränderung der Sinnes-, Körperwahrnehmung (Ort, Zeit, etc.) Physiologisch Pulsrate Blutdruck Atmung Muskeltonus Schmerzwahrnehmung
25 Traumatypen nach Terr (1991) Typ I - Trauma Typ II - Trauma Einzelnes, unerwartetes, traumatisches Erlebnis von kurzer Dauer. z.b. Verkehrsunfälle, Opfer/Zeuge von Gewalttaten, Vergewaltigung im Erwachsenenalter, Naturkatastrophen. Symptome: Meist klare sehr lebendige Wiedererinnerungen Vollbild der PTSD Serie miteinander verknüpfter Ereignisse oder lang andauernde, sich wiederholende traumatische Erlebnisse. Körperliche sexuelle Misshandlungen in der Kindheit, überdauernde zwischenmenschliche Gewalterfahrungen. Symptome: Nur diffuse Wiedererinnerungen, starke Dissoziationstendenz, Bindungsstörungen Hohe Komorbidität, komplexe PTSD Hauptemotion = Angst Eher gute Behandlungsprognose Sekundäremotionen (z.b. Scham, Ekel) Schwerer zu behandeln
26 Dissoziation und Trauma 10% der Traumatisierten entwickeln sofort eine chronische Dissoziationsneigung (Overkamp 2002). 50% bei sequentieller Traumatisierung (Murie et al. 2001). Dissoziierende Erwachsene sprechen von stärkeren/häufigeren Kindheitstraumata (Nash et al. 2009). extreme emotional negativ aufgeladene Familienatmosphären scheinen das Ausmaß der Dissoziationsneigung wesentlich zu beeinflussen (Sanders & Giolas 1991, DiTomasso & Routh 1993). Cartoon Bohus & Wolf, 2009 Zusammenhang wird aber auch von anderen Faktoren moderiert (Merckelbach & Muris, 2001).
27 Was ist Dissoziation Verlust des Raumund Zeitgefühls, der Orientierung Keine Erinnerung Fragmentierte Informationsverarbeitung Null-Reaktion auf Umwelt, Reize dringen nicht durch Bewegungslosigkeit/ keine Gestik Intrusionen, Bilder 1000 Yards Stare, Kein Blickkontakt leerer Blick Lernen in dissoziiertem Zustand nicht möglich Keine Mimik, starrer, oft ausdrucksloser Gesichtsausdruck Schmerzwahrnehmung ist deutlich reduziert, Verlust des Körpergefühls Innere Leere, emotionale Taubheit Keine Energie spürbar, unklare Gegenübertragung Depersonalisationserleben Kein Grounding Lediglich automatisierte Handlungsmuster, kein geplantes Verhalten
28 Gliederung 1. Warum entwickelte sich die Traumapädagogik Traumatische Erlebnisse bei Heimkindern Heimkinder als Hochrisikopopulation für psychische Störungen Gefahr von weiteren Beziehungsabbrüchen im Jugendhilfesystem 2. Folgen von komplexer Traumatisierung Was ist ein Trauma (Typ-I vs. Typ-II) Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung Besondere Bedeutung der Dissoziation Besondere Bedeutung der Emotionsregulation Körper und Somatisierung 3. Sozial-pädagogische Ansatzpunkte bei traumatisierten Kindern
29 Cave Keine psychische Störung oder ein Symptom kann einer Ursache zugeordnet werden. Jedes Symptom hat eine multifaktorielle Genese (Genetik, biologische Faktoren, Umweltbedingungen, Erziehungsstil, kritische Lebensereignisse, Einflüsse von Gleichaltrigen). Alle folgenden Aussagen beziehen sich auf wissenschaftliche Studien und zeigen, dass diese Symptome bei traumatisierten Menschen viel häufiger vorkommen. Ein Kausalzusammenhang zwischen Traumatisierung und einem Symptom besteht aber nie.
30 Biologische Faktoren Genetik, prä- und perinatale Risikofaktoren Soziale Wahrnehmung weniger soziale Kompetenzen Störungen der Empathiefähigkeit Mentalisierung Bindungsstörung Störungen der Interaktion PTSD: Hyperarousal, Intrusionen, Vermeidung Selbstwert, Gefühl d. Selbstunwirksamkeit kognitive Schemata Invalidierende, vernachlässigende Umgebung Typ-II-Traumata Störung der Impulskontrolle Selbstregulation Stresstoleranz Störung der Emotionsregulation Schmid (2008). Dissoziationsneigung/ Sinneswahrnehmung Störungen des Körperselbst Körperwahrnehmung Somatisierung Störung der exekutiven, kognitiven Funktionen
31 Störungsmodell: Spannungsreduktion Selbstverletzung Aggression Dissoziation Konsum Stimulus Emotion Reaktion Spannungsanstieg negiert inadäquat Emotionsphobie Das Dilemma ist, dass diese Patienten entweder zuviel oder zuwenig von ihren Gefühlen wahrnehmen! (van der Hart)
32 Biologische/genetische Disposition zu heftigen Gefühlen Negative Lerngeschichte mit Emotionen Schwierigkeiten im Umgang und bei der Wahrnehmung mit Emotionen, Angst vor Gefühlen Gefühle werden bedrohlich unangenehm erlebt und nicht wahrgenommen oder unterdrückt Bei niederem Erregungsniveau viele Verhaltensalternativen Emotion wird als Überforderung erlebt: Gefühl der Leere, Taubheit Selbstverletzung, Aggression, Substanzkonsum, Suizidversuch Fazit: Normale emotionale Reaktionen im Alltag sollten bemerkt und für eine gute Beziehungsgestaltung nutzbar gemacht werden! Die Signale die Gefühle für die Verhaltenssteuerung geben werden nicht bemerkt und Verhalten wird nicht danach ausgerichtet Bei höchstem Erregungsniveau werden automatisierte Lösungsmechanismen eingesetzt Verhaltensmöglichkeiten sind scheinbar blockiert, Anspannungsniveau wird unerträglich In-Albon & Schmid in press Situation bleibt ungeklärt Gefühle werden stärker, unangenehm belastende Anspannungsgefühle treten auf Je höher Erregungsniveau desto weniger Verhaltensalternativen, andere Personen reagieren dann oft ebenfalls emotionaler
33 Zwei Ebenen der Gefühlsregulation Gegenwärtige Wirklichkeit Wahrnehmung Körperreaktion Gedanken Handlungsdrang Gefühle Aktuelle Gefühlsreaktionen (nicht nur eigene) werden heftiger und als potentiell bedrohlich erlebt Vergangenes traumatisches Erleben Wahrnehmung Körperreaktion Gedanken Handlungsdrang = Freeze Gefühle Glaubenssätze Selbstbild
34 Zwei Ebenen der Gefühlsregulation Gegenwärtige Wirklichkeit Wahrnehmung Körperreaktion Traumapädagogisches Gedanken Milieu Handlungsdrang Wahrnehmung Körperreaktion Gedanken Handlungsdrang Gefühle Gefühle Vergangenes traumatisches Erleben Korrigierende Erfahrungen mit Gefühlen und Beziehungen im pädagogischen Alltag Schutz vor Retraumatisierung und den damit verbunden Gefühlen Braucht viel Zeit! Wahrnehmung Körperreaktion Gedanken Handlungsdrang = Freeze Gefühle Glaubenssätze und Selbstbild Verändern sich nur alternative Erfahrungen
35 Biologische Faktoren Genetik, prä- und perinatale Risikofaktoren Soziale Wahrnehmung weniger soziale Kompetenzen Störungen der Empathiefähigkeit Mentalisierung Bindungsstörung Störungen der Interaktion PTSD: Hyperarousal, Intrusionen, Vermeidung Selbstwert, Gefühl d. Selbstunwirksamkeit kognitive Schemata Invalidierende, vernachlässigende Umgebung Typ-II-Traumata Störung der Impulskontrolle Selbstregulation Stresstoleranz Störung der Emotionsregulation Schmid (2008). Dissoziationsneigung/ Sinneswahrnehmung Störungen des Körperselbst Körperwahrnehmung Somatisierung Störung der exekutiven, kognitiven Funktionen
36 X Mal höheres Risiko für Kinder mit mehr als vier traumatischen Erlebnissen haben ein Symptomatik Oddsratio Symptomatik Oddsratio (Felitti et al.1998, 2001) Rauchen 2 Mal Promiskuität 3.2 Mal (>50 Intimpartner) Depression 4.6 Mal Schlaganfall/ 2.4 / 2.2 Mal Herzerkrankung Suizidversuche 12.2 Mal Hepatitis 2.4 Mal Alkoholmissbrauch 7.4 Mal Lungenerkrankung 3.9 Mal Drogenmissbrauch/ 4.7/10.3 Mal Krebs 1.9 Mal Harte Drogen (Spritzen)
37 Ansatzpunkte für Interventionen Verbesserung der Emotionsregulation Angebot von hoffnungsvollen Bindungen Überwindung der Selbstunwirksamkeitserwartung, Aufbau von sozialen Fertigkeiten Achtsamkeit Verbesserung der Selbst-, Fremd-, Körper- und Umweltwahrnehmung Reduktion der Dissoziationsneigung Sicherer Ort Stabilisierung Keine Konfrontationsbehandlung im pädagogischen Alltagssetting, Trennung zwischen spezifischer Psychotherapie und Traumapädagogik.
38 Basis Vermittlung alternativer Beziehungserfahrungen Netz verlässlicher sozialer Bindungen Emotionale Belastbarkeit des Teams Analyse von Krisen auf Grundlage der traumatischen Beziehungsvorerfahrungen und der damit verbundenen Übertragung bzw. Gegenübertragung Ressourcenorientierung Vermittlung grundlegender Alltagsfertigkeiten
39 Sekundäre Traumatisierung - Gegenübertragung Stellvertreter Gefühle bei psychosozialen Helfern Übernahme des traumatischen Erlebnisses Helfer erleben selber ein Hyperarousal und intrusive Bilder der berichteten Traumata Häufige typische Schwierigkeiten in der Gegenübertragung in der Arbeit mit Traumatisierten - Sexuelle, aggressive, Gegenübertragungsgefühle - Glaub man mir? Kann ich vertrauen? - Kann der/die TherapeutIn meinen Bericht aushalten? - Retraumatisierung / Reinszenierung Menschen, die mit schwer traumatisierten Menschen arbeiten brauchen Unterstützung.
40 Teufelskreis im Team: Narzissmusfalle Lohmer 2002 Mitarbeiter zieht sich zurück oder reagiert über. Auftreten der Symptomatik, Entwertung des Mitarbeiters. Narzissmusfalle Jugendlicher macht besonderes Beziehungsangebot. Mitarbeiter fühlt sich unwohl, überfordert, emotional stark involviert. Jugendliche/r testet Beziehung aus, Reinszenierung von Abbrüchen, Beziehungserfahrungen. Jugendlicher fordert Beziehung immer stärker und intensiver ein. Hält diese intensive Beziehungen kaum aus.
41 Mittlerer Abstand in der Beziehungsgestaltung Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen. Joseph Joubert Emotionales Engagement Reflektierende/ professionelle Distanz Dammann 2006, Schmid 2007
42 Dialektische Beziehungsgestaltung
43 Fazit Chronisch traumatisierte Kinder leiden häufig unter spezifischen Symptomen, da sie grundlegende Fertigkeiten in ihren Ursprungsfamilien nicht erlernen konnten. - Emotionsregulation/Emotionale Validierung - Sensibilität für Sinneswahrnehmung - Selbstwirksamkeit / Selbstwert / Soziale Kompetenzen - Sichere Bindungserfahrungen - Förderung von Resilienzfaktoren Die Arbeit mit schwer traumatisierten Kindern ist emotional sehr belastend und die Mitarbeiter und Therapeuten benötigen hierzu besonders intensive Unterstützung in Form von Intervision/Supervision/spezifische Fallbesprechung sowie einen guten Ausbildungsstand bezüglich der Psychotraumatologie. Eine enge frühzeitige und kontinuierliche Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie /-psychotherapie ist unabdingbar. Diese unterentwickelten Fertigkeiten sollten im Rahmen von milieutherapeutischen Angeboten gezielt gefördert werden.
44 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts Sören Kierkegaard
45 Kontakt & Literatur Zeitschrift Trauma und Gewalt Klett-Cotta Themenhefte Traumapädagogik I +II Kontakt: Marc Schmid Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel Schaffhauserrheinweg 55 Ch-4058 Basel Tel (0) Marc.Schmid@upkbs.ch Schmid et al. (2007) Brauchen wir traumapädagogische Konzepte in der stationären Jugendhilfe? Kontext Jahrgang 38 (4) S
46 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Das Konzept von Refugio die Traumapädagogik Stellen Sie sich vor, wir würden traumapädagogische Arbeit, das trauma- und bindungspädagogische Konzept der Wohngruppe Refugio in ein Bild verwandeln, ja in ein Landschaftsbild. So sehe ich einen Flusslauf vor mir, einen Fluss mit einem Ursprung und einem Ziel, einen Flusslauf mit Windungen und geraden Streckenteilen, mit unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten sowie mit Anlege- und Versorgungstellen.
47 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Ich möchte mit Ihnen heute Morgen nicht den ganzen Fluss befahren, dazu haben wir nicht genügend gemeinsame Zeit. Vielmehr möchte ich mit Ihnen von dieser Erhöhung aus einzelne Flussabschhnitte betrachten, Ihnen Anmerkungen, Erklärungen und Impulse dazu geben aber auch unsere Erfahrungen schildern. Anfang der 90er Jahre lernte ich im Rahmen einer jugendhilflichen Maßnahme ein kleines Mädchen kennen, das beim Wickeln plötzlich am ganzen Körper steif wurde, ihre Augen wurden starr und sie stellte plötzliche jegliche verbale Kommunikation ein. Ich fühlte mich komplett überfordert mit dieser Situation, zumal ich mit heftigen Gefühlen und Empfindungen zu tun hatte. Ich fühlte mich hilflos, ich hatte Ekelgefühle, wurde ebenfalls sprachlos und mir wurde es schlecht. Ich wickelte das Mädchen fertig und hatte innerlich den Wunsch, diese pflegerische Aufgabe für dieses Mädchen nicht mehr übernehmen zu müssen. Natürlich war mir damals dann schon klar, auch auf Grund anderer Verhaltensauffälligkeiten, dass die Grenzen des Mädchens in massiver Form verletzt wurden; aber aus heutiger Sicht, verstehe ich nun viel mehr als ich damals verstanden habe lernte ich als Berater einen 3-jährigen Jungen in einer Pflegefamilie kennen, der beim Wickeln ähnliche Verhaltensweisen zeigte. Die Pflegeeltern erlebten diese Situationen ebenfalls besorgniserregend aber auch überfordernd. Nach einer Beratung bei Herrn Pfeifer vom Kinderschutzbund in Göppingen nahm die Pflegemutter nun immer zum Wickeln Autos und Traktoren für den Jungen mit. Er hielt die Fahrzeuge in der Hand, spielte mit ihnen und die Pflegemutter führte Gespräche mit ihm über die großen Räder der Traktoren und wer alles im Traktor mitfährt, usw.. Unter anderem über diese Intervention versteifte sich der Junge nicht mehr oder nicht mehr so häufig beim Wickeln. Hintergrund dieser Veränderung oder nennen wir es mal Stabilisierung beim Wickeln waren verschiedene Bausteine: Wir verstanden, was bei dem Jungen in diesem Moment passiert, wie sein Gehirn funktioniert, wie seine früheren Erfahrungen aktuelle Situationen beeinflussen, ja vielmehr bestimmen, was ein Trigger ist und welchen Nutzen für den kleinen Jungen das Dissoziieren beim Wickeln hat. Wir lernten seine zahlreichen sonstigen Verhaltensoriginalitäten als sekundäre Traumasymptome zu verstehen. Und natürlich gab es konkrete Interventionsmöglichkeiten um den Jungen zu stabilisieren. Auch durch den vorangehenden Vortrag von Marc Schmid sind Ihnen Begriffe wie Trigger, Dissoziation oder auch sekundäre Traumasymptome vertraut. Ich möchte Ihnen dennoch mit einer Geschichte aus dem Tierreich sehr einfache Grundlagen zur Psychotraumotologie darstellen. Ich möchte Ihnen das auch in dieser Form darstellen, um Ihnen zu vermitteln wie wir den Kindern, die auf Refugio leben, ihre Situation und ihre scheinbar so sonderbaren Verhaltensweisen helfen zu verstehen. In der Traumapädagogik ist dies eine zentrale Aufgabe, die als Psychoedukation benannt wird.
48 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Kennst du Antilopen und Löwen? In der Savanne von Afrika leben viele unterschiedliche Tiere. So zum Beispiel auch Löwen und Antilopen. Wenn sich eine Antilope durch einen Löwen sehr bedroht fühlt, kann diees sich, übrigens wie die Menschen auch, für das Fliehen oder für das Kämpfen entscheiden. Dabei geschehen ganz besondere Veränderungen im Körper. So wird zum Beispiel Blut aus dem Gehirn und aus den Verdauungsorganen abgezogen und das Herz transportiert nun ganz viel Blut in die Muskeln. Die Muskeln werden so für das Kämpfen oder das Fliehen ganz stark gemacht. Die Antilope weiß natürlich, dass sie vor einem Löwen besser flieht. Und eine Antilope kann schnell spring, aber manchmal kommt sie in eine Situation, in der sie merkt, jetzt geht gar nichts mehr. Ich bin in aller größter Gefahr und der Körper einer Antilope geht dann in der Jetzt geht gar nichts mehr Situation in die Erstarrung. Sie stellt sich tot, das nennt man auch den Totstellreflex. Dadurch hat sie neben dem Fliehen noch eine weitere Möglichkeit zu überleben. Auch hier ist es so, das der Körper von Menschen erstarrt, wenn Situationen so schlimm sind, dass gar nichts mehr geht. Das hilft die körperlichen Schmerzen und die Schmerzen für die Seele kleiner zu machen. O.k., wenn die Antilope es also schafft durch das Tot stellen zu überleben, weil der Löwe zum Beispiel keine Lust hat ein totes Tier zu jagen, dann ist der Körper der Antilope ja noch immer voller Energie, die sie gebraucht hat zu überleben. Diese ganz große Energie hilft der Antilope aber nicht mehr, wenn sie wieder mit ihren Antilopenfreunden spielen möchte, es ist auch keine gute Kraft und Energie, die sie für andere wichtige Antilopenaufgaben brauchen könnte. So stellt sich also die Antilope hin und fängt am ganzen Körper an zu zittern. Über dieses Zittern schafft sie die Energie aus sich raus, die ihr geholfen hat zu überleben. Sie bekommt so wieder die Kontrolle über ihren Körper zurück, jetzt ist ja wieder auch in Sicherheit. Nach dieser und mit dieser Geschichte entwickeln sich verschiedene Möglichkeiten mit einem Kind weiter. Stellen Sie sich nun Kinder vor, die immer wiederkehrend Situationen wie die Antilope am Wasserloch erlebt. Immer wiederkehrend wird das Kind und sein Körper auf das Höchstmass gefordert aus seiner Perspektive (lebens-) bedrohliche Situationen zu erleben und zu versuchen diese zu überleben. Kinder, wie diejenigen, die auf Refugio leben, machen meist von Geburt an existentielle Erfahrungen: Ihnen ist es kalt, sie sind hungrig und durstig, sie fühlen sich verängstigt oder auch bedroht, sie fühlen sich schutzlos und sie weinen und sie schreien immer lauter, damit sie gehört werden. Aber sie machen nicht die Erfahrung, dass sie mit ihrem Weinen und schreien, mit ihren Möglichkeiten sich mitzuteilen, mit ihren Möglichkeiten, an der bedrohlichen Situation etwas zu verändern, etwas erreichen. Sie haben keine Kontrolle über und in der Situation, sie sind ihr hilflos ausgeliefert. Vielmehr machen sie die Erfahrung, dass sie von den Personen, von denen sie Versorgung, Schutz, Geborgenheit und Liebe erwarten und benötigen, von denen sie auch abhängig sind, misshandelt und missbraucht werden.
49 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Ganz früh in ihrem Leben gibt es so elementare und zentrale Erfahrungen auf der Erlebensebene von Intensiver Angst Hilflosigkeit Drohender Vernichtung Kontrollverlust Da wir heute wissen, dass unser Gehirn sich anwendungsorientiert entwickelt, lernen wir auch zu verstehen, wie es immer wieder, auch scheinbar aus ganz heiterem Himmel zu nicht nachvollziehbaren Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern kommt. Schauen wir uns die überaus komplexen Abläufe des Gehirns in einem sehr vereinfachten Schema an:
50 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang In dieser Darstellung ist noch das Notfallreaktionsmuster der Täuschung dargestellt. In der Tierwelt ist nach Dorothea Weinmann die Täuschung eine Eigenschaft um Bedrohungen vorzubeugen (z.b. wechselnde Tarnung eines Chamäleons). Es ist also eine Anpassungsleistung an die bedrohliche Umwelt. Dorothea Weinmann beschreibt die Täuschungsvariante als Notfallstrategie bei kleinen Kindern, die z.b. von Bindungspersonen missbraucht wurden: Es gibt kaum strahlendere, herzigere Kinder aber nur, wenn sie mit dem übergriffigen Erwachsenen zusammen sind. Ansonsten wirken sie oft eher starr, abweisend und schwierig. Die verschiedenen Notfallreaktionsmuster verlaufen in sehr gut mehrspurig ausgebauten neuronalen Autobahnen. Viele, aus unserer Sicht unbedeutende Reize, wie zum Beispiel eine bestimmte Form einer Tasse, eine Farbe an der Gardine, eine bestimmte Berührung aber auch Erlebnisse, wie z.b. Frustrationen, Anforderungen, Misserfolge finden eine Auffahrt auf die Autobahn der Notfallreaktionsmuster. Das Notfallreaktionsmuster, das Muster, das das Überleben sichert, ist eine mehrspurige Autobahn. Die Geschichte der Antilope und das dargestellte Modell helfen traumatisierten Kindern sich und ihre Verhaltensweisen besser zu verstehen. Sie werden entlastet und fühlen sich erleichtert, da sie als zentrale Botschaft vermittelt bekommen: >> Deine Verhaltensweisen sind ganz normale Reaktionen auf frühere unnormale Erlebnisse << Aus den Erfahrungen auf der Erlebensebene und den neurobiologischen Veränderungen zeichnen sich nun auch Aufgabenstellungen ab, die die Traumapädagogik und so auch das Konzept von Refugio verfolgen: Traumatisierte Kinder erfahren Schutz und Sicherheit Sie erfahren Würdigung, Respekt und Achtung ihrer Lebensleistung Sie lernen den Nutzen ihrer Verhaltensweisen zu verstehen und sie lernen kontrollierbare und gewollte Alternativen zu ihren bisher nicht kontrollierbaren Strategien zu entwickeln Sie bemächtigen sich ihres Lebens, sie erleben sich selbstwirksam Das Konzept von Refugio zielt darauf ab, die Kinder an einem und durch einen Sicheren Ort zu stabilisieren. In der Traumapädagogik wird auch von einer Pädagogik des Sicheren Ortes gesprochen. Ich möchte nun für viele Facetten einer Pädagogik des Sicheren Ortes einige Prinzipien bzw. Interventionsmöglichkeiten herausgreifen.
51 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang 1. Die äußere Sicherheit Wir unterscheiden zwischen einem äußeren sowie einem inneren sicheren Ort. Der äußere sichere Ort ist die wichtigste Vorraussetzung, damit die Kinder auch eine innere Sicherheit und damit eine Heilung erfahren können. Äußere Sicherheit durch Besonders intensive Wahrung der Intimsphäre (z.b. Sensibilisierung der MitarbeiterInnen) Hoher Schutz vor Täterkontakten Individuelle Regeln und Gebote; Verdichtete erzieherische Präsenz im Alltag Besonders geschützte dezentrale Wohngruppe (also nicht innerhalb der Stammeinrichtung) Sicherheit vor großem Durchgangsverkehr und ständigen Veränderungen Innere Sicherheit durch Aufbau und Stärkung der Resilienzfaktoren und Ressourcen Imaginationsübungen und Schaffung eines inneren sicheren Ortes Schatzkiste / Notfallkoffer für Krisensituationen Refugio kommt aus dem Spanischen und heißt Schutzhütte. Refugio soll ein Ort sein an dem die Kinder verlässliche Strukturen und verlässliche Personen erleben. Sie kennen den Dienstplan der pädagogischen Fachkräfte, mit ihnen wird frühzeitig besprochen, wann ihr Bezugsbetreuer in den Urlaub geht und wer dann für sie verantwortlich ist. Die Strukturen und das Verhalten der Fachkräfte sind so ausgerichtet, dass der Alltag einschätzbar und kontrollierbar ist. Sie erleben ihr eigenes Zimmer als einen sicheren Ort, sie können ihr Zimmer abschließen und können so entscheiden, ob sie jemand einlassen möchten.
52 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Wenn wir uns die Lebensgeschichten der Kinder vor Augen führen, uns deutlich machen, wie wenig Schutz und Kontrollmöglichkeiten sie erfahren haben, so wird deutlich, wie wichtig es wird, ihnen Rückzugsmöglichkeiten anzubieten und sie sich bemächtigen. Ein sehr brisantes Thema ist die Aufrechterhaltung von Kontakten zu ehemals schädigenden Elternteilen. Begleitete Besuchskontakte bedeuten zumindest Schutz vor äußeren Übergriffen aber noch nicht automatisch Schutz vor den inneren Bedrohungen. Kann ein Kind und mit ihm seine neurobiologisch Abläufe differenzieren zwischen dem Täter und der Pflegeperson, die es nicht geschafft hat das Kind damals zu schützen, die die Nöte und die Botschaften des Kindes nicht wahrgenommen hat, aus der Perspektive des Kindes ignoriert hat? Die systemische Prämisse Eltern sind und bleiben die wichtigsten Bezugspersonen hat Kinder und Jugendliche in stationären Wohngruppen und in Pflegefamilien destabilisiert und massiv verunsichert sowie eine heilende korrigierende neue Beziehungserfahrung verhindert. Als systemischer Familientherapeut habe ich mit großer Zustimmung in einen Artikel zweier systemischer Therapeuten, Reinert Hanswille und Anette Kissenbeck, folgendes Zitat gelesen: Die Vorstellung, dass ein Umgang mit den Eltern begleitet oder nicht für das Kind sinnvoll sei, beruht auf einer kollektiven Dissoziation traumatischer Erfahrungen (Anmerkung des Verfassers: gemeint sind hier die Helfer und nicht die Kinder).Diese z.t. institutionalisierte gutgemeinte Haltung wirkt sich auf die Beteiligten oft katastrophal aus und verstärkt die gemeinsame Leugnung. Auch dem Kind bleibt innerpsychisch nur die Chance, das Trauma abzuspalten. Es muss die schädigenden Pflegepersonen weiter idealisieren und sich selbst die Schuld an den Misshandlungen zuschreiben. Das heißt, wenn wir traumatisierten Kinder immer wiederkehrend in Kontakt bringen mit ihren Eltern, weil es halt die Eltern so wollen, negieren wir die Lebenserfahrungen und die Gefühle der Kinder. Was bedeutet es für das Kind und die Beziehung zu mir, wenn ich sehe, höre und spüre wie groß seine Verletzungen sind und ihm aber signalisiere, dass der nächste Kontakt schon nicht so schlimm sein wird. Kinder, die massiv von ihren Eltern misshandelt wurden, zeigen sich weiterhin loyal den Eltern gegenüber. Zudem lassen sich viele Fachleute, z.b. auch Gutachter noch sehr von der Notfallstrategie der Täuschung täuschen. Das heißt dieses Verhalten wird selten als Notfallstrategie verstanden, vielmehr als gute Beziehung interpretiert. Hier braucht es eine wohlwollende konfrontierende Haltung und Arbeit den Eltern gegenüber, eine gut gestaltete Kooperation zwischen uns als Einrichtung zu den Jugendämtern. Und eine Kooperation stets in dem Sinne: Nicht gegen die Eltern aber für das Kind oder anders ausgedrückt, das elterliche Umgangsrecht muss dem Kinderschutz untergeordnet werden.
53 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Für Refugio heißt das aktuell dennoch, dass es teilweise begleitete Besuchskontakte in der Stammeinrichtung gibt. Ziel in der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten soll es nicht nur sein, Absprachen bzgl. der Häufigkeit der Kontakte zu treffen, sonder Umgangskontakte als stabilisierendes Element zu gestalten. Ziel ist es nicht nur, die Eltern für verlässliche Absprachen zu gewinnen, vielmehr geht es auch darum, uns von dem Kind leiten zu lassen. Das heißt nicht, dass das Kind hierüber entscheidet aber wir hören von dem Kind, wir erleben es vor, während und nach dem Kontakt, wir stellen Unterschiede fest und wir begreifen, was hilft und was nicht. Und dafür machen wir uns stark, dafür kämpfen wir auch. 2. Aufbau und Stärkung der Resilienzfaktoren und Ressourcen Mit Resilienz ist die psychische Widerstandskraft eines Menschen gemeint. Diese Merkmale und Eigenschaften verhelfen ihm schwierige Situation gut und unbeschadet zu überleben oder zu meistern. Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sie entwickelt sich nur über eine unterstützende Interaktion mit der Umwelt. Gehen wir nochmals zurück zu den neurobiologischen Autobahnen und versuchen dies wiederum in einem einfachen Schema darzustellen:
54 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Der rechte präfrontale Cortex ist die Gehirnregion, die Emotionen wie Wut, Schmerz und Angst steuert. Der linke präfrontale Cortex ist für das Erleben positiver Emotionen zuständig. Ziel der traumapädagogischen Arbeit ist es also, den linken präfrontalen Cortex und seine Nervenbahnungen auszubauen. Es geht darum, eine Balance zwischen beiden Regionen herzustellen. Resilienz- und Ressourcenarbeit soll diese Regionen leichter ansprechbar machen. Da unser Gehirn sich anwendungsorientiert entwickelt, kann es trainiert werden, im Grunde genommen wie ein Muskel. Traumapädagogik ist in erster Linie ein ressourcenorientiertes Vorgehen. Die Resilienz- und Ressourcenaktivierung stellt ein primäres Prinzip dar, das eine überragende Wichtigkeit für den Erfolg der Maßnahme besitzt. Die pädagogischen Fachkräfte praktizieren einen ressourcenorientierten Wahrnehmungs- und Denkstil als Grundhaltung im Kontakt mit den Kindern. Traumatisierte Kinder erfahren so Zugang zu positiven Emotionen und erlernen ein Gegengewicht gegen ihre Schreckenswelten aufzubauen. In dem Konzept von Refugio sind Einzelstunden zwischen dem Bezugsbetreuer und seinem Bezugskind ausschließlich Ressourcen- und Resilienzstunden. In und durch gemeinsame Aktivitäten werden Mut, Hoffnung, Phantasie, Schönheit, Kreativität, Glaube an das Gute, positive Bindungserfahrung oder Lösungsorientierung gefördert. Resilienzförderung und Ressourcenorientierung hilft auch, die Kinder nicht nur mit und in ihrem Trauma zu erleben oder sie auf ihren Missbrauch zu reduzieren. Sie erleben sich so nicht mehr nur als Opfer, als Spielball des Traumas, sondern sie beginnen und fahren fort, aus sich heraus etwas zu bewirken. Sie brauchen Mitgefühl aber kein Mitleid. Mitleid macht die Helfer hilflos und ohnmächtig So fördert zum Beispiel die abendlichen Tagesreflektion mit Fragen Was hat dir heute gut getan? und Was ist dir heute gut gelungen? die Wahrnehmung für das Schöne und für das Gelungene. Das permanente Erzählen negativer Situation darf zu Gunsten einer Fokussierung auf positive Erfahrungen, z.b. an einem Schulvormittag gestoppt werden. Das regt sie an zu einer Selbstaufmerksamkeit und zu einer liebevolleren Beziehung zu sich selbst. Eine wichtige Methode zur Ressourcenfokussierung für uns selber ist es im Diensttagebuch Positives mit einer anderen Farbe zu vermerken.
55 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang 3. Bindungsorientierte pädagogische Arbeit Die bindungsorientierte pädagogische Arbeit hat die Bindungstheorie zur Grundlage. Die Bindungstheorie besagt, dass ein Säugling bei seiner Geburt eine angeborene Motivation mitbringt, sich an einen Menschen zu binden, der ihm Sicherheit bietet. Bei Angst, Schmerz und Verunsicherung wird das Bindungssystem aktiviert und der Säugling sucht Sicherheit und Versorgung bei seiner Bindungsperson. Fühlt sich das Kind sicher und angstfrei kann es anfangen die Umwelt zu erkunden, zu explorieren. Das Explorationssystem steht also mit dem Bindungssystem in einer engen Wechselwirkung. Ein feinfühliges Interaktionsverhalten fördert die Entwicklung einer sicheren Bindung. Feinfühliges Interaktionsverhalten bedeutet die Signale des Kindes zu sehen, zu hören, wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und angemessen und prompt darauf zu reagieren. Traumatisierte Kinder haben kaum feinfühliges Interaktionsverhalten erlebt und sind so nicht sicher gebunden. Sie haben Pflegepersonen erlebt, die sich emotional von ihnen zurückgezogen, die sich feindselig und grenzüberschreitend ihnen gegenüber verhalten haben. Ihre basalen Grundbedürfnisse wurden oft nicht befriedigt. So entwickelte sich bei den Kindern ein hoch unsicheres Bindungsmuster. In der Begegnung mit den Kindern auf Refugio heißt nun auch ihre Signale wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und entsprechend darauf zu reagieren. Die Bedürfnisse und die Signale der Kinder, verpackt in originelle Verhaltensweisen, sind oft auch irritierend und erscheinen auf den ersten Blick unpassend: Sie bedrängen, sie zeigen sich wütend, sie ziehen sich zurück, sie provozieren, sie horten Nahrungsmittel, Reagiere ich hier nur auf das gezeigte Verhalten lade ich eher zur Eskalation ein. Gelingt es die dahinterliegenden Gefühle und Empfindungen in Worte zu fassen, versteht sich das Kind als verstanden, als angenommen, als gehalten. Thomas Hensel vom Kindertraumainstitut in Offenburg spricht in einer festgefahrenen Kommunikation von einem Gangwechsel. Schlittere ich mit meinem Wunsch, mit meiner Aufforderung den Tisch abzuräumen in eine Eskalation, schalte ich in einen anderen Gang. Ich wechsle in den Gang der Empathie, in das aktive Zuhören und das Verbalisieren emotionaler Inhalte. Durch diesen emotional orientierten Dialog verstehe ich als Pädagoge, was bei dem Kind momentan wirklich los ist. Wenn ich hier einen Zugang bekomme muss ich ihm nicht unterstellen, dass er wieder mal faul ist oder mir eins auswischen will. Das Kind erlernt so den Umgang mit seinen Emotionen, es lernt sich selber wahrzunehmen, sich zu kontrollieren und erlangt Selbstwirksamkeit.
56 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Jede neue Interaktionserfahrung des Kindes ist auch eine neue neuronale Erfahrung. Die Kinder erleben auf der Erlebensebene etwas Neues und Korrigierendes und diese neue Erfahrung bahnt sich auch neue bisher wenig vorhandene neuronale Verbindungen. Karl Heinz Brisch sagt: Viele konstante Neuerfahrungen dieser Art werden mit der Zeit zu einem generalisierbaren Muster, das schließlich auch neue Verhaltensweisen mit Spielkameraden ermöglicht. Jedes Kind auf Refugio hat eine Bezugsbetreuerin oder einen Bezugsbetreuer. Ihnen kommt auch die wichtige Aufgabe zu, in besonderen Belastungssituationen wie z.b. Krankheit, Arztbesuche, Krisengespräche in der Schule, sich als sichere Basis anzubieten. Sie brauchen die Bereitschaft und die Fähigkeit emotional zu investieren. Die Pädagogik des Sicheren Ortes heißt auch auf der Ebene der Bindungpädagogik, dass bei Kindern, die schwieriges Verhalten zeigen, nicht die Beziehung und ihr Platz in Frage gestellt wird. Das Konzept, die Einrichtung, das Team braucht eine Haltefähigkeit, auch für außer sich geratene Kinder. 4. Die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter sind Teil des Konzeptes Die Kinder bringen ihre Interaktions- und Bindungserfahrungen als einen Teil ihres Lebensrucksackes mit auf die Wohngruppe. Ihre Notfallstrategien, ihre Bindungserfahrungen und ihre Beziehungserwartung sind als neuronale Muster verankert. Und als Teil ihrer Weiterentwicklung und Heilung ist es auch ein wichtiger Aspekt, dass sie ihre Erfahrungen reinszenieren und nun aber neue und korrigierende Erfahrungen machen. Die Belastungen und die Anforderungen an die Pädagogischen Fachkräfte sind mannigfaltig. Forschungen weisen die Gefahr einer sekundären Traumatisierung von Fachkräften, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, nach. So beinhaltet die Pädagogik des Sicheren Ortes neben der äußeren und inneren Sicherheit der Kinder auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Das heißt, dass die Fachkräfte auch in zentralen Ansatzpunkten der traumapädagogischen Arbeit in ihrer Kompetenzentwicklung unterstützt werden: Balance der Sinneswahrnehmungen (anstatt nicht mehr bei Sinnen zu sein bin ich aller meiner Sinne gewahr) Förderung der Emotionsregulation Stärkung der Selbstwirksamkeit Förderung der Resilienzfaktoren und der Ressourcenorientierung
57 Fachtagung - Das traumapädagogische Konzept von Refugio / Seite Thomas Lang Die strukturellen Rahmenbedingungen der Einrichtung müssen so ausgestaltet sein, dass sie übermäßig belastende Arbeitssituationen und sekundäre Traumatisierungen helfen zu vermeiden. Hierzu gehören: Sach- und Fachkompetenz durch Fort- und Weiterbildungen Fall-, Team- und Einzelberatungen, Supervision Temporäre Begleitung und Präsenz durch Kolleginnen und Kollegen und Fachdienst (in Krisensituationen ggf. unter Einbeziehung der Leitung) Aktive Unterstützung zur Selbstfürsorge Bereitstellen von personellen und materiellen Ressourcen Multidisziplinäres Kooperationsnetzwerk Rückblick und Ausblick Traumapädagogik und die Umsetzung eines traumapädagogischen Konzeptes braucht Begeisterung und Kraft auf den verschiedensten Ebenen einer Institution. Traumapädagogik schafft Begeisterung, weil sie verschiedene bisher unerklärliche Verhaltensweisen von Kindern erklärbar macht und die Hilflosigkeit, die Ohnmacht, die Angst, die Wut, die Scham und den Ekel auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Zusammenhang stellt und so verständlich macht. Traumapädagogik ist auch eine Haltung, sie stellt aber auch Interventionen und Methoden zur Verfügung. Traumapädagogik kommt mitunter etwas frech daher. Schnell wird sie mit dem Etikett Du bist die Neue (Pädagogik) versehen und ihr wird unterstellt die Bessere (Pädagogik) sein zu wollen. Aber es geht nicht um besser oder schlechter, um ein entweder oder, es geht um eine Erweiterung bestehender Konzepte, es geht um eine Integration von Haltung, Wissen und Handlungsmöglichkeiten in die eigene Person. Die eigene (fachliche) Persönlichkeit darf nicht geschwächt werden durch den Wunsch permanent trauma- und bindungspädagogisch korrekt zu denken, zu fühlen und zu handeln. Gibt es das überhaupt? Die Kinder brauchen viel Normalität und ehrliche Reaktionen, sie brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit ihren bisherigen Stärken aber auch Schwächen zeigen und sie brauchen pädagogische Bezugsbetreurinnen und -betreuer mit einer großen Reflektionsbereitschaft und einer Freude an eigenen Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozessen. Thomas Hensel sagt, es braucht Fachkräfte, die bereit sind, zu und mit 50% an sich zu arbeiten. Die bisherige Arbeit in den letzten Monaten zeigt, dass es in Vielem auch viel Normalität braucht, dass die Basis einer traumapädagogischen Konzeptes jedoch die Stabilität und somit die Versorgung des Mitarbeiterteams darstellt. In diesem Prozess liegt auch viel Besonderheit. Ihnen liebe Gäste danke ich nun für Ihre Aufmerksamkeit und euch liebe Kolleginnen und liebe Kollegen von Refugio danke ich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Arbeit in den vergangenen Monaten.
58 Fachtag Refugio, Rupert-Mayer-Haus,Göppingen / Seite 1 Dr. med. Markus Löble, KJPP, Christophsbad, Göppingen Anregungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Sehr geehrte Gäste, lieber Herr Hummel, lieber Herr Lang, liebes Team von Refugio, was könnten Anregungen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie für die neu entstandene Gruppe Refugio sein? Zunächst einmal: machen Sie weiter so! Seit 6 Jahren schon arbeitet die Göppinger Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Rupy zusammen und in dieser Zeit ist eine vertrauensvolle und fruchtbare Zusammen-Arbeit entstanden, die wahrlich beiden Einrichtungen Anregungen bietet. Auch wir, die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Christophsbad profitieren von Innovationen, die im Rupert-Mayer-Haus entwickelt werden, und nun davon, dass sich diese mit Refugio in einem modernen traumapädagogischen Konzept für eine neue Wohngruppe manifestiert. Hierzu gratuliere ich noch einmal ganz offiziell. Refugio wird sich in die jugendhilfliche und pädagogische, die schulische und kinder- und jugendpsychiatrische Landschaft der Region einbetten und wird sich, zusammen mit der zweiten Traumagruppe im Landkreis ( Louise de Marillac ) gut entwickeln. Wir sehen schon an der Zahl der Gäste, wie gut dies funktioniert. Sich einbetten in eine Region, in Vorhandenes, heißt auch, sich einbetten in eine Gesellschaft, in der man sich zunehmend, seit etwa 15 Jahren, für die Psychotraumatologie zu interessieren beginnt. Oder ist es so, dass sich seit ca. 15 Jahren die Gesellschaft in Deutschland erlauben darf, sich dafür zu interessieren? Peter Riedesser, der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der leider letztes Jahr im Alter von 63 Jahren, verstarb, begründete erst vor 11 Jahren mit seinem 2009 vollständig aktualisierten Lehrbuch der Psychotraumatologie[1] die moderne kinder- und jugendpsychiatrische Psychotraumatologie in Deutschland. Und doch kommt uns, vielen von uns, das Thema nicht seltsam vertraut vor? Kennen wir nicht, aus der eigenen Kindheit und Jugend noch den Unterricht, den Schulunterricht durch selbst traumatisierte Lehrer? Kriegszitterer waren es, die noch bis weit in die 60er Jahre hinein unterrichteten. Kriegszitterer, so nannte man die aus dem ersten Weltkrieg, später dem zweiten zurückkehrenden Überlebenden der Weltkriege. Im kollektiven Gedächtnis, teils präsent, teils mühsam abgewehrt, sind die Traumatisierten der beiden Weltkriege, nicht nur die zitternd und innerlich zerstört heimkehrenden Soldaten, sondern auch die traumatisierten Kinder, Jugendlichen und die Kriegsfrauen, Überlebende der Bombennächte. Ausgebombt nannte man sie, verschüttet gewesen war der oft nur unheilvoll geraunte, hinter vorgehaltener Hand aber umso mächtiger wirksame allgemeine Bezeichnungscode für diese Menschen. [1] Riedesser Peter, Fischer Gottfried: Lehrbuch der Psychotraumatologie. UTB, Stuttgart; 4. aktualisierte und erweiterte Auflage, Mai 2009
Förderbereiche und. in der Förderschule ES. bei komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Typ-II-Traumata)
 Förderbereiche und methoden in der Förderschule ES bei komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Typ-II-Traumata) EREV Forum Eisenach 23. 26. 11. 2010 Förderbereiche und -methoden in der Förderschule
Förderbereiche und methoden in der Förderschule ES bei komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Typ-II-Traumata) EREV Forum Eisenach 23. 26. 11. 2010 Förderbereiche und -methoden in der Förderschule
Die psychiatrisch/-psychotherapeutische Perspektive psychische Folgen von Vernachlässigung und wiederholten Misshandlungen in der Kindheit
 Die psychiatrisch/-psychotherapeutische Perspektive psychische Folgen von Vernachlässigung und wiederholten Misshandlungen in der Kindheit Tagung «Gefährdungsmeldung ein heisses Eisen!» Marc Schmid, Weinfelden,
Die psychiatrisch/-psychotherapeutische Perspektive psychische Folgen von Vernachlässigung und wiederholten Misshandlungen in der Kindheit Tagung «Gefährdungsmeldung ein heisses Eisen!» Marc Schmid, Weinfelden,
Brauchen wir traumapädagogische Konzepte?
 Brauchen wir traumapädagogische Konzepte? Das Konzept der Wohngruppe Greccio St. Canisius Schwäbisch-Gmünd M. Schmid, B. Lang, K., Jaskowic, J.M. Fegert, D. Wiesinger Schlosshofen 30. Juni 2008 Gliederung
Brauchen wir traumapädagogische Konzepte? Das Konzept der Wohngruppe Greccio St. Canisius Schwäbisch-Gmünd M. Schmid, B. Lang, K., Jaskowic, J.M. Fegert, D. Wiesinger Schlosshofen 30. Juni 2008 Gliederung
Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe Herausforderungen und Antworten
 Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe Herausforderungen und Antworten Referent: Marc Schmid, Hanau, 18.05.2011 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik 1 Einleitung Obwohl die Welt
Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe Herausforderungen und Antworten Referent: Marc Schmid, Hanau, 18.05.2011 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik 1 Einleitung Obwohl die Welt
Fachtagung zum Abschluss des von der World Childhood Foundation gefördeten Pflegekinderprojekts der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm
 Traumasensibilität und Traumapädagogik Fachtagung zum Abschluss des von der World Childhood Foundation gefördeten Pflegekinderprojekts der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm Referent: Marc Schmid Günzburg,
Traumasensibilität und Traumapädagogik Fachtagung zum Abschluss des von der World Childhood Foundation gefördeten Pflegekinderprojekts der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm Referent: Marc Schmid Günzburg,
Verständnis komplexer Traumafolgestörungen und dissoziativer Symptome
 Verständnis komplexer Traumafolgestörungen und dissoziativer Symptome Fachtag «guterhirte» Marc Schmid, Ulm, 19.05.2017 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik 1 Beitrag der Psychotraumatologie Einleitung
Verständnis komplexer Traumafolgestörungen und dissoziativer Symptome Fachtag «guterhirte» Marc Schmid, Ulm, 19.05.2017 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik 1 Beitrag der Psychotraumatologie Einleitung
Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege Tagung Davos
 Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege Tagung Davos 20. 22.09.2017 Workshop Alternativen und Ergänzungen zur Medikation? Philipp Lehmann, dipl. in Sozialer Arbeit, Leiter Pflege und Pädagogik
Schweizerische Vereinigung für Jugendstrafrechtspflege Tagung Davos 20. 22.09.2017 Workshop Alternativen und Ergänzungen zur Medikation? Philipp Lehmann, dipl. in Sozialer Arbeit, Leiter Pflege und Pädagogik
Korrigierende Beziehungsgestaltung bei traumatisierten Kindern und Erwachsenen in Einrichtungen
 Korrigierende Beziehungsgestaltung bei traumatisierten Kindern und Erwachsenen in Einrichtungen 3. Impulstagung Wohnheim Tilia Marc Schmid, Illnau, 2. November 2017 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik
Korrigierende Beziehungsgestaltung bei traumatisierten Kindern und Erwachsenen in Einrichtungen 3. Impulstagung Wohnheim Tilia Marc Schmid, Illnau, 2. November 2017 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik
Die Bedeutung des sicheren Raumes für eine innovative Traumapädagogik
 Die Bedeutung des sicheren Raumes für eine innovative Traumapädagogik Tagung Zentrum für Frühförderung Traumaerlebnisse Traumaarbeit und Traumapädagogik mit Kleinkinder Marc Schmid, Basel, 31. Oktober
Die Bedeutung des sicheren Raumes für eine innovative Traumapädagogik Tagung Zentrum für Frühförderung Traumaerlebnisse Traumaarbeit und Traumapädagogik mit Kleinkinder Marc Schmid, Basel, 31. Oktober
Informationsveranstaltung Modellversuch Traumapädagogik Was ist «Traumapädagogik»? Brauchen wir diese?
 Informationsveranstaltung Modellversuch Traumapädagogik Was ist «Traumapädagogik»? Brauchen wir diese? Marc Schmid (Basel) & Birgit Lang (Ulm/Göppingen) Bern, den 23.3.2012 Kinder- und Jugendpsychiatrische
Informationsveranstaltung Modellversuch Traumapädagogik Was ist «Traumapädagogik»? Brauchen wir diese? Marc Schmid (Basel) & Birgit Lang (Ulm/Göppingen) Bern, den 23.3.2012 Kinder- und Jugendpsychiatrische
Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe und als Mandanten von Kinderanwälten
 Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe und als Mandanten von Kinderanwälten Weiterbildung für die Kinderanwaltschaft.ch Zentrum Karl der Große Zürich Referent: Marc Schmid Zürich,
Komplex traumatisierte Kinder in der stationären Jugendhilfe und als Mandanten von Kinderanwälten Weiterbildung für die Kinderanwaltschaft.ch Zentrum Karl der Große Zürich Referent: Marc Schmid Zürich,
Traumapädagogische Überlegungen zur Kooperation «Fachaustausch Kooperation» Marc Schmid, Basel, Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik
 Traumapädagogische Überlegungen zur Kooperation «Fachaustausch Kooperation» Marc Schmid, Basel, 5.12.2013 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Gliederung Ultrakurze Einführung in die Traumafolgestörungen
Traumapädagogische Überlegungen zur Kooperation «Fachaustausch Kooperation» Marc Schmid, Basel, 5.12.2013 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Gliederung Ultrakurze Einführung in die Traumafolgestörungen
Belastungsfaktor häusliche Gewalt transgenerationale Brutalisierung affektiver Beziehungen und Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
 Belastungsfaktor häusliche Gewalt transgenerationale Brutalisierung affektiver Beziehungen und Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung Basel, den 24.08.2011 Fachtagung von Halt-Gewalt im Bildungszentrum
Belastungsfaktor häusliche Gewalt transgenerationale Brutalisierung affektiver Beziehungen und Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung Basel, den 24.08.2011 Fachtagung von Halt-Gewalt im Bildungszentrum
Gliederung. Was ist ein Trauma? Einleitung. Obwohl die Welt voller Leid ist, ist sie auch voller Siege über das Leid. Was ist ein Trauma?
 Gliederung Was ist ein Trauma? Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik Fachtag «Als die Sorgenfresser kamen Wege der Traumapädagogik» Traumaentwicklungsstörung Warum eine Traumapädagogik?
Gliederung Was ist ein Trauma? Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik Fachtag «Als die Sorgenfresser kamen Wege der Traumapädagogik» Traumaentwicklungsstörung Warum eine Traumapädagogik?
Fachtagung. anlässlich der. Eröffnung der salus Frauenklinik Hürth. Wann ist es eine Traumafolgestörung
 Fachtagung anlässlich der Eröffnung der salus Frauenklinik Hürth Wann ist es eine Traumafolgestörung Samia Said Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Systemische Traumatherapeutin
Fachtagung anlässlich der Eröffnung der salus Frauenklinik Hürth Wann ist es eine Traumafolgestörung Samia Said Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Systemische Traumatherapeutin
Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik Fachtagung «Warum und wenn, wie sollte ich etwas ändern?»
 Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik Fachtagung «Warum und wenn, wie sollte ich etwas ändern?» Marc Schmid, Dornach, 31. Januar/1. Februar 2014 Kinder- und Jugendpsychiatrische
Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik Fachtagung «Warum und wenn, wie sollte ich etwas ändern?» Marc Schmid, Dornach, 31. Januar/1. Februar 2014 Kinder- und Jugendpsychiatrische
Das Normale am Verrückten
 Das Normale am Verrückten Erleben und Verhalten von traumatisierten / bindungsgestörten Kindern durch Videoanalyse verständlich machen Jedes Verhalten hat einen Grund wenn nicht im Heute dann in der Vergangenheit
Das Normale am Verrückten Erleben und Verhalten von traumatisierten / bindungsgestörten Kindern durch Videoanalyse verständlich machen Jedes Verhalten hat einen Grund wenn nicht im Heute dann in der Vergangenheit
Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b.
 Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b. häusliche Gewalt Vernachlässigung unsichere oder oft wechselnde Bindungspersonen emotionale Ablehnung körperliche
Kinder können in ihren Familien häufig massiv angstbesetzte Situationen erlebt haben, wie z.b. häusliche Gewalt Vernachlässigung unsichere oder oft wechselnde Bindungspersonen emotionale Ablehnung körperliche
Komplex traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe
 Komplex traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe Forum AEF 2011: Aide à l enfance et à la familie Kinder- und Familienhilfe Thema: Krisen und Krisenintervention Referent: Marc Schmid Luxemburg,
Komplex traumatisierte Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe Forum AEF 2011: Aide à l enfance et à la familie Kinder- und Familienhilfe Thema: Krisen und Krisenintervention Referent: Marc Schmid Luxemburg,
Betreuungssettings für (komplex) traumatisierte Kinder: Konzepte und Strukturen optimieren
 Betreuungssettings für (komplex) traumatisierte Kinder: Konzepte und Strukturen optimieren Ein von der Aktion Mensch gefördertes Projekt des Christlichen Jugenddorf Werkes (CJD) in Kooperation mit der
Betreuungssettings für (komplex) traumatisierte Kinder: Konzepte und Strukturen optimieren Ein von der Aktion Mensch gefördertes Projekt des Christlichen Jugenddorf Werkes (CJD) in Kooperation mit der
Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden?
 Bild: Fotolia Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden? Verstehen - Lernen Lehren. Jan Glasenapp (2018) Bestimmt (k)eine
Bild: Fotolia Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden? Verstehen - Lernen Lehren. Jan Glasenapp (2018) Bestimmt (k)eine
Jedem KIND gerecht werden! Die Kita als sicherer und kultursensibler Lebensund Lernort für Kinder mit Fluchterfahrungen
 Jedem KIND gerecht werden! Die Kita als sicherer und kultursensibler Lebensund Lernort für Kinder mit Fluchterfahrungen Workshop: Besonderheiten im Umgang mit Kindern und Familien nach Fluchterfahrung
Jedem KIND gerecht werden! Die Kita als sicherer und kultursensibler Lebensund Lernort für Kinder mit Fluchterfahrungen Workshop: Besonderheiten im Umgang mit Kindern und Familien nach Fluchterfahrung
Korrigierende Beziehungserfahrungen sind möglich!
 Korrigierende Beziehungserfahrungen sind möglich! Möglichkeiten und Herausforderungen für die teil- und vollstationäre Jugendhilfe Rastatt 19.01.2018 Prof. Dr. Mone Welsche Katholische Hochschule Freiburg
Korrigierende Beziehungserfahrungen sind möglich! Möglichkeiten und Herausforderungen für die teil- und vollstationäre Jugendhilfe Rastatt 19.01.2018 Prof. Dr. Mone Welsche Katholische Hochschule Freiburg
Einleitung. Gliederung. Einleitung. Obwohl die Welt voller Leid ist, ist sie auch voller Siege über das Leid.
 Einleitung Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik-Einführung in traumapädagogische Konzepte Die Erwachsenen beschäftigen sich zu wenig mit den Problemen, die Jugendliche haben,
Einleitung Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik-Einführung in traumapädagogische Konzepte Die Erwachsenen beschäftigen sich zu wenig mit den Problemen, die Jugendliche haben,
Traumatisierung durch häusliche Gewalt und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Bindungsfähigkeit von Frauen und Kindern
 Traumatisierung durch häusliche Gewalt und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Bindungsfähigkeit von Frauen und Kindern Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen
Traumatisierung durch häusliche Gewalt und die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Bindungsfähigkeit von Frauen und Kindern Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung
 WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
WORKSHOP 3 Sexualisierte Gewalt ansprechen? Opferperspektive Mythen Scham und Schuld Hintergründe von Traumatisierung 1. Sensibilisierung 2. Mythen abbauen LERNZIELE 3. Sekundäre Viktimisierung verhindern
Wirkung von Trauma im System Familie
 Wirkung von Trauma im System Familie EREV Forum 2016-44 Sozialraumnahe Hilfen Auf dem Weg mit (un-) begleiteten Minderjährigen und Familien 21.-23. September 2016 in Würzburg Barbara Freitag, Dipl.-Psych.,
Wirkung von Trauma im System Familie EREV Forum 2016-44 Sozialraumnahe Hilfen Auf dem Weg mit (un-) begleiteten Minderjährigen und Familien 21.-23. September 2016 in Würzburg Barbara Freitag, Dipl.-Psych.,
Überlegungen zur praktischen Umsetzung traumapädagogischer Ansätze in Frauenhäusern. Gliederung. Einleitung
 Gliederung 1. Einige Zahlen und Fakten zur häuslichen Gewalt Überlegungen zur praktischen Umsetzung traumapädagogischer Ansätze in Frauenhäusern Baden-Württemberg Stiftung: Kinder in Frauenhäusern Wege
Gliederung 1. Einige Zahlen und Fakten zur häuslichen Gewalt Überlegungen zur praktischen Umsetzung traumapädagogischer Ansätze in Frauenhäusern Baden-Württemberg Stiftung: Kinder in Frauenhäusern Wege
Traumapädagogik. im Kontext kultursensiblen Handelns
 Traumapädagogik im Kontext kultursensiblen Handelns Quelle: Lars Dabbert- Workshop Traumapädagogik - Fortbildung Nürrnberg Referentin Brigitte Zwenger-Balink Traumapädagogik Sind: Sammelbegriff für die
Traumapädagogik im Kontext kultursensiblen Handelns Quelle: Lars Dabbert- Workshop Traumapädagogik - Fortbildung Nürrnberg Referentin Brigitte Zwenger-Balink Traumapädagogik Sind: Sammelbegriff für die
Das Verborgene zu Tage fördern. Psychoanalytischpädagogisches
 Institut für Traumapädagogik Berlin Zertifizierte Weiterbildung Supervision Das Verborgene zu Tage fördern. Psychoanalytischpädagogisches Verstehen und die Gestaltung der Beziehung JProf. Dr. David Zimmermann
Institut für Traumapädagogik Berlin Zertifizierte Weiterbildung Supervision Das Verborgene zu Tage fördern. Psychoanalytischpädagogisches Verstehen und die Gestaltung der Beziehung JProf. Dr. David Zimmermann
Grundzüge einer Pädagogik des Sicheren Ortes
 Grundzüge einer Pädagogik des Sicheren Ortes Dipl. Behindertenpädagoge Martin Kühn Workshop A.01. / Fachtagung Trauma & systemische Praxis Syke, 20.08.2010 Gliederung 1. Zur Situation in pädagogischen
Grundzüge einer Pädagogik des Sicheren Ortes Dipl. Behindertenpädagoge Martin Kühn Workshop A.01. / Fachtagung Trauma & systemische Praxis Syke, 20.08.2010 Gliederung 1. Zur Situation in pädagogischen
Psychosoziale Unterstützung für die Helfer zur Prävention von tätigkeitsbedingten Erkrankungen
 Psychosoziale Unterstützung für die Helfer zur Prävention von tätigkeitsbedingten Erkrankungen Dr. Marion Koll-Krüsmann 10. November 2018 53. Linzer Psychiatrischer Samstag Ein Trauma erleben und dann?
Psychosoziale Unterstützung für die Helfer zur Prävention von tätigkeitsbedingten Erkrankungen Dr. Marion Koll-Krüsmann 10. November 2018 53. Linzer Psychiatrischer Samstag Ein Trauma erleben und dann?
Trauma und Gruppe. Zentrum für Traumapädagogik
 Trauma und Gruppe Jacob Bausum Traumapädagogik ist ein Sammelbegriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichen
Trauma und Gruppe Jacob Bausum Traumapädagogik ist ein Sammelbegriff für die im Besonderen entwickelten pädagogischen Konzepte zur Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in den unterschiedlichen
Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung
 Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik
Die Bedeutung der sicheren Bindung. Chancen und Risiken der kindlichen Entwicklung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik
Danach ist nichts mehr wie es war
 Danach ist nichts mehr wie es war -tische Erlebnisse und ihre Folgen- Dipl.Psych. Claudia Radermacher-Lamberty Caritas Familienberatung Reumontstraße 7a 52064 Aachen el.: 0241 /3 39 53 Auswirkungen auf
Danach ist nichts mehr wie es war -tische Erlebnisse und ihre Folgen- Dipl.Psych. Claudia Radermacher-Lamberty Caritas Familienberatung Reumontstraße 7a 52064 Aachen el.: 0241 /3 39 53 Auswirkungen auf
Missbrauch und Life - events
 Missbrauch und Life - events Gertrude Bogyi, Petra Sackl-Pammer, Sabine Völkl-Kernstock Curriculumdirektion Humanmedizin Medizinische Missbrauch und Life events Missbrauch an Kindern und Jugendlichen kann
Missbrauch und Life - events Gertrude Bogyi, Petra Sackl-Pammer, Sabine Völkl-Kernstock Curriculumdirektion Humanmedizin Medizinische Missbrauch und Life events Missbrauch an Kindern und Jugendlichen kann
Traumapädagogische Diagnostik mit psychometrischen Fragebögen 5. Tagung Soziale Diagnostik
 Traumapädagogische Diagnostik mit psychometrischen Fragebögen 5. Tagung Soziale Diagnostik Marc Schmid, Olten, 17. Oktober 2014 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Einleitung Traumapädagogik Man weiss
Traumapädagogische Diagnostik mit psychometrischen Fragebögen 5. Tagung Soziale Diagnostik Marc Schmid, Olten, 17. Oktober 2014 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Einleitung Traumapädagogik Man weiss
Traumapädagogik als Pädagogik der Selbstbemächtigung von jungen Menschen Wilma Weiß
 Fachtag Traumapädagogik Traumapädagogik als Pädagogik der Selbstbemächtigung von jungen Menschen Wilma Weiß Reformpädagogik Heilpädagogik Psychoanalytische Pädagogik Die Pädagogik der Befreiung Milieutherapeutische
Fachtag Traumapädagogik Traumapädagogik als Pädagogik der Selbstbemächtigung von jungen Menschen Wilma Weiß Reformpädagogik Heilpädagogik Psychoanalytische Pädagogik Die Pädagogik der Befreiung Milieutherapeutische
Katzen als Begleiterinnen in der Psychotherapie
 Katzen als Begleiterinnen in der Psychotherapie Auswahl der Tiere Artgerechte Aufzucht Gut sozialisierte Katzen, die während ihrer frühen Sozialisierungsphase (2. bis 7. Lebenswoche) mit Artgenossen
Katzen als Begleiterinnen in der Psychotherapie Auswahl der Tiere Artgerechte Aufzucht Gut sozialisierte Katzen, die während ihrer frühen Sozialisierungsphase (2. bis 7. Lebenswoche) mit Artgenossen
RETRAUMATISIERUNG IM KONTEXT VON KONTAKTRECHTEN
 KINDERKLINIK UND POLIKLINIK IM DR. VON HAUNERSCHEN KINDERSPITAL RETRAUMATISIERUNG IM KONTEXT VON KONTAKTRECHTEN GRUNDLAGEN, INTERVENTION UND PRÄVENTION Karl Heinz Brisch ÜBERLEBENSWICHTIGE BEDÜRFNISSE
KINDERKLINIK UND POLIKLINIK IM DR. VON HAUNERSCHEN KINDERSPITAL RETRAUMATISIERUNG IM KONTEXT VON KONTAKTRECHTEN GRUNDLAGEN, INTERVENTION UND PRÄVENTION Karl Heinz Brisch ÜBERLEBENSWICHTIGE BEDÜRFNISSE
Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41)
 Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41) Wer sind wir? Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz, Münster
Traumapädagogik in der stationären Jugendhilfe ein Weg aus der Ohnmacht Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen (Wilma Weiß, 41) Wer sind wir? Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz, Münster
Einleitung Trauma, Selbstkontrolle, Freiheit und geschlossene Unterbringung. Gliederung. Was ist ein Trauma? Flucht Freeze.
 Einleitung Trauma, Selbstkontrolle, Freiheit und geschlossene Unterbringung Komplexe Traumafolgestörungen und ihre Auswirkungen auf die Selbststeuerungsfähigkeit Bedeutung für die Ausgestaltung von pädagogischer
Einleitung Trauma, Selbstkontrolle, Freiheit und geschlossene Unterbringung Komplexe Traumafolgestörungen und ihre Auswirkungen auf die Selbststeuerungsfähigkeit Bedeutung für die Ausgestaltung von pädagogischer
Komplexe Traumafolgestörungen und ihre Auswirkungen auf die Selbststeuerungsfähigkeit Bedeutung für die Ausgestaltung von pädagogischer Settings
 Komplexe Traumafolgestörungen und ihre Auswirkungen auf die Selbststeuerungsfähigkeit Bedeutung für die Ausgestaltung von pädagogischer Settings Schwarzacher Symposium: Qualitätsstandards für freiheitsentziehende
Komplexe Traumafolgestörungen und ihre Auswirkungen auf die Selbststeuerungsfähigkeit Bedeutung für die Ausgestaltung von pädagogischer Settings Schwarzacher Symposium: Qualitätsstandards für freiheitsentziehende
Traumagerechtes Vorgehen in der systemischen Arbeit
 Traumagerechtes Vorgehen in der systemischen Arbeit 12. DGSF-Tagung Freiburg 04.10.2012 Nikola v. Saint Paul, Dipl.-Psych., PP, KJP Praxis für Psychotherapie und Traumabehandlung 79098 Freiburg, Poststr.
Traumagerechtes Vorgehen in der systemischen Arbeit 12. DGSF-Tagung Freiburg 04.10.2012 Nikola v. Saint Paul, Dipl.-Psych., PP, KJP Praxis für Psychotherapie und Traumabehandlung 79098 Freiburg, Poststr.
Trauma und Traumafolgestörung bei Kindern und Jugendlichen
 Erziehung zur Selbstwirksamkeit Fachtagung zur Traumapädagogik Deutscher Kinderschutzbund e. V. Trauma und Traumafolgestörung bei Kindern und Jugendlichen Kiel, 3.7.2014 Dr. med. Andreas Krüger Institut
Erziehung zur Selbstwirksamkeit Fachtagung zur Traumapädagogik Deutscher Kinderschutzbund e. V. Trauma und Traumafolgestörung bei Kindern und Jugendlichen Kiel, 3.7.2014 Dr. med. Andreas Krüger Institut
Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst?
 Fachtagung München : Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 09.06.2016 Alexander Korittko 1 Wurzeln und Flügel ! Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern,
Fachtagung München : Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 09.06.2016 Alexander Korittko 1 Wurzeln und Flügel ! Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern,
TRAUMA ALS PROZESSHAFTES GESCHEHEN
 Renate Jegodtka TRAUMA ALS PROZESSHAFTES GESCHEHEN Weinheimer Gespräch 2010 Trauma und Systemische Praxis Syke 20.08.2010 1 ÜBERSICHT 1. Alles Trauma? 2. Trauma als psychosozialer Prozess 3. Trauma als
Renate Jegodtka TRAUMA ALS PROZESSHAFTES GESCHEHEN Weinheimer Gespräch 2010 Trauma und Systemische Praxis Syke 20.08.2010 1 ÜBERSICHT 1. Alles Trauma? 2. Trauma als psychosozialer Prozess 3. Trauma als
Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL
 Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL 24. Januar 2017 Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel Gliederung Beispiele für Traumata (u.a. aus der Sprechstunde
Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL 24. Januar 2017 Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel Gliederung Beispiele für Traumata (u.a. aus der Sprechstunde
Bindung. Definition nach John Bowlby:
 Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
Bindung und Bildung Bindung Definition nach John Bowlby: Beziehung ist der übergeordnete Begriff Bindung ist Teil von Beziehung Mutter und Säugling sind Teilnehmer/innen in einem sich wechselseitig bedingenden
TRAUMAHILFE NETZWERK SCHWABEN AUGSBURG. Umgang mit Trauma in der Asylarbeit Basisinformationen Maria Johanna Fath 2015 Prof.Dr.
 TRAUMAHILFE AUGSBURG NETZWERK SCHWABEN Umgang mit Trauma in der Asylarbeit Basisinformationen 2015 Maria Johanna Fath 2015 Prof.Dr.Andrea Kerres 0 Definition - Trauma Trauma (griechisch) = Verletzung Allgemein
TRAUMAHILFE AUGSBURG NETZWERK SCHWABEN Umgang mit Trauma in der Asylarbeit Basisinformationen 2015 Maria Johanna Fath 2015 Prof.Dr.Andrea Kerres 0 Definition - Trauma Trauma (griechisch) = Verletzung Allgemein
Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit. Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert?
 Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert? Die einzig verlässlichen Erinnerungen sind die Erinnerungen des
Trauma, Beziehung und Beziehungslosigkeit Können wir unserer Erinnerung trauen? Was ist Erinnerung überhaupt, und wo wird sie gespeichert? Die einzig verlässlichen Erinnerungen sind die Erinnerungen des
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Landesnervenklinik Sigmund Freud
 Landesnervenklinik Sigmund Freud Trauma WHO, ICD-10: Traumata sind kurz- oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende
Landesnervenklinik Sigmund Freud Trauma WHO, ICD-10: Traumata sind kurz- oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tiefgreifende
Komplex traumatisierte und bindungsgestörte Heimkinder, welche Ideen kann die Verhaltenstherapie in die stationäre Jugendhilfe einbringen
 Komplex traumatisierte und bindungsgestörte Heimkinder, welche Ideen kann die Verhaltenstherapie in die stationäre Jugendhilfe einbringen 6.März 2010 DGVT - Tagung in Berlin Marc Schmid Gliederung 1. Einleitung
Komplex traumatisierte und bindungsgestörte Heimkinder, welche Ideen kann die Verhaltenstherapie in die stationäre Jugendhilfe einbringen 6.März 2010 DGVT - Tagung in Berlin Marc Schmid Gliederung 1. Einleitung
DID eine Herausforderung für alle Beteiligten. Mainz, den 25.Nov Referentin: Dr. med. Brigitte Bosse
 DID eine Herausforderung für alle Beteiligten Mainz, den 25.Nov. 2015 Referentin: Dr. med. Brigitte Bosse Man sieht nur was man weiß Strukturelle Dissoziation Strukturelle Dissoziation nach Nijenhuis Primäre
DID eine Herausforderung für alle Beteiligten Mainz, den 25.Nov. 2015 Referentin: Dr. med. Brigitte Bosse Man sieht nur was man weiß Strukturelle Dissoziation Strukturelle Dissoziation nach Nijenhuis Primäre
Gewalterfahrungen und Trauma bei Flüchtlingen
 Gewalterfahrungen und Trauma bei Flüchtlingen Dr. med. Barbara Wolff Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e. V. Gewalterfahrung und Trauma Durch die Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht leidet
Gewalterfahrungen und Trauma bei Flüchtlingen Dr. med. Barbara Wolff Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e. V. Gewalterfahrung und Trauma Durch die Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht leidet
BILDUNGSPROZESSE UND BEZIEHUNGSDYNAMIKEN BEI PSYCHOSOZIAL BELASTETEN KINDERN UND JUGENDLICHEN
 1 BILDUNGSPROZESSE UND BEZIEHUNGSDYNAMIKEN BEI PSYCHOSOZIAL BELASTETEN KINDERN UND JUGENDLICHEN BERLIN, 29.10.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 2 BILDUNG UND BEZIEHUNG emotionale und kognitive Entwicklung
1 BILDUNGSPROZESSE UND BEZIEHUNGSDYNAMIKEN BEI PSYCHOSOZIAL BELASTETEN KINDERN UND JUGENDLICHEN BERLIN, 29.10.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 2 BILDUNG UND BEZIEHUNG emotionale und kognitive Entwicklung
Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind
 Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind Evelyn Heyer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin PRISMA-SUPERVISION.DE Häusliche Gewalt Ängstigt Belastet
Zur Psychodynamik von Kindern, die Opfer und Zeugen von häuslicher Gewalt geworden sind Evelyn Heyer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin PRISMA-SUPERVISION.DE Häusliche Gewalt Ängstigt Belastet
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung. Trauma und Bindung
 Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Psychotherapeutische Praxis und Institut für Supervision und Weiterbildung Trauma und Bindung Auswirkungen erlebter Traumatisierung auf die Mutter-Kind-Beziehung Trauma Was kennzeichnet ein Trauma? Ausgangspunkt:
Möglichkeiten der Traumapädagogik im Pflege- und Adoptivfamilienalltag. Wundertüte e.v., Heike Karau, Zentrum für Traumapädagogik, Hanau
 Möglichkeiten der Traumapädagogik im Pflege- und Adoptivfamilienalltag Wundertüte e.v., 2.11.2013 Heike Karau, Zentrum für Traumapädagogik, Hanau Traumatisierte Kinder profitieren von Beziehungsangeboten,
Möglichkeiten der Traumapädagogik im Pflege- und Adoptivfamilienalltag Wundertüte e.v., 2.11.2013 Heike Karau, Zentrum für Traumapädagogik, Hanau Traumatisierte Kinder profitieren von Beziehungsangeboten,
Traumapädagogische Aspekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sexualisierten Gewalterfahrungen
 Traumapädagogische Aspekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sexualisierten Gewalterfahrungen Fachtagung 'Sexualität und Heimerziehung' 17.3.2016 Uni Siegen R. Semmerling Dipl. Psychologe
Traumapädagogische Aspekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sexualisierten Gewalterfahrungen Fachtagung 'Sexualität und Heimerziehung' 17.3.2016 Uni Siegen R. Semmerling Dipl. Psychologe
Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten
 Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten Beziehungen Werte Vorstellung von Sicherheit Vertrauen Selbstwertgefühl Selbstwertvertrauen/-wirksamkeitserwartung Zentrale
Auswirkungen der traumatischen Erfahrung auf Gedanken, Gefühle und Verhalten Beziehungen Werte Vorstellung von Sicherheit Vertrauen Selbstwertgefühl Selbstwertvertrauen/-wirksamkeitserwartung Zentrale
IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie
 Seminar: Psychotherapeutische Methoden in der Beratung Sitzung:13.06.2013 IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie Von Dieter Höger Referenten: Bettina Tomascsik, Elena Schweikert, Kristina
Seminar: Psychotherapeutische Methoden in der Beratung Sitzung:13.06.2013 IV Der personzentrierte Ansatz und die Bindungstheorie Von Dieter Höger Referenten: Bettina Tomascsik, Elena Schweikert, Kristina
Borderline-Quiz. Wer wird Super-Therapeut?
 Borderline-Quiz Wer wird Super-Therapeut? Was versteht man unter Borderline? Störung der Emotionsregulation Eine Identitätsstörung Borderline ist im Kern eine Eine Beziehungsstörung Pubertätskrise oder
Borderline-Quiz Wer wird Super-Therapeut? Was versteht man unter Borderline? Störung der Emotionsregulation Eine Identitätsstörung Borderline ist im Kern eine Eine Beziehungsstörung Pubertätskrise oder
4. Fachtag des Aktionsbündnisses Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen
 4. Fachtag des Aktionsbündnisses Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen Hey, ich bin normal! Traumapädagogische Methoden für den Umgang mit Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Auf sich selbst
4. Fachtag des Aktionsbündnisses Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen Hey, ich bin normal! Traumapädagogische Methoden für den Umgang mit Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Auf sich selbst
PITT - Praxis-Institut für Systemische Traumaarbeit, Trauma & Sport. Zertifiziert durch das Institut für systemisches Deeskalationsmanagement SyDeMa
 Zertifizierte Weiterbildung zum Traumapädagogen / zur Traumapädagogin Pädagogisch-therapeutische Hilfen für traumatisierte Kinder und Jugendliche 05.10.2019 05.04.2020 (Hannover) (berufsbegleitende Weiterbildung)
Zertifizierte Weiterbildung zum Traumapädagogen / zur Traumapädagogin Pädagogisch-therapeutische Hilfen für traumatisierte Kinder und Jugendliche 05.10.2019 05.04.2020 (Hannover) (berufsbegleitende Weiterbildung)
Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend?
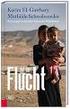 Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend? Traumatisiert arbeiten? Eingliederung von traumatisierten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt Netzwerk InProcedere Bleiberecht durch Arbeit 2. Oktober
Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend? Traumatisiert arbeiten? Eingliederung von traumatisierten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt Netzwerk InProcedere Bleiberecht durch Arbeit 2. Oktober
Umgang mit traumatisierten Kindern
 Umgang mit traumatisierten Kindern Themeninput IWB PH FHNW Brugg-Windisch, 19. Oktober 2016 Hans Burgherr und Johannes Gerber Fachpsychologen für Kinder und Jugendliche Schulpsychologischer Dienst Brugg
Umgang mit traumatisierten Kindern Themeninput IWB PH FHNW Brugg-Windisch, 19. Oktober 2016 Hans Burgherr und Johannes Gerber Fachpsychologen für Kinder und Jugendliche Schulpsychologischer Dienst Brugg
Umgang mit schwierigen Schüler/innen. Ilshofen
 Umgang mit schwierigen Schüler/innen Ilshofen 16.11.2017 Ziel für heute: Wie kann ich die Arbeit mit schwierigen Schülern gestalten mit dem Ziel, Störungen zu vermindern und selbst handlungsfähig zu bleiben.
Umgang mit schwierigen Schüler/innen Ilshofen 16.11.2017 Ziel für heute: Wie kann ich die Arbeit mit schwierigen Schülern gestalten mit dem Ziel, Störungen zu vermindern und selbst handlungsfähig zu bleiben.
Neugier braucht Sicherheit
 Neugier braucht Sicherheit Die Bedeutung der Bindungsqualität für die Entwicklungschancen Vortrag beim Fachtag der Frühförderstellen Mecklenburg-Vorpommern am 3.9.2011 Bindungen und ihre Entwicklungen
Neugier braucht Sicherheit Die Bedeutung der Bindungsqualität für die Entwicklungschancen Vortrag beim Fachtag der Frühförderstellen Mecklenburg-Vorpommern am 3.9.2011 Bindungen und ihre Entwicklungen
Pädagogische Vollversammlung St. Josefsplfege Mulfingen ggmbh Traumapädagogik
 In der folgenden Präsentation ist der klare Bezugsrahmen die vollstationäre Hilfe ich gehe aber davon aus, dass viele der von mir genannten Aspekte problemlos in andere Arbeitsbereiche integriert werden
In der folgenden Präsentation ist der klare Bezugsrahmen die vollstationäre Hilfe ich gehe aber davon aus, dass viele der von mir genannten Aspekte problemlos in andere Arbeitsbereiche integriert werden
Flüchtlingskinder zwischen Trauma und Entwicklung
 Flüchtlingskinder zwischen Trauma und Entwicklung Dr. phil. Maria Teresa Diez Grieser Fachpsychologin für Psychotherapie FSP Forschungsleitung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen Zürich,
Flüchtlingskinder zwischen Trauma und Entwicklung Dr. phil. Maria Teresa Diez Grieser Fachpsychologin für Psychotherapie FSP Forschungsleitung Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste St. Gallen Zürich,
Grundbedingungen nach Jaspers (1965)
 Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Kinder psychisch kranker Eltern
 Kinder psychisch kranker Eltern Christina Stadler Integrative Versorgung - wie kann es aussehen? Kinder psychisch kranker Eltern haben ein hohes Risiko selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln......
Kinder psychisch kranker Eltern Christina Stadler Integrative Versorgung - wie kann es aussehen? Kinder psychisch kranker Eltern haben ein hohes Risiko selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln......
Inhalt. 1 Basiswissen
 Welche Schutz- und Risikofaktoren gibt es? 22 Wie wirkt sich eine unsichere Bindung aus? 23 Was sind Bindungsstörungen? 23 1 Basiswissen Wie häufig sind Traumata? 25 Traumata kommen oft vor 26 Viele Menschen
Welche Schutz- und Risikofaktoren gibt es? 22 Wie wirkt sich eine unsichere Bindung aus? 23 Was sind Bindungsstörungen? 23 1 Basiswissen Wie häufig sind Traumata? 25 Traumata kommen oft vor 26 Viele Menschen
Opfer von Frauenhandel sprachlos, hilflos, rechtlos?
 Opfer von Frauenhandel sprachlos, hilflos, rechtlos? Aus psychotherapeutischer Sicht Barbara Abdallah-Steinkopff Psychologin, Psychotherapeutin REFUGIO München Behandlung einer Traumatisierung im politischen
Opfer von Frauenhandel sprachlos, hilflos, rechtlos? Aus psychotherapeutischer Sicht Barbara Abdallah-Steinkopff Psychologin, Psychotherapeutin REFUGIO München Behandlung einer Traumatisierung im politischen
TRAUMAPÄDAGOGIK IN DER FRÜHEN KINDHEIT
 TRAUMAPÄDAGOGIK IN DER FRÜHEN KINDHEIT ZÜRICH, 24.03.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 1 FALLSKIZZE 2 VERSTEHEN? Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. (Paul Moor, 1965, S. 15) Wir müssen
TRAUMAPÄDAGOGIK IN DER FRÜHEN KINDHEIT ZÜRICH, 24.03.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 1 FALLSKIZZE 2 VERSTEHEN? Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. (Paul Moor, 1965, S. 15) Wir müssen
HERZLICH WILLKOMMEN!
 HERZLICH WILLKOMMEN! Basiswissen Traumatologie für die Beratung Geflüchteter Diplom-Psychologin Frauke Petras Systemische Therapeutin SG Traumatologin DeGPT Sexualtherapeutin Agenda I II III IV V Was ist
HERZLICH WILLKOMMEN! Basiswissen Traumatologie für die Beratung Geflüchteter Diplom-Psychologin Frauke Petras Systemische Therapeutin SG Traumatologin DeGPT Sexualtherapeutin Agenda I II III IV V Was ist
Evaluation im Modellversuch Traumapädagogik. Dipl.-Psych. Claudia Dölitzsch (Evaluationsbeautragte)
 Evaluation im Modellversuch Traumapädagogik Dipl.-Psych. Claudia Dölitzsch (Evaluationsbeautragte) Zentrale Fragen Können wir mit der Traumapädagogik positive Veränderungen bei den Mitarbeitenden sowie
Evaluation im Modellversuch Traumapädagogik Dipl.-Psych. Claudia Dölitzsch (Evaluationsbeautragte) Zentrale Fragen Können wir mit der Traumapädagogik positive Veränderungen bei den Mitarbeitenden sowie
Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind
 Leuchtturm-Preis 2015 der Stiftung Ravensburger Verlag Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind F A B I E N N E B E C K E R - S T O L L S T A A T S I N S T I T U T F Ü R F
Leuchtturm-Preis 2015 der Stiftung Ravensburger Verlag Mütterliche Bindungserfahrung und Beziehungsqualität zum eigenen Kind F A B I E N N E B E C K E R - S T O L L S T A A T S I N S T I T U T F Ü R F
LERNEN, EMOTIONALE BELASTUNG UND DIE BEDEUTUNG DER SCHULE
 LERNEN, EMOTIONALE BELASTUNG UND DIE BEDEUTUNG DER SCHULE HAMELN, 19.09.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 1 FALLSKIZZE 2 VERSTEHEN? Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. (Paul Moor, 1965,
LERNEN, EMOTIONALE BELASTUNG UND DIE BEDEUTUNG DER SCHULE HAMELN, 19.09.2018 PROF. DR. DAVID ZIMMERMANN 1 FALLSKIZZE 2 VERSTEHEN? Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen. (Paul Moor, 1965,
Hintergrundwissen Trauma. E. L. Iskenius, Rostock
 Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Unser Auftrag. ist der caritative Dienst für den Menschen als lebendiges Zeugnis der frohen Botschaft Jesu in der Tradition der Orden.
 Unser Auftrag ist der caritative Dienst für den Menschen als lebendiges Zeugnis der frohen Botschaft Jesu in der Tradition der Orden. Nach einem Trauma gesund bleiben Dr. Doris Naumann Psychologische Psychotherapeutin
Unser Auftrag ist der caritative Dienst für den Menschen als lebendiges Zeugnis der frohen Botschaft Jesu in der Tradition der Orden. Nach einem Trauma gesund bleiben Dr. Doris Naumann Psychologische Psychotherapeutin
Kinder stark machen Die Bedeutung von Bindung und Autonomie in der Pädagogik
 Kinder stark machen Die Bedeutung von Bindung und Autonomie in der Pädagogik Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Kinder stark machen Die Bedeutung von Bindung und Autonomie in der Pädagogik Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Dienstag, 27. September 16
 Vom Umgang mit Schutzsuchenden und ihren Helfer/innen ERV Forum 2016-44 Sozialraumnahe Hilfen Auf dem Weg...mit (un-)begleiteten Minderjährigen und Familien Würzburg, 21.-23.9.2016 Übersicht Was ist ein
Vom Umgang mit Schutzsuchenden und ihren Helfer/innen ERV Forum 2016-44 Sozialraumnahe Hilfen Auf dem Weg...mit (un-)begleiteten Minderjährigen und Familien Würzburg, 21.-23.9.2016 Übersicht Was ist ein
Traumatischer Stress in der Familie
 Traumatisierte Familien Traumatischer Stress in der Familie Das erstarrte Mobile Das erstarrte Mobile 1 Ein triadisches Modell post-traumatischer Prozesse Traumatische Zange: Flucht - Kampf Einfrieren
Traumatisierte Familien Traumatischer Stress in der Familie Das erstarrte Mobile Das erstarrte Mobile 1 Ein triadisches Modell post-traumatischer Prozesse Traumatische Zange: Flucht - Kampf Einfrieren
Die Bedeutung von Bindung in Sozialer Arbeit, Pädagogik und Beratung
 Die Bedeutung von Bindung in Sozialer Arbeit, Pädagogik und Beratung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Die Bedeutung von Bindung in Sozialer Arbeit, Pädagogik und Beratung Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Definition Frühgeburt
 Trauma Frühgeburt Definition Frühgeburt Frühgeburt: weniger als 37 Wochen Geburtsgewicht unter 2500 g Sehr kleines Frühgeborenes: weniger als 32 Wochen Geburtsgewicht unter 1500 g Extrem kleines Frühgeborenes
Trauma Frühgeburt Definition Frühgeburt Frühgeburt: weniger als 37 Wochen Geburtsgewicht unter 2500 g Sehr kleines Frühgeborenes: weniger als 32 Wochen Geburtsgewicht unter 1500 g Extrem kleines Frühgeborenes
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
TRAUMAPÄDAGOGIK - BEDEUTUNG DER EIGENEN PERSON
 09.02.2017, TRAUMAPÄDAGOGIK - BEDEUTUNG DER EIGENEN PERSON Definition Trauma (Gottfried Fischer) Vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und Individuellen Bewältigungsmöglichkeiten,
09.02.2017, TRAUMAPÄDAGOGIK - BEDEUTUNG DER EIGENEN PERSON Definition Trauma (Gottfried Fischer) Vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und Individuellen Bewältigungsmöglichkeiten,
Weshalb uns traumatisierte Kinder an die Grenzen bringen. Fachtag für westfälische Pflegefamilien
 Weshalb uns traumatisierte Kinder an die Grenzen bringen. Fachtag für westfälische Pflegefamilien Selbst oder als Augenzeugln erlebt Risikofaktoren (Emotionale) Vernachlässigung, anhaltende Abweisung Körperliche
Weshalb uns traumatisierte Kinder an die Grenzen bringen. Fachtag für westfälische Pflegefamilien Selbst oder als Augenzeugln erlebt Risikofaktoren (Emotionale) Vernachlässigung, anhaltende Abweisung Körperliche
Wie wichtig sind sichere Beziehungen? Über Kompetenz und Verletzlichkeit von Kleinkindern
 Wie wichtig sind sichere Beziehungen? Über Kompetenz und Verletzlichkeit von Kleinkindern 30. Oktober 2014 Prof. Dr. med. Alain Di Gallo Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Die psychische
Wie wichtig sind sichere Beziehungen? Über Kompetenz und Verletzlichkeit von Kleinkindern 30. Oktober 2014 Prof. Dr. med. Alain Di Gallo Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Die psychische
Einleitung 11. Grundlagen 15
 Inhalt Einleitung 11 Grundlagen 15 1 Unterstützungsbedürfnisse von Kindern mit Missbrauchserfahrungen 17 1.1 Stärkung des Selbstbewusstseins 17 1.2 Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle 18
Inhalt Einleitung 11 Grundlagen 15 1 Unterstützungsbedürfnisse von Kindern mit Missbrauchserfahrungen 17 1.1 Stärkung des Selbstbewusstseins 17 1.2 Hilfen zum Selbstverstehen und zur Selbstkontrolle 18
Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst?
 Kinder als Zeugen elterlicher Gewalt Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 04.03.2016 Alexander Korittko 6 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
Kinder als Zeugen elterlicher Gewalt Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 04.03.2016 Alexander Korittko 6 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
ETI-KJ. Essener Trauma Inventar für Kinder und Jugendliche. Chiffre/Name: Alter: Untersuchungsdatum:
 Essener Trauma Inventar für Kinder und Jugendliche (ETI-KJ) Tagay S., Hermans BE., Düllmann S., Senf W. LVR-Klinikum Essen, Universität Duisburg Essen 2007 ETI-KJ Essener Trauma Inventar für Kinder und
Essener Trauma Inventar für Kinder und Jugendliche (ETI-KJ) Tagay S., Hermans BE., Düllmann S., Senf W. LVR-Klinikum Essen, Universität Duisburg Essen 2007 ETI-KJ Essener Trauma Inventar für Kinder und
Flucht & Trauma. Stefan Lehmeier Stellv. Landesdirektor. From Harm to Home Rescue.org
 Flucht & Trauma Stefan Lehmeier Stellv. Landesdirektor Flucht & Migration Wie stellen wir uns psychische Gesundheit vor? Wie wirkt sich Fluchterfahrung aus? Wann kommt es zu Traumatisierung? Wodurch wird
Flucht & Trauma Stefan Lehmeier Stellv. Landesdirektor Flucht & Migration Wie stellen wir uns psychische Gesundheit vor? Wie wirkt sich Fluchterfahrung aus? Wann kommt es zu Traumatisierung? Wodurch wird
Bindung und Ablösung bei Jugendlichen mit mehreren Eltern
 Bindung und Ablösung bei Jugendlichen mit mehreren Eltern Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie Ludwig-Maximilians-Universität
Bindung und Ablösung bei Jugendlichen mit mehreren Eltern Karl Heinz Brisch Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie Ludwig-Maximilians-Universität
Besonderheiten im therapeutischen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen
 Besonderheiten im therapeutischen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen Dresden, 09.03.2016 Dipl.-Psych. Ute Rokyta Migrationsambulanz der Uniklinik Dresden Lukasstr. 3, 01069 Dresden ute.rokyta@uniklinikum-dresden.de
Besonderheiten im therapeutischen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen Dresden, 09.03.2016 Dipl.-Psych. Ute Rokyta Migrationsambulanz der Uniklinik Dresden Lukasstr. 3, 01069 Dresden ute.rokyta@uniklinikum-dresden.de
Einleitung und Grundidee des Projektes
 Einleitung und Grundidee des Projektes Warum gibt es so viele Abbrüche in der Heimerziehung Von der Idee zur Umsetzung des Projektes Eine Einführung in die Traumapädagogik und das Projekt Man weiss nie,
Einleitung und Grundidee des Projektes Warum gibt es so viele Abbrüche in der Heimerziehung Von der Idee zur Umsetzung des Projektes Eine Einführung in die Traumapädagogik und das Projekt Man weiss nie,
Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst?
 Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 14.12.17 Alexander Korittko 1 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
Zwischen Kinderschutz und Elternrecht Umgang um jeden Preis oder Neuanfang ohne Angst? 14.12.17 Alexander Korittko 1 Regelmäßige Kontakte zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Verwandten oder anderen vertrauten
