Invasion of the Wrong Planet
|
|
|
- Johann Beutel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Universität Konstanz 4. Februar 2013 FB Informatik und Informationswissenschaft Arbeitsgruppe Mensch-Computer-Interaktion Betreuer: Roman Rädle Gutachter: Prof. Dr. Harald Reiterer Bericht zum Bachelorprojekt Invasion of the Wrong Planet Ein Projekt zur Untersuchung von Kollaboration in hybriden Therapiespielen für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen vorgelegt von: Sebastian Marwecki BA Information Engineering, 6. Semester Max Stromeyer Straße 10, Konstanz
2 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung Einführung Autismus Spektrum Störungen Therapiemöglichkeiten Therapiespiele Hybride Spiele Verwandte Arbeiten Anforderungen Anforderungen aus Literaturrecherchen Anforderungen aus Interviews Beschreibung des Spiels Vorstellung Postuliertes Therapiesetting Audiovisuelle Präsentation Spielaufbau Spielsteuerung Spielinhalte Kollaboration und Kognition - Zweidimensionaler Flow Erste Evaluation Entwicklung Verwendete Entwicklungsumgebungen und Werkzeuge Modellierung der Spielfiguren Systemarchitektur Lessons Learned Ausblick Quellenverzeichnis Anhänge Anhang A - Interview mit Andreas Wacker Anhang B - Interview mit Katharine Lilje und Andreas Targan Anhang C - Material für die Ersatznutzer-Studie, Videopräsentation, Sourcecode... 41
3 Zusammenfassung In der vorliegenden Ausarbeitung wird die Entwicklung des hybriden Therapiespiels Invasion of the Wrong Planet vorgestellt. Der Spielprototyp soll als Grundlage zur Diskussion dienen, wie Kollaboration in Therapiespielen für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) gestaltet werden sollte. Er wurde nach zielgruppenspezifischen Kriterien konzipiert und entwickelt und kann somit prinzipiell als Instrument für Gruppentherapiesitzungen für Kinder und Jugendliche mit ASS eingesetzt werden.
4 1 Einführung 1.1 Autismus Spektrum Störungen 1 Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Unter frühkindlichem Autismus, auch Kanner-Syndrom genannt, versteht man eine angeborene Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung. Kinder mit frühkindlichen Autismus zeigen Schwächen in ihren sozialen Fähigkeiten, sowie ihrer Art der Kommunikation und machen durch ungewöhnliche, teils repetitive Handlungsabläufe auf sich aufmerksam. Man unterscheidet je nach Intelligenzgrad beim frühkindlichen Autismus zwischen low, intermediate und high functioning autism (LFA, IFA, HFA). Parallel zum frühkindlichen Autismus existiert das Aspergersyndrom, das sich erst im Kleinkindalter von etwa drei Jahren bemerkbar macht und im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus keinen Entwicklungsrückstand in der Sprache oder in den kognitiven Fähigkeiten bedingt. Jedoch lassen sich bei Betroffenen des Aspergersyndroms ebenfalls negative Auffälligkeiten in der psychomotorischen Entwicklung und in der sozialen Interaktion feststellen. Gleichzeitig zeigen sie aber eine höhere Intelligenz als Betroffene des gewöhnlichen frühkindlichen Autismus. So sind sie hier mit frühkindlichen Autisten auf der Stufe des HFA vergleichbar, und besitzen zudem in häufig kognitiven, mathematischen, logischen oder musikalischen Teilbereichen extrem ausgeprägte Fertigkeiten. Die Erscheinungsformen von autistischen Störungen sind vielfältig. So wie Menschen per se unterschiedlich sind, existiert auch beim Autismus eine Bandbreite an Ausprägungen. Man spricht vom Autismus-Spektrum. Ein weiteres zusammenfassendes Kriterium, nach dem in diesem Zusammenhang geforscht wurde und das Autismus als solchen kategorisiert, ist die von Premack & Woodruff (1978) eingeführte Theory of Mind. Sie bezeichnet die Fähigkeit, sich in seine Mitmenschen hineinzuversetzen und ihnen Gefühle und Gedanken zu unterstellen und ist nach Baron- Cohen (1992) einer der entscheidendsten Bestandteile der sozialen Fähigkeiten. Menschen mit Autismus vereint die Schwierigkeit, Gefühle und Gedanken ihrer Mitmenschen, die sich insbesondere durch nonverbale Signale wie Mimik, Gestik und Tonfall als auch Ironie oder Humor äußern, zu verstehen. Sie sind für die Existenz von Bewusstseinszuständen blind (Baron-Cohen 1992: 10). Es lässt sich also sagen, dass ein kennzeichnendes Merkmal von Autismus Abweichungen in der Theory of Mind sind. 1 Dieser Abschnitt ist mit wenigen Änderungen der Ausarbeitung des Bachelorseminars übernommen.
5 1.2 Therapiemöglichkeiten Störungen im Autismus-Spektrum sind nicht heilbar. Ziel von Therapien ist es, dass Betroffene ihre Krankheit akzeptieren und mit ihr umzugehen lernen. Möglichkeiten zur Behandlung bieten Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und verschiedene Verhaltenstherapien. Ganzheitliche Verhaltenstherapien vermitteln Kindern und Jugendlichen mit autistischen Störungen soziale Kompetenzen. Dabei unterliegt eine solche Therapie immer dem Prinzip von Verstärkung und Bestrafung; gewünschtes Verhalten wird verstärkt und belohnt, unerwünschtes Verhalten wird kritisiert und bestraft. Einen Ansatz dafür bietet Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH). Betroffene von ASS fühlen sich in strukturierten Umgebungen wohler. Zudem nehmen sie visualisierte Inhalte schneller auf. TEACCH greift diese Gedanken auf und vermittelt Kindern und Jugendlichen mit ASS über einen strukturierten Weg und mithilfe von Visualisierungen Konzepte der sozialen Interaktion und Kommunikation. Das von Häußler et al. (2008) entwickelte soziale Kompetenz Training (SOKO) baut auf TEACCH auf und bietet eine Bandbreite an konkreten Inhalten für Gruppentherapiesitzungen. Durch das von SOKO konzipierte Therapiematerial werden Kinder und Jugendliche mit ASS auf verschiedene Art und Weise Feinheiten sozialer Interaktion und Kommunikation vermittelt. 1.3 Therapiespiele In Gruppentherapien, auch beim SOKO, finden häufig Spiele Anwendung. Spiele dieser Art werden Therapiespiele oder auch Health Games genannt. Ein Beispiel für ein solches Spiel ist Time Timer 2. Mit Hilfe dieses Spiels wird das Verständnis von wechselseitiger Kommunikation und Zeitverständnis innerhalb einer Konversation geschult. Das Spiel basiert auf dem TEACCH-Ansatz, mithilfe von Visualisierungen und strukturgebenden Elementen soziale Interaktion zu fördern. Es existieren eine ganze Reihe weiterer Spiele. Jedes dieser Spiele fördert bestimmte Eigenschaften beim Spieler. Somit kann ein einzelnes Spiel auch nur als ein Instrument in Gruppentherapien verstanden werden. Welche Spiele eingesetzt werden, unterliegt immer der Entscheidung des Therapeuten. 2 Bei diesem Spiel nimmt sich zunächst jeder teilnehmende Spieler eine farbige Karte grün, gelb oder rot. Anschließend wird eine Uhr gestellt, beispielsweise in Form einer Zählleiste. Jeder Spieler erhält einen Zeitabschnitt entsprechend der Farbe, die er gewählt hat. In dieser Zeit kann der Spieler von sich erzählen. Nachdem die Zeit aufgebraucht ist, oder der Spieler nichts mehr erzählt, wird die Uhr entsprechend der verbrauchten Zeit vorgestellt.
6 1.4 Hybride Spiele Therapiespiele bilden, neben den Lernspielen, eine Unterkategorie der Serious Games. In solchen Spielen wird versucht, die intrinsische Motivation, die von Spielen ausgehen kann, aufzugreifen und mit einem extrinsischen Nutzen zu kombinieren. In diesem Falle ist dieser Nutzen ein Therapieeffekt. Nun gibt es Möglichkeiten, diesen Nutzen zu maximieren. Einen Ansatz liefern die sogenannten hybriden Spiele. Hybride Spiele (lat. Hybrida gemischt, gekreuzt) kombinieren Elemente analoger und digitaler Spiele. 3 Haptische und soziale Elemente aus analogen Spielen können aufgegriffen und mit audiovisuellen Möglichkeiten von digitalen Spielen in Verbindung gesetzt werden. Mit Hilfe von digitalen Rechenkapazitäten und Steuerungsmechanismen kann der Flow 4, der Spielfluss und die Motivationsfähigkeit, maximiert werden. Routineaufgaben wie Spielaufbau fallen weg, Spielregeln werden auf intuitive Art und Weise über Einschränkungen der Bedienmöglichkeiten deutlich. Es existiert eine Bandbreite an Möglichkeiten, diese analogen und digitalen Elemente zu kombinieren. Eine dieser Möglichkeiten sind die horizontalen hybriden interaktiven Oberflächen. Hierbei handelt es sich um horizontal aufgestellte, großformatige Displays, die sowohl über Multitouch, als auch über analoge Steuerungsmöglichkeiten bedient werden können. Durch den die Kombination analoger und digitaler Elemente durch hybride interaktive Oberflächen entstehen Vorteile, die im Bereich der Therapiespiele für Kinder und Jugendliche mit ASS eingesetzt werden können. Das Medium Computer wird als strukturiert und damit als kontrollierbar und beruhigend empfunden. Zudem bieten sich viele Visualisierungsmöglichkeiten. Beides entspricht dem TEACCH Konzept. Der Formfaktor einer hybriden interaktiven Oberfläche erlaubt soziale Interaktion und Kommunikation, welches Eigenschaften analoger Spiele sind. Somit können Kinder und Jugendliche in einem kontrollierbaren Setting in sozialen Kontakt treten, wodurch im Sinne des SOKO Trainings soziale Kompetenz gefördert wird. Eine Visualisierung dieser Schnittstelle zwischen hybriden Spielen und Therapieanwendungen wird zur Verdeutlichung in Abbildung 1 geboten. 3 Siehe hierzu auch: Ausarbeitung zum Bachelorseminar Abschnitt 2.3 Hybride Spiele 4 Csíkszentmihályi (1997) beschreibt Flow als state of effortless concentration and enjoyment (Csíkszentmihályi 1997: 1). Er führt die Entstehung von Flow auf folgende acht Punkte zurück: Eine den eigenen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe, ein klares Aufgabenziel, ungeteilte Konzentration auf diese Aufgabe, eine Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein, direktes Feedback, ein Gefühl von Kontrolle, das Verschwinden der Selbstwahrnehmung und eigener Sorgen und eine verfälschte Zeitwahrnehmung. Das Ziel von Spielen ist es, hohe Konzentrationen von Spaß, Fokus und Motivation bei dem Spieler zu erzeugen, sprich, den state of effortless concentration and enjoyment beim Spieler zu erreichen. Man kann somit sicherlich sagen, dass Spiele eines der besten Werkzeuge sind, Flow zu erreichen.
7 Hybride Spiele Analoge Spiele Digitale Spiele Spiele auf hybriden interaktiven Oberflächen Verhaltenstherapie für ASS Optimale Nutzung Hybrider Spiele als Therapiemöglichkeit für ASS Abbildung 1: Visualisierung der Schnittstelle von Therapiespielen auf hybriden interaktiven Oberflächen. 1.5 Verwandte Arbeiten Die Idee der Förderung der sozialen Kompetenzen durch hybride Therapiespiele ist nicht neu. Bereits Projekte wie Sides 5 von Piper et al. (2006) oder StoryTable 6 von Gal et al. (2009) greifen auf diese Überlegungen zurück. In der Ausarbeitung des Seminars zum Bachelorprojekt wurden Verbesserungspotentiale dieser von Piper und Gal vorgestellten Spiele herausgearbeitet. Hauptkritikpunkt war, dass kollaborative Aktionen zwischen den Spielern erzwungen werden. Dies steht im Kontrast zum Prinzip von Verstärkung und Bestrafung, welches in Verhaltenstherapien Anwendung findet. Gewünschtes Verhalten soll lediglich belohnt und dadurch konditioniert werden. Die Überlegung, die in der Ausarbeitung zu finden ist, war, dass eine empfohlene Kollaboration zwischen den Spielern zu einem verbesserten Therapieeffekt führen kann. Dieses Projekt soll dazu dienen, diese Überlegung zu konkretisieren und eine Grundlage für eine weitere Diskussion zu schaffen, die in der anschließenden Bachelorarbeit geführt wird. 5 In Sides spielen bis zu vier Spieler zusammen um eine kollaborative Aufgabe zu lösen. Ziel des Spieles ist es, einem Frosch bei der Überquerung eines Teichs zu helfen. Hierbei legen die Spieler abwechselnd Lilienfelder aus, die eine Laufrichtung für den Frosch vorgeben. Haben sich die Spieler auf einen Pfad geeinigt, läuft der Frosch die Lilienfelder ab. Dabei frisst er verschiedene Libellen, die den Spielern, eine unterschiedliche Anzahl an Punkten geben. Es gilt somit, gemeinschaftlich einen optimalen Pfad zu finden. 6 Bei StoryTable erfinden zwei Spieler zusammen eine Geschichte. Dies passiert mit Hilfe von vorgefertigten Bilddateien und zusätzlich aufgenommenen Sprachdateien. Als Resultat kann die Geschichte als kleiner Film abgespielt werden.
8 2 Anforderungen 2.1 Anforderungen aus Literaturrecherchen Nach umfassender Literaturrecherche ergaben sich eine Reihe von zielgruppenspezifischer Anforderungen, die während des Designprozesses des Spiels berücksichtigt werden mussten. Die im Folgenden genannten Anforderungen sind in der Ausarbeitung des Seminars zum Bachelorprojekt 7 zu finden. A01. Das Spieldesign muss kollaborativer Natur sein. Die Spieler spielen zusammen gegen antagonistische Elemente im Spiel. A02. Das Spiel muss in Teilen in einer virtuellen Umgebung stattfinden. A03. Das Spiel muss die verschiedenen motorischen Fähigkeiten der Spieler berücksichtigen. A04. Das Spiel muss die verschiedenen Toleranzen der Spieler auf äußere Einflüsse berücksichtigen, wie Lärmbelastung und räumliche Enge. A05. Das Spiel muss die verschiedenen geistigen Fertigkeiten der Spieler berücksichtigen. A06. Das Spiel muss die verschiedenen kognitiven Fähigkeiten der Spieler berücksichtigen. A07. Das Spiel muss die kommunikativen Eigenschaften der Spieler berücksichtigen. Weitere Anforderungen ergeben sich aus spieltechnischen Gründen. Das Spiel soll motivierend wirken. Dies kann zum einen mit einer starken audiovisuellen Präsentation, als auch mit einer gewissen Spieltiefe, einer gewissen Anzahl an Spielelementen, erreicht werden. 2.2 Anforderungen aus Interviews Abseits der genannten Anforderungen stellte sich zudem die Frage, wie ein solches Spiel unter therapeutischen Gesichtspunkten umzusetzen ist. Zu diesem Zwecke wurden zwei User Surrogates Studien durchgeführt. Studien dieser Art, auch Ersatznutzer-Studien genannt, werden nach Constantine & Lockwood (2006) durchgeführt, wenn entweder keine Nutzer der anvisierten Zielgruppe zur Verfügung stehen oder zunächst Anforderungen generiert werden sollen, bevor Nutzer zum Testen des Systems herangezogen werden. Zweiteres war hier der Fall. 7 Siehe hierzu: Ausarbeitung zum Bachelorseminar Abschnitt Resultierende Anforderungen
9 Teilnehmer der Studie waren Andreas Wacker, der bereits zwei einjährige Gruppentherapien für Kinder und Jugendliche mit ASS betreuen konnte, sowie Katharina Lilje und Andreas Targan, vom Regionalverband Autismus-Bodensee. Sie sind als Fachberater vor allem in Schulen tätig und beraten in Gruppensitzungen Eltern, Lehrer und Betroffene über ASS. Die Studie war in drei Abschnitte aufgebaut, in denen die Interviewpartner zunächst in die Domäne hybrider Therapiespiele für ASS eingeführt wurden. Im zweiten Abschnitt wurden ihnen zwei Spielideen präsentiert, welche als weiterführende Diskussionsgrundlage dienen sollten. Diese sind im CD-Anhang zu finden. Anschließend wurde ein semi-strukturiertes Interview durchgeführt. Spezifische Fragen nach dem Alter ( In welchem Alter befinden sich Teilnehmer einer Gruppentherapie üblicherweise? ) und offenere Fragestellungen ( Wie könnte man den Transfer der geförderten Kompetenzen in den Alltag gewährleisten? ), dienten dazu die Anforderungen für das Spiel zu spezifizieren. Die Interviews wurden akustisch aufgezeichnet. Aus den Aufzeichnungen ergaben sich die zusammengefassten Inhalte der Interviews, die sich in Anhang A und B befinden. Der Gesprächsleitfaden sowie die Aufnahmen werden in Anhang C bereitgestellt. Aus den Ergebnissen dieser Zusammenfassungen ergaben sich die folgenden Anforderungen, aus welchen sich die spezifischen Designentscheidungen des Spiels herleiten: A08. Das Spiel sollte für Kinder mit hochfunktionalem Autismus oder auch Aspergersyndrom spielbar sein. A09. Das Spiel sollte für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren ausgelegt sein. A10. Die Präsentation des Spiels sollte für männliche Spieler konzipiert sein. A11. Die Länge eines Spiels oder eines Spielabschnittes sollte den Zeitrahmen von zehn Minuten nicht überschreiten. Anschließend muss das Spiel dem Therapeuten die Gelegenheit geben, zusammen mit den Spielern über die Spielinhalte zu reflektieren um so eine Transfer des kollaborativen Verhaltens in den Alltag zu ermöglichen. A12. Die Schwierigkeit des Spiels sollte nicht zu tief angesetzt werden, aber variabel bleiben. A13. Das Ziel des Spiels, sowie der Spielfortschritt sollten kognitiv leicht erfassbar sein. Diese sollten sich den Spielern visuell und strukturiert darstellen.
10 A14. Die Kommunikation und Interaktion muss spielbasiert mit Hinblick auf das Spielziel stattfinden. Das Spiel sollte lediglich spiellösungsspezifische Kommunikation fördern. A15. Das Belohnen gemeinschaftlichen Verhaltens ist wichtiger als das Belohnen von Aktionen einzelner Spieler. Das Spiel sollte das Verhalten der Spieler hinsichtlich der Kollaboration zeitnah bewerten und dadurch konditionieren. A16. Kollaboration sollte nicht erzwungen werden, sondern lediglich belohnt. A17. Eingeschränkte Spielfähigkeit einzelner Spieler darf durch das Spiel nicht abgestraft werden. Eingeschränkte Spielfähigkeit beinhaltet grobmotorisches Verhalten und kognitives Verstehen der Spielsituationen. A18. Dominantes Auftreten von einzelnen Spielern sollte im Spiel mit einplant sein. Andere Spieler müssen in kollaborativen Aufgaben stets die Möglichkeit haben, sich im gemeinsamen Prozess der Lösungsfindung zu integrieren. A19. Die Spielfiguren sollten ansprechend gestaltet sein und einen haptischen Wert besitzen. 3 Beschreibung des Spiels 3.1 Vorstellung Invasion of the Wrong Planet ist ein hybrides Therapiespiel auf dem Samsung SUR40 mit Microsoft Pixelsense 8. Die Spieler haben die gemeinsame Aufgabe, die Erde ( The Wrong Planet 9 ) vor einer außerirdischen Invasion zu beschützen. Über eine Reihe von verschiedenen Spielinhalten motiviert das Spiel zu gemeinschaftlichem Handeln. Die Anforderungen A01 und A02 sind erfüllt, Spieler handeln gemeinsam gegen antagonistische Elemente im Spiel und das Spielmedium ist hybrid. Das Spielsetting ist bewusst für die angeforderte Altersgruppe ausgelegt. Das futuristische Setting impliziert eine genaue Erwartungshaltung bei den jungen Spielern. Dadurch, dass im Design der Spielaufgaben auf diese Erwartungshaltung eingegangen wird, ist der kognitive Aufwand gering. Das Spiel ist schnell zu erlernen. Die in A09 und A10 postulierten Anforderungen, dass Spiel vor allem für acht- bis zwölfjährige Jungen anzulegen, sind erfüllt. 8 Produktseite unter (Stand ). 9 Die Bezeichnung ist angelehnt an eine alternative Beschreibung der Autismusstörungen. Kinder und Jugendliche mit Autismus, obwohl sie ihres Zustandes bewusst sind, haben das gleiche Selbstverständnis wie andere Menschen auch. Nur empfinden sie, durch ihre Störung, ihre Umgebung und ihre Mitmenschen als umso sonderbarer. Sie fühlen sich wie auf einem anderen Planeten. Man spricht vom Wrong-Planet-Syndrome.
11 Abbildung 2: Hauptmenü (ausgerichtet für Therapeuten) Einschränkend muss angemerkt werden, dass der kognitive Anspruch des Spiels jedoch in jedem Fall zu hoch ist, als dass das Spiel als Therapieinstrument für Kinder und Jugendlichen mit LFA oder MFA eingesetzt werden kann. Das Spiel bleibt für Kinder und Jugendliche mit HFA und AS ausgelegt. Dies entspricht der Anforderung A08. Auch die von Piper et al. (2006) und Gal et al. (2009) entwickelten Projekte hatten diese Zielgruppe. Diese Einschränkung ist ein Trade-off, welcher sich aus der Nutzung eines hybriden Mediums für Therapiespiele ergibt. 3.2 Postuliertes Therapiesetting Das Spiel kann in seiner Form in Therapiesitzungen eingebettet werden. Dies geschieht im besten Falle gegen Ende von Gruppentherapiesitzungen. Das Spiel soll als Motivator und als Grundlage für Gruppendiskussionen dienen. Der Therapeut ist bei den Spieldurchläufen anwesend. Im Hauptmenü (siehe Abbildung 2) bereitet er das Spiel für die Zielgruppe vor und startet das Spiel. Nach einem Spieldurchlauf reflektiert er zusammen mit den Spielern die Spielinhalte. Nur dadurch kann ein Transfer der gemeinsamen Spielleistungen in alltägliche Aufgaben gelingen. Es sei erwähnt, dass dieses Projekt lediglich ein Therapieinstrument darstellen kann. Es ist somit nur eine Möglichkeit für den Therapeuten, welche er in Gruppensitzungen nutzen kann.
12 Abbildung 3: Optionsmenü für Therapeuten 3.3 Audiovisuelle Präsentation Nach Schell (2008) lässt sich Spieldesign an vier Faktoren festmachen 10 : Mechanics, Story, Aesthetics, Technology. Die narrativen Elemente, die Story, wurden bereits besprochen. Die ludologischen Elemente, sowie die Technik werden in den nachfolgenden Abschnitten 3.6 Spielinhalt beziehungsweise 5 Entwicklung erläutert. An dieser Stelle soll auf die ästhetischen Gesichtspunkte, die audiovisuelle Präsentation der Spielinhalte, eingegangen werden. Wie jedes Spiel sollen auch Therapiespiele ihre Spieler motivieren und dazu anregen, sich umfassend mit dem Spiel zu beschäftigen. Es versteht sich von selbst, dass gerade Therapiespiele, deren Inhalte konkreten Nutzen haben, genau diese Motivation fördern sollten. Die Immersion des Spielers in das Spiel sollte höchstmöglich sein. Auch gerade da die Zielgruppe des Spiels, die mediengewohnt ist, dieses Therapiespiel wohl auch mit kommerziellen Spielen vergleichen wird. Schell argumentiert, dass die Art der Präsentation der Spielinhalte ausschlaggebend sind, damit diese Inhalte im Gedächtnis haften bleiben: Aesthetics are an incredibly important aspect of game design since they have the most direct relationship to a player s experience. [...] (The aesthetics) reinforce the other elements of the game [...] (Schell 2008: 41) Motivation der Spieler fördert somit den langfristigen Nutzen der Spielinhalte. In diesem Sinne wurde auch bei diesem Spiel versucht auf visuellem Wege Spielinhalte zu verstärken. 10 Siehe Schell 2008: 41 "The Four Basic Elements".
13 Der Fokus auf die ansprechende audiovisuelle Repräsentation der Spielinhalte liefert zudem den Vorteil, dass Spielfortschritt und Spielziel leichter erfassbar sind. Der kognitive Anspruch an die Spieler sinkt. Anforderung A13 ist gedeckt. Dass im Spiel sowohl Musik- als auch Effektlautstärken angepasst werden können (siehe Abbildung 3) ist im Sinne von Anforderung A Spielaufbau Das Spiel umfasst eine Anzahl an Spielleveln. Jedes dieser Level beinhaltet eine Anzahl an Spielelementen. Die Anzahl der Level und Spielelemente kann bei Bedarf leicht ausgebaut werden. Die Bedeutung dieser der einzelnen Elemente wird Kapitel 3.6 Spielinhalt erläutert. Die Spieler haben die Auswahl zwischen den Spielleveln. Die Spiellänge eines Levels beträgt genau drei Minuten. Die gesamte Spielzeit beträgt mehr, wenn davor und währenddessen der Spielablauf erläutert wird. Der zeitliche Rahmen von maximal zehn Minuten, wie in Anforderung A11 gefordert, wird dabei in jedem Fall eingehalten. Der Therapeut hat die Möglichkeit, das Spielerlebnis zusammen mit den Spielern zu reflektieren. Es empfiehlt sich jedoch für den Therapeuten, vor Spielbeginn den kollaborativen Gedanken des Spiels näherzubringen und die Spieler in das Setting des Spieles einführen. Optional lassen sich Spielhinweise einstellen, die das Spiel zu Beginn erläutern und strukturiert Hinweise zu neuen Spielelementen geben, wie in Anforderung A13 gefordert wird (Abbildung 4 und 5). Nachdem ein Spieldurchlauf erfolgreich bestanden wurde, dürfen sich die Spieler in eine Highscoreliste eintragen (siehe Abbildungen 6 und 7). Dieses klassische Element soll die Wiederspielbarkeit und die Motivation verstärken. 3.5 Spielsteuerung Das Spiel wird mithilfe sogenannter Tokens 11 gesteuert. Diese Tokens werden im Nachfolgenden als Spielfiguren bezeichnet. Jeder Spieler hat eine Spielfigur in Form eines Raumschiffes. Er interagiert mit dem Spiel indem er diesen Spielfigur auf die Spieloberfläche auflegt, bewegt und mit dem Zeigefinger auf den vor der Spielfigur erscheinenden virtuellen Button drückt. Durch das Drücken auf den Button werden virtuelle Laserschuss -Animationen generiert, wodurch Gegner eliminiert werden können. Die Interaktion mit den Spielfiguren soll intuitiv und nach 11 Tokens bezeichnen analog repräsentierte digitale Informationen. [ ] physical tokens are used to reference digital information (Ullmer et al. 2005: 2).
14 Abbildung 4: Hinweise (zu Spielbeginn und für jeden neuen Gegnertyp) Abbildung 5: Empfohlene Kollaboration bei Hinweisen (Hinweise lassen sich auseinanderziehen) Anm.: Hände und Pfeile wurden nachträglich eingefügt. Sie dienen der Veranschaulichung der Bewegung. Anforderung A03 mit möglichst geringen motorischen Anspruch erfolgen. Zur Entwicklung der Spielfiguren siehe Abschnitt 5.2 Modellierung der Spielfiguren. Die Spielfiguren besitzen einen haptischen Wert, wodurch Anforderung A19 gedeckt ist. Teile der Spielelemente werden zudem durch einzelne Singletouch-Gesten gesteuert.
15 Abbildung 6: Spieler können sich in die Highscoreliste eintragen. Abbildung 7: Highscoreliste 3.6 Spielinhalte Jedes Spiellevel setzt sich aus einer Reihe von Spielelementen zusammen. Die Anzahl dieser Elemente steigt mit dem Spiellevel. Jedes Spielelement beinhaltet eine kollaborative Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Die Zeit, welche für die Aufgaben zur Verfügung steht, ist begrenzt und wird visuell in einem Fenster am Rand des Spielbildschirms angezeigt (siehe Abbildung 8). Lösen die Spieler die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit, erhalten sie Punkte.
16 Abbildung 8: Jeder Spielabschnitt muss in einer vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden. Die verbleibende Zeit ist für jeden Spieler am Spielrand durch ein Diagramm visualisiert. Abbildung 9: Minuspunkte bei Nichtlösung der Spielaufgaben in der vorgegebenen Zeit. Lösen die Spieler die Aufgabe nicht, werden ihnen Punkte abgezogen (siehe Abbildung 9). Kommunizieren die Spieler einen Lösungsweg, ist die Anzahl der erreichten Punkte höher. Die Kommunikation ist somit spielbasiert [und findet] mit Hinblick auf das Spielziel statt[ ], wie in Anforderung A14 gefordert. Das Spiel kann jedoch auch mit weniger, oder sogar gänzlich ohne Kommunikation und Kollaboration gelöst werden. Dies ist von den
17 getroffenen Einstellungen abhängig, wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben wird. Das Spiel berücksichtigt somit die verschiedenen kommunikativen Fähigkeiten der Spieler, wie in Anforderung A07 gefordert wird. Kollaboration und Kommunikation werden nicht erzwungen, sondern lediglich belohnt und verstärkt. Die Konzeption der nachfolgend beschriebenen Spielelemente erfolgte in diesem Sinne. Der Raider (Abbildung 10) ist der erste im Spiel zu findende Gegner. Ein Spieler kann ihn besiegen, indem er eine gewisse Zeit auf ihn schießt (siehe Abbildung 14). Wenn jedoch mehrere Spieler zeitgleich den Gegner angreifen, sinkt die benötigte Zeit exponentiell (Abbildung 15). Abbildung 10: Raider Durch abgestimmtes Verhalten bei mehreren Gegnern steigt also auch die Anzahl erreichter Punkte. Kommunikation wird belohnt, nicht erzwungen, ganz nach Anforderung A16. Das Design der anderen Gegner folgt dieser Idee. Der Teleporter (Abbildung 11) zeigt für eine bestimmte Zeit eine Spielerfarbe an. Nur der entsprechende Spieler kann ihm in dieser Zeit Schaden zufügen. Sobald die Farbe wechselt, sollte dies kommuniziert Abbildung 11: Teleporter werden. In Verbindung mit den Drohnen (Abbildung 12) entsteht eine Situation, die eine starke Abstimmung erfordert. Diese Drohnen werden durch einen einzelnen Touch eingesammelt, wodurch die verbliebene Zeit für die Spieler steigt. Abbildung 12: Nachschubdrohne Der Neutralisierer (Abbildung 13) heftet sich an einen Spieler und hindert diesen daran Schaden auszugeben. Dieser Spieler hat nun die Möglichkeit, entweder seine Spielfigur anzuheben, wodurch der Neutralisierer zum nächsten Spieler Abbildung 13: Neutralisierer wandert, oder er teilt seine Situation seinen Mitspielern mit. Schießt ein Spieler den Neutralisierer ab, während sich dieser an einem anderen Spieler befindet, wird dies ebenfalls mit weit mehr Punkten honoriert; Kommunikation des ersten Spielers, und kollaboratives Verhalten des zweiten werden belohnt.
18 Abbildung 14: Unkollaborativer Lösungsversuch (Spieler greift alleine an) Anm.: Spielfigur wurde nachträglich eingefügt. Abbildung 15: Kollaborativer Lösungsversuch (Spieler greifen zusammen an) Anm.: Spielfiguren wurden nachträglich eingefügt. Jeder Schuss eines Spielers erfordert Energie. Fällt die Energie eines Spielers unter ein gewisses Level, erscheint eine Nachschub-Batterie (Abbildung 16). Diese Batterie Abbildung 16: Nachschubbatterie ist weitestmöglich vom Spieler (Abbildung 17) entfernt.
19 Abbildung 17: Auftauchen der Nachschubbatterie (an anderer Seite des Spieltisches) Anm.: Spielfigur wurde nachträglich eingefügt. Der Spieler kann, um die Batterie einzusammeln, nun entweder über den Tisch greifen, wodurch er die anderen Spieler stört und negatives Feedback erfahren wird, oder ein anderer Spieler schiebt ihm die Batterie mit einer Touchgeste zu. Dies geschieht recht effizient und führt zu einer Zeitersparnis, welches wiederum zu mehr Punkten führt. Jeder eliminierte Gegner gibt Punkte. Gemeinschaftlich eliminierte Gegner geben mehr Punkte. Es empfiehlt sich den Spielern, gemeinsam zu handeln und Lösungen zu kommunizieren. Zudem erhalten die Spieler nach einer gemeinsamen Aktion eine erhöhte Schussgeschwindigkeit, wodurch nachfolgende Gegner wiederum leichter besiegt werden. Die Spieler geraten somit in einen kollaborativen Belohnungskreislauf. Ein generelles Problem kollaborativer Spiele ist das dominante Verhalten einzelner Spieler. Abstrakt betrachtet hat jeder Spieler eines kollaborativen Spieles eine Anzahl an Ressourcen. Abgestimmter Einsatz dieser Ressourcen erhöht den Output, die gesammelten Punkte. Im Spiel vom Piper et al. (2006) konnte ein einzelner Spieler die gestellte Aufgabe lösen, da die Aufgabe eine rein kognitive war. Die Mitspieler wurden daraufhin zu Hindernissen, deren Ressourcen es zu erhalten galt. Invasion of the Wrong Planet verfolgt einen anderen Ansatz; die Ressourcen der Spieler ist deren gemeinschaftliches Verhalten an sich. Je mehr Spieler am Spiel teilnehmen, je mehr Mitspieler miteinander interagieren, desto höher ist der Output, die gesammelten Punkte. Der Wert der Mitspieler ist demnach ein intrinsischer, der
20 Abbildung 18: Audiovisuelles Feedback bei Kollaboration Anm.: Spielfiguren wurden nachträglich eingefügt. Abbildung 19: Verstärkter Belohnunsmechanismus bei Kollaboration Anm.: Spielfiguren wurden nachträglich eingefügt. Wert liegt im Mitspieler selbst. Die Ressourcen, die er zur Verfügung stellt, können ihm nicht entwendet werden. Dominantes und damit unkollaboratives Verhalten einzelner Spieler wird somit bestraft und in keiner Weise motiviert. Anforderung A18 ist demnach erfüllt.
21 3.7 Kollaboration und Kognition - Zweidimensionaler Flow Üblicherweise bilden in Spielen der kognitive Anspruch oder körperliche Faktoren die Spielfähigkeit des Spielenden. Durch die in Anforderung A15 gegebene Prämisse, das Belohnen gemeinschaftlicher Aktionen in den Vordergrund zu rücken, darf in diesem Fall jedoch nicht die Spielfähigkeit im Sinne von motorisch-kognitiven Fähigkeiten belohnt werden, sondern alleine der kollaborative Gedanke beim Spieler. Dies geht einher mit dem Anspruch, auf wechselnde kognitive, motorische und geistige Fähigkeiten zu berücksichtigen wie in A03, A05 beziehungsweise A06 gefordert wird. Daher motiviert das Spiel die Zusammenarbeit der Spieler viel stärker als die Spielfähigkeit der Einzelnen. Es sollte jedoch merkbar sein, dass Kenntnis und Erfahrung im Spiel belohnt werden, was den Spieler ebenfalls zur langfristigen Nutzung des Spiels anhält. Daher ist die Schwierigkeit zweidimensional strukturiert. Sie gestaltet sich aus dem Zusammenspiel von kognitiven und kollaborativen Anspruch. Der kollaborative Anspruch ist die eigentliche Schwierigkeit im Spiel. Zum Verständnis der Bedeutung der Schwierigkeit eines Spiels, an dieser Stelle ein Zitat Bernhard Suits` (2005): Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. (Suits 2005: 159) In diesem Sinne kann ein Therapiespiel aber nur der freiwillige Versuch verstanden werden notwendige Hindernisse zu überwinden Dasjenige, was durch das Therapiespiel gefördert werden soll, muss auch das Hindernis im Spiel sein! Ein Spieler wird durch ein Spiel dazu motiviert, die gebotenen Hindernisse zu bewältigen. In diesem Fall sind diese die Einschränkungen in Fähigkeiten der sozialer Interaktion und Kommunikation. Die Schwierigkeit ist also nicht im Spiel selbst vorhanden, darf es an dieser Stelle auch nicht sein, sondern sie besteht ausschließlich in dem Unwillen oder der Unfähigkeit der Spieler zur Interaktion mit ihren Mitspielern. Das Spiel bietet in dem Sinne lediglich einen Belohnungsmechanismus, das gewünschtes Verhalten verstärkt und unerwünschtes Verhalten bestraft. Dieser Belohnungsmechanismus wird vom Therapeuten vor der jeweiligen Spielrunde reguliert. Er stellt den Level an kollaborativen Anspruch ein. Dadurch sinkt oder steigt das Minimum an Kollaboration, welches die Spieler aufwenden müssen, um das Level zu bestehen. Der Therapeut ist somit in der Lage, für jedwede Gruppe an Spielern eine geeigneten Schwierigkeit zu finden, der die Spieler motiviert, jedoch nicht unter- oder überfordert. Dieses Prinzip wird Flow genannt (Abbildung 20).
22 Zum anderen besteht die Auswahl zwischen den verschiedenen Spielleveln. Jedes dieser Spiellevel beinhaltet eine Anzahl an Spielelementen. Wie viele dieser Elemente im Spiel genutzt werden, ist für den therapeutischen Aspekt nicht relevant. Kollaboration wird von jedem Element gefördert. Die Auswahl des Levels richtet sich allein nach der Erfahrung der Spieler, die neue, kognitive, Herausforderungen suchen und durch eine steigende Anzahl an Spielinhalten neugierig gemacht werden sollen. Wie bei der kollaborativen Schwierigkeit auch, darf der Spieler weder über- noch unterfordert werden. Kognitive Schwierigkeit Überforderung Flow Kollaborative Schwierigkeit Überforderung Flow Unterforderung Unterforderung Kognitive Fähigkeiten Kollaborative Fähigkeiten Abbildung 20: Prinzip des Flow s angewandt auf Kognition und Kollaboration. In beiden Fällen muss die Schwierigkeit, die Anforderung des Spiels, den Fähigkeiten der Spieler entsprechen, um ein motivierendes Spielerlebnis mitsamt Lerneffekt zu ermöglichen. Der Spielfluss, der Flow, wird somit auf zwei Ebenen erzeugt: Kollaboration und Kognition. Diese zweidimensionale Schachtelung erlaubt somit eine starke Motivationsfähigkeit des Spiels, ohne jedoch den therapeutischen Aspekt zu vernachlässigen. Der Schwierigkeitsgrad ist variabel, wie in Anforderung A12 gefordert und überlässt sowohl dem Therapeuten, als auch den Spielenden Freiräume. Der Fokus liegt auf der Belohnung von Kooperation. Die Umsetzung von kooperativem Willen bei Spielern erfolgt über die Spielfähigkeit. Diese kognitive und körperliche Hürde ist jedoch zu Anfang tief gehalten. Somit ist Anforderung A17 erfüllt, eingeschränkte Spielfähigkeit wird nicht abgestraft. Nicht die Spielfähigkeit wird belohnt, sondern ausschließlich der Teamgedanke dahinter. Die Spieler sorgen für eine längerfristige Motivation dadurch, dass sie den kognitiven Anspruch ändern. Dass Spieler, die das Spiel gerade kennenlernen, nicht sofort auf hohen Spielleveln einsteigen, unterliegt der Kontrolle des Therapeuten.
23 4 Erste Evaluation Das Spiel wurde zu diesem Zeitpunkt bereits in einem ersten Evaluationsschritt von den Teilnehmern der ersten Ersatznutzerstudie getestet. Auf den genauen Ablauf und die Details der Ergebnisse wird jedoch erst in der kommenden Bachelorarbeit eingegangen. Zusammenfassend sei erwähnt, dass einige Spielinhalte, wie der Teleporter oder die Drohne verbessert werden können, ebenfalls müssen die Hinweise die Inhalte stärker visualisieren. Der Schwierigkeitsgrad einzelner Spiellevel muss noch balancierter sein und der motorische Anspruch der Aufgaben kann ein wenig höher gesetzt werden. 5 Entwicklung 5.1 Verwendete Entwicklungsumgebungen und Werkzeuge Das Projekt wurde mithilfe von CSharp und WPF umgesetzt. Als Entwicklungsumgebungen dienten Microsoft Visual Studio Ultimate 2010 sowie Microsoft Expression Blend 4. Neben dem.net Framework wurden XNA Bibliotheken für die Soundeffekte verwendet. Das VisualStudio Plugin JetBrains ReSharper half bei der korrekten Ausformulierung und Bildung der Syntax in CSharp. Durch Autodesk AutoCAD und Autodesk Inventor konnten die Spielfiguren modelliert werden. 5.2 Modellierung der Spielfiguren Nach Anforderung A09 sollte das Spieldesign für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf angelegt sein. Daher war es das Beste, dass ein Kind dieser Altersgruppe bei der Modellierung der Spielfiguren half. Vladislav Syomushkin, acht Jahre alt, war Teilnehmer des Integrationsprojektes Balu und Du, bei dem auch ich ehrenamtlich teilnahm, um ihn über ein Jahr hinweg zu begleiten und ihn durch sprach- und integrationsfördernde Tätigkeiten bei seiner Entwicklung zu unterstützen. Er half mir bei der Modellierung des ersten Spielfigurenmodells (Abbildung 21). Kriterien für die Modellierung war die Passbarkeit für seine Hände und die Möglichkeit der Farberkennung des Modelle, welche im fertigen Spiel eine Rolle spielen. Aus diesem Entwurf konnte mithilfe von AutoCAD ein 3D-Modell, sowie technische Zeichnungen angefertigt werden (Abbildung 22 und 24), welches schließlich durch die Werkstätten der Universität realisiert wurde (Abbildung 23).
24 Abbildung 21: Modell aus Modelliermasse Abbildung 22: Modell in AutoCAD Abbildung 23: Fertiggestelltes Modell
25 Abbildung 24: Technische Zeichnung der Spielfigur (AutoCAD)
26 5.3 Systemarchitektur An dieser Stelle soll die Systemarchitektur des Projekts erläutert werden. Vorangestellt sei an dieser Stelle, dass der Fokus dieses Projekts nicht technischer, als vielmehr theoretischer Natur ist. Aus diesem Grund wird die Ausformulierung der technischen Aspekte kurz gehalten. Zusammenfassend soll erwähnt werden, dass es diverse Schwierigkeiten zu bewältigen gab. Die Implementierung nahm vier Monate in Anspruch. Die vorangestellte Planung des Projekts überstieg diesen Zeitrahmen um ein vielfaches. Das nachfolgende Komponentendiagramm soll nun einen Überblick über die Architektur des Systems bieten (Abbildung 25). In das Hauptfenster der Applikation werden konsekutiv Seiten geladen. Diese Seiten verwenden verschiedene UserControls, mit denen der Nutzer interagiert, um das System zu steuern. Darunterliegende Klassen bewältigen die innere Logik des Programms. Pages Diese Komponente umfasst sowohl die Hauptmenüseite, als auch die eigentliche Spielseite. Zwischen diesen Seiten wird navigiert, wenn das Spiel gestartet, beziehungsweise beendet wird. UserControls Diese Komponente umfasst alle spielspezifischen Grafikelemente, wie animierte Hintergründe und Gegnertypen, aber auch allgemeine Elemente wie Effekte (Überblendungen, Explosionen, Lichter etc.) und Steuerelemente (Punktanzeigetafeln, Buttons, Tutorials etc.). UserControls verwenden neben ihren partiellen Klassen auch eigenständige Klassen. Classes Wichtige Klassengruppen in dieser Komponente liefern die Interfaces, nach denen alle Gegnertypen, Hintergründe und sonstige Spielelemente vereinheitlicht werden. Die Nutzung von Interfaces bietet an dieser Stelle die Möglichkeit, relativ effizient neue Spielelemente zu generieren. Andere Klassen sind die Events, mithilfe derer die Kommunikation unterhalb der Klassen stattfindet, die Datenklassen, durch welche Einstellungen und Spielstände gespeichert werden und Helferklassen für Abfragen visueller Strukturen und Soundwiedergabe.
27 Abbildung 25: Komponentendiagramm des Systems (Enterprise Architect)
28 Im folgenden wird die Vorgehensweise objektorientierter Entwicklung beispielhaft erläutert. Relevant ist an dieser Stelle die Nutzung der Interfaces, mithilfe derer effizient Spielelemente hinzugefügt werden können. Diese Interfaces werden von der GameMain- Klasse in den Pages genutzt. Interfaces sind IEnemy, IPickup und IBackground. Die Ausführung an dieser Stelle bleibt exemplarisch, wie schon zu Beginn des Kapitels erläutert. Der komplette Sourcecode des Projekts kann bei Bedarf in Anhang C eingesehen werden. public interface IEnemy { event EventHandler<EnemyDestroyedEventArgs> EnemyDestroyed; event EventHandler<EnemyFledEventArgs> EnemyFled; event EventHandler<EnemyReadyToUnloadEventArgs> EnemyReadyToUnload; event EventHandler<EnemyDisplayScoreEventArgs> EnemyDisplayScore; } void Show(); void Flee(); void PauseAnimation(); void ContinueAnimation(); void SetModeToScan(); void SetModeToAlreadyScanned(); void SetModeToNormal(); Hint Hint(); void ReceiveDamageFromPlayer(double damage, Player player); bool IsDamagePossible(); int ScanIdentifier(); double LoadingTimeFactor(); void RotateLightComponents(double angle, int time); bool IsTopmostEnemy(); int OrderValueSize(); public interface IBackground { void Start(); void NextStep(); bool HasNextStep(); void Pause(); void Continue(); } public interface IPickup { event EventHandler<EventArgs> PickedUp; event EventHandler<EventArgs> ReadyToLoad; event EventHandler<EventArgs> ReadyToUnload; event EventHandler<EventArgs> ReadyToScan; } Hint Hint(); void LoadedIntoView(); void StartLoadingTimer(); void StopLoadingTimer(); bool Remove(); void PauseAnimationSetModeToScan(bool alreadyscanned); void ContinueAnimationSetModeToNormal(); void ReceiveBeamHit(); int ScanIdentifier();
29 Die gebotenen Schnittstelle werden in der GameMain vor allem durch folgende Methoden angesprochen. /// <summary> /// Loads one enemy into the view /// </summary> /// <param name="enemy"></param> private void LoadEnemy(IEnemy enemy) { _loadedenemies.add(enemy); enemy.enemydestroyed += EnemyDestroyedHandler; enemy.enemyfled += EnemyFledHandler; enemy.enemyreadytounload += EnemyUnloadHandler; enemy.enemydisplayscore += EnemyDisplayScoreHandler; _enemycontent.children.insert(0, (UIElement) enemy ); enemy.show(); enemy.rotatelightcomponents(_currentlightangle, 0); } /// <summary> /// Deletes the enemy from view. This method does not delete the enemy from the _currentenemies list! /// (check Enemyhandlers for that) /// </summary> /// <param name="enemy"></param> private void UnloadEnemy(IEnemy enemy) { _loadedenemies.remove(enemy); enemy.enemydestroyed -= EnemyDestroyedHandler; enemy.enemyfled -= EnemyFledHandler; enemy.enemyreadytounload -= EnemyUnloadHandler; enemy.enemydisplayscore -= EnemyDisplayScoreHandler; _enemycontent.children.remove(enemy as System.Windows.Controls.UserControl); } /// <summary> /// Pickup gets loaded /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void PickupReadyToLoadHandler(object sender, EventArgs e) { //get pickup var pickup = sender as IPickup; if (pickup == null) return; //remove handler pickup.readytoload -= PickupReadyToLoadHandler; //add handlers pickup.readytounload += PickupReadyToUnloadHandler; pickup.pickedup += PickupPickedUpHandler; //sort lists _loadingpickups.remove(pickup); _currentpickups.add(pickup); } //add into view var pickupelement = pickup as UIElement; if (pickupelement == null) return; _pickupcontent.children.add(pickupelement); pickup.loadedintoview();
30 /// <summary> /// Pickup gets unloaded /// </summary> /// <param name="sender"></param> /// <param name="e"></param> private void PickupReadyToUnloadHandler(object sender, EventArgs e) { //get pickup var pickup = sender as IPickup; if (pickup == null) return; //remove handlers pickup.readytounload -= PickupReadyToUnloadHandler; pickup.pickedup -= PickupPickedUpHandler; } //remove from view var pickupelement = pickup as UIElement; if (pickupelement == null) return; _enemycontent.children.remove(pickupelement); Die einzelnen Handler-Methoden rufen die Funktionen auf, welche die Gegner steuern. So können Gegner nach Ablauf der Zeit fliehen, bei Scans (Hinweisen) pausieren oder Schaden nehmen. Die Funktion zum Schaden nehmen wird an dieser Stelle als Beispiel ausgeführt. Logik, die den Gegner, in diesem Fall den Raider, selbst betrifft, wird intern abgehandelt. Relevante Informationen, etwa, wenn bei einer Zerstörung des Schiffs, werden über Events nach außen geleitet. /// <summary> /// Ship receives damage from player, plays specific animation and throws events accordingly /// </summary> /// <param name="damage"></param> /// <param name="player"></param> public void ReceiveDamageFromPlayer(double damage, Player player) { if (!_damagepossible) return; //animate damage var damagevisual = new DamageVisual(player.PlayerColor) {Width = Width, Height = Height}; _explosioncontent.children.add(damagevisual); Canvas.SetLeft(damageVisual, - damagevisual.width / 2); Canvas.SetTop(damageVisual, - damagevisual.height / 2); var damagereceiving = damage; var collaborative = false; //more damage if player changed (in time), not first shot if (_lastplayerreceiveddamagefrom!= null && _lastplayerreceiveddamagefrom.playernumber!= player.playernumber &&!_damagebonustimeexpired) { collaborative = true;
31 } else { } //more damage damagereceiving *= CollaborativeBonusDamageFactor; _collaborativedamagereceived += damagereceiving; _normaldamagereceived += damagereceiving; //sound SoundHelper.Play(Properties.Resources.EnemyHit); //receive damage _healthpoints -= damagereceiving; if (_healthpoints < 0.0) _healthpoints = 0.0; //set damage visual SetLifepointPercentage(_healthPoints / _starthealthpoints); //check if enemy is destroyed if (_healthpoints <= 0.0) { //stop movement StopMovement(); //stop rotation _continuerotating = false; //stop receiving damage _damagepossible = false; //stop color changing _damagebonustimeexpiredtimer.stop(); //compute score and set parameters for event _scoreachieved = PointsPlusMinusForEnemy; _scoreachieved += (PointsPlusMinusForHealthPoint * _starthealthpoints); //set event properties if (_collaborativedamagereceived > _normaldamagereceived) { collaborative = true; } _collaborativekill = collaborative; //set display type _displaytype = EnemyDisplayTypes.Shot; DisplayScoreText(); //Raise display score event after score has been properly displayed var timer = new Timer {Interval = 2500}; timer.tick += (sender, e) => { timer.stop(); RaiseEnemyDisplayScoreEvent(); }; timer.start(); //Raise event RaiseEnemyDestroyedEvent(); var storyboard = (Storyboard)FindResource(AnimationReceivingDamage); //let enemy explode after damage animation
32 var storyboard2 = (Storyboard)FindResource(AnimationExplosion); storyboard.completed += (sender, e) => { storyboard2.begin(); SoundHelper.Play(Random.Next(2) == 1? Properties.Resources.Explosion1 : Properties.Resources.Explosion2); //add explosion uc`s var currentexplosions = TotalNumberExplosions; while (currentexplosions!= 0) { //disable timer if neccessary if (--currentexplosions == 0) { var eventtimer = new Timer {Interval = ExplosionTime }; eventtimer.tick += (sender2, e2) => { eventtimer.stop(); Visibility = Visibility.Collapsed; RaiseEnemyReadyToUnloadEvent(); }; eventtimer.start(); } }; //add to random point inside raider window AddRandomExplosion(); } } else { //reset timer and bonus damage data _lastplayerreceiveddamagefrom = player; _damagebonustimeexpired = false; _damagebonustimeexpiredtimer.stop(); _damagebonustimeexpiredtimer.start(); //stop movement StopMovement(); } } //set storyboard if not already running if (!_isdmgstoryboardrunning) { _isdmgstoryboardrunning = true; var storyboard = (Storyboard)FindResource(AnimationReceivingDamage); storyboard.begin(); }
33 6 Lessons Learned Nach der Fertigstellung des Projekts kam es zu Performanzproblemen. Die Möglichkeiten von WPF wurden ausgereizt, jedoch wurde offensichtlich, dass das Framework nicht für anspruchsvolle, das heißt animationsintensive, Programme ausgelegt ist. Bei zukünftigen Arbeiten sollte daher von vornherein beispielsweise mit dem XNA Framework gearbeitet werden. Dafür spricht auch, dass das Programm bereits zu Teilen mit diesem Framework umgesetzt worden ist. Bei der Entwicklung der Spielfiguren kam es zu Problemen mit der Absorbierfähigkeit infraroten Lichts durch das Material auf der Unterseite des Tokens. Hier brauchte es einige Versuche, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. 7 Ausblick Der Spielprototyp wird im nachfolgenden optimiert. Die Performanzprobleme sollen beseitigt werden. Die Verbesserungspotentiale, die sich durch die erste Evaluation ergeben haben, werden in einem nachfolgenden Implementierungsschritt eingearbeitet. Im Fokus bei der weiteren Evaluierung liegt die zentrale Fragestellung, ob Kollaboration, die sich dem Spieler empfiehlt, tendenziell wirkungsvoller ist als solche, die erzwungen wird. Eine weitere Evaluierung schließt daher die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ASS ein. Angestrebt wird ein Spieltest, eine Case Study, innerhalb einer Therapiegruppe. Als Möglichkeit hierfür bieten sich Kontakte vom Autismustherapiezentrum in Freiburg oder in Zürich an. Ich habe bereits Anfragen an diese Zentren geschickt und warte zu diesem Zeitpunkt auf Rückmeldungen. Die Antwort auf die Fragestellung kann zu einer Verbesserung im Designprozess zukünftig entwickelter Therapiespielen führen. Dies umfasst nicht nur das Krankheitsbild der Autismus-Spektrum-Störungen, sondern jedwede Krankheit, die im Bereich der kommunikativen Störungen liegt.
34 8 Quellenverzeichnis Baron-Cohen 1992: Baron-Cohen, Simon: Out of sight or out of mind? Another look at deception in autism. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry 30, S , 1992 Constantine & Lockwood 2006: Constantine, L.L., Lockwood, L.A.D.: Software for Use A Practical Guide to the Models and Mehods of Usage-Centered Design. ACM Press, 8. Auflage, 2006 Csíkszentmihályi 1997: Csíkszentmihályi, Mihály.: Finding flow: the psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997 DSM-IV-TR American Psychatric Association 2000: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition, Text Revision. Washington, DC, American Psychatric Association, 2000 Gal et al. 2009: Gal, E., Bauminger, N., Goren-Bar, D., Pianesi, F., Stock, O., Zancanaro, M., Weiss, P.L.: Enhancing Social Communication of Children with High-Functioning Autism through a Co-located Interface. Artificial Intelligence & Society 24, 75-84, 2009 Häußler et al. 2008: Häußler, Anne; Happel, Christina; Tuckermann, Antje; Altgassen, Mereike; Adl-Amini, Katja: SOKO Autismus - Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus. Erfahrungsbericht und Praxishilfen.Verlag Modernes Lernen, Dortmund, 2008 Piper et al. 2006: Piper, A.M.; O'Brien, E.; Morris, M.R.; Winograd, T.: SIDES: a cooperative tabletop computer game for social skills development. In Proceedings CSCW, pp.1-10, 2006 Premack & Woodruff 1978: Premack, D.; Woodruff, G.: Does the chimpanzee have a theory of mind? The behavioral and Brain Sciences, 4, , 1987 Schell 2008: Schell, Jesse: The Art of Game Design. Elsevier Inc, 2008 Ullmer et al. 2005: Ullmer, B; Ishii, H.; Jacob J.K.: Token and constraint systems for tangible interaction with digital information. TOCHI 12, 1, ACM Press, , 2005 Die Ausarbeitung zum Bachelorseminar kann bei Bedarf vorgelegt werden.
Autismus-Spektrum- Störung. von Dennis Domke & Franziska Richter
 Autismus-Spektrum- Störung von Dennis Domke & Franziska Richter Krankheitsbild Symptome können bereits direkt nach der Geburt auftreten Grad der Ausprägung variiert stark Geht oft mit weiteren psychischen
Autismus-Spektrum- Störung von Dennis Domke & Franziska Richter Krankheitsbild Symptome können bereits direkt nach der Geburt auftreten Grad der Ausprägung variiert stark Geht oft mit weiteren psychischen
Autismustherapie in der Praxis
 3. Mönchengladbacher Fachtagung AUTISMUS SPEKTRUM STÖRUNG 29.05. & 30.05.2015 Autismustherapie in der Praxis Ziel Wir möchten das Entwicklungspotential jedes Kindes nutzen und der Familie dabei helfen,
3. Mönchengladbacher Fachtagung AUTISMUS SPEKTRUM STÖRUNG 29.05. & 30.05.2015 Autismustherapie in der Praxis Ziel Wir möchten das Entwicklungspotential jedes Kindes nutzen und der Familie dabei helfen,
Proseminar (SS 2009): Human-Computer Interaction. Michael Kipp Jan Miksatko Alexis Heloir DFKI
 Proseminar (SS 2009): Human-Computer Interaction Michael Kipp Jan Miksatko Alexis Heloir DFKI Heute Mensch-Computer-Interaktion Ablauf Vorträge Ausarbeitungen Betreuung Themen Themenvergabe Mensch-Computer-Interaktion
Proseminar (SS 2009): Human-Computer Interaction Michael Kipp Jan Miksatko Alexis Heloir DFKI Heute Mensch-Computer-Interaktion Ablauf Vorträge Ausarbeitungen Betreuung Themen Themenvergabe Mensch-Computer-Interaktion
Usability Engineering: Design Gruppe 4: Rapid Contextual Design
 Universität Konstanz Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion WS 07/08 Usability Engineering: Design Gruppe 4: Rapid Contextual Design Oliver Runge 623924 Benjamin Frantzen 617681 Kerstin Samad 623924 Inhaltsverzeichnis
Universität Konstanz Fachbereich Mensch-Computer-Interaktion WS 07/08 Usability Engineering: Design Gruppe 4: Rapid Contextual Design Oliver Runge 623924 Benjamin Frantzen 617681 Kerstin Samad 623924 Inhaltsverzeichnis
Ich bin mir Gruppe genug
 Ich bin mir Gruppe genug Leben mit Autismus Spektrum bzw. Asperger Syndrom Mag. Karin Moro, Diakoniewerk OÖ. Autismus Spektrum Störung Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Beginn: frühe Kindheit) Kontakt-
Ich bin mir Gruppe genug Leben mit Autismus Spektrum bzw. Asperger Syndrom Mag. Karin Moro, Diakoniewerk OÖ. Autismus Spektrum Störung Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Beginn: frühe Kindheit) Kontakt-
Autismus-Spektrum-Störung im Versorgungssystem der Jugendhilfe. Prof. Dr. med. Judith Sinzig
 Autismus-Spektrum-Störung im Versorgungssystem der Jugendhilfe Prof. Dr. med. Judith Sinzig Symptomatik Autismus Spektrum Störungen (ASS) Qualitative Beeinträchtigung der reziproken sozialen Interaktion
Autismus-Spektrum-Störung im Versorgungssystem der Jugendhilfe Prof. Dr. med. Judith Sinzig Symptomatik Autismus Spektrum Störungen (ASS) Qualitative Beeinträchtigung der reziproken sozialen Interaktion
Prim.Dr.Katharina Purtscher
 Prim.Dr.Katharina Purtscher Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz Definition tiefgreifende Entwicklungsstörung Qualitative Beeinträchtigungen gegenseitiger
Prim.Dr.Katharina Purtscher Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz Definition tiefgreifende Entwicklungsstörung Qualitative Beeinträchtigungen gegenseitiger
Repetitive Strukturen
 Repetitive Strukturen Andreas Liebig Philipp Muigg ökhan Ibis Repetitive Strukturen, (z.b. sich wiederholende Strings), haben eine große Bedeutung in verschiedenen Anwendungen, wie z.b. Molekularbiologie,
Repetitive Strukturen Andreas Liebig Philipp Muigg ökhan Ibis Repetitive Strukturen, (z.b. sich wiederholende Strings), haben eine große Bedeutung in verschiedenen Anwendungen, wie z.b. Molekularbiologie,
ucanvas: Interaktive Anzeigeflächen auf heterogenen Oberflächen
 ucanvas: Interaktive Anzeigeflächen auf heterogenen Oberflächen Tobias Bagg und Yves Grau Projekt-INF-Tagung Stuttgart 07.11.2013 Agenda Einleitung Verwandte Arbeiten ucanvas Architektur Applikationen
ucanvas: Interaktive Anzeigeflächen auf heterogenen Oberflächen Tobias Bagg und Yves Grau Projekt-INF-Tagung Stuttgart 07.11.2013 Agenda Einleitung Verwandte Arbeiten ucanvas Architektur Applikationen
Windows Presentation Foundation (WPF) -Grundlagen -Steuerelemente. Dr. Beatrice Amrhein
 Windows Presentation Foundation (WPF) -Grundlagen -Steuerelemente Dr. Beatrice Amrhein Überblick Die Architektur WPF Projekt erstellen Steuerelemente einfügen Eigenschaften von Steuerelementen ändern Nach
Windows Presentation Foundation (WPF) -Grundlagen -Steuerelemente Dr. Beatrice Amrhein Überblick Die Architektur WPF Projekt erstellen Steuerelemente einfügen Eigenschaften von Steuerelementen ändern Nach
Algorithmen und Datenstrukturen Musterlösung 5
 Algorithmen und Datenstrukturen Musterlösung 5 Martin Avanzini Thomas Bauereiß Herbert Jordan René Thiemann
Algorithmen und Datenstrukturen Musterlösung 5 Martin Avanzini Thomas Bauereiß Herbert Jordan René Thiemann
a.k.a. Broker a.k.a. Vermittler , Sebastian Gäng, Moritz Moll, Design Pattern, HTWG Konstanz
 Mediator Pattern a.k.a. Broker a.k.a. Vermittler 1 2009, Sebastian Gäng, Moritz Moll, Design Pattern, HTWG Konstanz Beschreibung Klassifikation: i Objektbasiertes b Verhaltensmuster hl Zweck: Wenn eine
Mediator Pattern a.k.a. Broker a.k.a. Vermittler 1 2009, Sebastian Gäng, Moritz Moll, Design Pattern, HTWG Konstanz Beschreibung Klassifikation: i Objektbasiertes b Verhaltensmuster hl Zweck: Wenn eine
Autismus ambulant Regionalbüro Münsterland
 Evangelisches Kinderheim - Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel ggmbh ISOLATION ÜBERWINDEN GEMEINSCHAFT ERÖFFNEN PERSPEKTIVEN ENTWICKELN Autismus ambulant Regionalbüro Münsterland Konzeption Mar.Te.As Ein
Evangelisches Kinderheim - Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel ggmbh ISOLATION ÜBERWINDEN GEMEINSCHAFT ERÖFFNEN PERSPEKTIVEN ENTWICKELN Autismus ambulant Regionalbüro Münsterland Konzeption Mar.Te.As Ein
Prim.Dr.Katharina Purtscher
 Prim.Dr.Katharina Purtscher Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz Definition tiefgreifende Entwicklungsstörung Qualitative Beeinträchtigungen gegenseitiger
Prim.Dr.Katharina Purtscher Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz Definition tiefgreifende Entwicklungsstörung Qualitative Beeinträchtigungen gegenseitiger
Freiburger Elterntraining
 Freiburger Elterntraining für Autismus-Spektrum-Störungen 2015, Springer Verlag Berlin Heidelberg. Aus: Brehm et al.: FETASS Freiburger Elterntraining für Autismus-Spektrum-Störungen 1.1 Die Module und
Freiburger Elterntraining für Autismus-Spektrum-Störungen 2015, Springer Verlag Berlin Heidelberg. Aus: Brehm et al.: FETASS Freiburger Elterntraining für Autismus-Spektrum-Störungen 1.1 Die Module und
Anleitung Badges (Moodle)
 Anleitung Badges (Moodle) Herzlich willkommen zur Einführung von Badges in Moodle. Warum könnten Badges auch eine Bereicherung für Ihren Moodle-Kurs sein? 2 Beispielszenarien für Badges: Externer Wettbewerb
Anleitung Badges (Moodle) Herzlich willkommen zur Einführung von Badges in Moodle. Warum könnten Badges auch eine Bereicherung für Ihren Moodle-Kurs sein? 2 Beispielszenarien für Badges: Externer Wettbewerb
Weiterbildungsreihe: Förderung von Menschen mit hochfunktionalem Autismus/Asperger Syndrom auf der Basis des TEACCH -Ansatzes
 Weiterbildungsreihe: Förderung von Menschen mit hochfunktionalem Autismus/Asperger Syndrom auf der Basis des TEACCH -Ansatzes Die einzelnen Teile finden, falls nicht anders vermerkt, in der Stiftung Kind
Weiterbildungsreihe: Förderung von Menschen mit hochfunktionalem Autismus/Asperger Syndrom auf der Basis des TEACCH -Ansatzes Die einzelnen Teile finden, falls nicht anders vermerkt, in der Stiftung Kind
Wuerfel - augenzahl: int + Wuerfel() + wuerfeln() + gibaugenzahl(): int
 Informatik Eph IFG1/2 (GA) Bearbeitungszeit: 90 min. Seite 1 Aufgabe 1: Kniffel Modellierung und Implementierung Im Folgenden sollen Teile eines kleinen "Kniffel"-Spiels modelliert, analysiert und implementiert
Informatik Eph IFG1/2 (GA) Bearbeitungszeit: 90 min. Seite 1 Aufgabe 1: Kniffel Modellierung und Implementierung Im Folgenden sollen Teile eines kleinen "Kniffel"-Spiels modelliert, analysiert und implementiert
Service Design. Service Design Workshop. //Was ist das?
 ? Service Design //Was ist das? Service Design formt die Beziehung zwischen Menschen und den Dienstleistungen, die sie benutzen. Wie ist der Bezug verschiedener Bestandteile einer Dienstleistung hergestellt
? Service Design //Was ist das? Service Design formt die Beziehung zwischen Menschen und den Dienstleistungen, die sie benutzen. Wie ist der Bezug verschiedener Bestandteile einer Dienstleistung hergestellt
Experiment zur Theory of Mind an Hand einer false belief- Fragestellung
 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Julia Schnaus und Natalie Spahn Experiment zur Theory of Mind an Hand einer false belief-
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache Julia Schnaus und Natalie Spahn Experiment zur Theory of Mind an Hand einer false belief-
Einführung in Truevision3D
 Einführung in Truevision3D Einleitung: In diesem Artikel werden wir uns mit der Truevision Engine beschäftigen, ihr werdet lernen wie man in C# auf die Engine zugreift und wie man einfache 2D Ausgaben
Einführung in Truevision3D Einleitung: In diesem Artikel werden wir uns mit der Truevision Engine beschäftigen, ihr werdet lernen wie man in C# auf die Engine zugreift und wie man einfache 2D Ausgaben
Die Logik der Sicherheit
 Die Logik der Sicherheit Seminar im Sommersemester 2016 Vorbesprechung, 20.04.2016 FAKULTÄT FÜR INFORMATIK, INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK 0 20.04.2016 Gunnar Hartung, Julia Hesse, Alexander Koch
Die Logik der Sicherheit Seminar im Sommersemester 2016 Vorbesprechung, 20.04.2016 FAKULTÄT FÜR INFORMATIK, INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK 0 20.04.2016 Gunnar Hartung, Julia Hesse, Alexander Koch
Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen
 Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21005 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21005 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Web Agents Business Intelligence - Teil II: Data Mining & Knowledge Discovery
 Web Agents Business Intelligence - Teil II: Data Mining & Knowledge Discovery Christian Weber c_web@informatik.uni-kl.de Gliederung 1. Das Konzept der Web Agents Web Agents im Kontext der Web Intelligence
Web Agents Business Intelligence - Teil II: Data Mining & Knowledge Discovery Christian Weber c_web@informatik.uni-kl.de Gliederung 1. Das Konzept der Web Agents Web Agents im Kontext der Web Intelligence
Übungen zu Softwareentwicklung 1, WS 2009/10 Übung 6
 Übungen zu Softwareentwicklung 1, WS 2009/10 Übung 6 Name: Abzugeben bis: Mi, 2.12.2009 12:00 Matrikelnummer: Bearbeitungsdauer in Stunden: Nummer der Übungsgruppe: Name des Tutors: Name des Übungsleiters:
Übungen zu Softwareentwicklung 1, WS 2009/10 Übung 6 Name: Abzugeben bis: Mi, 2.12.2009 12:00 Matrikelnummer: Bearbeitungsdauer in Stunden: Nummer der Übungsgruppe: Name des Tutors: Name des Übungsleiters:
WPF Steuerelemente. Dr. Beatrice Amrhein
 WPF Steuerelemente Listbox, ComboBox, ListView, Dr. Beatrice Amrhein Überblick Einführung Listen ComboBox Tabellen 2 Einf führung 3 Listen- und Tabellen-Elemente Listen und Tabellen-Elemente sind Steuerelemente,
WPF Steuerelemente Listbox, ComboBox, ListView, Dr. Beatrice Amrhein Überblick Einführung Listen ComboBox Tabellen 2 Einf führung 3 Listen- und Tabellen-Elemente Listen und Tabellen-Elemente sind Steuerelemente,
M O V I E I T. KUNST_Filmlabor, Visual Intelligence, Filmtraining und Interaktionsdesign für Menschen mit autistischer Wahrnehmung
 M O V I E I T KUNST_Filmlabor, Visual Intelligence, Filmtraining und Interaktionsdesign für Menschen mit autistischer Wahrnehmung Ein Projekt von RAINMAN`s HOME in Cooperation mit den Filmemachern Patricia
M O V I E I T KUNST_Filmlabor, Visual Intelligence, Filmtraining und Interaktionsdesign für Menschen mit autistischer Wahrnehmung Ein Projekt von RAINMAN`s HOME in Cooperation mit den Filmemachern Patricia
Design und Entwicklung von Online-Lernangeboten für die Hochschule
 Thomas Lerche Lehrstuhl für Schulpädagogik LMU München Hans Gruber Lehrstuhl für Pädagogik III Universität Regensburg Design und Entwicklung von Online-Lernangeboten für die Hochschule Ausgangslage Ca.
Thomas Lerche Lehrstuhl für Schulpädagogik LMU München Hans Gruber Lehrstuhl für Pädagogik III Universität Regensburg Design und Entwicklung von Online-Lernangeboten für die Hochschule Ausgangslage Ca.
Psychologische/Psychiatrische Begleitung und Coaching von jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Beruflichen Rehabilitation
 Psychologische/Psychiatrische Begleitung und Coaching von jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Beruflichen Rehabilitation Dr. med. Stefan Thelemann Kinder- und Jugendpsychiater, Betriebsarzt
Psychologische/Psychiatrische Begleitung und Coaching von jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Beruflichen Rehabilitation Dr. med. Stefan Thelemann Kinder- und Jugendpsychiater, Betriebsarzt
USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch
 USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch 1. Produkt Eigenschaften 1 2. System Vorraussetzungen 1 3. Treiber Installation (Alle Windows Systeme) 1 4. Den COM Port ändern 2 5. Einstellen eines RS232
USB -> Seriell Adapterkabel Benutzerhandbuch 1. Produkt Eigenschaften 1 2. System Vorraussetzungen 1 3. Treiber Installation (Alle Windows Systeme) 1 4. Den COM Port ändern 2 5. Einstellen eines RS232
Interface. So werden Interfaces gemacht
 Design Ein Interface (=Schnittstelle / Definition) beschreibt, welche Funktionalität eine Implementation nach Aussen anzubieten hat. Die dahinter liegende Algorithmik wird aber der Implementation überlassen.
Design Ein Interface (=Schnittstelle / Definition) beschreibt, welche Funktionalität eine Implementation nach Aussen anzubieten hat. Die dahinter liegende Algorithmik wird aber der Implementation überlassen.
Dr. Monika Meiler. Inhalt
 Inhalt 15 Parallele Programmierung... 15-2 15.1 Die Klasse java.lang.thread... 15-2 15.2 Beispiel 0-1-Printer als Thread... 15-3 15.3 Das Interface java.lang.runnable... 15-4 15.4 Beispiel 0-1-Printer
Inhalt 15 Parallele Programmierung... 15-2 15.1 Die Klasse java.lang.thread... 15-2 15.2 Beispiel 0-1-Printer als Thread... 15-3 15.3 Das Interface java.lang.runnable... 15-4 15.4 Beispiel 0-1-Printer
Didaktik Workshop FS10
 Didaktik Workshop FS10 Datum: März - August 2010 Leitung: Maria Papanikolaou Martina Dalla Vecchia 2010 1 Teaser Nachfolgendes Konzept wurde erstellt von Martina Dalla Vecchia im Rahmen des Didaktik- Workshops
Didaktik Workshop FS10 Datum: März - August 2010 Leitung: Maria Papanikolaou Martina Dalla Vecchia 2010 1 Teaser Nachfolgendes Konzept wurde erstellt von Martina Dalla Vecchia im Rahmen des Didaktik- Workshops
THEORY OF MIND TEIL 2
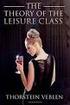 Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozentin: Susanne Kristen Wintersemester 2010/11 THEORY OF MIND TEIL 2 Nicole Biebel 6.12.2010 Gliederung 1) Theory of Mind ab 4 Jahren 1) Fähigkeiten mit
Seminar Vertiefung in Entwicklungspsychologie Dozentin: Susanne Kristen Wintersemester 2010/11 THEORY OF MIND TEIL 2 Nicole Biebel 6.12.2010 Gliederung 1) Theory of Mind ab 4 Jahren 1) Fähigkeiten mit
Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Ohmstraße 12, Karlsfeld
 Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Ohmstraße 12, 85757 Karlsfeld Petra Weindl / Klaus Funke Inklusive Förderung von Schülern mit hohem emotionalem
Dr.-Elisabeth-Bamberger-Schule Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Ohmstraße 12, 85757 Karlsfeld Petra Weindl / Klaus Funke Inklusive Förderung von Schülern mit hohem emotionalem
Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000)
 Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000) 12. Dezember 2012 Theory of Mind bei Autismus 2 Theoretischer
Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Abell, Happé, & Frith (2000) 12. Dezember 2012 Theory of Mind bei Autismus 2 Theoretischer
TEACCH EIN SCHULENTWI C KLUN GS P R O JE KT:
 TEACCH EIN SCHULENTWI C KLUN GS P R O JE KT: UNTERRICHT IN EINER NACH TEACCH PRINZIPI EN EINGERICHTET EN KLASSE Ausgangssituation an unserer Schule 2006/07 Steigende Zahl der Schüler mit frühkindlichen
TEACCH EIN SCHULENTWI C KLUN GS P R O JE KT: UNTERRICHT IN EINER NACH TEACCH PRINZIPI EN EINGERICHTET EN KLASSE Ausgangssituation an unserer Schule 2006/07 Steigende Zahl der Schüler mit frühkindlichen
Kinder mit Autismus Spektrum in der heilpädagogischen Früherziehung. Autismus Spektrum Störung. Erstellen der Diagnose
 Kinder mit Autismus Spektrum in der heilpädagogischen Früherziehung VHDS 18. September 2014 Monika Casura www.m-casura.ch Autismus Spektrum Störung Soziale Interaktion Qualitative Beeinträchtigung der
Kinder mit Autismus Spektrum in der heilpädagogischen Früherziehung VHDS 18. September 2014 Monika Casura www.m-casura.ch Autismus Spektrum Störung Soziale Interaktion Qualitative Beeinträchtigung der
Susanne Greiner, Data Scientist, Würth Phoenix. Würth Phoenix more than software
 USER GROUP 2018 Von der Datenaufnahme zur Datenanalyse Das Performance Monitoring von morgen: Einfluss von User Experience, Anomaly Detection, Deep Learning Susanne Greiner, Data Scientist, Würth Phoenix
USER GROUP 2018 Von der Datenaufnahme zur Datenanalyse Das Performance Monitoring von morgen: Einfluss von User Experience, Anomaly Detection, Deep Learning Susanne Greiner, Data Scientist, Würth Phoenix
Humanorientierung (HO) der IT Voraussetzungen
 Humanorientierung (HO) der IT Voraussetzungen Information setzt ein Lebewesen mit eigenem Bewusstsein voraus (= vordringlich Mensch). *) Nur ein solches kann Information verarbeiten und erzeugen. *) Dies
Humanorientierung (HO) der IT Voraussetzungen Information setzt ein Lebewesen mit eigenem Bewusstsein voraus (= vordringlich Mensch). *) Nur ein solches kann Information verarbeiten und erzeugen. *) Dies
Bedienungsanleitung der LED-Qube 5 V2
 Bedienungsanleitung der LED-Qube 5 V2 Winamp-Plugin V1.2 Stand 15.03.2010, V1.00 Qube Solutions UG (haftungsbeschränkt) Luitgardweg 18, DE-71083 Herrenberg info@qube-soutions.de http://www.qube-solutions.de
Bedienungsanleitung der LED-Qube 5 V2 Winamp-Plugin V1.2 Stand 15.03.2010, V1.00 Qube Solutions UG (haftungsbeschränkt) Luitgardweg 18, DE-71083 Herrenberg info@qube-soutions.de http://www.qube-solutions.de
Domain-Independent Support for Computer- Based Education of Argumentation Skills
 Domain-Independent Support for Computer- Based Education of Argumentation Skills Institut für Informatik - Research Group Human-Centered Information Systems St. Andreasberg, 08.03.2011 Argumentationsfertigkeiten
Domain-Independent Support for Computer- Based Education of Argumentation Skills Institut für Informatik - Research Group Human-Centered Information Systems St. Andreasberg, 08.03.2011 Argumentationsfertigkeiten
Download zu Beiträge aus der sozialpädagogischen Ausbildung Nr. 6/2015 Ricky Siegel: Hilft Klettern?
 1 Download zu Beiträge aus der sozialpädagogischen Ausbildung Nr. 6/2015 Ricky Siegel: Hilft Klettern? Tabelle 1 (Beispiele für Förderbereiche) zu Kapitel 4.3: Ziele des Kletterns Kognitiver Bereich Emotional-affektiver
1 Download zu Beiträge aus der sozialpädagogischen Ausbildung Nr. 6/2015 Ricky Siegel: Hilft Klettern? Tabelle 1 (Beispiele für Förderbereiche) zu Kapitel 4.3: Ziele des Kletterns Kognitiver Bereich Emotional-affektiver
Herzlich Willkommen zum Themenabend «Übergänge im Alltag»
 Herzlich Willkommen zum Themenabend «Übergänge im Alltag» Über uns Matthias Huber, Vorstandsmitglied ads, Fachperson und Selbstbetroffener Fabienne Serna, Beratungsstelle ads, Fachperson Barbara Wegrampf,
Herzlich Willkommen zum Themenabend «Übergänge im Alltag» Über uns Matthias Huber, Vorstandsmitglied ads, Fachperson und Selbstbetroffener Fabienne Serna, Beratungsstelle ads, Fachperson Barbara Wegrampf,
Game-Based Skill Development & Training Wie HR-Manager und Trainer betriebliches Lernen steuern und bewerten können
 Game-Based Skill Development & Training Wie HR-Manager und Trainer betriebliches Lernen steuern und bewerten können Zukunft Personal 2014 Köln Klaus P. Jantke Fraunhofer IDMT 16.10.2014 Game-Based Skill
Game-Based Skill Development & Training Wie HR-Manager und Trainer betriebliches Lernen steuern und bewerten können Zukunft Personal 2014 Köln Klaus P. Jantke Fraunhofer IDMT 16.10.2014 Game-Based Skill
Flow. Sich selbst entdecken und neue Erkenntnisse nutzen! Praxischeck für die Arbeitswelt
 CoachingBrief 02/2014 Sich selbst entdecken und neue Erkenntnisse nutzen! Erfahren Sie heute ein psychologisches Phänomen, was Ihnen vielleicht unbekannt erscheint. Doch Sie werden sich wieder erkennen!
CoachingBrief 02/2014 Sich selbst entdecken und neue Erkenntnisse nutzen! Erfahren Sie heute ein psychologisches Phänomen, was Ihnen vielleicht unbekannt erscheint. Doch Sie werden sich wieder erkennen!
Spezialklasse für Kinder mit Autismusspektrumstörung
 Spezialklasse für Kinder mit Autismusspektrumstörung Die Käthe-Kollwitz-Schule verfügt seit dem Schuljahr 2012/2013 über eine Klasse im Primarbereich, in der vorwiegend Schülerinnen und Schüler mit einer
Spezialklasse für Kinder mit Autismusspektrumstörung Die Käthe-Kollwitz-Schule verfügt seit dem Schuljahr 2012/2013 über eine Klasse im Primarbereich, in der vorwiegend Schülerinnen und Schüler mit einer
UNIGATE CL Konfiguration mit WINGATE
 UNIGATE CL Konfiguration mit WINGATE - UNIGATE CL Configuration via WINGATE Art.-Nr.: V3928 Deutschmann Automation GmbH & Co. KG Carl-Zeiss-Str. 8 D-65520 Bad Camberg Phone: +49-(0)6434-9433-0 Hotline:
UNIGATE CL Konfiguration mit WINGATE - UNIGATE CL Configuration via WINGATE Art.-Nr.: V3928 Deutschmann Automation GmbH & Co. KG Carl-Zeiss-Str. 8 D-65520 Bad Camberg Phone: +49-(0)6434-9433-0 Hotline:
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung
 Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung Dr. Helen Jossberger Was sind Ihrer Meinung nach die richtigen Zutaten für eine professionelle Entwicklung? Was ist für Sie gute Anleitung? Was
Analyse und Bewertung von Apps zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit
 Analyse und Bewertung von Apps zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Analyse und Bewertung von Apps zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Workshop zum Thema. 4. Workshop Gamification: Spielen wir uns zu Tode?
 Workshop zum Thema 4. Workshop Gamification: Spielen wir uns zu Tode? Spielen ist das dem Menschen innewohnende Prinzip ~ Edmund Burke (1729 1797) Agenda des Vortrags Was ist Gamification? Wie sieht Gamification
Workshop zum Thema 4. Workshop Gamification: Spielen wir uns zu Tode? Spielen ist das dem Menschen innewohnende Prinzip ~ Edmund Burke (1729 1797) Agenda des Vortrags Was ist Gamification? Wie sieht Gamification
Autismus. Verteifungsseminar Entwicklungspsychologie WS 10/11 Julia Willibald,
 Autismus Verteifungsseminar Entwicklungspsychologie WS 10/11 Julia Willibald, 11.01.11 Gliederung I. Definition II. III. IV. Klassifikation (nach ICD-10) Symptomatik Autismus und Theory of Mind-Defizite
Autismus Verteifungsseminar Entwicklungspsychologie WS 10/11 Julia Willibald, 11.01.11 Gliederung I. Definition II. III. IV. Klassifikation (nach ICD-10) Symptomatik Autismus und Theory of Mind-Defizite
THEMA: GUT VORBEREITET IST HALB ZERTIFIZIERT ANTWORTEN ZUR SAS VISUAL ANALYTICS-ZERTIFIZIERUNG" THOMAS WENDE
 WEBINAR@LUNCHTIME THEMA: GUT VORBEREITET IST HALB ZERTIFIZIERT ANTWORTEN ZUR SAS VISUAL ANALYTICS-ZERTIFIZIERUNG" THOMAS WENDE EBINAR@LUNCHTIME HERZLICH WILLKOMMEN BEI WEBINAR@LUNCHTIME Moderation Anne
WEBINAR@LUNCHTIME THEMA: GUT VORBEREITET IST HALB ZERTIFIZIERT ANTWORTEN ZUR SAS VISUAL ANALYTICS-ZERTIFIZIERUNG" THOMAS WENDE EBINAR@LUNCHTIME HERZLICH WILLKOMMEN BEI WEBINAR@LUNCHTIME Moderation Anne
Von Geburt an sozial - Wie Babys ihre Welt wahrnehmen
 Von Geburt an sozial - Wie Babys ihre Welt wahrnehmen Stefanie Hoehl & Tricia Striano Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig und Universität Heidelberg & Hunter College, CUNY,
Von Geburt an sozial - Wie Babys ihre Welt wahrnehmen Stefanie Hoehl & Tricia Striano Max Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig und Universität Heidelberg & Hunter College, CUNY,
Bedienungsanleitung / Manual : LED-Nixie
 Bedienungsanleitung / Manual : LED-Nixie English please see below. Bei Neustart und gleichzeitig gedrückter Taste während der Versionsanzeige (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (Standard)
Bedienungsanleitung / Manual : LED-Nixie English please see below. Bei Neustart und gleichzeitig gedrückter Taste während der Versionsanzeige (halten bis Beep hörbar), erfolgt eine Zurücksetzung auf (Standard)
Gelingensbedingungen schulischer Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen
 Gelingensbedingungen schulischer Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen Prof. Dr. Andreas Eckert Hochschule Bonn, 24. Oktober 2015 Fragestellungen Ø Welche besonderen pädagogischen Förderbedarfe lassen
Gelingensbedingungen schulischer Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen Prof. Dr. Andreas Eckert Hochschule Bonn, 24. Oktober 2015 Fragestellungen Ø Welche besonderen pädagogischen Förderbedarfe lassen
Fachgebiet Softwaretechnik, Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn. Testen. Tutorial im Rahmen des Software(technik)praktikums SS 2012
 Testen Tutorial im Rahmen des Software(technik)praktikums SS 2012 Grundlagen (1) Software ist ein fundamentales Element in der Softwarequalitätssicherung Software wird am häufigsten eingesetzt Viele Organisationen
Testen Tutorial im Rahmen des Software(technik)praktikums SS 2012 Grundlagen (1) Software ist ein fundamentales Element in der Softwarequalitätssicherung Software wird am häufigsten eingesetzt Viele Organisationen
1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement
 1 1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement Darstellung der Inhalte der Funktion Informationsmanagement und deren Bedeutung sowohl für handelnde Personen als auch in einem Unternehmen / einer Organisation.
1 1 Inhalte der Funktion Informationsmanagement Darstellung der Inhalte der Funktion Informationsmanagement und deren Bedeutung sowohl für handelnde Personen als auch in einem Unternehmen / einer Organisation.
Evangelisches Kinderheim - Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel ggmbh
 Evangelisches Kinderheim - Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel ggmbh ISOLATION ÜBERWINDEN GEMEINSCHAFT ERÖFFNEN PERSPEKTIVEN ENTWICKELN Konzeption TE.TR.AS TEACCH-TRIANGEL-ASPERGER-MOBIL Die ambulante Förderung
Evangelisches Kinderheim - Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel ggmbh ISOLATION ÜBERWINDEN GEMEINSCHAFT ERÖFFNEN PERSPEKTIVEN ENTWICKELN Konzeption TE.TR.AS TEACCH-TRIANGEL-ASPERGER-MOBIL Die ambulante Förderung
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Vorwort 11 1 Theoretische Einführung 13 1.1 Klassifikation und Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störungen... 13 1.1.1 Frühkindlicher Autismus (gem. ICD-10 F84.0) 13 1.1.2 Asperger-Syndrom (gem. ICD-10
Vorwort 11 1 Theoretische Einführung 13 1.1 Klassifikation und Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störungen... 13 1.1.1 Frühkindlicher Autismus (gem. ICD-10 F84.0) 13 1.1.2 Asperger-Syndrom (gem. ICD-10
Maschinennah visualisieren mit SIMATIC HMI
 Maschinennah visualisieren mit SIMATIC HMI Innovativ in Design und Bedienung Frei verwendbar Siemens AG 2016 siemens.de/hmi SIMATIC HMI machine based Über Maschinen, Funktionalität und Design Das Auge
Maschinennah visualisieren mit SIMATIC HMI Innovativ in Design und Bedienung Frei verwendbar Siemens AG 2016 siemens.de/hmi SIMATIC HMI machine based Über Maschinen, Funktionalität und Design Das Auge
Situated Reference in a Hybrid Human-Robot Interaction System
 Situated Reference in a Hybrid Human-Robot Interaction System M. Giuliani et al. 2010 vorgetragen von Bernadett Smolibocki Überblick Mensch-Roboter-Dialogsysteme Referenzgenerierung Experiment (Evaluation)
Situated Reference in a Hybrid Human-Robot Interaction System M. Giuliani et al. 2010 vorgetragen von Bernadett Smolibocki Überblick Mensch-Roboter-Dialogsysteme Referenzgenerierung Experiment (Evaluation)
NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient
 Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The
Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The
2.5 Listen. Kurzschreibweise: [42; 0; 16] Listen werden mithilfe von [] und :: konstruiert.
![2.5 Listen. Kurzschreibweise: [42; 0; 16] Listen werden mithilfe von [] und :: konstruiert. 2.5 Listen. Kurzschreibweise: [42; 0; 16] Listen werden mithilfe von [] und :: konstruiert.](/thumbs/55/37072779.jpg) 2.5 Listen Listen werden mithilfe von [] und :: konstruiert. Kurzschreibweise: [42; 0; 16] # let mt = [];; val mt : a list = [] # let l1 = 1::mt;; val l1 : int list = [1] # let l = [1;2;3];; val l : int
2.5 Listen Listen werden mithilfe von [] und :: konstruiert. Kurzschreibweise: [42; 0; 16] # let mt = [];; val mt : a list = [] # let l1 = 1::mt;; val l1 : int list = [1] # let l = [1;2;3];; val l : int
Der pragmatische Ansatz von Watzlawick unter Einbeziehung des Teufelskreismodells nach Schulz von Thun
 Geisteswissenschaft Antje Haim Der pragmatische Ansatz von Watzlawick unter Einbeziehung des Teufelskreismodells nach Schulz von Thun Analyse eines Konfliktgesprächs im Kontext einer Kindertagesstätte
Geisteswissenschaft Antje Haim Der pragmatische Ansatz von Watzlawick unter Einbeziehung des Teufelskreismodells nach Schulz von Thun Analyse eines Konfliktgesprächs im Kontext einer Kindertagesstätte
Design des Konzeptuellen Modells
 3.2.1.2 Design des Konzeptuellen Modells das modifizierte Organisationsmodell bildet die Grundlage (Struktur und Organisation) der Interface-Architektur. die Interface-Architektur schließt auch Konventionen
3.2.1.2 Design des Konzeptuellen Modells das modifizierte Organisationsmodell bildet die Grundlage (Struktur und Organisation) der Interface-Architektur. die Interface-Architektur schließt auch Konventionen
Kapitel 1: Die ersten Schritte 1
 Kapitel 1: Die ersten Schritte Thema: Programmieren Seite: 1 Kapitel 1: Die ersten Schritte 1 Starten Sie Eclipse. Importieren Sie das Eclipse-Projekt scenarios-chapter-1. Gehen Sie in den Unterordner
Kapitel 1: Die ersten Schritte Thema: Programmieren Seite: 1 Kapitel 1: Die ersten Schritte 1 Starten Sie Eclipse. Importieren Sie das Eclipse-Projekt scenarios-chapter-1. Gehen Sie in den Unterordner
Inhalt. 1. Einführung Philosophie 4. a) Isolation / Globalität. b) Die drei Wahrnehmungsstationen. 3. Schaubild Wahrnehmungsstationen 6
 Inhalt 1. Einführung 3 2. Philosophie 4 a) Isolation / Globalität b) Die drei Wahrnehmungsstationen 3. Schaubild Wahrnehmungsstationen 6 4. Schaubild Isolation / Globalität 7 5. Ansichten des Projektgebäudes
Inhalt 1. Einführung 3 2. Philosophie 4 a) Isolation / Globalität b) Die drei Wahrnehmungsstationen 3. Schaubild Wahrnehmungsstationen 6 4. Schaubild Isolation / Globalität 7 5. Ansichten des Projektgebäudes
Role Motivation Theory
 Wirtschaft Patrizia Szmergal / Dimitri Klundt / Alexander Quint Role Motivation Theory Studienarbeit Role Motivation Theory Dimitri Klundt Alexander Quint Patrizia Szmergal Abstract Unser Thema behandelt
Wirtschaft Patrizia Szmergal / Dimitri Klundt / Alexander Quint Role Motivation Theory Studienarbeit Role Motivation Theory Dimitri Klundt Alexander Quint Patrizia Szmergal Abstract Unser Thema behandelt
Kollaboratives Erkunden von Software mithilfe virtueller Realität 28. September in ExplorViz / 33
 Kollaboratives Erkunden von Software mithilfe virtueller Realität in ExplorViz 28. September 2017 Kollaboratives Erkunden von Software mithilfe virtueller Realität 28. September in ExplorViz 2017 1 / 33
Kollaboratives Erkunden von Software mithilfe virtueller Realität in ExplorViz 28. September 2017 Kollaboratives Erkunden von Software mithilfe virtueller Realität 28. September in ExplorViz 2017 1 / 33
Diagnostik AK Treffen 10/13 1
 Diagnostik 20.10.2013 AK Treffen 10/13 1 dabei handelt es sich um ein Bündel von Fähigkeiten, um den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Schüler sowie die Schwierigkeiten
Diagnostik 20.10.2013 AK Treffen 10/13 1 dabei handelt es sich um ein Bündel von Fähigkeiten, um den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Schüler sowie die Schwierigkeiten
Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind
 Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind Semantik im normalen und gestörten Spracherwerb Prof. Dr. Petra Schulz Referentin: Carolin Ickstadt Gliederung Definition: False belief
Faktivität und Theory of Mind / Komplexe Syntax und Theory of mind Semantik im normalen und gestörten Spracherwerb Prof. Dr. Petra Schulz Referentin: Carolin Ickstadt Gliederung Definition: False belief
Tube Analyzer LogViewer 2.3
 Tube Analyzer LogViewer 2.3 User Manual Stand: 25.9.2015 Seite 1 von 11 Name Company Date Designed by WKS 28.02.2013 1 st Checker 2 nd Checker Version history Version Author Changes Date 1.0 Created 19.06.2015
Tube Analyzer LogViewer 2.3 User Manual Stand: 25.9.2015 Seite 1 von 11 Name Company Date Designed by WKS 28.02.2013 1 st Checker 2 nd Checker Version history Version Author Changes Date 1.0 Created 19.06.2015
Software Design Patterns Zusammensetzung. Daniel Gerber
 Software Design Patterns Zusammensetzung Daniel Gerber 1 Gliederung Einführung Iterator Composite Flyweight Zusammenfassung 2 So wird s werden Problem und Kontext an einem Beispiel vorstellen Lösung des
Software Design Patterns Zusammensetzung Daniel Gerber 1 Gliederung Einführung Iterator Composite Flyweight Zusammenfassung 2 So wird s werden Problem und Kontext an einem Beispiel vorstellen Lösung des
Tiergestützte Therapie in der Sozialen Arbeit Der heilsame Prozess in der Mensch-Tier-Interaktion
 Geisteswissenschaft Sonja Doepke Tiergestützte Therapie in der Sozialen Arbeit Der heilsame Prozess in der Mensch-Tier-Interaktion Diplomarbeit Diplomarbeit zur Abschlußprüfung im Fachbereich Sozialwesen
Geisteswissenschaft Sonja Doepke Tiergestützte Therapie in der Sozialen Arbeit Der heilsame Prozess in der Mensch-Tier-Interaktion Diplomarbeit Diplomarbeit zur Abschlußprüfung im Fachbereich Sozialwesen
Die mentale Stärke verbessern
 1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
1 Die mentale Stärke verbessern 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 4 Was können wir uns unter der mentalen Stärke vorstellen?... 5 Wir suchen die mentale Stärke in uns... 6 Unsere Gedanken haben mehr Macht,
Modularitätsbetrachtung von Webanwendungen im Rahmen des Plat_Forms Wettbewerbs
 Andreas Franz Arbeitsgruppe Software Engineering, Institut für Informatik der Freien Universität Berlin Modularitätsbetrachtung von Webanwendungen im Rahmen des Plat_Forms Wettbewerbs Abschlussvortrag
Andreas Franz Arbeitsgruppe Software Engineering, Institut für Informatik der Freien Universität Berlin Modularitätsbetrachtung von Webanwendungen im Rahmen des Plat_Forms Wettbewerbs Abschlussvortrag
Designing Haptic. Computer Interfaces for blind people
 Designing Haptic Computer Interfaces for blind people Agenda 2 01 Motivation 02 Forschung 03 Einleitung 04 Experimente 05 Guidelines Motivation Motivation 4 i 1,2 Millionen sehbehinderte und blinde Menschen
Designing Haptic Computer Interfaces for blind people Agenda 2 01 Motivation 02 Forschung 03 Einleitung 04 Experimente 05 Guidelines Motivation Motivation 4 i 1,2 Millionen sehbehinderte und blinde Menschen
Objektorientierung. Marc Satkowski 20. November C# Kurs
 Objektorientierung Marc Satkowski 20. November 2016 C# Kurs Gliederung 1. Weiterführende Verzweigungen Tertiäre-Verzweigung switch case 2. Schleifen Zählschleife (for) break & continue 3. Objektorientierung
Objektorientierung Marc Satkowski 20. November 2016 C# Kurs Gliederung 1. Weiterführende Verzweigungen Tertiäre-Verzweigung switch case 2. Schleifen Zählschleife (for) break & continue 3. Objektorientierung
So kann ich lernen! Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs bei Schülern mit ASS. Susanne Schirmer und Katharina Kayser
 So kann ich lernen! Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs bei Schülern mit ASS 1 Kommunikation soziales Verhalten Interessen und Neigungen Wahrnehmung theory of mind (sich in andere hineinversetzen) exekutive
So kann ich lernen! Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs bei Schülern mit ASS 1 Kommunikation soziales Verhalten Interessen und Neigungen Wahrnehmung theory of mind (sich in andere hineinversetzen) exekutive
Vorlesung Informatik II
 Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 16. Java: Threads für Animationen 1 Motivation
Vorlesung Informatik II Universität Augsburg Wintersemester 2011/2012 Prof. Dr. Bernhard Bauer Folien von: Prof. Dr. Robert Lorenz Lehrprofessur für Informatik 16. Java: Threads für Animationen 1 Motivation
Software-Challenge Sixpack Spielregeln. 24. Juni 2013 PACK SIX
 Software-Challenge 2014 - Sixpack Spielregeln 24. Juni 2013 SIX PACK 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Spielmaterial 3 2.1 Das Spielbrett.................................. 3 2.2 Die Spielsteine.................................
Software-Challenge 2014 - Sixpack Spielregeln 24. Juni 2013 SIX PACK 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 3 2 Spielmaterial 3 2.1 Das Spielbrett.................................. 3 2.2 Die Spielsteine.................................
Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung. Zusammenfassung Kapitel 2
 Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung Zusammenfassung Kapitel 2 Übersicht Kapitel 2 2 Gamification... 5 2.1 Begriffsbestimmung... 6 2.1.1 Spiel... 9 2.1.2 Elemente... 12 2.1.3 Design...
Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung Zusammenfassung Kapitel 2 Übersicht Kapitel 2 2 Gamification... 5 2.1 Begriffsbestimmung... 6 2.1.1 Spiel... 9 2.1.2 Elemente... 12 2.1.3 Design...
Einführung in die Informatik
 Einführung in die Informatik Jochen Hoenicke Software Engineering Albert-Ludwigs-University Freiburg Sommersemester 2014 Jochen Hoenicke (Software Engineering) Einführung in die Informatik Sommersemester
Einführung in die Informatik Jochen Hoenicke Software Engineering Albert-Ludwigs-University Freiburg Sommersemester 2014 Jochen Hoenicke (Software Engineering) Einführung in die Informatik Sommersemester
Mathematik Seminar WS 2003: Simulation und Bildanalyse mit Java. Software-Architektur basierend auf dem Plug-in-Konzept
 Mathematik Seminar WS 2003: Simulation und Bildanalyse mit Java Software-Architektur basierend auf dem Plug-in-Konzept Aufteilung: Probleme mit normaler/alter Software Ziele des Software Engineerings Die
Mathematik Seminar WS 2003: Simulation und Bildanalyse mit Java Software-Architektur basierend auf dem Plug-in-Konzept Aufteilung: Probleme mit normaler/alter Software Ziele des Software Engineerings Die
Testing Reality. Real users. Real devices. Real time.
 1 Testing Reality. Real users. Real devices. Real time. Erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse über die Nutzung Ihres Produkts mit Crowdtesting und Cloud Devices auf einer Plattform. Für die Optimierung von
1 Testing Reality. Real users. Real devices. Real time. Erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse über die Nutzung Ihres Produkts mit Crowdtesting und Cloud Devices auf einer Plattform. Für die Optimierung von
Modularisierung in Java: Pakete Software Entwicklung 1
 Modularisierung in Java: Pakete Software Entwicklung 1 Annette Bieniusa, Mathias Weber, Peter Zeller Um zusammengehörende Klassen, Interfaces, etc. gemeinsam zu verwalten, Sichtbarkeiten einzugrenzen und
Modularisierung in Java: Pakete Software Entwicklung 1 Annette Bieniusa, Mathias Weber, Peter Zeller Um zusammengehörende Klassen, Interfaces, etc. gemeinsam zu verwalten, Sichtbarkeiten einzugrenzen und
Dies ist der zweite Artikel einer Serie über Electron.
 Electron WebDeskApps Dies ist der zweite Artikel einer Serie über Electron. Im ersten Artikel wurden die Grundlagen von Elektron, und die benötigten Ressourcen, die man benötigt um eine Elektron-App zu
Electron WebDeskApps Dies ist der zweite Artikel einer Serie über Electron. Im ersten Artikel wurden die Grundlagen von Elektron, und die benötigten Ressourcen, die man benötigt um eine Elektron-App zu
Einführung in die Programmierung I Systematisches Programmieren. Thomas R. Gross. Department Informatik ETH Zürich
 252-0027 Einführung in die Programmierung I 10.0 Systematisches Programmieren Thomas R. Gross Department Informatik ETH Zürich Copyright (c) Pearson 2013 and Thomas Gross 2016 All rights reserved. Uebersicht
252-0027 Einführung in die Programmierung I 10.0 Systematisches Programmieren Thomas R. Gross Department Informatik ETH Zürich Copyright (c) Pearson 2013 and Thomas Gross 2016 All rights reserved. Uebersicht
Michael Grönert 9. Juli Game Design
 Michael Grönert 9. Juli 2010 Game Design Page 2 Game Design Michael Grönert 9. Juli 2010 Game Design Die Grundlage der Spiele-Entwicklung Tätigkeit der theoretischen Konzeption Spielwelten Regeln Charaktere
Michael Grönert 9. Juli 2010 Game Design Page 2 Game Design Michael Grönert 9. Juli 2010 Game Design Die Grundlage der Spiele-Entwicklung Tätigkeit der theoretischen Konzeption Spielwelten Regeln Charaktere
Dokumentation BIPARCOURS für kreative Köpfe
 Dokumentation BIPARCOURS für kreative Köpfe Das Seminar BIPARCOURS für kreative Köpfe richtete sich an erfahrene BIPARCOURS-Nutzerinnen und -Nutzer. Diese sollten durch das Seminar Anregungen für eigene
Dokumentation BIPARCOURS für kreative Köpfe Das Seminar BIPARCOURS für kreative Köpfe richtete sich an erfahrene BIPARCOURS-Nutzerinnen und -Nutzer. Diese sollten durch das Seminar Anregungen für eigene
Software Entwicklung 1
 Software Entwicklung 1 Annette Bieniusa / Arnd Poetzsch-Heffter AG Softech FB Informatik TU Kaiserslautern Fallstudie: Lauftagebuch Bieniusa/Poetzsch-Heffter Software Entwicklung 1 2/ 21 Erstellen einer
Software Entwicklung 1 Annette Bieniusa / Arnd Poetzsch-Heffter AG Softech FB Informatik TU Kaiserslautern Fallstudie: Lauftagebuch Bieniusa/Poetzsch-Heffter Software Entwicklung 1 2/ 21 Erstellen einer
Einstieg in die Informatik mit Java
 1 / 15 Einstieg in die Informatik mit Java Collections Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 15 1 Überblick Collections 2 Hierarchie von Collections 3 Verwendung
1 / 15 Einstieg in die Informatik mit Java Collections Gerd Bohlender Institut für Angewandte und Numerische Mathematik Gliederung 2 / 15 1 Überblick Collections 2 Hierarchie von Collections 3 Verwendung
Knospe-ABA GmbH. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA
 .. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA Es wurden einige Studien durchgeführt, um den Stellenwert des Eltern-Trainings in den Prinzipien und Handlungsempfehlungen von ABA näher zu betrachten. Alle
.. Die Bedeutung des Eltern-Trainings in ABA Es wurden einige Studien durchgeführt, um den Stellenwert des Eltern-Trainings in den Prinzipien und Handlungsempfehlungen von ABA näher zu betrachten. Alle
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material
 Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
Colorcontex Zusammenhänge zwischen Farbe und textilem Material Zusammenfassung 2 2 2 Abstract Gruppierungen nach Eigenschaftspaaren Wirkung der Materialien Auswertung 3 4 5 6 7 8 9 10 Gelb Orange Rot Braun
Embedded Computing Conference 2017 Abstracts Stream 1 "Hardware"
 Abstracts Stream 1 "" Abstract en Email Firma Entscheidungsträger Entwickler Produktmanager Beschreibung (mind.200-300 Zeichen) Seite 1 von 1 Abstract Hochschulen en Email Hochschule Entscheidungsträg
Abstracts Stream 1 "" Abstract en Email Firma Entscheidungsträger Entwickler Produktmanager Beschreibung (mind.200-300 Zeichen) Seite 1 von 1 Abstract Hochschulen en Email Hochschule Entscheidungsträg
