Manual Neuro-Urologie und Querschnittlähmung Leitlinien zur urologischen Betreuung Querschnittgelähmter
|
|
|
- Gabriel Pfaff
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Manual Neuro-Urologie und Querschnittlähmung Leitlinien zur urologischen Betreuung Querschnittgelähmter 4. überarbeitete Auflage (2007)
2 Manual Neuro-Urologie und Querschnittlähmung Leitlinien zur urologischen Betreuung Querschnittgelähmter 4. überarbeitete Auflage (2007) Aus dem Arbeitskreis Urologische Rehabilitation Querschnittgelähmter Autoren: H. Burgdörfer - Hamburg; H. Heidler - Linz; H. Madersbacher - Innsbruck; J. Kutzenberger - Bad Wildungen; H. Palmtag - Sindelfingen; J. Pannek - Herne; D. Sauerwein - Bad Wildungen M. Stöhrer - Murnau
3 Geleitwort Vor 25 Jahren wurde der Arbeitskreis Urologische Rehabilitation Querschnittgelähmter gegründet. Durch die engagierte Arbeit seiner Gründungsmitglieder konnten die Grundlagen der neuro-urologischen Diagnostik und Therapie bei Querschnittgelähmten erarbeitet, standardisiert und in einem Manual publiziert werden. Bereits die bisherigen drei Auflagen fanden rasch weite Verbreitung. Seitdem haben sich viele Dinge gewandelt. Die Neuro-Urologie, einst exotischer Grenzbereich der Urologie, hat durch die Arbeit der Gründer dieses Arbeitskreises einen hohen Stellenwert erlangt. Die Neuro-Urologie ist heute eine innovative Subdisziplin der Urologie, deren Grundregeln Bestandteil der Facharztausbildung sind. Dadurch ist eine neue Generation von Urologen entstanden, welche die neuro-urologischen Zentren betreuen. Die Gründungsmitglieder scheiden nun aus dem Arbeitskreis aus. Sowohl die Patienten als auch wir, ihre Nachfolger, haben Ihnen viel zu verdanken. Die Arbeit dieser Pioniere hat dazu geführt, dass die hohe Mortalität durch urologische Komplikationen bei Querschnittgelähmten deutlich gesenkt werden konnte. Heute wird bei adäquater Versorgung kaum noch ein querschnittgelähmter Patient dialysepflichtig. Gleichzeitig konnte die Lebensqualität der Patienten verbessert werden. Ihre wissenschaftliche und publizistische Arbeit hat dazu geführt, dass die Neuro-Urologie wissenschaftlich anerkannt wurde und rasche Verbreitung fand. Die Aufgaben für die Zukunft sind vielfältig. Es gilt, eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung auch im DRG-System bezahlbar zu gestalten, die Rehabilitation des Harntrakts zu optimieren und somit die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Wir hoffen, dass die neue Mannschaft des Arbeitskreises ihre Ziele ebenso gut verwirklichen kann wie ihre Vorgänger es konnten, denen wir für ihre Arbeit und die Etablierung dieses Arbeitskreises ganz herzlich danken. Mittlerweile liegt die 4., überarbeitete Auflage dieses Manuals vor. Sie soll Ärzten, die sich nicht täglich mit der urologischen Behandlung Querschnittgelähmter beschäftigen, eine aktuelle Richtlinie für die Diagnostik und Therapie dieser Patienten sein. Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen ist der Arbeitskreis dankbar. Jürgen Pannek Manfred Stöhrer
4 Inhaltsverzeichnis Verwendete Abkürzungen und Definitionen 1 1 Der frisch Querschnittgelähmte Ziel Diagnostik Sofortmaßnahmen Suprapubische Blasenpunktionsfistel (SPF) Intermittierender Katheterismus (IK) Transurethraler Dauerkatheter (DK) Spontane Blasenentleerung (SB) Harnwegsinfekt (HWI) Infektprophylaxe (IK, SPF, DK) Maßnahmen bei Harnwegsinfektion (HWI) Zielsetzung in der Frühphase der Querschnittlähmung 8 2 Rehabilitation der Blasenfunktion Ziel Diagnostik Voraussetzung Komplette Lähmung Neurogene Akontraktilität von Detrusor und Sphinkter: (LMNL, Schlaffe Blase, areflexive Lähmung Ziel Diagnostik Routine-Maßnahmen Spezielle Maßnahmen bei neurogener Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz) Spezielle Maßnahmen bei atypischer symptomatik z.b. kleiner Blasenkapazität, niedriger Compliance Neurogene Hyperaktivität von Detrusor und Sphinkter: (UMNL, Hyperreflexive Lähmung Spastische Blase, Reflexblase ) Ziel Diagnostik Risikofaktoren Maßnahmen bei guter Handfunktion (Männer und Frauen) Maßnahmen bei Frauen ohne ausreichende Handfunktion Maßnahmen bei Männern ohne ausreichende Handfunktion Unterschiedliche Lähmungsmuster von Detrusor und Sphinkter (sog. gemischte Läsionen) Detrusorhyperaktivität mit Sphinkterakontraktilität Detrusorakontraktilität mit Sphinkterhyperaktivität Inkomplette Lähmung Viscerosensorisch inkomplette Lähmung Charakteristika 16
5 Maßnahmen Visceromotorisch inkomplette Lähmung bei suprasakraler Läsion (UMNL) - neurogene Detrusorhyperaktivität Charakteristika Maßnahmen zur Hemmung der Detrusorkontraktion Maßnahmen zur Auslösung der Detrusorkontraktion Visceromotorisch inkomplette Lähmung bei LMNL Charakteristika Maßnahmen Somatomotorisch inkomplette Lähmung bei suprasakraler Läsion (UMNL) - neurogene Sphinkterhyperaktivität Charakteristika Maßnahmen Somatomotorisch inkomplette Lähmung bei subsakraler/ peripherer Läsion (LMNL) - neurogene Sphinkterhypo-/ akontraktilität Charakteristika Maßnahmen 19 3 Langzeitbetreuung Ziel Allgemeine Kontrolluntersuchungen Zwischenanamnese Klinische Untersuchung Laboruntersuchung Sonographische Untersuchung Spezielle Kontrolluntersuchungen Zeitplan der Kontrolluntersuchungen Risikofaktoren Allgemeine Risikofaktoren Risikofaktoren nur durch Video-Urodynamik erkennbar Spezielle Überwachung nach neuro-urologischen Operationen 23 4 Lebenserwartung und Lebensqualität 24
6 Begriffe und Definitionen: Augmentation Autoaugmentation Autonome Dysreflexie Blasenfunktion ausgeglichen Compliance Detrusor- Akontraktilität neurogen Detrusorhyperaktivität, neurogen DK DSD Funktionelle Elektrostimulation /-Therapie Getriggerte Reflexentleerung HWI IK Erweiterung der Blase mit Darm, z.b. durch ausgeschaltete Ileumschlinge Entfernung des muskulären Blasendomes unter Erhalt der Schleimhaut mit folgender Ausbildung eines Pseudodivertikels (partielle Myektomie) Vegetative Fehlsteuerung mit Symptomen wie Gänsehaut, Schwitzen und/oder Bluthochdruckkrise Klinischer Begriff für eine aktzeptable Speicher- und Entleerungsfunktion normale Compliance adequate Kapazität physiologischer Entleerungsdruck akzeptabler Restharn Adaptation der Harnblase an die zunehmende Füllung, gemessen in ml/cmh 2 O Fehlende Detrusorkontraktion bei Läsion des spinalen Reflexbogens und bekanntem neurologischen Korrelat (früher: Detrusorareflexie) Unwillkürliche Detrusorkontraktion bei suprasakraler Läsion und bekanntem neurologischen Korrelat (früher: Detrusorhyperreflexie) Transurethraler Dauerkatheter Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie Neuro-Stimulation Neuro-Modulation Willkürliche Entleerung durch mechanische Auslösung des Blasenentleerungsreflexes Harnwegsinfekt Intermittierender Katheterismus (Selbstk. oder Fremdk.) Aseptischer Katheterismus 1. Desinfektion des Meatus urethrae 2. Verwendung steriler Materialien 3. Steriles (besser zusätzlich desinfizierendes) Gleitmittel/ Gleitschichtkatheter 4. kontaminationsfreies Einführen des Katheters Hygienischer Katheterismus (Synonyme: sauberer Katheterismus, CIC) 1. Händereinigung 1
7 2. evtl. Katheterwiederaufbereitung 3. möglichst kontaminationsfreies Einführen des Katheters Cave: erhöhtes Infektionsrisiko Steriler Katheterismus Steriles Setup wie bei aseptischen Operationen Influx LMNL Low Compliance Kontraktilität des Detrusors Durch pathologisch erhöhten Druck in der hinteren Harnröhre bedingtes Einfließen von Harn in die Prostata- und Samenbläschen, selten auch in den Ductus deferens Subsakrale oder periphere Läsion des sakralen Reflexbogens (früher: lower motor neuron lesion) Compliance < 20 ml/cm H 2 O In der Urodynamik meßbare Höhe des Detrusordruckes bei Kontraktion LPP Druck in der Blase bei Auftreten von Inkontinenz = Leak-Point-Pressure Reflexentleerung Reflexievolumen SARS SDAF SPF SB Sphinkter- Akontraktilität, neurogen Sphinkterotomie Harnentleerung durch neurogene Detrusorhyperaktivität (provoziert oder spontan) Blasenvolumen, bei dem eine neurogene Detrusorhyperaktivität auftritt Elektrostimulation der sakralen Vorderwurzeln S 2 bis S 5 (sacral anterior root stimulation) Vollständige Durchtrennung der sakralen Hinterwurzeln, S 2 bis S 5 (sacral deafferentation) Suprapubische Blasenfistel Spontane Blasenentleerung (willkürlich/unwillkürlich) Fehlende Sphinkterkontraktion bei Läsion des spinalen Reflexbogens und bekanntem neurologischen Korrelat Einkerbung des M. sphincter externus urethrae (transurethral durch Schneidstrom oder Laser) UMNL suprasakrale spinale Läsion (früher: upper motor neuron lesion) VUR Reflux aus der Blase in die oberen Harnwege (vesico-uretero-renaler Reflux) Nomenklatur berücksichtigt die ICS-Standardization of Terminology of LUT-Function
8 1 Der frisch Querschnittgelähmte 1 Der frisch Querschnittgelähmte Bei jeder Querschnittlähmung besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neurogene Blasenfunktionsstörung, die sich durch mehrere Symptome bemerkbar macht: Gestörtes oder fehlendes Gefühl für die Blasenfüllung, fehlende oder unvollständige Blasenentleerung, Harninkontinenz. Als Akutphase ist der Zeitraum anzusehen, bis der Blasenlähmungstyp erkennbar ist und ein mittelfristiges Therapiekonzept erstellt werden kann. In der Akutphase der Querschnittlähmung spricht man vom Spinalen Schock. Die Harnblase ist in der Lage Urin zu speichern, jedoch nicht zu entleeren. Ohne sofortige urologische Maßnahmen (Unfalltag!) kommt es zur Überdehnung der Harnblase mit Inkontinenz, sekundär zur Infektion und Nierenfunktionsstörung. 1.1 Ziel Vermeidung von Frühkomplikationen als Voraussetzung für erfolgreiche Rehabilitation der Funktion des unteren Harntraktes Verhinderung von Blasenüberdehnung Verhinderung von Harnwegsinfektionen Verhinderung der Steinbildung Vermeidung von Harnröhrenschäden 1.2 Diagnostik Urologische Anamnese (Vorerkrankungen) Bestimmung der Blasenfüllung (Sonographie oder Katheterismus) Harnuntersuchung Sonographie der Nieren Ausschluß urologischer Begleitverletzungen 1.3 Sofortmaßnahmen Sicherstellung der Blasenentleerung Intermittierender Katheterismus (IK) Suprapubische Blasenpunktionsfistel (SPF) Transurethraler Dauerkatheter (DK) Spontane Blasenentleerung (SB) 1.3.1Suprapubische Blasenpunktionsfistel (SPF) Voraussetzung Blasenfüllung > 350 ml 3
9 Makroskopisch klarer Harn Ausschluß einer Gerinnungsstörung Kontraindikation Relativ: Verletzungen im kleinen Becken Zustand nach Unterbauchoperationen (Narbe am Unterbauch) Thrombozytenaggregationshemmer Absolut: Akutes Abdomen Gravidität 1 Der frisch Querschnittgelähmte Technik Sterile Bedingungen Probepunktion Punktion mit geeignetem Set Fixierung, ggf. Ballonfüllung mit 10 % Glyceringemisch bei Silicon-Katheter Verband, der sicherstellt, daß Katheter senkrecht aus der Haut herausgeführt wird Geschlossene Harnableitung Folgemaßnahmen Ausschluß von Punktionskomplikationen wie Blutung und Peritonismus Geschlossenes Ableitungssystem Kontinuierliche Ableitung HWI- und Steinprophylaxe Harnausscheidungskontrolle Beachte: Täglicher Verbandswechsel in den ersten 7 Tagen. Sicherung des senkrechten Katheteraustrittes aus der Haut. 1. Wechsel nach ca. 3-4 Wochen (Seldinger-Technik), wenn SPF noch erforderlich Intermittierender Katheterismus (IK) Voraussetzung Geregelte Diurese, maximal 2000 ml in 24 Stunden Patient nicht intensivmedizin-pflichtig Keine akute Operationsindikation Katheterismus 4-6 stündlich, rund um die Uhr durchführbar 4
10 1 Der frisch Querschnittgelähmte Kontraindikationen Harnröhren- oder Blasenverletzung (Blutung aus der Harnröhre, Hämaturie) Harnröhrenstriktur Akute Operationsindikation Technik Aseptischer Katheterismus (siehe Definition) Frauen Ch 14 oder Ch 16 Männer Ch 12 oder Ch 14 Beachte: Aseptischer Katheterismus: Katheterismus nicht erzwingen, sondern gegebenenfalls Urologen hinzuziehen. Blasenfüllung von 400 ml bei Erwachsenen nicht überschreiten Transurethraler Dauerkatheter (DK) Legen des Dauerkatheters unter aseptischen Bedingungen mit desinfizierendem Gleitmittel Indikation Intakte Harnröhre Wenn SPF und IK kontraindiziert Wenn SPF und IK nicht möglich (technisch oder personell) Technik Ausschließlich Verwendung von weichen Voll-Silikon-Kathetern Frauen Ch 14 oder Ch 16 Männer Ch 12 oder 14 Lockere Fixierung des DK und Penis auf der Bauchdecke, um Druckschäden in der Harnröhre zu vermieden. Geschlossene Harnableitung Folgemaßnahmen Entfernung zum frühesten Zeitpunkt (tägliche Entscheidung) Geschlossenes Harnableitungssystem Kontinuierliche Ableitung HWI- und Steinprophylaxe Katheterpflege täglich (Meatus- und Katheterreinigung - sekretaufsaugende Gaze.) Wechsel wöchentlich 5
11 1 Der frisch Querschnittgelähmte Beachte: Transurethralen Dauerkatheter mit Pflastersteg locker am Unterbauch fixieren (beim Mann auch den Penis fixieren). DK gilt als Notmaßnahme Spontane Blasenentleerung (SB) (willkürliche oder unwillkürliche Urinentleerung über die Harnröhre) In seltenen Fällen ist eine spontane Blasenentleerung bei inkompletter Querschnittlähmung möglich. Voraussetzung Miktionsprotokoll (Miktionszeitpunkt, Miktionsmenge und Restharn) Kontraindikation Entleerung nur mit Bauchpresse oder Credé Intensivmedizinische Bilanzierung Ausgeprägte DSD, autonome Dysreflexie Folgemaßnahmen Tägliche Restharnkontrolle (sonographisch) Wenn Rh 100 ml intermittierend katheterisieren (Frequenz restharnabhängig) Beachte: Nicht jede restharnfreie, spontane Blasenentleerung ist Beweis für eine ausgeglichene Blasenfunktion. 1.4 Harnwegsinfekt (HWI) Ein Harnwegsinfekt bei frischer Querschnittlähmung ist meist eine nosokomiale Infektion. Er kann Symptom für eine unausgeglichene Blasenfunktion sein. Definition eines HWI bei Querschnittlähmung Als sichere Zeichen eines klinisch relevanten Harnwegsinfektes gelten: Bakteriurie mit Keimzahl 10 5 / ml zusammen mit Leukozyturie 100 / mm 3 6
12 1 Der frisch Querschnittgelähmte 1.4.1Infektprophylaxe (IK, SPF, DK) Diurese Harnausscheidung von ca. 1,5 Liter pro 24 Stunden Harnansäuerung Optimum ph 5,6-6,2 Medikament: z.b. L-Methionin Antibiotische Infektprophylaxe grundsätzlich in dieser Phase nicht indiziert Bei länger (> 48 h) liegendem transurethralen Dauerkatheter Chemotherapeutika (z.b. Nitrofurantoin Trimethoprim) Blasenspülung + Blaseninstillation Grundsätzlich in dieser Phase nicht indiziert Maßnahmen bei Harnwegsinfektion (HWI) Die signifikante Bakteriurie ist kein Beweis eines Harnwegsinfektes bei Querschnittlähmung. Sie ist kein Anlaß für eine antibiotische Behandlung. Als sichere Zeichen eines klinisch relevanten Harnwegsinfektes gelten: Bakteriurie mit Keimzahl 10 5 / ml zusammen mit Leukozyturie 100 / mm 3 Achtung: Forcierte Diurese kann das Ausmaß der Leukozyturie beeinflussen. Uringewinnung Katheterurin Blasenpunktionsurin Beachte: Ein Harnwegsinfekt bei Querschnittlähmung ist keine Krankheit per se, sondern Folge der gestörten Blasenfunktion / der Harnableitung bzw. des Managements. Konsequenz: Behandlung der Blasenfunktionsstörung und Form der Harnableitung überdenken. 7
13 1 Der frisch Querschnittgelähmte Medikamentöse Therapie Resistenzgerecht Nosokomiale Situation beachten Lokale Maßnahmen Katheterwechsel Kontinuierliche Ableitung Diurese ca ml / 24 Stunden Folgemaßnahmen Nach Ende der Therapie und bei normalisiertem Harnbefund (Keimzahl < 10 4 /ml + Leukozyturie < 100/mm 3 ) 2 x wöchentlich Harnkontrollen (Leukozyturie?, ggf. Bakteriologie) Infektprophylaxe mit Chemotherapeutikum beiurinableitungen Beachte: Unkritische Antibiotikatherapie schadet und fördert die Resistenzentwicklung. Kontrolle der Leukozytenzahl im Urin informiert über die Indikation und Effizienz der Therapie. 1.5 Zielsetzungen in der Frühphase der Querschnittlähmung Vermeidung von Frühkomplikationen wie Blasenüberdehnung, Harnwegsinfektion, Steinbildung und Harnröhrenschäden als Voraussetzung für erfolgreiche Blasenrehabilitation Aseptischer intermittierender Katheterismus zum frühest möglichen Zeitpunkt 8
14 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung 2 Rehabilitation der Blasenfunktion Ziel Klassifikation der Blasenfunktionsstörung Erfassen von Risikofaktoren Individuelles Speicher- und Entleerungskonzept Diagnostik Neuro-urologische Untersuchung Video-Urodynamik am Ende der Akutphase Bei UMNL (suprasakraler Läsion) nach Auftreten von sakralen Reflexen, bei LMNL (subsakraler Läsion) vor Abschluss der Erstrehabilitation) Voraussetzung Neuro-urologische Erfahrung obligat Beachte: Aufklärung des Patienten über verschiedene Therapiemöglichkeiten unter Einbeziehung seines sozialen Umfeldes und seiner Interessenslage. 2.1 Komplette Lähmung Sicherung der Diagnose komplette Lähmung durch den Neurologen. Grundlage der Klassifikation und Therapie der Blasenfunktionsstörung ist das Ergebnis der videourodynamischen Untersuchung Neurogene Akontraktilität von Detrusor und Sphinkter: (LMNL, Schlaffe Blase, areflexive Lähmung) Detrusorakontraktilität Sphinkterakontraktilität fehlende Sensitivität 9
15 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung Ziel Speicherfunktion: physiologische Compliance physiologische Blasenkapazität Harnkontinenz Bei Inkontinenz adäquate Hilfsmittelversorgung Blasenentleerung: druckfrei vollständig (IK) Diagnostik Neuro-urologische Untersuchung (Analsphinkterkontraktion nicht möglich, Analreflex negativ, Bulbocavernosusreflex negativ, Sensitivität S2-S5 ( Reithose ) aufgehoben) Video-Urodynamische Charakteristika Fehlende Sensitivität Compliance selten erniedrigt Keine Detrusorkontraktion, auch nicht unter physikalischer oder medikamentöser Provokation Keine Sphinkterkontraktion Beckenboden-EMG ohne Aktivität Blasenhals offen oder geschlossen Routine-Maßnahmen Intermittierender Katheterismus 4-6x/24 Stunden, Einzelvolumen 400 ml Miktionsprotokoll, Erlernen des Selbstkatheterismus Regulierung der Diurese (1,5 Liter/24 Std.) Bauchpresse oder Credé nur ausnahmsweise zur Entleerung bei Miktionsdruck < 60 cm H 2 O (Kontraindikation: Reflux) Spezielle Maßnahmen bei neurogener Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz) Pharmakotherapie: bisher keine wirksamen Substanzen bekannt. Operative Therapie Artefizieller Sphinkter am Blasenhals, bei Frauen Faszienzügelplastik möglich, keine alloplastischen urethralen Bänder. 10
16 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung Alternative mit seltener Indikation: Kontinente Vesikostomie mit Blasenhalsverschluss Supravesicale Harnableitung Spezielle Maßnahmen bei atypischer Symptomatik z.b. kleiner Blasenkapazität, niedriger Compliance Überprüfung: der Klassifikation der Blasenfunktionsstörung, Urologischer Begleiterkrankungen der bisherigen Behandlung Operative Therapie nur bei organisch bedingter Low Compliance Blase: Augmentation meist in Kombination mit artefiziellem Sphinkter (selten supravesikale Harnableitung) Beachte: Miktionsprotokoll ist hilfreich zur Vermeidung einer Blasenüberdehnung und zur Festlegung der Entleerungszeiten bei intermittierendem Katheterismus. Preßentleerung führt im Allgemeinen durch Deformierung von Beckenboden und Harnröhre ( Quetschhahnphänomen ) zu morphologischen Schäden Neurogene Hyperaktivität von Detrusor und Sphinkter: (UMNL, Hyperreflexive Lähmung Spastische Blase, Reflexblase ) Detrusorhyperaktivität Sphinkterhyperaktivität fehlende Sensitivität Ziel Ausreichende Speicherfunktion mit physiologischer Compliance Harnkontinenz oder adäquate Inkontinenzversorgung Ausgeglichene Entleerung Vermeidung sekundärer Druckschäden Diagnostik Anamnese mit Miktionsprotokoll Neuro-urologische Untersuchung 11
17 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung (Analreflex positiv, BCR positiv, Sensibilität S2-S5 -sog. Reithose- aufgehoben) Video-Urodynamische Charakteristika Fehlende Sensitivität, Ungehemmte Detrusorkontraktionen (Reflexievolumen) Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (DSD), Compliance normal oder erniedrigt. Zeitpunkt für Video-Urodynamik spätestens vor Beginn einer Therapie, die die Detrusor- und/oder Sphinkterfunktion verändert. Beachte: Die urodynamische Untersuchung stellt bei neurogener Hyperaktivität per se eine Provokation dar. Zur Minimierung von Artefakten dienen unter anderem: kein akuter Harnwegsinfekt, Füllgeschwindigkeit nicht > 20 ml/min, körperwarmes Füllmedium, entspannte Lagerung des Patienten Risikofaktoren Hochdrucksituation in der Speicherphase Low Compliance < 20 ml / cm H 2 O Geringes Reflexievolumen mit hohem Restharn Hochdrucksituation Entleerungsphase Maximaler Detrusordruck bei Männern > 80 cm H 2 O bei Frauen > 60 cm H 2 O Prolongierte Detrusorkontraktion Ausgeprägte Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (DSD) Hoher Restharn* (>100 ml oder > 30 % der funktionellen Blasenkapazität) Autonome Dysreflexie Vesico-uretero-renaler Reflux Influx in die männlichen Adnexe *Restharn unabhängig von urodynamischer Messung bestimmen Maßnahmen bei guter Handfunktion (Männer und Frauen) 12
18 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung Intermittierender Selbstkatheterismus mit anticholinerger Therapie (oral, transdermal, ggf. intravesikal -off label use-, auch in Kombination), Anticholinergika nicht zwingend notwendig bei hohem Reflexievolumen in Kombination mit Detrusorkontraktionen < 20 cm H 2 O und Kontinenz. Alternativ oder in Kombination mit reduzierter Anticholingerika-Dosierung: Botulinum-Toxin-Injektionen in den Detrusor (off label use) vor allem bei Unverträglichkeit oder mangelhafter Wirkung der anticholinergen Therapie. Getriggerte Reflexentleerung, bei Männern in der Regel mit Sphinkterotomie wegen DSD (siehe 3.4) Spontane Reflexentleerung auch wegen der Inkontinenzproblematik nicht anzustreben. Sakrale Deafferentation (SDAF) mit Implantation eines Vorderwurzelstimulators (SARS) vor allem bei erfolglosen oder nicht gewünschten konservativen Maßnahmen, bei autonomer Dysreflexie mit Blutdrucksteigerung, die anderweitig nicht beherrschbar ist. Auto-Augmentation, wenn pharmakologische Therapie nicht zielführend oder andere Verfahren nicht möglich/nicht erwünscht sind. IK weiterhin erforderlich. Kontraindikation: Organische Low-Compliance. Augmentation (Enterozystoplastik) bei organischer Low- Compliance-Blase. IK weiterhin erforderlich. Augmentationsverfahren sind bei Blasenfibrose (organische Low-Compliance) kritisch zu beurteilen - ggfls. Blasenersatz. SPF oder DK mit anticholinerger Therapie nur, wenn andere Versorgung unmöglich Maßnahmen bei Frauen ohne ausreichende Handfunktion Intermittierender Fremdkatheterismus + Anticholinerge Therapie (Alternative Botulinum-Toxin, siehe ) Voraussetzung: qualifizierte Pflege, hoher Pflegeaufwand Getriggerte Reflexentleerung in Ausnahmefällen bei hohem 13
19 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung Reflexievolumen Voraussetzung: intensive Pflege Sakrale Deafferentation (SDAF) in Kombination mit Implantation eines Vorderwurzelstimulators (SARS) vor allem bei erfolglosen, oder nicht durchführbaren, oder zu pflegeaufwendigen, oder nicht gewünschten konservativen Maßnahmen Auch bei autonomer Dysreflexie mit Blutdrucksteigerung, die anderweitig nicht beherrschbar ist Auto-Augmentation, pharmakologische Therapie nicht zielführend oder andere Verfahren nicht möglich/nicht erwünscht sind. IK weiterhin erforderlich. Kontraindikation: Organische Low-Compliance. Voraussetzung: qualifizierte Pflege, hoher Pflegeaufwand (IK durch Fremdpersonen) Kontinentes Vesicostoma bei effizienter anticholinerger Therapie, besonders, wenn dadurch Selbstkatheterismus ermöglicht oder Fremdkatheterismus erleichtert wird Augmentation (Enterozystoplastik) bei organischer Low Compliance Blase Voraussetzung: qualifizierte Pflege, hoher Pflegeaufwand (Fremdkatheterismus) SPF oder DK mit anticholinerger Therapie nur wenn andere Versorgung unmöglich. Beachte: Neurogene Detrusorhyperaktivität mit DK-Versorgung bedingt hohe Komplikationsrate. Indikationsstellung zu operativen Maßnahmen erfordert neuro-urologische Erfahrung. Ersatzblase und supravesicale Harnableitung gehören bei Querschnittlähmung zur Ausnahme Maßnahmen bei Männern ohne ausreichende Handfunktion Reflexentleerung in Kondom-Urinal Sphinkterotomie meist erforderlich wegen DSD Fremdkatheterismus mit anticholinerger Therapie, 14
20 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Komplette Lähmung (Alternative: Botulinum-Toxin, siehe ), wenn Kondom- Urinal nicht möglich oder nicht gewünscht Voraussetzung: qualifizierte Pflege, hoher Pflegeaufwand Sakrale Deafferentation (SDAF) in Kombination mit Implantation eines Vorderwurzelstimulators (SARS) vor allem bei erfolglosen, oder nicht durchführbaren, oder zu pflegeaufwendigen, oder nicht gewünschten konservativen Maßnahmen. Auch bei autonomer Dysreflexie mit Blutdrucksteigerung, die anderweitig nicht beherrschbar ist. Auto-Augmentation, pharmakologische Therapie nicht zielführend oder andere Verfahren nicht möglich/nicht erwünscht sind. IK weiterhin erforderlich. Kontraindikation: Organische Low-Compliance Augmentation (Enterozystoplastik) bei organischer Low Compliance Blase Voraussetzung: qualifizierte Pflege, hoher Pflegeaufwand (Fremdkatheterismus) SPF oder DK mit anticholinerger Therapie nur wenn andere Versorgung unmöglich Beachte: Neurogene Detrusorhyperaktivität mit DK-Versorgung bedingt hohe Komplikationsrate. Indikationsstellung zu operativen Maßnahmen erfordert neuro-urologische Erfahrung. Ersatzblase und supravesicale Harnableitung gehören bei Querschnittlähmung zur Ausnahme Unterschiedliche Lähmungsmuster von Detrusor und Sphinkter (sog. gemischte Läsionen) Detrusor, Sphinkter können jeweils hyperaktiv oder akontraktil reagieren, die Sensitivität ist ausgefallen Detrusorhyperaktivität mit Sphinkterakontraktilität Hauptproblem Inkontinenz Behandlung der Detrusorhyperaktivität pharmakologisch oder operativ (SDAF, Augmentation) Behandlung der Sphinkterakontraktilität durch artefiziellen 15
21 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Inkomplette Lähmung Sphinkter oder Schlingensuspension (siehe ), jedoch erst nach Beherrschung der Detrusorhyperaktivität Detrusorakontraktilität mit Sphinkterhyperaktivität Hauptproblem Blasenüberdehnung Behandlung wie Detrusorkontraktilität (siehe ), Preßentleerung kontraindiziert 2.2 Inkomplette Lähmung Die Innervation des unteren Harntraktes durch drei unterschiedlichen Nervensysteme - parasympathisch, sympathisch, somatisch - kann zu unterschiedlichen, neurogen induzierten Läsionen am Detrusor, der hinteren Harnröhre und der Beckenbodenmuskulatur führen. Diese Strukturen können jeweils hyperaktiv oder akontraktil oder normal reagieren. Die Sensitivität kann normal oder gestört sein. Drei Formen inkompletter Lähmungen sind nach dem klinischen Erscheinungsbild unterscheidbar: Viscerosensorisch Visceromotorisch Somatomotorisch sie kommen meist in Kombination vor. Eine eindeutige Zuordnung des Lähmungstyps kann klinisch und urodynamisch schwierig sein. Rückbildungsmöglichkeiten beachten. Reversible Maßnahmen anstreben, definitivemaßnahmen frühestens 2 Jahre nach Lähmungseintritt durchführen. Diagnostik wie bei kompletter Lähmung Viscerosensorisch inkomplette Lähmung Charakteristika Blasenfüllungsgefühl und/oder Harndranggefühl reduziert oder gesteigert Maßnahmen Bei reduzierter Blasensensitivität Behandlung durch intravesikale Elektrostimulation und/oder mit Cholinergika. 16
22 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Inkomplette Lähmung Verhaltenstherapie Bei gesteigerter Blasensensivität Neuromodulation (Elektrostimulation des N. Pudendus oder der Sakralnerven); Pharmakotherapie (z.b. Anticholinergika, Vanilloide, Botulinum-Toxin) Verhaltenstherapie Visceromotorisch inkomplette Lähmung bei suprasakraler Läsion (UMNL) - neurogene Detrusorhyperaktivität Charakteristika Urodynamisch charakterisiert durch Detrusorhyperaktivität bei vorhandener Sensitivität Maßnahmen zur Hemmung der Detrusorkontraktion Konservativ Pharmakotherapie zur Detrusordämpfung kombiniert mit Miktionstraining) Neuromodulation Pudendusstimulation Sakralnervenstimulation Operativ Augmentation, wenn konservative Maßnahmen versagen (siehe ) Maßnahmen zur Auslösung der Detrusorkontraktion Konservativ Auslösen des Detrusorreflexes durch Triggern; Intermittierender Katheterismus ggf. mit Anticholinergika. Neuromodulation Intravesikale Elektrostimulation, Neurostimulation Sakralnervenstimulation (nichtinvasiv / invasiv) Visceromotorisch inkomplette Lähmung bei subsakraler/peripherer Läsion (LMNL) Charakteristika Klinisch Unvollständige Entleerung Vorhandene Blasensensitivität 17
23 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Inkomplette Lähmung Urodynamisch Detrusorhypokontraktilität oder -akontraktilität Maßnahmen Konservativ Alpha-Rezeptoren-Blocker evtl. in Kombination mit Cholinergika Alternative: Intermittierender Katheterismus. Neuromodulation Intravesikale Elektrostimulation, Neurostimulation Sakralnervenstimulation. Operativ Senkung des Blasenauslaßwiderstandes Strenge Indikationsstellung, Kontraindikation bei Detrusorakontraktilität (video-urodynamische Abklärung erforderlich). Gefahr der Harninkontinenz Somatomotorisch inkomplette Lähmung bei suprasakraler Läsion (UMNL) - neurogene Sphinkterhyperaktivität Charakteristika Klinisch Verzögerte, unvollständige oder intermittierende Miktion. Urodynamisch Fehlende, unvollständige oder nur intermittierende Relaxation des äußeren Schließmuskels bzw. des Beckenbodens während der Miktion. Reduzierter/ intermittierender Flow trotz adaequater Detrusorkontraktion Maßnahmen Konservativ Intermittierender Katheterismus Antispastika (Relaxation der quergestreiften Muskulatur) in tolerablen Dosen wenig oder nicht wirksam. Operativ Pharmakologische Sphinkterparalyse (Botulinus-Toxin lokal); Sphinkterotomie in Ausnahmefällen 18
24 2 Rehabilitation der Blasenfunktion bei Querschnittlähmung Inkomplette Lähmung Somatomotorisch inkomplette Lähmung bei subsakraler/peripherer Läsion (LMNL) - neurogene Sphinkterhypo-/akontraktilität Charakteristika Klinisch Belastungsinkontinenz möglich, erniedrigter analer Sphinktertonus und/oder abgeschwächtes Willkürkneifen des Sphinkter ani. Urodynamisch Harnröhrenhypotonie mit verminderter Kontraktion der quergestreiften Sphinkter-/Beckenboden-Muskulatur Maßnahmen Konservativ Beckenbodenkontraktionstraining Medikamentöser Therapieversuch mit Duloxetin (Yentreve ) und/oder Alpha-Adrenergika möglich. Elektrotherapie des Beckenbodens (vaginal, anal) Ggf. adäquate Inkontinenzversorgung Operativ Bulking Agents, Schlingensuspension oder artefizieller Sphinkter möglich, ggf. in Kombination mit intermittierendem Katheterismus. 19
25 3 Langzeitbetreuung 3 Langzeitbetreuung Die neurogene Blasenfunktionsstörung ist kein statisches Geschehen, sie hat eine Eigendynamik, die zu Veränderungen - (funktionell und später morphologisch) am unteren und oberen Harntrakt führen und auch die männliche Sexualfunktion beeinflussen kann Ziel Ziel der neuro-urologischen Betreuung ist die best mögliche Erhaltung der Funktion des unteren und oberen Harntraktes im Rahmen der individuellen neurogenen Störung. Durch eine risiko- und patientenorientierte, lebenslange, regelmäßige Betreuung lässt sich eine optimale Lebensqualität und Lebenserwartung erreichen. Aktivitäten des täglichen Lebens sollen von den Folgen der Blasenlähmung so wenig wie möglich beeinflußt werden. 3.1 Allgemeine Kontrolluntersuchungen Zwischenanamnese: Änderung gegenüber Voruntersuchungen: Blasenentleerung Kontinenz fieberhafte/nicht fieberhafte Harnwegsinfekte und Antibiotika - Therapien, Stuhlentleerung, Sexualfunktion, Spastizität, aktuelle Medikamente Klinische Untersuchung Allgemeiner Status Hautverhältnisse, Blutdruck, äußeres Genitale (z.b. Penis, Nebenhoden) Rektale Untersuchung Prostata, Rektum (Vorsorge) Neuro-Urologischer Status Allgemeine Spastik, Sensitivität der Reithose, Inspektion des Anus, Sphinktertonus, Analreflex, Bulbokavernosusreflex, Willkürkontraktion Anus und Beckenboden. 20
26 3 Langzeitbetreuung Laboruntersuchung Urin (frisch) Status, Leukozytenzahl, Keimzahl, ggf. Antibiogramm Uringewinnung durch Katheterismus, Blasenpunktion, ggf. Mittelstrahl bei Männern, wenn Miktion in großer Portion möglich. Blut Blutbild, Elektrolyte, Kreatinin, Harnstoff, Harnsäure, ggfls. CRP, PSA Beachte: Normales Serumkreatinin schließt eine Nierenfunktionsstörung nicht aus! Bei Verdacht auf Nierenfunktionsstörung Isotopen-Clearance Serum-Cystatin-C gilt als sensibelster Marker der Gesamtnierenfunktion und eignet sich zur Verlaufskontrolle. Bei Langzeitansäuerung mit L-Methionin Homocysteinspiegel bestimmen. Bei anticholinerger Langzeitmedikation Bestimmung der Transaminasen Sonographische Untersuchung Oberer und unterer Harntrakt inklusive Restharn 3.2 Spezielle Kontrolluntersuchungen Je nach Blasenlähmungstyp, Risikofaktoren und durchgeführter Therapie: Urodynamik Cystometrie Video-Urodynamik, Miktionszystourethrogramm, (Retrogrades/Infusions)-Urethrogramm insbesondere bei IK, Endoskopie (strenge Indikationsstellung) Nierenfunktionsuntersuchung (Endogene Kreatininclearance, Serum-Cystatin C, Isotopenclearance) Ausscheidungsurogramm (spezielle Beurteilung von Nierenbecken und Ureteren, verlangt spezielle Indikationsstellung) 21
27 3 Langzeitbetreuung Beachte: Indikation und Bewertung der speziellen Maßnahmen setzen neuro-urologische Erfahrung voraus. Aus diesem Grund ist eine regelmässige Nachsorge bei einem Neuro- Urologen/ im neuro-urologischen Zentrum erforderlich. 3.3 Zeitplan der Kontrolluntersuchungen Komplikationsloser Verlauf (ohne Risikofaktoren) Harnselbstkontrolle (Streifentest), wenn Verdacht auf HWI Konsultation von Hausarzt oder Urologen sonst Harnkontrolle alle 2 Monate durch den Arzt (Hausarzt, niedergelassener Urologe) Sonographie (Nieren, Blase, Restharn), klinische Untersuchung und Labor alle 6 Monate oder risikoadaptiert. Nach der Erstrehabilitation Untersuchung im Zentrum alle 6-12 Monate, später risikoadaptiert, spätestens alle 2 Jahre mit Video-Urodynamik 3.4 Risikofaktoren Allgemeine Risikofaktoren Fieberhafte Harnwegsinfekte, Rezidivierende Harnwegsinfekte (mehr als 2 pro Jahr) Bluthochdruckkrisen (im Rahmen der autonomen Dysreflexie) Restharnzunahme, mehrfach gemessen, Zunehmende oder neuauftretende Harninkontinenz und/oder Blasenentleerungsproblemen Harnstauungsnieren (sonographisch) Veränderungen an der Blase (Wandverdickung, Pseudodivertikel, Konkremente) Persistierende pathologische Laborwerte (Laborwerte: Blutbild, CRP, Nierenfunktionswerte) Beachte: Diese Risikofaktoren erfordern zwingend eine Vorstellung beim neuro-urologisch erfahrenen Urologen/im neurourologischen Zentrum. 22
28 3 Langzeitbetreuung Risikofaktoren - nur durch Video-Urodynamik erkennbar Es gibt Risikofaktoren, die ausschließlich durch die Video- Urodynamik erkennbar sind. Sie können klinisch über längere Zeit stumm sein, d.h., zu keiner klinischen Auffälligkeit führen. z.b.: Hochdrucksituation Low Compliance Frühzeitige und/oder prolongierte Detrusorkontraktion (Reduziertes Reflexievolumen) Hyperkontraktilität in der Entleerungsphase zunehmende Trabekulierung Vesico-uretero-renaler-Reflux (VUR) Ausgeprägte Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie Ballonierung der hinteren Harnröhre Influx in männliche Adnexe Spezielle Überwachung nach neuro-urologischen Operationen Nach Eingriffen wie: Botulinum-Toxin-Injektion Sphinkterotomie, Faszienzügelplastik artefizieller Sphinkter, sakrale Deafferentation mit und ohne Implantation eines Vorderwurzelstimulators, permanente Neuromodulation, Blasenaugmentation, sind Kontrollen beim Neuro-Urologen (Operateur) erforderlich. 23
29 4 Lebenserwartung und Lebensqualität 4 Lebenserwartung und Lebensqualität Lebenserwartung und Lebensqualität hängen entscheidend von einer frühzeitig (Unfalltag!) einsetzenden und konsequent lebenslang fortgesetzten neuro-urologischen Betreuung ab. Einsicht und Mitarbeit des Betroffenen sind erforderlich. Unter diesen Voraussetzungen ist die Lebenserwartung in Abhängigkeit von Lähmungshöhe und Lähmungsausmaß kaum (z.b. motorisch komplette Tetraplegien) oder gar nicht eingeschränkt. Beachte: Eine ausgeglichene Blasenfunktion und die Erhaltung oder Wiederherstellung der Kontinenz tragen entscheidend bei zur Verbesserung der Lebenserwartung und Verbesserung der Lebensqualität Querschnittgelähmter. 24
30 Manual Neuro-Urologie und Querschnittlähmung Copyright by: Dr. med. Harald Burgdörfer Leitender Arzt Neuro-Urologie im Querschnittgelähmten-Zentrum Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg Bergedorfer Str. 10 D Hamburg Prim. Univ. Doz. Dr. med. Helmut Heidler Vorstand der Urologischen Abteilung AKH Linz Krankenhausstr. 9 A Linz Dr. med. Johannes Kutzenberger Chefarzt Klinik für Neuro-Urologie Im Kreuzfeld 4 Werner-Wicker-Klinik D Bad Wildungen Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Leiter der Neuro-Urologischen Ambulanz Universitätskliniken Innsbruck Anichstr. 35 A Innsbruck Prof. Dr. med. Hans Palmtag Chefarzt der Urologischen Abteilung Städtisches Krankenhaus Sindelfingen Arthur-Gruber-Str Sindelfingen Prof. Dr. med. Jürgen Pannek Leitender Arzt Neuro-Urologie Marienhospital Widumer Str. 8 D Herne Prof. Dr. med. Dieter Sauerwein Ehemaliger Chefarzt der Klinik für Neuro-Urologie an der Werner-Wicker-Klinik Im Kreuzfeld 4 D Bad Wildungen Prof. Dr. med. Manfred Stöhrer Lehrbeauftragter für Neuro-Urologie der Universität Essen Graf-Alban-Str. 1 D Murnau IVManualD2007.p65/gru 4. Auflage, 04/2007, Farco-Pharma GmbH 25
Neurogene Blasenfunktionsstörung
 Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
Neurogene Blasenfunktionsstörung Formen, Symptome, Diagnostik Harnblase - ein unscheinbares Organ Beobachter 24/99 Die Harnblase ist eigentlich ein langweiliges Organ, ein plumper Sack. Wichtger ist.?
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?-
 Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
Probleme mit Blase und Darm bei Spina bifida -Gibt es erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten?- I.Kurze, 1.ASBH Kongress Köln, 21./22.3.2014 Zertifizierte Beratungstelle WAS IST DAS PROBLEM? Fehlende
Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz
 12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
12. Bamberger Gespräche 2008 Harninkontinenz Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Einfluss des Geschlechts auf die Diagnostik der Harninkontinenz Von Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher Bamberg
Weitere Vorstellungen erfolgen je nach Befund dann jährlich bis vierteljährlich.
 Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
Hamburger Therapiestandard Blasenstörung bei MS Version: 12-6-12 Zielsetzung des Standards: Dieses Dokument will Konsensus von Urologen und Neurologen sein, wie idealerweise im Raum Hamburg Blasenstörung
Inhalt. Geschichtliche Anmerkungen... 1
 Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Inhalt Geschichtliche Anmerkungen.............. 1 Daten zur Inkontinenz.................. 7 Altersabhängigkeit................... 7 Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz......... 9 Inkontinenz in der ärztlichen
Anatomie und Physiologie Blase
 Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Anatomie und Physiologie Blase 1 Topographie Harnblase Liegt vorne im kleinen Becken, hinter Symphyse und Schambeinen Dach der Blase wird vom Peritoneum bedeckt Bei der Frau grenzt der hintere Teil an
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP. Braunlage
 Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Neurogene Blasenentleerungsstörungen bei Hereditärer Spastischer Spinalparalyse HSP Braunlage 20.4.2013 MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie,
Die neurogene Blase im Kindes- und Jugendalter. G. Kiss Neuro-Urologische Ambulanz Univ. Klinik f. Neurologie Innsbruck
 Die neurogene Blase im Kindes- und Jugendalter G. Kiss Neuro-Urologische Ambulanz Univ. Klinik f. Neurologie Innsbruck Ätiologie der neurogenen Blasen- und Beckenbodenfunktionsstörungen im Kindesalter
Die neurogene Blase im Kindes- und Jugendalter G. Kiss Neuro-Urologische Ambulanz Univ. Klinik f. Neurologie Innsbruck Ätiologie der neurogenen Blasen- und Beckenbodenfunktionsstörungen im Kindesalter
Neurogene Blasenfunktionsstörung
 Neurogene Blasenfunktionsstörung Dr. Mark Koen, FEAPU, Abteilung für Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern, Seilerstätte, 4010 Linz Die neurogene Blasenfunktionsstörung stellt eine der seltenen
Neurogene Blasenfunktionsstörung Dr. Mark Koen, FEAPU, Abteilung für Kinderurologie, KH der Barmherzigen Schwestern, Seilerstätte, 4010 Linz Die neurogene Blasenfunktionsstörung stellt eine der seltenen
Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz
 encathopedia Volume 6 Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz Indikationen für Harnableitungen Formen der kontinenten Blasenersatzanlagen ISK kann helfen Indikationen für Harnableitungen
encathopedia Volume 6 Kontinente Harnableitung nach Blasenvergrößerung oder Blasenersatz Indikationen für Harnableitungen Formen der kontinenten Blasenersatzanlagen ISK kann helfen Indikationen für Harnableitungen
Blasenentleerungsstörung
 Blasenentleerungsstörung Maßnahmen jenseits des Dauerkatheters Brigi6e Harrer, DGKS, KSB Harnblase ist ein Niederdruckreservoir Zuständig für Speicherung- und Entleerung Voraussetzung für Kontinenz Intakte
Blasenentleerungsstörung Maßnahmen jenseits des Dauerkatheters Brigi6e Harrer, DGKS, KSB Harnblase ist ein Niederdruckreservoir Zuständig für Speicherung- und Entleerung Voraussetzung für Kontinenz Intakte
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC
 Urologie Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Teil II Von Dr. med. Ulf Bersch Was ist die richtige Form der Blasenentleerung? Zu dieser Frage gilt grundsätzlich: Diejenige, die am Harntrakt den geringsten
Urologie Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Teil II Von Dr. med. Ulf Bersch Was ist die richtige Form der Blasenentleerung? Zu dieser Frage gilt grundsätzlich: Diejenige, die am Harntrakt den geringsten
Brigitte Sachsenmaier. Inkontinenz. Hilfen, Versorgung und Pflege. Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus. schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei
 Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Brigitte Sachsenmaier Inkontinenz Hilfen, Versorgung und Pflege Unter Mitarbeit von Reinhold Greitschus schlulersche Verlagsanstalt und Druckerei Inhalt Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1. Was ist Inkontinenz?
Harnblasenkatheterismus
 Harnblasenkatheterismus Definition In Krankenanstalten sind Infektionen der Harnwege die häufigsten Infektionen, in erster Linie bedingt durch den Einsatz transurethraler Katheter. Auch bei nicht katheterisierten
Harnblasenkatheterismus Definition In Krankenanstalten sind Infektionen der Harnwege die häufigsten Infektionen, in erster Linie bedingt durch den Einsatz transurethraler Katheter. Auch bei nicht katheterisierten
MS und Blasenentleerung. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 MS und Blasenentleerung Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie Harnblase Speicherung Entleerung Wahrnehmung Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss Wahrnehmung
MS und Blasenentleerung Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie Harnblase Speicherung Entleerung Wahrnehmung Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss Wahrnehmung
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten. Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie
 Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Multiple Sklerose: Blasenfunktionsstörungen und Behandlungsmöglichkeiten Prof. Jürgen Pannek Chefarzt Neuro-Urologie 1 Speicherphase normale Menge (400-600 ml) elastische Dehnung Schliessmuskel: Verschluss
Urologie. Jürgen Sökeland Harald Schulze Herbert Rübben. 13., korrigierte und aktualisierte Auflage 238 Abbildungen 46 Tabellen
 Urologie Verstehen-Lernen-Anwenden Jürgen Sökeland Harald Schulze Herbert Rübben Unter Mitarbeit von Burkhard Helpap, Iris Körner und Michael Krieger Begründet von Carl-Erich Alken 13., korrigierte und
Urologie Verstehen-Lernen-Anwenden Jürgen Sökeland Harald Schulze Herbert Rübben Unter Mitarbeit von Burkhard Helpap, Iris Körner und Michael Krieger Begründet von Carl-Erich Alken 13., korrigierte und
Klinik für Urologie und Kinderurologie
 Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
Klinik für Urologie und Kinderurologie Mehr als gute Medizin. Krankenhaus Schweinfurt D ie Klinik für Urologie und Kinderurologie ist auf die Behandlung von Erkrankungen bestimmter Organe spezialisiert.
Die Behandlung Rückenmarkverletzter
 D.C.Burke D.D. Murray Die Behandlung Rückenmarkverletzter Ein kurzer Leitfaden Übersetzt von F.-W. Meinecke Mit 8 Abbildungen Institut für Arbeitswissons-hoft der TH Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
D.C.Burke D.D. Murray Die Behandlung Rückenmarkverletzter Ein kurzer Leitfaden Übersetzt von F.-W. Meinecke Mit 8 Abbildungen Institut für Arbeitswissons-hoft der TH Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
Juni 2004. Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin
 Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Neurologische Abteilung Dr. med. Konrad Luckner, Chefarzt Helle Dammann, Ass.-Ärztin Blasenstörungen und Sexualfunktionsstörungen bei Multipler Sklerose Krankenhaus Buchholz Abteilung für Neurologie Helle
Blasenkatheterismus. Allgemeines
 1/6 Allgemeines Vor jeder Manipulation am Drainagesystem bzw. am Blasenkatheter ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen und Handschuhe zu tragen. Legen eines Blasenverweilkatheters nur nach
1/6 Allgemeines Vor jeder Manipulation am Drainagesystem bzw. am Blasenkatheter ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen und Handschuhe zu tragen. Legen eines Blasenverweilkatheters nur nach
Urodynamik. Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau
 Urodynamik Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau von Hans Palmtag, Mark Goepel, H Heidler überarbeitet Urodynamik
Urodynamik Fort- und Weiterbildungskommission der Deutschen Urologen Arbeitskreis Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau von Hans Palmtag, Mark Goepel, H Heidler überarbeitet Urodynamik
BHS Linz, Kinderurologie. e bei MMC Linz, Seilerstätte 4. und in. Ausmaß. zu sein. Familie. dlich sein. Von. störung. werden.
 Elterninformation NeurogeneN e Neurogene Blase bei MMC Was versteht man unter MMC? MMC ist die Abkürzung für Meningomyelocele. Man versteht darunter eine Fehlbildung des Neuralrohrs. Das Neuralrohr ist
Elterninformation NeurogeneN e Neurogene Blase bei MMC Was versteht man unter MMC? MMC ist die Abkürzung für Meningomyelocele. Man versteht darunter eine Fehlbildung des Neuralrohrs. Das Neuralrohr ist
PATIENTENINFORMATION. über. Harninkontinenz
 PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
PATIENTENINFORMATION über Harninkontinenz Harninkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Der Begriff Inkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen, das heißt unkontrollierten Verlust von Urin aufgrund
Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum
 Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Aufnahmeantrag für: Das Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum in Koordinator: Klinik Abteilung
Antrag an die Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.v. auf Zertifizierung als Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Aufnahmeantrag für: Das Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum in Koordinator: Klinik Abteilung
Aktuelle Aspekte des Katheterismus der Harnblase beim geriatrischen Patienten
 Aktuelle Aspekte des Katheterismus der Harnblase beim geriatrischen Patienten MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie, Rehabilitationswesen,
Aktuelle Aspekte des Katheterismus der Harnblase beim geriatrischen Patienten MBA, MPH W. N. Vance Facharzt für Urologie, Sexualmedizin, Sozialmedizin, Naturheilkunde, Homöopathie, Rehabilitationswesen,
Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
 Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. Fornara Spezialsprechstunde für Blasenentleerungsstörungen
Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll
 Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Was ist Harninkontinenz? Mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt zu speichern und selbst zu bestimmen, wann und wo er entleert werden soll Blasenschwäche Wer ist betroffen? Über 5 Mio. Betroffene
Patienteninformation. Nehmen Sie sich Zeit...
 Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Patienteninformation Nehmen Sie sich Zeit... ... etwas über das Thema Harninkontinenz zu erfahren. Liebe Patientin, lieber Patient, mit dieser Broschüre möchten wir Sie auf ein Problem aufmerksam machen,
Therapie bei Kindern mit Spina bifida und neurogener Detrusorüberaktivität
 Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie Therapie bei Kindern mit Spina bifida und neurogener Detrusorüberaktivität T. Lehnert, M. Weißer, T. Woller, U. Bühligen, U. Rolle Neurogene Harnblasenentleerungsstörung
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie Therapie bei Kindern mit Spina bifida und neurogener Detrusorüberaktivität T. Lehnert, M. Weißer, T. Woller, U. Bühligen, U. Rolle Neurogene Harnblasenentleerungsstörung
Harnwegskatheter. Hygiene-Arbeitsanleitung der Krankenhaushygienekommission des Universitätsklinikums Bonn. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
 Hygiene-Arbeitsanleitung der Krankenhaushygienekommission des Universitätsklinikums Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Harnwegskatheter Arbeitsgruppe: Herr Prof. Brühl (Vorsitzender) Frau Dr.
Hygiene-Arbeitsanleitung der Krankenhaushygienekommission des Universitätsklinikums Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Harnwegskatheter Arbeitsgruppe: Herr Prof. Brühl (Vorsitzender) Frau Dr.
Diabetes und die Harnblase
 encathopedia Volume 5 Diabetes und die Harnblase Wichtig zu beachten Die Warnsignale erkennen ISK kann helfen Diabetes (Diabetes mellitus, DM) Diabetes mellitus gehört zu der Gruppe der Stoffwechselkrankheiten,
encathopedia Volume 5 Diabetes und die Harnblase Wichtig zu beachten Die Warnsignale erkennen ISK kann helfen Diabetes (Diabetes mellitus, DM) Diabetes mellitus gehört zu der Gruppe der Stoffwechselkrankheiten,
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt
 Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Welche Untersuchungen werden bei meinem Hausarzt durchgeführt Miktionsanamnese Begleiterkrankungen Miktionsanamnese Trink- und Essgewohnheiten
Ich verliere Winde was tun?
 HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
HERZLICH WILLKOMMEN Samstag, 29. August 2015 Ich verliere Winde was tun? Marc Hauschild Stv. Oberarzt Klinik für Chirurgie Liestal ANO-REKTALE INKONTINENZ Inhaltsverzeichnis 1. Kontinenz 2. Häufigkeit
Universitätsklinikum Jena Zentrale Notfallaufnahme
 Seite 1 von 6 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Seite 1 von 6 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart
 Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart Professor Dr. med. Andreas Kribben Klinik für Nephrologie Universitätsklinikum Essen 21. 5. 2011 Harnwegsinfektionen
Harnwegsinfekte nach Nierentransplantation Symposium 25 Jahre Transplantationszentrum Stuttgart Professor Dr. med. Andreas Kribben Klinik für Nephrologie Universitätsklinikum Essen 21. 5. 2011 Harnwegsinfektionen
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose
 2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
2. Informationsveranstaltung über die Multiple Sklerose Botulinumtoxin und Multiple Sklerose Johann Hagenah Die Geschichte des Botulinumtoxins 1817 Justinus Kerner publiziert in den Tübinger Blättern für
Parkinson und die Blase
 encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt Behandlung von Blasenproblemen ISK kann helfen Die Krankheit Parkinson Parkinson ist eine fortschreitende neurologische
Diagnostik in der Urogynäkologie
 Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
Diagnostik in der Urogynäkologie Urodynamik Die Urodynamik hielt 1939 Einzug in die urologische Diagnostik: Lewis: A new clinical recording cystometry in J Urol 41 (1939): 638 beschrieb die Methode als
14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen Erkrankungen aus Sicht des Urologen
 Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Hofrat Prof. Dr. med. Helmut Madersbacher: Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronale 14. Bamberger Gespräche 2010: Blase und Gehirn Diagnostik von Harnblasenfunktionsstörungen bei neuronalen
Rückenmarkverletzungen und die Blase
 encathopedia Volume 4 Rückenmarkverletzungen und die Blase Veränderungen der Blasenfunktion Die Verletzung verstehen ISK kann helfen Rückenmarkverletzungen Unter einer Rückenmarkverletzung versteht man
encathopedia Volume 4 Rückenmarkverletzungen und die Blase Veränderungen der Blasenfunktion Die Verletzung verstehen ISK kann helfen Rückenmarkverletzungen Unter einer Rückenmarkverletzung versteht man
LoFric encathopedia. Behandlung von Blasenproblemen. Wie sich Parkinson auf die Blase auswirkt. ISK kann helfen
 LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
LoFric encathopedia encathopedia Volume 7 Parkinson und die Blase Wellspect HealthCare ist ein führender Anbieter innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Urologie und Chirurgie. Wir
Inkontinenz. Dr. med. P. Honeck. Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen
 Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
Therapie der männlichen Inkontinenz Dr. med. P. Honeck Oberarzt Urologische Klinik Klinikum Sindelfingen-Böblingen g Formen der Inkontinenz Form Belastung (Stress) Beschreibung Unwillkürlicher Harnabgang
BLASENENTLEERUNGSSTÖRUNG NACH NIERENTRANSPLANTATION BEI MÄNNERN IM EUROPEAN SENIOR
 BLASENENTLEERUNGSSTÖRUNG NACH NIERENTRANSPLANTATION BEI MÄNNERN IM EUROPEAN SENIOR PROGRAM (ESP) Carsten Breunig Urologische Klinik Transplantationszentrum Klinikum Bremen Mitte Urologische Klinik Transplantationszentrum
BLASENENTLEERUNGSSTÖRUNG NACH NIERENTRANSPLANTATION BEI MÄNNERN IM EUROPEAN SENIOR PROGRAM (ESP) Carsten Breunig Urologische Klinik Transplantationszentrum Klinikum Bremen Mitte Urologische Klinik Transplantationszentrum
Pflegerische Maßnahmen im Zusammenhang mit Katheterisierung der Harnblase
 Medizinische Indikationen für einen Katheter können insbesondere sein Überlaufblase (siehe Harninkontinenz bei chron. Harnretention) Neurologische Blasenentleerungsstörung mit Restharnbildung Flüssigkeitsbilanzierung
Medizinische Indikationen für einen Katheter können insbesondere sein Überlaufblase (siehe Harninkontinenz bei chron. Harnretention) Neurologische Blasenentleerungsstörung mit Restharnbildung Flüssigkeitsbilanzierung
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz
 Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Minimalinvasive Eingriffe bei Belastungsinkontinenz Dr. med Petra Spangehl Leitende Ärztin Kompetenzzentrum Urologie Soloturner Spitäler SIGUP Olten 16.3.2012 1 Formen der Inkontinenz Drang-Inkontinenz
Von neurogen bedingten Störungen
 34 4 2012 Urologie Bei Spina bifida sind urologische Aspekte in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: einerseits für die Gesunderhaltung der Nieren und die Vermeidung von Harnwegsinfekten, andererseits für die
34 4 2012 Urologie Bei Spina bifida sind urologische Aspekte in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: einerseits für die Gesunderhaltung der Nieren und die Vermeidung von Harnwegsinfekten, andererseits für die
encathopedia Volume 3 Harnröhrenstrikturen Was zu tun ist Auswirkungen auf die Blase Wie Dilatation Ihnen hilft
 encathopedia Volume 3 Harnröhrenstrikturen Auswirkungen auf die Blase Was zu tun ist Wie Dilatation Ihnen hilft Was ist eine Harnröhrenstriktur? Eine Harnröhrenstriktur bedeutet eine Verengung der Harnröhre.
encathopedia Volume 3 Harnröhrenstrikturen Auswirkungen auf die Blase Was zu tun ist Wie Dilatation Ihnen hilft Was ist eine Harnröhrenstriktur? Eine Harnröhrenstriktur bedeutet eine Verengung der Harnröhre.
Blasenfunktionsstörungen in der Geriatrie. Dr. med. Nina Zeh Oberärztin i.v. Urologie Spital Uster
 Blasenfunktionsstörungen in der Geriatrie Dr. med. Nina Zeh Oberärztin i.v. Urologie Spital Uster Harnröhrenstriktur Urolithiasis Neurogene Blase Prostatakarzinom HWI Inkontinenz Blasentumore Prostataobstruktions
Blasenfunktionsstörungen in der Geriatrie Dr. med. Nina Zeh Oberärztin i.v. Urologie Spital Uster Harnröhrenstriktur Urolithiasis Neurogene Blase Prostatakarzinom HWI Inkontinenz Blasentumore Prostataobstruktions
Prophylaxen. P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz
 Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prophylaxen P 3.4. Standard zur Förderung der Harnkontinenz 1. Definition Harnkontinenz Unter Harnkontinenz versteht man die Fähigkeit, willkürlich und zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase
Prostataerkrankungen
 Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
Wenn s s einmal nicht mehr läuft: Prostataerkrankungen Prof. Dr. med. K.D. Sievert Stellvertretender Direktor Klinik für f r Urologie Universität t T Ablauf Anatomie & Physiologie Benignes Prostatasyndrom
Wiederkehrende Harnwegsinfekte -vermeidbar oder Schicksal? Dr. Livio Mordasini Klinik für Urologie Universitätsspital Bern
 Wiederkehrende Harnwegsinfekte -vermeidbar oder Schicksal? 16.03.2012 Dr. Livio Mordasini Klinik für Urologie Universitätsspital Bern Chronisch rezidivierende Harnwegsinfekte: Einleitung/Prävalenz: 7 000
Wiederkehrende Harnwegsinfekte -vermeidbar oder Schicksal? 16.03.2012 Dr. Livio Mordasini Klinik für Urologie Universitätsspital Bern Chronisch rezidivierende Harnwegsinfekte: Einleitung/Prävalenz: 7 000
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC
 Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
Funktionsstörung des Harntraktes bei MMC Urologie Von Dr. med. Ulf Bersch Eines der grössten Probleme bei einer Schädigung des Rückenmarks ist die Funktionsstörung der Harnblase mit den daraus entstehenden
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME. Solutions with you in mind
 ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
ALLES ÜBER BLASENPROBLEME www.almirall.com Solutions with you in mind WAS IST DAS? Blasenprobleme sind definiert als Symptome, die von einer unzureichenden Funktion der Blase herrühren. Bei MS-Patienten
DR. ANDREA FLEMMER. Blasenprobleme. natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung
 DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
DR. ANDREA FLEMMER Blasenprobleme natürlich behandeln So helfen Heilpflanzen bei Blasenschwäche und Blasenentzündung it se m ln a l B Die Mitte n e h c n einfa trainiere aktiv 18 Ihre Harnblase das sollten
Dauerkatheter Versorgung im extramuralen Bereich
 Dauerkatheter Versorgung im extramuralen Bereich Zusammenfassung des Vortrags im Rahmen des 6. Pflegeforums OÖ am 3. Okt. 2012 in Linz Arten der Harnableitungen: Dauerkatheter transurethral Dauerkatheter
Dauerkatheter Versorgung im extramuralen Bereich Zusammenfassung des Vortrags im Rahmen des 6. Pflegeforums OÖ am 3. Okt. 2012 in Linz Arten der Harnableitungen: Dauerkatheter transurethral Dauerkatheter
BECKENBODEN- ZENTRUM
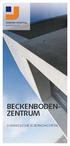 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE JOSEPHS-HOSPITAL WIR BERATEN SIE! Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema Inkontinenz und Senkung geben. Allerdings kann keine Informationsschrift
Inkontinenz Urologische Rehabilitation des onkologischen Patienten
 Inkontinenz Urologische Rehabilitation des onkologischen Patienten D. Hegeholz Medical Advisor Continence Care Coloplast GmbH VII. Onkologische Fachtagung 2004 2 Tumorbedingte Harninkontinenz beeinträchtigt
Inkontinenz Urologische Rehabilitation des onkologischen Patienten D. Hegeholz Medical Advisor Continence Care Coloplast GmbH VII. Onkologische Fachtagung 2004 2 Tumorbedingte Harninkontinenz beeinträchtigt
Universitätsklinikum Jena Zentrale Notfallaufnahme
 Seite 1 von 5 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Seite 1 von 5 1. Fakten Zu Beginn: Sollte der Patient an die Urologie angebunden werden, bitte vor Antibiotikagabe wegen laufender Studien Kontakt mit der Urologie aufnehmen. Wenn dies medizinisch nicht
Harninkontinenz. Inhaltsverzeichnis. 1 Formen der Harninkontinenz
 Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
Harninkontinenz Inhaltsverzeichnis 1 Formen der Harninkontinenz 1.1 Überlaufinkontinenz 1.2 Syndrom der überaktiven Blase 1 Formen der Harninkontinenz Die häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz (ICD-10:
Multiple Sklerose und die Harnblase
 encathopedia Volume 2 Multiple Sklerose und die Harnblase Behandlung von Blasenproblemen Wie sich MS auf die Blase auswirkt ISK kann helfen Multiple Sklerose (MS) MS ist eine entzündliche Erkrankung, die
encathopedia Volume 2 Multiple Sklerose und die Harnblase Behandlung von Blasenproblemen Wie sich MS auf die Blase auswirkt ISK kann helfen Multiple Sklerose (MS) MS ist eine entzündliche Erkrankung, die
ICA Österreich St. Pölten Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben?
 Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben? Funktionsleitung: Urologische Ambulanz und Endourologischer OP Urotherapie Ist eine nicht chirurgische und nicht pharmakologische
Was ist Urotherapie? Welche Bedeutung kann sie für Patientinnen mit IC haben? Funktionsleitung: Urologische Ambulanz und Endourologischer OP Urotherapie Ist eine nicht chirurgische und nicht pharmakologische
Ruhr-Universiät Bochum Prof. Dr. med. J. Pannek Dienstort: Schweizer Paraplegiker Zentrum Abt.: Urologie
 Ruhr-Universiät Bochum Prof. Dr. med. J. Pannek Dienstort: Schweizer Paraplegiker Zentrum Abt.: Urologie Der Einfluss einer Blasenfunktionsstörung bei Rückenmarkverletzten auf ihre subjektiv wahrgenommene
Ruhr-Universiät Bochum Prof. Dr. med. J. Pannek Dienstort: Schweizer Paraplegiker Zentrum Abt.: Urologie Der Einfluss einer Blasenfunktionsstörung bei Rückenmarkverletzten auf ihre subjektiv wahrgenommene
BECKENBODENZENTRUM TÜV WIR SORGEN FÜR SIE. Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf. geprüft
 BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
BECKENBODENZENTRUM Behandlungspfad Zertifizierter TÜV geprüft Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf WIR SORGEN FÜR SIE Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Bergedorf
Nosokomiale Infektionen. Harnwegsinfektionen bei der Frau
 Im Wesentlichen gibt es vier verschiedene Ausgangspunkte der Blasenkatheter-assoziierten, über die Erreger in die unteren Harnwege eindringen und besiedeln: - - Extraluminäre Besiedlung - Intraluminäre
Im Wesentlichen gibt es vier verschiedene Ausgangspunkte der Blasenkatheter-assoziierten, über die Erreger in die unteren Harnwege eindringen und besiedeln: - - Extraluminäre Besiedlung - Intraluminäre
Beratung Vorsorge Behandlung. Beckenboden- Zentrum. im RKK Klinikum Freiburg. Ihr Vertrauen wert
 Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Beratung Vorsorge Behandlung Beckenboden- Zentrum im RKK Klinikum Freiburg Ihr Vertrauen wert 2 RKK Klinikum RKK Klinikum 3 Inkontinenz was ist das? In Deutschland leiden ca. 6 7 Millionen Menschen unter
Urologie und Kinderurologie
 Urologie und Kinderurologie Informationen für Patienten und Kooperationspartner Die Klinik für Urologie und Kinderurologie steht unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Ludger Franzaring, Facharzt für
Urologie und Kinderurologie Informationen für Patienten und Kooperationspartner Die Klinik für Urologie und Kinderurologie steht unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Ludger Franzaring, Facharzt für
Harnkontinenz. Definitionen. Formen nicht kompensierter Inkontinenz. Pflegediagnosen: Risikofaktoren
 Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Definitionen Harninkontinenz ist jeglicher unfreiwilliger Urinverlust. ist die Fähigkeit, willkürlich zur passenden Zeit an einem geeigneten Ort die Blase zu entleeren. Es beinhaltet auch die Fähigkeit,
Logbuch Praktisches Jahr Urologische Universitätsklinik Tübingen
 Logbuch Praktisches Jahr Urologische Universitätsklinik Tübingen Name: Vorname: Matrikelnummer: Tertialdauer von : bis: Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir möchten Sie ganz herzlich
Logbuch Praktisches Jahr Urologische Universitätsklinik Tübingen Name: Vorname: Matrikelnummer: Tertialdauer von : bis: Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir möchten Sie ganz herzlich
encathopedia Volume 1 Harnwegsinfektionen Vermeidung einer HWI Was ist eine HWI? Symptome einer HWI
 encathopedia Volume 1 Harnwegsinfektionen Was ist eine HWI? Vermeidung einer HWI Symptome einer HWI Symptome einer HWI Eine Harnwegsinfektion beinhaltet in der Regel eine Veränderung des Ausscheidungsverhaltens.
encathopedia Volume 1 Harnwegsinfektionen Was ist eine HWI? Vermeidung einer HWI Symptome einer HWI Symptome einer HWI Eine Harnwegsinfektion beinhaltet in der Regel eine Veränderung des Ausscheidungsverhaltens.
UMFRAGEERGEBNISSE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN
 UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
UMFRAGEERGEBNISSE Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.v. UMFRAGE ZUR: DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON HARNINKONTINENZ BEI FRAUEN Die Blase ist ein kompliziertes
Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes
 11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
11 Anatomie, Physiologie und Innervation des Harntraktes P.M. Braun und K.-P. Jünemann.1 Anatomie des unteren Harntrakt es 1. Neuroanatomie (Steuerung und Innervation) 1.3 Neurophysiologie 13 Literatur
Inhaltsverzeichnis Wen betrifft Inkontinenz? Wie häufig ist Inkontinenz? Welche Formen der Inkontinenz gibt es?
 IX 1 Wen betrifft Inkontinenz?............................................... 1 Frank Perabo Risikofaktoren 1 Klassifikationssystem für Risikofaktoren 3 Was kann getan werden, um einer Harninkontinenz
IX 1 Wen betrifft Inkontinenz?............................................... 1 Frank Perabo Risikofaktoren 1 Klassifikationssystem für Risikofaktoren 3 Was kann getan werden, um einer Harninkontinenz
2., vollständig überarbeitete Auflage
 Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage Mit 209 Abbildungen 123
Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage Hans Palmtag Mark Goepel Helmut Heidler Urodynamik 2., vollständig überarbeitete Auflage Mit 209 Abbildungen 123
ISK bei Jugendlichen/Erwachsenen mit Spina bifida
 ISK bei Jugendlichen/Erwachsenen mit Spina bifida Ist eine soziale Kontinenz möglich? Ingo Krause Krankenpfleger Urotherapeut Fachverantwortlicher Medizin AstraTech GmbH 65604 Elz Gemeinsame Jahrestagung
ISK bei Jugendlichen/Erwachsenen mit Spina bifida Ist eine soziale Kontinenz möglich? Ingo Krause Krankenpfleger Urotherapeut Fachverantwortlicher Medizin AstraTech GmbH 65604 Elz Gemeinsame Jahrestagung
AKTUELL. Ursachen Abklärung Behandlung. 4. April 2014 AUVA 1200 Wien
 AKTUELL NEUROGENE BLASE Ursachen Abklärung Behandlung 4. April 2014 AUVA 1200 Wien Österreichische Gesellschaft für Urologie (ÖGU) Arbeitskreis Blasenfunktionsstörungen Ab 8:15 Registrierung 09:00 09:15
AKTUELL NEUROGENE BLASE Ursachen Abklärung Behandlung 4. April 2014 AUVA 1200 Wien Österreichische Gesellschaft für Urologie (ÖGU) Arbeitskreis Blasenfunktionsstörungen Ab 8:15 Registrierung 09:00 09:15
Die Lungenembolie in der Notfallaufnahme. Oana-Maria Driga
 Die Lungenembolie in der Notfallaufnahme Oana-Maria Driga Definition: partieller oder vollständiger Verschluss eines Lungenarterienastes durch einen verschleppten (Thromb)embolus in ca. 90% sind Becken-Bein-
Die Lungenembolie in der Notfallaufnahme Oana-Maria Driga Definition: partieller oder vollständiger Verschluss eines Lungenarterienastes durch einen verschleppten (Thromb)embolus in ca. 90% sind Becken-Bein-
BECKENBODEN- KONTINENZ- & ZENTRUM ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR
 ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
ZERTIFIZIERT UND INTERDISZIPLINÄR KONTINENZ- & BECKENBODEN- ZENTRUM WILLKOMMEN Über uns Der Beckenboden ist für die Funktion von Blase und Darm von entscheidender Bedeutung. Geburten, Bindegewebsschwäche,
Inkontinenz. Was versteht man unter Harninkontinenz? Welche Untersuchungen sind notwendig?
 Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Inkontinenz Was versteht man unter Harninkontinenz? Darunter verstehen wir unwillkürlichen Urinverlust. Je nach Beschwerden unterscheidet man hauptsächlich zwischen Belastungsinkontinenz (Stressharninkontinenz)
Urologische Probleme in der Allgemein-Praxis. Urologische Diagnosen in abnehmender Häufigkeit WS 2009/10. Urologische Probleme in der Allgemeinmedizin
 Symptome der akuten Zystitis Allgemein-Praxis Arbeitsbereich Leiter: Dr. P. Maisel Mitarbeiter: Dr. A. Arend, Dr. K. Mayer, Prof. Dr. K. Wahle PJ-Beauftragter: U. Engels Datum: 28.10.2009 Häufiger Harndrang
Symptome der akuten Zystitis Allgemein-Praxis Arbeitsbereich Leiter: Dr. P. Maisel Mitarbeiter: Dr. A. Arend, Dr. K. Mayer, Prof. Dr. K. Wahle PJ-Beauftragter: U. Engels Datum: 28.10.2009 Häufiger Harndrang
56. Kongress der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie. Funktionell
 56. Kongress der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie Enuresis / Harninkontinenz Anatomisch Neurologisch Funktionell Dr. med. Iris Körner - Sektion Kinderurologie - Universitätsklinikum Essen
56. Kongress der Nordrhein-Westfälischen Gesellschaft für Urologie Enuresis / Harninkontinenz Anatomisch Neurologisch Funktionell Dr. med. Iris Körner - Sektion Kinderurologie - Universitätsklinikum Essen
Urologische Diagnosen in abnehmender HÅufigkeit
 Urologische Diagnosen in abnehmender HÅufigkeit 1. Cystitis Ç Cysto-Pyelitis 2. Benigne Prostata-Hyperplasie (ÉBPHÑ) 3. Harninkontinenz 4. Urolithiasis 5. Harnverhalt 6. Potenzprobleme 7. Prostata-Carcinom
Urologische Diagnosen in abnehmender HÅufigkeit 1. Cystitis Ç Cysto-Pyelitis 2. Benigne Prostata-Hyperplasie (ÉBPHÑ) 3. Harninkontinenz 4. Urolithiasis 5. Harnverhalt 6. Potenzprobleme 7. Prostata-Carcinom
Merkheft für Mitomycin-Patienten. Die Forschung kommt weiter, weil sie in Chancen denkt. Nicht in Risiken.
 Die Forschung kommt weiter, weil sie in Chancen denkt. Nicht in Risiken. Michael von Wasielewski, Außendienstleiter medac Urologie Merkheft für Mitomycin-Patienten 1 Therapieschema für die Behandlung mit
Die Forschung kommt weiter, weil sie in Chancen denkt. Nicht in Risiken. Michael von Wasielewski, Außendienstleiter medac Urologie Merkheft für Mitomycin-Patienten 1 Therapieschema für die Behandlung mit
MS-Rehabilitationszentrum
 MS-Rehabilitationszentrum nach den Vergabekriterien der DMSG, Bundesverband e.v. 1. Expertise und Weiterbildung 1.1. Die kontinuierliche Betreuung der MS-Patienten durch eine/n Facharzt/Fachärztin für
MS-Rehabilitationszentrum nach den Vergabekriterien der DMSG, Bundesverband e.v. 1. Expertise und Weiterbildung 1.1. Die kontinuierliche Betreuung der MS-Patienten durch eine/n Facharzt/Fachärztin für
idealer Fluss ein Dauerkatheter Harnableitung und pflegende Angehörige Informationen für Betroffene Deutsche Kontinenzgesellschaft e.v.
 Dauerkatheter Harnableitung ein idealer Fluss Überreicht durch: Die Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Produktänderungen aufgrund technischen Fortschritts vorbehalten. 12/2009 UROMED
Dauerkatheter Harnableitung ein idealer Fluss Überreicht durch: Die Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Produktänderungen aufgrund technischen Fortschritts vorbehalten. 12/2009 UROMED
BLASEERSATZ ÜBERBLICKEN BLASENERSATZ
 BLASEERSATZ ÜBERBLICKEN BLASENERSATZ Je nachdem wie weit der Tumor fortgeschritten ist (siehe Tumorformen), wird die Blase zusammen mit dem Tumor entfernt. Hat der Krebs auch das umliegenden Lymphknotengewebe
BLASEERSATZ ÜBERBLICKEN BLASENERSATZ Je nachdem wie weit der Tumor fortgeschritten ist (siehe Tumorformen), wird die Blase zusammen mit dem Tumor entfernt. Hat der Krebs auch das umliegenden Lymphknotengewebe
Urogenitalsystem-Harnwegssystem
 Urogenitalsystem-Harnwegssystem 1 Urogenital-Fortpflanzungssystem 2 Urogenitalsystem-Harnwegssystem Unter dem Begriff Urogenitalsystem werden die Harnorgane und die Geschlechtsorgane zusammengefasst. Zum
Urogenitalsystem-Harnwegssystem 1 Urogenital-Fortpflanzungssystem 2 Urogenitalsystem-Harnwegssystem Unter dem Begriff Urogenitalsystem werden die Harnorgane und die Geschlechtsorgane zusammengefasst. Zum
Interdisziplinäres Zentrum für Kontinenzund Beckenbodenmedizin
 Interdisziplinäres Zentrum für Kontinenzund Beckenbodenmedizin HOTLINE: +43 (6542) 777-8585 TERMINVEREINBARUNGEN: Mo.-Fr. 8-13 Uhr www.tauernklinikum.at ALLGEMEIN 2 INTERDISZIPLINÄRES ZENTRUM FÜR KONTINENZ-
Interdisziplinäres Zentrum für Kontinenzund Beckenbodenmedizin HOTLINE: +43 (6542) 777-8585 TERMINVEREINBARUNGEN: Mo.-Fr. 8-13 Uhr www.tauernklinikum.at ALLGEMEIN 2 INTERDISZIPLINÄRES ZENTRUM FÜR KONTINENZ-
UROLOGIE. Inhaltebogen zum Antrag auf Weiterbildungsbefugnis gemäß Weiterbildungsordnung vom 25. Mai 2011
 UROLOGIE Inhaltebogen zum Antrag auf Weiterbildungsbefugnis gemäß Weiterbildungsordnung vom 25. Mai 2011 Name, Vorname Antragssteller Weiterbildungsstätte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Berichtszeitraum
UROLOGIE Inhaltebogen zum Antrag auf Weiterbildungsbefugnis gemäß Weiterbildungsordnung vom 25. Mai 2011 Name, Vorname Antragssteller Weiterbildungsstätte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Berichtszeitraum
steigende Transplantationszahlen höheres Alter von Spendern/Empfängern rezidivierende Harnwegsinfekte nach NTX
 Harnwegsinfekt nach Nierentransplantation Algorithmen und Möglichkeiten sekundärer urologischer Interventionen am Harntrakt 20. Jahrestagung des Arbeitskreises Nierentransplantation der Deutschen Gesellschaft
Harnwegsinfekt nach Nierentransplantation Algorithmen und Möglichkeiten sekundärer urologischer Interventionen am Harntrakt 20. Jahrestagung des Arbeitskreises Nierentransplantation der Deutschen Gesellschaft
BECKENBODEN- ZENTRUM
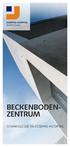 BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
BECKENBODEN- ZENTRUM GYNÄKOLOGIE IM JOSEPHS-HOSPITAL KONTAKT JOSEPHS-HOSPITAL WARENDORF GYNÄKOLOGIE AGUB II-Zertifikat der Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und plastische Beckenbodenrekonstruktion
Die Schlaganfall-Station
 Von der Diagnose zur Therapie Die Schlaganfall-Station St. Johannes Krankenhaus Wilhelm-Busch-Straße 9 53844 Troisdorf Tel.: 02241 / 488-0 www.johannes-krankenhaus.com Krankheitsbild und Ursache Das Krankenbild
Von der Diagnose zur Therapie Die Schlaganfall-Station St. Johannes Krankenhaus Wilhelm-Busch-Straße 9 53844 Troisdorf Tel.: 02241 / 488-0 www.johannes-krankenhaus.com Krankheitsbild und Ursache Das Krankenbild
Frau Prof. Burkhard, wie lässt sich das Problem der Inkontinenz zuordnen? Wer ist davon betroffen?
 Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Inkontinenz Frau Professor Dr. Fiona Burkhard ist als Stellvertretende Chefärztin der Urologischen Universitätsklinik des Inselspitals Bern tätig und beantwortet Fragen zum Thema Inkontinenz. Frau Prof.
Voruntersuchungen. Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Voruntersuchungen ASA Klassifikation Grundlagen für apparative, technische Untersuchungen entscheidende Grundlagen zur Indikation jeder präoperativen technischen Untersuchung: - Erhebung einer sorgfältigen
Reha für operierte BPS Patienten. Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar Köln
 Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Reha für operierte BPS Patienten Arbeitskreis Benignes Prostatasyndrom 23. Seminar 17.02. 18.02.2017 Köln Prof. Dr. med. Ullrich Otto Ärztlicher Direktor Ltd. Chefarzt UKR Urologisches Kompetenzzentrum
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm. Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr
 Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
Hilfe bei Funktionsstörungen von Blase und Darm Zertifiziertes Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum Essen-Ruhr Liebe Patienten, in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an ständigem Harndrang,
