WOLFHART PANNENBERG. Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie. Siebte Auflage V&R
|
|
|
- Melanie Meissner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 WOLFHART PANNENBERG Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie Siebte Auflage V&R VANDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN
2 Wolfhart Pannenberg Geb in Stettin. Studium der Theologie in Berlin, Göttingen, Basel und Heidelberg. Promotion 1953, Habilitation Von 1955 bis 1958 Dozent für Systematische Theologie in Heidelberg, dann bis 1961 Prof. an der Kirchl. Hochschule Wuppertal. Seit 1961 o.prof. in Mainz, von 1967 ab in München Wissenschaflliche Veröffentlichungen: Die Prädestinationslehre des Duns Skotus u 1954, Offenbarung als Geschichte (Hrsg.) 4. Aufl. 1970, Grundzüge der Christologie (1964), 2. Aufl. 1966, Grundfragen systematischer Theologie, 2. Auflage Gottesgedanke und menschliche Freiheit Meiner Frau CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Pannenberg, Wolßart: Was ist der Mensch? : Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie / Wolfhart Pannenberg Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, (Kleine Vandenhoeck-Reihe; 1139) ISBN NE:GT Kleine Vandenhoeck-Reihe Auflage Tausend Umschlag: Hans Dieter Ullrich. - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen Printed in Germany. - Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf foto- oder akustomechanischem Wege zu vervielfältigen. - Gesamtherstellung: Hubert 6c Co., Göttingen.
3 VORWORT Die elf Vorträge dieses Bandes sind erwachsen aus Vorlesungen über theologische Anthropologie, die ich 1959/60 in Wuppertal und 1961 in Wuppertal und Mainz vorgetragen habe. Es handelte sich dabei um die Aufgabe einer theologischen Verarbeitung der verschiedenartigen anthropologischen Forschungen der Gegenwart hinsichtlich ihrer Methoden und Resultate. Einige Themen aus diesen Vorlesungen wurden zu einer Sendereihe des NDR zusammengestellt und bearbeitet, die im Winter 1961/62 gesendet worden ist. Die Vorträge erscheinen hier so gut wie unverändert. Die beigegebenen Anmerkungen, die äußerst knapp gehalten werden mußten, verdeutlichen kritische oder zustimmende Bezugnahmen im Text auf bestimmte Arbeiten. Daneben stehen einige wenige Hinweise auf einführende Literatur. VORWORT ZUR 3. AUFLAGE Für die Neuauflage wurde der Anmerkungsteil etwas erweitert, um die Beziehungen zur soziologischen und tiefenpsychologischen Forschung deutlicher hervortreten zu lassen, das Verhältnis der theologischen Perspektive zur verhaltensanthropologischen Deutung der Weltoffenheit des Menschen genauer zu bestimmen und die methodischen Voraussetzungen meiner Betrachtungsweise noch besser kenntlich zu machen. Alle Zusätze sind in eckige Klammern gesetzt. Mainz, im Oktober 1967 W.P.
4 INHALT 1. Weltoffenheit und Gottoffenheit 5 2. Daseinsbewältigung mit Phantasie Sicherung statt Vertrauen? Hoffnung über den Tod hinaus Die Ichhaftigkeit und die Bestimmung des Menschen Zeit, Ewigkeit, Gericht Person in Gesellschaft Recht durch Liebe Der Gesellschaftsprozeß Tradition und Revolution Der Mensch als Geschichte 95 Anmerkungen 104
5 1. WELTOFFENHEIT UND GOTTOFFENHEIT Wir leben in einem Zeitalter der Anthropologie. Eine umfassende Wissenschaft vom Menschen ist ein Hauptziel der geistigen Bestrebungen der Gegenwart. Eine ganze Anzahl wissenschaftlicher Forschungszweige haben sich dazu vereinigt. Gerade ihre je besondere Problematik hat sie in dieser Frage in oft unerwartete Berührung mit andern Forschungen gebracht. Biologen und Philosophen, Juristen und Soziologen, Psychologen, Mediziner und Theologen haben in der Frage nach dem Menschen verwandte Einsichten und zum Teil auch eine gemeinsame Sprache gefunden. Die spezialisierten Methoden scheinen vor unsern Augen zur Überwindung ihrer eigenen Zersplitterung beizutragen, indem sich ein neues, umfassendes Verständnis des Menschen herausbildet. Die mit dem Menschen beschäftigten Wissenschaften sind heute auf dem besten Wege, im allgemeinen Bewußtsein den Platz einzunehmen, den in früheren Jahrhunderten die Metaphysik innehatte. Darin äußert sich der tiefgreifende Wandel, den das Bewußtsein der Menschen in der Neuzeit erfahren hat: Der Mensch will sich nicht mehr in eine Ordnung der Welt, der Natur, einfügen, sondern er will über die Welt herrschen. Die Metaphysik hatte umgekehrt seit ihren Anfängen in der griechischen Philosophie dem Menschen seinen Platz im Kosmos, in der Ordnung der Gesamtheit alles Seienden, angewiesen. Ihren charakteristischen Ausdruck hat diese Haltung in der Auffassung des Menschen als Mikrokosmos gefunden: Der Mensch galt als die Welt im Kleinen; denn er hat an allen Schichten des Kosmos Anteil, am körperlichen, wie am seelischen und geistigen Sein. Darin liegt für diese Auffassung die Besonderheit des Menschen unter allen Wesen. Aber der Mensch ist hier ganz von der Welt her verstanden, dazu bestimmt, ihren Aufbau in seinem Dasein abzubilden. Das ist ein Gedanke, der weit in die religionsgeschichtliche Vorzeit zurückreicht, aber von der griechischen Metaphysik ist er besonders klar ausgebildet worden. Heute ist die alte Auffassung des Menschen als Mikrokosmos uns so fremd geworden wie das antike Bild des Kosmos selbst, wie die Vorstellung von Himmelssphären, die um die Erde kreisen. Heute erschiene es als sinnlos, wollte jemand irgendein Bild von einer alles umfassenden 5
6 und unveränderlichen kosmischen Ordnung ein für allemal festlegen. Schon eine derartige Zielsetzung wäre der Arbeitsweise neuzeitlicher Naturwissenschaft und Technik entgegengesetzt. Weltbilder sind heute nur noch Modelle der Natur, die der Mensch im Dienste seiner technischen Naturbeherrschung entwirft und wieder verwirft. Die Welt ist kein Zuhause mehr für den Menschen, sondern nur noch Material für seine umgestaltende Tätigkeit. Der Erfolg dieser Bemühungen, der früheren Jahrhunderten unvorstellbar war, zeigt, daß die in ihnen wirksame Lebenshaltung zumindest teilweise wirklichkeitsgerecht ist. Angesichts dieser Situation, angesichts der gestaltenden Freiheit des Menschen gegenüber der Welt, erhebt sich heute mit besonderer Dringlichkeit die Frage, wer denn der Mensch selbst ist. Die Menschheit hat den alten Halt an festen Ordnungen verloren, seien es nun die Ordnungen des Kosmos oder die angeblich den Kosmos abbildende Ordnung der Gesellschaft. Die Geistesgeschichte der Neuzeit ist von Pascal bis in die Gegenwart gezeichnet durch das Erschrecken vor der schrankenlosen Freiheit des modernen Menschen. Sind wir nicht so weit gelangt, das Leben auf dieser Erde und die Menschheit selbst vernichten zu können? Die Existenzphilosophie hat diese Situation des ins Nichts hinausgreifenden, schöpferischen Menschen so beschrieben, daß nur noch die Entscheidung des Menschen selbst entscheidet, wer oder was der Mensch eigentlich ist. In solcher Zuspitzung ist die existenzialistische These freilich allzu abstrakt. Wo ein Mensch schöpferische Entscheidungen trifft, da bleiben sie immer auf die biologischen und soziologisch-geschichtlichen Bedingungen seiner Situation bezogen, auf die eigene Lebensgeschiente wie auf den Geist seiner Zeit. Und das gilt gerade auch von den kritischen Entscheidungen, in denen jemand sich abstößt von allem, was er vorfindet. Aber in der Tat ist heute die Frage, was der Mensch ist, nicht mehr aus der Welt zu beantworten, sondern auf den Menschen selbst zurückgeschlagen. Dadurch ist die Wissenschaft vom Menschen zu einer noch nie dagewesenen Bedeutung aufgestiegen. In der Anthropologie heißt die von der Neuzeit entdeckte eigentümliche Freiheit des Menschen, über alle vorfindliche Regelung seines Daseins hinauszufragen und hinwegzuschreiten, seine Weltoffenheit 1. Dieser Ausdruck soll mit einem Wort den Grundzug angeben, der den Menschen zum Menschen macht, ihn vom Tier unterscheidet und ihn über die außermenschliche Natur überhaupt hinaushebt. Recht verstanden läuft dieser Ausdruck nämlich nicht darauf hinaus, den Menschen einseitig von der außermenschlichen Natur her zu charakterisieren. Was aber ist mit Weltoffenheit gemeint? 6
7 Zunächst geht es hier allerdings um den Unterschied von Mensch und Tier. Man sagt, der Mensch hat Welt, während jede Tierart auf eine erblich festgelegte, arttypische Umwelt beschränkt ist. Nach allem, was wir wissen, nehmen Tiere ihre Umgebung nicht in der reichen Fülle wahr, in der sie uns erscheint. Tiere bemerken von ihrer Umgebung nur das, was für ihre Art triebwichtig ist. Alles übrige dringt gar nicht in ihr Bewußtsein. Die Weite oder Enge, Einfachheit oder Kompliziertheit der Umwelt ist natürlich bei den einzelnen Tierarten sehr verschieden. Aber von allen gilt, daß ihr Verhalten umweltgebunden ist. Bestimmte Merkmale der Umgebung wirken wie Signale und lösen ein Verhalten aus, das in seinem Grundbestand nicht erst erlernt zu werden braucht, sondern angeboren ist. Auf die Wahrnehmung solcher Merkmale sind die Sinnesorgane der Tiere spezialisiert, und wenn sie auftreten, so erfolgt die im Instinkt vorgesehene Reaktion. Bei gewissen primitiven Arten besteht die Umwelt nur aus sehr wenigen Merkmalen. So hat, um ein einfaches Beispiel zu nennen, die Zecke nur drei Sinne: Lichtsinn, Geruchssinn, Temperatursinn. Mit Hilfe des Lichtsinns ihrer Haut findet sie den Weg auf einen Ast. Geruchs- und Temperatursinn melden ihr, wenn ein warmblütiges Tier sich unter dem Ast befindet. Auf dieses Signal hin läßt sich die Zecke fallen, um dem Tier das Blut abzusaugen. Das ist die Umwelt der Zecke. Augen, Ohren und Geschmack besitzt sie nicht. Sie bedarf ihrer auch nicht. Die Umwelt der Zecke ist natürlich ein besonders einfaches Beispiel. Die Umwelt der meisten Tierarten ist sehr viel komplizierter. Aber gemeinsam scheint allen Tierarten zu sein, daß sie nur einen Ausschnitt der unserem Wissen zugänglichen Welt kennen, bestimmte Merkmale, die für die Art triebwichtig sind, auf die ihre Sinnesorgane spezialisiert sind und auf die sie instinktiv reagieren. Auch wo das instinktive Verhalten elastischer ist, erleben Tiere von der Welt nur das, was sie eigentlich schon vorher kennen, in den erblichen Formen ihrer Wahrnehmung und ihres Verhaltens, ganz ähnlich, wie sich Kant das menschliche Erkennen vorgestellt hat. Gerade der Mensch ist aber nicht auf eine bestimmte Umwelt für sein Erleben und Verhalten beschränkt. Wo bei Menschen so etwas wie eine Umwelt erscheint, da handelt es sich um Einrichtungen seiner Kultur, nicht um angeborene Schranken. So ist zwar der Wald für den Jäger etwas anderes als für den Holzfäller oder für den sonntäglichen Ausflügler. Aber die Weise, wie der Jäger den Wald erlebt, ist nicht durch seine biologische Organisation festgelegt, sondern hängt mit seinem Beruf zusammen, den er gewählt hat, und an dessen Stelle er auch einen andern hätte wählen können. Sobald 7
8 er Ingenieur wird, erlebt auch er den Wald aus dem Blickwinkel des Sonntagsausflüglers. Der Mensch bleibt auch als Jäger offen für andere Möglichkeiten des Menschseins. Das ist beim Tier anders. Tiere kennen nur ihre angeborene Umwelt. Der Mensch ist nicht umweltgebunden, sondern weltoffen. Das heißt: Er kann immer neue und neuartige Erfahrungen machen, und seine Möglichkeiten, auf die wahrgenommene Wirklichkeit zu antworten, sind nahezu unbegrenzt wandelbar. Das entspricht bis in Einzelheiten hinein dem Besonderen der menschlichen Leiblichkeit. So sind unsere Organe im Vergleich zu denen der Tiere kaum spezialisiert, dafür aber wie etwa die Hand erstaunlich vielseitig. Der Mensch kommt im Vergleich zu andern Säugetieren viel zu früh und unfertig zur Welt, und er bleibt für eine lange Jugendzeit bildsam. Die Antriebe der Menschen richten sich nicht von Geburt an eindeutig auf bestimmte Merkmale, sondern sind verhältnismäßig unbestimmt. Sie werden erst durch individuelle Wahl und Gewohnheit sowie durch Erziehung und Sitte eindeutiger ausgeprägt. Das bedeutet: Die tierisches Verhalten steuernden Instinkte sind beim Menschen weitgehend zurückgebildet, nur noch in Resten vorhanden. Dies hat nun sehr einschneidende Folgen für das Ganze unserer Daseinserfahrung und unseres Verhaltens: Weil die Richtung seiner Antriebe nicht von vornherein festliegt, darum ist der Blick des Menschen auf die Wirklichkeit eigentümlich offen. Wer von einem klar bestimmten Trieb ganz beherrscht wird, der blickt nicht mehr rechts noch links, sondern schaut nur nach den Merkmalen aus, die das Erstrebte ankündigen. Das normale Verhalten des Menschen ist das nicht. Vielmehr erfährt er die Dinge als etwas für sich, das er erst nachträglich in seine Pläne einordnen wird. Und weil er die Dinge so in Distanz sich gegenüber hat, darum sieht er auch nicht nur eine Seite, sondern viele Seiten, viele Eigenschaften an ihnen, viele Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Erst der Mensch erfährt überhaupt in diesem genauen Sinne des Wortes Gegenstände, wie selbständig ihm gegenüberstehende, fremdartige und staunenerregende Wesen. Es ist spezifisch menschlich, neugierig bei den Dingen zu verweilen, von ihrer Seltsamkeit uird Eigenart in gleichsam atemlosem Interesse benommen zu sein. Die Dinge sind dem Menschen gerade nicht, wie Heidegger gemeint hat, ursprünglich zuhanden 2. Solche natürliche Vertrautheit mit der Umgebung ist nur den Tieren beschieden, soviel auch romantische Schwärmerei nach einem solchen Zustand sich sehnen mag! Erst nachträglich, indem er sich eine Kulturwelt, eine künstliche Welt, aufbaut, macht der Mensch sich seine Umgebung so zurecht, daß sie ihm zuhanden wird. Ursprünglich und immer 8
9 wieder aber ist er so benommen von der aufregenden Fremdheit der Dinge um ihn her, daß er von ihnen her sich selbst mit ganz anderen Augen, wie ein fremdes Wesen, betrachten lernt. Erst von der Welt her erfährt der Mensch sich selbst, indem er seinen eigenen Leib in bestimmten Zusammenhängen mit den andern Dingen vorfindet. Darum ist die Erforschung der Welt der Weg, den der Mensch einschlagen muß, um seine Bedürfnisse kennenzulernen und um sich darüber klarzuwerden, worauf er selbst eigentlich hinaus will. Nur auf dem Umweg über die Welterfahrung vermag er seine zunächst richtungslosen Antriebe zu orientieren, legt er sich Interessen und Bedürfnisse zu. Und mit fortschreitender Erfahrung werden die Bedürfnisse selbst verwandelt. Nur auf diesem mühevollen Weg kann der Mensch versuchen, Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Man versteht, wie die Griechen dazu kamen, die Frage nach dem Menschen vom Kosmos her zu beantworten. Aber freilich vermag die Welt nie, eine endgültige Antwort auf die Frage des Menschen nach seiner Bestimmung zu geben. Das ist schon in der Antike da und dort gefühlt worden. Mit unwiderstehlicher Gewalt jedoch hat sich dem neuzeitlichen Menschen die Erfahrung aufgedrängt, daß er über jeden Horizont, der sich ihm auftut, immer noch hinausfragen kann, so daß sich geradezu durch ihn, den Menschen, erst entscheidet, was aus der Welt werden soll. Damit wird nun aber die Frage nach dem genauen Sinn des Wortes Weltoffenheit dringend. Wofür ist der Mensch da eigentlich offen? Die Antwort muß gewiß zunächst lauten: Er ist offen für immer neue Dinge, frische Erfahrungen, während die Tiere nur für eine beschränkte und arttypisch festliegende Anzahl von Merkmalen offen sind. Hier erhebt sich nun aber erst das eigentliche Problem: Ist etwa die Welt für den Menschen das, was den Tieren ihre Umwelt ist? Ist er angelegt auf die Welt, auf sie hin geöffnet? Meint das der Ausdruck Weltoffenheit? Es liegt von seinem Wortlaut her sehr nahe, ihn so mißzuverstehen. Dann wäre unsere Welt nur eine riesenhafte und sehr komplizierte Umwelt. Das Verhältnis der Menschen zur Welt wäre nicht grundsätzlich von dem der Tiere zu ihrer Umwelt verschieden. Der festbegrenzte Kosmos des antiken Denkens war in der Tat ein derartiges Gehäuse für den Menschen. Aber insofern hat man damals eben den tieferen Unterschied des Menschen von allen Tieren noch nicht verstanden. Die Weltoffenheit, die die moderne Anthropologie im Blick hat, ist nicht nur dem Grade nach, sondern grundsätzlich von tierischer Umweltgebundenheit verschieden. Darum kann es sich hier nicht nur um eine Offenheit für die Welt handeln. Sondern Weltoffenheit muß heißen: Der 9
10 Mensch ist ganz und gar ins Offene gewiesen. Er ist über jede Erfahrung, über jede gegebene Situation hinaus immer noch weiter offen. Er ist offen auch über die Welt hinaus, nämlich über sein jeweiliges Bild von der Welt; aber auch über jedes mögliche Weltbild hinaus und über das Suchen nach Weltbildern überhaupt, so unerläßlich es ist, bleibt er offen im Fragen und Suchen. Solche Offenheit über die Welt hinaus ist sogar Bedingung der Welterfahrung selbst. Drängte unsere Bestimmung uns nicht über die Welt hinaus, dann würden wir nicht, auch ohne konkreten Anlaß, immer weiter suchen. Hat die Offenheit des Menschen über die Naturwelt hinaus dann vielleicht den Sinn, daß er nur an seiner eigenen Schöpfung Genüge finden kann, indem er die Naturwelt in eine künstliche Welt verwandelt? Ist der Mensch bestimmt zur Kultur? Diese Meinung scheint heute verbreitet zu sein 8. Aber auch bei ihren eigenen Gebilden finden die Menschen keine dauernde Ruhe. Sie wandeln nicht nur die Natur zur Kultur, sondern setzen unablässig neue Kulturgestaltungen an die Stelle der früheren. Daß so der Mensch auch durch seine eigenen Schöpfungen keine endgültige Befriedigung findet, sondern sie als bloße Durchgangspunkte seines Strebens alsbald wieder hinter sich läßt, das setzt voraus, daß seine Bestimmung auch über die Kultur hinausgeht, über die vorhandene wie über jede noch zu gestaltende. Wieder wird der Prozeß kultureller Gestaltung selbst in seinem schöpferischen Reichtum nur verständlich, wenn man sieht, daß seine treibenden Kräfte über jedes Werk hinausschießen, daß die Werke nur Stufen sind auf einem Wege zu unbekanntem Ziel. Was ist der Motor dieses Strebens ins Offene? Man hat gesagt, daß der Mensch ständig unter dem Druck eines Antriebsüberschusses lebe 4. Dieser Druck ist nicht der gewöhnliche Zwang tierischen Trieblebens. Der tierische Triebzwang setzt nur ein, wenn der auslösende Gegenstand gegenwärtig ist. Der menschliche Antriebsdruck hingegen richtet sich ins Unbestimmte. Er entsteht, weil unsere Antriebe keine Ziele finden, die ihnen ganz Genüge tun. Er äußert sich in dem für den Menschen so charakteristischen Drang zu Spiel und Wagnis, in der Distanzierung von der Gegenwart durch ein Lächeln. Er treibt ins Offene, scheinbar ziellos. Arnold Gehlen hat treffend von einer unbestimmten Verpflichtung gesprochen 5, die das Blut der Menschen in Unruhe versetzt und sie hinaustreibt über jede erreichte Stufe der Lebens Verwirklichung. Und er hat auch gesehen, daß diese Unruhe eine Wurzel alles religiösen Lebens ist. Das bedeutet nun freilich nicht, daß der Mensch sich selbst Religionen schafft, indem er jenem unbestimmten Drang durch seine Phan- 10
11 tasie Gestalt verleiht. Aller Tätigkeit der Phantasie in der Bildung der Religionen geht schon etwas anderes voraus, und dadurch ist Religion mehr als bloß eine Schöpfung der Menschen. Das läßt sich begründen durch eine eingehendere Besinnung auf die menschliche Antriebsstruktur. Triebhaftigkeit bedeutet nämlich beim Menschen wie bei den Tieren, auf etwas angewiesen zu sein. Das liegt in ihrem Begriff. Alle Lebewesen sind angewiesen auf Nahrung, auf Lebensbedingungen des Klimas und der Vegetation, auf die Gemeinschaft mit Artgenossen und nicht zuletzt auf die Gesundheit des eigenen Leibes. Während nun die Bedürftigkeit der Tiere auf ihre Umwelt beschränkt ist, kennt die des Menschen keine Grenzen. Er ist nicht nur angewiesen auf bestimmte Bedingungen seiner Umgebung, sondern darüber hinaus auf etwas, das sich ihm entzieht, sooft er nach einer Erfüllung greift. Die chronische Bedürftigkeit, die unendliche Angewiesenheit des Menschen setzt ein Gegenüber jenseits aller Welterfahrung voraus. Der Mensch schafft sich nicht erst unter dem Druck seines Antriebsüberschusses einen phantastischen Gegenstand seiner Sehnsucht und Ehrfurcht über alle in der Welt möglichen Dinge hinaus, vielmehr setzt er in seiner unendlichen Angewiesenheit ein entsprechend unendliches, nicht endliches, jenseitiges Gegenüber immer schon voraus, mit jedem seiner Atemzüge, auch wenn er es nicht zu nennen weiß. Das liegt wiederum im Wesen seines unendlichen Triebes. Erst daraufhin, daß der Mensch unendlich angewiesen ist und also in jedem Lebensvollzug ein über alles Endliche hinweg ihm zugewandtes Gegenüber seiner Angewiesenheit voraussetzt, erst daraufhin kann seine Phantasie Vorstellungen davon bilden. Für dieses Gegenüber, auf das der Mensch in seinem unendlichen Streben angewiesen ist, hat die Sprache den Ausdruck Gott. Das Wort Gott kann nur sinnvoll verwendet werden, wenn es -das Gegenüber der grenzenlosen Angewiesenheit des Menschen meint. Sonst wird es zu einer leeren Vokabel. Die unendliche Angewiesenheit des Menschen auf ein unbekanntes Gegenüber hat sich uns nun als der Kern des etwas vagen Ausdrucks Weltoffenheit herausgestellt. Damit ist freilich kein theoretischer Beweis für die Existenz Gottes geführt. Es hat sich aber gezeigt, daß der Mensch rein durch den Vollzug seines Lebens ein Gegenüber voraussetzt, auf das er unendlich angewiesen ist, ob er es weiß oder nicht. Es hat sich ferner gezeigt, daß diese Voraussetzung für ein Verständnis der grundlegenden biologischen Struktur des Menschseins unumgänglich ist, sobald man sich nicht mit der vagen Bezeichnung Weltoffenheit zufrieden gibt, sondern wissen will, was damit gemeint sein kann. 11
12 Aber, wie gesagt, jenes Gegenüber ist unbekannt. Es ist noch nichts darüber ausgemacht, wer oder was das Gegenüber, auf das der Mensch unendlich angewiesen ist, eigentlich ist. Die Angewiesenheit auf Gott ist gerade darin unendlich, daß die Menschen diese ihre Bestimmung nicht immer schon haben, sondern nach ihr suchen müssen. Und sie bleiben im Suchen selbst auf das Gegenüber Gottes angewiesen, wenn es sich überhaupt finden läßt. Die Religionsgeschichte zeigt, wie die Menschen das Gegenüber Gottes jeweils erfahren haben, wie es sich ihnen gezeigt hat. Ob sie es angemessen erfahren haben, das ist eine ganz andere Frage. Jedenfalls wären die Botschaften der Religionen darauf zu prüfen, ob sie die unendliche Offenheit menschlichen Daseins verdecken oder hervortreten lassen. Nun ist es wohl kein Zufall, daß die moderne Anthropologie der Weltoffenheit des Menschen ihre geistesgeschichtlichen Wurzeln im biblischen Denken hat. Die biblische Schöpfungsgeschichte hat den Menschen zum Herrn der Welt erklärt, freilich zum Herrscher im Auftrag Gottes, als sein Statthalter, sein Ebenbild. Dem jenseitigen Gott der Bibel verbunden, war der Mensch über alle übrigen Geschöpfe hinausgehoben, und die Welt konnte für ihn nicht mehr, wie für andere Religionen, eine Welt voll von Göttern und so ein Gegenstand frommer Scheu sein. Sie ist entgöttert und menschlicher Verwaltung übergeben. Die Jenseitigkeit des biblischen Gottes hat die Welt profan gemacht, und sein Bund hat die Mensdien zur Herrschaft über sie berufen. Aus solchem Geiste hat der abendländische Mensch gelernt, die Natur sich dienstbar zu machen und eben dadurch über sie hinauszufragen nach dem Gott jenseits der Welt. Es ist bezeichnend, daß am Anfang der modernen Anthropologie ein Theologe steht, Johann Gottfried Herder 6. In seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1784 beschrieb Herder den Menschen als den ersten Freigelassenen der Schöpfung. Und schon 1772, in seiner Schrift über den Ursprung der Sprache, hat er den Unterschied des Menschen von den Tieren so dargestellt, wie es im Prinzip noch in der gegenwärtigen Anthropologie geschieht. Der Stammbaum der modernen Anthropologie weist zurück auf die christliche Theologie. Und dieser Herkunft ist sie auch heute noch nicht entwachsen; denn, wie sich uns gezeigt hat, ihr Grundgedanke enthält immer noch die Frage nach Gott. Ich fasse das Ergebnis noch einmal zusammen: 1. Die Weltoffenheit des Menschen setzt eine Gottbezogenheit voraus. Wo darüber keine ausdrückliche Klarheit herrscht, bleibt das Wort Weltoffenheit undeutlich, als ob der Mensch auf die Welt angelegt sei, während es sich doch darum handelt, daß er 12
13 über alles, was er als seine Welt vorfindet, hinausfragen muß. Diese Eigenart des menschlichen Daseins, seine unendliche Angewiesenheit, ist nur als Frage nach Gott verständlich. Die unbegrenzte Offenheit für die Welt ergibt sich erst aus der Bestimmung des Menschen über die Welt hinaus. 2. Die Offenheit des Menschseins ist noch nicht genügend tief erfaßt, wenn man nur von einer Bestimmung des Menschen zur Kultur spricht. Gewiß ist es richtig, daß der Mensch von Natur ein Kulturwesen ist, wie man prägnant gesagt hat. Gewiß muß er selbst sich immer erst bilden zu dem, was die Gestalt seines Lebens ausmachen wird. Aber die kulturschöpferische Tätigkeit der Menschen bleibt selbst unverstanden, wenn sie nicht als Ausdruck eines Fragens und Suchens erfaßt wird, das wie über die Natur, so auch über alle kulturelle Gestaltung immer wieder hinausgreift. 3. Der Umweltgebundenheit der Tiere entspricht also beim Menschen weder sein Verhältnis zur Naturwelt, noch die Vertrautheit mit seiner Kulturwelt, sondern seine unendliche Angewiesenheit auf Gott. Was für das Tier die Umwelt, das ist für den Menschen Gott: das Ziel, an dem allein sein Streben Ruhe finden kann und wo seine Bestimmung erfüllt wäre. 2. DASEINSBEWÄLTIGUNG MIT PHANTASIE In der eigentümlichen Weltoffenheit, die den Menschen vom Tier unterscheidet, brennt die Frage nach Gott. Über alles, was ihm in der Welt begegnet, strebt der Mensch hinaus, durch nichts ganz und endgültig befriedigt. Bedeutet das aber nicht viel eher asketische Abwendung von der Welt, als Offenheit für sie? Diese Folgerung liegt nahe. Sie ist aber falsch, weil gerade die Verbundenheit mit Gott den Menschen wieder in die Welt hineinweist. Das ist jedenfalls die Meinung des biblischen Gedankens der Gottesebenbildlichkeit des Menschen: Die Bestimmung des Menschen zu Gott zeigt sich in seiner Herrschaft über die Welt, als Repräsentant der Weltherrschaft Gottes 1. Uns soll nun die Frage beschäftigen, wie der Mensch zur Herrschaft über die Welt gelangt, indem er sich als das weltoffene Wesen betätigt. Dabei geht es uns nicht nur um die technische Nutzung der Natur. Diese sichtbarste Gestalt menschlicher Herrschaft über die Welt wird ermöglicht durch andere Eigenheiten des menschlichen Verhaltens. Sie verbinden sich zur Entstehung der Sprache, und darum wollen wir die Sprache als erste Haupt- 13
14 form menschlicher Daseinsbewältigung betrachten. Anschließend werden wir einen Blick auf das Ganze menschlicher Kulturtätigkeit werfen und nach der Quelle der schöpferischen Meisterung des Daseins suchen. Dabei müssen wir vorläufig noch davon absehen, daß Sprache und Kultur durch und durch soziale Erscheinungen sind. Dieser Seite der Sache haben wir uns später noch besonders zuzuwenden. Vorläufig geht es nur um den Vorgang der Daseinsbewältigung für sich genommen. Zunächst ist die Situation ins Auge zu fassen, die durch Ausbildung der Sprache gemeistert wird 2. Durch seine Weltoffenheit ist dem Menschen eine viel größere Mannigfaltigkeit von Eindrücken zugänglich als jedem Tier. Solcher Vielfalt stehen die Menschen ursprünglich und faktisch immer wieder hilflos gegenüber. Das ist die Ursituation des Menschen in der Welt, besonders die des Kindes. Darum ist es als erstes nötig, sich zu orientieren, eine Übersicht zu gewinnen. Diese Aufgabe der Orientierung wird nun auf eine sehr bemerkenswerte, für alles menschliche Verhalten charakteristische Weise gelöst: Während die Tiere durch ihre Organe die Eindrücke sozusagen filtern, so daß nur ganz wenige davon ihr Bewußtsein erreichen, vermehrt der Mensch die Vielfalt der Welt noch durch eigene Schöpfungen. Im Umgang mit seiner Umgebung baut er sich immer eine eigene, künstliche Welt auf, um durch sie die Vielfalt der auf ihn einstürmenden Sensationen zu bändigen. Das neugeborene Kind ist noch nicht fähig, sich zu orientieren. Erst in dem Maße wie es lernt, über seine Bewegungen zu verfügen, wird es auch mit seiner Umgebung vertraut. Wenn es mit dem Kopf auf sein Bettgitter schlägt, so bemerkt das Kind dessen schmerzhafte Härte, und es wiederholt diese Bewegung wohl gar, um sich davon recht zu überzeugen. Die Unspezialisiertheit der menschlichen Organe und die in der Weltoffenheit begründete, weitgehende Triebfreiheit seines Verhaltens ermöglichen es dem Menschenkind, seine Bewegungen sehr vielfältig abzuwandeln und miteinander zu kombinieren. Dadurch lernt es seine Umgebung mehr und mehr kennen. Eine große Rolle spielen dabei zunächst die Tastbewegungen. Später bedarf es des Betastens nicht mehr: Man lernt, einem Tisch anzusehen, daß er hart, einer Decke, daß sie weich ist. Das Auge sieht also von den Dingen vieles, was man im Augenblick gar nicht empfindet, wovon man aber weiß, daß man es fühlen könnte, wenn man hinginge, um Tisch oder Decke zu berühren. Je mehr die Erfahrung wächst, desto mehr Zusammenhänge, mögliche Ansichten und Verwendungen werden mit einem Blick erfaßt. So entsteht überhaupt erst die Wahrnehmung von Dingen: Wenn ich einen Apfel sehe, 14
15 dann sehe ich eine Gestalt, eine sinnvolle Verbindung bestimmter Merkmale. Habe ich diese Gestalt einmal erfaßt, dann kann ich mit Leichtigkeit überall wieder Äpfel erkennen, auch wenn sie nur ganz wenig über dem Rand eines Korbes sichtbar werden. Kenne ich die Gestalt eines Hauses, dann weiß ich, wenn ich eine Giebelspitze entdecke: Das ist ein Haus. Das Auge errät aus wenigen Andeutungen das Ganze einer schon bekannten Gestalt, und andererseits repräsentiert ein einziges gesehenes Ding eine Fülle von möglichen Beziehungen und Verwendungen. Das bedeutet, daß unsere Sinneswahrnehmungen weitgehend symbolischen Charakter haben. Wir nehmen viel mehr wahr, als die Sinnesempfindung eigentlich enthält. Durch solche Symbolik der Sinneswahrnehmung wird die Vielfalt der Eindrücke einerseits noch vermehrt, andererseits aber gegliedert und so überschaubar gemacht. Immer größer wird dabei der Kreis bekannter Dinggestalten, schon vertrauter Zusammenhänge, so daß die Aufmerksamkeit für anderes frei wird. Die Anfänge der eben beschriebenen Wahrnehmungswelt sind schon vorausgesetzt, wenn Sprache entstehen soll. Nur ihr Umfang wird durch die Sprache sprunghaft wachsen. Damit Sprache möglich wird, ist jedoch eine zweite Voraussetzung nötig, nämlich die Fähigkeit, verschiedenartige Laute hervorzubringen und zu kombinieren. Wenn ein Baby sich selbst damit beschäftigt, Laute auszustoßen, dann tut es das in der Erwartung, sich zu hören. Den gehörten Laut kann man wiederholen, einüben und mit andern Lauten abwechseln lassen. So erlernt man eine Mehrzahl von Lauten, die dann beliebig verfügbar bleiben. Solche spielerische Lautäußerung, frei von Triebzwang und ganz hingegeben an den wechselnden Klang, den man wunderbarerweise selbst hervorbringt, bereitet die Elemente der sprachlichen Äußerung vor. Die Sprache entsteht, sobald eine mehrfach wiederkehrende Gestalt mit einem besonderen Laut begrüßt wird, mit einem Laut, der fortan dieser Gestalt zugeeignet ist und ihr vorbehalten bleibt. Daß überhaupt ein Wiedererkennen durch Laute sich ausdrückt, erleben wir auch an Tieren, zum Beispiel am Bellen eines Hundes, der seinen Herrn begrüßt. Aber wo ein bestimmter Laut oder eine Lautfolge einer bestimmten Gestalt vorbehalten bleibt, während andere Gestalten durch andere Laute begrüßt werden, da entsteht Sprache. Dieses Ereignis hängt eng zusammen mit der eigentümlichen Sachlichkeit, die der Mensch den ihn umgebenden Dingen entgegenbringt. Sie sind ihm nicht automatisch wirkende Auslöser von Triebzwängen, sondern selbständige Gegenstände, die um ihrer selbst willen Interesse verdienen und wecken. Dar- 15
16 um nimmt der Mensch nun auch seine eigenen Laute, mit denen er eine bekannte Gestalt begrüßt, so wahr, als ob sie von ihr ausgelöst würden. Die Laute werden als diesem Ding, dieser Gestalt zugehörig erfahren. Und nun reizt natürlich die Mannigfaltigkeit der Dinge und Gestalten dazu, immer neue Laute und Lautverbindungen zu bilden, damit ein jedes benannt werden kann. Und umgekehrt wächst eben dadurch das Bewußtsein von der Vielfalt der Wirklichkeit. Lautentwicklung und Welterfahrung steigern einander gegenseitig. Auf diese Weise bilden Kinder ganz spontan Ansätze zu einer eigenen Sprache aus, die sogenannte Kindersprache. Diese Ansätze verschwinden freilich bald wieder; denn da die Erwachsenen ihm Dinge zeigen und die dazugehörigen Wörter vorsprechen, lernt das Kind schnell, sich in der Sprache der Erwachsenen auszudrücken. Die soziale Bedingtheit der Sprachbildung wird daraus sichtbar. Überhaupt bildet ja wohl die Mitteilung den Hauptreiz, der zur Aneignung einer Vielzahl von Wörtern führt. Das Vergnügen an der Mitteilung der eigenen Erfahrungen und Wünsche an andere regt die weitere Ausgestaltung der Sprache an. Mit alledem haben wir die Entstehung der Sprache erst, soweit sie Dingwörter bildet, in den Blick genommen. Für alle weitere Sprachgestaltung ist es aber wichtig, daß neben Dingwörtern auch Tätigkeitswörter gebildet werden können. Sie haben einen eigenen Ursprung. Kinder begleiten ihr Tun vielfach mit einer Art Musik, mit Lauten, die dann auch dazu dienen können, die betreffende Tätigkeit zu bezeichnen oder in Gang zu bringen. Ein Laut nämlich, der wiederholt eine bestimmte Folge hat, wird zum Ruf. Solche ein Tun begleitenden oder auch in Gang bringenden Laute und Lautfolgen wie dada für Spazierengehen oder happa für Essen, sind die Wurzel des Tätigkeitswortes. Freilich sind das Wiedererkennen eines Dinges oder einer Gestalt und die Bezeichnung einer Tätigkeit keineswegs von Anfang an säuberlich getrennt. Der Ruf happa meint ja nicht nur den Vorgang des Essens, sondern auch die Nahrung selbst und wird durch ihren Anblick ausgelöst. Erst mit der Entstehung des Satzes tritt eine endgültige Scheidung zwischen Dingwort und Tätigkeitswort ein: Im Satz werden sie unterschieden, um nur zusammen ein Ganzes zu bilden. Ursprünglich kann jedes einzelne Wort den Charakter eines Satzes haben. Der Sinn ist dann aber nur deutlich durch die Situation, in die das Wort hineingeworfen wird. So ist der Ausruf: Blitz! verständlich, wenn gerade ein Gewitter niedergeht. Man wird daraufhin den Kopf wenden, um das Zucken des Blitzes zu sehen. Wenn jedoch die Luft gewitterfrei ist, dann 16
17 bildet das Wort Blitz für sich allein keine eindeutige Aussage. Man muß dann zum Mehrwortsatz greifen und etwa sagen: Gestern sah ich einen starken Blitz. Der Satz beschreibt eine einzige Erscheinung durch mehrere Wörter. Das ist möglich, weil jedes Ding ja schon verschiedene Züge enthält, wie wir vorhin im Blick auf den Symbolcharakter der Wahrnehmungen bemerkten. Der Satz zählt aber nun nicht nur Eigenschaften eines Dinges nacheinander auf, sondern die Verbindung von Tätigkeitswort und Dingwort gestattet es sogar, die Abfolge der Wörter als eine von der Sache selbst her gebotene Reihenfolge erscheinen zu lassen. Etwa: Der Blitz leuchtet. Der Fortgang von Blitz zu leuchtet gibt die Bewegung der Sache selbst wieder, nicht nur die Bewegung unseres Sprechens. Der Verbalsatz bringt die Dynamik der Wirklichkeit in ihrer Sachlichkeit, ihrer Objektivität, als vom Redenden unabhängiges Geschehen zur Sprache. Wir können die weitere Ausbildung der Sprache, die auch bei den Sprachen der verschiedenen Völker sehr unterschiedlich verlaufen ist, jetzt nicht im einzelnen verfolgen. Die Sprachen verfeinern sich. Je mehr die Aufgaben der Wörter im Satz gesondert und auf eigene Wortformen verteilt werden, desto genauer kann die Sprache einen Sachverhalt ohne Rücksicht auf die Situation des Redenden zum Ausdruck bringen. So entwickeln viele Sprachen reiche Flexionsformen. Dadurch verliert freilich das Einzelwort seine Selbständigkeit. Das flektierte Wort ist nur noch ein unselbständiges Element, das ohne Beziehung auf ein entsprechendes anderes Wort sinnlos wäre. Das Schwergewicht der Aussage verschiebt sich immer mehr von den Einzelwörtern auf das Gefüge des Satzes. Und der Satz selbst erweitert sich. Er wird zu einem Gefüge nicht mehr bloß von Einzelwörtern, sondern von ganzen Wortfolgen, von Haupt- und Nebensätzen. So bildet die Sprache sich immer mehr zu einem System von Beziehungen aus, und je weiter damit die Zusammenhänge werden, die sie formulieren kann, desto genauer läßt sich ein Sachverhalt wiedergeben. Dabei schleifen sich im Laufe der Zeit die Konturen der Wörter ab. Sie verlieren wieder den Formenreichtum. Die Wortstellung im Satz und die Folge der Sätze selbst läßt nun den Zusammenhang erfassen, der zum Ausdruck gebracht werden soll. Gerade die letzten Erwägungen machen den Dienst deutlich, den die Sprache dem Menschen leistet. Der Mensch spinnt gleichsam ein Netz von Wörtern und Wortbeziehungen, um dadurch den Zusammenhang des Verschiedenen in der Wirklichkeit darzustellen. Er fängt die zunächst verworren erscheinende Mannigfaltig- 17
18 keit in das Netz einer selbstgeschaffenen Symbolwelt ein 2a. Er wird der Welt Herr durch eine künstliche Welt, die er zwischen sich selbst und seiner Umgebung ausspannt. Vor allem ist dabei der Überblick wichtig, den die Sprache vermittelt. Schon das einzelne Wort vertritt eine komplizierte Fülle von Wahrnehmungen. Und weil der Mensch ein erlerntes Wort nach Belieben wiederholen kann, so vermag er sich das entsprechende Gedächtnisbild beliebig ins Bewußtsein zu rufen, sich das Ding vorzustellen. Erst durch die Sprache entsteht die bunte Innenwelt des Bewußtseins, die Welt der Vorstellungen, die auch ohne äußeren Gegenstand herbeigeholt werden können. Auch wenn das lautlos geschieht, ist die Fähigkeit zur Sprache immer vorausgesetzt, wo Vorstellungen uns beschäftigen. Ohne Sprache gäbe es kein lautloses Denken in Vorstellungsbildern, keine Innenwelt des Bewußtseins. Man kann sich davon überzeugen, wenn man bedenkt, daß jeder Mensch in seiner Sprache denkt und träumt. So verdanken wir der Sprache erst den weiten geistigen Überblick über den jeweils gegenwärtigen Moment hinaus. Darum vermag der Mensch die Dinge in ihren weiteren Zusammenhängen zu erfassen und sie von den Zusammenhängen her, in denen sie von sich aus stehen, zu beherrschen. Das bedeutet aber, daß jeder zielstrebige, planvolle Umgang mit Dingen Sprache voraussetzt, vielleicht abgesehen von ganz bescheidenen Ansätzen. Eine zielbewußte Zusammenschau setzt nämlich immer schon eine weite Übersicht voraus, die Übersicht nicht nur über die wahrgenommenen Dinge und deren Zusammenhänge, sondern auch über die Vielzahl geübter und also verfügbarer eigener Bewegungen für den Umgang mit ihnen. Und solche Übersicht wird erst durch die Sprache erworben. Denn die Sprache ermöglicht es, wie gesagt, ganze Zusammenhänge durch Vorstellung ins Bewußtsein zu holen. Damit ist bereits die Bedeutung der Sprache für die Kulturtätigkeit im weitesten Sinne berührt. Kultur bedeutet ursprünglich Ackerkultur. Die materielle Kultur umfaßt dann auch Handwerk und Industrie. Alle materielle Kultur beruht auf planvollem, zwecktätigem Umgang mit den Dingen unserer Umgebung. Daher wäre sie ohne Sprache nicht möglich. Die Kultur ist in ihrer Struktur der Sprache, die selbst eines ihrer Elemente ist, eng verwandt: Wie in der Sprache, so schafft der Mensch auch in der Kultur eine künstliche Welt, um sich dadurch die Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen verfügbar zu machen. Aber die künstliche Welt der Sprache ist nur eine Symbolwelt. Sie verkörpert sich in Lauten und allenfalls durch die Schrift. Die Sprache verändert nicht die Dinge um uns herum. 18
19 Eben das geschieht durch die Kultur. Durch sie baut der Mensch sich eine künstliche Welt, indem er die Dinge so verwandelt, daß sie besser der Befriedigung seiner Bedürfnisse dienen. Nun können aber die menschlichen Bedürfnisse sich ändern, da ja ihr Inhalt nicht festliegt, sondern vom Menschen selbst erdacht werden muß. Mit den Bedürfnissen der Menschen aber muß sich das ganze System der materiellen Kultur ebenfalls ändern. Davon muß in einem späteren Vortrag noch ausführlich die Rede sein. Zunächst will ich nur hervorheben, daß das Wesen des Menschen, seine radikale Offenheit, ihn nötigt, neben der materiellen Kultur immer auch eine Geisteskultur auszubilden. Die Bedürfnisse des Menschen gehen eben immer hinaus über alles, was er an materiellen Gütern erlangen kann. Ja, seine Bedürfnisse übersteigen alles, was er zu ihrer Befriedigung planen und ersinnen kann. Die Bedürfnisse, die durch materielle Produkte nicht zu befriedigen sind, gewinnen eben dadurch den Charakter geistiger Bedürfnisse, deren Unendlichkeit durch Gebilde der Phantasie in Worten und Tönen, in Zeichnung und Farbe, in Stein und Erz vorgestellt wird. Die Geisteskultur hat es daher immer mit der unendlichen Bestimmung des Menschen zu tun, vor allem in Kunst und Religion, aber auch in den Ideen des Rechtes und der Sittlichkeit. Wir halten inne und blicken zurück: In der Ausbildung der Sprache fanden wir sowohl das Grundelement als auch das Modell menschlicher Kulturtätigkeit. Wir sahen, wie der Mensch schöpferisch seine eigene Welt erzeugt, um mit der verworrenen Vielfalt, die ihn umgibt, fertig zu werden: In der Sprache ein Netz von Lauten und Lautfolgen, das die Wirklichkeit repräsentiert und Mitteilung ermöglicht, in der materiellen Kultur ein System zur Bearbeitung der Naturdinge, damit sie den Bedürfnissen der Menschen gefügig werden. Wir können nun die Frage stellen: Welche Kraft befähigt eigentlich zu solchen schöpferischen Leistungen? Gewiß wirkt hier vieles zusammen. Entscheidend aber ist die Macht der Phantasie. Sie bildet den schöpferischen Grundzug im menschlichen Verhalten 8. Schon in den spielenden Bewegungen des kleinen Kindes drückt sich Phantasie aus; denn das Kind wächst nicht nur in artgemäße Bewegungsformen hinein, wie die Jungtiere, sondern es wandelt seine Bewegungen frei ab. Und ebenso wandelt es im Lallen seine Laute ab. Auch dieser für die Sprache grundlegende Vorgang ist ein Phantasieakt. Im menschlichen Verhalten gewinnt die Phantasie deshalb so breiten Raum, weil der Mensch nicht frühzeitig durch Instinkte in eine arttypisch festliegende Richtung gedrängt wird. Menschliches Ver- 19
20 halten behält etwas Zwecklos-Freies, Spielerisches, soweit die Menschen es nicht selbstgesetzten Zielen unterwerfen. Und wer sein Verhalten zu sehr in der Verfolgung von Zwecken aufgehen läßt, so daß dem freien Spiel der Phantasie gar kein Raum mehr bleibt, der verkümmert und verliert seine Spannkraft. Im menschlichen Verhalten, sofern es schöpferisch ist, kommt der Phantasie diejenige Schlüsselstellung zu, die bei den Tieren die Instinkte innehaben. Wie Bewegungen und Lautbildung, so ist auch die menschliche Wahrnehmung von Grund auf phantasievoll. Die Gestalten, die wir in der Welt wahrnehmen, springen ins Auge durch eine sinnvolle Verbindung einiger Hauptmerkmale. Die menschlichen Sinne sind aber nicht wie die der Tiere von Natur aus auf bestimmte Merkmale spezialisiert und auf die Wahrnehmung bestimmter Strukturen angelegt, sondern der Mensch entdeckt schöpferisch immer neue Formen, Strukturen, Gestalten im vorher scheinbar Zusammenhanglosen. Das ist eine Leistung der Phantasie, auch wenn die einmal gesehene Struktur nachträglich gelernt werden kann und sich vielleicht immer wieder als sachgemäß, als ein passendes Modell bewährt. Die Strukturen und Gestalten, die wir erfassen, haben ja immer etwas vom Modell an sich; sie enthalten nur einen Umriß, wie eine Karikatur, nie die Gesamtheit aller Einzelzüge. Es hängt oft sehr vom Gesichtspunkt ab, den man wählt, wie die Einzelzüge sich zur Gestalt zusammenordnen. Das zeigt sich in der Mannigfaltigkeit der Sprachen. Da sind nicht nur die Vokabeln verschieden. Wie anders wird oft ein und dieselbe Sache von zwei Sprachen aufgefaßt! Der Geist der Sprachen ist verschieden. Sie drücken verschiedene Perspektiven der Wirklichkeit aus. Daran zeigt sich, daß die Sprache nicht mechanisch gegebene Verhältnisse abbildet, sondern daß ihr ein schöpferisches Element innewohnt. Ist nicht auch die Zusammenfassung ähnlicher Züge zum Allgemeinbegriff ein Akt der Phantasie? Gerade durch Gebilde der Phantasie, die sich nachträglich als sachgerecht bewähren, erschließt sich der Zugang zur Wirklichkeit. Das zeigt der Vollzug wissenschaftlicher Erkenntnis. Jede weiterführende wissenschaftliche Einsicht, ob in der Mathematik, in der Geschichtsforschung oder in den Naturwissenschaften, beginnt mit einem Einfall, mit einem Phantasieereignis. Zwar entscheidet erst die anschließende Prüfung darüber, ob der Einfall eine Erkenntnis ist oder nicht. Aber ohne Einfälle gibt es keine wissenschaftliche Erkenntnis. Und die Wissenschaft vollzieht dabei nur mit methodischem Bewußtsein das, was schon in aller alltäglichen Wahrnehmung und Erkenntnis geschieht. 20
21 Welche Bedeutung Erfindung und Phantasie für die Technik und überhaupt für das praktische Leben haben, ist zu bekannt, als daß wir uns eigens dabei aufhalten wollen. Erst recht gilt das von den Vorstellungen, die der Mensch von seiner unendlichen Bestimmung bildet, besonders in den Künsten. Der Hinweis darauf mag genügen, um das Bild von der Bedeutung der Phantasie im menschlichen Verhalten abzurunden. Was Phantasie eigentlich ist, das liegt noch weitgehend im Dunkel. Grundlegend ist wohl nicht so sehr das bekannte Erlebnis eines Stromes von Bildern 4, als vielmehr die Fähigkeit, sich aus der eigenen Situation zu lösen und sich in eine beliebige andere Lage hineinzuversetzen 5. Insofern ist es zum Beispiel Aufgabe der Phantasie, einen anderen Menschen zu verstehen; denn zum Verstehen ist nicht so sehr eine innere Verwandtschaft erforderlich, wie man vielfach meint, als vielmehr die Fähigkeit, sich in den andern hineinzudenken. Dieses Sichlösen aus der eigenen Situation enthält auch schon das Moment des Neuen, Schöpferischen, ein Zug, der für echte Phantasietätigkeit bezeichnend ist. Zwar bringt die Phantasie als Quelle des Vorstellungslebens auch den Gedächtnisinhalt ans Licht, aber sie wiederholt doch nie nur Gewesenes, sondern entdeckt immer schöpferisch etwas Neues. Das hängt gewiß mit der eigentümlich menschlichen Offenheit für die Zukunft zusammen 6. Nur der Mensch kann die Zukunft als Zukunft, als noch nicht gegenwärtig erleben. Diese Offenheit für die Zukunft ergibt sich aus der Weltoffenheit, aus der weitgehenden Freiheit des Menschen vom unmittelbaren Triebdruck, und darin ist auch die Fähigkeit der Phantasie, sich von der eigenen Situation zu lösen und Neues vorwegzunehmen, begründet. Sehr eigenartig ist nun der Umstand, daß die Phantasie als die am entschiedensten schöpferische Tätigkeit des Menschen zugleich einen passiven Zug hat: Echte Einfälle kann man nicht hervorrufen. Durch diese Passivität ist das Phantasieleben der Aktivität des logischen Denkens entgegengesetzt. Die Phantasie ist nicht von sich aus folgerichtig, sondern sie äußert sich in einer lockeren Folge von Einfällen, die der phantasierende Mensch mehr empfängt als hervorbringt. Aber woher kommen die Einfälle? Man wird vermuten dürfen, daß die Phantasie es in besonderer Weise mit der unendlichen Offenheit des Menschen zu tun hat. Das bedeutet aber: Durch die Phantasie empfängt der Mensch sich in seiner Innerlichkeit von Gott. Das bedeutet allerdings auch, daß das Phantasieleben besonders von der Verkehrung zum Bösen betroffen wird. 21
22 Das schöpferische Wesen der Phantasie ist bis in neuere Zeit hinein verkannt worden. Es ist sehr bezeichnend, daß die Griechen zwischen Phantasie und Gedächtnis nicht unterschieden haben. Ihnen fehlte der Blick für das Schöpferische, das je Neue in der Welt wie im Menschen. Erst unter dem Einfluß des biblischen Wissens von Gottes allmächtigem Geschichtshandeln wurde der Blick dafür frei. Das Schöpferische der Phantasie entspricht dem Neuen, Unvorhersehbaren im äußeren Geschehen. Trotzdem blieb es für das abendländische Denken noch lange verborgen, daß Gott wie in der äußeren Geschichte, so auch in der Innerlichkeit der Menschen unablässig Neues wirkt, und daß der Mensch gerade in seinem Schöpfertum zugleich ganz und gar ein Empfangender ist. Daß der Mensch Schöpfer seiner Welt ist, das ist in der Neuzeit zur allgemeinen Überzeugung geworden. Es fragt sich nur, wie er die künstliche Welt seiner Sprache und Kultur hervorbringt. Der deutsche Idealismus sah die Herrschaft des Menschen über die Welt in der Macht der logischen Vernunft begründet. Er verschloß sich dadurch dem Zufallscharakter des Geschehens und der Offenheit des Zukünftigen. Im 19. Jahrhundert finden sich aber auch Ansätze zu einer Anthropologie, die der Phantasie die führende Rolle im menschlichen Verhalten zuerkennt 7. Konsequent durchdacht ergäbe sich von das aus ein Verständnis des menschlichen Schöpfertums, das nicht nur dem Zufallscharakter des Geschehens Rechnung trägt, sondern auch den demütigen Empfang von Einfällen als die Quelle der schöpferischen Kraft des Menschen erkennt. So erscheint Gott nicht nur als das Ziel des weltoffenen Strebens, sondern auch als der Ursprung der schöpferischen Meisterung der Welt durch den Menschen. 3. SICHERUNG STATT VERTRAUEN? Das Leben wird den Menschen täglich neu zur Aufgabe. Es muß immer wieder bewältigt werden. Durch diese Aufgabe sind die Menschen unablässig in Atem gehalten, und sie suchen ihr gerecht zu werden, indem sie nach möglichst weitgehender Verfügung über die sie umgebende Wirklichkeit streben. Das ist ein Zug, der schon das menschliche Wahrnehmen kennzeichnet und vollends die Ausbildung von Sprache und Kultur. In der technischen Sicherung der Lebensbedingungen gipfelt solches Streben in besonders sichtbarer Weise, und zwar nicht erst in der modernen naturwissenschaftlichen Technik, sondern schon in den magischen 22
23 Praktiken archaischer Völker kommt ein ähnlicher Wille zum Ausdruck. Man hat oft versucht, das Werden kultureller Lebensgestaltung ganz aus der Einstellung der Menschen auf Verfügbarmachung, Sicherung, Beherrschung der Wirklichkeit verständlich zu machen. Doch derartige Versuche sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie nur einen Aspekt des menschlichen Verhaltens in den Blick gelangen lassen. Der Mensch ist immer wieder auch zu ganz andersartigem Verhalten gezwungen. Niemand kann ganz aufgehen im Sorgen und Besorgen der Daseinsbedingungen, weil niemand damit zu Ende kommt. Jeder muß darüber hinaus vertrauen, und zwar immer wieder, in jedem Augenblick. Ohne zu vertrauen, kann niemand leben. Darin zeigt sich wieder, daß die Weltoffenheit des Menschen nicht nur seine schöpferische Fähigkeit zu immer weiter ausgreifenden Daseinsentwürfen bedeutet. Der Mensch als weltoffenes Wesen ist immer auch angewiesen auf das in jeder Situation undurchschaut bleibende Ganze der begegnenden Wirklichkeit. Diese Angewiesenheit übergreift sogar die schöpferische Daseinsbewältigung selbst, sofern diese auf Einfälle angewiesen bleibt. Als ganze bleibt die Wirklichkeit, auf die hin wir leben, immer unbekannt, und von daher kann auch das einzelne, auf das wir uns einzurichten wissen, immer einmal anders ausgehen als wir vorhersehen. Darum müssen wir vertrauen. Denn zum Unbekannten, auf das wir doch angewiesen sind, können wir nur durch Vertrauen ein Verhältnis gewinnen. Im Akt des Vertrauens gibt einer sich selbst zumindest in bestimmter Hinsicht dem preis, worauf er sein Vertrauen setzt. Der Vertrauende verläßt sich selbst in ganz buchstäblichem Sinne. Er verläßt sich auf die Treue dessen, dem er vertraut, auf seine Beständigkeit: daß der Mensch oder das Ding, dem man vertraut, sich in Zukunft als das erweist, was ich jetzt von ihm erwarte. Darauf verläßt sich der Vertrauende. Er hat fortan in dieser Hinsicht keine Gewalt mehr über sich selbst, sondern bei dem, dem er sich anvertraut hat, liegt nun die Entscheidung über Wohl oder Wehe, je nachdem, ob das Vertrauen gerechtfertigt oder enttäuscht wird. Durch Vertrauen wagt der Mensch sich an das Unbekannte. Zwar greift er nicht ins gänzlich Ungewisse. Das, worauf ich vertraue, muß durch Erfahrung bekannt sein, sonst ist Vertrauen gar nicht möglich. Und es muß sich durch gemachte Erfahrungen als vertrauenswürdig erwiesen haben; sonst wäre es blanker Leichtsinn, sich darauf zu verlassen. Aber dennoch ist es nicht einfach selbstverständlich, daß das Vertrauen gerechtfertigt wird. Insofern 23
WOLFHART PANNENBERG. Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie. Siebte Auflage V&R
 WOLFHART PANNENBERG Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie Siebte Auflage V&R VANDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN Wolfhart Pannenberg Geb. 1928 in Stettin. Studium
WOLFHART PANNENBERG Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie Siebte Auflage V&R VANDENHOECK & RUPRECHT IN GÖTTINGEN Wolfhart Pannenberg Geb. 1928 in Stettin. Studium
Die Frage nach der Existenz Gottes
 Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Lieferung 12 Hilfsgerüst zum Thema: Die Frage nach der Existenz Gottes Die letzte Vorlesung des Semesters findet am 19. Juli 2013 statt. 1. Vorbemerkungen An sich ist die Existenz Gottes selbstevident
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE
 Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG
Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Offenbarung 21, 1-5 Ewigkeitssonntag
 Predigt zu Offenbarung 21, 1-5 Ewigkeitssonntag 2010 1 Ihr Lieben, Ewigkeit leuchtet auf das ist unsere Hoffnung für den Tag heute. Dieser Tag heute trägt ja zwei Namen. Totensonntag und Ewigkeitssonntag.
Predigt zu Offenbarung 21, 1-5 Ewigkeitssonntag 2010 1 Ihr Lieben, Ewigkeit leuchtet auf das ist unsere Hoffnung für den Tag heute. Dieser Tag heute trägt ja zwei Namen. Totensonntag und Ewigkeitssonntag.
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz
 Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Carl Friedrich von Weizsäcker Die Tragweite der Wissenschaft
 Lieferung 2 Hilfsfragen zur Lektüre von: Carl Friedrich von Weizsäcker Die Tragweite der Wissenschaft Schöpfung und Weltentstehung. Die Geschichte zweier Begriffe SIEBTE VORLESUNG: Descartes, Newton, Leibniz,
Lieferung 2 Hilfsfragen zur Lektüre von: Carl Friedrich von Weizsäcker Die Tragweite der Wissenschaft Schöpfung und Weltentstehung. Die Geschichte zweier Begriffe SIEBTE VORLESUNG: Descartes, Newton, Leibniz,
Von der Besinnung und dem Verstand
 Das elfte Buch Hermetis Trismegisti Rede an Asclepium Von der Besinnung und dem Verstand estern, lieber Asclepi! habe ich eine vollkommene Rede geführt, jetzt halte ich nötig, solches zu verfolgen und
Das elfte Buch Hermetis Trismegisti Rede an Asclepium Von der Besinnung und dem Verstand estern, lieber Asclepi! habe ich eine vollkommene Rede geführt, jetzt halte ich nötig, solches zu verfolgen und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Das Menschenbild im Koran
 Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
Was ist Gott? Das Buch der Philosophen Das Buch der Kinderphilosophen
 Was ist Gott? Das Buch der Philosophen Das Buch der Kinderphilosophen Die weisesten Philosophen der Welt waren einmal über lange Zeit versammelt und redeten über alle großen Fragen der Menschheit. Sie
Was ist Gott? Das Buch der Philosophen Das Buch der Kinderphilosophen Die weisesten Philosophen der Welt waren einmal über lange Zeit versammelt und redeten über alle großen Fragen der Menschheit. Sie
ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS
 ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 8, August 1919 (GA 24, S. 48-52) Sozialistisch
ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 8, August 1919 (GA 24, S. 48-52) Sozialistisch
Du bist Teil seiner Geschichte
 Hans-Joachim Eckstein Du bist Teil seiner Geschichte Das Geheimnis des Glaubens Allein durch Glauben! Die einzigartige Bedeutung des Glaubens Ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Ein Glaube
Hans-Joachim Eckstein Du bist Teil seiner Geschichte Das Geheimnis des Glaubens Allein durch Glauben! Die einzigartige Bedeutung des Glaubens Ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Ein Glaube
Wahrheit individuell wahr, doch die Art, wie wir das, was wir wahrnehmen, rechtfertigen und erklären, ist nicht die Wahrheit es ist eine Geschichte.
 Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Was ist Wahrheit Jeder Mensch ist ein Künstler, und unsere größte Kunst ist das Leben. Wir Menschen erfahren das Leben und versuchen, den Sinn des Lebens zu verstehen, indem wir unsere Wahrnehmung durch
Platons Symposion. Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros. Hilfsfragen zur Lektüre von: Sechste Lieferung
 Hilfsfragen zur Lektüre von: Platons Symposion Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros 201 D 212 C Sechste Lieferung [1] Woher hat Sokrates seine Kenntnisse
Hilfsfragen zur Lektüre von: Platons Symposion Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros 201 D 212 C Sechste Lieferung [1] Woher hat Sokrates seine Kenntnisse
Der Zeigefinger von uns Menschen, der aktive Zeigefinger ist ein Ausdruck von Dynamik und Lebenswillen!
 Liebe Gemeinde, er hat es in sich! In ihm steckt eine ganz besondere Kraft! Wenn er sich meldet, dann kommt der starke und mächtige Wille wirklich zum Zuge! Wenn er in die Höhe schnellt, dann erzeugt das
Liebe Gemeinde, er hat es in sich! In ihm steckt eine ganz besondere Kraft! Wenn er sich meldet, dann kommt der starke und mächtige Wille wirklich zum Zuge! Wenn er in die Höhe schnellt, dann erzeugt das
A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)
 A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
KULTURSCHÖPFER:. - "RÜCKSCHRITT" UND "FORTSCHRITT" FINDEN IHREN SINN "IN DER BEOBACHTUNG EINER SICH STETS VERÄNDERNDEN EINHEIT - DER ZEIT.
 KULTURSCHÖPFER:. - "RÜCKSCHRITT" UND "FORTSCHRITT" FINDEN IHREN SINN "IN DER BEOBACHTUNG EINER SICH STETS VERÄNDERNDEN EINHEIT - DER ZEIT. - "DIE ZEIT" VERÄNDERT SICH DESHALB BESTÄNDIG, WEIL "IHR FLUSS
KULTURSCHÖPFER:. - "RÜCKSCHRITT" UND "FORTSCHRITT" FINDEN IHREN SINN "IN DER BEOBACHTUNG EINER SICH STETS VERÄNDERNDEN EINHEIT - DER ZEIT. - "DIE ZEIT" VERÄNDERT SICH DESHALB BESTÄNDIG, WEIL "IHR FLUSS
"MENSCH SEIN": Umso selbstverständlicher Uns ein Umstand erscheint, -desto schwerer ist es, Ihn zu hinterfragen...
 "MENSCH SEIN": Umso selbstverständlicher Uns ein Umstand erscheint, -desto schwerer ist es, Ihn zu hinterfragen... Und umso klarer es für Uns ist, "was wir sind", -desto weniger Gründe suchen wir, es zu
"MENSCH SEIN": Umso selbstverständlicher Uns ein Umstand erscheint, -desto schwerer ist es, Ihn zu hinterfragen... Und umso klarer es für Uns ist, "was wir sind", -desto weniger Gründe suchen wir, es zu
Predigt Matthäus 5,8 Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen (Zeichnung von Vivien)
 Predigt Matthäus 5,8 Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag haben Lea, Eike und Vivien davon erzählt, wie Gott ihr Herz berührt hat. Was Jesus für euch getan hat, ist euch im wahrsten Sinne des Wortes
Predigt Matthäus 5,8 Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag haben Lea, Eike und Vivien davon erzählt, wie Gott ihr Herz berührt hat. Was Jesus für euch getan hat, ist euch im wahrsten Sinne des Wortes
2.2.1 Werteorientierung und Religiosität
 2.2.1 Werteorientierung und Religiosität Religion im Alltag des Kindergartens Unser Verständnis von Religion Wenn wir von Religion im Alltag des Kindergartens sprechen, ist zunächst unser Verständnis von
2.2.1 Werteorientierung und Religiosität Religion im Alltag des Kindergartens Unser Verständnis von Religion Wenn wir von Religion im Alltag des Kindergartens sprechen, ist zunächst unser Verständnis von
Predigt zu Philipper 4, 4-7
 Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Predigt zu Philipper 4, 4-7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allem
Sei dankbar, dass du bist! Eine Meditation zur Ermutigung
 Sei dankbar, dass du bist! Eine Meditation zur Ermutigung Die Meditation "Sei dankbar, dass Du bist" geht auf ein Manuskript aus dem Jahr 1982 zurück. Sei dankbar, dass Du bist! - Eine Meditation zur Ermutigung
Sei dankbar, dass du bist! Eine Meditation zur Ermutigung Die Meditation "Sei dankbar, dass Du bist" geht auf ein Manuskript aus dem Jahr 1982 zurück. Sei dankbar, dass Du bist! - Eine Meditation zur Ermutigung
Domvikar Michael Bredeck Paderborn
 1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
1 Domvikar Michael Bredeck Paderborn Das Geistliche Wort Entdeckungsreise zu Jesus Christus Sonntag, 20.02. 2011 8.05 Uhr 8.20 Uhr, WDR 5 [Jingel] Das Geistliche Wort Heute mit Michael Bredeck. Ich bin
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 12/14 Gott hat dir bereits alles geschenkt. Was erwartest du von Gott, was soll er für dich tun? Brauchst du Heilung? Bist du in finanzieller Not? Hast du zwischenmenschliche
an Kontakt. Manche von euch sind im Inneren richtig verkümmert. Selbst wenn dir Materielles genommen wird, kannst du nur gewinnen.
 Das Wesentliche Die Geschehnisse dieser Zeit sind ein Regulativ, um alles, was ausgeufert ist, wieder zum Ursprung zurückzuführen. Eure Illusionen werden enttarnt, damit ihr erkennt, was wesentlich ist.
Das Wesentliche Die Geschehnisse dieser Zeit sind ein Regulativ, um alles, was ausgeufert ist, wieder zum Ursprung zurückzuführen. Eure Illusionen werden enttarnt, damit ihr erkennt, was wesentlich ist.
Christoph Dohmen Die Bibel und ihre Auslegung
 Unverkäufliche Leseprobe Christoph Dohmen Die Bibel und ihre Auslegung 116 Seiten, Paperback ISBN: 978-3-406-43299-6 Verlag C.H.Beck ohg, München Zur Einführung Direkt oder indirekt begegnet uns die Bibel
Unverkäufliche Leseprobe Christoph Dohmen Die Bibel und ihre Auslegung 116 Seiten, Paperback ISBN: 978-3-406-43299-6 Verlag C.H.Beck ohg, München Zur Einführung Direkt oder indirekt begegnet uns die Bibel
Leseprobe aus: Ein Garten aus Gedanken von Louise Hay. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten.
 Leseprobe aus: Ein Garten aus Gedanken von Louise Hay. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier geht s zum Buch >> Ein Garten aus Gedanken Dieses Buch soll
Leseprobe aus: Ein Garten aus Gedanken von Louise Hay. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier geht s zum Buch >> Ein Garten aus Gedanken Dieses Buch soll
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen
 Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff
 Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
Evangelische Religionspädagogik, Religion
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere
 Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Nervensystem Gliederung des Nervensystems der Wirbeltiere Aufgaben Welche Aufgaben erfüllt das Nervensystem? - Welche Vorgänge laufen bei einer Reaktion ab? - Was ist das Ziel der Regulation? - Was ist
Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die
 92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
angesichts all der Vertrauenskrisen in ihrem persönlichen und im öffentlichen Leben. ANNE & NIKOLAUS SCHNEIDER
 Vertrauen lehrt Menschen, das Leben zu lieben und das Sterben getrost in Gottes Hände zu legen. Und zugleich ist das Dennoch-Vertrauen eine unersetzbare Lebensader für eine menschenfreundliche Politik
Vertrauen lehrt Menschen, das Leben zu lieben und das Sterben getrost in Gottes Hände zu legen. Und zugleich ist das Dennoch-Vertrauen eine unersetzbare Lebensader für eine menschenfreundliche Politik
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Da schreibt jemand: Ist das noch dieselbe Straße, die ich
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Da schreibt jemand: Ist das noch dieselbe Straße, die ich
Weinfelder. Predigt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Juni 2016 Nr Römer 8,38-39
 Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Weinfelder Juni 2016 Nr. 777 Predigt Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes Römer 8,38-39 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 27. Juni 2016 Römer 8,38-39 Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Mensc
 Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen und Menschen,
Advent Advent feiern heißt warten können. Warten kann nicht jeder: nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen und Menschen,
Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere.
 Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Geisteswissenschaft. Carolin Wiechert. Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen.
 Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Geisteswissenschaft Carolin Wiechert Was ist Sprache? Über Walter Benjamins Text Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen Essay Veranstaltung: W. Benjamin: Über das Programm der kommenden
Eigenschaften der Seele
 Eigenschaften der Seele Auszug aus dem Buch Die Weisheit der erwachten Seele von Sant Rajinder Singh In uns befinden sich Reichtümer, großartiger als alles, was wir in dieser Welt anhäufen können. Wir
Eigenschaften der Seele Auszug aus dem Buch Die Weisheit der erwachten Seele von Sant Rajinder Singh In uns befinden sich Reichtümer, großartiger als alles, was wir in dieser Welt anhäufen können. Wir
Entscheide dich für das Licht
 Entscheide dich für das Licht Wir Menschen haben einen freien Willen und können jederzeit selbst entscheiden, ob wir Licht oder Schatten in unser Leben und in das Leben der anderen bringen. Ein Sprichwort
Entscheide dich für das Licht Wir Menschen haben einen freien Willen und können jederzeit selbst entscheiden, ob wir Licht oder Schatten in unser Leben und in das Leben der anderen bringen. Ein Sprichwort
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING LUDWIGSHAFEN
 KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
Glaube kann man nicht erklären!
 Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Glaube kann man nicht erklären! Es gab mal einen Mann, der sehr eifrig im Lernen war. Er hatte von einem anderen Mann gehört, der viele Wunderzeichen wirkte. Darüber wollte er mehr wissen, so suchte er
Wie real ist die unsichtbare Wirklichkeit?
 Wie real ist die unsichtbare Wirklichkeit? Der Verstand ist auf das Naturgegebene begrenzt 1.Korinther 1,21 Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt.
Wie real ist die unsichtbare Wirklichkeit? Der Verstand ist auf das Naturgegebene begrenzt 1.Korinther 1,21 Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt.
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften?
 Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
VL März 2012 R Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12
 VL 4 12. März 2012 R.3.119 Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12 1 Der Mensch als moralisches Wesen 2 1. Der Mensch als moralisches Wesen: Aristoteles Die staatliche Gemeinschaft (besteht) der tugendhaften
VL 4 12. März 2012 R.3.119 Was ist der Mensch? Andreas Brenner FS 12 1 Der Mensch als moralisches Wesen 2 1. Der Mensch als moralisches Wesen: Aristoteles Die staatliche Gemeinschaft (besteht) der tugendhaften
t r a n s p o s i t i o n e n
 t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
Anthropologische Grundlagen
 Anthropologische Grundlagen Kind ist Geschöpf Gottes es hat das Recht auf sein selbst, Anspruch auf Liebe Teil des Kosmos "Baumeister seiner selbst", wenn der Erwachsene es zulässt Kind hat Anspruch auf
Anthropologische Grundlagen Kind ist Geschöpf Gottes es hat das Recht auf sein selbst, Anspruch auf Liebe Teil des Kosmos "Baumeister seiner selbst", wenn der Erwachsene es zulässt Kind hat Anspruch auf
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel. Sitzung vom 1. November 2004
 Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Leitbild der Kita St. Elisabeth
 Leitbild der Kita St. Elisabeth Unser Christliches Menschenbild Die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die biblische Offenbarung und die Überlieferung durch die Kirche. Wir Menschen sind Geschöpfe
Leitbild der Kita St. Elisabeth Unser Christliches Menschenbild Die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die biblische Offenbarung und die Überlieferung durch die Kirche. Wir Menschen sind Geschöpfe
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Alle W e l t redet von F r i e d e n... So heisst das Thema der heutigen Predigt.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Alle W e l t redet von F r i e d e n... So heisst das Thema der heutigen Predigt.
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 22 Walter Kern / Walter Kasper Atheismus und Gottes Verborgenheit Walter Kern / Yves Congar Geist und Heiliger Geist Raphael Schulte Zeit und Ewigkeit
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 22 Walter Kern / Walter Kasper Atheismus und Gottes Verborgenheit Walter Kern / Yves Congar Geist und Heiliger Geist Raphael Schulte Zeit und Ewigkeit
Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis
 Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis Prof. Dr. Markus Mühling Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog Leuphana Universität Lüneburg 1. Das Problem 2. Klassische Lösungen
Das Verhältnis von Christlicher Lehre und Glaubenspraxis Prof. Dr. Markus Mühling Systematische Theologie und Wissenschaftskulturdialog Leuphana Universität Lüneburg 1. Das Problem 2. Klassische Lösungen
Die Kunst lebendiger Beziehungen Lektion 6. Was wäre wenn
 Die Kunst lebendiger Beziehungen Lektion 6. Was wäre wenn QUALITÄT: PROAKTIVE SCHÖPFUNG Es macht keinen Sinn, sich wegen 0,003% der Wirklichkeit zu streiten. þ DEINE CHECKLISTE o Hast du die Fragen zur
Die Kunst lebendiger Beziehungen Lektion 6. Was wäre wenn QUALITÄT: PROAKTIVE SCHÖPFUNG Es macht keinen Sinn, sich wegen 0,003% der Wirklichkeit zu streiten. þ DEINE CHECKLISTE o Hast du die Fragen zur
1 Was leisten Rituale?
 1 Was leisten Rituale? a Kann man Rituale abschaffen? 12 Wozu brauchen wir Rituale? ^ 14 Was macht ein Ritual aus? 16 Wie viel individuelle Bedeutung halten Rituale aus? 18 Wann sind Rituale lebensfeindlich?
1 Was leisten Rituale? a Kann man Rituale abschaffen? 12 Wozu brauchen wir Rituale? ^ 14 Was macht ein Ritual aus? 16 Wie viel individuelle Bedeutung halten Rituale aus? 18 Wann sind Rituale lebensfeindlich?
Predigt über Jeremia 1,4-10 Ein gutes Fundament
 Predigt über Jeremia 1,4-10 Ein gutes Fundament Es gibt 3 Möglichkeiten, wie wir unser Leben sehen, verstehen und auch leben können: Die 1.: Wir sehen, verstehen und leben unser Leben von uns selbst her.
Predigt über Jeremia 1,4-10 Ein gutes Fundament Es gibt 3 Möglichkeiten, wie wir unser Leben sehen, verstehen und auch leben können: Die 1.: Wir sehen, verstehen und leben unser Leben von uns selbst her.
Wenn Du Dich in der Schule wahnsinnig aufgeregt hast, schreib den Ärger auf einen Zettel, zerknüll ihn und wirf ihn in hohem Bogen in die Ecke.
 Motivation: Wenn Du Dich in der Schule wahnsinnig aufgeregt hast, schreib den Ärger auf einen Zettel, zerknüll ihn und wirf ihn in hohem Bogen in die Ecke. Merken: Forschungen haben ergeben: WIR MERKEN
Motivation: Wenn Du Dich in der Schule wahnsinnig aufgeregt hast, schreib den Ärger auf einen Zettel, zerknüll ihn und wirf ihn in hohem Bogen in die Ecke. Merken: Forschungen haben ergeben: WIR MERKEN
Soviel fürs erste, Pater Kassian. Lieber Pater Kassian Ich bin ganz Ihrer Meinung. Dass es eine Welt gibt und in dieser
 Pater Kassian, woher kommt dieser Glaube? Ein Email-Gespräch aus dem Jahr 2007 mit dem damals 78 Jahre alten Pater Kassian Etter aus dem Kloster Einsiedeln Sehr geehrter Pater Kassian Das Leben ist flüchtig,
Pater Kassian, woher kommt dieser Glaube? Ein Email-Gespräch aus dem Jahr 2007 mit dem damals 78 Jahre alten Pater Kassian Etter aus dem Kloster Einsiedeln Sehr geehrter Pater Kassian Das Leben ist flüchtig,
Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse
 Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse Unsere Sängerin heißt Josefine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesanges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt, was umso
Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse Unsere Sängerin heißt Josefine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesanges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt, was umso
1. Thematischer Gottesdienst zum Jahresthema Sonntag als Ruhetag - inhaltlich gefüllt
 1. Thematischer Gottesdienst zum Jahresthema Sonntag als Ruhetag - inhaltlich gefüllt Begrüßung und Einführung Der Herr, der uns den Sonntag als Ruhetag schenkt, sei mit euch. Bis zu den Sommerferien 2011
1. Thematischer Gottesdienst zum Jahresthema Sonntag als Ruhetag - inhaltlich gefüllt Begrüßung und Einführung Der Herr, der uns den Sonntag als Ruhetag schenkt, sei mit euch. Bis zu den Sommerferien 2011
Ein Satz wird auch dunkel werden wo solch ein Begriff einfliest; Klar: Ist Erkenntnis wenn man die dargestellte Sache wieder erkennen kann.
 Lebenslauf: Gottfried Wilhelm Leibniz: 1.Juli 1646(Leipzig) - 14. November 1716 (Hannover) mit 15 Besuchte er Uni Leipzig; mit 18 Mag; wegen seines geringen Alters (kaum 20) nicht zum Doktorat zugelassen;
Lebenslauf: Gottfried Wilhelm Leibniz: 1.Juli 1646(Leipzig) - 14. November 1716 (Hannover) mit 15 Besuchte er Uni Leipzig; mit 18 Mag; wegen seines geringen Alters (kaum 20) nicht zum Doktorat zugelassen;
DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT. des REICHWERDENS
 DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS 248 Vorwort AKTUALISIERTE VERSION 9 1. DAS RECHT REICH ZU SEIN was auch immer zum Lobpreis der Armut gesagt werden
DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS LESEPROBE DIE NEUE WISSENSCHAFT des REICHWERDENS 248 Vorwort AKTUALISIERTE VERSION 9 1. DAS RECHT REICH ZU SEIN was auch immer zum Lobpreis der Armut gesagt werden
Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit
 Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit Martha C. Nussbaum *1947 1975 Promotion in klassischer Philologie in Harvard Lehrtätigkeiten in Harvard (1975-1983), Brown University
Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit Martha C. Nussbaum *1947 1975 Promotion in klassischer Philologie in Harvard Lehrtätigkeiten in Harvard (1975-1983), Brown University
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
...an den Vater, den Allmächtigen. Credo III BnP
 ...an den Vater, den Allmächtigen Credo III BnP 21.5.2017 Unsere Beziehungen Unsere wichtigsten menschlichen Beziehungen bauen Identität auf In Umfragen, was Menschen am meisten fürchten, gehört die Angst
...an den Vater, den Allmächtigen Credo III BnP 21.5.2017 Unsere Beziehungen Unsere wichtigsten menschlichen Beziehungen bauen Identität auf In Umfragen, was Menschen am meisten fürchten, gehört die Angst
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit
 Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Predigt zu Markus 9,14-21 "Ich glaube, hilf meinem Unglauben" Pfrin Martina Müller, 31. Oktober 2000, Muttenz Dorf, Jubiläum Goldene Hochzeit 1. Einleitung Ich möchte Sie heute dazu anstiften, über Ihren
Das Geheimnis der Dankbarkeit
 Das Geheimnis der Dankbarkeit Das Geheimnis der Dankbarkeit In unserer heutigen Welt, bekommt Dankbarkeit wieder eine bedeutendere Stellung. Wenn wir einige Jahre zurückblicken, waren viele Menschen sehr
Das Geheimnis der Dankbarkeit Das Geheimnis der Dankbarkeit In unserer heutigen Welt, bekommt Dankbarkeit wieder eine bedeutendere Stellung. Wenn wir einige Jahre zurückblicken, waren viele Menschen sehr
[DAS ÄLTESTE SYSTEMPROGRAMM
 [DAS ÄLTESTE SYSTEMPROGRAMM DES DEUTSCHEN IDEALISMUS] 1) (1796 oder 1797) - eine Ethik. Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt - wovon Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten nur ein
[DAS ÄLTESTE SYSTEMPROGRAMM DES DEUTSCHEN IDEALISMUS] 1) (1796 oder 1797) - eine Ethik. Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt - wovon Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten nur ein
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht!
 Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Friedrich Schiller (1759 1805) 1 Schillers Rezeption von Kants Pflichtbegriff, satirisch
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Friedrich Schiller (1759 1805) 1 Schillers Rezeption von Kants Pflichtbegriff, satirisch
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Leitbild
 Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
HGM Hubert Grass Ministries
 HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
HGM Hubert Grass Ministries Partnerletter 1/14 Gott will durch dich wirken Gott möchte dich mit deinen Talenten und Gaben gebrauchen und segnen. Er hat einen Auftrag und einen einzigartigen Plan für dich
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 KURT TEPPERWEIN Nichts geschieht umsonst DIE SPRACHE DES LEBENS VERSTEHEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Alle Rechte vorbehalten. Außer zum Zwecke kurzer Zitate für Buchrezensionen darf kein Teil dieses
KURT TEPPERWEIN Nichts geschieht umsonst DIE SPRACHE DES LEBENS VERSTEHEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Alle Rechte vorbehalten. Außer zum Zwecke kurzer Zitate für Buchrezensionen darf kein Teil dieses
Inhaltsverzeichnis. Titel. Unumgängliche Voraussetzung zum Verständnis dieser Schrift Vorwort
 Das Leben richtig leben Inhaltsverzeichnis Unumgängliche Voraussetzung zum Verständnis dieser Schrift Vorwort Gutes und Wertvolles tun... Der Mensch muss das Leben wieder zu leben lernen... Der Mensch
Das Leben richtig leben Inhaltsverzeichnis Unumgängliche Voraussetzung zum Verständnis dieser Schrift Vorwort Gutes und Wertvolles tun... Der Mensch muss das Leben wieder zu leben lernen... Der Mensch
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität
 Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
"DER MAGISCHE MENSCH":
 "DER MAGISCHE MENSCH": Man sollte annehmen, dass es nach 5000 Jahren Praxis, -wenn nicht länger, -innerhalb derselben Spezies eine gewisse "Grundeinigung in Bezug auf die Funktion der Sinnesorgane" geben
"DER MAGISCHE MENSCH": Man sollte annehmen, dass es nach 5000 Jahren Praxis, -wenn nicht länger, -innerhalb derselben Spezies eine gewisse "Grundeinigung in Bezug auf die Funktion der Sinnesorgane" geben
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Predigt im Fest- und Familiengottesdienst zum St. Georgsfest und 70 Jahre Kita Daubitz 30. April 2016,
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Predigt im Fest- und Familiengottesdienst zum St. Georgsfest und 70 Jahre Kita Daubitz 30. April 2016,
Predigt zu Römer 8,32
 Predigt zu Römer 8,32 Wie frustrierend muss das sein, wenn man so ein schönes Geschenk hat und niemand möchte es annehmen. Ich hoffe, dass euch so etwas nicht passiert schon gar nicht heute am Heilig Abend.
Predigt zu Römer 8,32 Wie frustrierend muss das sein, wenn man so ein schönes Geschenk hat und niemand möchte es annehmen. Ich hoffe, dass euch so etwas nicht passiert schon gar nicht heute am Heilig Abend.
Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion
 Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
Geisteswissenschaft Lars Okkenga Lernstoff zu: George Herbert Mead. Entstehung von Bewusstsein und Identität aus dem Prozess der symbolisch vermittelten Interaktion Prüfungsvorbereitung George Herbert
ROMAN0 GUARDINI DAS ENDE DER NEUZEIT. Ein Versnch zur Orientierung
 ROMAN0 GUARDINI DAS ENDE DER NEUZEIT Ein Versnch zur Orientierung Mit Druckerlaubnis des Ordinariates Basel vom 30. Juni 1950 i Meinem Bruder Mario zugeeignet Erste Auflage Alle Rechte vorbehalten Copyright
ROMAN0 GUARDINI DAS ENDE DER NEUZEIT Ein Versnch zur Orientierung Mit Druckerlaubnis des Ordinariates Basel vom 30. Juni 1950 i Meinem Bruder Mario zugeeignet Erste Auflage Alle Rechte vorbehalten Copyright
Die analytische Tradition
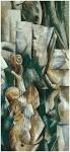 Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Hebräer 3:1-2 (frei übersetzt) Copyright 2009 by
 1 Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn eingesetzt hat... Hebräer 3:1-2
1 Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn eingesetzt hat... Hebräer 3:1-2
DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH
 DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH Vieles können wir mit Geld bekommen, das Wesentliche nicht. Alle wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nicht käuflich: Verständnis, Zuneigung, Verbundenheit, Tiefe,
DAS WESENTLICHE IST NICHT KÄUFLICH Vieles können wir mit Geld bekommen, das Wesentliche nicht. Alle wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nicht käuflich: Verständnis, Zuneigung, Verbundenheit, Tiefe,
Reich Gottes: Schon jetzt, noch nicht!
 "Warum denn nicht?" "Ja, man hat es nicht leicht!" Reich Gottes Mentalität Sehnsucht, dass Gott seine Herrschaft aufrichten kann unter uns und durch uns. Seine Herrlichkeit, Liebe, Grösse und Macht soll
"Warum denn nicht?" "Ja, man hat es nicht leicht!" Reich Gottes Mentalität Sehnsucht, dass Gott seine Herrschaft aufrichten kann unter uns und durch uns. Seine Herrlichkeit, Liebe, Grösse und Macht soll
ZENSHO W. KOPP. Gemälde und Aussprüche eines westlichen Zen-Meisters
 ZENSHO W. KOPP Gemälde und Aussprüche eines westlichen Zen-Meisters Das reine Sein Alles ist der Eine Geist, neben dem nichts anderes existiert, und jede vielheitliche Wahrnehmung ist Illusion. Alles,
ZENSHO W. KOPP Gemälde und Aussprüche eines westlichen Zen-Meisters Das reine Sein Alles ist der Eine Geist, neben dem nichts anderes existiert, und jede vielheitliche Wahrnehmung ist Illusion. Alles,
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
Jenseitsbotschaften Was dir deine geliebte Seele noch sagen möchte Kartenset
 Leseprobe aus: Jenseitsbotschaften Was dir deine geliebte Seele noch sagen möchte Kartenset von Nathalie Schmidt. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier
Leseprobe aus: Jenseitsbotschaften Was dir deine geliebte Seele noch sagen möchte Kartenset von Nathalie Schmidt. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Hier
Monat der Weltmission 2011
 Fürbitten (1) (ggf. die Fläche vor dem Altar mit Gegenständen gestalten) P: Gott ist ein Anwalt der Armen und Schwachen. Zu ihm kommen wir voller Vertrauen mit dem, was uns bewegt: Trommel V: Musik spielt
Fürbitten (1) (ggf. die Fläche vor dem Altar mit Gegenständen gestalten) P: Gott ist ein Anwalt der Armen und Schwachen. Zu ihm kommen wir voller Vertrauen mit dem, was uns bewegt: Trommel V: Musik spielt
Rudolf Steiner ERWIDERUNG AUF DEN ARTIKEL: MEINE «EINGEBILDETE» REVOLUTION, VON ARNO HOLZ
 Rudolf Steiner ERWIDERUNG AUF DEN ARTIKEL: MEINE «EINGEBILDETE» REVOLUTION, VON ARNO HOLZ Erstveröffentlichung in: Magazin für Literatur 1900, 69. Jg., Nr. 9 u. 14 (GA 32, S. 459-463) Jeder Psychologe
Rudolf Steiner ERWIDERUNG AUF DEN ARTIKEL: MEINE «EINGEBILDETE» REVOLUTION, VON ARNO HOLZ Erstveröffentlichung in: Magazin für Literatur 1900, 69. Jg., Nr. 9 u. 14 (GA 32, S. 459-463) Jeder Psychologe
ICH UND DIE SCHÖPFUNG:
 ICH UND DIE SCHÖPFUNG: UM MIR DIESE IDEE ZU VERGEGENWÄRTIGEN, STELLE ICH MIR MICH ALLEINE VOR, - ALLEINE IN EINEM WEISSEN RAUM OHNE ERSICHTLICHE ECKEN, KANTEN ODER ANDERE BEGRENZUNGEN. - - ICH HABE "ALLES
ICH UND DIE SCHÖPFUNG: UM MIR DIESE IDEE ZU VERGEGENWÄRTIGEN, STELLE ICH MIR MICH ALLEINE VOR, - ALLEINE IN EINEM WEISSEN RAUM OHNE ERSICHTLICHE ECKEN, KANTEN ODER ANDERE BEGRENZUNGEN. - - ICH HABE "ALLES
Diskussion der Theorie des Seins
 Diskussion der Theorie des Seins Es gibt nur Bewusstsein über Ideen, sonst nichts. Die Liebe von Peter Richard - Stand: Donnerstag, 18. August 2016 1 / 5 Die Liebe von Peter Richard - http://diskussion.theoriedesseins.de/2012/07/06/die-liebe/
Diskussion der Theorie des Seins Es gibt nur Bewusstsein über Ideen, sonst nichts. Die Liebe von Peter Richard - Stand: Donnerstag, 18. August 2016 1 / 5 Die Liebe von Peter Richard - http://diskussion.theoriedesseins.de/2012/07/06/die-liebe/
Schöpfungsgeschichte, grandios einfach, mit wie in Stein gehauenen Worten. Gott sprach, und es geschah. Gott sah es an, und es war gut.
 Schöpfungsgeschichte, grandios einfach, mit wie in Stein gehauenen Worten. Gott sprach, und es geschah. Gott sah es an, und es war gut. Am siebten Tag aber ruhte Gott von seinem Werke. Was mag das bedeuten?,
Schöpfungsgeschichte, grandios einfach, mit wie in Stein gehauenen Worten. Gott sprach, und es geschah. Gott sah es an, und es war gut. Am siebten Tag aber ruhte Gott von seinem Werke. Was mag das bedeuten?,
Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung,
 Zur Einführung Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge Dornach, 11. Februar 1922 Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung, Sie nach längerer Zeit wieder hier begrüßen zu können,
Zur Einführung Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge Dornach, 11. Februar 1922 Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung, Sie nach längerer Zeit wieder hier begrüßen zu können,
Die Phänomenologie des Fremden als Grundlage psychiatrischpsychotherapeutischen Handelns
 Die Phänomenologie des Fremden als Grundlage psychiatrischpsychotherapeutischen Handelns Prof. Dr. med. Joachim Küchenhoff Chefarzt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Ärztlicher Leiter Psychiatrie
Die Phänomenologie des Fremden als Grundlage psychiatrischpsychotherapeutischen Handelns Prof. Dr. med. Joachim Küchenhoff Chefarzt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Ärztlicher Leiter Psychiatrie
"Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit"
 Wort der Schweizer Bischöfe "Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit" (2 Kor 3,17) TAG DER VÖLKER Tag der Migranten 12. November 2006 - 2 - Liebe Schwestern und Brüder "Denn das Gesetz des Geistes
Wort der Schweizer Bischöfe "Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit" (2 Kor 3,17) TAG DER VÖLKER Tag der Migranten 12. November 2006 - 2 - Liebe Schwestern und Brüder "Denn das Gesetz des Geistes
