Verantwortung für Rheinland-Pfalz
|
|
|
- Eleonora Brinkerhoff
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 realschule-vdr.de REALSCHULE IN RHEINLAND-PFALZ Mitteilungen des Verbandes Deutscher Realschullehrer Landesverband Rheinland-Pfalz e.v. Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Schulen im Sekundarbereich Verantwortung für Rheinland-Pfalz VDR 3/ Jahrgang ISSN Parlamentarischer Abend des VDR in Mainz
2 Editorial J4F Können Sie das Sinn entnehmend lesen? HEGL! Sie können das nicht? PPKM! GNGN, strengen Sie sich an! Entweder haben Sie nicht aufgepasst oder Sie interessieren sich für anderes oder Sie kennen diese Sprache nicht. Sie sind nicht integriert in die Gesellschaft der SMS-Schreiber und -Leser! Ähnlich geht es den Schülerinnen und Schülern, die bei PISA 2009 beim Lesen schlecht abschnitten. Aber man kann dazulernen. Bei der Vorstellung der PISA 2009-Ergebnisse sagte der Leiter des Berliner OECD-Büros, Heino von Meyer: "Deutschland ist aufgestiegen - aufgestiegen aus der zweiten in die erste Liga. Aber von der Champions League ist Deutschland noch weit entfernt, Nötig sind Training, Training, Training und mehr Integration statt Ausgrenzung. So blieb den deutschen Kultusministern anders als vor neun Jahren dieses Mal ein Scherbengericht erspart. Die Pisa-Prüfer bescheinigen ihnen in der neuen Auswertung, dass die Schulkinder im Vergleich zur ersten Studie im Jahr 2000 besser geworden sind. Erstmals liegen ihre Testwerte in Mathematik und Naturwissenschaften über dem OECD-Durchschnitt. Aber es bleiben weiterhin große Herausforderungen, denn es hapert nach wie vor an einer Schlüsselkompetenz dem Leseverständnis. Tatsächlich hatten die Bildungspolitiker ein kleines Weihnachtsgeschenk bei der Vorstellung der PISA-Ergebnisse für die Lehrer dabei: So lobte die Bundesbildungsministerin Schavan: Die Verbesserung der Ergebnisse ist in erster Linie Verdienst der Lehrer, der individuellen Förderung und der Verbesserung der Lernatmosphäre. Auffällig, dass bei der PISA-Ergebnis- Vorstellung in der Bundespressekonferenz am 7. Dezember mit keinem Wort auf die Forderung des OECD- Bildungs- und Statistikexperten Andreas Schleicher eingegangen wurde. Für ihn ist auch die Auswahl der Lehrer in Deutschland wesentlich verbesserungsbedürftig. Man muss versuchen, die besten Köpfe für die Schulen zu gewinnen. Länder wie Finnland machen das recht erfolgreich vor! Das wäre dann wohl doch zu sehr ans Eingemachte gegangen. Womöglich hätte sich die anwesende rheinlandpfälzische Bildungsministerin ob des Einsatzes der vielen Hilfs-Lehrkräfte in ihrem Bundesland rechtfertigen müssen. Wer Qualität nicht auf allen Gebieten der Schule zum Standard werden lässt, darf sich nicht beklagen, von der Champions League ausgeschlossen zu bleiben. Freundlichst wünscht Ihnen frohe Feiertage und erholsame Ferien I m p r e s s u m Herausgeber VDR Verband Deutscher Realschul lehrer Landesverband Rheinland-Pfalz e.v Mainz Landesvorsitzender Bernd Karst Grolsheimer Weg Bingen Tel / Fax / karst.bernd@vdr-rlp.de Zentrale Mitgliederkartei und Inkasso Martin Radigk Nachtigallenweg Speyer Tel / Fax / landeskassierer@vdr-rlp.de Chefredakteurin Christiane Lehmann Grüner Weg Waldesch Tel / lehmann.christiane@vdr-rlp.de Internet Adresse Layout Mediengestaltung Nehring Lohrweg Mülheim-Kärlich roland.nehring@web.de Druck Görres Druckerei Koblenz Texte Verband Deutscher Realschul lehrer Landesverband Rheinland-Pfalz e.v. Das Foto auf dem Titel zeigt die Vorsitzenden und bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen Rheinland-Pfalz sowie Vertreter des VDR-Landesvorstands während des parlamentarischen Abends am 17. November in Mainz: Michael Eich (VDR); Nicole Morsblech, MdL, bildungspolitische Sprecherin der FDP; Bernd Karst (VDR); Ulla Brede-Hoffmann, MdL, bildungspolitische Sprecherin der SPD; Bettina Dickes, MdL, bildungspolitische Sprecherin der CDU; Herbert Mertin, MdL, Fraktionsvorsitzender der FDP; Timo Lichtenthäler (VDR); Jochen Hartloff, MdL, Fraktionsvorsitzender der SPD; Doris Ahnen, Bildungsministerin (SPD); Hanns Peters (VDR); Christian Baldauf, MdL, Fraktionsvorsitzender der CDU; Wilfried Rausch (VDR); Erwin Schneider (VDR); Vera Reiß, Staatssekretärin im MBWJK, SPD. 2 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
3 Schulpolitik Unterrichtsversorgung 2010/2011 gibt wenig Anlass zum Jubeln Bildungsministerin Doris Ahnen hat für dieses Schuljahr die beste Unterrichtsversorgung seit 25 Jahren festgestellt. Konkret in Zahlen ausgedrückt heißt das: Im Schuljahr 2010/2011 fallen planmäßig nur 1,2 Prozent der Unterrichtsstunden aus. Doch diese Erfolgsnachricht trügt. Die Schulstatistik für die allgemeinbildenden Schulen vermittelt mit einer strukturellen Unterrichtsversorgung von 98,8 Prozent im Schuljahr 2010/2011 lediglich auf den ersten Blick ein erfreuliches Ergebnis. Die Realität ist eine andere. Dies räumt auch die Ministerin ein, die in ihrer Pressemitteilung vom erklärt, dass die Werte für die strukturelle Unterrichtsversorgung nicht mit einer auf den Tag bezogenen Situationsbeschreibung der Unterrichtsversorgung in den Schulen gleichgesetzt werden dürften. Der tatsächliche Unterrichtsausfall infolge von Krankheiten, Fortbildungen oder Klassenfahrten liegt erfahrungsgemäß zwischen 5 und 7 Prozent. Er wird in der allgemeinen Schulstatistik nicht abgebildet. Letztendlich sagen Prozentzahlen rein gar nichts aus über die Unterrichtsqualität. Sie machen nämlich nicht transparent, wie hoch der Anteil an Unterricht ist, den befristet eingestellte Hilfskräfte, oft ohne ausreichende Qualifikation, erteilen. So dienen billige Zeitverträge zwar der statistischen Kosmetik, aber nicht dem Ziel einer möglichst hohen Unterrichtsqualität. Wer vor einer Klasse steht, muss ausgebildet sein fachlich und pädagogisch. In Rheinland-Pfalz unterrichten zu viele unausgebildete, Statistik schönende Beschäftigte ohne Unterrichtserfahrung und ohne einschlägige Ausbildung. Der Einsatz dieser Hilfskräfte beeinträchtigt nicht nur das Image des Lehrerberufes, sondern er widerspricht auch dem spezifischen Auftrag der Schule. Wer die Entprofessionalisierung des Lehrerberufes akzeptiert und fördert, der darf am Ende nicht darüber klagen, wenn PISA-Ergebnisse oder andere Vergleichsstudien besorgniserregend bleiben. Ein weiterer Aspekt der Unter(richts) versorgung ist der fachspezifische Mangel. Aktuell, mittelfristig und wenn keine Abhilfe geleistet wird auch langfristig fehlen Lehrkräfte insbesondere mit einer Facultas in den Fächern Musik, Naturwissenschaften und Fremdsprachen. Der Mangel an Französischlehrern beispielsweise ist beängstigend hoch. Eine nachhaltige Gegensteuerung ist nicht erkennbar. Die strukturelle Unterrichtsversorgung ist von vielen Faktoren abhängig, auch vom Schülerrückgang oder von den durchschnittlichen Klassengrößen. Durch Schulschließungen bzw. durch Zusammenschlüsse von Hauptschulen und Realschulen entstehen größere Systeme und damit größere Klassen. Die Klassenmesszahlen, die in der Orientierungsstufe an der Realschule plus auf 25 Schüler reduziert wurden, sind ein positiver Ansatz. Sie dürfen daher nicht wieder ab Klassenstufe 7 auf 30 Schüler erhöht werden. Die kleinen Hauptschulen waren solche Größen schon lange nicht mehr gewohnt. 20 Schüler im Berufsbildungsgang, 25 Schüler im Realschulbildungsgang das ist der pädagogische Maßstab, den der VDR zugrunde legt. Eine solche Verbesserung erfordert Bernd Karst, VDR-Landesvorsitzender natürlich zusätzliche Lehrerstellen. Aber wenn Bildung, wie alle Parteien behaupten, ein zentrales gesellschaftliches Anliegen ist, dann muss konsequenterweise auch die dafür erforderliche Finanzierung sichergestellt werden. Sinkende Schülerzahlen und eine kontinuierliche Einstellung von Lehrern helfen weiter. Die frei werdenden Ressourcen sollen im Bildungssystem bleiben. Das jedenfalls fordert die Opposition und das verspricht auch die Regierung. Aber die im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel sind nicht ausreichend mit Blick auf den tatsächlichen Unterrichtsausfall und den Anspruch an eine zeitgemäße Unterrichtsqualität. Die beste Unterrichtsversorgung seit 25 Jahren gibt folglich wenig Anlass zum Jubeln. Zuversicht vermittelt demgegenüber die Einstellungspolitik in ihrer Wirkung auf die Altersstruktur. So liegt Rheinland-Pfalz bei der Altersgruppe der Lehrkräfte unter 35 Jahren mit einem Anteil von 20 Prozent deutlich an der Spitze aller Bundesländer. Dieses zweifellos positive Ergebnis sollte mit Blick auf die anderen Tatsachen anspornen. Bernd Karst VDR Landesvorsitzender reale Bildung reale Chancen Realschule 3
4 Schulpolitik Parlamentarischer Abend Schulen brauchen gute und verlässliche Rahmenbedingungen. Der Parlamentarische Abend des VDR hat Tradition. Er fi ndet regelmäßig vor dem Ende einer Legislaturperiode statt. Tradition hat auch die besondere Wertschätzung, die dieser Parlamentarische Abend über alle Parteigrenzen hinweg bei den Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtages genießt. Bernd Karst VDR-Landesvorsitzender Unter den zahlreich erschienenen Parlamentariern konnte VDR-Landesvorsitzender Bernd Karst die Vorsitzenden aller im Landtag vertretenen Fraktionen begrüßen: Jochen Hartloff (SPD), Christian Baldauf (CDU) und Herbert Mertin (SPD). Auch alle drei bildungspolitischen Sprecherinnen Ulla Brede-Hoffmann (SPD), Bettina Dickes (CDU) und Nicole Morsblech (FDP) - waren der Einladung gefolgt. Stellvertretend für die Landesregierung waren Bildungsministerin Doris Ahnen und Staatssekretärin Vera Reiß gekommen. Martin Brandl MdL, CDU; VDR: Michael Eich; Mareike Albert Schulen brauchen gute und verlässliche Rahmenbedingungen! Bernd Karst zitierte diese zentrale Feststellung der Ministerin im Titelbeitrag der Staatszeitung vom Vortag und fand darin einen Konsens, der uns schulpolitisch über alle Parteien und Verbände hinweg verbindet. Er wünschte gute Gespräche und einen Abend, der die Parlamentarier mit vielen Anregungen für die bildungspolitische Arbeit belohnen möge. Als Themen-Schwerpunkte, zu denen die Fraktionen auch ihre Positionen einbrachten, setzte Karst: Martin Radigk, VDR; Herbert Mertin MdL, FDP-Fraktionsvorsitzender MdL Jochen Hartloff SPD-Fraktionsvorsitzender Die Zielsetzung der SPD-Landespolitiker ist, allen Kindern eine bestmögliche Ausbildung zu eröffnen. Die Verwirklichung ist dann schwierig, wenn das Elternhaus ausfällt. Schulen benötigen in diesen Fällen Hilfestellung von außen u. a. durch den Einsatz von Schulsozialarbeitern. Bildung hat einen hohen Stellenwert: Bildung ist unser Gold! Deswegen investiert die Landesregierung sehr viel Geld in Bildung. Hartloff hat Verständnis für die Forderungen des Realschullehrerverbandes, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dennoch müssten die Politiker die Einnahmenseite und die Schulden im Blick haben. Das erfordere häufi g den Spagat. Die Sozialdemokraten setzen sich auch in Zukunft dafür ein, gute Rahmenbedingungen für Schulen zu schaffen. Jochen Hartloff bedankte sich bei den Verbandsvertretern für ihre konstruktive und kritische Mitarbeit an der Schulpolitik des Landes. O-Ton Hartloffs auf die Frage: Was passiert nach der Wahl 2011? : Wir setzen auf Kontinuität. 4 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
5 Schulpolitik In nahezu allen Bundesländern ist die Abschlussprüfung eingeführt. Der VDR hält sie auch in Rheinland-Pfalz für unverzichtbar. Mit der Fachoberschule an der Realschule plus habe die Landesregierung einer jahrzehntelangen Forderung des VDR entsprochen. Das war eine mutige Entscheidung mit einer Signalwirkung, die zu einem Durchbruch auch in anderen Bundesländern führen wird. Jede Schule und jede Schulart in Deutschland wird daran gemessen, ob sie in der Lage ist, Wege zum Abitur anzubieten bzw. Wege zum Abitur zu eröffnen. Werner Kuhn, Mdl, FDP; Marion Bellinger, VDR MdL Ulla Brede-Hoffmann, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Ulla Brede-Hoffman sieht in der Einrichtung und Weiterentwicklung der neuen Schulart Realschule plus eine große neue Chance tolle Ergebnisse zu erzielen. Die Realschule plus wird ihrer Ansicht nach die Schülerinnen und Schüler sehr gut auf die berufl iche Zukunft vorbereiten können. Durch die Stärkung der Berufsorientierung in der neuen Schulart würden insgesamt die Chancen der jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt verbessert wie auch der Übergang von den allgemeinbildenden Schulen in die berufl ichen Schulen erleichtert. Sie ist sehr optimistisch, dass die rheinland-pfälzischen Schulen die an sie gestellten Anforderungen erfüllen, junge Menschen für den Arbeitsmarkt zu qualifi zieren. Sie betont allerdings, dass Lehrkräfte aller Schularten, insbesondere die Lehrkräfte der Realschulen plus und der Berufsbildenden Schulen, intensiver zusammenarbeiten müssten. Als vordringlich für die Weiterentwicklung der Realschulen plus sieht sie in den nächsten Jahren die Beschäftigung mit inhaltlichen und didaktischen Themen. Es muss geklärt werden, was individuelle Förderung bedeutet und wie innere Differenzierung umgesetzt werden kann. Wichtig ist ihr auch die Auseinandersetzung mit den Themen Jungenförderung und Klassenwiederholung. Die Realschule plus ist nicht unsere Erfindung. Aber sie ist die Schulart, in der wir unterrichten. Lehrerinnen und Lehrer tragen eine große Verantwortung für die Kinder für alle Kinder. Eine gute Lehrkraft bringe immer wieder Opfer den Kindern zuliebe. Das Motiv, Lehrer zu werden, müsse durch diese Grundhaltung geprägt sein. Der rasant ablaufende Schulstrukturwandel hat viele Erschütterungen verursacht, die in ihrer Konsequenz im Vorfeld nicht bedacht worden sind. So gilt es, manches wenigstens im Nachhinein - zu reparieren. Welche Themen haben die Schulen neben der Strukturver- Nicole Morsblech, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion Berufsbild Schulleitung Die FDP hält die Vorstellung des Schulleiters als Lehrkraft mit Entlastungsstunden für die Aufgaben der Schulleitung für überholt. Schulleiterinnen und Schulleiter nehmen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer modernen Schule ein. Das bedeutet, dass eine qualifi zierte Ausbildung geeigneter Bewerberinnen und Bewerber auf diese eigenständige anspruchsvolle Aufgabe erfolgen muss. Abschlussprüfung Die FDP bekennt sich zu einem leistungsorientierten Schulsystem. Dazu gehört die Vergleichbarkeit von Abschlüssen. Sie fordert deshalb im Gegensatz zur SPD geeignete Abschlussprüfungen an allen Bildungsgängen der Realschule plus in Rheinland-Pfalz. Berufsorientierung und MINT-Fächer Die FDP ist sich der besonderen Bedeutung der genannten Bereiche im Hinblick auf die Berufschancen der Schülerinnen und Schüler bewusst, und begrüßt die Anstrengungen, über den traditionellen Kanon der Wahlpfl ichtfächer der Realschule hinaus, Berufsorientierung und MINT-Fächern besondere Aufmerksamkeit bei der Ausgestaltung der Realschule plus zukommen zu lassen. reale Bildung reale Chancen Realschule 5
6 Schulpolitik änderung ansonsten beherrscht? Die Schulbuchausleihe. Sie hat große Kraft gekostet insbesondere für die Schulsekretärinnen. Dieser Aufwand könne kein Dauerzustand sein, zumal im nächsten Jahr nicht nur die Ausgabe, sondern auch die Rückgabe der Bücher ansteht. Der Unterrichtsausfall. Die Zahlen hören sich besser an als in den Vorjahren. Aber Zahlen allein sind kein Index für Unterrichtsqualität. Wir haben in RLP zu viele unausgebildete, Statistik schönende Beschäftigte ohne Unterrichtserfahrung und ohne einschlägige Ausbildung. Die Entprofessionalisierung des Lehrerberufes kann so nicht weitergehen. Wer vor einer Klasse steht, muss ausgebildet sein fachlich und pädagogisch. MdL Christian Baldauf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion "Ich bin der Meinung, dass die Eltern die freie Wahl haben sollten, ob sie für ihr Kind Ganztagsbetreuung wünschen oder nicht. Der Ganztagsbetrieb darf aber nicht die Existenz der örtlichen Vereine gefährden. Wenn Ganztagsunterricht angeboten wird, muss Hausaufgabenbetreuung durch voll ausgebildete Lehrkräfte gewährleistet sein. Sinnvoll wäre eine von den Schulen selbst verantwortete Mischung aus festen Kernunterrichtszeiten und fl exiblen freiwilligen Angeboten." Der fachspezifische Mangel. Der Mangel an Lehrkräften in den naturwissenschaftlichen Fächern ist bekannt. Nicht weniger Sorge bereitet das Stundendefizit im Fremdsprachenbereich. Es herrscht ein gravierender Mangel an Französischlehrern an der Realschule plus. Spanisch als 2. Fremdsprache sollte parallel eingeführt werden, um der Orientierung der Realschule an der Realität der Wirtschaft gerecht zu werden. Die Klassenmesszahlen. Nach der Messzahl 25 in der Orientierungsstufe darf nicht wieder ab Klassenstufe 7 auf 30 erhöht werden. 20 Schüler im Berufsbildungsgang, 25 Schüler im Realschulbildungsgang das ist der pädagogische Maßstab, den der VDR zugrunde legt. VDR: Gudrun Deck, Timo Lichtenthäler, Heinz-Jörg Dähler V D R - P R E S S E M I T T E I L U N G Aussagekraft der Zeugnisse und Schulabschlüsse sichern Der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) fordert, das Profi l der Schulabschlüsse zu schärfen, indem klare und überprüfbare Kriterien für das Erlangen eines bestimmten Abschlusses vorgegeben werden. Am ehesten ist das Ziel besserer Vergleichbarkeit durch zentrale Abschlussprüfungen zu erreichen, wie sie auch durch die Kammern der Wirtschaft immer wieder gefordert werden. Da Schulabschlüsse Wege für weitere Bildungsgänge eröffnen, ist die Vergleichbarkeit eine zentrale Frage der Bildungsgerechtigkeit. Aus dem Bereich der Kammern wird immer wieder beklagt, dass Zeugnisnoten für die Wirtschaft wenig aussagekräftig seien. In pointierter Überspitzung hört sich das z.b. so an: Wir haben zwischenzeitlich den Eindruck dass, egal welche Schulform ein Schüler besucht, er entsprechend gute Noten erhalten wird. Wir haben nur noch Schüler mit tollen Noten und zufriedene Eltern." ( Die Rheinpfalz vom ) Oft haben die Noten der Bewerber um einen Ausbildungsplatz weniger Bedeutung als der Ruf der konkreten Schule, von der der künftige Azubi kommt, so der VDR Landesvorsitzende Bernd Karst. Eine leichtfertige Vergabe von Berechtigungen ohne entsprechende Leistungsnachweise muss zwangsläufi g in einer Sackgasse enden. Der VDR bekennt sich zu einer leistungsorientierten Schule, in der die Noten wahre Aussagen über das Leistungsvermögen eines Schülers treffen, weil er seine Kenntnisse in objektivierbaren Prüfungen nachgewiesen hat V.i.S.d.P.: Wolfgang Häring, VDR-Pressereferent 6 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
7 Schulpolitik Im Gespräch mit Landtagsabgeordneten Zu einem Meinungsaustausch trafen sich in Landau Vertreter des Bezirksvorstandes Neustadt mit den südpfälzischen Landtagsabgeordneten Christine Schneider (CDU, Edenkoben) und Martin Brandl (CDU, Rülzheim). Unter der souveränen Gesprächsführung des Bezirksvorsitzenden Michael Eich wurden die Folgen der Schulstrukturreform und aktuelle bildungspolitische Themen erörtert. Der Einfluss der kommunalen Schulträger bei der Umgestaltung des Schulsystems zeigt sich deutlich: Während im Kreis Südliche Weinstraße vorwiegend kooperative Schulformen etabliert wurden, hat der Kreis Germersheim inzwischen vier Integrierte Gesamtschulen und weitere sind beantragt. Martin Brandl, der auch dem bildungspolitischen Ausschuss seiner Fraktion angehört, führt das darauf zurück, dass im Kreis Germersheim die Schulpolitik eher ideologiefrei gesehen wird. Man möchte dem Elternwillen möglichst entgegen kommen. Schließlich komme es stärker auf die Qualität der Lehrkräfte an als auf die Organisationsform. Zur Sicherung der Leistungsstandards und der Vergleichbarkeit der Abschlüsse fordere seine Partei zentrale Abschlussprüfungen in allen Bildungsgängen. Christine Schneider legt Wert auf eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung. Um kurzfristige Ausfälle abzudecken, sei eine Versorgung der Schulen mit 100+x % erforderlich. Beim Einsatz von Vertretungskräften sei darauf zu achten, dass diese eine abgeschlossene fachwissenschaftliche und pädagogische Ausbildung vorweisen können. Martin Brandl MdL (CDU), Gudrun Deck (VDR) Einig waren sich die VDR-Vertreter mit den Abgeordneten auch in dem Ziel, die Arbeitsbedingungen an den Realschulen plus zu verbessern. So fordert der VDR die maximale Klassengröße auch in den Stufen 7 bis 10 auf 25 festzusetzen, wobei in den Berufsreifeklassen bzw. -kursen mit 20 Schülerinnen und Schülern schon die Belastungsgrenze erreicht sein dürfte. Die große Heterogenität der Schülerschaft erfordere den Einsatz von Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern in viel größerem Umfang als bisher. Nicht zuletzt werfe die angestrebte Inklusion (Einbeziehung behinderter Kinder in Regelschulen) weitere Probleme auf. Bezirksvorsitzender Eich betonte, dass die Realschule plus zum Erfolg verurteilt sei. Ohne eine attraktive und erfolgreiche Realschule plus sei die Berufsausbildung im dualen System gefährdet und der Facharbeitermangel werde weiter steigen. Außerdem wäre mit einer schwachen Realschule plus der Weg in die Einheitsschule vorprogrammiert. Deshalb sei es auch unabdingbar, dass durch die Fachoberschule im organisatorischen Verbund mit der Realschule plus den Eltern mit der Anmeldung ihrer Kinder nach der Grundschule die Option auf einen Hochschulzugang geboten werde. Außerdem sei es erforderlich eine Alternative zum Gymnasium zu haben, die eine engere Verzahnung von beruflicher und allgemeiner Bildung ermögliche. Zum Abschluss des Gesprächs zeigten sich beide Seiten an einer Fortsetzung des Dialogs interessiert. Text: Wolfgang Häring Pressesprecher Ref.: Fachoberschule (FOS) Haering.Wolfgang@vdr-rlp.de Wolfgang Häring (VDR), Christine Schneider MdL (CDU), Michael Eich (VDR) Fotos: Gudrun Deck Organisationsfragen Deck.Gudrun@vdr-rlp.de reale Bildung reale Chancen Realschule 7
8 Schulpolitik Die Realschule plus muss den Integrierten Gesamtschulen gleichgestellt werden! Treffen mit den CDU-Landtagsabgeordneten des Ausschusses für Bildung und Jugend Am trafen im Mainzer Abgeordnetenhaus die CDU-Landtagsabgeordneten Bettina Dickes, Brigitte Heyn und Martin Brandl sowie Bernd Karst, Wilfried Rausch, Timo Lichtenthäler und Michael Eich als Vertreter des VDR zu einem Meinungsaustausch zusammen. Neben den Landtagsabgeordneten nahm auch der CDU-Bildungsreferent Gereon Geissler an dem Gespräch teil. Wichtige Eckpunkte des Gespräches waren die Zukunft der Realschulbildung, die Unterrichtsversorgung und Unterrichtsqualität gerade im Zusammenhang mit dem Ausbau des Projektes Erweiterte Selbständigkeit (PES) sowie die Einführung zentraler Abschlussprüfungen. Die Abgeordneten vertraten folgende Positionen: Die Realschule plus soll grundsätzlich kooperativ ausgerichtet sein und ist in der Ressourcenzuwei- Michael Eich; Wilfried Rausch; Bettina Dickes, MdL; Bernd Karst, Timo Lichtenthäler; Brigitte Heyn, MdL; Martin Brandl, MdL sung den Integrierten Gesamtschulen gleichzustellen, sodass aktuelle Versorgungsungleichheiten abgebaut werden. Überdies plädiert die CDU für zentrale Abschlussprüfungen für alle Bildungsgänge. Die Vertretungsregelung solle nach den Vorstellungen der Christdemokraten über einen Vertretungspool erfolgen, über den ausschließlich vollausgebildete Lehrer mit Festverträgen den Schulen als Vertretungsreserve zur Verfügung stehen. Vereinbart wurde, im Gespräch zu bleiben. Für Sie gelesen Schule und Macht Sylvia Löhrmann, die Schulministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, ist eine machtkundige Frau. Im Sommer zeigte sie der zaudernden Hannelore Kraft (SPD) den Weg in die Staatskanzlei. Nun erteilt die Schulministerin politischen Freunden wie Gegnern wieder eine Lektion. Und wieder zeigt sie, dass man auch ohne parlamentarische Mehrheit zum Ziel kommen kann. Die rot-grüne Reformmission "Gemeinschaftsschule", also die Abschaffung des gegliederten Schulsystems, hat sie nun mit Hilfe einer noch von der schwarz-gelben Vorgängerregierung geschaffenen Experimentierklausel begonnen. Utilitaristisch nutzt Frau Löhrmann die Nöte von Land-Bürgermeistern (am besten mit CDU-Parteibuch), die in Zeiten des demographischen Wandels die Schule um beinahe jeden Preis in ihrem Dorf halten wollen und sich vor lauter Verzweiflung nicht mehr um ein ausgewogenes regionales, vielfältiges und qualitätssicherndes Schulangebot scheren. Um die Einheitsschule durchzusetzen, verspricht ihnen Frau Löhrmann "Standortsicherung" und nimmt eine weitere Aufsplitterung der Schulstruktur in Kauf. "Kommunalisiere und herrsche", heißt das Motto, das nicht recht zu ihrer angeblich sanften Graswurzelrevolution passt. Zudem ist die Idee, Haupt-, Realschulen und Gymnasien zusammenzufassen, überholt. In den siebziger Jahren gab es einen heftigen ideologischen Kampf in Nordrhein-Westfalen um das damals Gesamtschule genannte Vorhaben. Bis 2005 bevorzugten SPD und dann Grüne Gesamtschulen systematisch. Trotzdem schnitt das Land in allen Vergleichstests verheerend ab. Mittlerweile hat die Bildungsforschung gezeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen längerem gemeinsamen Lernen und mehr Gerechtigkeit gibt. Im Gegenteil: Regelmäßig schneiden Bundesländer mit gegliedertem System am besten ab. Quelle: Reiner Burger, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
9 Schulpolitik Aller Anfang ist schwer Podiumsdiskussion zum Konzept Realschule plus Die Jungen Liberalen Landau-Südliche Weinstraße, die Jugendorganisation der FDP, veranstaltete Ende September eine Podiumsdiskussion in der Landauer Festhalle. Das Thema: Die Zukunftsfähigkeit des rheinland-pfälzischen Schulsystems. Im Zentrum der Diskussion stand das Konzept der Realschule plus. Die Rheinpfalz attestierte den Podiumsteilnehmern eine sachliche Diskussion und stellte fest: Aus den Realschulen plus, die in Rheinland-Pfalz aus der Zusammenlegung der Hauptund Realschulen resultieren, erhoffen sich Bildungspolitiker eine verbesserte Chancengleichheit, verbesserte Jobperspektiven durch vermehrt stattfindende Praktika sowie die Möglichkeit, später einmal ein Gymnasium besuchen zu können. Der Vorteil dieser Schulform, der immer wieder hervorgehoben wurde, ist die individuelle Förderung von Schülern. Auf dem Bildungsgipfel der Jungen Liberalen in Landau wurde kontrovers diskutiert: Ulla Brede-Hoffmann (MdL, SPD), Michael Böffel (Industrie- und Handelskammer Pfalz), Elvire Kuhn (Philologenverband), Hannah Lea Schmidt (FDP), Johannes Hahn (FDP), Nikolas Palmarini (FDP), Michael Eich (VDR) und Nicole Morsblech (MdL, FDP). Michael Eich nahm als stellvertretender VDR-Bezirksvorsitzender Neustadt/ Rheinhessen-Pfalz an der Podiumsdiskussion teil. Er hob hervor, dass die Realschulen plus dank des Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleitungen vor Ort einen soliden Start hingelegt hätten, und das obwohl sich an den nach wie vor verbesserungswürdigen schulischen Arbeits- und Rahmenbedingungen nur wenig getan habe. Die Realschule plus könne sich seiner Meinung nach als zweites Standbein neben der Inte- grierten Gesamtschule (IGS) und den Gymnasien behaupten, wenn nun die Voraussetzungen dafür geschaffen würden. Dazu gehöre, so Eich, u.a. die Einrichtung von Fachoberschulen (FOS). Für die Akzeptanz der Realschule plus bei den Eltern sei es unerlässlich, ihnen mit der Möglichkeit des Erreichens der allgemeinen Fachhochschulreife an Realschulen plus eine Alternative zu der akademisch geprägten Hochschulreife an Gymnasien anzubieten. In den Bereichen Unterrichtsqualität und Unterrichtsversorgung müsse seiner Ansicht nach energisch nachgesteuert werden. Mit Blick auf individuelle Förderung gab er zu bedenken, dass diese nur zu gewährleisten sei, wenn die Lehrerkräfte mehr Unterstützung erführen. Ein Kompliment Eichs ging an die Jungen Liberalen für deren Engagement in Sachen Bildung sowie an die jungen Moderatoren Hannah Lea Schmidt und Johannes Hahn, denen eine feine Premiere gelang. 3. Fachkongress Realschule plus Schulpolitik in Rheinland-Pfalz: Bilanz und Perspektiven Diskussion mit Bildungspolitikern der Landtagsfraktionen Ulla Brede-Hoffmann (SPD), Bettina Dickes (CDU), Nicole Morsblech (FDP) und Bildungsministerin Doris Ahnen Donnerstag, 17. März 2011 Ingelheim Fridtjof-Nansen-Akademie, Wilhelm-Leuschner-Straße 61 reale Bildung reale Chancen Realschule 9
10 Recht Stellungnahmen des VDR zu Verwaltungsvorschriften und Richtlinien Im zweiten Halbjahr wurden unserem Verband der Entwurf einer Landesverordnung zur Änderung der Schullaufbahnverordnung, der Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur Suchtprävention sowie der Richtlinien-Entwurf Verbraucherbildung vorgelegt. In Auszügen stellen wir im Folgenden unsere Stellungnahmen dar: Zweite Landesverordnung zur Änderung der Schullaufbahnverordnung Der Verordnungsentwurf enthält eine Neuregelung des Höchstalters für die Einstellung in das Beamtenverhältnis. Demnach soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Einzelfall oder bei eng begrenzten Gruppen von Fällen weitergehende Ausnahmen zuzulassen. Die Entscheidung soll im Ermessen der zuständigen Schulbehörde liegen und der Zustimmung des für die Finanzen zuständigen Ministeriums bedürfen. Die Neuregelung war notwendig, weil das Verwaltungsgericht in einem Rechtstreit zur Altershöchstgrenze im Jahre 2009 gegen das Land Rheinland-Pfalz entschied, und in der Urteilsbegründung klarstellte, dass die konkrete Höchstaltersgrenze und die Ausnahmen hierzu noch in Verwaltungsvorschriften zu regeln seien. Unsere Stellungnahme: Die Ausnahmeregelung, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen und an den Schulen zu behalten, wenn ein außerordentlicher Mangel an geeigneten jüngeren Bewerberinnen und Bewerbern besteht, halten wir für sinnvoll. Hierdurch können im Wettbewerb mit anderen Bundesländern qualifizierte Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz gehalten werden. Zu den Einzelfällen sind u. E. auch Bewerberinnen und Bewerber zu zählen, die aus familiären Gründen nach der Ausbildung nicht in den Schuldienst gegangen sind. Suchtprävention in der Schule und Verhalten bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten Unsere Stellungnahme: 1. Suchtprävention als Aufgabe von Schulen Die Forderung, dass alle Maßnahmen in ein nachhaltiges Präventionskonzept eingebettet werden müssen, ist zu allgemein. Nachhaltig kann eine Suchtprävention nur sein, wenn verschiedene Akteure aus den Bereichen der Medizin, sozialer Einrichtungen, Polizei, Schulträger, Fortbildungsinstitute und schulpsychologischer Dienste mit Schulen und Eltern zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit sich verpflichten würden. Der Hinweis, dass Lehrkräfte über die Entstehung von Suchthaltungen informiert sein müssen und an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen sollen, ist wichtig. Allerdings sehen wir hier eher einen zentralen Aufgabenbereich der 1. und 2. Phase der Lehrerausbildung. 2. Beratungslehrkraft für Suchtprävention Die Ausführungen zu diesem Punkt sind sehr umfangreich und belegen die besondere Bedeutung dieses Amtes. Aus der Auflistung der Aufgaben wird deutlich, dass Beratungslehrkräfte sehr stark gefordert sind. Dass die Lehrkräfte in Erfüllung ihrer Aufgaben ein notwendiger Freiraum gewährt werden muss, ist sinnvoll, aber in der allgemeinen Form wenig aussagekräftig. Hier wünschen wir beispielhafte Erklärungen zur Gewährung des Freiraums. Die Aufgabenerfüllung benötigt Kenntnisse sowie Beratungs- und Handlungskompetenzen. Aus unserer Sicht erfordert die sachgerechte Aufgabenerfüllung auch das Angebot einer psychologischen Betreuung. Wegen der vielfältigen und zeitintensiven Arbeit bei der Betreuung gefährdeter Schüler wie auch bei der Umsetzung eines nachhaltigen Präventionskonzepts sind Entlastungsstunden zu gewähren. 3. Verhalten bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten In diesem Abschnitt wird der pädagogische Aspekt der Präventionsarbeit hervorgehoben, dass gefährdete Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Beratung und Unterstützung durch die Schule haben. Auf die enge Zusammenarbeit mit den Eltern wird ebenfalls hingewiesen. Welche Maßnahmen Schulen allerdings in dem Fall ergreifen können, der bei einer Gefährdung der Mitschülerinnen und Mitschüler u. a. beim Handel mit Drogen eintritt, wird hier nicht näher ausgeführt. Gerade in schwerwiegenden Fällen muss eine Verwaltungsvorschrift für alle Beteiligten Rechtssicherheit schaffen. 10 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
11 Recht Richtlinie Verbraucherbildung an allgemeinbildenden Schulen Unsere Stellungnahme: Verbraucherbildung ist wegen der rasanten Entwicklungen in den Bereichen des Lebens, in denen Konsum stattfindet, gerade für die heranwachsenden Menschen wichtig. Insofern gewinnt die Verbraucherbildung an den Schulen zunehmend an Bedeutung. Wesentliche Aufgabe der Verbraucherbildung ist nach den Richtlinien die Wertevermittlung. Eine Wertevermittlung bedarf grundsätzlich der Mitarbeit der Eltern. Eine Richtlinie Verbraucherbildung muss daher eine Zusammenarbeit mit den Eltern als eine wesentliche Rahmenbedingung der Verbraucherbildung thematisieren. Im vorliegenden Entwurf wird der Aspekt der gemeinsamen Verantwortung von Eltern und Schule nicht aufgegriffen. Hier sehen wir die Notwendigkeit der Ergänzung. Die Nachhaltigkeit der Verbraucherbildung hängt sehr stark von der Kooperation mit externen Partnern ab. Die Einbeziehung von Partnern aus der Praxis ermöglicht die erforderliche Praxisnähe. Auf die Bedeutung dieser Partner wird in der Richtlinie lediglich unter dem Methodenaspekt hingewiesen. Aus unserer Sicht reicht dies nicht aus. Die Richtlinie muss den Aspekt der Kooperation mit externen Partnern in einem eigenen Abschnitt umfassender behandeln. Als Kernbereiche der Verbraucherbildung werden Finanzkompetenz und Konsum, Ernährung und Gesundheit sowie Datenschutz genannt. Den letzten Kernbereich zu sehr auf den Datenschutz zu fokussieren, überzeugt u. E. nicht. Zur Verbraucherbildung gehört auch die Vermittlung der Informationskompetenz, also der sachgerechte Umgang mit Informationen und Daten. Die Wahlpflichtfächer der Realschule plus können auch aus unserer Sicht einen besonderen Beitrag in den Querschnittsthemen für die Verbraucherbildung leisten. Für den Wahlpflichtfachunterricht empfehlen wir, dass ein Curriculum speziell für die Querschnittsthemen der neuen Wahlpflichtfächer von der 6. bis zur 10. Klasse erstellt wird. Das Curriculum kann als Orientierungshilfe für andere Fächer dienen und damit im Sinne der Richtlinie die Grundlage für ein schlüssiges Konzept schulischer Bildung durch eine verstärkte Kooperation der Fächer bieten. Auch die Ganztagsschule kann in starkem Maße zur Verbraucherbildung beitragen. Dies sollte in der Verwaltungsvorschrift Erwähnung finden. Eine weitere Voraussetzung für eine wirksame Integration der Verbraucherbildung in ein Konzept schulischer Bildung ist, dass Inhalte der Verbraucherbildung in der Lehreraus- und -weiterbildung verankert werden. Wilfried Rausch Stv. Landesvorsitzender Ref.: Dienst- und Schulrecht Das Bildungspaket Ab 1. Januar 2011 haben Schülerinnen und Schüler aus hilfebedürftigen Familien einen Rechtsanspruch auf Bildungsförderung. Das Bildungspaket besteht aus folgenden Komponenten: 1. Schulbasispaket Aus diesem Paket können Anschaffungen wie Schulranzen, Taschenrechner und Zirkel getätigt werden. Daneben werden auch eintägige Schulfahrten aus diesem Topf bezuschusst. 2. Lernförderung Die Finanzierung außerschulischer Lernförderung wird ermöglicht. Voraussetzung ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Notwendigkeit einer Lernförderung feststellen und bescheinigen. 3. Das warme Mittagessen in Ganztagsschulen Eltern erhalten einen Zuschuss zum Mittagessen, wenn der Schulträger ein Mittagessen anbietet. Verfügung gestellt, die für Musikunterricht, außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit eingelöst werden können. Die Umsetzung erfolgt durch die Jobcenter bzw. durch die Kommunen. 4. Außerschulische Bildung: Kultur, Sport und Mitmachen Den Familien werden personengebundene Gutscheine zur Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales reale Bildung reale Chancen Realschule 11
12 Schulpolitik Steuerungsgruppen zur FOS-Einrichtung an Optionsschulen * Ein Vergleich mit der Wirtschaft Vergleiche zwischen Schule und Wirtschaft hinken. Deshalb reagieren Pädagogen oft irritiert, wenn zunehmend Wirtschaftbegriffe wie Standortsicherung oder Kundenorientierung in die schulischen Diskussionen einfl ießen. Andererseits verschaffen Vergleiche neue Sichtweisen. Deshalb sei hier der Versuch eines Vergleichs am Beispiel der Einführung der Fachoberschule in Rheinland-Pfalz gewagt: Ein mittelständisches Chemieunternehmen mit etwa 60 Mitarbeitern ( Realschule plus) produziert im Wesentlichen 2 Produkte, nämlich Kosmetika und Bodenpflegemittel ( Berufsreife und Mittlere Reife). Im Sinne einer Verbreiterung der Produktpalette entschließt man sich, in einer weiteren Sparte Arzneimittel ( Fachhochschulreife) herzustellen. Zur Vorbereitung der neuen Abteilung wird 10 Monate vor dem Start eine Steuergruppe gebildet. Sie besteht aus dem Firmenchef ( Rektor der Realschule plus) und zwei Mitarbeitern ( Lehrkräften). Eigentlich sollte auch noch der neue Abteilungsleiter ( FOS-Koordinator) mitwirken, aber den gibt es noch nicht. Da ist noch ein umfangreiches Bewerbungs- und Auswahlverfahren abzuwarten. Das Dreier-Team soll sich nun mit Elan an die Arbeit machen. Dabei muss jedes Mitglied im Stammwerk ( Realschule plus), das nach dem ersten Jahr seines Bestehens auch noch viel Planungsarbeit erfordert, mit vollem Einsatz genau wie bisher arbeiten und sein gesamtes Pensum erfüllen. Den Steuerungsgruppenmitgliedern wird allerdings angeboten 1 ½ Stunden pro Woche unbezahlte Überstunden zu machen, mit der vagen Aussicht, diese im kommenden Jahr abzufeiern. In den 90 Minuten pro Woche, das Lehrkräfte benachbarter BBS Schulbehörde (ADD) Schulleiter/in FOS-Koordinator/in 2 Lehrkräfte (WPF und Kernfach) sind etwa 45 Stunden bis zum Beginn der Produktion, hat das Team beachtliche Aufgaben zu schultern: Entwicklung eines standortspezifischen Produktionsprozesses ( Schulkonzept) Aufbau eines Kundenstammes ( Einzugsbereich) Auswahl der Produktionsmittel ( Lehrmittel, Schulbücher) Organisation des Einkaufs und des Verkaufs ( Aufnahmeverfahren) Kooperation mit der Arbeitsverwaltung ( Praktikumsplätze) Kontaktaufnahme und Absprachen mit Nachbarfirmen ( Nachbarschulen) Organisation des Mitarbeitereinsatzes ( Stundenplan) Erstellung eines Fortbildungskonzepts (Für Fortbildungsmaßnahmen stehen (!) zur Verfügung.) Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation des neuen Angebots in den Medien und im Internet Vorträge zum neuen Produkt ( Schüler/Eltern-Info-Abende) Einbeziehung von Potential aus der Wissenschaft ( BBS-Lehrkräfte) Regelmäßige Kommunikation des Konzepts mit den Mitarbeitern des Stammwerkes ( Gesamtkonferenz) Beirat mit Vertretern - des Schulträgers - der Wirtschaft - der Kammern - der Eltern - der Nachbarschulen Gesamtkonferenz Kooperation mit den Genehmigungsbehörden ( ADD) Aufbau eines Beirats für die neue Abteilung mit Vertretern der Wirtschaftsverbände ( Nachbarschulen) der Kammern der Verbraucher ( Eltern) der Standortgemeinde ( Schulträger) der Gewerkschaften (???) Vielleicht haben Sie einen Betriebswirt (z.b. Unternehmensberater) in Ihrem Bekanntenkreis. Fragen Sie ihn doch einmal, wie er das Vorgehen des Betriebes beurteilt. *Grundlage: Einrichtung von Fachoberschulen an Realschulen plus - Bildung von Steuerungsgruppen, Amtsblatt Nr. 8 / 2010, S. 253 Wolfgang Häring Pressesprecher Ref.: Fachoberschule (FOS) Haering.Wolfgang@vdr-rlp.de 12 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
13 FOS Noch Fragen offen? Im Zusammenhang mit dem Start der FOS im nächsten Schuljahr erreichten den VDR viele Fragen von Lehrkräften, Schulleitern, Schulträgern, Eltern und Schülern. Die Anzahl der Rückfragen spiegelt das große Interesse, das dem neuen Bildungsweg entgegengebracht wird. Landesvorsitzender Bernd Karst und FOS-Referent Wolfgang Häring haben diese Fragen mit den Experten aus dem Bildungsministerium Ottmar Schwinn und Herbert Petri erörtert. Der VDR wird die häufig gestellten Fragen (FAQs) und die entsprechenden Antworten spätestens Anfang Januar 2011 auf unserer Homepage unter FOS veröffentlichen. Eine kleine Auswahl häufig gestellter Fragen sei hier bereits vorgestellt: Schulpolitik Aufnahmevoraussetzungen und Anmeldung: Dürfen sich auch Schüler der 10. Klassen aus dem Gymnasium, der Integrierten Gesamtschule oder der Hauptschule anmelden? Können Schüler nach der 9. Klasse eines G8-Gymnasiums aufgenommen werden? Werden Schüler der eigenen Schule bevorzugt aufgenommen? Zählt das Halbjahreszeugnis oder das Jahreszeugnis für die Aufnahme? Was passiert, wenn mehr als 60 Anmeldungen für eine FOS an einer Schule vorliegen? Wann werden die Schüler informiert, ob sie an der FOS aufgenommen sind? MBWJK: Herbert Petri, Ottmar Schwinn; VDR: Bernd Karst, Wolfgang Häring in allen Ländern der Bundesrepublik anerkannt? Was muss man tun, wenn man nach der Fachhochschulreife noch die allgemeine Hochschulreife erwerben möchte? Kann man mit dem Fachabi an der Fachhochschule alle Fachrichtungen studieren? Wolfgang Häring Pressesprecher Ref.: Fachoberschule (FOS) Schule und Praktikum: Welche Fächer sind versetzungsrelevant? Muss der Praktikumsvertrag bereits bei der Anmeldung vorgelegt werden? Gibt es eine Begrenzung der räumlichen Entfernung zum Praktikumsplatz? Gibt es Fahrtkostenerstattung für die Fahrt zum Praktikumsplatz? Wird das Praktikum benotet? Abschluss und Berechtigungen: Wie ist die Abschlussprüfung gestaltet? Wird die an der Fachoberschule in RLP erworbene Fachhochschulreife schule Realschule Realschule Realschule Realschule Realschule VERBAND DEUTSCHER Realschule REALSCHULLEHRER Realschule Landesverband Rheinland-Pfalz e.v. Zweite erweiterte Auflage FOS VDR chule F ach Realschule o ber s an der Realschule plus schule Realschule Realschule Realschule Realschule schule Realschule Eine Information Realschule für Lehrkräfte, Realschule Eltern, Schulträger, Praktikumsbetriebe sowie Schülerinnen und Schüler Die ausführliche Informationsbroschüre des VDR zur FOS wurde erweitert und neu aufgelegt. Zu beziehen über Gudrun Deck Deck.Gudrun@vdr-rlp.de zum Preis von: 1 bis 10 Exemplare je 3,00 11 bis 25 Exemplare je 2,00 > 25 Exemplare je 1,50 reale Bildung reale Chancen Realschule 13
14 Schulpolitik Neues Pädagogisches Landesinstitut gestartet Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz Am 1. August 2010 wurde das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL) gegründet. Darin sind die bisherigen Pädagogischen Service Einrichtungen, das Institut für schulische Fortbildung und Schulpsychologische Beratung (ifb), das Pädagogische Zentrum (PZ) und das Landesmedienzentrum (LMZ) zusammen geführt. Das PL gliedert sich in: 1. Personalentwicklung; 2. Schul- und Unterrichtsentwicklung, Medienbildung; 3. Schulpsychologische Beratung; 4. Zentrale Dienste und IT-Dienste; 5. Zentrum für Schulleitung und Personalführung. Die Aufgaben der bisherigen pädagogischen Serviceeinrichtungen des Instituts für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung (IFB) in Speyer mit seinen regionalen Fortbildungszentren in Speyer, Boppard und Saarburg sowie den 14 schulpsychologischen Beratungsstellen, des Pädagogischen Zentrums in Bad Kreuznach mit seinen sieben Außenstellen und des Landesmedienzentrums in Koblenz werden im neuen Landesinstitut gebündelt. Bildungsministerin Doris Ahnen hebt in einer Presseerklärung zum Schuljahresanfang hervor: Die Serviceleistungen für Schulen, Lehrer- und Schülerschaft sowie Eltern in den Feldern pädagogische und psychologische Beratung, Lehrerweiterbildung sowie Unterstützung in den Bereichen Medienbildung und Informationstechnologien sollen mit dem Aufbau des Pädagogischen Landesinstituts intensiviert und noch besser auf einander abgestimmt werden. Vom Start des neuen Landesinstituts erhoffen wir uns Synergieeffekte und ein noch effi zienteres Dienstleistungsangebot. VDR: Holpriger Start Aus Verbandssicht war der Start holprig. Die Erwartungen, die im Vorfeld der Planungen geweckt wurden, konnten nicht erfüllt werden. Es ist noch nicht erkennbar, wo die verbesserten Unterstützungsmaßnahmen für unsere Schulen sind. Seit Jahren fordert der VDR wirksame und nachhaltige Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu den Bereichen Umgang mit Heterogenität, individuelle Förderung und Differenzierung im Unterricht. Die Angebote für das 1. Halbjahr 2011 hierzu sind dürftig. In den schwierigen Phasen des Umgestaltungsprozesses, in denen sich die neuen Realschulen plus momentan befinden, sind überzeugende und praxiserprobte Veranstaltungen zu den aufgeführten Themenbereichen notwendig. Dass es anders geht, zeigen die Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der neuen Wahlpflichtfächer. Hier wurde rechtzeitig ein Konzept für den neuen Wahlpflichtbereich entwickelt und umgesetzt: Qualifizierte Fachmoderatoren stehen den Schulen zur Verfügung und können landesweit die Realschulen plus bei der Umgestaltung des Wahlpflichtfachbereichs unterstützen. Neu strukturiertes Beratungssystem Fachberater abgeschafft Mit der Errichtung des neuen Landesinstituts endete auch die Tätigkeit der Fachberater an den Realschulen, die bei der ADD angesiedelt waren. Begründet wurde die Auflösung damit, das Beratungssystem neu zu strukturieren und wegen der Synergieeffekte im neuen Institut anzusiedeln. Die Fachberatertätigkeit an den Realschulen war eine bewährte Einrichtung. Sie garantierte ein an den Bedürfnissen der Realschulen orientiertes Beratungs- und Fortbildungsangebot, das in Abstimmung mit der ADD in den Regionen zum Tragen kam und eine Vernetzung der Schulen ebendort ermöglichte. Der Realschullehrerverband erwartete vom neuen Beratungssystem mindestens die Fortführung der bewährten Beratungspraxis. Dies ist bisher nicht geschehen. Im neuen Beratungssystem tauchen zwar einige bekannte Fachberater mit der neuen Bezeichnung Beraterinnen und Berater für Unterrichtsentwicklung auf, aber hier gibt es lediglich für die Naturwissenschaften ein breites Beratungsangebot. Für die Hauptfächer Deutsch und Englisch und auch für Französisch gibt es (noch) keine im Fortbildungskatalog für das 1. Halbjahr 2011 ausgewiesene Beratung und Prozessbegleitung. Die Versäumnisse lassen sich vielleicht dadurch erklären, dass die Hausaufgaben zum Start nicht vollständig erledigt werden konnten. Sicherlich ist es nicht einfach, aus drei unterschiedlichen Instituten mit unterschiedlichen Philosophien und Leitungsstrukturen eine neue Einheit zu schaffen. Umso wichtiger wäre es gewesen, zum Starttermin eine neue Leiterin bzw. einen neuen Leiter des Pädagogischen Landesinstituts zu präsentieren. Wir wissen alle, wie wichtig eine Führungspersönlichkeit gerade für den Start eines neuen Landesinstituts ist. Wir werden die weiteren Entwicklungen des neuen Landesinstituts konstruktiv-kritisch begleiten und darauf achten, dass die Versprechungen der Bildungsministerin eingelöst werden. Wilfried Rausch Stv. Landesvorsitzender Ref.: Dienst- und Schulrecht 14 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
15 Sie geben alles. Wir geben alles für Sie. Mit dem optimalen Schutz von Anfang an. Spezialist für den Öffentlichen Dienst. Dienstanfänger-Police Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit Einstieg in die private Altersvorsorge mit reduziertem Anfangsbeitrag Vision B Umfassender Krankenversicherungsschutz für Beihilfeberechtigte Beitragsfrei mitversichert sind medizinische Dienstleistungen Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen Dienst geben wir alles für Sie mit Produkten, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So wie die speziellen Absicherungen für LehramtsanwärterInnen. Sprechen Sie jetzt mit Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe. Mehr Informationen: oder unter Tel * * 9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent, jeweils je angefangene Minute. Vom dbb vorsorgewerk empfohlen! Ein Unternehmen der AXA Gruppe
16 Schule und Gesundheit Land will Institut für Lehrergesundheit in Mainz gründen Zur verbesserten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der mehr als staatlichen Lehrkräfte sowie der knapp pädagogischen Fachkräfte will das Land ein Institut für Lehrergesundheit an der Universitätsmedizin Mainz gründen. Staatssekretär Michael Ebling betonte darin: Mit diesem Schritt wollen wir Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung für alle Lehrerinnen und Lehrer weiterentwickeln. Damit tragen wir auch den wachsenden Anforderungen an den Berufsalltag der Lehrkräfte Rechnung und leisten einen wichtigen Beitrag, die Schulqualität weiter zu verbessern. Das Konzept für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung von Lehrkräften sieht unter anderem vor, mit Hilfe mobiler Betreuungseinheiten flächendeckend im Land eine arbeitsmedizinische Betreuung von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften sicherzustellen und ein Netzwerk zu allen für das schulische Gesundheitsmanagement Verantwortlichen zu knüpfen. Zu den Aufgaben des Instituts soll unter anderem auch die individuelle Beratung von Lehrkräften und Schulleitungen, die Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und die Beratung bei der Wiedereingliederung von langfristig Erkrankten gehören. Kommentar Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht Zur Gründung eines Instituts für Lehrergesundheit Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, so steht es im Lukas-Evangelium (Kap. 5, Vers 31) geschrieben. Gemessen an diesem Bibelzitat muss es um uns rheinland-pfälzische Lehrerinnen und Lehrer schlecht bestellt sein. Wir sind allem Anschein nach gesundheitlich so angeschlagen, dass uns mit einem Arzt nicht mehr zu helfen ist, wir brauchen ein Institut für Lehrergesundheit. Die rheinland-pfälzische Landesregierung gab am die Gründung eines solchen Institutes in Mainz bekannt. Mit diesem Schritt wollen wir Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung für alle Lehrerinnen und Lehrer weiterentwickeln. Damit tragen wir auch den wachsenden Anforderungen an den Berufsalltag der Lehrkräfte Rechnung (...), verkündete der Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (MBWJK), Michael Ebling. Ob die Institutsgründung nun aus Fürsorge geschieht oder auf die steigenden Versorgungsausgaben für frühpensionierte Pädagogen zurückzuführen ist, bleibt offen. Das Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Mainz hat im Auftrag des MBWJK ein umfassendes Konzept für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung von Lehrkräften entwickelt. Im Abschlussbericht über das Projekt Konzeptentwicklung einer arbeitsmedizinischen Betreuung von Lehrkräften in Rheinland-Pfalz heißt es: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern (...) besteht in Rheinland-Pfalz derzeit keine adäquate und rechtskonforme arbeitsmedizinische Betreuung der ca Lehrkräfte des Landes. Mainz ist demnach darum bemüht, eine Rechtslücke zu schließen. Dass der Fürsorgegedanke nicht immer das leitende Motiv der Landesregierung ist, wissen wir aus unserem Berufsalltag. Die Landesregierung ist es, die mit immer neuen Aufgaben für die Schulen, mit einer übersteigerten Anspruchshaltung auf der einen und einer vergleichsweise geringen Unterstützung auf der anderen Seite einen wesentlichen Anteil an den krankheitsverursachenden schulischen Rahmenbedingungen hat. Dazu heißt es im Forschungsbericht: Die Rahmenbedingungen des Lehrerberufes führen dazu, dass Lehrkräfte z.t. erheblichen psychomentalen, physikalischen, biologischen und chemischen Belastungen ausgesetzt sind. (...) Diese Belastungen führen bei Lehrkräften vermehrt zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit und einem vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand. In Lehrerohren klingt deshalb die Aussage des Staatssekretärs Ebling, die Institutsgründung ermögliche die weitere Entwicklung präventiver Maßnahmen des Gesundheitsschutzes wenig überzeugend. Die Landesregierung sollte primär für adäquate schulische Arbeitsbedingungen und eine Reduzierung der oben aufgeführten Belastungen Sorge tragen, ein Landesinstitut kann dann sekundär von therapeutischem Nutzen sein. Sollte darüber hinaus noch Rat benötigt werden, ist die Rückbesinnung auf alte Volksweisheiten oftmals aufschlussreicher und billiger als die Gründung von Instituten. So heißt es in einer Redewendung wahrhaft und weise: Wer arbeitet über die Kraft, der hat bald ausgeschafft. Um Missverständnisse zu vermeiden: Der VDR begrüßt, dass sich das MBWJK des Themas Lehrergesundheit in Form der Institutsgründung verstärkt annimmt. Schließlich haben Personalräte und Lehrerverbände jahrelang auf die Problematik aufmerksam gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Institut nicht auf die Therapie der Symptome beschränkt, sondern dem Ministerium Vorschläge macht, wie die Arbeitsbedingungen verbessert und die Belastungen der Lehrkräfte verringert werden können. Schließlich ist vorbeugen immer besser als heilen. Michael Eich komm. Bezirksvorsitzender Neustadt 16 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
17 Schule und Gesundheit Erneut PCB-Belastung an einer Schule Kaum scheinen die Schadstoffbelastungen an der Erich-Kästner-Realschule Hermeskeil in der öffentlichen Diskussion verstummt, wurden an einer weiteren Realschule im Land Schadstoffe, die auf PCB zurückzuführen sind, festgestellt: dieses Mal an der Otto-Hahn-Realschule in Bitburg. Seit Sommer 2009 ist ein Gefahrenpotential in das öffentliche Interesse gerückt, welches viele bereits vergessen oder verdrängt hatten: PCB-Schadstoffe in Schulen. Die Ereignisse an der Erich-Kästner- Realschule Hermeskeil haben die PCB-Problematik wieder in den Fokus der Gesundheits- und Schadstoffbelastungsdiskussion gebracht, zumindest kurzzeitig. Mit der Otto-Hahn-Realschule Bitburg hat es nun eine weitere Schule getroffen. Hintergrund: PCB PCB sind weniger durch akute Giftigkeit bekannt, vielmehr durch ein erhebliches Risiko bei ständiger Belastung. Sie können nur sehr schwer biologisch abgebaut werden und durch ihren lipophilen (fettlöslichen) Charakter lagern sie sich sukzessive im Fettgewebe von Tieren und Menschen an. In einer Tierversuchsreihe mit PCB wurde eine krebserregende Wirkung nachgewiesen, darüber hinaus wiesen die Forscher Schädigungspotential des Immunsystems und der Nerven nach. Polychlorierte Biphenyle (PCB) C 12 H 10-x Cl x Verwendung In den 80er Jahren wurde PCB im großen Maße hergestellt und vor allem als Weichmacher in Kunststoffen (Fugendichtungen und Deckenverkleidungen) und als Flammschutzmittel in Wandfarben, Lacken und Klebstoffen verwendet. Seit dem Jahr 1989 sind die Herstellung und die Verarbeitung von PCB in Deutschland grundsätzlich verboten, seit 2001 durch das Stockholmer Übereinkommen sogar weltweit. Aber weit vor den 80er Jahren wurde PCB bautechnisch eingesetzt. So auch im aktuellen Fall in Bitburg. Grenzwerte Als Reaktion auf die enorme Gefährdung wurden sogenannte PCB-Richtlinien erlassen, die eine eindeutige Kategorisierung erlauben. Die Gefahren der PCB sind sehr vielseitig und daher sehr ernst zu nehmen: Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen Schädigung des zentralen Nervensystems Schädigung der Haut, der Leber, der Nieren und des Blutes Beeinträchtigung des Immunsystems Fruchtschädigend für den Menschen Krebserregende Wirkungen Der VDR fordert die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht darauf hinzuwirken, dass an Schulgebäuden, die in den 80er Jahren oder früher erbaut wurden, Messungen durchgeführt werden. Es kann nicht sein, dass man sich der Gesamtproblematik immer nur dann annimmt, wenn mal wieder ein Fall publik gemacht wird. Timo Lichtenthäler Ref.: Delegierte, Newsletter Lichtenthaeler.Timo@vdr-rlp.de Bleib entspannt. Mach dich schlau. Unter dem Motto "Bleib entspannt. Mach dich schlau." startet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine neue Initiative zur Sexualaufklärung für Jugendliche. Ziel ist es, Heranwachsende zu befähigen, bei sexuellen Kontakten rechtzeitig miteinander über Verhütung zu sprechen und sie für riskante Situationen zu sensibilisieren. Dabei sollen insbesondere Jungen angesprochen werden, in punkto Verhütung mehr Verantwortung zu übernehmen. Mädchen sollen darin bestärkt werden, Verhütung durchzusetzen. Die neue Initiative ist crossmedial aufgestellt. Im Mittelpunkt steht das bewährte Internetportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Liebe, Sex und Verhütung. Dort erhalten Jugendliche Antworten auf alle Fragen rund um Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Regelmäßig finden hier Expertenchats statt und in den Chaträumen von "Loveline-City", einer grafisch gestalteten Chatwelt, können sich Mädchen und Jungen über ihre Erfahrungen austauschen. sexualaufklaerung reale Bildung reale Chancen Realschule 17
18 Recht Zwischenergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitstudie Auf der Fachtagung Digitale Medien Impulse für die Qualität von Schule und Unterricht am 8. November in Mainz stellte Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz folgende Zwischenergebnisse einer wissenschaftlichen Begleitstudie zum Projekt Medienkompetenz macht Schule vor: Alle Schulen sehen ihre Beteiligung an dem Programm als große Chance, sich weiter zu entwickeln und die Medienkompetenz noch stärker zu fördern. Die Unterrichtsentwicklung in den Schulen hat über das Programm einen neuen Schub erhalten. Die Grundkompetenzen von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit Textverarbeitungs- und Präsentationssoftware konnten erheblich verbessert werden. Die Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber zweifelhaften Internetangeboten ist erheblich kritischer geworden. Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern verschiedener Schularten konnten über den Einsatz digitaler Medien deutlich reduziert werden. Die Lehrkräfte fühlen sich im Umgang mit digitalen Medien erheblich sicherer. Quelle: PM MBWJK vom DURCHBLICK Die Verschiedenheit der Köpfe ist ein großes Hindernis aller Schulbildung. Darauf nicht zu achten, ist der Grundfehler aller Schulgesetze... Quelle: Friedrich Herbart ( ), zitiert nach SchulVerwaltung, Heft 9/2009, S. 242 Digitale Übergriffe in der Schule: Wie kann ich mich schützen? Die Bezirksversammlung in Koblenz informierte über das Medienrecht an Schulen In seiner diesjährigen Bezirksversammlung informierte der VDR zu einem hochaktuellen Thema. Als Referentin eingeladen war Frau Antonia Dufeu, die seit 2003 als selbständige Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Medienrecht an Schulen in Mainz tätig ist. Ihr Vortrag umfasste folgende Themen: Aufsichtspflichten bei Internetnutzung Persönlichkeitsrechte Handy in der Schule Das Nutzen der neuen Medien in den Schulen impliziert, dass die Schulen viele unterschiedliche Rechtsgebiete wie das des Zivilrechts, Urheberrechts, Strafrechts, Wettbewerbsrechts beachten müssen. Hochrangig zu bewerten sind die Aufsichtspflichten der Schule gegenüber den Schülern. Diese müssen bei der Nutzung des Internets im Rahmen des Unterrichts gewährleistet sein. So muss ein Lehrer in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sich seine Schüler im Unterrichtsgeschehen nicht mit jugendbeeinträchtigenden Inhalten beschäftigen. Der Umfang seiner Aufsichtspflicht wird bestimmt durch das Alter der Schüler und das Gefahrenmaß, welches aber durch geeignete Filterprogramme gemindert werden kann. Diese Aufsichtspflichten können nicht Aufsichtspfl icht bei Internetnutzung? Cyber-Mobbing? Handy in der Schule? zuletzt durch eine umfangreiche Information der Schüler vor der Nutzung des Internets erleichtert werden. Die Internetnutzung an Schulen birgt die Gefahren der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch veröffentlichte Fotos, Videos oder Texte im Internet, von denen die Betroffenen entweder nichts wissen oder deren Veröffentlichung sie nicht zugestimmt haben. Auch der Tatbestand der Aufnahme von Fotos oder Videos kann schon Straftatbestände erfüllen, auch wenn eine Veröffentlichung nicht beabsichtigt ist. Videoaufnahmen durch die Lehrer müssen immer einen pädagogischen oder wissenschaftlichen Zweck erfüllen. Der Lehrer muss zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen differenzieren und die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Schüler schützen. Das heißt, dass der Lehrer in nicht-öffentlichen Bereichen zum Schutz der Privatsphäre des Schülers eine Genehmigung der Eltern und Schüler zur Veröffentlichung von Aufnahmen benötigt. Als Beispiel nichtöffentlicher Bereiche seien Klassenfahrten, Lehrerkonferenzen oder Elternabende genannt. Schülerveranstaltungen oder die Schulhomepage stellen dahingegen öffentliche Bereiche der Schule dar. Cyber-Mobbing bietet sich an als ein brandaktuelles Beispiel für Persönlichkeitsverletzung durch Internetnutzung. Cyber-Mobbing kann sich auf unterschiedliche Straftatbestände wie Belei- 18 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
19 Recht digungsdelikte, Körperverletzung auf Grund von psychischer Belastung, Nötigung oder Bedrohung beziehen. Die Rechtsansprüche der Opfer von Cyber- Mobbing sind umfangreich: Neben dem Anspruch auf der Verhinderung von Weiterverbreitung persönlichkeitsverletzender Bilder oder Texte, dem Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch, und dem Recht auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung kann das Opfer straf- und zivilrechtliche Schadenersatzansprüche geltend machen. Ein momentan heißdiskutiertes Beispiel für Cyber-Mobbing bietet die Social- Scoring-Plattform spickmich, in denen Lehrer durch Schülermeinungen subjektiv bewertet werden. Umstritten ist die Frage, ob Lehrerbewertungen Persönlichkeitsverletzungen darstellen oder ob sie durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sind. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sehen folgendermaßen aus: Bei der Lehrerbewertung sind die Verletzung des Persönlichkeitsrechts und das Recht auf freie Meinungsäußerung gegeneinander abzuwägen. Da die Lehrerbewertungen subjektiv sind, werden sie rechtlich dem Bereich der freien Meinungsäußerung zugeordnet. Gegen Diffamierungen ist man jedoch durch das Persönlichkeitsrecht geschützt. Der Betroffene hat dann das Recht auf Schadenersatz, auf Beseitigung sowie Unterlassensansprüche. Die Nutzung von Mobiltelefonen durch Schüler stellt einen weiteren Problembereich für die Schule dar. Jedoch bestehen in diesem Bereich konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen die illegale Nutzung. Als Präventionsmaßnahmen geeignet ist eine Nutzungs-Ordnung für Mobiltelefone während der Schulzeit, ein Verbot jugendgefährdender Inhalte auf den Mobiltelefonen sowie das Festlegen von Sanktionen bei Verstößen. Bei der Ausarbeitung von Handy-Ordnungen sollte immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden, der im Grundgesetz verankert ist und besagt, das der Eingriff in das Eigentum der Schüler geeignet und angemessen sein muss. Nicole Weiß-Urbach Bezirkskassiererin, Bezirk Koblenz Das VDR-Handbuch: Die ultimative Fundgrube für Lehrkräfte Kurzübersicht zur 48. Ergänzungslieferung Aktualisiert werden die Adressen Suchtberatungsstellen (1.14), die Schulrechts-Artikel Ebenen des Schulrechts (3.1), Elterliches Erziehungsrecht und staatlicher Bildungsauftrag (3.2), Schulverfassung (3.3), darüber hinaus die aktuellen Informationen zu Steuerfragen (5.40.2) sowie die Beiträge über die Schulaufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (14.20) und Aufsichtspflicht, Schülerunfallversicherung und Haftung (15.11). Neu aufgenommen bzw. neu bearbeitet werden folgende Beiträge: In der Reihe Beiträge zum Besoldungsrecht: Besoldung beamteter Lehrkräfte fehlte bislang das Kapitel Kindergeld. Das wird nun von Rainer Gierlich unter 5.8 eingebracht. Er geht ein auf die Anspruchsberechtigung, berücksichtigungsfähige Kinder, Beantragung des Kindergelds und die Folgen des Kindergeldanspruchs. Im ABC der Werbungskosten (5.40.4) werden die Buchstaben F, R und S aktualisiert. Autor Klaus Mader hat die anstehende Aktualisierung von A (wg. Arbeitszimmer) zurückgestellt, weil zur Zeit auf Bundesebene ein Vereinfachungsvorschlag diskutiert wird, künftig auf die umständliche und streitanfällige Prüfung zu verzichten, ob das Arbeitszimmer zu mindestens 90% beruflich genutzt wird. Im Übrigen (siehe ) ist die Regelung im Gesetzgebungsverfahren, dass Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer wieder bis höchstens Euro als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Schulgesetznovelle und die neue Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) haben die Ordnungsmaßnahmen neu verortet. Die flankierenden Maßnahmen bei drohendem Schulausschluss sind nunmehr geregelt. Bernd Weirauch passt seinen Beitrag Schulische Ordnungsmaßnahmen (10.1) diesen Gegebenheiten an. Die Schulstrukturreform ist seit dem in die aktive Umsetzungsphase getreten. Ottmar Schwinn benennt die ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen und bildungspolitischen Herausforderungen. Das Kernstück der Reform stellt er in seinem Beitrag Die Realschule plus im zweigliedrigen Schulsystem (14.5) vor. In seinem Beitrag Der Gestaltungsfreiraum der Lehrkraft (17.5) zeigt Hartmut Fischer Möglichkeiten der gestalterischen Freiheit in Unterricht und Erziehung auf und verdeutlicht sie an einigen Beispielen exemplarisch. Das VDR-Handbuch erscheint im Wingen-Verlag und ist die Sonderausgabe einer Loseblattsammlung, deren Grundwerk derzeit zum Preis von 29,00 EURO (zzgl. Versand und Porto) verkauft wird. Mit 1 bis 2 Ergänzungslieferungen jährlich wird das Werk regelmäßig erweitert und auf aktuellem Stand gehalten. VDR-Mitglieder erhalten die Ergänzungen zu einem ermäßigten Preis. Für Neumitglieder ist das Grundwerk das VDR-Begrüßungspräsent. reale Bildung reale Chancen Realschule 19
20 Lehrerbildung und Studienseminare VDR im Gespräch mit der Universität Trier Hanns Peters, Gerhard Klein und Birgitt Maczuck (Bezirksvorstand Trier) sowie Michael Eich (Bezirk Rheinhessen-Pfalz) trafen sich mit der Leiterin des Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) an der Universität Trier, Frau Professor Dr. Helga Schnabel-Schüle und der Geschäftsführerin, Frau Birgit Weyand zu einem erneuten Meinungsaustausch über Fragen zum aktuellen Stand der Lehrerausbildung. Studium Bachelor und Master Die Gesprächsteilnehmer sind sich einig, dass der heiße Herbst der Studentenproteste gezeigt habe, dass eine Nachjustierung des Reformkonzepts in Einzelaspekten notwendig ist. Die VDR-Vertreter verweisen auf frühere Stellungnahmen des Verbandes, in denen die jetzt öffentlich kritisierten Mängel bereits benannt worden sind. Das Ministerium habe u.a. die nachfolgenden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Studierenden an den Universitäten ins Auge gefasst: Die Anzahl der Prüfungen soll reduziert werden. Angestrebt wird ein flexibleres Zeitmanagement hinsichtlich der Module u. a. solle die strikte Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge des Modulstudiums aufgehoben werden. In einzelnen Fächern ist auch wieder ein Numerus clausus als Reaktion auf die steigende Zahl der Lehramtsstudierenden eingerichtet worden. Hinsichtlich der Kritik an der großen Zahl der Praktika werde u.a. erwogen, die Assistententätigkeit an einer Schule im Ausland für Studierende moderner Fremdsprachen als Praktikum anzuerkennen. Die VDR-Vertreter begrüßen dies sehr, da dies einer immer wieder seitens des Verbandes geäußerten Forderung entspreche. Positive Rückmeldungen der Studierenden gibt es laut Frau Schnabel- Schüle hinsichtlich der stärkeren Strukturierung des Lehramtsstudiums im Rahmen der Bachelor-Master- Studiengänge. Die inhaltliche Vielfalt bzw. die Qualität der Lehre habe unter der Einführung der curricularen Standards nicht gelitten auch wenn einige Medien oftmals das Bild vom alten Wein in neuen Schläuchen bemüht hätten. Der Reformprozess sei genutzt worden, mehr schulrelevante Themenbereiche verpflichtend ins Studium einzubeziehen. Nicht bestritten werde, dass es in einigen Fachbereichen Probleme bei der Umsetzung gegeben hätte. Die Qualität der Lehre werde nach wie vor beeinträchtigt durch die Tatsache, dass (deutschlandweit) die Zahl der Lehramtsstudierenden steige, ohne dass parallel dazu auf Seiten der Lehrenden eine bessere Personalausstattung an den Universitäten erfolgt. Das sei aber keine Folge der Reform, sondern ein lange bekanntes Grundproblem der Hochschulfinanzierung, denn mehr Köpfe bedeute gleichzeitig höhere Ausgaben. Was die freie Fächerwahl der Studierenden anbelangt, bedauern die Gesprächsteilnehmer, dass seitens des Ministeriums diesbezüglich gänzlich auf Lenkungsmechanismen verzichtet werde. Fächerkombinationen wie z.b. Geschichte und Sozialkunde seien laut Frau Professor Schnabel-Schüle nicht selten die Folge. Hier müsste die Studienberatung ansetzen; doch vor allem die Studierendenvertretung würde sich in diesem Bereich gegen Reglementierungen sperren. Die Vertreter des VDR betonen, dass bestimmte Fächerkombinationen die Einstellung in den Schuldienst erschweren, während sie mit Blick auf eine akademische Laufbahn durchaus sinnvoll sein können. Praktika Auf die Frage nach Rückmeldungen seitens der Studierenden über ihre Erfahrungen mit den Praktika an den Schulen, berichtet Frau Weyand, dass sich die Studierenden über die Orientierungspraktika mehrheitlich sehr positiv geäußert haben. So sei z.b. bei vielen die Einführungen/Arbeit an den Schulen in Kleingruppen sehr gut angekommen. Einschränkend müsse aber auch festgehalten werden, dass sich Studierende nicht an allen Schulen willkommen gefühlt hätten. Neben diesen inhaltlich positiven Rückmeldungen seien aber auch vermehrt Klagen über zeitliche Kollisionen der Schulpraktika mit Blockveranstaltungen, Prüfungen, Praktika in den Fächern, Lateinkursen und Auslandsaufenthalten von den Studierenden zu hören. Man könne insgesamt nicht von einem tatsächlich vorlesungsfreien Zeitraum ausgehen, in dem die Schulpraktika ohne Probleme platziert werden könnten. Die VDR-Vertreter verweisen auf kritische Rückmeldungen einzelner Studierender hinsichtlich der während der Praktika schriftlich zu bearbeitenden Themen aus den Aufgabenkatalogen (Portfolio). Sie hätten z.b. eine Besprechung ihrer Ausarbeitungen sowohl an den Universitäten als auch an einzelnen Schulen vermisst. Frau Weyand sieht dafür an den Universitäten weder die formale Zuständigkeit noch die notwendigen Voraussetzungen gegeben. Insofern müssten dies die betreuenden Lehrkräfte bzw. Fachleiter/-innen leisten und neben der Kontrolle formaler Kriterien auch ein inhaltliches Feedback geben. Die VDR-Vertreter geben zu bedenken, dass hierdurch für die betreuenden Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine weitere zeitliche Belastung entstehe, ohne dass ihnen hierfür eine Entlastung gegeben würde. Fachdidaktik Die augenblickliche Situation der Fachdidaktik an der Universität Trier müsse nach Fächern differenziert gesehen werden, konstatiert Frau Schnabel- Schüle. Die Fachbereiche Geschichte und Sozialkunde würden sich z. B. eine diesbezügl. Stelle teilen, die - auf fünf Jahre befristet mit einer Lehrkraft für besondere Aufgaben besetzt ist. Abordnungen mit halber Stelle aus dem Schuldienst für Fachdidaktik gebe es in den Fachbereichen Anglistik, Germanistik, Mathematik und In- 20 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
21 Lehrerbildung und Studienseminare formatik. Für die Fächer kath. Religion und Geographie seien schon lange Fachdidaktik-Professuren eingerichtet. Ingesamt sei die Situation der Fachdidaktik in Deutschland schlecht, moniert Frau Weyand. Mittel- und langfristig fehlt es an dem nötigen wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Bereich, weshalb auch die Besetzung von Juniorprofessuren schwierig sei. Einigkeit besteht bei den Gesprächsteilnehmern darüber, dass für die fachdidaktischen Bereiche Qualifizierungszirkel etabliert werden müssen, damit der notwendige wissenschaftliche Nachwuchs im Bereich der Fachdidaktik gesichert werden könne. Zudem können Lehrkräfte so Frau Weyand nur schlecht für die Tätigkeit an den Univer sitäten gewonnen bzw. gehalten werden, weil die Entlohnung dort im Vergleich mit der Bezahlung von Lehrerkräften geringer sei. Erschwerend komme hinzu, dass es in Rheinland-Pfalz nur Teilabordnungen an die Universitäten gäbe, was zur Folge habe, dass die Lehrkräfte sowohl an Sitzungen der Schule als auch an Sitzungen des jeweiligen Fachbereichs der Universität teilnehmen müssten und auch die Ferien- bzw. Urlaubszeiten an beiden Institutionen unterschiedlich seien. Diese Faktoren tragen mit dazu bei, dass eine Abordnung für Lehrkräfte unattraktiv sein könne. Die Vertreter des VDR verweisen auf eine möglicherweise weitere Hürde, denn es müsse sichergestellt werden, dass die Schulen adäquaten Ersatz für die abgeordneten Lehrkräfte bekommen. Realschule plus Frau Schnabel-Schüle informiert, dass zukünftig für jedes Fach ein zusätzliches, speziell auf den neuen Lehramtstudiengang Realschule plus ausgerichtetes Modul angeboten werden müsse, und zwar im Masterstudiengang. Für die Fächer Biologie, Chemie und Physik sowie für Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde würden jeweils übergreifende Bereichsfachmodule eingerichtet, die als zusätzliche Module im Rahmen der Fachausbildung anzusehen seien. Hier sollen fächerübergreifende Aspekte vermittelt werden, da viele Lehrkräfte, die eines der in den Bereichsfachmodulen angesiedelten Fächern studiert haben, in einem oder mehreren dieser Fächer fachfremd eingesetzt werden könnten. Damit solle aber, betont Frau Schnabel- Schüle, keine Tendenz zur Auflösung oder Aufweichung des Fachlehrerprinzips initiiert werden. Konsens besteht, dass das Fachlehrerprinzip eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Realschule war und daher erhalten bleiben muss. Insgesamt gebe es derzeit - so die Universitätsvertreterinnen zum Studiengang Lehramt Realschule plus wenig Konkretes zu sagen; die diesbezügl. Anhörung stehe noch aus. Studienseminare Frau Weyand hebt hervor, dass schon in der Vergangenheit die Zusammenarbeit der Universität Trier mit den Studienseminaren vor Ort sehr fruchtbar gewesen sei. Auch die Zusammenarbeit und Absprachen in Sachen Ausbildungsaufgaben wie auch im Bereich der Praktika funktionierten sehr gut. Herr Klein bestätigte dies, gab aber zu bedenken, dass die Betreuung der Studierenden während der 3-wöchigen Fachpraktika zu einer erheblichen Mehrbelastung der Fachleiterinnen und Fachleiter geführt habe, die während dieser Zeit ihren eigentlichen Aufgaben der Ausbildung der Lehramtsanwärter kaum mehr nachkommen können. Wünschenswert wäre auch, so Frau Weyand und Frau Schnabel-Schüle, wenn analog zur Entwicklung der curricularen Standards für die Universitäten auch die Module für die Ausbildung in den Studienseminaren unter Beteiligung der Universitäten gemeinsam entwickelt würden. Frau Weyand regt ferner eine Intensivierung der Kommunikation unter den Fachleitern landesweit an, auch unter Einbeziehung des ZfL. Daraus könnten sich positive Entwicklungseffekte in den fachbezogenen Zirkeln ergeben. Am Ende des sehr konstruktiv geführten Gesprächs dankten die VDR-Vertreter Frau Schnabel-Schüle und Frau Weyand für die erneute Möglichkeit des Gedankenaustauschs. Sie werden die Kontakte mit der Universität Trier zudem auch durch Veranstaltungen mit Studierenden intensivieren. Birgitt Maczuck Bezirk Trier Maczuck.Birgitt@vdr-rlp.de Hanns Peters Bezirksvorsitzender Trier Peters.Hanns@vdr-rlp.de Michael Eich komm. Bezirksvorsitzender - Neustadt Eich.Michael@vdr-rlp.de Lebenslanges Lernen Studie bescheinigt Deutschland nur Mittelmaß In Deutschland sind die Voraussetzungen für das lebenslange Lernen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur mittelmäßig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Der Grund: Investitionen in Schulen und Hochschulen seien zu gering. Die Stiftung hatte bereits vor rund einem Jahr errechnen lassen, welch hohe Rendite Investitionen in die Bildung ergeben würden. Eine Studie kam zum Ergebnis, dass dem deutschen Staat in den nächsten acht Jahrzehnten rund 2,8 Billionen Euro entgehen würden, wenn die meisten Risikoschüler nicht bald auf ein ordentliches Niveau gehoben werden. Gemeint sind Schüler, die im Alter von 15 Jahren noch nicht richtig rechnen und schreiben können. Weil sich Investitionen in Bildung nur langfristig auszahlten, würden ihre positiven Effekte allerdings häufig unterschätzt, beklagte die OECD. Quelle: SpiegelOnline reale Bildung reale Chancen Realschule 21
22 Lehrerbildung und Studienseminare Begrüßung der neuen Realschullehreranwärterinnen und -anwärter am Trierer Studienseminar Über 50 Realschullehreranwärterinnen und -anwärter folgten nach einem langen und anstrengenden Seminartag des AS der Einladung des VDR in die benachbarte Integrierte Gesamtschule Trier. Die Vertreter des Bezirksverbands Trier stellten den VDR, seine Ziele und Schwerpunkte sowie die Serviceleistungen vor. Hanns Peters begrüßte die jungen Kolleginnen und Kollegen und gab seiner Freude Ausdruck, dass so viele am Abend nach Uhr gekommen waren, was angesichts von Fahrtzeiten von nahezu 1,5 Stunden an die Schulstandorte bemerkenswert ist. Alle Teilnehmer erhielten eine VDR- Tasche mit aktuellen Ordnungen und den Wegweiser für Studenten und Realschullehreranwärter. Peters wies auf die Bedeutung des VDR hin, bei dem mehr als die Hälfte der Realschullehrerinnen und Realschullehrer organisiert seien. Holger Schwab betonte die Wichtigkeit des VDR in Zeiten der Schulstrukturreform, bei der insbesondere die Chancen durch differenzierte Wahlpflichtfächer zu sehen seien. Nina Lauer berichtete von ihren eigenen Erfahrungen während der Ausbildung am Studienseminar und gab einige Tipps sowie Ratschläge zum Ausbildungsstart. Insbesondere verwies sie auf das VDR-Handbuch, eine Fundgrube von Informationen und Anregungen, die über die Ausbildung und Prüfung hinaus im Lehrerleben wertvolle Hilfe leiste. (s. a. S. 19) Erwin Schneider berichtete von aktuellen Fragestellungen im Bezirkspersonalrat und hob die nach wie vor guten Chancen für eine Anstellung nach der Ausbildung hervor. Er betonte, dass der VDR sich für die Anstellung im Beamtenverhältnis möglichst vieler Absolventen einsetze. Die Tätigkeit von Hilfslehrern wie Studenten ohne Uni-Abschluss, Lehrern zum Billigtarif wie Absolventen Lehrer zum Billigtarif? Nicht mit dem VDR! der Universitäten zur Überbrückung der Zeit bis zum Beginn der Referendarzeit wird vom VDR zunehmend kritisch gesehen. So erklärte abschließend Gerhard Klein, dass es nicht angehe gerade in den Ganztagsschulen immer mehr Lehrer ohne pädagogische Ausbildung einzusetzen und nicht mehr nach der Qualität der Lehrertätigkeit zu fragen. Man werde um die Planstellen kämpfen, die nach der Ausbildung jungen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt werden müssen. Bei kühlen Getränken und warmen Fleischkäse saßen alle noch lange zusammen, stellten den VDR-Mitgliedern zahlreiche Fragen und wurden mit besten Wünschen für eine erfolgreiche Ausbildung verabschiedet. Hanns Peters Bezirksvorsitzender Trier Gerhard Klein VDR-Bezirksvorstand Trier 22 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
23 Lehrerbildung und Studienseminare Hochschultour an der Uni Trier VDR informiert über Referendariat Inzwischen führte der Bezirksvorstand Trier seine 3. Informationsveranstaltung in Zusam men arbeit mit der DBV Winterthur und dem Zentrum für Lehrerbildung der Universität Trier durch. Hanns Peters, Birgitt Maczuck, Erwin Schneider, Nina Lauer und Michael Eich stellten die Aufgaben und Ziele des Verbandes vor und gaben hilfreiche Tipps rund ums Referenda riat. Zu Beginn der Veranstaltung wurde über Grundsätze der Arbeit des VDR informiert. Hierbei war es ein wichtiges Anliegen, den Studierenden und zukünftigen Realschullehrern ein leben diges Bild der Verbandsarbeit zu vermitteln, bei der nicht nur die Interessensvertretung der ak tiven Lehrkräfte an Schulen, sondern auch die individuellen Belange der Studierenden an den Hochschulen und der Referendare an den Studienseminaren und Schulen durch besondere Aufmerksamkeit gewürdigt werden. Im Anschluss stellten die Bezirksvorstandsmitglieder die verschiedenen Studien seminar stand orte Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Mainz vor. Hierbei wurden unter anderem die jeweiligen Bewerbungsfristen und Ausbildungsbeginne genannt sowie auf die notwendigen Bewer bungsunterlagen hingewiesen. Von großem Interesse waren die Informationen, die Erwin Schneider als stellvertretender Bezirkspersonalratsvorsitzender den Lehramtsstudenten geben konnte. Er berichtet über die Vergabe von Seminarplätzen seitens der ADD und die damit ver bundenen Auswahlverfahren, aber auch über Einstellungschancen im Anschluss an den Vor be reitungsdienst. Die Anwesenden wurden zudem darüber informiert, welche Möglich keiten es gibt, für den Fall, dass man keinen Referendariatsplatz unmittelbar nach dem Stu dium er hält. In einer abschließenden Fragerunde standen die Mitglieder des Bezirksvorstandes den Lehr amtsstudenten Rede und Antwort. Es wurde deutlich, dass auf Seiten der Studierenden große Unsicherheit hinsichtlich des Vorbereitungsdienstes besteht. Aus Sicht des Verbandes ist es daher besonders wichtig, den angehenden Lehrern in einer Zeit der Umstrukturierung unterstützend zur Seite zu stehen. Die eigens vom Verband erstellte Infobroschüre Mein Weg ins Referendariat soll den Anwesenden als Orientierungshilfe dienen und Antworten auf häufig gestellte Fragen geben. Orientierungshilfen und Informationen zum bevorstehenden neuen Lebensabschnitt gab es auch von Herrn Mertens von der DBV Winterthur. Er informierte vor allem über die mit der Aufnahme des Beamtenverhältnisses einhergehenden Versicherungsmöglichkeiten. Nina Lauer Stv. Bezirksvorsitzende Trier VDR-PRESSEMITTEILUNG Erfolg für den VDR Zwei neue Studienseminare und weitere Seminarplätze für das Lehramt an Realschulen Der Realschullehrerverband (VDR) verlangt seit Jahren eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten der Studienseminare für das Lehramt an Realschulen, um unnötige Wartezeiten nach dem Studium zu vermeiden. So forderte der Landesvorsitzende Bernd Karst schon zu Jahresbeginn in einer Pressemitteilung die Landesregierung auf, in einem Sofortprogramm neue Studienseminare für das Realschullehramt evtl. zunächst als Außenstellen der bestehenden Seminare zu gründen, um den Bewerbern eine zeitnahe Chance auf einen Ausbildungsplatz nach dem Studium zu bieten. Schließlich habe der Staat das Ausbildungsmonopol für die Lehrämter. Vor dem Hintergrund der Altersstruktur der Lehrkräfte könne es sich kein Land leisten, den Nachwuchs derart abblitzen zu lassen. Nachdem diese Kritik damals vom Ministerium noch zurückgewiesen wurde, musste die Regierung nun doch handeln nicht zuletzt mit Blick auf die jüngsten VDR-Forderungen, keine Abstriche an der Unterrichtsqualität zuzulassen. In einer Pressemitteilung teilte das Bildungsministerium nunmehr mit: Für das Realschul-Lehramt entstehen zum 1. Februar 2011 insgesamt 70 neue Seminarplätze durch die Einrichtung eines neuen Studienseminars im Süden des Landes und die Aufstockung der Realschul- Seminare in Kaiserslautern und Koblenz von derzeit jeweils 80 Plätzen auf jeweils 90 Plätze. Zum 1. August 2011 seien dann für das künftige Lehramt an der Realschule plus die Einrichtung eines weiteren Seminarstandorts in der Mitte des Landes mit 50 Plätzen sowie die Aufstockung der Seminare in Mainz und Trier um jeweils 10 Plätze auf 90 Plätze vorgesehen. Der VDR erwartet nun, dass die Zahl der regulären Fachleiterstellen an den Seminaren endlich dem Bedarf angepasst wird. Seit Jahren wird der Mangel in diesem Bereich durch Lehrbeauftragte nur notdürftig überbrückt. Die herannahende Welle der Hochschulpraktikanten muss zusätzlich bewältigt werden. Mit der gegenwärtigen Personalausstattung können die Studienseminare ihrem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden. Weitere Informationen unter , V.i.S.d.P.: Wolfgang Häring, VDR-Pressereferent reale Bildung reale Chancen Realschule 23
24 Berufswahlunterricht Berufsorientierung mit Heavy Metal(l) : Mit pfi ffigen Ideen und gutem Projektmanagement Neues wagen! Der demographische Wandel wird als besondere Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Deutschland gesehen. Der daraus resultierende Fachkräftemangel, insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Berufen, wird viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Die Zukunft der Regionen hängt davon ab, ob es gelingt, junge, qualifi zierte Menschen vor Ort zu halten und ihnen wie auch den Wirtschaftsunternehmen Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Der Landkreis Altenkirchen hat mit dem Metall-Erlebnistag Lust auf Heavy Metal(l) ein Projekt ins Leben gerufen, das Unternehmen aus dem Bereich der Metall- und Elektrobranche mit Schülern und Schulen zusammenführt und damit weitere Möglichkeiten einer Berufsorientierung außerhalb der Schule eröffnet. Initiiert wurde der Metall-Erlebnistag von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbh (WFG). Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind Berno Neuhoff und Oliver Schrei. Berno Neuhoff ist zuständig für das Thema Fachkräftegewinnung. bzw. Aus- und Weiterbildung innerhalb der WFG Kreis Altenkirchen mbh. Ihn interviewte RSiRLP. RSiRLP Ihre Wirtschaftsförderung hat vor drei Jahren mit einem pfi ffi gen Titel ein ehrgeiziges Projekt entwickelt. Wie kam es dazu? Berno Neuhoff Die Idee kam aus den Reihen der Unternehmen, genauer gesagt von der Brancheninitiative Metall. Hierbei handelt es sich um das von der WFG initiierte Netzwerk mittelständischer Unternehmen im Metallbereich, die sehr frühzeitig die Herausforderungen einer schrumpfenden Bevölkerung und den drohenden Fachkräftemangel im Kreis Altenkirchen erkannt haben. Die regionalen Betriebe agieren heute fast alle weltweit, z.b. in Ländern wie China, Amerika, Indien und Südamerika. Wichtig ist es, Schule und Betriebe in einem frühen Stadium eng miteinander zu verzahnen. Die WFG ist da nur Mittler. Die Schulen bilden die künftigen Facharbeiter/-innen aus, die später einmal innovative Produkte entwickeln und damit Arbeitsplätze in unserer Region sichern. Hinzu kommt, dass Metallberufen immer noch ein falsches Image anhaftet. Es geht vor allem um Technik-Begeis- terung. Ölverschmierte Facharbeiter im Overall waren gestern. Heute kommt man in blitzsaubere Betriebe mit gut ausbildetem Fachpersonal, das moderne High-Tech-Maschinen programmiert und bedient. Die späteren Azubis im Maschinenbau fertigen weltweit innovative Produkte wie z.b. Porsche- Turbolader, Mähdrescherantriebe und können in diesem Rahmen zudem Auslandserfahrungen sammeln. Das alles zu transportieren, ist Grund für den Metall-Erlebnistag. RSiRLP War es schwierig, Schulen und Betriebe für das Projekt zu überzeugen? Berno Neuhoff Die Betriebe waren sofort hoch motiviert. Zunächst haben wir das Ganze als zentrale Messe in einem Betrieb mit passendem Rahmenprogramm gestartet. Bei der diesjährigen dritten Auflage sind wir dazu übergegangen, den Tag dezentral in über 20 Betrieben und dort in Kleingruppen, sozusagen unter Live-Bedingungen, zu gestalten. Bei den Schulen mussten wir bei einigen anfangs viel Motivationsarbeit leisten und unser Anliegen und Konzept: Gewinnung von Fachkräften, überzeugend erklären. Andere Schulen wie die Hauptschule und Realschule Altenkirchen und die Berufsschulen waren sofort mit von der Partie und haben als Katalysatoren für die Folgeveranstaltungen gewirkt. Wir haben aber auch erfahren, dass die Schulen mit Angeboten überschüttet werden und sich zu Recht fragen, wie das Verhältnis von Aufwand und Nut- Berno Neuhoff, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbh (WFG). Ein ehemaliger Realschüler der RS Wissen. zen ist. Aber mittlerweile hat sich ein kleines, gut funktionierendes Netzwerk im Kreis Altenkirchen herausgebildet. Wir als Wirtschaftsförderer organisieren die Plattform und begreifen uns, wie gesagt, als Mittler. RSiRLP Wie hoch war die Beteiligung der Schulen und Betriebe? Berno Neuhoff Insgesamt haben sich in diesem Jahr ca. 250 Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen in 22 Betrieben im gesamten Kreisgebiet freiwillig an diesem Tag beteiligt. Den Schulen danken wir für diese Motivationsarbeit in den verschiedenen Klassenstufen 8, 9 bzw. 10. Und das in Zeiten einer Schulreform, die den Schulen viel abverlangt. 24 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
25 Berufswahlunterricht RSiRLP In diesem Jahr wurde der Metall-Erlebnistag zum dritten Mal durchgeführt. Mit jedem Jahr haben Sie Neuerungen vorgenommen. Wie hat sich das Projekt entwickelt? Berno Neuhoff Wie gesagt, zunächst sind wir mit einem zentralen Messe- bzw. Ausstellerkonzept gestartet, bei dem Azubis und Meister ihren Betrieb, die Produkte und die Ausbildungsplatzmöglichkeiten dargestellt haben. Daran haben sich komplette Klassen beteiligt. Im nächsten Jahr konnten sich die Schülerinnen und Schüler freiwillig melden, die sich für Metall- und Elektroberufe interessierten. Das Konzept wurde zu einem sogenannten Praxistag umgestaltet, der durch das Prinzip Lernen auf Augenhöhe getragen wird. Die Schülerinnen und Schüler konnten im letzten Jahr im Team einen Metalladler bauen. Dieser wurde am Rechner mit den Schülern mittels moderner Zeichenprogramme konstruiert, in einer anderen Firma wurde das benötigte Material mit einem Wasserstrahl ausgeschnitten. Die Schüler fügten den Adler dann zusammen und in einer dritten Firma wurden Leuchtdioden als Augen eingebaut. Die Arbeitsgänge erfolgten unter fachlicher Anleitung. Das hat den meisten Schülern und Schülerinnen viel Spaß gemacht. Das Ergebnis durfte die Gruppe als Erfolgserlebnis nach Hause bzw. in die Schulen mitnehmen. RSiRLP Welche Rückmeldungen haben Sie von den Schulen und Betrieben in diesem Jahr erhalten? Berno Neuhoff Die Rückmeldungen waren durchweg sehr positiv. Natürlich gab es auch Anregungen von beiden Seiten, um das Projekt weiter voran zu bringen. Die Schulen und Fachlehrer haben, wie gesagt, fächer- und klassenübergreifend, Schülerinnen und Schüler mit unserem Infomaterial geworben und die Betriebe haben sich individuell ansprechende Praxisprojekte ausgedacht. Da haben die Betriebe freie Handhabe. Praktische Ergebnisse waren beispielsweise: ein Metallwürfel mit Aussparungen, ein Briefbeschwerer, ein Metallhalter für Stifte, ein Mini-Windrad. Die Kreativität unserer Betriebe kennt da keine Grenzen. Schön zu erleben war, mit welcher Begeisterung und Motivation die Jugendlichen mitgemacht haben. Sie haben geschliffen, gebogen und gebohrt und waren mit ganzem Eifer dabei. Zudem hat das Projekt zu Praktikastellen und sogar zu ersten Ausbildungsstellen für Schüler/-innen geführt. RSiRLP Die Schüler haben einen Evaluationsbogen erhalten? Wie bewerten die Schüler den Metall- Erlebnistag? Berno Neuhoff Insgesamt würde ich mal sagen, haben sie uns die Note gut ausgestellt. Klar erkennbar ist, dass der Charme des Metall-Erlebnistages Lust auf Heavy Metal(l) darin liegt, etwas Praktisches zu erarbeiten und sozusagen als Vorstufe zum Praktikum, den Betrieb und den Beruf praktisch und hautnah kennen zu lernen. Was sehr gut ankommt ist, wenn Azubis die Anleitung übernehmen und für Fragen der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Da ist die Hemmschwelle geringer. Das ist Lernen auf Augenhöhe und das möchten die Betriebe vertiefen und Azubis auch in den Schulunterricht entsenden. RSiRLP Haben Sie Äußerungen von Eltern bekommen? Berno Neuhoff Nur indirekt, weil wir ja mit Betrieben und Schulen bzw. den Schülerinnen und Schülern unmittelbar zusammenarbeiten. Ich weiß aber, dass Eltern teilweise ihre Kinder zum Betrieb gefahren und abgeholt haben und in einem Fall sofort ein konkretes Ausbildungsverhältnis entstanden ist. RSiRLP Gibt es auch Rückmeldungen aus dem politischen Raum? Berno Neuhoff Ja, von den Gesellschaftern der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen mbh. Sowohl die heimischen Regionalbanken, die das Projekt finanziell unterstützen, als auch der Landrat als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung haben sich unmittelbar sehr positiv geäußert und auch die heimische Presse sprach von einem individuellen Metall-Erlebnis(tag) in diesem Jahr. RSiRLP Wie sieht die weitere Entwicklung aus? Haben sich Ihre Erwartungen erfüllen können? Wie beurteilen Sie die Zukunft des Projekts? Berno Neuhoff Wir wollen im nächsten Jahr neben den Industriebetrieben auch das Handwerk im Metall- und Elektrobereich mit einbeziehen. Dort gibt es ebenfalls viel High-Tech. Man denke nur an die Nacht der Technik von der Handwerkskammer Koblenz. Ziel ist es, den Jugendlichen in Westerwald und Siegerland deutlich zu machen, welche High-Tech-Standards reale Bildung reale Chancen Realschule 25
26 Berufswahlunterricht unsere Betriebe vor Ort haben und dass man auch aus dem Westerwald heraus im Metallbereich gutes Geld verdienen kann, wenn man qualifiziert und leistungsbereit ist. Außerdem kann man auch aus dem Westerwald heraus weltweit Firmen aus anderen Kontinenten und Kulturen zusammenarbeiten. RSiRLP Wie werden Schulen und Lehrer in das Projekt eingebunden? Berno Neuhoff Es gab zwei Treffen im Vorfeld, damit der Praxistag im Unterricht entsprechend vorbereitet werden konnte und eine Nachlese mit den beteiligten Fachlehrern und Unternehmen. Von einigen größeren mittelständischen Betrieben waren sogar die Geschäftsführer dabei. Das zeigt, wie ernst man dieses Projekt nimmt und das freut uns. Auch die Termine für Mai 2011 und 2012 wurden bereits festgelegt. So können sich alle Beteiligten frühzeitig darauf einstellen. RSiRLP Sie haben in den Vorbereitungsund Nachbesprechungen Schulen und Betriebe an einen Tisch gebracht und die Gespräche moderiert. Welche Eindrücke haben Sie aus diesen Gesprächen gewinnen können? Berno Neuhoff Das man sehr, sehr ernsthaft bemüht ist gemeinsam in Sachen Fachkräftegewinnung zusammenzuarbeiten und den Kontakt sucht. Das Projekt bietet Entwicklungsperspektiven. So möchten die Unternehmen im Vorfeld des Metall-Erlebnistages eigene Azubis in die Schulen schicken, die für das Projekt, die Metallausbildungsberufe und die Unternehmen der Region werben. Man will sich innerhalb der Unternehmen frühzeitig und gezielt auf die Tages-Praktikanten aus den Schulen einstellen. Dabei ist nicht nur der Name wichtig, sondern Neigungen und die Fähigkeiten und Fertigkeiten der künftigen Azubis. Um Technikbegeisterung im Bereich Mathematik- und Naturwissenschaften zu wecken, gibt es von Seiten der Unternehmen erste Vorschläge zukünftig Projekte im Unterricht zusammen mit den Schülern zu entwickeln. Ein ehrgeiziges Ziel. Wir wissen natürlich auch, dass Schulen in Sachen Profilbildung, Gewinnung von Schülern viele andere Aufgaben haben und dass der Metall-Erlebnistag nur ein Projekt davon darstellt, aber ein sehr lohnendes. RSiRLP Die Durchführung eines so großen Projektes erfordert weitere Unterstützungsmaßnahmen. Wie sahen die Unterstützungen aus? Berno Neuhoff Unsere Arbeit besteht in der Vor- und Nachbereitung eines solchen Tages. Hauptarbeit ist für diesen Tag, Marketing, Transport und Logistik. 250 Schülerinnen und Schüler in 22 Betrieben müssen transportiert werden. Wichtiger ist aber die Vor- und Nachbereitung des Tages und vor allem die Netzwerkbildung zwischen Schulen, Betrieben und der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Wir machen gerne die Hauptarbeit und koordinieren das Ganze, vieles muss aber auch bilateral zwischen Schulen und Betrieben laufen, z. B. wenn Azubis in den Schulunterricht kommen sollen. Wir stehen neuen Betrieben aus Industrie und Handwerk offen gegenüber. Zur Unterstützung der Arbeit der WFG und zur Vorbereitung haben wir jetzt ein kleines Team aus einem Mitglied einer Schule, einer Job-Füxin, dem Marketingleiter eines mittelständischen Metallbetriebes und der Wirtschaftsförderung gebildet. Das hilft uns, unsere Arbeit besser zu machen und die verschiedenen Sichtweisen und Anforderungen noch besser miteinander zu vereinbaren. RSiRLP Kann der Erlebnistag aus Ihrer Sicht als Modell dienen? Berno Neuhoff Das wäre schön. Wir würden uns über Nachahmungen freuen. Bei uns liegt der Branchenschwerpunkt aufgrund unserer Industriegeschichte im Metall- und Elektrobereich. Andere Regionen haben andere Schwerpunkte. Wir stehen gerne für Infos zur Verfügung und würden uns freuen, wenn unser Projekt auf Landes- oder Bundesseite Anerkennung erfahren würde. Denn es handelt sich um ein praxisnahes und von der Region für die Region gemeinsam entwickeltes Projekt und Anliegen. RSiRLP Gibt es eine Internetseite, die weitere Informationen bieten kann? Berno Neuhoff Momentan gibt es Infos auf unserer Web-Seite: Im Navigationspunkt Brancheninitiative Metall finden Sie unter Projekte den Unterpunkt Fachkräfte/ Personal, der den Metall-Erlebnistag beinhaltet. Eine eigene Homepage unter ist geplant. Die Domain ist schon reserviert. RSiRLP bedankt sich für das Gespräch. Wilfried Rausch Stv. Landesvorsitzender Ref.: Dienst- und Schulrecht 26 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
27 Berufswahlunterricht Ovaler Tisch Beck: Duale Ausbildung ist zukunftssicher In Mainz sind Anfang Oktober die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ovalen Tischs für Ausbildung und Fachkräftesicherung zusammengekommen, um die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt zu erörtern. Im Anschluss an die Beratungen resümierte Ministerpräsident Kurt Beck: Das Wissen um den künftigen Fachkräftebedarf lässt die Unternehmen angesichts sinkender Schülerzahlen beim Thema Ausbildung handeln. Es ist nicht zu spüren, dass die Betriebe etwa infolge der Wirtschaftskrise der vergangenen beiden Jahre bei der Nachwuchsgewinnung verhaltener geworden sind. (...) Kommentar Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist mit der Realschule plus im Verbund mit den Fachoberschulen (FOS) auf dem richtigen Weg, um das Duale Ausbildungssystem zu stärken. Soll die von Ministerpräsident Beck angestrebte Zukunftssicherung der Dualen Ausbildung tatsächlich erreicht werden, muss dieser Weg aber auch konsequent mit der fl ächendeckenden Einführung der Fachoberschule weiter gegangen werden. Für die Eltern ist dieser alternative Weg zu einem höheren Bildungsabschluss, den sie ohne die Nutzung unübersichtlicher Bildungslandkarten überblicken können, wichtig. Das Bildungsziel Abschluss Fachhochschulreife ist gut ausgeschildert, und eine Abzweigung nach der Mittleren Reife in Richtung Gymnasium und Abitur DURCHBLICK Die Partner am Ovalen Tisch waren sich daher einig, dass die Attraktivität und die Zukunftssicherheit der Dualen Ausbildung erhalten und den Jugendlichen noch deutlicher dargelegt werden müssten. Ministerpräsident Beck erinnerte daran, dass die Landesregierung hier bereits unterstützend tätig sei, beispielsweise indem sie frühzeitige Kontakte zu Unternehmen während der Schulzeit und in den Fachoberschulen fördere, die sich an die Realschule plus anschließen. Dem Ovalen Tisch für Ausbildung und Fachkräftesicherung gehören der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, die Bildungsministerin und die Arbeitsministerin des Landes Rheinland Pfalz, die Vertreterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Vertreter der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern und der Unternehmerverbände sowie Vertreter der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz an. bzw. Hochschulreife ist nach wie vor möglich. Die Landesregierung steht nun in der Pfl icht, für adäquate Rahmenbedingungen an unseren Realschulen plus zu sorgen. Der eingeschlagene Weg ist gut und solide auszubauen. Was die Realschule plus im Verbund mit der Fachoberschule zur Sicherung der Dualen Ausbildung beitragen kann, wird sich auch in den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, den Unternehmerverbände sowie den Gewerkschaften verbreiten. Michael Eich komm. Bezirksvorsitzender Neustadt Wer Individualisierung im Klassenzimmer fordert, muss sie mit allen nötigen Mitteln unterstützen; andernfalls kann der Verdacht entstehen, dass es sich um Sonntagsreden und Lippenbekenntnisse handelt Quelle: (HELMKE 2009) Verbesserung der Chancen zur Lebensgestaltung der Jugendlichen Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftemangel für weitere vier Jahre verlängert Die Partner des 2004 geschlossenen Ausbildungspakts haben Ende Oktober beschlossen, ihre Arbeit mit neuen Partnern und mit veränderter Zielsetzung fortzuführen. Wie bisher haben Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Bundesagentur für Arbeit ihre Mitarbeit im Pakt bestätigt. Neu im Pakt vertreten sind die Bundesländer über die Kultusministerkonferenz und die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung. Die Neuausrichtung zielt darauf, möglichst viele Potenziale zur Sicherung des Fachkräftemangels zu erschließen. Insbesondere sollen leistungsschwächere Schüler aus dem Kreis der Migranten, sozial benachteiligte und lernbeeinträchtigte Jungendliche durch den Ausbau und Weiterentwicklung der Berufsorientierung an den Schulen individuell gefördert und mit den Betrieben besser zusammengebracht werden. Quelle: Pressemitteilung BMWi vom reale Bildung reale Chancen Realschule 27
28 Personalvertretung Lärmschutz ist Arbeitsschutz Beteiligungsrecht des ÖPR: Arbeitsschutz ( 86 LPersVG) Lehrkräfte sind in besonderem Maße psychischen Belastungen ausgesetzt. Lärm ist dabei von besonderer Bedeutung. Eine Befragung durch die Universität Bremen ergab, dass sich 80% der Lehrkräfte durch Lärm am Arbeitsplatz belastet fühlen. Über 70 % gaben an, dass es ihnen nach einigen Berufsjahren schwerer fällt Lärm in der Schule zu ertragen, als zu Beginn ihrer Tätigkeit 1. Psychische und psychosomatische Erkrankungen und schließlich Frühpensionierungen können die Folge sein. Lärmmessungen in Schulen ergaben Durchschnittswerte von 65 db. Ab diesem Schallpegelwert reagiert der Körper mit einer Erhöhung der Stresshormonwerte, einer Steigerung der Muskelspannung, einer Veränderung von Atem- und Herzrhythmus und einer Erhöhung des Blutdrucks 2. Stressreaktionen sind die Folge und langfristig erhöht sich das Krankheitsrisiko. Ergebnisse einer Lärmmessung in der Humboldt-Schule in Kiel 3 : Tätigkeit 7. Klasse Schallpegel Klassenarbeit 45 db (A) Vorsagen bei der Klassenarbeit db (A) Ruhige Klasse 60 db (A) Schülerantworten db (A) Normal sprechende Lehrkraft db (A) Hof während der Pause 80 db (A) Klasse vor dem Eintreffen der Lehrkraft 90 db (A) Lärm behindert Lernen und wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen der Schüler aus. Ungünstige Hörbedingungen und Lärm stören Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Zuhören wird anstrengend, die Konzentration nimmt ab, die Lernleistungen sinken, die Reizbarkeit steigt ein Teufelskreis, der nicht sein müsste. Ursache dafür kann eine schlechte Raumakustik sein. Große Glasflächen, unverkleidete Betonwände, Linoleumböden und metallene Stuhlbeine sor- Beispiel für einen Klassenraum der Gruppe A ( Hörsamkeit über mittlere und größere Entfernungen ) nach DIN mit Deckenabsorbern. gen schon bei kleinen Geräuschen und Bewegungen für einen erhöhten Lärmpegel, der von Lehrern und Schülern übertönt wird, und den Lärmdruck weiter erhöht. Eine wichtige Größe bei der Beurteilung der akustischen Eigenschaften eines Raumes ist die Nachhallzeit, die Zeit in Sekunden, in der nach Verklingen einer Schallquelle der Schallpegel um 60 db absinkt. Die Nachhallzeit hängt vom Raumvolumen, dem Schallabsorptionsvermögen der Einrichtungsgegenstände, der Wände und Decke sowie der Zahl der anwesenden Personen ab 4. Als Norm für Messungen der Nachhallzeit und damit der akustischen Eigenschaften von Räumen gilt seit 1968 die DIN 18041, deren Anforderungen 2004 unter Berücksichtigung von skandinavischen Standards erhöht wurden. Für ein Standardklassenzimmer mit einem Raumvolumen von 180 m² gilt heute eine Sollnachhallzeit von 0,55 Sekunden für Räume mit Normalbesetzung. In einem leeren Raum sollte die Nachhallzeit nicht mehr als 0,2 Sekunden über dem Sollwert in besetztem Zustand liegen 5. Viele Klassenzimmer erfüllen die DIN nicht, denn die DIN gilt bei allen Neu- und Umbauten sowie Sanierungen als allgemein anerkannt, eine rechtliche Verpflichtung kann daraus aber nicht abgeleitet werden. So sind Standardklassenzimmer ohne Schallabsorptionsmaßnahmen mit Nachhallzeiten von 1,4 bis 2 Sekunden weit verbreitet. Lehrkräfte, die in akustisch schlecht gestalteten Schulen, tätig sind, sollten sich nicht scheuen, mit Hilfe des Örtlichen Personalrats an Schulleitung und Schulträger heranzutreten und Messungen zur Beurteilung der Raumakustik einfordern. Falls die gemessenen Werte weit über 28 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
29 Personalvertretung dem Sollwert liegen, können schon relativ kostengünstige Maßnahmen zu einer spürbaren Verbesserung der akustischen Umgebung führen. Schallabsorber in Decken- und Wandplatten, schalldämpfende Kappen an den Füßen der Stühle und schallschluckende Pinnwände können die Nachhallzeit auf ca. 0,4 Sekunden absenken. Durch Reduzierung der Nachhallzeit sinkt der Lärmpegel, da sich der durch Reflexionen im Raum verursachte Schallanteil verringert. Schallpegelmessungen ergaben in Klassenräumen vor und nach der Sanierung sogar noch deutlich höhere Pegelminderungen, als zuvor erwartet wurden einen bis zu 8 db geringeren Lärmpegel. Die Senkung des Lärmpegels durch Lärmschutzmaßnahmen bewirkte eine Verhaltensänderung, die zu einer weiteren Senkung führte. Der geringere Störgeräuschpegel ermöglicht eine Verständigung mit leiserer Stimme und begünstigt ein insgesamt ruhigeres Verhalten. Niedrige Nachhallzeiten senken den Störgeräuschpegel und erhöhen dadurch die Sprachverständlichkeit, Laute und Silben fließen nicht mehr ineinander, sondern sind klarer und deutlicher zu vernehmen. 86 LPersVG verpflichtet Personalräte sich bei der Vorbeugung und der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu engagieren. Personalräte können den Anstoß geben, eine schlechte Raumakustik zu überprüfen, und sie können fordern, dass vom Schulträger Maßnahmen zur akustischen Sanierung von Schulräumen ergriffen werden. Lärmschutz ist Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz und dient letztlich allen, die in der Schule erfolgreich arbeiten oder lernen sollen. Der Arbeitsplatz Schule muss von allen Beteiligten weiter entwickelt werden. Im Sinne des Arbeitsschutzes müssen Gesundheitsgefährdungen vermieden werden. Dazu gehört auch ein Konzept für eine gesunde Raumakustik. Martin Radigk Landeskassierer Ref.: Besoldungs-/Versorgungsrecht Radigk.Martin@vdr-rlp.de Fußnoten: 1 news91387, Die Ergebnisse der Studie sind erschienen in der Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin, Forschungsbericht Fb 1030 Lärm in Bildungsstätten - Ursachen und Minderung ; H.-G. Schönwälder, J. Berndt, F. Ströver, G. Tiesler; 2 Rickes, Ortrun, Lärm in Schulen, 2005, uesterndesklassenzimmer.de/pdf/inform_ _ Laerm_Rickes.pdf 3 is/39309/ 4 Rickes, O., a.a.o. 5 gymnasialnetz/unterfranken/ fortschritt_f_ngt_in_der_schule_an_10.pdf Siehe hier S. 24 ff Diagramme der Messungen von O. Rickes in verschiedenen Schulräumen. Links: uesterndesklassenzimmer.de/index.html le.php4?laermminderung.pdf&dir=menu2%2f Schallpegelmessgerät reale Bildung reale Chancen Realschule 29
30 Personalvertretung Personalräteschulung Ende November veranstaltete unser Verband erneut eine Personalräteschulung in Speyer. In bewährter Örtlichkeit, dem Speyrer Bistumshaus, durfte VDR-Referent und Moderator Martin Radigk zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus Schulen der gesamten Region als Schulungsteilnehmer begrüßen. Aufschlag hatte VDR-Referent Michael Eich mit dem Thema Vierteljahresgespräch. Mit dem einleitenden Luhmann-Zitat Kommunikation ist unwahrscheinlich. Sie ist unwahrscheinlich, obwohl wir sie jeden Tag erleben, praktizieren und ohne sie nicht leben würden, fordert er die Personalräte einerseits dazu auf, das Vierteljahresgespräch und dessen Gelingensbedingungen, selbst zum Gegenstand eines Gesprächs mit der Schulleitung zu machen und dabei adäquate Rahmenbedingungen für das Vierteljahresgespräch verbindlich zu verabreden. Andererseits, so Eich, muss die örtliche Personalvertretung die Einhaltung ihrer im Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) grundgelegten Rechte selbstbewusst und konsequent einfordern, und das nicht nur im Zusammenhang mit dem Vierteljahresgespräch. Einigkeit herrschte darüber, dass ein regelmäßiger Austausch zwischen Personalvertretung und Schulleitung über das Vierteljahresgespräch hinaus gehend im Interesse aller Beteiligen und der Schule insgesamt anzustreben sei. Direkt danach erarbeiteten die Seminarteilnehmer anhand von Fallbeispielen zusammen mit Michael Eich die grundlegenden Informationen zu den Themen Nebentätigkeit und Fortbildungen heraus. Den äußerst kom- Personalräte fragen - der VDR antwortet verlässlich! plexen Bereich der Nebentätigkeit betreffend, sprach Eich die Empfehlung aus, dass sich die Kolleginnen und Kollegen schon im Vorfeld der Aufnahme einer Nebenbeschäftigung über eine etwaige Genehmigungspflicht erkundigen sollen. Generell sei es erforderlich, Nebentätigkeiten und auch Ehrenämter vor der Aufnahme der Schulleitung anzuzeigen. Im Anschluss referierte Martin Radigk über die Beteiligungsrechte der Personalvertretung beim Arbeitsschutz auf der Grundlage des 86 LPersVG. Danach ist der Personalrat verpflichtet, sich bei der Vorbeugung und Bekämpfung von Gesundheitsgefahren zu beteiligen und sich für die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung einzusetzen. Hierfür könne er auf die Beratung und Unterstützung der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden zurückgreifen. Am Beispiel der Auswirkungen von bauartbedingten Mängeln der Raumakustik in Schulen stellte Martin Radigk dar, dass Lärm nicht nur das Lernen behindert, sondern auch für Schüler wie Lehrer in einem hohen Maße gesundheitsschädlich sein kann. Im danach einsetzenden Austausch gelang es Radigk zusammen mit den Schulungsteilnehmern, Einflussmöglichkeiten der örtlichen Perso- Wesentlicher Bestandteil der Schulungen ist die Arbeit mit dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG). 30 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
31 Personalvertretung Michael Eich nalräte aufzuzeigen, um Maßnahmen des Arbeitsschutzes einzufordern und auch erfolgreich durchzusetzen. Noch vor der Mittagspause konnte VDR-Referent Wolfgang Wünschel Fragen klären, welche sich aus der Personalratspraxis einiger Teilnehmer ergeben hatten. Eine Frage, die in diesem Kontext gestellt und geklärt werden konnte, war, welche Entlastungsregelungen es für ältere Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit Vertretungsstunden gebe: Lehrkräfte ab vollendetem 55. Lebensjahr dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu Mehrarbeit herangezogen werden (Ziffer 3.7 VV Mehrarbeit). Als Gastreferent stieß nach der Mittagspause Ministerialrat Stephan Unterkeller, der im Bildungsministerium für Rechtsfragen in Personalangelegenheiten zuständig ist, zu der Veranstaltung dazu. Herr Unterkeller informierte die Anwesenden über das Thema Dienstliche Beurteilungen, die beispielsweise anlässlich von Lebenszeitverbeamtungen oder Funktionsüberprüfungen durchgeführt werden müssen. Der Diskurs mit den Schulungsteilnehmern zeigte auf, dass hier ein großes Spannungsverhältnis zwischen theoretischer Konzeption und Umsetzung im Schulalltag konstatiert werden muss. Ein Kollege wollte beispielsweise wissen, in welchem Ausmaß die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen in die Beurteilungen miteinfließen soll bzw. muss. Hier entscheide der Einzelfall, entgegnete Herr Unterkeller: Es müsse überprüft werden, ob die Fortbildungen das schulische Tun vorangebracht habe. Den abschließenden Tagesordnungspunkt markierte Wilfried Rausch, indem er über seine Arbeit als Hauptpersonalrat berichtete und somit den Personalräten einen Einblick in das Wirken auf dieser Vertretungsebene ermöglichte. Dabei nahm er u.a. Bezug auf die Rückmeldung einer Kollegin, an ihrer Schule würde es zu einer Mehrbelastung von Kolleginnen und Kollegen kommen, weil keine Vertretungskräfte mehr zur Verfügung stehen. Über das PES-Portal könne man keine geeigneten Vertretungskräfte rekrutieren, schilderte jene Kollegin. Das sei ein Missstand, so Wilfried Rausch, auf den immer wieder hingewiesen werde. Neben den Vorträgen, Fallbeispielen und Fragerunden sind, das verdeutlichen die Rückmeldungen der Schulungsteilnehmer, auch die Gespräche in den kurzen Pausen sehr wichtig und DURCHBLICK Es ist unfair, wenn hierzulande ähnliche Förderdiagnosen und maßnahmen wie in Finnland propagiert werden, obgleich doch jedermann weiß, dass solches bei der gegenwärtigen Lehrer-Schülerrelation in unseren Schulen beim besten Willen nicht zu machen ist. Quelle: (KLIPPERT 2010) fruchtbar. Hier können Erfahrungen ausgetauscht, Lösungswege weitergegeben und Kontakte geknüpft werden. Moderator Radigk bot den Tagungsteilnehmern einen kontinuierlichen Beratungs-Service an und brachte zum Ende der Veranstaltung seine Vorfreude auf den nächsten Schulungsdurchgang im kommenden Frühjahr zum Ausdruck. Haben Sie Anregungen in Sachen Personalräteschulung für uns? Dann nehmen Sie doch bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind beständig bemüht, unsere Veranstaltungen weiterzuentwickeln und sind in diesem Zusammenhang für alle Anregungen dankbar. Michael Eich komm. Bezirksvorsitzender - Neustadt Eich.Michael@vdr-rlp.de Martin Radigk Wilfried Rausch reale Bildung reale Chancen Realschule 31
32 Personalvertretung Gemeinsame Personalräteschulung der Bezirksverbände Koblenz und Trier Wiederum hohe Teilnehmerzahl und Synergieeffekte durch gemeinsame Aktion Wie im vergangenen Jahr führten die Bezirke Koblenz und Trier eine gemeinsame Personalräteschulung in Treis-Karden durch. Timo Lichtenthäler freute sich, viele neue Personalratsmitglieder begrüßen zu dürfen. Tagungsthemen waren das Vierteljahresgespräch mit der Schulleitung, Beteiligungsrechte, die an konkreten Beispielen zu Nebentätigkeiten, Fortbildungen und Arbeitsschutz erarbeitet wurden und die dienstliche Beurteilung. Referenten waren Wilfried Rausch (Stellv. VDR-Landesvorsitzender und Vorstandsmitglied im Hauptpersonalrat Realschule plus), Erwin Schneider (Stellv. VDR-Landesvorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender im Bezirkspersonalrat Realschule plus), Timo Lichtenthäler (VDR-Bezirksvorsitzender Koblenz und Vorstandsmitglied im Hauptpersonalrat Realschule plus) sowie Wolfgang Seebach (Schriftführer im Bezirksvorstand Trier und Mitglied im Hauptpersonalrat). Für den Tagungsordnungspunkt Dienstliche Beurteilung konnte Herr Ministerialrat Stephan Unterkeller (MBWJK) als Referent gewonnen werden. Anhand des Referats entwickelte sich eine sehr lebendige Diskussion, die das große Interesse der Personalratsmitglieder an diesem Thema zeigte. Referat und Diskussion machten deutlich: Die Beurteilung darf nur das erfassen, was der Beurteilende bisher geleistet hat. Der Beurteiler muss für den Zeitraum, den er nicht beurteilen kann, eine Außenbewertung u. a. vom Vorgänger anfordern. Diese Außenbewertung ist zu dokumentieren. Die unterrichtlichen Tätigkeitsbereiche finden zu 60 % Niederschlag in der Beurteilung! Die dienstliche Beurteilung ist kein Staatsexamen. Die dienstliche Beurteilung wird mit der Eröffnung wirksam (Beweissicherungssystem). In der Fragestunde wurde deutlich, dass gerade in Übergangsperioden an den Schulen viele neue Situationen ge- Erwin Schneider, Wilfried Rausch, Timo Lichtenthäler An ausgewählten Fallbeispielen zu den Themen Fortbildung und Arbeitsschutz erarbeiten die Teilnehmer in Gruppen ihre Lösungsstrategien. meistert werden müssen. Die Fragen der Personalratsmitglieder betrafen vor allem die neuen Herausforderungen an den Schulen: Aspekte der Schulstrukturänderung und deren Auswirkung für die Personalräte als auch das schulische Alltagsgeschäft. Besonders herausgestellt wurden die schwierige Aufgabe des Zusammenführens von Kollegien und die hohen Belastungen durch den Unterrichtseinsatz an dislozierten Standorten. Erwin Schneider Stellv. Landesvorsitzender Schneider.Erwin@vdr-rlp.de 32 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
33 Personalvertretung VDR-Wahlvorstandsschulung in Simmern Die große Zahl von Schulen, die zum in Realschulen plus und Integrierte Gesamtschulen umgewandelt wurden, legte es nahe, eine Schulung für die bestellten Wahlvorstände anzubieten. Zum einen wird die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse immer komplizierter, zum anderen ist die Terminfrage beim Ablauf der Wahl von Bedeutung, um eine ordnungsgemäße Durchführung zu gewährleisten. Das Angebot sollte zeitlich früh erfolgen, um den Schulen die Möglichkeit zu geben, zügig Personalräte zu wählen. Eine Reihe von Wahlvorständen war der Einladung gefolgt. Sie erlebten eine abwechslungsreiche Schulung, die ihren Bedürfnissen und Anforderungen Rechnung trug. So ging es um Termine, Fristen, Wählbarkeit, Beschäftigtenverhältnisse, die Größe des örtlichen Personalrates u. v. a. m. Deutlich wurde auch, in welcher Umbruchssituation sich die betroffenen Arbeitserleichterung für Wahlvorstände mit VDR-Formularen Schulen gegenwärtig befinden und welche Anforderungen an alle Beteiligten gestellt sind. Dass hier ministeriumsseitig nicht genügend Entlastungsmöglichkeiten eingeräumt werden, wurde allseits bemängelt. Tagungsreferenten waren Erwin Schneider, Timo Lichtenthäler, Martin Radigk und Hanns Peters. Die notwendigen Formulare und Hinweise sowie eine Checkliste sind den Schulen postalisch zugegangen und finden sich auf der VDR-Homepage: Hanns Peters Bezirksvorsitzender Trier Aktueller Hinweis zur Altersteilzeit Die derzeitige Altersteilzeitregelung endet am Dies bedeutet, dass Lehrkräfte, die bis zum das 55. Lebensjahr vollenden, die Möglichkeit haben, Altersteilzeit zu beantragen. Antragsfrist ist der Es gibt keine Hinweise auf eine eventuelle Verlängerung. Defi nition Altersteilzeit Altersteilzeit ist eine Teilzeitbeschäftigung bis zur Pensionierung mit der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit auf Antrag des Beamten. Die Altersteilzeit ermöglicht eine Pensionierung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Interessenten müssen sich bei der Beantragung für einen dieser Zeitpunkte entscheiden: A. Altersteilzeit bis zur gesetzlichen Altersgrenze (ATZ-Kurzform; 80e Landesbeamtengesetz). Die gesetzliche Altersgrenze für Lehrkräfte ist derzeit das Ende des Schuljahres (jeweils 31. Juli), in dem das 64. Lebensjahr vollendet worden ist. Sonderregelung für schwerbehinderte Lehrkräfte (GdB: mindestens 50%) bei Altersteilzeit: Eine Pensionierung ist bereits am Ende des Schuljahrs, in dem das 63. Lebensjahr vollendet worden ist, möglich. B. Altersteilzeit über die gesetzliche Altersgrenze hinaus (ATZ-Langform; 80 f Landesbeamtengesetz) Die Altersteilzeit muss bis zum Ablauf von drei Jahren nach Erreichen der Altersgrenze beantragt werden (derzeit: Ende des Schuljahres, in dem das 67. Lebensjahr vollendet worden ist). Wählt man dieses Modell, darf nur dieser Pensionierungszeitpunkt angeben werden. Eine Verbindung von dieser Art der Altersteilzeit mit einer früheren Pensionierung (z.b. Ende des Schuljahres, in dem das 65. Lebensjahr oder das 66. Lebensjahr vollendet wird) ist nicht möglich. Voraussetzung für die Beantragung von Altersteilzeit Bei Antritt (nicht bei Beantragung!) der Altersteilzeit muss das 55. Lebensjahr vollendet sein. Altersteilzeit können Lehrkräfte nur zu Schuljahresbeginn (jeweils 1. August) antreten. Innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit muss eine mindestens dreijährige Beschäftigung (in der Regel mindestens auf halber Stelle) nachgewiesen werden. Dienstliche Belange dürfen nicht entgegenstehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel müssen vorhanden sein. reale Bildung reale Chancen Realschule 33
34 Recht Der VDR vor Ort an der Realschule plus in Salmtal In Zeiten großer Veränderungen in der Schullandschaft nimmt sich der VDR des gestiegenen Beratungs- und Informationsbedarfs an. Ganztagsschule war das zentrale Thema bei einem Schulbesuch in Salmtal. Ent sprechend zahl reich erschien das Kollegium zur gemeinsamen Sprechstunde um Fragen und Proble me im Zusammenhang mit der bevorstehenden Umstruk turie rung der Schule zur Ganz tagsschule zu besprechen. Monika Winkelmann (Konrektorin der Realschule plus Bleialf) und Gabriele Schmidt (Schulleiterin der Realschule Konz) erläuterten die Ganztagsschulkonzepte ihrer Schu le und beantworteten im Anschluss viele unterschiedliche Fragen zum The ma. Bei personalrechtlichen Fragestellungen konnte der Bezirksvorsitzende Hanns Peters weiterhelfen. Der VDR gibt konkrete Informationen und Antworten auf Fragen direkt vor Ort Hanns Peters: Wir sehen, dass der Informationsbedarf an den Schulen steigt und nehmen uns der Sache an. Gerne ist der VDR bereit, an Schulen zu gehen und dort vor Ort mit den Kollegen über Probleme zu sprechen. Text und Foto: Peter Quint Bundesfinanzhof erleichtert Steuerabzug von Büchern Der Bundesfi nanzhof (BFH) in München hat Lehrern den Steuerabzug vorbereitender Literatur erleichtert. Nach einem Urteil vom (Az: VI R 53/09) müssen sie nicht für jedes einzelne Buch konkret nachweisen, für welche Unterrichtsstunde es genutzt wurde. Auch ein gleichgerichtetes privates Interesse steht dem Steuerabzug nicht entgegen. Der Kläger unterrichtet an einer Realschule die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Ethik. In seiner Einkommensteuererklärung 2002 machte er Ausgaben von Euro für 37 Bücher und vier Zeitschriftenabonnements geltend. Das Finanzamt lehnte eine Berücksichtigung als Werbungskosten zunächst nahezu komplett ab. In erster Instanz gab das Finanzgericht Rheinland-Pfalz der Steuerbehörde noch recht (Urteil vom , Az.: 4 K 2895/04). Schließlich habe der Lehrer nicht nachgewiesen, in welchen Unterrichtsstunden er die Literatur jeweils eingesetzt habe. Doch so eng ist der berufliche Veranlassungszusammenhang nicht zu sehen, urteilte der BFH. Dass sich der Lehrer auch privat für gesellschaftliche und politische Themen interessiere, stehe der steuerlichen Anerkennung dann nicht entgegen. Es reiche aus, wenn die weitaus überwiegend beruflich genutzt wird. Im Streitfall muss daher nun das Finanzgericht die Bücher und Zeitschriften jeweils einzeln ansehen und bewerten. Leitsatz des Urteils: 1. Arbeitsmittel sind Wirtschaftsgüter, die unmittelbar zur Erledigung der dienstlichen Aufgaben dienen. Hierzu können auch Zeitschriften und Bücher zählen, wenn die Literatur ausschließlich oder zumindest weitaus überwiegend berufl ich genutzt wird. 2. Die allgemeinen Grundsätze zur steuerlichen Behandlung von Arbeitsmitteln gelten auch, wenn zu entscheiden ist, ob Bücher als Arbeitsmittel eines Lehrers zu würdigen sind. Dabei ist die Eigenschaft eines Buchs als Arbeitsmittel nicht ausschließlich danach zu bestimmen, in welchem Umfang der Inhalt eines Schriftwerks in welcher Häufi gkeit Eingang in den abgehaltenen Unterricht gefunden hat. Auch die Verwendung der Literatur zur Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsnachbereitung oder die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften für eine Unterrichtseinheit, die nicht abgehalten worden ist, kann eine ausschließliche oder zumindest weitaus überwiegende berufl iche Nutzung der Literatur begründen. 34 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
35 Schulpolitik Was nicht geht Es geht nicht (an): dass immer größere Anwärtergruppen an den Realschul-Studienseminaren (in Trier von 99 im Jahre 2004 auf 160 im Jahre 2010) ausgebildet werden sollen, aber gleichzeitig weder die Seminarleitungen noch die FL-Stellen für Pädagogik und Allg. Didaktik personell ausgebaut und nahezu alle neuen Fachgruppen mit lehrbeauftragten Fachleiterinnen und Fachleitern ohne angemessene Bezahlung besetzt sind; dass auf die Studienseminare eine immer größer werdende Zahl von Praktikanten in zwei engen Zeitfenstern im Februar und September zukommt, aber die Fachleiterinnen und Fachleiter ihrer eigentlichen Aufgabe der Ausbildung von Anwärtern nicht mehr nachkommen und gerecht werden können; dass die beschlossene Bachelor- und Masterausbildung im Bereich Lehrerbildung auch mit einer Verkürzung der gesamten Lehrerausbildung begründet wurde, im Februar 2011 über 500 Bewerberinnen und Bewerber vor den Toren der RS-Seminare stehen, aber nicht die Hälfte von ihnen eingestellt werden kann und damit die Warteschlange und zeit für das Lehrerstudium insgesamt immer länger wird; dass gut ausgebildete Realschullehrerinnen und Realschullehrer auch 2 Jahre nach ihrer 2. Staatsprüfung keine Planstelle erhalten und teilweise auf das Jahr 2013 vertröstet werden, aber zunehmend PES-Kräfte ohne pädagogische Ausbildung den Fachunterricht an Ganztagsschulen übernehmen; dass überall neue Realschulen plus und Gesamtschulen geschaffen werden, aber über lange Zeit die Leitungsstellen unbesetzt bleiben, da die nötigen personellen Entscheidungen nicht getroffen werden bzw. nicht getroffen werden können; dass mitten im Umsetzungsverfahren der Schulstrukturreform den Schulen eine gänzlich neue Form der Schulbuchausleihe zugeht, die bis zum Schuljahresende 2009/10 zu realisieren ist, aber die Organisation in die Hände der bereits überlasteten Schulsekretariate gelegt wird; dass für den beschlossenen Ausbau einer Realschule plus in Trier-Süd mehr als eine halbe Million Euro ausgegeben wurde, aber das Kollegium sowie die Schulleitung dann aus der Zeitung erfahren, dass ihr Standort aufgegeben wird und sie in einen anderen Stadtteil verschoben werden ; dass Eltern beim Landeselterntag in Saarburg immer wieder von Unterrichtsausfall, mangelnder Förderung und Angst vor falscher Schulwahl sprechen, aber die zuständige Ministerin dies nicht annimmt und vielmehr betont, dass das Land auf dem richtigen Weg sei. (Trierischer Volksfreund, ) So kann es doch nicht sein, so geht es nicht! Gerhard Klein VDR Trier Klein.Gerhard@vdr-rlp.de Stark für jede Stunde - selbstsicher und wirksam im Lehreralltag Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz hat in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie mit Professor Dr. Stephan Letzel, Leiter des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Mainz, und der Psychologin Prof. Dr. Gerdamarie Schmitz ein neues Präventionsvorhaben auf den Weg gebracht. Das Vorhaben Stark für jede Stunde - selbstsicher und wirksam im Lehreralltag basiert auf dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Es zielt darauf, die persönlichen Ressourcen jedes Einzelnen zu stärken. Insbesondere soll aufgezeigt werden, wie Lehrkräfte berufliche Herausforderungen meistern, sich optimal motivieren und erfolgreich Ziele verfolgen können. Geplant sind Workshops, der Aufbau eines Netzwerkes und die Einrichtung eines Onlineportals. Infos unter: reale Bildung reale Chancen Realschule 35
36 Schulpolitik Tag der Schulsekretärinnen 40 Schulsekretärinnen trafen sich im September in Bad Kreuznach zum Tag der Schulsekretärinnen. Auf dem Podium diskutierten u.a. Annedore Wieland (Landesvorsitzende der Schulsekretärinnen RLP), Ulla Brede-Hoffmann (Bildungspolitische Sprecherin der SPD im Landtag RLP), Harald Pitzer (Landkreistag) und Bernd Karst (VDR-Landesvorsitzender). Einig waren sich die Podiumsteilnehmer in der Beurteilung, dass Schulsekretärinnen an einer sensiblen Schnittstelle tätig sind und mehr Anerkennung verdienen. Anne Wieland stellte fest, dass die Themen und Probleme bereits vor 20 Jahren diskutiert wurden. Ulla Brede-Hoffmann (SPD) erklärte, dass die Landesregierung, wie schon einmal vor 20 Jahren, bei der Bestellung eines neuen Wibera-Gutachtens unterstützend tätig werden könnte, wenn die kommunalen Verbände sich entsprechend einbringen würden. Der Beigeordnete Harald Pitzer vom Landkreistag erklärte, dass er sich eine Überarbeitung der Empfehlungen zu den Arbeits- und Tätigkeitsbeschreibungen nur unter Beteiligung der Berufsgruppe vorstellen könne. VDR-Landesvorsitzender Bernd Karst wollte mit seiner Teilnahme die Ziele der Schulsekretärinnen hinsichtlich der Verbesserung ihrer beruflichen und standespolitischen Situation unterstützen und den Zusammenhang zwischen der Arbeit der Schulsekretärinnen und der Qualitätsverbesserung an Schulen hervorheben, denn ein wesentlicher Qualitätsfaktor für Schulen ist die gute Schulsekretärin. Es gibt keine gute Schule ohne funktionierendes Schulsekretariat. Karst stellte fest, dass es für die Schulsekretärinnen in den letzten 25 Jahren kaum sichtbare Verbesserungen gegeben hat. Im Gegenteil: Die Erwartungen an die Schulsekretärinnen stiegen von Jahr zu Jahr. Im Rahmen der Schulbuchausleihe sind Sekretärinnen mit Urlaubssperren bedacht oder mit der verpflichtungsähnlichen Aufforderung konfrontiert worden, ihr Stundendeputat zu erhöhen. Der Arbeitsdruck, der gerade beim Schuljahrwechsel entsteht, wurde dadurch nochmals erhöht. Der Schulalltag habe sich grundlegend verändert: Die Erwartungen und das Anspruchsdenken auch der Eltern sind anders geworden. Und wer ist die erste Ansprechpartnerin in der Schule? Die Sekretärin. Ihre Aufgabe ist es, berechtigten sowie oftmals auch überzogenen Forderungen souverän zu begegnen. In Betrieben werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit differenziertem Klientel zu tun haben, professionell geschult. Und Beispiele für notwendige Qualifizierungsmaßnahmen gibt es zahlreiche. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so alleine gelassen wird mit den veränderten Herausforderungen wie die Schulsekretärinnen. Als weiteres aktuelles Beispiel für die veränderte Rolle der Schulsekretärin nannte der Landesvorsitzende die Schulstrukturveränderung in RLP. Die Schulstrukturveränderung hat zur Folge, dass Außenstehende verständlicherweise kaum wissen, mit welcher Schule sie es zu tun haben. So vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht mitbekomme, wie unsere Schulsekretärin mit größter Sachkompetenz die Struktur der Realschule plus VDR-Landesvorsitzender Bernd Karst erklärt, das Wahlpflichtfachangebot der Realschule plus erläutert oder über Aufnahmevoraussetzungen Auskunft gibt. Die Schulsekretärin sei, nach seiner Auffassung, eine Mitarbeiterin, die dem Berufsbild einer Fachwirtin für Verwaltung entspricht. Die Allroundverantwortlichkeit komme auch in den so genannten soft skills zum Tragen: Teamgeist und Sozialkompetenz gehören zu den unverzichtbaren Schlüsselqualifikationen. Wer über diese Qualifikationen nicht verfügt, ist auch nicht in der Lage, im Berufsalltag mit Schülerschicksalen adäquat umzugehen. Die psychosozialen Aufgaben, mit denen die Schulsekretärin zwangsläufig betraut ist, werden in Zukunft rapide zunehmen. Bernd Karst, VDR-Landesvorsitzender (re): Ein wesentlicher Qualitätsfaktor für Schulen ist die gute Schulsekretärin. Es gibt keine gute Schule ohne funktionierendes Schulsekretariat. Fazit Karst wünschte eine erfolgreiche Umsetzung der berechtigten gewerkschaftlichen Forderungen nach höherer Einstufung in der Besoldung, einer wertschätzenden Berufsbezeichnung, Möglichkeiten der Höherqualifizierung durch anspruchsvolle Fortbildungsangebote und systematische Qualifizierungsmaßnahmen. 36 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
37 Schulpolitik Familie und Schule bedingen Lernerfolg Schülerbeförderungskosten nach Ordnungsmaßnahme Sachverhalt: Eine durch eine Ordnungsmaßnahme an eine andere Schule überwiesene hessische Schülerin forderte die Übernahme der Schülerbeförderungskosten. Großes Interesse am Landeselterntag "Eine gute Schule ist die, an der das eigene Kind ohne Probleme all das lernen kann, was es fürs spätere Leben braucht!", davon ist der neue Landeselternsprecher Rudolf Merod überzeugt. An erster Stelle bedarf es dazu guter Lehrerinnen und Lehrer. Aber nicht nur! Genauso bedeutsam sind gute Schülerinnen und Schüler, gute Eltern, gute Rahmenbedingungen und das gegenseitige Vertrauen, das sich alle Beteiligten schenken sollten. Es kommt also auch auf die Eltern an, denn sie sind Vorbilder für ihre Kinder und sie schaffen wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich der Nachwuchs erfolgreich den Herausforderungen schulischen Lernens stellen kann. Etwa 250 bis 300 Eltern nutzten am 6. November das anspruchsvolle Programm des rheinland-pfälzischen Landeselterntages in Saarburg. Bildungsministerin Doris Ahnen beglückwünschte die neuen Mitglieder von Landes- und Regionalelternbeirat und setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten. Ihre Messlatte für das Bildungssystem: Es muss sowohl Leistungsfähigkeit als auch Chancengleichheit bieten und das Bildungsministerium muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Viele Faktoren beeinflussen den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Das ist für den Hauptreferenten Prof. Dr. Stefan Sell von der Fachhochschule Koblenz ein wichtiges Ergebnis der Bildungsforschung. Die Bedeutung der Familien ist dabei fast doppelt so groß wie die der Schule selbst. Die Schule muss vor allem ihre Arbeit an die jeweilige Herausforderung anpassen - und das ist derzeit vor allem der Umgang mit Heterogenität. Schule muss Verantwortung für ihre Ergebnisse übernehmen, die Verbesserung selbst in die Hand nehmen. Beschluss: Der Verwaltungsgerichtshof Hessen hat den Antrag auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten abgewiesen. Aus der Begründung: Nach 161 Abs. 5 Nr. 3 HSchG sind die Beförderungskosten für eine andere als der nächstgelegenen Schule ausnahmsweise zu erstatten, wenn diese aus Kapazitätsgründen nicht besucht werden kann. Die Aufnahmefähigkeit der ursprünglich besuchten Schule ist aber nicht dadurch erloschen, dass die Schülerin im Rahmen einer Ordnungsmaßnahme einer anderen Schule zugewiesen wurde. Die Übernahme der Beförderungskosten richtet sich nur nach der objektiven Kapazität der nächstgelegenen Schule, nicht aber auf Gründe in der Person des Schülers. Das Tatbestandsmerkmal der Aufnahmefähigkeit einer Schule ist lediglich einrichtungs- aber nicht benutzerbezogen zu verstehen. DURCHBLICK Der Staat kann nicht begaben, er kann und muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Begabungen unabhängig von Milieus entfalten können. Aus purer Verzweiflung darüber, dass Begabungen nicht umverteilt werden können, haben sich Bildungspolitiker oft genug dazu entschlossen, die Schwachen zu begünstigen und die Talentierten zu benachteiligen. Das Niveau wird gesenkt, die Begabten sind unterfordert und die weniger Talentierten nicht ausreichend gefördert, weil die Chancen ungleich genutzt werden. Quelle: SCHMOLL: Bildungspolitik Gerecht ist nicht gleich FAZ, Es ist zwar richtig, dass sich die Ordnungsmaßnahme gegen die Schülerin richtet, die Versagung der Beförderungskosten aber die Eltern trifft. Nach 1610 Abs. 2 BGB umfasst der von den Eltern für ihre Tochter zu leistende Unterhalt jedoch unabhängig von staatlichen Hilfen den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen Vorbildung zu einem Beruf und somit auch die Beförderungskosten zur Schule. Text: Wolfgang Häring (Beschluss vom , Az.: 7 A 1900/08) reale Bildung reale Chancen Realschule 37
38 Persönliches Erinnerungen an Hanna-Renate Laurien von Georg Stenner Dr. Hanna-Renate Laurien 1995 als Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses Die Frage des VDR, ob ich bereit sei, für die realschulblätter Erinnerungen an die am 12. März 2010 in Berlin verstorbene, frühere rheinland-pfälzische Kultusministerin Dr. Hanna-Renate Laurien aufzuschreiben, habe ich nach kurzem Zögern mit Ja beantwortet zögernd, weil ich mich nicht berufen fühle, das bedeutende und vielfältige Lebenswerk der Verstorbenen zu würdigen, schließlich aber doch bejahend, weil ich sie bei vielen Begegnungen als Gesprächs- und als Verhandlungspartnerin, als Vorgesetzte und als Mensch schätzen gelernt habe und weil ich ihr bezüglich meines beruflichen Werdegangs viel verdanke. Frau Dr. Hanna-Renate Laurien ist ohne Zweifel in der deutschen Politik und Gesellschaft eine hochverdiente Persönlichkeit, deren Würdigung aus unterschiedlichen Perspektiven und aus berufenem Munde längst erfolgt ist. Meine Erlebnisse und Erfahrungen beschränken sich fast ausschließlich auf ihr Wirken als Hauptabteilungsleiterin, Staatssekretärin und Kultusministerin in Rheinland-Pfalz, denn in diesen Funktionen habe ich sie als Lehrer und Schulleiter sowie als Referent im Kultusministerium und zeitweise als VDR- Vertreter und Vorsitzender des HPR für die staatlichen Lehrerinnen und Lehrer an Realschulen kennen gelernt. Zum ersten Mal begegnete ich Hanna- Renate Laurien, nachdem Kultusminister Dr. Bernhard Vogel sie 1970 als Hauptabteilungsleiterin in das Kultusministerium Rheinland-Pfalz berufen hatte. Ihre Funktion als Leiterin einer neu geschaffenen Hauptteilung mit vier Abteilungen für einzelne oder mehrere Schularten einschließlich einer Abteilung für schulartübergreifende Grundsatzangelegenheiten lässt schon den Auftrag erkennen, den sie übernommen hatte und mit Leben erfüllen sollte, nämlich für die bestehenden und erfolgreichen Schularten ein Mehr an koordiniertem Miteinander zu organisieren und zu gestalten. Dieser Aufgabe widmete sich Dr. Hanna-Renate Laurien als Fachfrau mit Erfahrungen als Gymnasiallehrerin, Fachleiterin, Schulleiterin und Referentin im nordrhein-westfälischen Kultusministerium mit Intelligenz, Sachverstand, Wortgewalt und Durchsetzungsvermögen. Sie verschaffte sich rasch bei Lehrkräften und Mitarbeitern, bei politischen Parteien, bei Verbänden und Gewerkschaften, aber auch bei Eltern und Schülern Respekt und Anerkennung! Mit anderen Worten: Der Name, den ihr die Berliner später treffsicher und zugleich wohlwollend gaben, nämlich Hanna-Granata, hätte schon in Rheinland-Pfalz gepasst! In Rheinland-Pfalz stand nach dem erst 1963 verabschiedeten ersten Realschulgesetz angesichts eines raschen überproportionalen Wachstums des Realschulwesens dringend eigene Lehrplanarbeit an, um die ersatzweise eingeführten nordrhein-westfälischen Richtlinien für den Unterricht an Realschulen durch spezifisch rheinland-pfälzische abzulösen und zu ersetzen. In diesem inhaltlichen Zusammenhang erlebte ich Hanna- Renate Laurien erstmals als Vorgesetzte und Referentin, da ich als Leiter einer fachdidaktischen Kommission an der einleitenden und Richtung weisenden landesweiten Konferenz teilnehmen sollte. Mit einem Kollegen und Freund zusammen wurde ich sogar mit dem Protokoll beauftragt, und uns beiden ist dies bis heute peinlich. Denn wir (aber nicht nur wir) waren damals noch nicht auf dem aktuellen Stand der Curriculumdiskussion, was zur Folge hatte, dass die Hauptreferentin, Ministerialdirigentin Dr. Hanna-Renate Laurien, das Protokoll zu ihrem Referat zumindest teilweise selbst schreiben musste. Für mich war diese Erfahrung Ansporn, mich tiefer in die Curriculumtheorie einzuarbeiten und die Früchte dieses Bemühens in die fachdidaktische Arbeit für das Wahlpflichtfach Wirtschaftskunde einzubringen. Offensichtlich gelang mir dies zur Zufriedenheit des Ministeriums und der Hauptabteilungsleiterin Dr. Hanna- Renate Laurien, denn 1971 musste ich mich im Rahmen einer befristeten Abordnung in das Kultusministerium erstmals bei ihr vorstellen. Für ein Jahr hatte ich dann als Hilfsreferent im Realschulreferat vor allem die Aufgabe, für das junge Fach Wirtschaftskunde ein Curriculum zu entwickeln, an einer neuen Stundentafel für die Realschule mitzuwirken und die Ergebnisse der Ende der 60er- und Anfang der 70er- Jahre Jahre an Realschulen durchgeführten Leistungsvergleiche und -feststellungen auszuwerten. Die Arbeit für das Wahlpflichtfach Wirtschaftskunde erfolgte zusammen mit dem Wirtschaftspädagogischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dessen Leiter damals Prof. Dr. Joachim Peege war; als wissenschaftliche Mitarbeiterin war die heutige Staatsministerin im Kanzleramt, Prof. Dr. Maria Böhmer, beteiligt, die dann auch für ihre Dissertation die Wahlpflichtdifferenzierung in der Realschule als Thema wählte. Für unsere Schulart ist bedeutsam, dass Hanna- Renate Laurien von Anfang an die traditionelle Öffnung der Realschule für berufsfeldbezogene Lerninhalte im Wahlpflichtbereich ausdrücklich förderte. 38 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
39 Persönliches Damit wurde nach meiner Einschätzung eine wesentliche Grundlage dafür gelegt, dass inzwischen das rheinlandpfälzische Schulgesetz die Einrichtung von Fachoberschulen an Realschulen plus vorsieht und dass nach deren Einrichtung an ersten Standorten im Jahre 2011 zwei Jahre später die ersten Schüler die Realschule plus mit Fachhochschulreife verlassen können. Damit wird im Grunde wenn auch unter den geänderten Bedingungen einer Realschule plus - eine alte Forderung des VDR und seines früheren Vorsitzenden Werner Schappert erfüllt, der ein 11. Realschuljahr zum Erwerb der Fachhochschulreife gefordert hatte. Dr. Hanna-Renate Laurien (* in Danzig; in Berlin) Für Hanna-Renate Laurien war Neigungsdifferenzierung durch Wahlpflichtfächer mit berufsfeldbezogenen Schwerpunkten und Inhalten ein wichtiger Beitrag zur Individualisierung des Lernens, um unterschiedlichen Begabungen und Neigungen gerecht zu werden. Insgesamt sollten Hauptschule, Realschule und Gymnasium in der Sekundarstufe I eine fächerübergreifende Leistungsdifferenzierung mit maßvoller Heterogenität in jeder Klasse verwirklichen, um von Leistungsdruck zu entlasten, wie er in sehr heterogenen Lerngruppen und bei Ein- und Umstufungen durch Fachleistungsdifferenzierung an Integrierten Gesamtschule entstehen kann. Zu meinen Aufgaben als Hilfsreferent gehörte wie schon gesagt auch die Mitarbeit an einer neuen Stundentafel und die Auswertung von Leistungsvergleichen und Leistungsfeststellungen. All dies zeigt, dass Hanna-Renate Laurien, seit 1971 Staatssekretärin, in der inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens einen Arbeitsschwerpunkt sah. Für sie gehörten dazu differenzierte, aber aufeinander abgestimmte Stundentafeln und Lehrpläne, um vertikale und horizontale Durchlässigkeit zu ermöglichen, bei der die Realschule zwischen Hauptschule und Gymnasium eine besondere Brückenfunktion übernehmen musste. Diese Zielsetzung schlug sich auch in dem 1974 verabschiedeten Schulgesetz nieder, das zwar inzwischen mehrfach novelliert, aber in Teilen bis heute erhalten geblieben ist und somit das rheinland-pfälzische Schulwesen noch immer prägt. Darin wurde das Lieblingskind des damaligen Kultusministers Dr. Vogel, wie ihm ein Oppositionspolitiker in der entsprechenden Landtagsdebatte vorhielt, weiterhin als selbstständige Schulart des gegliederten Schulwesens verankert. Zugleich wurden Hauptschule, Realschule und Gymnasium aber auch als aufeinander bezogene Teile eines übergreifenden Differenzierungssystems begriffen. Diese Weiterentwicklung folgte auch Vorgaben des 1970 vom Deutschen Bildungsrat veröffentlichten Strukturplans für das Bildungswesen, wie die damals im Schulgesetz aufgenommene klare Stufengliederung des Schulwesens in Primarstufe sowie in Sekundarstufe I und II, die Einführung der schulartabhängigen und der schulartübergreifenden Orientierungsstufe sowie die gesetzliche Verankerung des 10. Hauptschuljahres beweisen. Wenn auch Dr. Bernhard Vogel dieses Schulgesetz als Kultusminister politisch verantwortete, so ist dennoch die Handschrift seiner damaligen Staatssekretärin Dr. Hanna- Renate Laurien zu erkennen. Damit reagierte die rheinland-pfälzische Landesregierung auch auf Herausforderungen, die durch die Idee und das politische Ziel einer Schule für alle Schüler, also durch die Integrierte Gesamtschule entstanden war. Hanna-Renate Laurien bevorzugte ohne Zweifel das gegliederte Schulwesen. Ich erinnere mich an bildungspolitische Diskussionen, in denen sie sinngemäß fragte, ob Schülerinnen und Schüler, die sich an Hauptschulen als Schülersprecher erproben konnten, auch an Integrierten Gesamtschulen eine solche Chance gehabt hätten, und stellte damit die Frage nach Chancengerechtigkeit im Verhältnis zu formaler Chancengleichheit! Hanna-Renate Laurien lehnte meines Erachtens die Integrierte Gesamtschule nicht generell ab, wohl aber ideologische Festlegungen, wie sie bisweilen die Diskussion um diese neue Schulform prägten, indem die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit wie das Ziel sozialer Integration mit Ausschließlichkeitsanspruch für dieses Schulmodell beansprucht wurden. Für die offene Einstellung von Hanna-Renate Laurien sprechen die von ihr unterstützten Schulversuche mit integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz ebenso wie ihre politische Tätigkeit als Schulsenatorin in Berlin, wo mehr Gesamtschulen bestanden. In einer anderen, vom VDR und der Lehrerschaft immer wieder diskutierten Forderung nach einer Abschlussprüfung folgte Hanna-Renate Laurien den Vorgaben des schon erwähnten Strukturplans für das Bildungswesen. So sollte dem Erwerb der Hochschulrei- reale Bildung reale Chancen Realschule 39
40 Persönliches Dr. Hanna-Renate Laurien 1978 als rheinland-pfälzische Kultusministerin beim 20-jährigen Bestehen der Realschule in Waldfi schbach fe, dem Abitur II, ein Abitur I vorausgehen, das an die Stelle der so genannten Mittleren Reife bzw. des qualifizierten Sekundarabschlusses I treten sollte. Es gab die Überlegung, auch das Abitur I mit einer Abschlussprüfung zu verbinden, in die Erfahrungen aus den Leistungsvergleichen und -feststellungen an Realschulen eingehen sollten. Gegen das Vorhaben sträubten sich allerdings die Vertreter des Gymnasiums, weil sie dessen Einheit bedroht sahen, und schließlich auch die Vertreter der Realschule, die nur für den Fall zustimmen wollten, dass auch andere Schularten einbezogen würden, sofern sie wie das Gymnasium diesen Abschluss vermittelten. In der Folge wurde die Abschlussprüfung zu Grabe getragen. In Rheinland-Pfalz ist es zu meinem Bedauern bis heute dabei geblieben! Mit diesen Diskussionen war ich nicht mehr als Hilfsreferent, sondern als VDR-Vertreter auf Landes- und auf Bundesebene und seit 1974 auch als HPR-Vorsitzender befasst. In dieser Zeit bis zum Februar 1980 erlebte ich die Staatssekretärin und ab 1976 die Kultusministerin Hanna-Renate Laurien als streitbare, aber faire Verhandlungspartnerin mit Verständnis für die Arbeit der Verbände, aber auch ohne Scheu vor Auseinandersetzungen. An den Streitpunkt um die Schulleitungsanrechnungen erinnere ich mich sehr genau, weil in diesem Fall VDR, HPR und damit auch ich erfolgreich waren: Kultusministerin Laurien setzte die vorgesehene Regelung nicht in Kraft. Dies brachte mir allerdings später als Realschulreferent im Kultusministerium Spott ein, weil die dann von Kultusminister Dr. Gölter verantwortete Regelung für die Realschulen ungünstiger war als die von mir in anderer Funktion bekämpfte. In das Kultusministerium hatte mich 1980 als Nachfolger von Gerhard Weuthen Kultusministerin Hanna-Renate Laurien zunächst abgeordnet, dann versetzt. Nur kurze Zeit vorher war ich als Vorsitzender des HPR Realschulen aus diesem Gremium ausgeschieden. Dieser Frontwechsel führte prompt zu einer mir unvergesslichen Situation. Als ich nämlich die Ministerin zum ersten Mal zu einem Spitzengespräch mit dem Hauptpersonalrat begleitete, wurde sie nach wenigen Minuten in den Landtag abberufen. Sie beauftragte mich energisch mit der weiteren Verhandlungsführung. Meine Anspannung, die man mir wohl auch anmerkte, war zunächst viel größer als die Freude über das mir damit entgegengebrachte Vertrauen! Hanna-Renate Laurien wechselte 1981 als Schulsenatorin nach Berlin. Nach meiner Erinnerung war ihre Teilnahme am Landesrealschultag des VDR im Bürgerhaus Mainz-Finthen einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte als rheinland-pfälzische Kultusministerin. Sie hielt keine Rede, sondern machte ausführliche Anmerkungen zum Thema Die Realschule: Unverzichtbares Element unseres Schulwesen. Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon definitiv von ihrem Wechsel nach Berlin wusste, ist mir nicht bekannt. In jedem Fall lobte sie den VDR, der sich über gewerkschaftliche Aufgaben hinaus auf Bundes- wie auf Landesebene erfolgreich um Ansätze für eine Bildungstheorie der Realschule und deren Umsetzung bemühe. Hanna-Renate Laurien unterstrich den über die Landesgrenzen hinaus anerkannten Beitrag der rheinland-pfälzischen Wahlpflichtdifferenzierung in der Realschule für die Individualisierung des Lernens und kündigte einen Schulversuch mit einem weiteren, näm- lich einem sozialpädagogisch-künstlerischen Schwerpunkt an. Außerdem erläuterte sie den Beitrag der Realschule zur Durchlässigkeit im Schulwesen, und zwar horizontal nach der Orientierungsstufe und vertikal beim Übergang in die Sekundarstufe II, und sie ging auf die bildungsökonomische und die sozialpolitische Leistung der Realschule ein, Kinder und vor allem Mädchen aus bildungsferneren Schichten zu höheren Bildungsabschlüssen zu führen. In diesem Zusammenhang warnte Hanna-Renate Laurien allerdings auch eindringlich vor einem Kampf um Kinderköpfe, der zwangsläufig zu einer Gefährdung der Hauptschule und damit auch zur Gefährdung der Realschule führen werde, da die Schülerzahlen rückläufig seien und die Realschule in Zukunft nicht mehr mit dem Anteil an Volksschulelternschaft rechnen dürfe, aus dem sie in der Vergangenheit ihr überproportionales Wachstum gespeist habe. Dies verlange der Realschule auch in Zukunft die Flexibilität ab, die sie in ihrer Geschichte und auch in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach bewiesen habe. Wie Recht sie mit ihrer Warnung und mit ihrer Voraussage hatte! Denn der Anteil des Gymnasiums und der Realschule erhöhte sich zu Lasten der Hauptschule von Jahr zu Jahr übrigens schon lange vor dem Wegfall der verbindlichen Schullaufbahnempfehlung der Grundschule. Und die in Rheinland-Pfalz nunmehr eingeführte Realschule plus verlangt nach Flexibilität, ohne Bewährtes aufzugeben: In dieser neuen Realschule, die unter Einschluss der Hauptschule zu drei Abschlüssen führt, sind die von Hanna- Renate Laurien zitierten Prinzipien von Adaptivität und Selektivität, die der Bildungswissenschaftler Prof. Alfons Otto Schorb beim Bad Kreuznacher Realschulkongress beide der Realschule zugeordnet hat, für deren pädagogische Arbeit noch bedeutsamer! Anfang der 90er-Jahre traf ich Hanna- Renate Laurien, damals Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, als Festrednerin bei einer Schulveranstaltung an einer rheinland-pfälzischen 40 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
41 Persönliches Ltd. MR i. R. Georg Stenner Dr. Hanna-Renate Laurien Hermann Kölsch Fotos: Filmausschnitte von der Schulnamen-Verleihungsfeier Max-Wittmann-Realschule, Waldfi schbach-burgalben 1994 Realschule wieder. Sie war vom Schulträger und vom Leiter der Realschule als Festrednerin eingeladen worden, und ich sprach im Auftrag von Kultusministerin Dr. Rose Götte ein Grußwort. Meine bei solchen Aufgaben inzwischen eigentlich ungewöhnliche Anspannung war wohl der Anwesenheit meiner früheren Chefin geschuldet. Sie selbst fand zu ihrer nie abgelegten Rolle als Lehrerin zurück, als sie mir nach meinem Beitrag ihre Hand auf den Arm legte und bemerkte: Ein schönes Grußwort! Einige Jahre später begegnete ich Hanna-Renate Laurien inzwischen ohne Ämter, aber nach wie vor aktiv bei einem Konzert in Berlin. Sie erkannte mich sofort wieder und erinnerte sich an meinen Aufgabenbereich im rheinland-pfälzischen Kultusministerium. Nach einigen Worten verabschiedete sie sich mit der Entschuldigung, dass sie ihre Schwester, die sie in der Pause verloren habe, suchen müsse. Meine Überraschung war groß, als ich drei Tage später wieder in Mainz in meinem Briefkasten ein persönliches Schreiben mit der Einladung fand, sie doch bei meinem nächsten Aufenthalt in Berlin einmal zu besuchen. Zu dem Besuch kam es leider nie! Den Brief bewahre ich aber bis heute auf, mit großem Respekt vor ihrer Lebensleistung und vor ihrer Menschlichkeit, auch wenn letztere bei ihrer manchmal unverblümten Bewertung von Menschen, bei ihrer Bereitschaft zur harten Auseinandersetzung und bei ihrer bisweilen aufkommenden Lust zum Spott nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen war. Im Übrigen war ihr Brief vermutlich auf derselben alten Schreibmaschine geschrieben, die sie auch benutzte, als sie vor vielen Jahren für meinen Kollegen und mich das schon erwähnte Protokoll zu ihrem eigenen Referat tippte! Für Hanna-Renate Laurien war die Realschule kein Lieblingskind, aber sie erkannte die Leistung dieser Schulart an und förderte sie. Sie hat die Dankbarkeit und Erinnerung der Realschullehrerschaft verdient! Mit dem VDR, vor allem mit dem früheren Vorsitzen- Die Pädagogin Dr. Hanna-Renate Laurien (CDU) wurde 1971 als Staatssekretärin ins Kultusministerium nach Mainz berufen. Fünf Jahre später wurde sie Kultusministerin von Rheinland-Pfalz und hatte das Amt bis 1981 inne. Von 1981 bis 1989 war sie Berliner Schulsenatorin und von 1991 bis 1995 als erste Frau Präsidentin des Abgeordnetenhauses in Berlin. Sie starb am 12. März 2010 in Berlin. In zahlreichen und umfassenden Nachrufen wird Frau Laurien als hochgebildete, streitbare, ausgesprochen faire und menschliche Persönlichkeit gewürdigt und das über Parteigrenzen hinweg; z. B. durch Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Online-Redaktionen u. a. Tagesspiegel Berlin, Berliner Morgenpost, ZEIT, Stern, Spiegel, Bild-Zeitung widmeten der Verstorbenen lange von Achtung und Respekt geprägte Texte. den Werner Schappert, stand sie immer in gutem und für die Realschule förderlichen Kontakt. Ich selbst habe Hanna-Renate Laurien sehr geschätzt und werde sie nicht vergessen! Ltd. MR i. R. Georg Stenner 1988 beim 30-jährigen Bestehen des VDR Rheinland-Pfalz Ihre Aussage: In zentralen, lebenswichtigen Fragen muss ein Bündnis der Vernünftigen möglich sein, beschrieb ihre Haltung. Die von der Staatskanzlei Rheinland- Pfalz im Auftrag der Landesregierung herausgegebene, wöchentlich erscheinende StaatsZeitung, Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz, Nr. 9 vom 22. März 2010 hatte für den Nachruf leider nur in einem kleinen Zweispalter Platz. reale Bildung reale Chancen Realschule 41
42 Persönliches Der VDR gratuliert und wünscht Gesundheit und Gottes Segen für das neue Lebensjahr! Bezirk Koblenz 70. Geburtstag am Alois Kurth, Arzbach am Wolfgang Kaiser, Betzdorf 71. Geburtstag am Dieter Kettering, Nussbaum am Jürgen Helbach, St Goar am Christel Wienen, St Katharinen 72. Geburtstag am Walter Heinz, Münster-Sarmsheim am Wilfried Baus, Braubach 73. Geburtstag am Edwin Langer, Rheinböllen 74. Geburtstag am Rolf Schatto, Sobernheim am Lothar Hüsch, Elkenroth am Johannes Wickler, Friesenhagen am Günter Tretschok, Bell 75. Geburtstag am Hiltrud Schumacher, Anhausen am Luise Tonn, Sohren am Klaus-Peter Wyrwoll, St. Johann / Mayen 76. Geburtstag am Werner Freisberg, Caan 80. Geburtstag am Alfons Gerharz, Montabaur 81. Geburtstag am Hans-Ludwig Clemens, Simonswald 82. Geburtstag am Luise Löwer, Dierdorf Bezirk Neustadt 70. Geburtstag am Jutta Kern, Waldfi schb.-burgalben am Ingrid Schappert, MZ-Lerchenberg am Walter Paul, Rockenhausen am Wiltrud vonscharpen, Mainz am Wolfgang Friebe, Mainz 71. Geburtstag am Peter Dr. Bung, Annweiler am Eberhard Schneider, Mainz am Ursula Frank, Undenheim am Waltraud Lotz, Karlsruhe am Gert Hörner, Edenkoben am Johannes G. Kretkowski, Mainz 72. Geburtstag am Reinhard Hoffmann, Rohrbach 73. Geburtstag am Manfred Schäfer, Kaiserslautern am Wolfgang Held, Karlsruhe am Klaus Kiefer, Landau am Roswitha Stauder, Altleiningen am Oskar Francke, Neustadt 74. Geburtstag am Alfons Denig, Neustadt / W am Lothar Wipfl er, Bad Dürkheim 75. Geburtstag am Karl-Heinz Walz, Haßloch am Otto Stilgenbauer, Kaiserslautern am Herbert Grunwald, Heidesheim am Heribert Brechter, Landau 76. Geburtstag am Johannes Hoffmann, Mainz 78. Geburtstag am Rudolfi ne Zehetner, Landau 80. Geburtstag am Gerda Erbacher, Speyer am Günther Kohl, Haßloch 81. Geburtstag am Wolfgang Panzer, Schifferstadt 82. Geburtstag am Gerhard Scheinert, Schifferstadt am Karl-Heinz Kühefuß, Mainz 83. Geburtstag am Marie Müller-Buchholz, Bonn am Inge Pieroth, Mainz 84. Geburtstag am Walter Kallenbach, Neustadt / W 90. Geburtstag am Peter Nußbaum, Pirmasens Bezirk Trier 70. Geburtstag am Martha Mutscheller, Igel am Ilse Becker, Prüm 71. Geburtstag am Rüdiger Lancelle, Moselkern am Paul Schwab, Schweich am Friedel-Norbert Müller, Morbach am Hans-Jürgen Vogt, Kaperich 72. Geburtstag am Hans Karl Wimmer, Plein am Hans Jung, Morbach 73. Geburtstag am Karl-Heinz Dahlke, Hermeskeil am Hermann Erschens, Leiwen 42 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
43 Persönliches Bezirk Trier 73. Geburtstag am Gerd Leibenguth, Konz am Heinz-Albrecht Becker, Prüm 74. Geburtstag am Giselbert Baudner, Ayl am Hans Thielen, Korlingen am Eduard Gerten, Wintrich am Berthold Becker, Hillesheim 76. Geburtstag am Robert Adams, Rommersheim am Marlene Schamel, Trier 77. Geburtstag am Elisabeth Hempelmann, Trier am Hartmut Konz, Wittlich am Irmund Becker, Gusenburg am Bernhard Heisig, Trier 82. Geburtstag am Franz Meyer, Neumagen-Dhron 83. Geburtstag am Horst Faust, Starkenburg 87. Geburtstag am Leo Michels, Prüm 88. Geburtstag am Jula Scholzen-Gnad, Trier 96. Geburtstag am Karl Denkel, Haunetal Wir bitten um Entschuldigung, falls wir Geburtstage im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2010 übersehen haben. Bitte informieren Sie uns umgehend über relevante Änderungen Ihrer persönlichen Daten Rheinland-Pfalz: Beamtenbesoldung im Jahr 2008 verfassungsgemäß Die Besoldung der rheinland-pfälzischen Beamten war im Jahr 2008 amtsangemessen und damit verfassungsgemäß. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden. Geklagt hatte ein Justizamtsrat. Er machte geltend, dass sein Einkommen im Jahr 2008 in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen gewesen sei. Vergleichbare Tätigkeiten in der Privatwirtschaft seien höher bezahlt. Zudem habe der Gesetzgeber die Besoldung nicht ausreichend an die allgemeine Wirtschafts- und Einkommensentwicklung angepasst. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Nettoeinkommen des Klägers entspreche den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine amtsangemessene Besoldung. Es ermögliche ihm eine amtsangemessene Lebensführung. Das Einkommen sei auch mit dem Einkommen von Bundesbeamten und Beamten anderer Bundesländer vergleichbar. Der Kläger werde schließlich auch nicht gegenüber Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst benachteiligt. Das Verwaltungsgericht hat die Berufung gegen das Urteil zugelassen. Quelle: (Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 7. September 2010, 6 K 1406/09.KO) Der VDR-Landesvorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr in Gesundheit und Frieden! reale Bildung reale Chancen Realschule 43
44 VDR-Intern Pensionärsfahrt des Bezirks Trier Entschieden wird im Dezember beim vorweihnachtlichen Pensionärstreff, gefahren wird im Frühjahr. Dieses Mal zog es die Pensionäre in den Raum Köln Bonn. Erste Station war das Jagdschloss Falkenlust des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten Clemens August ( ), ein sehr sehenswertes Rokokoschlößchen in der Nähe von Schloss Augustusburg bei Brühl und zusammen mit diesem Teil des UNESCO-Kulturerbes. Nach der Führung mit vielen sachkundigen Hinweisen und Erläuterungen durch Paul Schwab ging es nach Bonn zum Mittagessen. Auch der in Schwarzrheindorf einsetzende Regen (immerhin der erste in einer Reihe von Jahren mit Ausflügen) tat der Stimmung keinen Abbruch. Unter dem Schutz von Bäumen rückte man näher zusammen und lauschte den Ausführungen von Paul Schwab zur Architektur und Geschichte der dortigen in romanischem Stil erbauten Doppelkirche. Diese beeindruckt einmal durch ihre Bauweise zum anderen durch die Wandmalereien. Abgeschlossen wurde der Tag auf der Terrasse des Bahnhofs Rolandseck mit Blick auf den Rhein und das Arp-Museum bei Kaffee und Kuchen. Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, an der zahlreiche Teilnehmer immer mit Begeisterung teilnehmen. Organisation und Führungen lagen wie immer in den bewährten Händen von Frau Schamel und Herrn Schwab. Hanns Peters Bezirksvorsitzender Trier Jagdschloss Falkenlust bei Brühl und Fahrt nach Rolandseck Übernahme in das Beamtenverhältnis trotz Überschreitens der Altersgrenze möglich Das Land Rheinland-Pfalz kann den Antrag von vier Lehrern auf Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht mit der Begründung ablehnen, sie überschritten die Höchstaltersgrenze von 45 Jahren für eine Einstellung. Dies entschied die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt am 16. November Zwar enthalte das Landesbeamtengesetz mittlerweile eine gesetzlich geregelte Höchstaltersgrenze von 45 Jahren. Diese Altersgrenze gelte nach dem Wortlaut des Gesetzes aber nur grundsätzlich. Näheres sei in den Laufbahnvorschriften zu regeln. Eine wirksame Altersgrenze setze nach Auffassung der Richter damit auch die Regelung von Ausnahmen, z.b. für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten, voraus. Solche Ausnahmeregelungen enthalte die Laufbahnverordnung derzeit noch nicht. Der Beklagte sei deshalb verpflichtet, über die Anträge der Kläger auf Übernahme in das Beamtenverhältnis trotz Überschreitens der Altersgrenze neu zu entscheiden und dabei die für bis Dezember 2010 angekündigten Ausnahmeregelungen in der Laufbahnverordnung zu berücksichtigen. Das Gericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache die Berufung zugelassen. Verwaltungsgericht Neustadt, Urteile vom 16. November K 271/10.NW, 6 K 343/10.NW 6 K 531/10.NW 6 K 842/10.NW 44 Realschule in Rheinland-Pfalz 3/2010 reale Bildung reale Chancen Realschule
45 VDR-Intern Den geheimnisvollen Kriegerinnen auf der Spur Was steckt hinter dem antiken Mythos der Amazonen? Gab es sie wirklich oder sind sie reine Fantasie? Diese und weitere Fragen wurden bei der Führung durch die Die Ausstellung Amazonen Geheimnisvolle Kriegerinnen im historischen Museum der Pfalz in Speyer von einer sehr kompetenten Kunsthistorikerin angesprochen und erläutert. Die VDR-Mitglieder waren fasziniert von neueren Forschungsergebnissen und Funden außerhalb Griechenlands, die noch nie zuvor in der Öffentlichkeit zu sehen waren: z. B. Gräberfunde aus den Steppen zwischen Osteuropa und Sibirien. Die Doppelbestattung eines Kriegers und einer Kriegerin aus Ak-Alacha im Altai-Gebirge, beide in Paraderüstung von Reiterkriegern beerdigt, geben Zeugnis von bewaffneten Frauen. Gleichzeitig belegen sie, dass das Phänomen Amazonen nicht auf den griechischen Raum zu beschränken ist. Die Historikerin des Museums erläuterte des Weiteren den VDR-Mitgliedern anhand prachtvoller griechischer Vasenmalereien die mitreißenden Geschichten von einer Welt voller Helden und Legenden, von Leben und Tod, Liebe und Unglück. Großartige Meisterwerke von der Antike bis zur Moderne zu diesem Thema schlagen den Bogen bis in die Gegenwart. Trotz neuer Erkenntnisse und Funde lässt sich kein abschließendes Urteil zu den Eingangsfragen bilden, die Amazonen bleiben ein Geheimnis. Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 13. Februar 2011 in Speyer zu erleben. VDR ler stürmen die Staufer-Ausstellung im Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim Es waren noch nie so viele Besucher, 48 Teilnehmer an der Zahl, dem Ruf des VDR gefolgt; sie wollten sich das herausragende Kulturereignis in Mannheim nicht entgehen lassen. Entscheidend prägten die neun staufischen Herrscher von Konrad III. ( ) bis Konradin ( ) die europäische Geschichte des Hochmittelalters. Besonders herausragend sind Friedrich I. Barbarossa und Friedrich II. zu nennen. Ihr Herrschaftsbereich, so informierte der Historiker, lässt sich in drei Kernbereiche aufteilen: sie hielten Hof am Rhein, in der Poebene und auf Sizilien. Dort wurden sowohl glänzende Hoffeste gefeiert, Kämpfe ausgetragen, aber auch Wissenszentren aufgebaut und künstlerische Aktivitäten gefördert. Die Ausstellung ermöglicht einen Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Le- benswelten in den drei Herrschaftsregionen. Anhand archäologischer Funde konnten die Teilnehmer Einblicke in die Lebensverhältnisse auf einer pfälzischen Burg ebenso wie in einem lombardischen Kaufmannshaus oder einem Stadt palast Palermos gewinne. Der Historiker wies daraufhin, dass in diesem sogenannten staufischen Jahrhundert, zwischen 1138 und 1268, sich in ganz Europa weitgreifende Veränderungs- und Umschichtungsprozesse vollzogen, die zu einem gewandelten Weltbild führten: Neue künstlerische Aktivitäten und Ausdrucksformen entwickelten sich, eine blühende Wissenskultur entstand, höfisches Leben entfaltete sich in ungeahnter Pracht und Größe, kirchliche Strukturen wurden erneuert. Radikal veränderten sich auch die wirtschaftlichen Bedingungen. Das Ende der staufischen Herrschaft erfolgte mit der Hinrichtung des kinderlosen Königs Konradin 1268 auf dem Marktplatz in Neapel. Doch die mythische Verklärung der glanzvollen Stauferzeit lebt bis heute fort und ist sicher ein Grund für das große Interesse an dieser Ausstellung. Bis 20. Februar 2011 ist noch Gelegenheit diesem Mythos im rem in Mannheim nachzuspüren. Wir danken Gudrun Deck für die immer wieder perfekt ausgesuchten und organisierten Museumsbesuche! reale Bildung reale Chancen Realschule 45
GROSSE ANFRAGE QUALITÄT UND SCHULSTRUKTUR IM RHEINLAND-PFÄLZISCHEN SCHULWESEN
 POSITIONSPAPIER GROSSE ANFRAGE QUALITÄT UND SCHULSTRUKTUR IM RHEINLAND-PFÄLZISCHEN SCHULWESEN Die Schulstrukturreform war richtig und wichtig Eine der zentralen landespolitischen Herausforderungen ist,
POSITIONSPAPIER GROSSE ANFRAGE QUALITÄT UND SCHULSTRUKTUR IM RHEINLAND-PFÄLZISCHEN SCHULWESEN Die Schulstrukturreform war richtig und wichtig Eine der zentralen landespolitischen Herausforderungen ist,
Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr.
 Schule am Floßplatz - Grundschule Fax-Nr. 0341/ 2 11 98 56 Hohe Str. 45 04107 Leipzig Tel. 0341/ 91046021 Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr. Hinweise für Eltern zum Aufnahmeverfahren an Oberschulen
Schule am Floßplatz - Grundschule Fax-Nr. 0341/ 2 11 98 56 Hohe Str. 45 04107 Leipzig Tel. 0341/ 91046021 Elternbrief der Grundschule Klasse 4, Schuljahr. Hinweise für Eltern zum Aufnahmeverfahren an Oberschulen
Die Berliner Schulstrukturreform
 Die Berliner Schulstrukturreform 26.06.2009 1 Die Ziele Qualität weiter verbessern, Chancengleichheit herstellen Alle Schülerinnen zum bestmöglichen Schulabschluss führen Abhängigkeit des Schulerfolgs
Die Berliner Schulstrukturreform 26.06.2009 1 Die Ziele Qualität weiter verbessern, Chancengleichheit herstellen Alle Schülerinnen zum bestmöglichen Schulabschluss führen Abhängigkeit des Schulerfolgs
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16. Wahlperiode. Kleine Anfrage. Antwort. Drucksache 16/1393. der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) und
 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16. Wahlperiode Drucksache 16/1393 05. 07. 2012 Kleine Anfrage der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) und Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16. Wahlperiode Drucksache 16/1393 05. 07. 2012 Kleine Anfrage der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) und Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Leitsätze für das Schulsystem 2016
 Leitsätze für das Schulsystem 2016 Impulspapier für eine zukunftsfähige Bildungspolitik in Baden-Württemberg Zukunftswerkstatt der CDU Baden-Württemberg 3 Impulspapier Nr. 3 für den Themenkongress am 13.
Leitsätze für das Schulsystem 2016 Impulspapier für eine zukunftsfähige Bildungspolitik in Baden-Württemberg Zukunftswerkstatt der CDU Baden-Württemberg 3 Impulspapier Nr. 3 für den Themenkongress am 13.
DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt
 DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK 2017 DIE REALSCHULE PLUS UND FACHOBERSCHULE IM PAUL-VON-DENIS-SCHULZENTRUM SCHIFFERSTADT 850 Schüler 40 Klassen 70 Lehrer 2 Gebäude Neue Mensa Fachtrakt S-Bahn-Haltestelle
DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK 2017 DIE REALSCHULE PLUS UND FACHOBERSCHULE IM PAUL-VON-DENIS-SCHULZENTRUM SCHIFFERSTADT 850 Schüler 40 Klassen 70 Lehrer 2 Gebäude Neue Mensa Fachtrakt S-Bahn-Haltestelle
Weiterentwicklung der Realschulen
 Weiterentwicklung der Realschulen Zielsetzung der Landesregierung Weiterentwicklung des Schulsystems in Baden-Württemberg zu einem Zwei-Säulen-System. Die Realschulen leisten durch die Stärkung individualisierter
Weiterentwicklung der Realschulen Zielsetzung der Landesregierung Weiterentwicklung des Schulsystems in Baden-Württemberg zu einem Zwei-Säulen-System. Die Realschulen leisten durch die Stärkung individualisierter
Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 3)
 SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 3)
SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 3)
Der voraussichtliche Rückgang wurde für die Schularten gesondert ermittelt: Realschule plus
 Kernaussagen des Gutachtens In der Studie wird die Entwicklung des Lehrkräftebedarfs in Rheinland-Pfalz bis zum Schuljahr 2016/17 untersucht und prognostiziert. Dabei werden die entscheidenden Faktoren,
Kernaussagen des Gutachtens In der Studie wird die Entwicklung des Lehrkräftebedarfs in Rheinland-Pfalz bis zum Schuljahr 2016/17 untersucht und prognostiziert. Dabei werden die entscheidenden Faktoren,
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 15. Wahlperiode. Kleine Anfrage. Antwort. Drucksache 15/831. des Abgeordneten Werner Kuhn (FDP) und
 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 15. Wahlperiode Drucksache 15/831 01. 03. 2007 Kleine Anfrage des Abgeordneten Werner Kuhn (FDP) und Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Zahl der
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 15. Wahlperiode Drucksache 15/831 01. 03. 2007 Kleine Anfrage des Abgeordneten Werner Kuhn (FDP) und Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Zahl der
Da dem Ausschuss unsere Stellungnahme bereits schriftlich vorliegt, erlaube ich mir, lediglich die wichtigsten Punkte vorzutragen.
 Anhörverfahren im Ausschuss für Bildung und Jugend des Landtags Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur / Gesetzentwurf der Landesregierung / Mainz, 06. November 2008 Statement des
Anhörverfahren im Ausschuss für Bildung und Jugend des Landtags Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur / Gesetzentwurf der Landesregierung / Mainz, 06. November 2008 Statement des
Bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion: Nicole Morsblech, MdL
 FDP Bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion: Nicole Morsblech, MdL 1. Finanzen / Beihilfe Qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer sind die Grundlage für ein gutes Schul- und Bildungswesen.
FDP Bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion: Nicole Morsblech, MdL 1. Finanzen / Beihilfe Qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer sind die Grundlage für ein gutes Schul- und Bildungswesen.
Sylvia Löhrmann: "Die Sekundarschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens"
 Artikel Bilder Schulstruktur Zweigliedrigkeit: Ist immer drin, was draufsteht? didacta 2012 Themendienst: Sylvia Löhrmann und Bernd Althusmann zum Dauerthema Schulstruktur Mehr zu: didacta - die Bildungsmesse,
Artikel Bilder Schulstruktur Zweigliedrigkeit: Ist immer drin, was draufsteht? didacta 2012 Themendienst: Sylvia Löhrmann und Bernd Althusmann zum Dauerthema Schulstruktur Mehr zu: didacta - die Bildungsmesse,
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
 Liebe Kollegin, lieber Kollege, Rheinland-Pfalz hat eine neue Landesregierung. Die sogenannte Ampel aus SPD, FDP und Grünen ist nun im Amt. Den Koalitionsvertrag haben wir aus gewerkschaftlicher Sicht
Liebe Kollegin, lieber Kollege, Rheinland-Pfalz hat eine neue Landesregierung. Die sogenannte Ampel aus SPD, FDP und Grünen ist nun im Amt. Den Koalitionsvertrag haben wir aus gewerkschaftlicher Sicht
Fachoberschule ein Bildungsangebot an Realschule plus
 Fachoberschule ein Bildungsangebot an Realschule plus Informationsveranstaltung am 24.11.2010 in Dahn Herbert Petri, MBWJK Folie 1 Themen 1. Schulstrukturreform 2. Neues Wahlpflichtfach in der Realschule
Fachoberschule ein Bildungsangebot an Realschule plus Informationsveranstaltung am 24.11.2010 in Dahn Herbert Petri, MBWJK Folie 1 Themen 1. Schulstrukturreform 2. Neues Wahlpflichtfach in der Realschule
Rahmenvereinbarung. über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt. der Sekundarstufe I. (Lehramtstyp 3)
 Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 3) (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 i. d. F. vom 07.03.2013) Sekretariat der Ständigen
Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 3) (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 i. d. F. vom 07.03.2013) Sekretariat der Ständigen
Schriftliche Kleine Anfrage
 BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/5064 19. Wahlperiode 26.01.10 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Ties Rabe (SPD) vom 15.01.10 und Antwort des Senats Betr.: A14-Stellen
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/5064 19. Wahlperiode 26.01.10 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Ties Rabe (SPD) vom 15.01.10 und Antwort des Senats Betr.: A14-Stellen
1. Es gibt in Castrop-Rauxel kein mehrgliederiges Schulsystem mehr.
 7 Argumente für die Sekundarschule Am Bürgerentscheid am 28.10. 2012 geht es doch um die Frage: Welche Schule ist am besten geeignet, ab dem kommenden Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen,
7 Argumente für die Sekundarschule Am Bürgerentscheid am 28.10. 2012 geht es doch um die Frage: Welche Schule ist am besten geeignet, ab dem kommenden Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen,
Kooperationsvereinbarung zur. Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft Schleswig-Holstein
 Kooperationsvereinbarung zur Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft Schleswig-Holstein Präambel: Die schleswig-holsteinische Wirtschaft erwartet auch infolge der demografischen Entwicklung künftig einen
Kooperationsvereinbarung zur Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft Schleswig-Holstein Präambel: Die schleswig-holsteinische Wirtschaft erwartet auch infolge der demografischen Entwicklung künftig einen
Planungsteam 2009/10 Uta Deutsch Bärbel Isermeyer Tina Reinhold Andrea Schäfer Heidi Webel
 Planungsteam 2009/10 Uta Deutsch Bärbel Isermeyer Tina Reinhold Andrea Schäfer Heidi Webel Willkommen an der IGS Grünstadt 02. Dezember 2009 Die IGS Grünstadt stellt sich vor Schule für alle: Schüler eines
Planungsteam 2009/10 Uta Deutsch Bärbel Isermeyer Tina Reinhold Andrea Schäfer Heidi Webel Willkommen an der IGS Grünstadt 02. Dezember 2009 Die IGS Grünstadt stellt sich vor Schule für alle: Schüler eines
Rahmenvereinbarung. über die Ausbildung und Prüfung. für übergreifende Lehrämter der Primarstufe
 Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 2) (Beschluss der Kultusministerkonferenz
Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe I (Lehramtstyp 2) (Beschluss der Kultusministerkonferenz
Die Oberschule Celle I. ( Mai 2012)
 Die Oberschule Celle I ( Mai 2012) Gliederung Die Oberschulen in Celle Die Oberschule Celle I Arbeit in der Oberschule Celle I Organisation der Oberschule Celle I Organisation des Unterrichts, insbesondere
Die Oberschule Celle I ( Mai 2012) Gliederung Die Oberschulen in Celle Die Oberschule Celle I Arbeit in der Oberschule Celle I Organisation der Oberschule Celle I Organisation des Unterrichts, insbesondere
Bildungspolitik in Brandenburg
 Bildungspolitik in Brandenburg Probleme der Transformation eines Bildungssystems unter den Bedingungen des demografischen Wandels 1991 bis 2020 Bildungssoziologie und politik im Überblick 19. Februar 2013
Bildungspolitik in Brandenburg Probleme der Transformation eines Bildungssystems unter den Bedingungen des demografischen Wandels 1991 bis 2020 Bildungssoziologie und politik im Überblick 19. Februar 2013
Grußwort zum Start der IGS in Zell
 Grußwort zum Start der IGS in Zell Grußwort Bürgermeister Karl Heinz Simon Zum offiziellen Start der Integrierten Gesamtschule in Zell am Samstag, den 06. September 2008 um 11 Uhr im Schulzentrum in Zell
Grußwort zum Start der IGS in Zell Grußwort Bürgermeister Karl Heinz Simon Zum offiziellen Start der Integrierten Gesamtschule in Zell am Samstag, den 06. September 2008 um 11 Uhr im Schulzentrum in Zell
6. Wie viele Sonderpädagogen sollen bei den Gymnasien im Landkreis Böblingen im Zeitraum 2014 bis 2019 eingestellt werden?
 Landtag von Baden-Württemberg 15. Wahlperiode Drucksache 15 / 6975 10. 06. 2015 Kleine Anfrage der Abg. Sabine Kurtz und Paul Nemeth CDU und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Situation
Landtag von Baden-Württemberg 15. Wahlperiode Drucksache 15 / 6975 10. 06. 2015 Kleine Anfrage der Abg. Sabine Kurtz und Paul Nemeth CDU und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Situation
Fachoberschule - Wirtschaft und Verwaltung - mit dem Schwerpunkt Wirtschaft BFS. 1 - jährig 4 Tage Schule 1 Tag prakt. Ausbildung
 1 REALSCHULE Ausbildung SI BFS SI FOS erw SI BG 1. Jahr 1 - jährig 4 Tage Schule 1 Tag prakt. Ausbildung 11. Klasse 2 Tage Schule 3 Tage Praktikum 11. Klasse 2. Jahr BFS - Abschluss + ggf. ESI 12. Klasse
1 REALSCHULE Ausbildung SI BFS SI FOS erw SI BG 1. Jahr 1 - jährig 4 Tage Schule 1 Tag prakt. Ausbildung 11. Klasse 2 Tage Schule 3 Tage Praktikum 11. Klasse 2. Jahr BFS - Abschluss + ggf. ESI 12. Klasse
Gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Neuwied im Schuljahr 2016/2017
 Gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Neuwied im Schuljahr 2016/2017 Der Schulträgerausschuss des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 19.01.2015 einstimmig den Antrag auf Errichtung
Gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Neuwied im Schuljahr 2016/2017 Der Schulträgerausschuss des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 19.01.2015 einstimmig den Antrag auf Errichtung
BERLIN SPORT MEHR» PRÜFUNGEN Berliner Gymnasien wollen Prüfung abschaffen
 zur Light-Version» BERLIN SPORT MEHR» PRÜFUNGEN Berliner Gymnasien wollen Prüfung abschaffen Foto: DPA Künftig sollen in Berlin die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss nur noch an den Sekundarschulen
zur Light-Version» BERLIN SPORT MEHR» PRÜFUNGEN Berliner Gymnasien wollen Prüfung abschaffen Foto: DPA Künftig sollen in Berlin die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss nur noch an den Sekundarschulen
Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Oberschule
 Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Oberschule Ab wann können Oberschulen geführt werden? Eine Oberschule kann seit Schuljahresbeginn 2011/2012 beginnend mit der Einrichtung eines 5. Schuljahrgangs
Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Oberschule Ab wann können Oberschulen geführt werden? Eine Oberschule kann seit Schuljahresbeginn 2011/2012 beginnend mit der Einrichtung eines 5. Schuljahrgangs
Wie weiter ab Klasse 7?
 Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg- Vorpommern ab dem Schuljahr 200/0 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM
Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg- Vorpommern ab dem Schuljahr 200/0 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM
GYMNASIUM & GEMEINSCHAFTSSCHULE ZWEI-SÄULEN-MODELL
 GYMNASIUM & GEMEINSCHAFTSSCHULE ZWEI-SÄULEN-MODELL www.gemeinsam-bilden.de GYMNASIUM & GEMEINSCHAFTSSCHULE ZWEI-SÄULEN-MODELL Im Bereich der weiterführenden allgemein bildenden Schulen wird zum Schuljahr
GYMNASIUM & GEMEINSCHAFTSSCHULE ZWEI-SÄULEN-MODELL www.gemeinsam-bilden.de GYMNASIUM & GEMEINSCHAFTSSCHULE ZWEI-SÄULEN-MODELL Im Bereich der weiterführenden allgemein bildenden Schulen wird zum Schuljahr
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule
 Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
Gemeinsames Lernen an der Sternenschule Im Schuljahr 2011 / 2012 hat sich das Kollegium der Sternenschule gemeinsam auf den Weg zur inklusiven Schulentwicklung gemacht. Seitdem nehmen auch Kinder mit festgestelltem
Die Arbeit in der Realschule
 Die Arbeit in der Realschule Vorstellung wichtiger Punkte des Erlasses vom 27.04.2010 Schwerpunkt Berufsorientierung Inhalt REALSCHULE JOHN-F.-KENNEDY-PLATZ Stellung der Realschule innerhalb des öffentlichen
Die Arbeit in der Realschule Vorstellung wichtiger Punkte des Erlasses vom 27.04.2010 Schwerpunkt Berufsorientierung Inhalt REALSCHULE JOHN-F.-KENNEDY-PLATZ Stellung der Realschule innerhalb des öffentlichen
STATISTISCHES LANDESAMT KOMMUNALDATENPROFIL. Stand: 03/2017. Gebietsstand: 1. Januar Bildung. Landkreis Alzey-Worms
 Stand: 03/2017 KOMMUNALDATENPROFIL Gebietsstand: 1. Januar 2017 Landkreis Alzey-Worms Landkreis Alzey-Worms111111111 seinrichtungen, Schüler/-innen sowie Schulentlassene im Landkreis nach Schulart Schulart
Stand: 03/2017 KOMMUNALDATENPROFIL Gebietsstand: 1. Januar 2017 Landkreis Alzey-Worms Landkreis Alzey-Worms111111111 seinrichtungen, Schüler/-innen sowie Schulentlassene im Landkreis nach Schulart Schulart
Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft. Anforderungen erfüllt?
 Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft Anforderungen erfüllt? Martin Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Berlin 1 Persönliche Vorstellung M. Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Referatsleiter
Berufliches Bildungssystem der Landwirtschaft Anforderungen erfüllt? Martin Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Berlin 1 Persönliche Vorstellung M. Lambers Deutscher Bauernverband (DBV) Referatsleiter
Rahmenvereinbarung zur Studien- und Berufsorientierung. Herbert Petri, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
 Rahmenvereinbarung zur Studien- und Berufsorientierung Herbert Petri, Folie 1 Rahmenvereinbarung: MBWJK Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Wirtschaft im Bereich der Studien- und Berufswahlvorbereitung
Rahmenvereinbarung zur Studien- und Berufsorientierung Herbert Petri, Folie 1 Rahmenvereinbarung: MBWJK Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Wirtschaft im Bereich der Studien- und Berufswahlvorbereitung
Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis Schul(form)wahl nach Klasse 4
 Schul(form)wahl nach Klasse 4 Staatliches Schulamt in Friedberg Ablauf / Inhalte Stationen / Termine Überblick über das hessische Schulsystem Entscheidungshilfen für Eltern Schulformen in der Region Rechtsbezug:
Schul(form)wahl nach Klasse 4 Staatliches Schulamt in Friedberg Ablauf / Inhalte Stationen / Termine Überblick über das hessische Schulsystem Entscheidungshilfen für Eltern Schulformen in der Region Rechtsbezug:
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
 Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Presseinformation 488/7/2014 Minister Schneider und Ministerin Löhrmann: Unternehmen sollten in dieser wirtschaftlich positiven Situation noch mehr Praktika und
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen Presseinformation 488/7/2014 Minister Schneider und Ministerin Löhrmann: Unternehmen sollten in dieser wirtschaftlich positiven Situation noch mehr Praktika und
Wie funktioniert PES?
 Herbert Petri, RR / Neustadt 28.04.2007 Herbert Petri, RR / Neustadt 28.04.2007 Wie funktioniert PES? Beteiligte Schulen Projekt Erweiterte Selbstständigkeit LMZ Koblenz IFB Boppard ADD / Ministerium Herbert
Herbert Petri, RR / Neustadt 28.04.2007 Herbert Petri, RR / Neustadt 28.04.2007 Wie funktioniert PES? Beteiligte Schulen Projekt Erweiterte Selbstständigkeit LMZ Koblenz IFB Boppard ADD / Ministerium Herbert
Den richtigen Weg wählen
 Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Den richtigen Weg wählen Hamburgs weiterführende Schulen im Schuljahr 2008/09 mit Ausblick auf das Schuljahr 2009/10
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Den richtigen Weg wählen Hamburgs weiterführende Schulen im Schuljahr 2008/09 mit Ausblick auf das Schuljahr 2009/10
Schulabschlüsse in der Sekundarstufe I
 Baltic-Schule Grund- und Gemeinschaftsschule der Hansestadt Lübeck mit Oberstufe Karavellenstraße 2-4 23558 Lübeck Schulabschlüsse in der Sekundarstufe I (Stand: September 2017) Eine Bemerkung zu den Begriffen
Baltic-Schule Grund- und Gemeinschaftsschule der Hansestadt Lübeck mit Oberstufe Karavellenstraße 2-4 23558 Lübeck Schulabschlüsse in der Sekundarstufe I (Stand: September 2017) Eine Bemerkung zu den Begriffen
Kooperationsvereinbarung
 Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.v. und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport über die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen an Ganztagsschulen
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.v. und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport über die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen an Ganztagsschulen
INFORMATIONSABEND WEITERFÜHRENDE SCHULE. Herzlich willkommen!!! Ablauf Vortrag Zwischenfragen möglich und erwünscht Aussprache, Fragen, Diskussion
 INFORMATIONSABEND WEITERFÜHRENDE SCHULE Herzlich willkommen!!! Ablauf Vortrag Zwischenfragen möglich und erwünscht Aussprache, Fragen, Diskussion DIE BESTE SCHULE FÜR MEIN KIND Hauptschule Realschule Gymnasium
INFORMATIONSABEND WEITERFÜHRENDE SCHULE Herzlich willkommen!!! Ablauf Vortrag Zwischenfragen möglich und erwünscht Aussprache, Fragen, Diskussion DIE BESTE SCHULE FÜR MEIN KIND Hauptschule Realschule Gymnasium
Inklusive Schule Grundlagen Beispiele - Visionen. Förderschulen in Bayern - Darstellung status quo
 FACHTAGUNG der Vertretung des kirchlichen Schulwesens in Bayern (VKS) Inklusive Schule Grundlagen Beispiele - Visionen Förderschulen in Bayern - Darstellung status quo Michael Eibl, Direktor der Katholischen
FACHTAGUNG der Vertretung des kirchlichen Schulwesens in Bayern (VKS) Inklusive Schule Grundlagen Beispiele - Visionen Förderschulen in Bayern - Darstellung status quo Michael Eibl, Direktor der Katholischen
Bedeutung von Abschlussvermerken auf Schulzeugnissen. in Nordrhein-Westfalen.
 von Abschlussvermerken auf Schulzeugnissen in Nordrhein-Westfalen. 1 www.mais.nrw Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung 4 2 der Abschlussvermerke 6 2.1 Abschlussvermerke der Hauptschule 8 2.2 Abschlussvermerke
von Abschlussvermerken auf Schulzeugnissen in Nordrhein-Westfalen. 1 www.mais.nrw Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung 4 2 der Abschlussvermerke 6 2.1 Abschlussvermerke der Hauptschule 8 2.2 Abschlussvermerke
Verkürzung im gymnasialen Bildungsgang
 Sachstand November 2006 November 2006 Frankfurt 1 Bildungspolitische Erklärung (Regierungsprogramm 2003) Am Ende der Legislaturperiode sollen an allen hessischen Gymnasien die dann in die Mittelstufe eintretenden
Sachstand November 2006 November 2006 Frankfurt 1 Bildungspolitische Erklärung (Regierungsprogramm 2003) Am Ende der Legislaturperiode sollen an allen hessischen Gymnasien die dann in die Mittelstufe eintretenden
Bildungsstandards. Ein weiterer Qualitätssprung für das österreichische Schulwesen
 Bildungsstandards Ein weiterer Qualitätssprung für das österreichische Schulwesen Wien, 5. März 2004 Ihre Gesprächspartner sind: BM Elisabeth GEHRER Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bildungsstandards Ein weiterer Qualitätssprung für das österreichische Schulwesen Wien, 5. März 2004 Ihre Gesprächspartner sind: BM Elisabeth GEHRER Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Weiterführende Schulen. in der Region Ingelheim
 Weiterführende Schulen in der Region Ingelheim Realschule plus Kaiserpfalz Realschule plus in Ingelheim Realschule mit einem kooperativen System Angebotene Abschlüsse: Berufsreife und Sekundarabschluss
Weiterführende Schulen in der Region Ingelheim Realschule plus Kaiserpfalz Realschule plus in Ingelheim Realschule mit einem kooperativen System Angebotene Abschlüsse: Berufsreife und Sekundarabschluss
Schulpolitischer Konsens für Nordrhein-Westfalen
 Schulpolitischer Konsens für Nordrhein-Westfalen Gemeinsame Leitlinien von CDU, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN für die Gestaltung des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, 19. Juli 2011 CDU, SPD
Schulpolitischer Konsens für Nordrhein-Westfalen Gemeinsame Leitlinien von CDU, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN für die Gestaltung des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, 19. Juli 2011 CDU, SPD
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 7. April 2009 (941 B Tgb.Nr. 969/08)
 223 331 Stundentafel für die Realschule plus Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 7. April 2009 (941 B Tgb.Nr. 969/08) 1 Allgemeines Die Stundentafel
223 331 Stundentafel für die Realschule plus Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 7. April 2009 (941 B Tgb.Nr. 969/08) 1 Allgemeines Die Stundentafel
Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr
 Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr Integration ist ein Grundrecht im Zusammenleben der Menschen, das wir als Gemeinsamkeit aller zum Ausdruck bringen. Es ist ein Recht, auf das jeder
Förderkonzept der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr Integration ist ein Grundrecht im Zusammenleben der Menschen, das wir als Gemeinsamkeit aller zum Ausdruck bringen. Es ist ein Recht, auf das jeder
Schulische Erziehungshilfe im Staatlichen Schulamt Gießen/Vogelsbergkreis
 Schulische Erziehungshilfe im Staatlichen Schulamt Gießen/Vogelsbergkreis Handreichung für die Zusammenarbeit von allgemein bildender sowie beruflicher Schule und Lehrkräften dezentraler Systeme der Erziehungshilfe
Schulische Erziehungshilfe im Staatlichen Schulamt Gießen/Vogelsbergkreis Handreichung für die Zusammenarbeit von allgemein bildender sowie beruflicher Schule und Lehrkräften dezentraler Systeme der Erziehungshilfe
Bildung in Niedersachsen. Besser Gemeinsam!
 Zukunft der Bildung Bildung in Niedersachsen. Besser Gemeinsam! Unsere Grundsätze Bildung ist mehr als das Anhäufen von Wissen: Es ist auch das Lernen lernen In den ersten Lebensjahren wird die Grundlage
Zukunft der Bildung Bildung in Niedersachsen. Besser Gemeinsam! Unsere Grundsätze Bildung ist mehr als das Anhäufen von Wissen: Es ist auch das Lernen lernen In den ersten Lebensjahren wird die Grundlage
10 Thesen zur Zukunft der Hauptschülerinnen und Hauptschüler in BW
 Konkretisierung der Umsetzung der 10 Thesen zur Zukunft der Hauptschülerinnen und Hauptschüler in BW 1. Hauptschule als: Regionale Netzwerkschule Die Hauptschule in Baden-Württemberg ist eine operativ
Konkretisierung der Umsetzung der 10 Thesen zur Zukunft der Hauptschülerinnen und Hauptschüler in BW 1. Hauptschule als: Regionale Netzwerkschule Die Hauptschule in Baden-Württemberg ist eine operativ
Wie weiter ab Klasse 7?
 Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM Herausgeber: Ministerium
Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM Herausgeber: Ministerium
Informationen zu den Übergängen in die gymnasiale Oberstufe im Raum Koblenz Frühjahr 2017
 24. November 2016 Informationen zu den Übergängen in die gymnasiale Oberstufe im Raum Koblenz Frühjahr 2017 Anmeldung und Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 der MSS oder der beruflichen
24. November 2016 Informationen zu den Übergängen in die gymnasiale Oberstufe im Raum Koblenz Frühjahr 2017 Anmeldung und Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 der MSS oder der beruflichen
Zahlen zur Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Stand: ohne Ersatzschulen)
 Schulsozialarbeit - Gesamtschulen als Motor der Entwicklung BERICHTE AUS DER SCHULPRAXIS Schulsozialarbeit - Gesamtschulen als Motor der Entwicklung In den vergangenen Jahren hat sich Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit - Gesamtschulen als Motor der Entwicklung BERICHTE AUS DER SCHULPRAXIS Schulsozialarbeit - Gesamtschulen als Motor der Entwicklung In den vergangenen Jahren hat sich Schulsozialarbeit
Hessisches Kultusministerium. Mein Kind kommt in die 5. Klasse Informationen zum Übergang in die weiterführende Schule
 Mein Kind kommt in die 5. Klasse Informationen zum Übergang in die weiterführende Schule 1 Inhalt Sie erhalten Informationen zu folgenden Fragen: Welche Rechte haben Sie als Eltern bei der Wahl des weiterführenden
Mein Kind kommt in die 5. Klasse Informationen zum Übergang in die weiterführende Schule 1 Inhalt Sie erhalten Informationen zu folgenden Fragen: Welche Rechte haben Sie als Eltern bei der Wahl des weiterführenden
Information. Die Grundschule
 Information Die Grundschule Allgemeines Flexible Eingangsphase Zeugnisse Lernplan Verlässliche Grundschule Betreuungsangebote an Grundschulen Programm gegen Unterrichtsausfall Vergleichsarbeiten Sprachförderung
Information Die Grundschule Allgemeines Flexible Eingangsphase Zeugnisse Lernplan Verlässliche Grundschule Betreuungsangebote an Grundschulen Programm gegen Unterrichtsausfall Vergleichsarbeiten Sprachförderung
Städt. Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück Möglichkeit zur. individuellen Entwicklung!
 Städt. Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück Möglichkeit zur individuellen Entwicklung! Städt. Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück: 70% der Abiturienten an Gesamtschulen hätten nach den Prognosen ihrer Grundschulen
Städt. Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück Möglichkeit zur individuellen Entwicklung! Städt. Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück: 70% der Abiturienten an Gesamtschulen hätten nach den Prognosen ihrer Grundschulen
Berufsschule Berufsfachschule Berufskolleg Wirtschaftsgymnasium. Unsere Schule
 Berufsschule Berufsfachschule Berufskolleg Wirtschaftsgymnasium Unsere Schule Unsere Leitsätze Wir unterstützen Wir fördern Wir kommunizieren Wir begleiten Im Zentrum unseres Unterrichts steht der Schüler
Berufsschule Berufsfachschule Berufskolleg Wirtschaftsgymnasium Unsere Schule Unsere Leitsätze Wir unterstützen Wir fördern Wir kommunizieren Wir begleiten Im Zentrum unseres Unterrichts steht der Schüler
Presseerklärung des Ganztagsschulverbandes Landesgruppe Hamburg
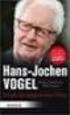 GANZTAGSSCHULVERBAND GGT e.v. LANDESVERBAND HAMBURG Ganztagsschulverband GGT e.v., Poßmoorweg 22 ; 22301 Hamburg GESCHÄFTSSTELLE HAMBURG Goldbek-Schule Poßmoorweg 22 22301 Hamburg Tel.: 040/271636-11 Fax:040/271636-22
GANZTAGSSCHULVERBAND GGT e.v. LANDESVERBAND HAMBURG Ganztagsschulverband GGT e.v., Poßmoorweg 22 ; 22301 Hamburg GESCHÄFTSSTELLE HAMBURG Goldbek-Schule Poßmoorweg 22 22301 Hamburg Tel.: 040/271636-11 Fax:040/271636-22
1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und. sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die
 1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die zustehenden Förderzeiten zu differenzieren? Diese Unterscheidung führt tatsächlich
1. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, zwischen pädagogischer und sonderpädagogischer Förderung zu unterscheiden und dadurch die zustehenden Förderzeiten zu differenzieren? Diese Unterscheidung führt tatsächlich
Kirchliche Kooperationspartner
 Rahmenvereinbarung zur schulisch-kirchlichen Kooperation zwischen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,
Rahmenvereinbarung zur schulisch-kirchlichen Kooperation zwischen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs,
1. Wie viele Stunden für pädagogische Fachkräfte stehen den Klassen des Projekts Keiner ohne Abschluss sowie des Berufsvorbereitungsjahres
 LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode Drucksache 16/1874 04. 12. 2012 K l e i n e A n f r a g e n der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) und A n t w o r t des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 16.Wahlperiode Drucksache 16/1874 04. 12. 2012 K l e i n e A n f r a g e n der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) und A n t w o r t des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen
 Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Rahmenvereinbarung. über die Ausbildung und Prüfung. für ein Lehramt der Sekundarstufe II (allgemein bildende Fächer) oder für das Gymnasium
 Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II (allgemein bildende Fächer) oder für das Gymnasium (Lehramtstyp 4) (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997
Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekundarstufe II (allgemein bildende Fächer) oder für das Gymnasium (Lehramtstyp 4) (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997
DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK 2014. Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt
 DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK 2014 DIE REALSCHULE PLUS UND FACHOBERSCHULE IM PAUL-VON-DENIS-SCHULZENTRUM SCHIFFERSTADT 930 Schüler 40 Klassen 70 Lehrer 2 Gebäude Neue Mensa Fachtrakt S-Bahn-Haltestelle
DIE FACHOBERSCHULE TECHNISCHE INFORMATIK 2014 DIE REALSCHULE PLUS UND FACHOBERSCHULE IM PAUL-VON-DENIS-SCHULZENTRUM SCHIFFERSTADT 930 Schüler 40 Klassen 70 Lehrer 2 Gebäude Neue Mensa Fachtrakt S-Bahn-Haltestelle
Die landesweit durchschnittliche Unterrichtsversorgung der einzelnen öffentlichen allgemein bildenden Schulformen zum Stichtag
 Presse Niedersächsisches Kultusministerium 28.02.2017 Heiligenstadt: Unter den gegebenen Rahmenbedingungen richtig gute Ergebnisse! - Unterrichtsversorgung an öffentlichen Schulen stabilisiert +++ 700
Presse Niedersächsisches Kultusministerium 28.02.2017 Heiligenstadt: Unter den gegebenen Rahmenbedingungen richtig gute Ergebnisse! - Unterrichtsversorgung an öffentlichen Schulen stabilisiert +++ 700
Risiken und Nebenwirkungen der Grundschulempfehlung im Spiegel der Hamburger Praxis
 Risiken und Nebenwirkungen der Grundschulempfehlung im Spiegel der Hamburger Praxis Hamburg, 22. Februar 2017 Ulrich Vieluf Zur Einstimmung Der vortragende Schulrat sprach sich für die Einrichtung einer
Risiken und Nebenwirkungen der Grundschulempfehlung im Spiegel der Hamburger Praxis Hamburg, 22. Februar 2017 Ulrich Vieluf Zur Einstimmung Der vortragende Schulrat sprach sich für die Einrichtung einer
zur Vorbereitung und Durchführung der Vergleichsarbeiten 2016 möchte ich Ihnen weitere aktuelle Hinweise geben.
 An alle Grundschulen, organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschulen, Grund- und Realschulen plus sowie Förderschulen mit dem Bildungsgang Grundschule in Rheinland-Pfalz nachrichtlich: ADD Trier ADD
An alle Grundschulen, organisatorisch verbundene Grund- und Hauptschulen, Grund- und Realschulen plus sowie Förderschulen mit dem Bildungsgang Grundschule in Rheinland-Pfalz nachrichtlich: ADD Trier ADD
Fragen und Antworten:
 Fragen und Antworten: 1. Änderungen in der Schulstruktur der Sekundarstufe I Welche Schulabschlüsse bietet die Realschule plus an? Jede Realschule plus bietet zwei Schulabschlüsse unter einem Dach: die
Fragen und Antworten: 1. Änderungen in der Schulstruktur der Sekundarstufe I Welche Schulabschlüsse bietet die Realschule plus an? Jede Realschule plus bietet zwei Schulabschlüsse unter einem Dach: die
LEITBILD. des Jobcenters EN. Gemeinsam. Für Ausbildung, Arbeit und Teilhabe.
 LEITBILD des Jobcenters EN Gemeinsam. Für Ausbildung, Arbeit und Teilhabe. UNSERE ORGANISATION Der Fachbereich Jobcenter EN ist auf unser Engagement angewiesen. Wir bringen unsere Ideen über die Gremien
LEITBILD des Jobcenters EN Gemeinsam. Für Ausbildung, Arbeit und Teilhabe. UNSERE ORGANISATION Der Fachbereich Jobcenter EN ist auf unser Engagement angewiesen. Wir bringen unsere Ideen über die Gremien
05_08_2005 VVRP-VVRP000000187
 Seite 1 von 5 Recherchieren unter juris Das Rechtsportal Vorschrift Normgeber: Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Aktenzeichen: 946 C-Tgb.Nr. 351/05 Erlassdatum: 05.08.2005 Fassung vom: 05.08.2005
Seite 1 von 5 Recherchieren unter juris Das Rechtsportal Vorschrift Normgeber: Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Aktenzeichen: 946 C-Tgb.Nr. 351/05 Erlassdatum: 05.08.2005 Fassung vom: 05.08.2005
Die Fachoberschule: Der schnellste Weg zur Fachhochschulreife
 Die Fachoberschule: Der schnellste Weg zur Fachhochschulreife Fachoberschule (FOS) Eine Form der beruflichen Bildung Eingangsvoraussetzung: Qualifizierter Sekundarabschluss I (von der Realschule plus,
Die Fachoberschule: Der schnellste Weg zur Fachhochschulreife Fachoberschule (FOS) Eine Form der beruflichen Bildung Eingangsvoraussetzung: Qualifizierter Sekundarabschluss I (von der Realschule plus,
Unterrichtsversorgung und Stundenausfall im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Schuljahr 2009/2010
 Landtag von Baden-Württemberg 14. Wahlperiode Drucksache 14 / 5863 08. 02. 2010 Kleine Anfrage des Abg. Christoph Bayer SPD und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Unterrichtsversorgung
Landtag von Baden-Württemberg 14. Wahlperiode Drucksache 14 / 5863 08. 02. 2010 Kleine Anfrage des Abg. Christoph Bayer SPD und Antwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Unterrichtsversorgung
Herzlich Willkommen. zur Arbeitsgruppe 7 Durchlässigkeit im Bayerischen Schulsystem
 Herzlich Willkommen zur Arbeitsgruppe 7 Durchlässigkeit im Bayerischen Schulsystem Referent: StD Roland Schuck, Dipl.Hdl. Leiter der Staatlichen Schulberatungsstelle für Oberfranken Theaterstraße 8, 95028
Herzlich Willkommen zur Arbeitsgruppe 7 Durchlässigkeit im Bayerischen Schulsystem Referent: StD Roland Schuck, Dipl.Hdl. Leiter der Staatlichen Schulberatungsstelle für Oberfranken Theaterstraße 8, 95028
AKTUELLE BILDUNGSPOLITIK
 AKTUELLE BILDUNGSPOLITIK Gastkommentar des Vorsitzenden des VBE NRW zum Inkrafttreten des Schulgesetzes Udo Beckmann: Gesetz mit Fallstricken Das Schulgesetz, das am 01.08.2006 in NRW in Kraft tritt, ist
AKTUELLE BILDUNGSPOLITIK Gastkommentar des Vorsitzenden des VBE NRW zum Inkrafttreten des Schulgesetzes Udo Beckmann: Gesetz mit Fallstricken Das Schulgesetz, das am 01.08.2006 in NRW in Kraft tritt, ist
Geschäftsverteilungsplan Gesamtschule Oelde
 Geschäftsverteilungsplan Gesamtschule Oelde Geschäftsverteilungsplan Schulleiter Der Schulleiter/ Die Schulleiterin hat folgende Aufgaben: - kann in Erfüllung der Aufgaben als Vorgesetzter oder Vorgesetzte
Geschäftsverteilungsplan Gesamtschule Oelde Geschäftsverteilungsplan Schulleiter Der Schulleiter/ Die Schulleiterin hat folgende Aufgaben: - kann in Erfüllung der Aufgaben als Vorgesetzter oder Vorgesetzte
Fachoberschule (FOS) Gesundheit & Soziales
 Fachoberschule (FOS) Gesundheit & Soziales Schwerpunkt Gesundheit an der Realschule plus in kooperativer Form Traben-Trarbach Zielsetzung der FOS Gesundheit (Landesverordnung Fachoberschule 2) Entwicklung
Fachoberschule (FOS) Gesundheit & Soziales Schwerpunkt Gesundheit an der Realschule plus in kooperativer Form Traben-Trarbach Zielsetzung der FOS Gesundheit (Landesverordnung Fachoberschule 2) Entwicklung
o die Einstellung von zusätzlich 500 Lehrern und 240 Referendaren in 2009,
 Thomas Dückers Pressesprecher Telefon (05 11) 30 30-41 18 Telefax (05 11) 30 30-48 54 Mobil (0172) 5 99 56 32 thomas.dueckers@lt.niedersachsen.de www.cdu-fraktion-niedersachsen.de Silke Schaar Pressesprecherin
Thomas Dückers Pressesprecher Telefon (05 11) 30 30-41 18 Telefax (05 11) 30 30-48 54 Mobil (0172) 5 99 56 32 thomas.dueckers@lt.niedersachsen.de www.cdu-fraktion-niedersachsen.de Silke Schaar Pressesprecherin
Leistungsstarke Schulen für unsere Kinder in Baden-Württemberg!
 1 2 3 4 5 6 7 Leistungsstarke Schulen für unsere Kinder in Baden-Württemberg! Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler im Land entsprechend ihrer persönlichen Stärken gefördert und unterstützt werden.
1 2 3 4 5 6 7 Leistungsstarke Schulen für unsere Kinder in Baden-Württemberg! Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler im Land entsprechend ihrer persönlichen Stärken gefördert und unterstützt werden.
Sekundarstufe I. Jahrgänge Jahrgangstufe 10 in Doppelfunktion. 10 mit Hinführung zur Oberstufe/ Einführungsphase 10 ohne Einführungsphase
 Marc Herter MdL stellv. Landesvorsitzender der NRWSPD Jochen Ott MdL stellv. Landesvorsitzender der NRWSPD G8flexi eine kurze Übersicht Sekundarstufe I Jahrgänge 5-10 Jahrgangstufe 10 in Doppelfunktion
Marc Herter MdL stellv. Landesvorsitzender der NRWSPD Jochen Ott MdL stellv. Landesvorsitzender der NRWSPD G8flexi eine kurze Übersicht Sekundarstufe I Jahrgänge 5-10 Jahrgangstufe 10 in Doppelfunktion
Entwurf. zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. V o r b l a t t
 Entwurf Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen V o r b l a t t A) Problem Eine Reihe bildungspolitischer Fragen bzw. Probleme bedürfen der schulrechtlichen
Entwurf Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen V o r b l a t t A) Problem Eine Reihe bildungspolitischer Fragen bzw. Probleme bedürfen der schulrechtlichen
Es gilt das gesprochene Wort.
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) vom Entwurfsfassung vom
 Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) vom Entwurfsfassung vom 06.12.2006 Aufgrund der 16 Abs. 1 Satz 2, 18 Abs. 3 Satz 3, 19 Abs. 3 Satz 4, 128 Abs. 2 und 3 des Schulgesetzes (SchulG) in der
Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) vom Entwurfsfassung vom 06.12.2006 Aufgrund der 16 Abs. 1 Satz 2, 18 Abs. 3 Satz 3, 19 Abs. 3 Satz 4, 128 Abs. 2 und 3 des Schulgesetzes (SchulG) in der
DIE NEUE SCHULE.
 DIE NEUE SCHULE www.gruene-fraktion-hessen.de Hessen braucht neue Antworten auf die wichtigen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Die Grünen wollen Alternativen zur schwarz-gelben Politik aufzeigen
DIE NEUE SCHULE www.gruene-fraktion-hessen.de Hessen braucht neue Antworten auf die wichtigen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Die Grünen wollen Alternativen zur schwarz-gelben Politik aufzeigen
Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Vielfältig und durchlässig Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Vielfältig und durchlässig Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem
ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN
 Gymnasien Hauptschulen Förderschulen Integrierte Gesamtschulen ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN Realschulen Einschulungen Schulwahl Realschule plus Freie Waldorfschulen Folie 1 Starker Primarbereich trotz schwacher
Gymnasien Hauptschulen Förderschulen Integrierte Gesamtschulen ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN Realschulen Einschulungen Schulwahl Realschule plus Freie Waldorfschulen Folie 1 Starker Primarbereich trotz schwacher
www.tmbjs.de Schulen in Thüringen Informationen in Leichter Sprache
 www.tmbjs.de Schulen in Thüringen Informationen in Leichter Sprache Diese Broschüre ist in Leichter Sprache geschrieben. Leichte Sprache verstehen viele Menschen besser. Zum Beispiel: Menschen mit Lern-Schwierigkeiten
www.tmbjs.de Schulen in Thüringen Informationen in Leichter Sprache Diese Broschüre ist in Leichter Sprache geschrieben. Leichte Sprache verstehen viele Menschen besser. Zum Beispiel: Menschen mit Lern-Schwierigkeiten
Aufnahmevoraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber an beruflichen Gymnasien verbessern
 14. Wahlperiode 16. 04. 2008 Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Aufnahmevoraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber an beruflichen Gymnasien verbessern
14. Wahlperiode 16. 04. 2008 Antrag der Fraktion GRÜNE und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Aufnahmevoraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber an beruflichen Gymnasien verbessern
WELCHE WEITERFÜHRENDE SCHULE IST FÜR MEIN KIND GEEIGNET? Infoveranstaltung am
 WELCHE WEITERFÜHRENDE SCHULE IST FÜR MEIN KIND GEEIGNET? Infoveranstaltung am 26.11.2014 Tagesordnungspunkte 1. Voraussetzungen für den Schullaufbahnwechsel, Empfehlungskriterien der Grundschule, Entscheidungshilfen
WELCHE WEITERFÜHRENDE SCHULE IST FÜR MEIN KIND GEEIGNET? Infoveranstaltung am 26.11.2014 Tagesordnungspunkte 1. Voraussetzungen für den Schullaufbahnwechsel, Empfehlungskriterien der Grundschule, Entscheidungshilfen
Gesundheit und Soziales
 Fachoberschule Gesundheit und Soziales Schwerpunkt Sozialpädagogik REGIONALES KOMPETENZZENTRUM FÜR DIENSTLEISTUNGSBERUFE EUROPASCHULE Erfahrung durch die Praxis Allgemein- und Berufsbildung Die Fachoberschule
Fachoberschule Gesundheit und Soziales Schwerpunkt Sozialpädagogik REGIONALES KOMPETENZZENTRUM FÜR DIENSTLEISTUNGSBERUFE EUROPASCHULE Erfahrung durch die Praxis Allgemein- und Berufsbildung Die Fachoberschule
Neustrukturierung der gymnasialen Schulzeit Strukturvarianten der im Landtag vertretenen Parteien im Überblick
 Neustrukturierung der gymnasialen Schulzeit Strukturvarianten der im Landtag vertretenen Parteien im Überblick Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
Neustrukturierung der gymnasialen Schulzeit Strukturvarianten der im Landtag vertretenen Parteien im Überblick Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
Sekundarschule. Rahmenkonzept. Soest Bad Sassendorf. entwickelt von der pädagogischen Arbeitsgruppe
 Sekundarschule Soest Bad Sassendorf Rahmenkonzept entwickelt von der pädagogischen Arbeitsgruppe Gliederung des Konzepts 1. Was ist eine Sekundarschule? 2. Organisationsform 3. Wie wird an einer Sekundarschule
Sekundarschule Soest Bad Sassendorf Rahmenkonzept entwickelt von der pädagogischen Arbeitsgruppe Gliederung des Konzepts 1. Was ist eine Sekundarschule? 2. Organisationsform 3. Wie wird an einer Sekundarschule
Berufsfachschule I (BF I)
 C H A N C E N N U T Z E N Z U K U N F T G E S T A L T E N Berufsfachschule I (BF I) Fachrichtungen : Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen Gesundheit und Pflege Gewerbe und Technik Wirtschaft und Verwaltung
C H A N C E N N U T Z E N Z U K U N F T G E S T A L T E N Berufsfachschule I (BF I) Fachrichtungen : Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen Gesundheit und Pflege Gewerbe und Technik Wirtschaft und Verwaltung
Abschlüsse und Leistungsbewertung. Gesamtschule
 Abschlüsse und Leistungsbewertung an der Gesamtschule Übergang Grundschule - dreigliedriges Schulsystem Nach der Grundschule, in der alle nach dem gleichen Maßstab benotet wurden, geht ein Teil der Kinder
Abschlüsse und Leistungsbewertung an der Gesamtschule Übergang Grundschule - dreigliedriges Schulsystem Nach der Grundschule, in der alle nach dem gleichen Maßstab benotet wurden, geht ein Teil der Kinder
Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis Schul(form)wahl nach Klasse 4 (HTK)
 Schul(form)wahl nach Klasse 4 (HTK) Staatliches Schulamt in Friedberg Ablauf / Inhalte Stationen / Termine Überblick über das hessische Schulsystem Entscheidungshilfen für Eltern Schulformen in der Region
Schul(form)wahl nach Klasse 4 (HTK) Staatliches Schulamt in Friedberg Ablauf / Inhalte Stationen / Termine Überblick über das hessische Schulsystem Entscheidungshilfen für Eltern Schulformen in der Region
Berufliche Schulen - Wege zu Hochschulzugangsberechtigungen
 Durchlässigkeit ein Problem der Voraussetzungen oder der Bekanntheit? Berufliche Schulen - Wege zu Hochschulzugangsberechtigungen Schuck, SB-OFR, 2010 1 Aus Frankenpost, Ressort Wirtschaft, 15.06.2010
Durchlässigkeit ein Problem der Voraussetzungen oder der Bekanntheit? Berufliche Schulen - Wege zu Hochschulzugangsberechtigungen Schuck, SB-OFR, 2010 1 Aus Frankenpost, Ressort Wirtschaft, 15.06.2010
