Stefan Wellgraf Hauptschüler Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung
|
|
|
- Kristina Dittmar
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus: Stefan Wellgraf Hauptschüler Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung April 2012, 334 Seiten, kart., 24,80, ISBN Stigmatisierende Medienberichte, Demütigungen durch Pädagogen und abfällige Bemerkungen von Freunden oder Verwandten all das sind Beispiele für Praktiken sozialer Abwertung, mit denen Hauptschüler tagtäglich konfrontiert werden. Wie kommen sie zustande? Wie werden sie erlebt und verarbeitet? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Ethnografie von Stefan Wellgraf, die Hauptschüler in ihrem letzten Schuljahr und beim Versuch, sich eine berufliche Zukunft zu erarbeiten, begleitet. Mit Blick auf die Erfahrungen und Perspektiven der Schüler/-innen in Schule und Freizeit entsteht ein materialreicher Beitrag zur Debatte um gesellschaftliche Ungleichheit und zugleich eine pointierte und beunruhigende Gesellschaftskritik. Stefan Wellgraf (Dr. phil.) hat an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder promoviert und war Kollegiat im Graduiertenkolleg»Berlin New York. Geschichte und Kultur der Metropolen im 20. Jahrhundert«. Weitere Informationen und Bestellung unter: transcript Verlag, Bielefeld
2 Inhalt Einleitung 9 Feldforschung: Zugänge zu Berliner Hauptschülern 10 Praxistheoretische Perspektiven 14 I. SELBSTWAHRNEHMUNGEN UND KULTURELLE PRAKTIKEN Soziale Beziehungen: Das Problem der Anerkennung 21 Formen verweigerter Anerkennung 22 Freundschaft: Die Neukölln Ghetto Boys 30 Die»große Liebe«38 Körper- und Konsumpraktiken: Boxer, Handys und Goldketten 45 Konsumopfer oder Konsumrebellen? Shoppen im Linden-Center 46 Umgang mit Artefakten: Markenprodukte, Goldketten und Handys 52 Aggressive Männlichkeit: Der Boxer-Stil 61 Starkult und Körperkapital: Germany s Next Topmodel 68 Hauptschule: Formationen von Klasse, Ethnizität und Geschlecht 77 Geschlecht: Aggressive Männlichkeit als Oppositionshaltung und Machtregime 79 Ethnizität: Bedeutung von ethnischer Zugehörigkeit im Alltag und Umgang mit Rassismus 89 Soziale Klasse: Die Unsichtbarkeit sozialer Diskriminierung 95 Formationen von Klasse, Ethnizität und Geschlecht 101 Nach der Schule: Wege und Zukunftsvorstellungen 105 Zukunftsträume: Familie Beruf gesicherte Existenz 107 Zukunftswege: Misserfolge und Demütigungen 112 Zukunftsängste: Drei Formen des Unheimlichen 128
3 Bürgerlichkeit? Lebensformen von Berliner Gymnasiasten im Vergleich 135»Proll«und»Öko«über Geschmack und Distinktion 137 Aktualität bürgerlicher Lebensformen: Politisches Engagement und Klassische Musik 144 Bildungsreisen: Ein Jahr im Ausland 152 Transgressionen: Kontakte zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern 158 II. REPRÄSENTATIONEN MACHT KRITIK Encoding: Entstehungszusammenhänge medialer Repräsentationen 165 Die Rütli-Schule in der Süddeutschen Zeitung 167 Frontal21 über»verweigerte Integration«an Berliner Schulen 178 Radioeins über die»vorfälle im Wrangelkiez«187 Decoding: Umgangsweisen mit medialer Stigmatisierung 201»Stimmt schon irgendwie«hegemonial-ausgehandelte Lesarten 203»Das ist mein Leben«wütende und kritische Lesarten 210»Voll Rütli«ironische Lesarten 218 Recoding? Die Mediatisierung der Alltagswelt und ihre Folgen 223 Mediatisierung der Alltagswelt: Medienpraktiken Berliner Hauptschüler 225 Online-Communitys: Suche nach Anerkennung und Spiele mit Zuschreibungen 231 Recoding? Potentiale medialer Neuarrangements 238 Affective States: Die politische Dimension von Emotionen und Affekten 243 Neoliberale Herrschaftstechniken: Die konfrontative Pädagogik 246 Grenzziehungen: Demütigen und Strafen 255 Wut und Neid Die politische Dimension von Emotionen und Affekten 263
4 »Wir sind dumm«ideologie und Mythos im staatlichen Bildungssystem 271 Ideologie: Das staatliche Bildungssystem 272 Bildungsmythen als Ideologie 281 Der Staat als Mythos und das Brüchigwerden von Ideologien 289 Das Ende der Hauptschule in Berlin 298 Schluss: Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung 303 Literatur 309
5 Einleitung»Hauptschule«diese seit einer Schulreform am Ende der 1960er Jahre verwendete Bezeichnung hat längst ihre vermeintliche Unschuld verloren. Die Begriffe»Hauptschule«und»Hauptschüler«sind seit einigen Jahren mit einer Fülle von negativen Assoziationen aufgeladen. Fragt man Hauptschüler, was ihrer Meinung nach andere über sie denken, wählen sie abwertende Bezeichnungen wie»dumm«,»faul«oder»psycho im Kopf«. Manche Hauptschullehrer beschreiben ihre eigene Schule als»irrenhaus«,»idiotenschule«oder»behindertenschule«. Und in vielen Medienberichten erscheinen Hauptschüler als bildungsresistent, gewalttätig und moralisch verwahrlost. Hauptschüler werden gesellschaftlich missachtet, gedemütigt und ausgegrenzt. Dieses Buch handelt davon, wie diese Verachtung zustande kommt und wie Hauptschüler mit ihr umgehen. Durch den Fokus auf die Situation von Hauptschülern in Berlin möchte ich auf anschauliche Weise nachvollziehen, wie Machtverhältnisse mittels Formen von Verachtung im Alltag reproduziert werden. Unter der Produktion von Verachtung verstehe ich gesellschaftliche Exklusionsprozesse, bei denen Formen materieller Benachteiligung mit Mechanismen symbolischer Abwertung verbunden werden. Beides lässt sich nicht voneinander trennen, denn Verachtung dient der Legitimation von ökonomischen Ungleichheitsverhältnissen. So werden Hauptschülern nicht einfach nur Berufschancen und Ausbildungsplätze vorenthalten, sondern ihnen wird darüber hinaus in Bewerbungssituationen häufig suggeriert, sie seien nichts wert und selbst schuld an ihrer Lage. Wer die brutalen Wirkungen gesellschaftlicher Verachtung verstehen will, sollte deshalb strukturelle Ausschlussmechanismen und Stigmatisierungsprozesse in ihrer Wechselwirkung betrachten. Aus einer solchen Perspektive erscheint Verachtung als etwas»gemachtes«, als
6 10 HAUPTSCHÜLER ein historisch bedingter und kulturell spezifischer Prozess gesellschaftlicher Ausschließung. Diese Studie basiert auf einer anderthalbjährigen Feldforschung mit Berliner Hauptschülern in den Jahren 2008 und Ich beschreibe die Situation von Großstadtjugendlichen aus dem Ost- und dem Westteil Berlins etwa zwanzig Jahre nach dem Mauerfall in Zeiten dauerhaft hoher Arbeitslosigkeit, die zudem durch die Wirkungen einer von den USA ausgehenden Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet waren. In diesen Zeitraum fielen auch die Vorbereitungen zur Abschaffung der Hauptschule in Berlin, die schließlich im Sommer 2010 vollzogen wurde. Meine Forschung ist somit in mehrfacher Hinsicht mittlerweile historisch. Trotz der klaren zeitlichen und räumlichen Verortung zielen meine Ausführungen auf über den Einzelfall hinausweisende Einsichten in die Funktionsweisen gegenwärtiger Gesellschaft und bieten vielfältige Anregungen zu Forschungen über gesellschaftliche Randgruppen und Prozesse sozialer Ausgrenzung. FELDFORSCHUNG: ZUGÄNGE ZU BERLINER HAUPTSCHÜLERN Als ich das erste Mal eine Hauptschule betrat, bemerkte ich, wie lange ich nicht mehr in einer Schule gewesen war. Das Gekreische der Schüler, der sich aus Bohnerwachs und Schweiß bildende Geruch und dann noch diese auf beeindruckende Weise eklektischen Wandgestaltungen in der Eingangshalle: bunte Fahnen verschiedener Länder, ein Andy Warhol nachempfundenes Portrait von Marilyn Monroe, die Fotos der Lehrerschaft, hierarchisch angeordnet mit teilweise schon vergilbten Passfotos, darunter bunte Fliesen und darüber große Palmenwedel aus Plastik. Gleich neben der von den»stämmigen Typen«des Wachschutzes Germania bewachten Eingangstür hing zudem eine Liste mit aktuellen Suspendierungen und Hausverboten. Bunt und ein bisschen brutal so in etwa war mein erster Eindruck an einer Berliner Hauptschule. Doch ich hätte auch anders beginnen können, schließlich forschte ich nicht nur an einer, sondern an drei Hauptschulen in den Berliner Bezirken Neukölln, Lichtenberg und Wedding. So ließen sich noch zwei weitere Versionen erzählen, eine mit einer eher positiven und eine mit einer eher negativen Botschaft. Beginnen wir also mit einer zweiten, recht»freundli-
7 EINLEITUNG 11 chen«version: Als ich vor der Schule eintraf, war ich ein bisschen aufgeregt, kam jedoch schnell mit ein paar Schülern ins Gespräch. Wenig später saß ich schon beim Direktor im Büro, der erst einmal eine kleine Rede hielt. Er begann mit Karl dem Großen, sah bald schon die Bildungserrungenschaften der»deutschen Aufklärung«in Gefahr und endete schließlich mit der Forderung, die heutigen Bildungsverweigerer endlich ins Gefängnis zu stecken. Ich hörte brav zu und fühlte mich ein bisschen wie ein Schüler, der zum Direktor vorgeladen wird, letztlich erhielt ich jedoch meine Forschungsgenehmigung. Später stellte ich mich in einer Klasse vor und führte nach der Schule auch gleich ein kleines Gespräch zum Kennenlernen mit zwei Schülerinnen. Da die Sonne schien, spazierten wir zu einem nahe gelegenen Park, wo wir auf einer Wiese sitzend uns etwa anderthalb Stunden unterhielten. Als ich zur Schule zurückkehrte, bemerkte ich plötzlich, dass ich vor lauter Forschungsbegeisterung vergessen hatte, mein Fahrrad anzuschließen. Es hatte einen halben Tag lang mitten auf dem belebten Gehweg vor dem Schulgelände gestanden, doch niemand hatte es gestohlen. Und zum Abschluss nun noch eine dritte, etwas»düstere«version: Als ich mich der Schule näherte, überlegte ich, ob ich mein Fahrrad lieber innerhalb oder außerhalb des Schulgeländes anschließen sollte. Ich warf einen skeptischen Blick auf die vor dem Eingang des Schulgeländes»herumlungernde«Gruppe junger Männer anscheinend migrantischer Herkunft und entschied daraufhin, dass es wohl sicherer wäre, das Fahrrad auf dem Schulgelände anzuschließen. Währenddessen beschlich mich ein ungutes Gefühl aufgrund der mir bewusst werdenden eigenen Vorurteile. War ich nicht hier hingekommen, um dem medialen Negativbild von Hauptschülern und jungen Migranten eine komplexere Beschreibung entgegenzusetzen? Ich versuchte etwas aufgeschlossener an den jungen Männern am Eingang vorbeizugehen, hörte aber dennoch, wie diese sich ganz angeregt über Pistolenmodelle unterhielten und wo man sich diese besorgen könne. Etwas ratlos ging ich weiter. Vor dem von einer Videokamera überwachten Hauseingang angekommen, sprach mich ein Schüler an, ob ich neu hier sei und was ich hier eigentlich mache. Als ich ihm kurz von der Idee für meine Forschung erzählte und ihn einlud mitzumachen, antwortete er:»mein Leben wollen Sie gar nicht wissen.«welcher Start auch immer meine ethnografischen Forschungen mit Berliner Hauptschülern sind von einer bestimmten Perspektive beeinflusst
8 12 HAUPTSCHÜLER und stehen für einen subjektiven Blick auf die Wirklichkeit. Es handelt sich, um ein englisches Wortspiel von James Clifford zu verwenden, um partial truths um»teil-wahrheiten«, die gleichzeitig immer auch»parteiisch«sind. 1 Doch wodurch zeichnet sich nun meine spezifische Blickweise aus? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Vielleicht am ehesten dadurch, dass ich die negativen Blickweisen auf Hauptschüler nicht nur berücksichtige oder reflektiere, sondern ihre Entstehungsweisen und Auswirkungen zum Fokus dieser Arbeit mache, die deshalb auch den Untertitel»Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung«trägt. Das Erzählen der drei verschiedenen Episoden, die sich alle in etwa dieser Form zugetragen haben, berührt somit bereits den Kern meines Anliegens. Ich will nicht nur die eine Geschichte erzählen, die das dominante Narrativ von Krise und Gewalt an Berliner»Brennpunkt«-Schulen weiterspinnt. Oder nur die andere Version darlegen, die in dem sozialromantischen Gegen-Diskurs vom»im Herzen guten«hauptschüler verhaftet bleibt. 2 Stattdessen will ich berichten, wie komplex und vielschichtig die Sichtweisen und Praktiken von marginalisierten Jugendlichen bei näherem Hinsehen häufig erscheinen. In den folgenden Kapiteln wird deshalb viel von Heterogenität und Komplexität, von Ambivalenzen und Widersprüchen die Rede sein von Dingen, die meiner Ansicht nach immer auch ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter miteinander zusammenhängen, als vielleicht zunächst gedacht. Das Erzählen der drei Episoden offenbart noch eine Reihe weiterer zentraler Prämissen meiner Herangehensweise: Eine besondere Aufmerksamkeit für die Entstehung und die Wirkkraft medialer Bilder im Alltag sowie für den Umgang der Schüler mit negativen Stereotypen. Die Berücksichtigung der Institution Schule, in der fortlaufend ideologisch gefärbte Bildungsmythen produziert werden. Die Einsicht, dass die physische Präsenz und die kommunikative Anwesenheit des Forschers die vorgefundene Realität notwendigerweise beeinflusst. Und die grundlegende Absicht, anhand anschaulicher Beschreibungen von ausgewählten Alltagsepisoden komplexere Zusammenhänge verständlich zu machen. Auf diese Weise habe ich schließlich ein Buch geschrieben, das an aktuelle Debatten der Sozial- und 1 Clifford: Introduction. Partial Truths. 2 Für einen Überblick der historischen und zeitgenössischen Leitmotive ethnografischer Forschungen über»unterschichten«siehe Warneken: Die Ethnographie popularer Kulturen.
9 EINLEITUNG 13 Kulturwissenschaften anschließt, das aber auch darauf abzielt, durch seine zugängliche Sprache und sein gesellschaftlich relevantes Thema über die Wissenschaft hinaus Diskussionen anzuregen. Die vorliegende Studie basiert, wie bereits erwähnt, auf den Ergebnissen einer ethnografischen Feldforschung: Von Februar 2008 bis zum August 2009 begleitete ich achtzehn Hauptschüler in den Berliner Bezirken Wedding, Neukölln und Lichtenberg während ihres letzten Schuljahres sowie in den ersten Monaten nach Verlassen der Schule. Die Forschung fand sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule statt: Ich besuchte während des gesamten Schuljahres 2008/09 an ein bis zwei Tagen in der Woche den Unterricht der zehnten Klassen der Anna-Seghers-Schule in Berlin-Wedding die Namen aller Schulen, Schüler und Pädagogen sind anonymisiert und nahm darüber hinaus an Schulausflügen und Feierlichkeiten teil. Parallel dazu traf ich die Schüler während ihrer Freizeit zu Interviews, zu Spaziergängen oder einfach zum»rumhängen«. Vor allem zu den Schülern in Neukölln und Lichtenberg, die ich zuvor bereits gegen Ende ihrer Schullaufbahn im Frühjahr 2008 kennengelernt hatte, hielt ich auf diese Weise auch nach Verlassen der Schule Kontakt. Ergänzt wird diese Forschung mit Berliner Hauptschülern durch Interviews mit Schuldirektoren, Lehrern und Sozialarbeitern verschiedener Berliner Hauptschulen. Zudem begleitete ich parallel noch eine Vergleichsgruppe von insgesamt zwölf etwa gleichaltrigen Gymnasiasten aus Berlin-Lichtenberg, die ich jedoch aus Zeitgründen unregelmäßiger und insgesamt auch etwas seltener traf. An den Hauptschulen nahmen mich die meisten Schüler in einer Zwischenrolle von Lehrer und Schüler war. So wurde ich beispielsweise auf dem Schulhof der Anna-Seghers-Schule von Schülern unterer Jahrgänge mehrfach gefragt, ob ich denn schon Lehrer oder noch Schüler sei. Selbst der dortige Direktor hatte meine Forscherrolle schnell vergessen und nannte mich nach einer Weile nur noch den»praktikanten«. An einer Neuköllner Schule verbreitete sich zudem zwischenzeitlich das Gerücht, ich sei der Sohn einer Lehrerin. Die Schüler der zehnten Klassen der drei Berliner Hauptschulen, in denen ich mich jeweils mit meinem Forschungsanliegen im Rahmen des Unterrichts vorgestellt hatte, fragten mich häufig ungeduldig, wann mein Buch»endlich«fertig sein würde und erkundigten sich auch in der Zeit nach Beendigung der Feldforschung per nach meinen Schreibfortschritten. Einige von ihnen haben später Passagen dieses Buches oder das gesamte Manuskript gelesen und durch ihre Kommentare
10 14 HAUPTSCHÜLER bereichert. Die Schüler beteiligten sich insgesamt mit unterschiedlicher Motivation an der Forschung. Einige hatten nach ein oder zwei Treffen keine Lust mehr, andere trafen sich auch dann nach der Schule mit mir, wenn sie den vorhergehenden Unterricht»geschwänzt«hatten. Zudem war nicht nur ich am Leben der Schüler interessiert, sondern auch diese an meinem. So wurde ich zu meinen Fußballinteressen befragt, sollte Ratschläge zum Thema Sex und Liebe geben oder vom Universitätsleben berichten. Die Höhe meines Promotionsstipendiums von knapp über 700 Euro monatlich wurde daraufhin sehr missbilligend bewertet:»also ehrlich Stefan, ich glaube du hast umsonst studiert.«während meine Aufmerksamkeit anfangs ganz den Schülern galt, interessierte ich mich im Verlauf der Forschung auch zunehmend für die Institution Schule und ihre Angestellten. Die Beziehungen zu den Lehrern, vor allem jenen der Anna-Seghers-Schule, verliefen dabei sehr unterschiedlich. Während sich zu einigen ein gutes Verhältnis etablierte und ich vor allem nach für die Pädagogen besonders aufreibenden Stunden häufig noch ein bisschen mit ihnen plauderte, reagierten andere gereizt auf mich, da sie mich möglicherweise als eine Kontrollinstanz empfanden. Diese war besonders unwillkommen, wenn Lehrer die letzten Unterrichtsstunden des Schultages mangels Lehrmotivation ausfallen ließen oder wenn sie ihre Schüler offensichtlich schlecht behandelten, was beides recht häufig vorkam. Aus solchen Gründen kam es auch zum einzigen Zwischenfall während meiner Forschung, als mir eine bei ihren Schülern sehr unbeliebte Lehrerin ich nenne sie Frau Mischke verbot, fortan an den von ihr angebotenen Unterrichtsstunden teilzunehmen. Die Schüler»gratulierten«mir daraufhin noch Tage später zu meinem»rausschmiss«mit Kommentaren wie»jetzt hasst du sie auch«oder»bei uns bist du immer willkommen«. Zudem wurde mir angeboten bei einem geplanten Überfall auf das Haus der Lehrerin teilzunehmen, was ich jedoch ablehnte. PRAXISTHEORETISCHE PERSPEKTIVEN Meine Forschungsergebnisse diskutiere ich unter Bezugnahme auf diverse theoretische Traditionen wie die britischen Cultural Studies, den französischen Poststrukturalismus, die Postkoloniale Theorie und die Frankfurter Schule sowie in Auseinandersetzung mit empirischen Befunden und wissen-
11 EINLEITUNG 15 schaftlichen Diskussionen vor allem aus dem Bereich der Ungleichheits-, Bildungs- und Migrationsforschung. Dabei geht es mir nicht nur darum, meine empirischen Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, sondern die von mir gewählte Forschungsperspektive, meine Materialauswahl und die Anordnung des Textes sind selbst schon theoriegeladen. Theoretische Überlegungen werden gleichsam stets in enger Auseinandersetzung mit dem empirischen Material entwickelt. 3 Um dieser wechselseitigen Verschränkung und Konstituierung von Theorie und Empirie auch formal Rechnung zu tragen, ist dieses Buch nicht in einen Theorie- und einen Empirie-Teil untergliedert. Stattdessen sollen in den einzelnen thematischen Kapiteln jeweils immer auch aktuelle Debatten der Sozial- und Kulturwissenschaften, wie beispielsweise über Intersektionalität, Bürgerlichkeit und Emotionen, besprochen und um eine neue Facette bereichert werden. Gekennzeichnet ist meine Herangehensweise durch eine praxistheoretische Grundorientierung. Unter Praxistheorie versteht man ein Bündel von theoretischen Ansätzen, die sich im Verlauf der 1980er Jahre etabliert haben. 4 Zuvor hatte in den 1960er Jahren der Streit zwischen»harten Objektivisten«und»weichen Subjektivisten«die theoretischen Diskussionen belastet und in den 1970er Jahren ein strukturfixierter Marxismus die Theorielandschaft überschattet. Praxistheoretiker wie Pierre Bourdieu oder Anthony Giddens zielten auf eine Überwindung des Dualismus von Mikro- und Makroperspektiven, indem sie gerade die Dialektik von Structure & Agency, also von einer vorherrschenden Gesellschaftsstruktur und von interessegeleiteten Praktiken der Akteure, ins Zentrum der Analyse rückten. Im Kontrast zum orthodoxen Marxismus der vorhergehenden Jahre, in dessen Rahmen viel von den revolutionären Massen gesprochen wurde, ohne sich jedoch für die Lebensformen der unterbürgerlichen Schichten zu interessieren, gingen praxistheoretische Ansätze mit einer Neubetonung des Status von Akteuren einher. Gleichzeitig übernahmen viele Praxistheoretiker vom Marxismus eine Kapitalismus- und somit eine systemkritische Haltung und interessierten sich vor allem für Fragen von Macht und Ungleichheit. So 3 Vgl. Hirschauer: Die Empiriegeladenheit von Theorien und der Erfindungsreichtum der Praxis. 4 Zur Herausbildung praxistheoretischer Perspektiven siehe Ortner: Theory in Anthropology since the Sixties. Zu aktuellen Entwicklungen im Feld der Praxistheorien siehe Ortner: Updating Practice Theory.
12 16 HAUPTSCHÜLER handelt auch dieses Buch über Berliner Hauptschüler von Akteuren in einer prekären sozialen Lage und interessiert sich vor allem für jene Selbstwahrnehmungen und Praktiken, die wiederum Rückschlüsse auf die Mechanismen machtbedingter Ausschließung ermöglichen. Aus einer solchen praxistheoretischen Perspektive ergeben sich eine Reihe von forschungsleitenden Implikationen in Bezug auf das Verständnis sowohl von Strukturen als auch von Akteuren sowie den komplexen Wechselbeziehungen zwischen beiden. Grundlegend ist zunächst die Ausrichtung an einem prozessualen statt eines statischen Verständnisses des Sozialen, was häufig eine historische Forschungsorientierung oder wie in meinem Fall zumindest ein Bewusstsein für die Einbettung des Forschungsgegenstandes in spezifische historische Konstellationen mit sich bringt. Mein Umgang mit marxistischer Kritik am Bildungssystem kann vielleicht am besten veranschaulichen, was damit gemeint ist. Am Ende dieses Buches werde ich die von Louis Althusser um 1970 formulierte Kritik am Bildungssystem als einer machtgeleiteten Reproduktionsinstanz des bürgerlichen Staates aufgreifen und auf das deutsche Schulsystem übertragen. Die Blickweise auf Schulen als»ideologische Staatsapparate«ermöglicht wichtige Einsichten zur Wirkungsweise von Bildungsideologien im Prozess der Reproduktion von Machtverhältnissen durch staatliche Bildungsinstitutionen. Statt jedoch wie Althusser von einem allmächtigen, hyperstabilen und quasi nur durch eine Revolution komplett abzulösenden ideologischen System auszugehen, zeige ich, wie parallel zum sich abzeichnenden Ende der Hauptschule in Berlin auch die das Schulsystem legitimierenden Ideologien brüchig werden. Machtbedingte Strukturen erscheinen auf diese Weise nicht mehr als unveränderlich und allmächtig, sondern im Gegenteil als etwas ständig Bedrohtes, das der stetigen ideologischen Aufbauarbeit bedarf. Die sich daraus ergebende Spannung zwischen systemreproduzierenden und systemverändernden Tendenzen spiegelt sich auf der Akteursebene in der Ambivalenz zwischen der Routinisiertheit und der Unberechenbarkeit, der Wiederholungstendenz und dem Veränderungspotential von Praktiken wider. 5 Der hier gewählte Fokus auf kulturelle Praktiken vor allem auf Körper-, Konsum- und Medienpraktiken geht einher mit einer Skepsis gegenüber einem eher mentalistischen oder intellektualistischen Blick auf das Soziale, in dessen Folge meist von Normen und Werten bestimmter so- 5 Siehe dazu Reckwitz: Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken.
13 EINLEITUNG 17 zialer Gruppen gesprochen wird, doch wenig davon, was Menschen eigentlich machen und womit sie Dinge tun. Ein solcher Perspektivenwechsel ist verbunden mit einer Neubetonung der politischen Dimension des Informellen und des Alltäglichen, also dessen, was in der intellektualistischen Sichtweise häufig als nebensächlich, minderwertig oder unwichtig und somit als politisch wenig relevant betrachtet wird. So interpretiere ich beispielsweise Formen aggressiver Männlichkeit, wie sie im Boxerstil eine prototypische Ausdrucksform finden, als eine Reaktion auf gesellschaftliche Verachtung oder arbeite die politischen Implikationen von Emotionen wie Scham, Wut und Neid heraus. Praxisorientierte Perspektiven umfassen auch die Selbstwahrnehmungen von Akteuren sowie Prozesse der Identitätsbildung, nur werden diese nicht in Bezug auf eine abstrakte mentale Struktur begriffen, sondern mit Blick auf die sie begleitenden und bedingenden Praktiken sowie unter Berücksichtigung von spezifischen sozialen Konstellationen analysiert. Es handelt sich demnach um ein situiertes Wissen von Akteuren in sozialen Lagen, um einen praktischen Sinn, der gleichsam bestimmte Selbstverhältnisse ermöglicht oder erschwert. Im nun folgenden Kapitel beschreibe ich zunächst Prozesse verweigerter intersubjektiver Anerkennung und werde in den anschließenden Kapiteln die Selbstwahrnehmungen und kulturellen Praktiken von Berliner Hauptschülern von der Annahme ausgehend analysieren, dass diese einerseits nach Anerkennung suchen und gleichzeitig beständig mit Verachtung konfrontiert werden.
Stefan Wellgraf Hauptschüler. Kultur und soziale Praxis
 Stefan Wellgraf Hauptschüler Kultur und soziale Praxis Stefan Wellgraf (Dr. phil.) hat an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/ Oder promoviert und war Kollegiat im Graduiertenkolleg»Berlin New
Stefan Wellgraf Hauptschüler Kultur und soziale Praxis Stefan Wellgraf (Dr. phil.) hat an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/ Oder promoviert und war Kollegiat im Graduiertenkolleg»Berlin New
9. Erweiterungen: Lebensstile und soziale Milieus 1. Lebensstile: Definition 2. Lebensstile im historischen Wandel 3. Lebensstile und soziale
 9. Erweiterungen: Lebensstile und soziale Milieus 1. Lebensstile: Definition 2. Lebensstile im historischen Wandel 3. Lebensstile und soziale Ungleichheit 4. Soziale Milieus und soziale Netzwerke 5. Die
9. Erweiterungen: Lebensstile und soziale Milieus 1. Lebensstile: Definition 2. Lebensstile im historischen Wandel 3. Lebensstile und soziale Ungleichheit 4. Soziale Milieus und soziale Netzwerke 5. Die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS)
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Bevölkerung und Bildung 9. Januar 2017 FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS) Inhaltsverzeichnis 1 Was ist das
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Bevölkerung und Bildung 9. Januar 2017 FAQs Erhebung Zusammenleben in der Schweiz (ZidS) Inhaltsverzeichnis 1 Was ist das
Krise der Städte und ethnisch-kulturelle Ausgrenzung
 Programm der heutigen Sitzung Soziale Ungleichheit Krise der Städte und ethnisch-kulturelle Ausgrenzung 1. Die Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft 2. Ethnisch-kulturelle Ungleichheiten 3. Trends in deutschen
Programm der heutigen Sitzung Soziale Ungleichheit Krise der Städte und ethnisch-kulturelle Ausgrenzung 1. Die Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft 2. Ethnisch-kulturelle Ungleichheiten 3. Trends in deutschen
Funktionen von Vorurteilen
 Ziel(e) Ë Präsenz von Vorurteilen im eigenen (Arbeits-)Alltag reflektieren Ë Reflexion der Funktionen und Mechanismen von Vorurteilen Ë Erarbeitung der Zusammenhänge zwischen individuellen und gesellschaftlichen
Ziel(e) Ë Präsenz von Vorurteilen im eigenen (Arbeits-)Alltag reflektieren Ë Reflexion der Funktionen und Mechanismen von Vorurteilen Ë Erarbeitung der Zusammenhänge zwischen individuellen und gesellschaftlichen
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Hintergrunds Eines des wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sprache ist ein System von Lauten, von Wörtern und von Regeln für die Bildung von Sätzen, das man benutzt,
Unterschiede, die einen Unterschied machen Intersektionalität: Überschneidungen und Wechselwirkungen von Benachteiligungen
 Unterschiede, die einen Unterschied machen Intersektionalität: Überschneidungen und Wechselwirkungen von Benachteiligungen Fachtag Interkulturelle Unterschiede im Umgang mit Behinderungen 01.03.2016 1
Unterschiede, die einen Unterschied machen Intersektionalität: Überschneidungen und Wechselwirkungen von Benachteiligungen Fachtag Interkulturelle Unterschiede im Umgang mit Behinderungen 01.03.2016 1
Freie Software für eine neue Gesellschaft. Stefan Merten Projekt Oekonux
 Freie Software für eine neue Gesellschaft eine 2009-05-24, Köln Outline eine eine Outline eine eine Ein virtuelles Oekonux == Ökonomie + Linux Diskussionsprozess über Freie Software und Gesellschaft Gegründet
Freie Software für eine neue Gesellschaft eine 2009-05-24, Köln Outline eine eine Outline eine eine Ein virtuelles Oekonux == Ökonomie + Linux Diskussionsprozess über Freie Software und Gesellschaft Gegründet
Ohne Angst verschieden sein
 Peter Nick Ohne Angst verschieden sein Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in der multikulturellen Gesellschaft Campus Verlag Frankfurt / New York Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Fragestellung
Peter Nick Ohne Angst verschieden sein Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in der multikulturellen Gesellschaft Campus Verlag Frankfurt / New York Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Fragestellung
Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung
 Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Jeder ist anders verschieden. Pädagogik der Diversität
 Jeder ist anders verschieden Pädagogik der Diversität Konrad Adenauer (1876 1967) 1. Bundeskanzler von Deutschland Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt s nicht Diversitätsbewusste Pädagogik
Jeder ist anders verschieden Pädagogik der Diversität Konrad Adenauer (1876 1967) 1. Bundeskanzler von Deutschland Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt s nicht Diversitätsbewusste Pädagogik
Exportmodule aus dem MA Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft (PO vom )
 e aus dem MA Europäische Ethnologie/ (PO vom 25.05.2016) Übersicht über Prüfungen... 1 Historische Anthropologie/Kulturgeschichte... 2 Globalisierung und regionale Kulturentwicklung... 3 Visuelle Anthropologie...
e aus dem MA Europäische Ethnologie/ (PO vom 25.05.2016) Übersicht über Prüfungen... 1 Historische Anthropologie/Kulturgeschichte... 2 Globalisierung und regionale Kulturentwicklung... 3 Visuelle Anthropologie...
Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung. Unterrichtsform Punkte I II III IV
 Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Seite 1 von 5 Beschreibung der Module und Lehrveranstaltungen Bezeichnung des Moduls/ der Lehrveranstaltung Beschreibung der Inhalte und Lernziele des Moduls/ der Lehrveranstaltung Unterrichtsform ECTS-
Rassismus in der Gesellschaft
 Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Martin Stern Stil-Kulturen Performative Konstellationen von Technik, Spiel und Risiko in neuen Sportpraktiken
 Aus: Martin Stern Stil-Kulturen Performative Konstellationen von Technik, Spiel und Risiko in neuen Sportpraktiken Januar 2010, 302 Seiten, kart., 29,80, ISBN 978-3-8376-1001-7 Dieses Buch präsentiert
Aus: Martin Stern Stil-Kulturen Performative Konstellationen von Technik, Spiel und Risiko in neuen Sportpraktiken Januar 2010, 302 Seiten, kart., 29,80, ISBN 978-3-8376-1001-7 Dieses Buch präsentiert
Rechtsextremismus und Geschlecht
 SUB Hamburg A2007/ 557 Rechtsextremismus und Geschlecht Politische Selbstverortung weiblicher Auszubildender Esther Burkert Centaurus Verlag Herbolzheim 2006 Inhaltsverzeichnis 1 EINFÜHRUNG 1 2.1 RECHTSEXTREMISMUS
SUB Hamburg A2007/ 557 Rechtsextremismus und Geschlecht Politische Selbstverortung weiblicher Auszubildender Esther Burkert Centaurus Verlag Herbolzheim 2006 Inhaltsverzeichnis 1 EINFÜHRUNG 1 2.1 RECHTSEXTREMISMUS
Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz
 Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz Fallstricke und Ambivalenzen Christine Riegel (Uni Tübingen) 33. Sozialpädagogiktag Differenz und Ungleichheit. Diversität als Herausforderung für
Zum pädagogischen Umgang mit Gleichheit und Differenz Fallstricke und Ambivalenzen Christine Riegel (Uni Tübingen) 33. Sozialpädagogiktag Differenz und Ungleichheit. Diversität als Herausforderung für
Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung
 Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Geisteswissenschaft Sarah Nolte Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Studienarbeit Der Wandel der Jugendkultur und die Techno-Bewegung Sarah Nolte Universität zu Köln 1. Einleitung...1
Der Habitus und die verschiedenen Kapitalformen nach Pierre Bourdieu
 Pädagogik Carolin Seidel Der Habitus und die verschiedenen Kapitalformen nach Pierre Bourdieu Essay Machttheorien in der Sozialpädagogik Der Habitus und die verschiedenen Kapitalformen nach Pierre Bourdieu
Pädagogik Carolin Seidel Der Habitus und die verschiedenen Kapitalformen nach Pierre Bourdieu Essay Machttheorien in der Sozialpädagogik Der Habitus und die verschiedenen Kapitalformen nach Pierre Bourdieu
Soziale Ungleichheit und Bildung in Deutschland
 Geisteswissenschaft Cornelia Lang Soziale Ungleichheit und Bildung in Deutschland Über ungleiche Bildungschancen aufgrund sozialer Herkunft Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Begriffserklärungen...
Geisteswissenschaft Cornelia Lang Soziale Ungleichheit und Bildung in Deutschland Über ungleiche Bildungschancen aufgrund sozialer Herkunft Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Begriffserklärungen...
Leseprobe aus: ISBN: Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf
 Leseprobe aus: ISBN: 978-3-644-00129-9 Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de. Bin ich denn schon rechts? Wie rechts bin ich eigentlich? In Deutschland ist es laut geworden, seit die
Leseprobe aus: ISBN: 978-3-644-00129-9 Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de. Bin ich denn schon rechts? Wie rechts bin ich eigentlich? In Deutschland ist es laut geworden, seit die
Sabine Andresen. Mein Leben wird richtig schön! Kinder aus Hamburg-Jenfeld und Berlin-Hellersdorf
 Sabine Andresen Mein Leben wird richtig schön! Kinder aus Hamburg-Jenfeld und Berlin-Hellersdorf 1 Gliederung 1. Unsicherheit und prekäres Aufwachsen 2. Zum Ansatz in der Kindheitsforschung 3. Zum Spielraumbegriff
Sabine Andresen Mein Leben wird richtig schön! Kinder aus Hamburg-Jenfeld und Berlin-Hellersdorf 1 Gliederung 1. Unsicherheit und prekäres Aufwachsen 2. Zum Ansatz in der Kindheitsforschung 3. Zum Spielraumbegriff
Vorwort des Herausgebers 11 Aus Althussers Hinweis" zur 1. Auflage 13 [Aus Althussers Vorwort zur 2. Auflage] 15 Abkürzungen 17
![Vorwort des Herausgebers 11 Aus Althussers Hinweis zur 1. Auflage 13 [Aus Althussers Vorwort zur 2. Auflage] 15 Abkürzungen 17 Vorwort des Herausgebers 11 Aus Althussers Hinweis zur 1. Auflage 13 [Aus Althussers Vorwort zur 2. Auflage] 15 Abkürzungen 17](/thumbs/61/46252340.jpg) Inhalt Vorwort des Herausgebers 11 Aus Althussers Hinweis" zur 1. Auflage 13 [Aus Althussers Vorwort zur 2. Auflage] 15 Abkürzungen 17 I. Vom Kapital zur Philosophie von Marx Louis Althusser 19 II. Der
Inhalt Vorwort des Herausgebers 11 Aus Althussers Hinweis" zur 1. Auflage 13 [Aus Althussers Vorwort zur 2. Auflage] 15 Abkürzungen 17 I. Vom Kapital zur Philosophie von Marx Louis Althusser 19 II. Der
Wirtschaft. Stephanie Schoenwetter. Das IS-LM-Modell. Annahmen, Funktionsweise und Kritik. Studienarbeit
 Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Wirtschaft Stephanie Schoenwetter Das IS-LM-Modell Annahmen, Funktionsweise und Kritik Studienarbeit Thema II Das IS-LM Modell Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1. Die Welt von John Maynard Keynes...
Olaf Stuve & Katharina Debus. Die sind eben so... Rassismus und Klasse als Kulminationspunkte geschlechtsbezogener Vorurteile
 & Katharina Debus Die sind eben so... Rassismus und Klasse als Kulminationspunkte geschlechtsbezogener Vorurteile Fachtag Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen in Schule und Jugendarbeit Konzepte
& Katharina Debus Die sind eben so... Rassismus und Klasse als Kulminationspunkte geschlechtsbezogener Vorurteile Fachtag Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen in Schule und Jugendarbeit Konzepte
Kulturelle Differenz?
 Kulturelle Differenz? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kultur und seinen Folgen Prof. Dr. Chantal Munsch Selbstreflexion Was denken Sie, wenn Ihnen eine SchülerIn oder eine KollegIn
Kulturelle Differenz? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kultur und seinen Folgen Prof. Dr. Chantal Munsch Selbstreflexion Was denken Sie, wenn Ihnen eine SchülerIn oder eine KollegIn
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically
 Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Das MdM ein Museum für alle?
 Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
Susanne Zauner Das MdM ein Museum für alle? Das Projekt unserer Gruppe bezieht sich nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Werk von Andrea Fraser, sondern greift vielmehr verschiedene Stränge ihres künstlerischen
Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung
 Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung Band 8 Editorial Die Reihe Critical Media Studies versammelt Arbeiten, die sich mit der Funktion und
Tanja Maier, Martina Thiele, Christine Linke (Hg.) Medien, Öffentlichkeit und Geschlecht in Bewegung Band 8 Editorial Die Reihe Critical Media Studies versammelt Arbeiten, die sich mit der Funktion und
Migrant + Männlich = Gewalttätig? Mythen, Erkenntnisse und Konsequenzen für die Gewaltprävention
 Migrant + Männlich = Gewalttätig? Mythen, Erkenntnisse und Konsequenzen für die Gewaltprävention Dr. Paul Scheibelhofer Vortrag bei: Landtagsenquete zu Gewaltprävention Innsbruck, 18. Juni 2015 www.wecansingapore.com/the-fight-for-all
Migrant + Männlich = Gewalttätig? Mythen, Erkenntnisse und Konsequenzen für die Gewaltprävention Dr. Paul Scheibelhofer Vortrag bei: Landtagsenquete zu Gewaltprävention Innsbruck, 18. Juni 2015 www.wecansingapore.com/the-fight-for-all
Julia Barbara Anna Frank Selektion entlang ethnischer Grenzziehungen im beruflichen Bildungssystem Türkische Jugendliche und jugendliche
 Julia Barbara Anna Frank Selektion entlang ethnischer Grenzziehungen im beruflichen Bildungssystem Türkische Jugendliche und jugendliche Spätaussiedler im kaufmännischen dualen Bildungssystem INHALTSVERZEICHNIS
Julia Barbara Anna Frank Selektion entlang ethnischer Grenzziehungen im beruflichen Bildungssystem Türkische Jugendliche und jugendliche Spätaussiedler im kaufmännischen dualen Bildungssystem INHALTSVERZEICHNIS
Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung
 Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Rational-Choice-Ansatz, Konstruktivismus und Sozialkonstruktivismus 30.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Rational-Choice-Ansatz, Konstruktivismus und Sozialkonstruktivismus 30.01.2012 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Modulbezeichnung. Forschungsfelder und Selbstverständnis der Europäischen Ethnologie / Kulturwissenschaft
 n Forschungsfelder und Selbstverständnis der Europäischen Ethnologie / Kulturwissenschaft Pflichtmodul Basismodul Das Modul vermittelt einen Überblick über Sachgebiete und Forschungsfelder der Europäischen
n Forschungsfelder und Selbstverständnis der Europäischen Ethnologie / Kulturwissenschaft Pflichtmodul Basismodul Das Modul vermittelt einen Überblick über Sachgebiete und Forschungsfelder der Europäischen
Bibel-online HA II Schulen, Hochschulen und Bildung,
 Mt 13, 31-32 Das Gleichnis vom Senfkorn" Lehrerhinweise Die Bibelstelle: Das Gleichnis vom Senfkorn ist eines von vielen "Reich Gottes Gleichnissen" des Neuen Testaments. Es kommt in allen drei synoptischen
Mt 13, 31-32 Das Gleichnis vom Senfkorn" Lehrerhinweise Die Bibelstelle: Das Gleichnis vom Senfkorn ist eines von vielen "Reich Gottes Gleichnissen" des Neuen Testaments. Es kommt in allen drei synoptischen
Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken
 Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken Meryem Uçan und Dr. Susanne Schwalgin Fachtagung des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg
Perspektiven muslimischer Eltern auf Bildung und Schule wahrnehmen Elternbeteiligung stärken Meryem Uçan und Dr. Susanne Schwalgin Fachtagung des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg
Was besprechen wir heute?
 Global Governance Annahme / Problem: Sozialwissenschaften analysieren Realität, die kann aber unterschiedlich interpretiert werden Weltsichten, Erkenntnisinteresse These: es gibt verschiedene Verständnisse
Global Governance Annahme / Problem: Sozialwissenschaften analysieren Realität, die kann aber unterschiedlich interpretiert werden Weltsichten, Erkenntnisinteresse These: es gibt verschiedene Verständnisse
Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland
 Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland Komparative Forschung Zuerst Südostasien und Brasilien Vergleich und Theorie Anwendung auf Deutschland: erst Lektüre, dann Revision der
Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Deutschland Komparative Forschung Zuerst Südostasien und Brasilien Vergleich und Theorie Anwendung auf Deutschland: erst Lektüre, dann Revision der
Einführung in die Europäische Ethnologie
 Wolfgang Kaschuba Einführung in die Europäische Ethnologie Verlag C.H.Beck München Inhalt Einleitung I. Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte Seite 17 1. Anfänge: Aufklärung, Romantik und Volks-Kunde"
Wolfgang Kaschuba Einführung in die Europäische Ethnologie Verlag C.H.Beck München Inhalt Einleitung I. Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte Seite 17 1. Anfänge: Aufklärung, Romantik und Volks-Kunde"
Anthony Giddens. Soziologie
 Anthony Giddens Soziologie herausgegeben von Christian Fleck und Hans Georg Zilian übersetzt nach der dritten englischen Auflage 1997 von Hans Georg Zilian N A U S N E R X _ N A U S N E R Graz-Wien 1999
Anthony Giddens Soziologie herausgegeben von Christian Fleck und Hans Georg Zilian übersetzt nach der dritten englischen Auflage 1997 von Hans Georg Zilian N A U S N E R X _ N A U S N E R Graz-Wien 1999
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung
 Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Allgemeines zum Verfassen der Einleitung Nach: Charbel, Ariane. Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Eco, Umberto. Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Martin, Doris. Erfolgreich texten!
Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft"
 Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Geisteswissenschaft Eva Kostakis Pierre Bourdieu "Die männliche Herrschaft" Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung:... 2 2. Die Kabylei:... 3 3. Die gesellschaftliche Konstruktion der Körper:...
Bahnfahrt Zürich Bern 1h 3 min.
 Bahnfahrt Zürich Bern 1h 3 min. Er hätte mich fast vom Kompostieren überzeugt, ohne je zu sagen, ich müsse dies auch tun! Er war einfach nur begeistert und darum überzeugend und ansteckend! Falsche Druck:
Bahnfahrt Zürich Bern 1h 3 min. Er hätte mich fast vom Kompostieren überzeugt, ohne je zu sagen, ich müsse dies auch tun! Er war einfach nur begeistert und darum überzeugend und ansteckend! Falsche Druck:
Sarah Oberkrome Internationales Zentrum für Hochschulforschung (INCHER-Kassel) Universität Kassel
 Chancenungleichheit der Geschlechter während der Promotionsphase die Wirkung von Kapitaleinsätzen nach Bourdieu 9. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung, 25.-27.06 2014, Dortmund Sarah Oberkrome
Chancenungleichheit der Geschlechter während der Promotionsphase die Wirkung von Kapitaleinsätzen nach Bourdieu 9. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung, 25.-27.06 2014, Dortmund Sarah Oberkrome
Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze. Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit. Workshop 6 - Diversity 1
 Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit 1 1. Übung: Schritt voran Struktur 2. Präsentation: Welchen Einfluss hat Diversity im Übergang
Diversity in der Begleitung von Übergängen - Reflexionsansätze Angela Rein, Hochschule für Soziale Arbeit 1 1. Übung: Schritt voran Struktur 2. Präsentation: Welchen Einfluss hat Diversity im Übergang
Evangelische Religion, Religionspädagogik
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Selbst- und Fremdzuschreibungen in den Geschlechterbildern. Pforzheim, Birol Mertol
 Selbst- und Fremdzuschreibungen in den Geschlechterbildern Pforzheim, 12.07.16 Birol Mertol Das Familienspiel Suchen Sie sich ein Kind aus, das Sie anspricht Gehen Sie in gruppen in den Austausch und beantworten
Selbst- und Fremdzuschreibungen in den Geschlechterbildern Pforzheim, 12.07.16 Birol Mertol Das Familienspiel Suchen Sie sich ein Kind aus, das Sie anspricht Gehen Sie in gruppen in den Austausch und beantworten
Geschlechterstereotype: Ursachen, Merkmale, Effekte. Dr. Marc Gärtner, Berlin
 Geschlechterstereotype: Ursachen, Merkmale, Effekte Dr. Marc Gärtner, Berlin Inputstruktur 1. Was sind Stereotype? 2. Geschlechterstereotype: Definition und Merkmale Interaktive Übung zu Geschlechterstereotypen
Geschlechterstereotype: Ursachen, Merkmale, Effekte Dr. Marc Gärtner, Berlin Inputstruktur 1. Was sind Stereotype? 2. Geschlechterstereotype: Definition und Merkmale Interaktive Übung zu Geschlechterstereotypen
»Wir sind keine Araber!«
 Kultur und soziale Praxis»Wir sind keine Araber!«Amazighische Identitätskonstruktion in Marokko Bearbeitet von Kristin Pfeifer 1. Auflage 2015. Taschenbuch. 364 S. Paperback ISBN 978 3 8376 2781 7 Format
Kultur und soziale Praxis»Wir sind keine Araber!«Amazighische Identitätskonstruktion in Marokko Bearbeitet von Kristin Pfeifer 1. Auflage 2015. Taschenbuch. 364 S. Paperback ISBN 978 3 8376 2781 7 Format
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.
 Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm
 Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm Aufgabenbereich A1 Das pädagogische Handeln basiert auf einem Bildungsverständnis, das allen Kindern die gleichen Rechte auf Bildung
Materialien für die interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm Aufgabenbereich A1 Das pädagogische Handeln basiert auf einem Bildungsverständnis, das allen Kindern die gleichen Rechte auf Bildung
Frauen- und Mutterrollen im Wandel der Zeit und Mutter-Kind-Gruppe als alternative Hilfsform
 Pädagogik Ursula Niederleithner Frauen- und Mutterrollen im Wandel der Zeit und Mutter-Kind-Gruppe als alternative Hilfsform Diplomarbeit Diplomarbeit für die Prüfung zum Diplom-Sozialpädagogen/Sozialarbeiter
Pädagogik Ursula Niederleithner Frauen- und Mutterrollen im Wandel der Zeit und Mutter-Kind-Gruppe als alternative Hilfsform Diplomarbeit Diplomarbeit für die Prüfung zum Diplom-Sozialpädagogen/Sozialarbeiter
Klimawandel und Geschlecht
 Studien zu Lateinamerika 29 Sarah K. Hackfort Klimawandel und Geschlecht Zur politischen Ökologie der Anpassung in Mexiko Nomos Studien zu Lateinamerika 29 Die Reihe Studien zu Lateinamerika wird herausgegeben
Studien zu Lateinamerika 29 Sarah K. Hackfort Klimawandel und Geschlecht Zur politischen Ökologie der Anpassung in Mexiko Nomos Studien zu Lateinamerika 29 Die Reihe Studien zu Lateinamerika wird herausgegeben
Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23
 Inhaltsverzeichnis Vorwort. 5 Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung... 11 1. Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23 1.1 Politik- und sozialwissenschaftliche Diskussionen I Eine diachrone Beschreibung...
Inhaltsverzeichnis Vorwort. 5 Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung... 11 1. Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23 1.1 Politik- und sozialwissenschaftliche Diskussionen I Eine diachrone Beschreibung...
Einführung in die Europäische Ethnologie
 Wolfgang Kaschuba Einführung in die Europäische Ethnologie Verlag C. H. Beck München Inhalt Einleitung 9 I. Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte Seite 17 1. Anfange: Aufklärung, Romantik und Volks-Kunde"...
Wolfgang Kaschuba Einführung in die Europäische Ethnologie Verlag C. H. Beck München Inhalt Einleitung 9 I. Zur Wissens- und Wissenschaftsgeschichte Seite 17 1. Anfange: Aufklärung, Romantik und Volks-Kunde"...
Soziologie für die Soziale Arbeit
 Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas)
 Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Kritische Theorie (u.a. Horkheimer, Marcuse, Adorno..., Habermas) Anlehnung an Marxismus, insbesondere Geschichtsinterpretation. Theorie ist Form gesellschaftlicher Praxis. Historische Analyse Grundlage
Inklusion von Anfang an
 Inklusion von Anfang an Herausforderungen für die Kita Jun. Prof. Dr. Timm Albers, Karlsruhe Kompetent für Inklusion 2. Wiff-Bundeskongress für Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik Berlin, den 17./18.
Inklusion von Anfang an Herausforderungen für die Kita Jun. Prof. Dr. Timm Albers, Karlsruhe Kompetent für Inklusion 2. Wiff-Bundeskongress für Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik Berlin, den 17./18.
Kurze Einleitung zum Buch Sacharja
 Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Geisteswissenschaft David Jäggi Kurze Einleitung zum Buch Sacharja Der Versuch einer bibeltreuen Annäherung an den Propheten Studienarbeit Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie für Leiterschaft in Zusammenarbeit
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Teil I Die Grenzen des guten Musikgeschmacks als Gegenstand der Soziologie
 Teil I Die Grenzen des guten Musikgeschmacks als Gegenstand der Soziologie 2. Elemente einer ungleichheitsanalytischen Soziologie des Musikgeschmacks Das folgende Kapitel behandelt theoretische Ansätze
Teil I Die Grenzen des guten Musikgeschmacks als Gegenstand der Soziologie 2. Elemente einer ungleichheitsanalytischen Soziologie des Musikgeschmacks Das folgende Kapitel behandelt theoretische Ansätze
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Entwicklungspolitik als globale Herausforderung
 Johannes Müller Entwicklungspolitik als globale Herausforderung Methodische und ethische Grundlegung Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Vorwort 10 Abkürzungsverzeichnis ll 1 Armut als weltweite
Johannes Müller Entwicklungspolitik als globale Herausforderung Methodische und ethische Grundlegung Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Vorwort 10 Abkürzungsverzeichnis ll 1 Armut als weltweite
Praktikum im Bundestag ( )
 Praktikum im Bundestag (13.04.-30.04.2015) Einleitung Wir, Anais Jäger und María José Garzón Rivera, sind Schülerinnen der Deutschen Schule in Cali, Kolumbien, wo wir in die 11. Klasse gehen, jedoch haben
Praktikum im Bundestag (13.04.-30.04.2015) Einleitung Wir, Anais Jäger und María José Garzón Rivera, sind Schülerinnen der Deutschen Schule in Cali, Kolumbien, wo wir in die 11. Klasse gehen, jedoch haben
Programm- und Notizheft Respect-Camp
 Programm- und Notizheft Respect-Camp Name: Willkommen im Respect-Camp! Dieses Heft begleitet dich durch das Respect-Camp. In 6 verschiedenen Zelten findest du die Trainingspoints, jeder zu einem anderen
Programm- und Notizheft Respect-Camp Name: Willkommen im Respect-Camp! Dieses Heft begleitet dich durch das Respect-Camp. In 6 verschiedenen Zelten findest du die Trainingspoints, jeder zu einem anderen
Publikationen Studium Universale
 Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Publikationen Studium Universale Schenkel, Elmar und Alexandra Lembert (Hrsg.). Alles fließt. Dimensionen des Wassers in Natur und Kultur. 199 S. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 2008. ISBN 978-3-631-56044-0
Der Nahostkonflikt in Deutschland
 Berlin goes Gaza Der Nahostkonflikt in Deutschland FACH UND SCHULFORM Geschichte/Politische Bildung, 9. Klasse ZEITRAHMEN 4 x 45 min LEHRPLANBEZUG Der Nahostkonflikt: historische Dimensionen; Gründung
Berlin goes Gaza Der Nahostkonflikt in Deutschland FACH UND SCHULFORM Geschichte/Politische Bildung, 9. Klasse ZEITRAHMEN 4 x 45 min LEHRPLANBEZUG Der Nahostkonflikt: historische Dimensionen; Gründung
Karl Marx ( )
 Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Grundkurs Soziologie (GK I) BA Sozialwissenschaften Karl Marx (1818-1883) Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts 1. Historischer Materialismus 2. Arbeit als Basis der Gesellschaft 3. Klassen und Klassenkämpfe
Eigene MC-Fragen "Ethnizität und Rassismus"
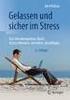 Eigene MC-Fragen "Ethnizität und Rassismus" 1. Welcher Aspekt ist keine Antwort auf die Frage "Was ist Rassismus?" Rassismus. [a]... bezeichnet ein gesellschaftliches oder kulturelles Muster [b] weit verbreitete
Eigene MC-Fragen "Ethnizität und Rassismus" 1. Welcher Aspekt ist keine Antwort auf die Frage "Was ist Rassismus?" Rassismus. [a]... bezeichnet ein gesellschaftliches oder kulturelles Muster [b] weit verbreitete
Dissertationsvorhaben Begegnung, Bildung und Beratung für Familien im Stadtteil - eine exemplarisch- empirische Untersuchung-
 Code: N11 Geschlecht: Frau, ca. 30 Jahre alt mit ihrem Sohn Institution: FZ DAS HAUS, Teilnehmerin FuN Baby Datum: 17.06.2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code: N11 Geschlecht: Frau, ca. 30 Jahre alt mit ihrem Sohn Institution: FZ DAS HAUS, Teilnehmerin FuN Baby Datum: 17.06.2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forschungsfelder und Theoriebedarf der Sozialstrukturanalyse
 Forschungsfelder und Theoriebedarf der Sozialstrukturanalyse Christoph Weischer Institut für Soziologie, WWU-Münster Forschungsfelder und Theoriebedarf der Sozialstrukturanalyse - 1 Gliederung I. Entwicklung
Forschungsfelder und Theoriebedarf der Sozialstrukturanalyse Christoph Weischer Institut für Soziologie, WWU-Münster Forschungsfelder und Theoriebedarf der Sozialstrukturanalyse - 1 Gliederung I. Entwicklung
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit
 Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit Herzlich Willkommen zum Impulsreferat: Transkulturalität in der Entwicklungszusammenarbeit im Kontext globalen und gesellschaftlichen Wandels und soziodemographischer
Evangelische Religionspädagogik, Religion
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Soziologie für die Soziale Arbeit
 Studienkurs Soziale Arbeit 1 Soziologie für die Soziale Arbeit Bearbeitet von Prof. Dr. Klaus Bendel 1. Auflage 2015. Buch. 249 S. Kartoniert ISBN 978 3 8487 0964 9 Weitere Fachgebiete > Ethnologie, Volkskunde,
Studienkurs Soziale Arbeit 1 Soziologie für die Soziale Arbeit Bearbeitet von Prof. Dr. Klaus Bendel 1. Auflage 2015. Buch. 249 S. Kartoniert ISBN 978 3 8487 0964 9 Weitere Fachgebiete > Ethnologie, Volkskunde,
Einleitung. Martin Spieß. in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, S.
 Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I. Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik
 Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
Das Erste Staatsexamen in den Erziehungswissenschaften neue LPO I Zur schriftlichen Prüfung in der Allgemeinen Pädagogik Inhaltliche Teilgebiete der Allgemeinen Pädagogik gemäß 32 LPO I a) theoretische
zumindest jener Armutsbegriff, wie er sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland etabliert hatte. Armut ist ein sehr stark emotional aufgeladener
 zumindest jener Armutsbegriff, wie er sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland etabliert hatte. Armut ist ein sehr stark emotional aufgeladener Begriff. Armut löst Assoziationen wie Mitleid, Zuwendung
zumindest jener Armutsbegriff, wie er sich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland etabliert hatte. Armut ist ein sehr stark emotional aufgeladener Begriff. Armut löst Assoziationen wie Mitleid, Zuwendung
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
(Eine) Queer-feministische Perspektive auf Kapitalismuskritik (einnehmen) Einladung zu einem Gedankenexperiment. Oder: Warum Feminist_innen schon
 (Eine) Queer-feministische Perspektive auf Kapitalismuskritik (einnehmen) Einladung zu einem Gedankenexperiment. Oder: Warum Feminist_innen schon heute mit der Revolution beginnen können. Ziel der heutigen
(Eine) Queer-feministische Perspektive auf Kapitalismuskritik (einnehmen) Einladung zu einem Gedankenexperiment. Oder: Warum Feminist_innen schon heute mit der Revolution beginnen können. Ziel der heutigen
B. Darstellung des Konzeptes der hate crimes aus den USA 19
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis xxi A. Einleitung und Fragestellung 1 1. Einleitung 1 1.1 Vertiefung des Vorgehens 2 1.1.1 Vergleichende Forschung 4 1.1.2 Empirische Dimension 8 1.2 Defizite der
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis xxi A. Einleitung und Fragestellung 1 1. Einleitung 1 1.1 Vertiefung des Vorgehens 2 1.1.1 Vergleichende Forschung 4 1.1.2 Empirische Dimension 8 1.2 Defizite der
Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./ in Köln
 Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./27. 11 2011 in Köln Samstag, 26.11. 1) Speeddating- Was bedeutet Weiss sein für uns? 2) Was bedeutet Rassismus für uns? 3) Individueller Zeitstrahl über
Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./27. 11 2011 in Köln Samstag, 26.11. 1) Speeddating- Was bedeutet Weiss sein für uns? 2) Was bedeutet Rassismus für uns? 3) Individueller Zeitstrahl über
Ausgangspunkt: Warum hat kaum ein(e) Volkswirt(in) die Krise vorhergesagt bzw. für möglich erachtet?
 Was ist Ihre Motivation für diese LVA? Mögliche Motivation zu den beiden Lehrveranstaltungen Kulturgeschichte 1 + 2: Verständnis über die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 bzw. 2008, aktuell die Finanzierungskrise
Was ist Ihre Motivation für diese LVA? Mögliche Motivation zu den beiden Lehrveranstaltungen Kulturgeschichte 1 + 2: Verständnis über die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 bzw. 2008, aktuell die Finanzierungskrise
"Es brauchte einen Mann wie Madiba, um nicht nur den Gefangenen zu befreien, sondern auch den Gefängniswärter. Barak Obama
 Dr. Eske Wollrad "Es brauchte einen Mann wie Madiba, um nicht nur den Gefangenen zu befreien, sondern auch den Gefängniswärter. Barak Obama Eine rassistische Welt ist für niemanden die beste aller Welten
Dr. Eske Wollrad "Es brauchte einen Mann wie Madiba, um nicht nur den Gefangenen zu befreien, sondern auch den Gefängniswärter. Barak Obama Eine rassistische Welt ist für niemanden die beste aller Welten
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart
 Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Bildung das handelnde Subjekt. Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg
 Bildung das handelnde Subjekt Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 2 Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 3 Bildung
Bildung das handelnde Subjekt Cornelie Dietrich, Universität Lüneburg Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 2 Bildung das handelnde Subjekt / Prof. Dr. Cornelie Dietrich / 3 Bildung
Übersetzung Video Helen (H), 14jährig
 Übersetzung Video Helen (H), 14jährig Klinisches Beispiel mit dem Teenager, ihrer Mutter (Km) und dem Therapeuten (Th) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Km:
Übersetzung Video Helen (H), 14jährig Klinisches Beispiel mit dem Teenager, ihrer Mutter (Km) und dem Therapeuten (Th) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Km:
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig)
 Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Schulcurriculum Geschichte (Stand: August 2012) Klasse 11/ J1 (2-stündig) Inhalte Kompetenzen Hinweise Themenbereich: 1. Prozesse der Modernisierung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft seit dem 18.
Gibt es eine Literatur der Migration?
 TU Dresden, Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte, Prof. Dr. Walter Schmitz Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen
TU Dresden, Neuere deutsche Literatur und Kulturgeschichte, Prof. Dr. Walter Schmitz Gibt es eine Literatur der Migration? Zur Konzeption eines Handbuchs zur Literatur der Migration in den deutschsprachigen
Walderholung mit Migrationshintergrund?
 Walderholung mit Migrationshintergrund? Wie Migrationserfahrungen und soziale Zugehörigkeiten die Waldnutzung und -wahrnehmung prägen NNA-Forum In und von der Landschaft leben (IV) Multikulturelle Perspektiven
Walderholung mit Migrationshintergrund? Wie Migrationserfahrungen und soziale Zugehörigkeiten die Waldnutzung und -wahrnehmung prägen NNA-Forum In und von der Landschaft leben (IV) Multikulturelle Perspektiven
Diskriminierungswahrnehmungg und -erfahrungen an der Universität
 Diskriminierungswahrnehmungg und -erfahrungen an der Universität Studierende der Universität Bielefeld, 2014 Unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Zick und MA Soz. Madlen Preuß fand in dem zurückliegenden
Diskriminierungswahrnehmungg und -erfahrungen an der Universität Studierende der Universität Bielefeld, 2014 Unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Zick und MA Soz. Madlen Preuß fand in dem zurückliegenden
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Entwicklung von Freundschaft als Form der sozialen Beziehung im Kindergartenalter
 Pädagogik Anna Badstübner Entwicklung von Freundschaft als Form der sozialen Beziehung im Kindergartenalter Zwischenprüfungsarbeit Zwischenprüfungsarbeit Magister im HF Rehabilitationspädagogik Thema:
Pädagogik Anna Badstübner Entwicklung von Freundschaft als Form der sozialen Beziehung im Kindergartenalter Zwischenprüfungsarbeit Zwischenprüfungsarbeit Magister im HF Rehabilitationspädagogik Thema:
Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden
 Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK
 STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
STUDIEN ZUR INTERNATIONALEN POLITIK Hamburg, Heft 2/2005 Steffen Handrick Das Kosovo und die internationale Gemeinschaft: Nation-building versus peace-building? IMPRESSUM Studien zur Internationalen Politik
Rede. der Staatsministerin Dr. Beate Merk. im Rahmen der Vernissage "Perspektivenwechsel" des Sozialdienstes katholischer Frauen e.v.
 Die Bayerische Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Beate Merk Rede der Staatsministerin Dr. Beate Merk im Rahmen der Vernissage "Perspektivenwechsel" des Sozialdienstes katholischer
Die Bayerische Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Beate Merk Rede der Staatsministerin Dr. Beate Merk im Rahmen der Vernissage "Perspektivenwechsel" des Sozialdienstes katholischer
Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie
 Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
Wirtschaft Marcus Habermann Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Studienarbeit Semesterarbeit Der normative Ansatz in der Stakeholder-Theorie Institut für Strategie und Unternehmensökonomik
