Evolution: Prädationsschutz bei Libellen
|
|
|
- Guido Michel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HEFT 5 / 64. JAHRGANG / 2015 LIBELLENFORSCHUNG / PdN BIOLOGIE in der Schule evolutionary research. Oxford University Press, Oxford (2008) [3] Sih, A.: Predators and prey life style. Predation: Direct and indirect impacts on aquatic communities University Press of New England, Hanover, NH (1987) [4] Lima, S. L., Dill, L. M.: Behavioral decisions made under the risk of predation: A review and prospectus. Canadian Journal of Zoology 68 (1990), [5] Wright, D. I., O Brien, W. J.: Differential location of Chaoborus larvae and Daphnia by fish: The importance of motion and visible size. The American Midland Naturalist 108 (1982), [6] McNamara, J. M., Houston, A. I.: Starvation and predation as factors limiting population size. Ecology 68 (1987), [7] Wellborn, G. A., Skelly, D. K., Werner, E. E.: Mechanisms creating community structure across a freshwater habitat gradient. Annual Review of Ecology and Systematics 27 (1996), [8] McCauley, S. J.: Slow, fast and in between: Habitat distribution and behaviour of larvae in nine species of Libellulid dragonfly. Freshwater Biology 53 (2008), [9] Mathis, A., Smith, R. J. F.: Fathead minnows (Pimephales promelas) learn to recognize pike (Esox lucius) as predators on the basis of chemical stimuli from minnows in the pike s diet. Animal Behaviour 46 (1993), [10] Wisenden, B. D., Chivers, D. P., Smith, R. J. F.: Learned recognition of predation risk by Enallagma damselfly larvae (Odonata, Zygoptera) on the basis of chemical cues. Journal of Chemical Ecology 23 (1997), [11] Brönmark, C., Hansson, L.-A.: Chemical Ecology in Aquatic Systems. Oxford University Press, Oxford (2012) [12] Howe, N. R., Sheikh, Y. M.: Anthopleurine: a sea anemone alarm pheromone. Science 189 (1975), [13] Atema, J., Stenzler, D.: Alarm substance of the marine mud snail, Nassarius obsoletus: Biological characterization and possible evolution. Journal of Chemical Ecology 3 (1977), [14] Sleeper, H. L., Paul, V. J., Fenical, W.: Alarm pheromones from the marine opisthobranch Navanax inermis. Journal of Chemical Ecology 6 (1980), [15] Pfeiffer, W., Riegelbauer, G., Meier, G., Scheibler, B.: Effect of hypoxanthine-3-n-oxide and hypoxanthine-1-n-oxide on central nervous excitation of the black tetra, Gymnocorymbus ternetzi (Characidae, Ostariophysi, Pisces) indicated by dorsal light response. Journal of Chemical Ecology 11 (1985), [16] Brown, G. E., Adrian, J. C., Jr., Smyth, E., Leet, H., Brennan, S.: Ostariophysan alarm pheromones: laboratory and field tests of the functional significance of nitrogen oxides. Journal of Chemical Ecology 26 (2000), [17] Giles, N., Huntingford, F. A.: Predation risk and inter-population variation in antipredator behaviour in the three-spined stickleback, (Gasterosteus aculeatus L.). Animal Behaviour 32 (1984), [18] McPeek, M. A.: Behavioral differences between Enallagma species (Odonata) influencing differential vulnerability to predators. Ecology 71 (1990), [19] Johansson, F.: The slow-fast life style characteristics in a suite of six species of odonate larvae. Freshwater Biology 43 (2000), [20] Stoks, R., McPeek, M. A.: Antipredator behavior and physiology determine Lestes species turnover along the pond-permanence gradient. Ecology 84 (2003), [21] Johansson, F., Suhling, F.: Behaviour and growth of dragonfly larvae along a permanent to temporary water habitat gradient. Ecological Entomology 29 (2004), Anschrift der Verfasser Dr. Kamilla Koch und Dipl. Biol. Kathrin Jäckel, Institut für Zoologie, Abteilung Ökologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Becherweg 13, Mainz, kochka@ uni-mainz.de, kathrinjaeckel@gmx.de Evolution: Prädationsschutz bei Libellen Beispiel Moosjungfern L. Rüsen, A. Conrad und D. J. Mikolajewski Prädation ist eine omnipräsente Bedrohung für das Überleben und somit die biologische Fitness von Organismen. Hier stellen wir evolutiv entstandene Antiprädationsmerkmale bei einigen Libellenlarven vor und zeigen, wie Prädatoren auf verschiedenartige Merkmalsausprägungen selektieren. Stichwörter: Prädation, Libellen, Moosjungfern 1 Einleitung Die Interaktion zwischen Individuen und ihrer Umwelt hat einen großen Einfluss auf die Diversität von Organismen. Eine wichtige Frage der Evolutionsbiologie ist, wie sich vorhandene biotische und abiotische Umweltverhältnisse, wie Klima, Nahrungsvorkommen oder auch unterschiedliche Prädationsregime, auf die Fitness von Individuen auswirken und sich somit unterschiedliche Anpassungen evolvieren können. Die Untersuchung der Wechselbeziehung zwischen Räubern und ihrer Beute kann dabei helfen, Evolutionsprozesse und die Entstehung von Biodiversität besser zu verstehen [1]. Vielfältige Studien belegen, dass Prädatoren einen starken Selektionsdruck auf ihre Beutetiere ausüben; Fressfeinde sind omnipräsent in fast allen Lebensräumen. Konsequenterweise evolvierten bei Beutetieren eine Fülle von Merkmalen, die Räuberzugriff vermeiden oder minimieren. Dazu zählen zum Beispiel Anpassungen von Verhalten und Physiologie, Tarnung, chemische Waffen oder auch die Ausbildung morphologischer Ausprägungen. Die Raupen einiger Schmetterlingsarten, wie etwa dem Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea), verfügen beispielsweise über Brennhaare, welche Nesselgift enthalten und Widerhaken haben. Dies schützt die Larven sehr effektiv vor Räubern [2]. Schwebfliegen (Syrphidae) hinge- 25
2 PdN BIOLOGIE in der Schule / LIBELLENFORSCHUNG HEFT 5 / 64. JAHRGANG / 2015 Abb. 1: Aquatische Habitattypen nach Wellborn et al. (1996). Von links nach rechts: (1) Kleine, kurzlebige Gewässer ohne große Prädatoren; (2) permanente Habitate, dominiert von invertebraten Prädatoren wie zum Beispiel Libellenlarven, und (3) permanente Habitate, dominiert von räuberischen Vertebraten wie zum Beispiel Fischen Zeichnungen: Axel Conrad gen schrecken Prädatoren ab, indem sie durch wespenähnliches Aussehen Giftigkeit vortäuschen [1]. Bei diesem Beispiel, bekannt als Bates sche Mimikry, evolvierte bei den Beutetieren eine Signalfälschung, welche Prädatoren abschreckt. Andere Beutetierarten halten sich Räuber mit Hilfe von Stacheln oder vom Leib, wie zum Beispiel die Stacheligel (Erinaceinae) oder der teufel (Moloch horridus). Wieder andere Beutetiere verfallen bei Räuberpräsenz in eine Art Schreckstarre und vermeiden so die Räuberzugriffe. Dieses Verhalten lässt sich bei vielen Insekten, Vögeln, Spinnen und auch Reptilien beobachten. Die Ausprägung von Abwehr- und Schutzmechanismen kann sich jedoch zwischen Arten und auch zwischen den einzelnen Individuen einer Art stark unterscheiden. Dabei ist es interessant zu untersuchen, inwieweit die Interaktion zwischen Räubern und ihrer Beute die Vielzahl dieser Merkmale und deren Variabilität beeinflusst. So können Merkmale zum Prädationsschutz gegen einen bestimmten Räubertyp adaptiv sein, aber auch einen Nachteil gegenüber einem anderen Räubertyp darstellen. Somit hat die Wechselbeziehung zwischen Räubern und ihrer Beute und der damit einhergehende Selektionsdruck das Potenzial, die Form und Diversität von Arten zu beeinflussen [3 5]. Generell kann man zwischen fixierten und phänotypisch plastischen Merkmalen unterscheiden. Die Expression fixierter Merkmale zum Prädationsschutz variiert nur wenig zwischen Individuen einer Art und wird auch nicht von kurz- oder mittelfristiger An- oder Abwesenheit der Prädatoren beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass solche Merkmale das evolutive Ergebnis einer langen und permanenten Koexistenz von Beutetieren und ihren Räubern sind [6]. Ein Beispiel hierfür ist die genetisch determinierte Po- Abb. 2: Adulte Nordische Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda, Linnaeus 1758) aus der Gattung der Moosjungfern (Odonata: Libellulidae) Foto: Axel Conrad 26 pulationsdivergenz von Individuen des Moskitofischs (Gambusia affinis) in Körperform und Schwimmstoßgeschwindigkeit. Individuen aus Habitaten mit Räubern, hier andere piscivore Fische, haben eine muskulösere Schwanzflosse, einen kleineren Kopf und einen generell aquadynamischeren Körper, als Individuen, die in Habitaten ohne Räuber leben. Diese Merkmalskombination ermöglicht es ihnen, effektivere Schwimmstöße zu erzeugen und damit schneller vor angreifenden Fischen zu fliehen [7]. Phänotypische Plastizität hingegen beschreibt die Fähigkeit gleicher Genotypen (z. B. Klone), unterschiedliche Merkmalsausprägungen (Phänotypen) bei wechselnden Umweltbedingungen mit teilweise sehr großer Variabilität auszubilden. Da die genetische Fixierung von Merkmalsausprägungen evolutiv durch neue Allelkombinationen mehrere Generationen (mindestestens jedoch eine) benötigt, bietet phänotypische Plastizität einen selektiven Vorteil gegenüber genetisch fixierten Merkmalen in Lebensräumen, die zeitlich und/oder örtlich heterogen in ihren Umweltbedingungen sind und sich diese auch innerhalb der gleichen oder wenigen Generation ändern können. Beispiele hierfür sind sich ändernde Prädatorenanwesenheit in Gewässern von Überschwemmungsgebieten von Flüssen oder das jahreszeitlich begrenzte Auftreten bestimmter prädatorischer Insekten. Im Tierreich besitzt eine Vielzahl von Arten phänotypisch plastische Merkmale, die einen Prädationsschutz bieten. Voraussetzungen für durch Räuber induzierte Merkmalsunterschiede sind eine zeitliche oder örtliche Variabilität in Prädationsrisiko und -regime, sowie das Vorhandensein einer Art Signalreiz, zum Beispiel chemischer oder visueller Natur. So sind etwa die Larven des Waldfroschs (Rana sylvatica) in Anwesenheit von Räubern, hier Libellenlarven, kleiner, haben kürzere Körper und tiefer
3 HEFT 5 / 64. JAHRGANG / 2015 LIBELLENFORSCHUNG / PdN BIOLOGIE in der Schule Abb. 3: Larven der fünf Europäischen Leucorrhinia-Arten. Von links nach rechts: Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons, Burmeister 1839), Zierliche Moosjungfer (L. caudalis, Charpentier 1840), Große Moosjungfer (L. pectoralis, Charpentier 1825), Kleine Moosjungfer (L. dubia, Vander Linden 1825) und Nordische Moosjungfer (L. rubicunda, Linnaeus 1758) Fotos: Axel Conrad sitzende Schwanzflossen als Larven, die ohne Räuber leben. Dies ermöglicht ihnen ein schnelleres Davonschwimmen und bietet weniger Angriffsfläche [8]. Libellenlarven können als hervorragende Modellorganismen bei der Erforschung von Abwehrmechanismen zum Prädationsschutz von Beutetieren dienen. Libellen verbringen den Großteil ihres Lebens bis zum Schlupf in aquatischen Habitaten (vergleiche Beitrag von Koch und Hesse, S. 4). Diese unterteilen sich generell in drei Habitattypen mit unterschiedlichen Prädationsregimen: (1) Kleine, temporäre Gewässer ohne große Prädatoren; (2) permanente Gewässer, dominiert von invertebraten Prädatoren wie zum Beispiel räuberischen Käfer- und Groß libellenlarven und (3) permanente Gewässer, dominiert von räuberischen Vertebraten wie zum Beispiel Fischen (Abb. 1) [9]. Fische und invertebrate Prädatoren unterscheiden sich deutlich in ihren Jagd- und Verfolgungstaktiken. Während Fische aktiv ihre Beute suchen und diese auch verfolgen können, sind Invertebraten eher Ansitzjäger, welche ruhig auf einer Stelle verharren und ihrer Beute auflauern; nach einer erfolglosen Attacke verfolgen sie ihre Beute nicht. Wegen dieser unterschiedlichen Räuberstrategien, evol vierten bei Beutetieren Unterschiede in der Ausprägung von Merkmalen zum Prädationsschutz in Abhängigkeit ihres jeweiligen Habitats. Besonders gut sind diese Merkmalsunterschiede bei Larven von Libellenarten der Gattung der Moosjungfern (Leucorrhinia) untersucht. Diese leben sowohl in aquatischen Habitaten mit Fischen, als auch mit In vertebraten als Spitzenprädatoren und sollen hier als Beispiel vorgestellt werden (Abb. 2) [10, 11]. 2 Moosjungfern und Prädation Die Gattung der Moosjungfern (Leucorrhinia, Brittinger 1850) gehört zur Unterordnung der Großlibellen (Anisoptera) und umfasst bis zu 14 Arten in Nordamerika und Eurasien [12]. Im Folgenden wird besonders auf die Larven der fünf europäischen Leucorrhinia-Arten eingegangen: Die Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons, Burmeister 1839), die Zier liche Moos jungfer (L. caudalis, Charpentier 1840), die Große Moosjungfer (L. pectoralis, Charpentier 1825), die Kleine Moosjungfer (L. dubia, Vander Linden 1825) und die Nordische Moosjungfer (L. rubicunda, Linnaeus 1758) (Abb. 3). Im Allgemeinen sind die Arten L. albifrons, L. caudalis und L. pectoralis auf die Entwicklung in Habitaten spezialisiert, die von Fischen, zum Beispiel Flussbarschen (Perca fluviatilis, L.), dominiert werden. Leucorrhinia dubia und L. rubicunda hingegen bevorzugen Habitate, in denen räuberische Wirbellose, wie etwa größere Libellenlarven aus der Familie der Edel libellen (Aeshnidae), oder räuberische Käfer, wie der Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis) Spitzenprädatoren sind [10]. Trotz dieser Präferenzen, können die Larven auch in den Habitaten zu finden sein, auf welche sie nicht spezialisiert sind, allerdings mit meist wesentlich niedrigeren Dichten [13]. Viele Studien zeigen, dass die unterschiedlichen Prädationsregime der beiden Habitattypen die Ausprägung verschiedenster adaptiver Schutzmerkmale innerhalb der Gattung Leucorrhinia beeinflusst haben und sich somit sowohl innerartliche als auch zwischenartliche Unterschiede herausbilden konnten. Hierbei ist ebenfalls zwischen fixierten und phänotypisch plastischen Merkmalen zu unterscheiden. Diese Merkmale können in der Gattung der Moosjungfern (Leucorrhina) Morphologie, Physiologie und Verhalten betreffen [13 15]. 2.1 Fixierte Merkmale zum Prädationsschutz Ein Beispiel für fixierte morphologische Merkmalsunterschiede bei Leucorrhinia- Larven aus Habitaten mit unterschiedlichen Spitzenprädatoren ist die Länge von abdominalen. Die auf Habitate mit Fischen spezialisierten Larven (L. albifrons, L. caudalis, L. pectoralis) weisen deutlich längere am Abdomen auf als die Larven, welche Habitate mit dominierenden Invertebraten präferieren (L. dubia, L. rubicunda) [3, 5]. Fische führen in der Regel schnelle Angriffe aus und nutzen den Sog beim Öffnen des Mauls zum Fangen ihrer Beute. Untersuchungen haben gezeigt, dass Leucorrhinia-Larven mit längeren Rückendornen einen Überlebensvorteil haben, wenn Fische sie von hinten attackieren, da sie oft wieder ausgespuckt werden und sich dann in eine geschützte Zuflucht zwischen Pflanzen und Blättern retten können. Gegensätzlich verhält es sich für Angriffe von Invertebraten, wie beispielsweise anderen Libellenlarven, da diese Ansitzjäger sind. Strukturen am Abdomen erleichtern das Ergreifen durch die Mundwerkzeuge der Räuber eher und sind somit nachteilig (Abb. 4). Larven, die in fischfreien Habitaten leben, bilden daher kürzere oder gar keine am Abdomen aus (Abb. 5) [5, 14]. Ein weiteres Beispiel für fixierte Unterschiede in der Merkmalsausprägung innerhalb der Gattung Leucorrhinia betrifft die Morphologie, die Physiologie und sogar das Verhalten. Wie alle Großlibellenlarven, können auch Leucorrhinia-Larven nach einem Angriff von Feinden durch schnelles Davonschwimmen fliehen, indem sie Atemwasser aus der Kiemenkammer des Enddarmes durch den Anus stoßartig herauspressen. Der Strahlantrieb erfolgt hierbei mittels Kontraktion spezieller dorso-ventraler und longitudinaler Muskeln, die Wasser aus der im Hinterleib (Abdomen) befindlichen Kammer drücken. Somit kann ein kraftvoller Wasserstrahl erzeugt werden, welcher die Larven geradezu raketenartig vorwärts treibt [16]. Die unterschiedlichen Jagdstrategien der Prädatorentypen in aquatischen Habitaten haben dazu geführt, dass Leucorrhinia-Larven, die mit Fischen vorkommen, eine höhere Schwimmstoßgeschwindigkeit evolvierten als solche, die mit invertebraten Spitzenprädatoren leben. Dies ist selektiv vorteilhaft, da die Larven eine zweite Chance zur schnellen Flucht ha- 27
4 PdN BIOLOGIE in der Schule / LIBELLENFORSCHUNG HEFT 5 / 64. JAHRGANG / 2015 Evolution zum Schutz vor bestimmten Räubertypen als adaptiv erwiesen haben. Fixierte Merkmale können allerdings mit gewissen Kosten verbunden sein, zum Beispiel Produktionskosten bei der Ausbildung von morphologischen Merkmalen wie abdominalen. Im Falle der Libellenlarven besteht zudem das Risiko, nicht im bevorzugten Habitattyp zu schlüpfen, da adulte Libellen häufig von ihren Schlupfgewässern abwandern und ihre Eier unabhängig vom vorhandenen Prädationsregime ablegen. Eine gewisse Variabilität im Prädationsschutz kann sich also präadaptiv als vorteilhaft für die Larven erweisen [4, 21]. Abb. 4: Grosslibellenlarve der Blaugrünen Mosaikjungfer (Aesna cyanea) fängt eine bedornte Larve der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) mit ihrer ausklappbaren Fangmaske Zeichnung: Axel Conrad ben, wenn sie von den Fischen aufgrund der wieder ausgespuckt werden und sich zwischen Blättern vor den sie verfolgenden Fischen verstecken können. Bei invertebraten Prädatoren ist dies nicht in dieser Stärke evolviert, da invertebrate Prädatoren ihre Beute nach einem missglückten Attacke nicht verfolgen. Das Verhalten, bei Fischattacken über kraftvolle Schwimmstöße zu entkommen, ist beispielsweise auch bei Tintenfischen zu beobachten [15, 17]. Die Antriebsgeschwindigkeit der Schwimmstöße hängt dabei von der Muskelmasse und der Größe der Kiemenkammer ab [18, 19]. Es ist somit davon auszugehen, dass Selektion von Fischprädatoren auf erhöhte Schwimmstoßgeschwindigkeit zu einer evolutiven Zunahme an Muskelmasse und Kammervolumen geführt hat, welches sich in einem vergrößerten Abdomen widerspiegeln muss. Erste Studien suggerieren, dass sich die Körperformen von Leucor rhinia-larven aus Habitaten mit unterschiedlichen Spitzenprädatoren tatsächlich in Bezug auf diese Merkmale unterscheiden. Larven, die mit Fischen leben, haben demnach breitere, also voluminösere Abdomina, welche nach hinten schmaler zulaufen, als Larven, die mit inverte braten Räubern leben [20]. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass bei Larven mit höherer Schwimmstoßgeschwindigkeit auch eine schnellere Generierung von Adenosintriphosphat (ATP) erfolgt, bewirkt durch die Erhöhung bestimmter Enzymaktivitäten. Somit können die Energiereserven nach den kurzen, aber energiereichen Kontraktionen der Abdomenmuskulatur schnell wieder aufgefüllt werden [12, 15]. Innerhalb der Gattung Leucorrhinia treten also zwischenartliche Merkmalsunterschiede auf, die sich im Laufe der Abb. 5: Charakteristische Abdomen (seitlich und von oben) von Leucorrhinia-Larven aus unterschiedlichen Habitattypen. Links: Breites Abdomen mit langen lateralen und dorsalen von Leucorrhinia caudalis aus Habitat mit Fischen. Rechts: Schmales Abdomen mit kurzen lateralen und ohne dorsale von L. rubicunda aus Habitat mit invertebraten Spitzenprädatoren Zeichnungen: Axel Conrad 2.2 Phänotypisch plastische Merkmale zum Prädationsschutz In der Gattung Leucorrhinia ist derzeit nur eine Art bekannt, welche nachweislich phänotypisch plastischen Prädationsschutz zeigt: Die Kleine Moosjungfer (L. dubia). Zwar gilt L. dubia als spezialisiert auf fischlose Habitate, jedoch variieren die Merkmale der Larven bis zu einem gewissen Grad, wenn sie in Habitaten mit Fischen schlüpfen. Man spricht hier von innerartlichen Merkmalsunterschieden. Zum Beispiel bilden die Larven der Kleinen Moosjungfer zwar generell kürzere abdominale aus, als die auf Fische spezialisierten Arten, allerdings unterscheiden sich die Längen je nach bewohntem Habitattyp. Larven, die mit Fischen leben, haben längere als Larven, die ohne Fische leben [11, 22]. Diese Anpassung ist allerdings ebenfalls mit Kosten verbunden. Die abdominalen werden aus demselben Material gebildet, wie die gesamte Exokutikula der Larven. Werden in Anwesenheit von Fischen längere ausgebildet, fällt die Exoku tikula dafür an anderen Stellen des Körpers dünner aus, was wiederum zu verminderter Stabilität bei den Larven führen kann [23]. Sowohl die länge, als auch die Dicke der Exokutikula von L. dubia-larven sind also phänotypisch plastisch und die jeweilige Ausprägung beider Merkmale basiert auf einem sogenannten adaptiven Kompromiss (trade-off). Genau wie die länge, so ist auch die Schwimmstoßgeschwindigkeit variabel. Die Larven der kleinen Moosjungfer, die in Habitaten mit Fischen leben, zeigen höhere Geschwindigkeiten als die Larven, die mit räuberischen Invertebraten leben. Auch hier kommt es zwar zu innerartlichen Unterschieden, die Geschwindigkeiten der auf Fische spezialisierten Larven (L. albifrons, L. caudalis, L. pectoralis) werden 28
5 HEFT 5 / 64. JAHRGANG / 2015 LIBELLENFORSCHUNG / PdN BIOLOGIE in der Schule jedoch nicht erreicht [15]. Es gilt nun, die Körperform weiter zu untersuchen, um Aufschluss darüber zu gewinnen, ob auch diese phänotypisch plastisch ist für L. dubia-larven aus Habitaten mit unterschiedlichen Prädatorentypen. 3 Fazit Die Untersuchung von Räuber-Beute- Interaktionen spielt eine wichtige Rolle bei der Beantwortung evolutionsbiologischer Fragen. Die Gattung Leucorrhinia kann hierbei auch weiterhin als hervorragendes Modellsystem dienen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass innerhalb dieser nahe verwandten Arten sowohl inner-, als auch zwischenartliche Merkmalsunterschiede zum Prädationsschutz auftreten, die untersucht und teilweise interpretiert werden können. Diese Tatsache kann Hinweise über die Entstehung und Diversifikation von Arten liefern. Trotzdem bleiben auch hier noch viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel konnte phäno typische Plastizität bisher nur für Larven der Kleinen Moosjungfer (L. dubia) nachgewiesen werden, obwohl auch andere der Leucorrhinia-Arten in Habitaten mit Räuber typen vorkommen, auf welche sie nicht spezialisiert sind. Es wäre also naheliegend, dass Plastizität in der gesamten Gattung auftritt. Auch ist es wahrscheinlich, dass viele Merkmale mit einem adaptiven Wert für den Prädationsschutz (sowohl fixierte, als auch plastische), bisher unentdeckt geblieben sind. Es ist anzunehmen, dass weiterführende Untersuchungen des Prädationsschutzes in der Gattung Leucorrhinia, aber auch bei anderen Libellen- und Tierarten, noch viele neue Entdeckungen zu Tage fördern werden. Zukünftige Forschung bleibt hier also unerlässlich für das Verstehen größerer Zusammenhänge. Gewiss ist allerdings, dass die bisherigen Erkenntnisse schon jetzt wichtige Aufschlüsse über Evolutionsprozesse und die Entstehung der Artenvielfalt auf der Erde geliefert haben. 4 Einsatz im Unterricht Das Beispiel der unterschiedlichen längen bei den besprochenen Leucorrhinia-Arten kann im Kurs Evolutionsbiologie der gymnasialen Oberstufe eingesetzt werden, um die Unterschiede zwischen modifikativer und mutativer Merkmalsausbildung zu verdeutlichen. Die umweltabhängige phänotypische Plastizität der längen erschließt sich als Resultat eines konkreten Umwelteinflusses, nämlich der Präsenz verschiedener Prädatoren. Literatur [1] Edmunds, M. (1974) Defence in animals. A survey of anti-predator defences. Longman, Essex, UK [2] Leitz, N., Arnold, M., Leitz, R. (2003) Raupendermatitis durch Eichen-Prozessionsspinner. Der Deutsche Dermatologe 9: [3] Johansson, F., Samuelsson, L. (1994) Fishinduced variation in abdominal spine length of Leucorrhinia dubia (Odonata) larvae. Oecologia 100: [4] Tollrian, R., Harvell, C. D. (1999) The ecology and evolution of inducible defenses. Princeton University Press, Princeton, NJ, USA [5] Mikolajewski, D. J., Johansson, F., Wohlfahrt, B., Stoks, R. (2006) Invertebrate predation selects for the loss of a morphological antipredator trait. Evolution 60: [6] Johansson, F., Mikolajewski, D. J. (2008) Evolution of morphological defences. In: Dragonflies & Damselflies: model organisms for ecological and evolutionary research (Ed. C ordoba Aguilar, A.). Oxford University Press, Oxford, UK, S [7] Langerhans, R. B., Layman, C. A., Shokrollahi, M., Dewitt, T. J. (2004) Predator-driven phenotypic diversification in Gambusia affinis. Evolution 58: [8] Van Buskirk, J., Relyea, R. A. (1989) Selection for phenotypic plasticity in Rana sylvatica tadpoles. Biological Journal of the Linnean Society 65: [9] Wellborn, G. A., Skelly, D. K., Werner, E. E. (1996) Mechanisms creating community structure across a freshwater habitat gradient. Annual Review of Ecology and Systematics 27: [10] Johansson, F., Mikolajewski, D. J. (2008) Evolution of morphological defences. In: Dragonflies & Damselflies: model organisms for ecological and evolutionary research (Ed. C ordoba Aguilar, A.). Oxford University Press, Oxford, UK, S [11] Petrin, Z., Schilling, E. G., Loftin, C. S., Johansson, F. (2010) Predators shape distribution and promote diversification of morphological defenses in Leucorrhinia, Odonata. Evolutionary Ecology 24: [12] Hovmöller, R., Johansson, F. (2004) A phylogenetic perspective on larval spine morphology in Leucorrhinia (Odonata: Libellulidae) based on ITS1, 5.8S, and ITS2 rdna sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 30: [13] Mikolajewski, D. J., Johansson, F. (2004) Morphological and behavioral defenses in dragonfly larvae: trait compensation and co-specialization. Behavioral Ecology 15: [14] Mikolajewski, D. J., Rolff, J. (2004) Benefits of morphological defence demonstrated by direct manipulation in larval dragonflies. Evolutionary Ecology Research 6: [15] Mikolajewski, D. J., Block, M. de, Rolff, J., Johansson, F., Beckerman, A. P., Stoks, R. (2010) Predator-driven trait diversification in a dragonfly genus: covariation in behavioral and morphological antipredator defense. Evolution 64: [16] Trueman, E.R. (1980) Aspects of animal movement. Cambride University Press, New York, USA [17] Mill, P. J., Pickard, R.S. (1975) Jet-propulsion in anisopteran dragonfly larvae. Journal of Comparative Physiology 97: [18] Thompson, J. T., Kier, W.M. (2002) Ontogeny of squid mantle function: changes in the mechanics of escape-jet locomotion in the oval squid, Sepioteuthis lessoniana Lesson, Biological Bulletin 203: [19] Bartol, I. K., Krueger, P. S., Thompson, J. T., Stewart, W. J. (2008) Swimming dynamics and propulsive efficiency of squids throughout ontogeny. Integrative and Comparative Biology 48: [20] Rüsen, L. (2014) Predators select for abdominal body shape differences in dragonfly larvae of the genus Leucorrhinia. Bachelor Thesis, Freie Universität Berlin. [21] McPeek, M. A. (1989) Differential dispersal tendencies among Enallagma damselflies (Odonata) inhabiting different habitats. Oikos 56: [22] Arnqvist, G., Johansson, F. (1998) Ontogenetic reaction norms of predator-induced defensive morphology in dragonfly larvae. Ecology 79: [23] Flenner, I., Olne, K., Suhling, F., Sahlén, G. (2009) Predator-induced spine length and exocuticle thickness in Leucorrhinia dubia (Insecta: Odonata): a simple physiological trade-off? Ecological Entomology 34: Anschriften der Verfasser Linda Rüsen, Neufertstraße 23, Berlin, linda.ruesen@web.de Axel Conrad, Karolinenstr. 12, Ansbach, axel_conrad@gmx.de Dr. Dirk. J. Mikolajewski, Freie Universität Berlin, Institut für Biologie, Königin-Luise-Str. 1 3, Berlin, d.mikolajewski@gmx.de 29
6 Stachelige Viecher mit Raketenantrieb Die Larven von Libellen der Gattung Leucorrhinia (Moosjungfern) leben in verschiedenen Stillgewässern. Sie halten sich in der Regel in der Vegetation auf, wo sie kleine Insektenlarven oder schwimmende Kleinkrebse fressen. Die Larven selbst werden von Fischen und Großlibellenlarven erbeutet. Fische führen in der Regel schnelle Angriffe von hinten aus und nutzen den Sog beim Öffnen des Mauls zum Fangen ihrer Beute. Stellen sie fest, dass die Beute nicht geeignet ist, spucken sie diese wieder aus. Großlibellenlarven sind meist Ansitzjäger, die ihrer Beute auflauern. Die Haken ihrer ausklappbaren Fangmaske ergreifen das Beutetier, das anschließend gefressen wird. Wird die Beute mit einem Fangmaskenschlag nicht gefangen, warten die Räuber am Ort, bis erneut ein Beutetier in die Nähe ihres Kopfes gelangt. Im Vergleich zu Fischen stellen sie ihrer Beute nicht nach. Je nach den vorherrschenden Hauptprädatoren, die ebenfalls in den Entwicklungsgewässern leben, zeigen sich bei den verschiedenen Leucorrhinia-Arten morphologische und verhaltensbiologische Angepasstheiten. Dazu gehören unter anderem die unterschiedliche Ausprägungen lateraler (seitlicher) und dorsaler (rückenseitiger) spitzer des Hinterleibes (Abb. 1). Durch den Rückstoß eines aus der Atemhöhle im Hinterleib ausgepressten Wasserstrahls (Strahlstoß) können die Larven sich sehr schnell bewegen, um sich vor Räubern in Sicherheit zu bringen (Abb. 2). Material 1a PdN BIOLOGIE in der Schule / LIBELLENFORSCHUNG 5 / 64. JAHRGANG / 2015 Abb. 1: bedornte Leucorrhinia-Larve Abb. 2: Rückstoßschwimmen mit dem Strahlstoß Beobachtungen in der Natur Die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) ist eher auf fischlose Habitate spezialisiert. In diesen Habitaten sind andere Libellenlarven die Haupträuber der Moosjungfern. Kleine Moosjungfern können in geringen Individuenzahlen aber auch in Fischgewässern leben. Durch die Vermessung einer großen Zahl von Larven verschiedener Leucorrhinia-Arten konnten Wissenschaftler folgende Zusammenhänge beschreiben: Larven von Leucorrhinia dubia 1) bilden kürzere abdominale aus als die Larven der anderen Leucorrhinia-Arten. 2), die in Fischgewässern aufwachsen, haben längere, als Larven, die ohne Fische leben. 3), die in Gewässern mit Großlibellen leben, haben kürzere, als Larven, die in Fischgewässern leben. a Prozent ausgespuckter Larven Abb. 3: Prädationsversuche an Larven von Leucorrhinia caudalis. a) Häufigkeit des Ausspuckens von Larven durch Fische (Barsche), b) Überlebensrate bei Anwesenheit von Großlibellenlarven Dorsale und laterale Nur dorsale Nur laterale b Überleben (%) Ohne Mit
7 PdN BIOLOGIE in der Schule / LIBELLENFORSCHUNG 5 / 64. JAHRGANG / 2015 Die Fähigkeit gleicher Genotypen, unterschiedliche Phänotypen bei wechselnden Umweltbedingungen auszubilden, wird als phänotypische Plastizität bezeichnet. Sie ist eine Form der Modifikation. Da die durch Mutationen entstandene Merkmalsausprägung evolutiv durch neue Allelkombinationen mehrere Generationen (mindestestens jedoch eine) benötigt, bietet phänotypische Plastizität einen selektiven Vorteil gegenüber genetisch festgelegten Merkmalen. Laborexperimente I und II In Abbildung 3 A und B sind die Ergebnisse von Laborexperimenten zur Prädation an Larven der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) durch Fische und Großlibellenlarven dargestellt. Leucorrhinia caudalis-larven sind stark bedornt. Den Versuchstieren wurden in Abhängigkeit der zu prüfenden Hypothese vor Versuchsbeginn die operativ entfernt. Laborexperiment III Die Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Messung des Strahlstoßes ausgepressten Atemwassers verschiedener Leucorrhinia-Arten. Material 1b 300 Schwimmstoß-Geschwindigkeit in mm/s L. albifrons L. caudalis L. pectoralis L. rubicunda L.dubia L.dubia Abb. 4: Messung des Strahlstoßes bei Larven verschiedener Leucorrhinia-Arten. Dunkle Balken: Arten von Fischgewässern mit langen, weiße Balken: Arten von Gewässern mit Großlibellenlarven und mit kurzen, schraffierter Balken: Larven von Leucorrhinia dubia aus einem Fischgewässer Aufgaben: 1. Formulieren Sie für alle drei Versuche die zu prüfenden Hypothesen. 2. Entwickeln Sie mögliche Versuchsdesigns, deren erfolgreiche Durchführung zu diesen Ergebnissen geführt haben könnten. 3. Beschreiben und interpretieren Sie die Ergebnisse. 4. Erläutern Sie die Vorteile der phänotypischen Plastizität am Beispiel des dargestellten Phänomens unterschiedlicher längen bei Larven von Leucorrhinia dubia. 31
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis
 Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
Evolutionsfaktoren. = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer Population bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen
 Evolutionsfaktoren 1 Genpool = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen gleich: keine Mutationen alle Individuen sind für Umweltfaktoren
Evolutionsfaktoren 1 Genpool = Gesamtheit der Gene aller Individuen einer bleibt nach dem HARDY-WEINBERG-Gesetz unter folgenden Bedingungen gleich: keine Mutationen alle Individuen sind für Umweltfaktoren
Phänotypische Plastizität bei Kaulquappen des Europäischen Laubfrosches, Hyla arborea.
 Phänotypische Plastizität bei Kaulquappen des Europäischen Laubfrosches, Hyla arborea. Claudia Lemcke Dissertation der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität Phänotypische Plastizität
Phänotypische Plastizität bei Kaulquappen des Europäischen Laubfrosches, Hyla arborea. Claudia Lemcke Dissertation der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität Phänotypische Plastizität
Evolution. Biologie. Zusammenfassungen. Semesterprüfung Freitag, 17. Juni Evolutionstheorien Lamarck/Darwin. Evolutionsfaktoren
 Biologie Evolution Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Evolutionstheorien Lamarck/Darwin Evolutionsfaktoren Auswirkungen der Selektion Artbildung Phylogenie Steffi ENTHÄLT INHALTE
Biologie Evolution Zusammenfassungen Semesterprüfung Freitag, 17. Juni 2016 Evolutionstheorien Lamarck/Darwin Evolutionsfaktoren Auswirkungen der Selektion Artbildung Phylogenie Steffi ENTHÄLT INHALTE
Mechanismen der Evolution. Übersicht. Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation
 Mechanismen der Evolution 1 Übersicht Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation 2 Jean Baptiste de LAMARCK... der häufige Gebrauch eines
Mechanismen der Evolution 1 Übersicht Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation 2 Jean Baptiste de LAMARCK... der häufige Gebrauch eines
Umweltwissenschaften: Ökologie
 Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Umweltwissenschaften: Ökologie Atmung und Gärung Quelle der Graphik: http://de.wikipedia.org/wiki/zellatmung Atmung C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 >>> 6 CO 2 + 6 H 2 O [30 ATP] G = - 2870 kj /mol Milchsäure G. C
Larve von Aeshna spec. (Odonata: Aeshnidae) als Beute des Südlichen Wasserschlauchs Utricularia australis
 Larve von Aeshna spec. als Beute des Wasserschlauchs 20. Dezember 2013 181 Larve von Aeshna spec. (Odonata: Aeshnidae) als Beute des Südlichen Wasserschlauchs Utricularia australis Juliana Herzog und Andreas
Larve von Aeshna spec. als Beute des Wasserschlauchs 20. Dezember 2013 181 Larve von Aeshna spec. (Odonata: Aeshnidae) als Beute des Südlichen Wasserschlauchs Utricularia australis Juliana Herzog und Andreas
Hintergrund zur Ökologie von C. elegans
 GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
GRUPPE: NAME: DATUM: Matrikelnr. Genereller Hinweis: Bitte den Text sorgsam lesen, da er Hinweise zur Lösung der Aufgaben enthält! Hintergrund zur Ökologie von C. elegans Der Fadenwurm Caenorhabditis elegans
Übersicht. Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation
 Evolution 1 Übersicht Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation 2 Jean Baptiste de LAMARCK... der häufige Gebrauch eines Organs [stärkt]
Evolution 1 Übersicht Lamarck und Darwin Variation natürliche Selektion, sexuelle, künstliche Gendrift Artbildung adaptive Radiation 2 Jean Baptiste de LAMARCK... der häufige Gebrauch eines Organs [stärkt]
Räuber und Beute. Evolution. b) entkommen. Anpassungen + Gegenanpassungen lange Koexistenz. Anpassungen Räuber und Gegenanpassungen Beute
 Räuber und Beute Evolutionäres Wettrennen Natürliche Selektion Evolution + Effizienz des Räubers Fähigkeit der Beute: a) vor Entdeckung entziehen b) entkommen Anpassungen + Gegenanpassungen lange Koexistenz
Räuber und Beute Evolutionäres Wettrennen Natürliche Selektion Evolution + Effizienz des Räubers Fähigkeit der Beute: a) vor Entdeckung entziehen b) entkommen Anpassungen + Gegenanpassungen lange Koexistenz
AUFGABENSAMMLUNG Lösungen. Laufen: Skelett. Lösungen
 Laufen: Skelett Bei der Fortbewegung spielt das Skelett eine wichtige Rolle. Wirbeltiere zeichnen sich durch ein Innenskelett aus. Beschrifte die Knochen des Hundes. 1 Laufen: Gangarten Die meisten Vierbeiner
Laufen: Skelett Bei der Fortbewegung spielt das Skelett eine wichtige Rolle. Wirbeltiere zeichnen sich durch ein Innenskelett aus. Beschrifte die Knochen des Hundes. 1 Laufen: Gangarten Die meisten Vierbeiner
Innerartliche Variation von Baumarten in der Reaktion auf den Klimawandel. PD Dr. Jürgen Kreyling
 Innerartliche Variation von Baumarten in der Reaktion auf den Klimawandel PD Dr. Jürgen Kreyling Prognosen: Arten im Klimawandel Ø Verlust von 15 37% der Taxa bis 2050 (Thomas et al. 2004 Nature) % Artenverlust
Innerartliche Variation von Baumarten in der Reaktion auf den Klimawandel PD Dr. Jürgen Kreyling Prognosen: Arten im Klimawandel Ø Verlust von 15 37% der Taxa bis 2050 (Thomas et al. 2004 Nature) % Artenverlust
Principles of heredity Mutations, substitutions and polymorphisms
 Bioinformatics 1 Principles of heredity Mutations, substitutions and polymorphisms Claudia Acquisti Evolutionary Functional Genomics Institute for Evolution and Biodiversity, WWU Münster claudia.acquisti@uni-muenster.de
Bioinformatics 1 Principles of heredity Mutations, substitutions and polymorphisms Claudia Acquisti Evolutionary Functional Genomics Institute for Evolution and Biodiversity, WWU Münster claudia.acquisti@uni-muenster.de
Neotropische Biodiversität. Die Bedeutung kryptischer Arten
 Neotropische Biodiversität Die Bedeutung kryptischer Arten Gliederung Definition kryptischer Arten Artkonzepte DNA barcodes distinguish species of tropical Lepidoptera HAJIBABAEI, M. et al., PNAS 2005
Neotropische Biodiversität Die Bedeutung kryptischer Arten Gliederung Definition kryptischer Arten Artkonzepte DNA barcodes distinguish species of tropical Lepidoptera HAJIBABAEI, M. et al., PNAS 2005
AUFGABENSAMMLUNG Lösungen. Homologie, Analogie. Lösungen
 Homologie, Analogie Lebewesen können Übereinstimmungen in ihren Merkmalen haben. Je nach Ursprung dieser Ähnlichkeiten werden sie als homolog oder analog bezeichnet. Ordne die Kennzeichen von homologen
Homologie, Analogie Lebewesen können Übereinstimmungen in ihren Merkmalen haben. Je nach Ursprung dieser Ähnlichkeiten werden sie als homolog oder analog bezeichnet. Ordne die Kennzeichen von homologen
Die Evolution der Lebensgeschichte
 Die Evolution der Lebensgeschichte Barbara Taborsky Teil 1: Konzepte und Begriffe der Lebensgeschichtstheorie Teil 2: Trade-offs 1 Teil 1: Konzepte und Begriffe Fragen der Lebensgeschichtstheorie Constraints
Die Evolution der Lebensgeschichte Barbara Taborsky Teil 1: Konzepte und Begriffe der Lebensgeschichtstheorie Teil 2: Trade-offs 1 Teil 1: Konzepte und Begriffe Fragen der Lebensgeschichtstheorie Constraints
Biologie. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Bonn schulinternes Curriculum. Unterrichtsvorhaben: Materialhinweise:
 Jahrgang 5 UV 1: Vielfalt von Lebewesen / Vom Wild- zum Nutztier UV 2: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Bewegungssystem UV 3: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Ernährung und Verdauung
Jahrgang 5 UV 1: Vielfalt von Lebewesen / Vom Wild- zum Nutztier UV 2: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Bewegungssystem UV 3: Bau und Leistung des menschlichen Körpers / Ernährung und Verdauung
Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop; biotische und abiotische Faktoren am Beispiel des Ökosystemes Wald
 Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Jahrgang: Klasse 8 Fach: Biologie Inhaltsfelder Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Interne rgänzungen Grundbegriffe der Ökologie Ökologie, Art, Population, Biozönose, Ökosystem, Biotop;
Wenn es hell wird, suchen sie das Dunkle:
 Wenn es hell wird, suchen sie das Dunkle: Wie künstliche Beleuchtung Fledermausverhalten beeinflusst Studien im Bereich der Segeberger Kalkberghöhle in Schleswig-Holstein MSc Valerie Linden, Fledermaus-Zentrum
Wenn es hell wird, suchen sie das Dunkle: Wie künstliche Beleuchtung Fledermausverhalten beeinflusst Studien im Bereich der Segeberger Kalkberghöhle in Schleswig-Holstein MSc Valerie Linden, Fledermaus-Zentrum
Ökologie der Biozönosen
 Konrad Martin Ökologie der Biozönosen Zeichnungen von Christoph Allgaier Mit 135 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einführung,'. 1 1.1 Arten, Umwelt und Biozönosen 1 1.2 Definitionen der Interaktionen
Konrad Martin Ökologie der Biozönosen Zeichnungen von Christoph Allgaier Mit 135 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis 1 Einführung,'. 1 1.1 Arten, Umwelt und Biozönosen 1 1.2 Definitionen der Interaktionen
Spiel 1: Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel
 Spiel : Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel Spielbrett, Box Genpool, Taschenrechner Wichtig! Das Spiel wird fünf Runden gespielt!. Ziehen Sie aus dem Genpool ohne Hinschauen insgesamt 54 Individuen.
Spiel : Spielerische Simulation der Hardy-Weinberg-Regel Spielbrett, Box Genpool, Taschenrechner Wichtig! Das Spiel wird fünf Runden gespielt!. Ziehen Sie aus dem Genpool ohne Hinschauen insgesamt 54 Individuen.
Wann rasche Evolution eine Rolle spielt When rapid evolution matters
 Wann rasche Evolution eine Rolle spielt When rapid evolution matters Becks, Lutz Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Plön Korrespondierender Autor E-Mail: lbecks@evolbio.mpg.de Zusammenfassung
Wann rasche Evolution eine Rolle spielt When rapid evolution matters Becks, Lutz Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Plön Korrespondierender Autor E-Mail: lbecks@evolbio.mpg.de Zusammenfassung
Ökologie. basics. 103 Abbildungen 52 Tabellen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart
 Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Ökologie 103 Abbildungen 52 Tabellen basics Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Inhaltsverzeichnis 100* «HS- S>J.S(;HC LAN'f.:tS- UND \ Vorwort 8 1 Was ist Ökologie? 10 1.1 Teilgebiete der Ökologie 10 1.2 Geschichte
Von der Mikro- zur Makroevolution... (1) Einige Bemerkungen zur Evolution von Organen und der höheren Taxa
 Von der Mikro- zur Makroevolution... (1) Einige Bemerkungen zur Evolution von Organen und der höheren Taxa Wie funktioniert Evolution im Kleinen? Evolution beinhaltet nicht nur Artbildung, sondern auch
Von der Mikro- zur Makroevolution... (1) Einige Bemerkungen zur Evolution von Organen und der höheren Taxa Wie funktioniert Evolution im Kleinen? Evolution beinhaltet nicht nur Artbildung, sondern auch
Module der AG Molekulare Zoologie für Biologie
 Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt Module der AG Molekulare Zoologie für Biologie Modulname ECTS Lehrveranstaltung Sem Dozent Evolution, Biodiversität und Biogeographie
Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt Module der AG Molekulare Zoologie für Biologie Modulname ECTS Lehrveranstaltung Sem Dozent Evolution, Biodiversität und Biogeographie
3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch!
 1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
1 3, 2, 1 los! Säugetiere starten durch! Die Vielfalt an Säugetieren ist unglaublich groß. Sie besiedeln fast alle Teile der Erde und fühlen sich in Wüsten, Wasser, Wald und sogar in der Luft wohl. Aber
Sound of Rivers. Tonolla Diego. Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs
 Sound of Rivers Tonolla Diego Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs - Hydrologische, ökologische und visuelle Aspekte von Fliessgewässern sind gut untersucht die akustische Ausprägung wurde
Sound of Rivers Tonolla Diego Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs - Hydrologische, ökologische und visuelle Aspekte von Fliessgewässern sind gut untersucht die akustische Ausprägung wurde
Die Fülle der Hülle Alternative Nachweismöglichkeiten bei seltener Mottenart. Anett Richter
 Die Fülle der Hülle Alternative Nachweismöglichkeiten bei seltener Mottenart Anett Richter 14. UFZ Workshop zur Populationsbiologie von Tagfaltern & Widderchen (und einer Motte) Überblick Nachweise durch
Die Fülle der Hülle Alternative Nachweismöglichkeiten bei seltener Mottenart Anett Richter 14. UFZ Workshop zur Populationsbiologie von Tagfaltern & Widderchen (und einer Motte) Überblick Nachweise durch
biotischen Umweltfaktoren im Ökosystem Wald (Auswahl) Gewässer als Ökosysteme Projekt: Der See als Ökosystem gewusst gekonnt...
 Inhaltsverzeichnis Bio 9 /10 3 Inhaltsverzeichnis 1 Ökologie... 8 1.1 Struktur und Vielfalt von Ökosystemen... 9 1 Lebensraum und abiotische Umweltfaktoren... 10 Lebensraum und biotische Umweltfaktoren...
Inhaltsverzeichnis Bio 9 /10 3 Inhaltsverzeichnis 1 Ökologie... 8 1.1 Struktur und Vielfalt von Ökosystemen... 9 1 Lebensraum und abiotische Umweltfaktoren... 10 Lebensraum und biotische Umweltfaktoren...
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution
 1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
1 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q2 Evolution 1 Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen Evolution Evolutionstheorien LK Evolutionstheorie Biodiversität und Systematik Entwicklung
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer. Arbeitsblätter. mit Lösungen
 Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Mobile Museumskiste Artenvielfalt Lebensraum Gewässer Arbeitsblätter mit Lösungen WAHR und UNWAHR 1. Gelbrandkäfer holen mit dem Hintern Luft! 2. Muscheln suchen sich eine neue, größere Schale, wenn sie
Den molekularen Ursachen der Evolution auf der Spur
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/den-molekularen-ursachender-evolution-auf-der-spur/ Den molekularen Ursachen der Evolution auf der Spur Seit Darwin
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/den-molekularen-ursachender-evolution-auf-der-spur/ Den molekularen Ursachen der Evolution auf der Spur Seit Darwin
Legekreis. "Heimische Insekten"
 Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Legekreis "Heimische Insekten" Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Ameisen Ameisen leben in großen Staaten und jede Ameise hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ameisen haben sechs
Komplexität in der Ökologie
 Komplexität in der Ökologie Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems by Simon A. Levin (1998) Resilience and Stability of ecological Systems by C. S. Holling (1973) Inhaltsverzeichnis Vorstellung
Komplexität in der Ökologie Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems by Simon A. Levin (1998) Resilience and Stability of ecological Systems by C. S. Holling (1973) Inhaltsverzeichnis Vorstellung
Artentstehung Artensterben: Die kurzund langfristige Perspektive der Evolution
 KERNER VON MARILAUN VORTRÄGE 2014 Artentstehung Artensterben: Die kurzund langfristige Perspektive der Evolution Christian Sturmbauer Institut für Zoologie, Karl-Franzens-Universität Graz Struktur des
KERNER VON MARILAUN VORTRÄGE 2014 Artentstehung Artensterben: Die kurzund langfristige Perspektive der Evolution Christian Sturmbauer Institut für Zoologie, Karl-Franzens-Universität Graz Struktur des
Modulübersicht. für den Masterstudiengang. Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.)
 Modulübersicht für den Masterstudiengang Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.) Stand: 2016 Erläuterung zu den folgenden Modulbeschreibungen: G Grundmodul (Pflichtmodul) A* Aufbaumodul (Wahlpflichtmodul,
Modulübersicht für den Masterstudiengang Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.) Stand: 2016 Erläuterung zu den folgenden Modulbeschreibungen: G Grundmodul (Pflichtmodul) A* Aufbaumodul (Wahlpflichtmodul,
Schulmaterial Haie und Rochen
 Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
Schulmaterial Haie und Rochen Informationen für Lehrer und Schüler Haie und Rochen Jeder hat in Film und Fernsehen schon einmal einen Hai oder einen Rochen gesehen. Meist bekommt man hier die Bekanntesten
8. Evolution (Teil II): Koevolution
 8. Evolution (Teil II): Koevolution Darwinsche Evolution bedeutet zunächst einmal Konkurrenz wie können mehrere Arten gemeinsam evolvieren? was passiert, wenn die Arten ihre Fitnesslandschaften gegenseitig
8. Evolution (Teil II): Koevolution Darwinsche Evolution bedeutet zunächst einmal Konkurrenz wie können mehrere Arten gemeinsam evolvieren? was passiert, wenn die Arten ihre Fitnesslandschaften gegenseitig
Gliederung. Informationsgrundlage Probleme EOL Schätzungsmöglichkeiten Beschriebene + geschätzte Artenzahl Ausblick
 How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
How Many Species are There on Earth? Lehrveranstaltung: Biodiversität ität und Nachhaltigkeit it Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Sonja Pfister Datum: 12.11.2009 11 2009 Gliederung Informationsgrundlage
Schleswig-Holstein 2008 Leistungskurs Biologie Thema: Entwicklung und Veränderung lebender Systeme. Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees
 Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge
 Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
Diskrete dynamische Systeme in der Populationsgenetik Hofbauer J., und Sigmund K.: Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge Dominik Urig Saarbrücken, den 10.01.2012 Inhaltsangabe 1 Biologische
On the nature of pleiotropy and its role for adaptation
 Research Collection Doctoral Thesis On the nature of pleiotropy and its role for adaptation Author(s): Polster, Robert Publication Date: 2013 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010006485 Rights
Research Collection Doctoral Thesis On the nature of pleiotropy and its role for adaptation Author(s): Polster, Robert Publication Date: 2013 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-010006485 Rights
Was sind Arten und wie entstehen Sie?
 Was sind Arten und wie entstehen Sie? Weidenlaubsänger Fitislaubsänger Rakelkrähe Rabenkrähe Nebelkrähe westlich der Elbe östlich der Elbe Die Frage, was Arten sind und wie Arten entstehen, war lange Zeit
Was sind Arten und wie entstehen Sie? Weidenlaubsänger Fitislaubsänger Rakelkrähe Rabenkrähe Nebelkrähe westlich der Elbe östlich der Elbe Die Frage, was Arten sind und wie Arten entstehen, war lange Zeit
Evolutionspsychologische Emotionstheorien I: Grundlagen
 Evolutionspsychologische Emotionstheorien I: Grundlagen 2. Vererbung 3. natürliche Patricia Buggisch Justus-Liebig-Universität Gießen 2006 2. Vererbung 3. natürliche Einleitung - Biologische Evolution
Evolutionspsychologische Emotionstheorien I: Grundlagen 2. Vererbung 3. natürliche Patricia Buggisch Justus-Liebig-Universität Gießen 2006 2. Vererbung 3. natürliche Einleitung - Biologische Evolution
Grundlagen der Vererbungslehre
 Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
Grundlagen der Vererbungslehre Zucht und Fortpflanzung Unter Zucht verstehen wir die planvolle Verpaarung von Elterntieren, die sich in ihren Rassemerkmalen und Nutzleistungen ergänzen zur Verbesserung
SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG 2007 Biologie (Leistungskursniveau)
 Biologie (Leistungskursniveau) Einlesezeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 300 Minuten Der Prüfling wählt je ein Thema aus den Gebieten G (Grundlagen) und V (Vertiefung) zur Bearbeitung aus. Die zwei zur
Biologie (Leistungskursniveau) Einlesezeit: Bearbeitungszeit: 30 Minuten 300 Minuten Der Prüfling wählt je ein Thema aus den Gebieten G (Grundlagen) und V (Vertiefung) zur Bearbeitung aus. Die zwei zur
Beobachtungen zur Ökologie von Carcharodus stauderi auf Kalymnos
 Beobachtungen zur Ökologie von Carcharodus stauderi auf Kalymnos Martin Albrecht 15. UFZ Workshop zur Populationsbiologie von Tagfaltern & Widderchen Leipzig, 1. März 2013 Inhalt n Einleitung Systematik
Beobachtungen zur Ökologie von Carcharodus stauderi auf Kalymnos Martin Albrecht 15. UFZ Workshop zur Populationsbiologie von Tagfaltern & Widderchen Leipzig, 1. März 2013 Inhalt n Einleitung Systematik
- beschreiben ein ausgewähltes Ökosystem im Wechsel der Jahreszeiten.
 Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum Biologie für die Jahrgangsstufe 8 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 8.1 Inhaltsfelder Energiefluss und Stoffkreisläufe Erkundung und Beschreibung eines
Stadtgymnasium Detmold Schulinternes Curriculum Biologie für die Jahrgangsstufe 8 Stand: 20.06.2016 Klasse / Halbjahr 8.1 Inhaltsfelder Energiefluss und Stoffkreisläufe Erkundung und Beschreibung eines
Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie
 Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 3.1 Lebewesen und Umwelt Ökologische und Präferenz Ökologische (SF) planen ausgehend von
Schulinterner Kernlehrplan Biologie Q1: Ökologie Inhaltsfelder Schwerpunkt Basiskonzept Konkretisierte Kompetenzen 3.1 Lebewesen und Umwelt Ökologische und Präferenz Ökologische (SF) planen ausgehend von
Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards
 Allgemeine Didaktik: Prüfen, Beurteilen, Bewerten Frühjahrssemester 2015 Prof. Dr. Franz Eberle Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards Ergänzende Materialien zu den Folien der Vorlesung 1 Eine
Allgemeine Didaktik: Prüfen, Beurteilen, Bewerten Frühjahrssemester 2015 Prof. Dr. Franz Eberle Inhalte von Lernkontrollen: Kognitive Standards Ergänzende Materialien zu den Folien der Vorlesung 1 Eine
4.3 Unterrichtsmaterialien
 4.3 Unterrichtsmaterialien Jonathan Jeschke und Ernst Peller Material 1: Karten zum Ausdrucken und Ausschneiden Eigenschaften von Säugetieren I 4 Von r-strategen und K-Strategen sowie schnellen und langsamen
4.3 Unterrichtsmaterialien Jonathan Jeschke und Ernst Peller Material 1: Karten zum Ausdrucken und Ausschneiden Eigenschaften von Säugetieren I 4 Von r-strategen und K-Strategen sowie schnellen und langsamen
Joining weed survey datasets for analyses on a European scale a proposal
 Joining weed survey datasets for analyses on a European scale a proposal Jana Bürger Bärbel Gerowitt Crop Health, University Rostock, Germany European Weed Research Society WG Meeting Weeds and Biodiversity
Joining weed survey datasets for analyses on a European scale a proposal Jana Bürger Bärbel Gerowitt Crop Health, University Rostock, Germany European Weed Research Society WG Meeting Weeds and Biodiversity
Neue Studie über unerwartete Auswirkung der Hepatitis-B-Impfung
 Impfstoff-Egoismus mit Folgen Neue Studie über unerwartete Auswirkung der Hepatitis-B-Impfung Gießen (20. Januar 2011) - Ein internationales Forscherteam, darunter die Virusforscher Ulrike Wend und Wolfram
Impfstoff-Egoismus mit Folgen Neue Studie über unerwartete Auswirkung der Hepatitis-B-Impfung Gießen (20. Januar 2011) - Ein internationales Forscherteam, darunter die Virusforscher Ulrike Wend und Wolfram
Modulübersicht. für den Masterstudiengang. Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.)
 Modulübersicht für den Masterstudiengang Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.) Stand: 2014 Erläuterung zu den folgenden Modulbeschreibungen: G Grundmodul (Pflichtmodul) A* Aufbaumodul (Wahlpflichtmodul,
Modulübersicht für den Masterstudiengang Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.) Stand: 2014 Erläuterung zu den folgenden Modulbeschreibungen: G Grundmodul (Pflichtmodul) A* Aufbaumodul (Wahlpflichtmodul,
2 Life histories, Ökologie und Verhalten
 2 Life histories, Ökologie und Verhalten 2.1 Diversität der Life histories und ihre Ursachen 2.2 Evolution von Life histories 2.3 Die wichtigsten Life history-merkmale 2.3.1 Alter und Größe bei der ersten
2 Life histories, Ökologie und Verhalten 2.1 Diversität der Life histories und ihre Ursachen 2.2 Evolution von Life histories 2.3 Die wichtigsten Life history-merkmale 2.3.1 Alter und Größe bei der ersten
Das Mausprojekt: Evolution vor unserer Haustüre Evolution i-n unseren Häuse-rn
 Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie Abteilung: Evolutionsgenetik, Plön Anna Büntge Das Mausprojekt: Evolution vor unserer Haustüre Evolution i-n unseren Häuse-rn Latimeria chalumnae Archaeopteryx
Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie Abteilung: Evolutionsgenetik, Plön Anna Büntge Das Mausprojekt: Evolution vor unserer Haustüre Evolution i-n unseren Häuse-rn Latimeria chalumnae Archaeopteryx
Biodiversität, Klima und Gewässer im Wandel Mark Gessner
 Biodiversität, Klima und Gewässer im Wandel Mark Gessner Eawag, Abteilung Gewässerökologie, Dübendorf gessner@eawag.ch Süsswasser der Erde Fläche Seen,Flüsse: 0.3% Meere 67% Land 33% Süsswasser der Erde
Biodiversität, Klima und Gewässer im Wandel Mark Gessner Eawag, Abteilung Gewässerökologie, Dübendorf gessner@eawag.ch Süsswasser der Erde Fläche Seen,Flüsse: 0.3% Meere 67% Land 33% Süsswasser der Erde
2 Belege für die Evolutionstheorie
 2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
2 Belege für die Evolutionstheorie 2.1 Homologie und Analogie Die systematische Einordnung von Lebewesen erfolgt nach Ähnlichkeitskriterien, wobei die systematischen Gruppen durch Mosaikformen, d.h. Lebewesen
{slide=beispiel: Wirkung von Selektions- und Mutationsdruck beim Coli-Bakterium}
 Wenn man davon ausgeht, dass Mutation und Rekombination andauernd stattfinden, so müsste die Variabilität innerhalb einer Population ständig wachsen. Dem ist aber nicht so, weil sich nur bestimmte Genveränderungen
Wenn man davon ausgeht, dass Mutation und Rekombination andauernd stattfinden, so müsste die Variabilität innerhalb einer Population ständig wachsen. Dem ist aber nicht so, weil sich nur bestimmte Genveränderungen
Abb. 2: Mögliches Schülermodell
 Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Was fliegt denn da? Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Die SuS sammeln Bilder von Insekten, ordnen diese und erzählen und benennen, was sie bereits wissen. Sie suchen gezielt nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ziel
Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Sensitivität als Persönlichkeits- Eigenschaft
 Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Sensitivität als Persönlichkeits- Eigenschaft Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz, 02.09.2017 Übersicht
Biological and Experimental Psychology School of Biological and Chemical Sciences Sensitivität als Persönlichkeits- Eigenschaft Michael Pluess, PhD HSP Kongress, Münsingen, Schweiz, 02.09.2017 Übersicht
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen
 Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Inhalte Klasse 5 Konzeptbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen Biologie eine Naturwissenschaft 1. Womit beschäftigt sich die Biologie? Kennzeichen des Lebendigen bei Pflanzen und Tieren 2. So
Tierarten auf den Galapagosinseln. wie neue Arten entstehen
 VII Evolution Beitrag 4 Wie neue Arten entstehen (Kl. 9/10) 1 von 26 Exotische Tiere auf den Galapagosinseln wie neue Arten entstehen Ein Beitrag von Julia Schwanewedel, Kiel Mit Illustrationen von Julia
VII Evolution Beitrag 4 Wie neue Arten entstehen (Kl. 9/10) 1 von 26 Exotische Tiere auf den Galapagosinseln wie neue Arten entstehen Ein Beitrag von Julia Schwanewedel, Kiel Mit Illustrationen von Julia
Welche Weiher für Amphibien?
 Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
Welche Weiher für Amphibien? Benedikt Schmidt karch benedikt.schmidt@unine.ch Weiher für Amphibien. Weiher für Amphibien bauen hat Tradition ( Biotop ). Das ist gut. Aber warum braucht es Weiher? Und welche?
2) Können Sie allein aus den gegebenen Zahlen ablesen welches der beiden Allele einen Selektionsvorteil besitzt?
 Ihre Namen: Übung 2: Populationsgenetik 2, Drift und Selektion In der Vorlesung haben Sie ein Modell für Selektion kennengelernt. Heute wollen wir uns mit Hilfe von Simulationen intensiver mit den Konsequenzen
Ihre Namen: Übung 2: Populationsgenetik 2, Drift und Selektion In der Vorlesung haben Sie ein Modell für Selektion kennengelernt. Heute wollen wir uns mit Hilfe von Simulationen intensiver mit den Konsequenzen
Top Science Goes to Germany
 Alexander von Humboldt S t i f t u n g / F o u n d a t i o n Top Science Goes to Germany Sofja Kovalevskaja-Preis Junge Nachwuchswissenschaftler/innen aus aller Welt und ihre Forschungskooperationen in
Alexander von Humboldt S t i f t u n g / F o u n d a t i o n Top Science Goes to Germany Sofja Kovalevskaja-Preis Junge Nachwuchswissenschaftler/innen aus aller Welt und ihre Forschungskooperationen in
Beschreiben Sie in eigenen Worten die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Gendrift, Isolation und Separation.
 smechanismen (1) Beschreiben Sie in eigenen Worten die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Gendrift, Isolation und Separation. Gemeinsamkeiten: Gendrift, Isolation und Separation führen mit hoher
smechanismen (1) Beschreiben Sie in eigenen Worten die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Gendrift, Isolation und Separation. Gemeinsamkeiten: Gendrift, Isolation und Separation führen mit hoher
A.6 Altruismus, Egoismus
 Entwurf eines Beitrags für Evolution: Ein interdisziplinäres Handbuch, herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart. A.6 Altruismus, Egoismus Als evolutionsbiologische
Entwurf eines Beitrags für Evolution: Ein interdisziplinäres Handbuch, herausgegeben von Philipp Sarasin und Marianne Sommer. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart. A.6 Altruismus, Egoismus Als evolutionsbiologische
An Experimental Study of Inbreeding Depression in a Natural Habitat
 An Experimental Study of Inbreeding Depression in a Natural Habitat Vorlesung: Biodiversität und Naturschutz Semester: WS 09/10 Studiengang: Umweltwissenschaften Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Elisabeth
An Experimental Study of Inbreeding Depression in a Natural Habitat Vorlesung: Biodiversität und Naturschutz Semester: WS 09/10 Studiengang: Umweltwissenschaften Dozent: Dr. H. Schulz Referentin: Elisabeth
1 Regeln der Vererbung
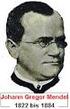 1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
1 Regeln der Vererbung Natura Genetik 1 Regeln der Vererbung Lösungen zu den Aufgaben Seiten 6 7 1.1 Eltern geben genetisches Material weiter 1 Erstelle einen möglichen Karyogrammausschnitt für ein weiteres
Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie Seiten
 Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Vorschlag für das Schulcurriculum bis zum Ende der Klasse 8 Auf der Grundlage von (Die zugeordneten Kompetenzen finden Sie in der Übersicht Kompetenzen ) Zeitliche Zuordnung (Vorschlag) Kompetenzen Wissen.Biologie
Themen im Jahrgang 5 Oberschule.
 B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
B B I O L O G I E Themen im Jahrgang 5 Oberschule. PRISMA Biologie 5/6 Niedersachsen Differenzierende Ausgabe, Klett Verlag Unterrichtserteilung: 2 Stunden pro Woche / ganzjährig Womit beschäftigt sich
Die Medelschen Regeln
 Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
Die Medelschen Regeln Der erste Wissenschaftler, der Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung fand und formulierte, war Johann Gregor Mendel Mendel machte zur Erforschung der Vererbung Versuche und beschränkte
Bromelien-Expedition
 Bromelien-Expedition Klassenstufe: Sekundarstufe I Benötigte Zeit: 30 Minuten Materialien: 6-7 Klemmbretter 6-7 Bleistifte 6-7 Verschiedene Bromelienarten Überblick: Die Schüler/innen suchen anhand von
Bromelien-Expedition Klassenstufe: Sekundarstufe I Benötigte Zeit: 30 Minuten Materialien: 6-7 Klemmbretter 6-7 Bleistifte 6-7 Verschiedene Bromelienarten Überblick: Die Schüler/innen suchen anhand von
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Biologie
 Hans-Ehrenberg-Schule Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Biologie Auszug Übersichtsraster Inhalt Stand: April 2016 1 Einführungsphase (EF) GK: Das Leben der Zellen Unterrichtsvorhaben
Hans-Ehrenberg-Schule Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Biologie Auszug Übersichtsraster Inhalt Stand: April 2016 1 Einführungsphase (EF) GK: Das Leben der Zellen Unterrichtsvorhaben
Zooschule Artenschutz
 Zooschule Der Zoo Leipzig beging im Jahr 2008 sein 130-jähriges Jubiläum und befindet sich derzeit in seiner größten Umgestaltungsphase. Seit 2001 lädt die Welt der Menschenaffen, das Pongoland, die Besucher
Zooschule Der Zoo Leipzig beging im Jahr 2008 sein 130-jähriges Jubiläum und befindet sich derzeit in seiner größten Umgestaltungsphase. Seit 2001 lädt die Welt der Menschenaffen, das Pongoland, die Besucher
Geschichte und Herkunft
 Geschichte und Herkunft 15 den Menschen auch die anderen Gebiete der Erde besiedelten. So konnte auch klar nachgewiesen werden, dass alle Hunde des amerikanischen Kontinents von den in Europa und Asien
Geschichte und Herkunft 15 den Menschen auch die anderen Gebiete der Erde besiedelten. So konnte auch klar nachgewiesen werden, dass alle Hunde des amerikanischen Kontinents von den in Europa und Asien
SE Biogeografie und Biodiversität der Neotropis WS 2006 Maria Burgstaller
 Mimikry bei neotropischen Schmetterlingen SE Biogeografie und Biodiversität der Neotropis WS 2006 Maria Burgstaller Mimikry drei Rollen: Model, dient als Vorbild Nachahmer Getäuschte, meist Prädatoren
Mimikry bei neotropischen Schmetterlingen SE Biogeografie und Biodiversität der Neotropis WS 2006 Maria Burgstaller Mimikry drei Rollen: Model, dient als Vorbild Nachahmer Getäuschte, meist Prädatoren
Which habitats in core areas of ecological networks in Germany are most affected by climate change?
 Which habitats in core areas of ecological networks in Germany are most affected by climate change? Katrin Vohland Potsdam Institute for Climate Impact Research In cooperation with: Supported by: Which
Which habitats in core areas of ecological networks in Germany are most affected by climate change? Katrin Vohland Potsdam Institute for Climate Impact Research In cooperation with: Supported by: Which
4.5 Lösungen zu den Unterrichtsmaterialien
 4.5 Lösungen zu den Unterrichtsmaterialien Material 1: Karten zum Ausdrucken und Ausschneiden Eigenschaften von Säugetieren Jonathan Jeschke und Ernst Peller I 4 Von r-strategen und K-Strategen sowie schnellen
4.5 Lösungen zu den Unterrichtsmaterialien Material 1: Karten zum Ausdrucken und Ausschneiden Eigenschaften von Säugetieren Jonathan Jeschke und Ernst Peller I 4 Von r-strategen und K-Strategen sowie schnellen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 2015
 K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
K l a u s u r Diversität der Organismen und Lebensräume SoSe 015 Donnerstag, den. Juli 015, 14:00 15:00 Uhr Name: (deutlich in Blockschrift schreiben) Matrikelnummer: (wichtig: unbedingt angeben!) Kreuzen
Archiv der Jahrestagungen der VAAM
 Archiv der Jahrestagungen der VAAM Bochum, 8.-11.3.2009 Mitglieder: 3229 Teilnehmer: 1342 Themen: Microbial Cell Biology :: Green Microbiology :: Sensory and Regulatory RNA :: Host-microbe Interactions
Archiv der Jahrestagungen der VAAM Bochum, 8.-11.3.2009 Mitglieder: 3229 Teilnehmer: 1342 Themen: Microbial Cell Biology :: Green Microbiology :: Sensory and Regulatory RNA :: Host-microbe Interactions
Liste der angebotenen Praktika
 Liste der angebotenen Praktika Im Folgenden finden Sie die Liste der angebotenen Praktika, die zu den jeweils genannten Uhrzeiten stattfinden. Die einzelnen Praktika dauern 45 Minuten. Da der Platz in
Liste der angebotenen Praktika Im Folgenden finden Sie die Liste der angebotenen Praktika, die zu den jeweils genannten Uhrzeiten stattfinden. Die einzelnen Praktika dauern 45 Minuten. Da der Platz in
10 Augensprache. Funktioniert nur bei nahen Verwandten
 10 Augensprache Funktioniert nur bei nahen Verwandten Wir Menschen verstehen bis zu einem gewissen Grad die Augenmimik unserer nächsten Verwandten. Untereinander können wir eine ganze Reihe von Gemütszuständen
10 Augensprache Funktioniert nur bei nahen Verwandten Wir Menschen verstehen bis zu einem gewissen Grad die Augenmimik unserer nächsten Verwandten. Untereinander können wir eine ganze Reihe von Gemütszuständen
 NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
NwT 9: Wald Pflanzen und Tiere Ökosystem Wald und Mensch Nutzung Naturschutz Artenkenntnis, Artenvielfalt; Wechselbeziehungen Waldformen, Biotope, Anpassungen von Pfl. u. Tieren; Nahrungsketten, Energiekreisläufe
Operantes Konditionieren
 Operantes Konditionieren Prof. Dr. Hermann Körndle Professur für die Psychologie des Lehrens und Lernens Technische Universität Dresden Operantes Konditionieren Vertreter I - Thorndike Edward Lee Thorndike
Operantes Konditionieren Prof. Dr. Hermann Körndle Professur für die Psychologie des Lehrens und Lernens Technische Universität Dresden Operantes Konditionieren Vertreter I - Thorndike Edward Lee Thorndike
W. Durka, S.G. Michalski
 W. Durka, S.G. Michalski 4.6 Genetische Vielfalt und Klimawandel Der Klimawandel führt zu einer Änderung lokal wirkender Selektionsbedingungen. Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten wie Arten und Populationen
W. Durka, S.G. Michalski 4.6 Genetische Vielfalt und Klimawandel Der Klimawandel führt zu einer Änderung lokal wirkender Selektionsbedingungen. Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten wie Arten und Populationen
Biologische Vielfalt durch Konsum von Produkten fördern kann das gehen? Dipl. laök L. Voget
 Biologische Vielfalt durch Konsum von Produkten fördern kann das gehen? Dipl. laök L. Voget Biodiversität Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter
Biologische Vielfalt durch Konsum von Produkten fördern kann das gehen? Dipl. laök L. Voget Biodiversität Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, inter
Wesentliche prozessbezogene Kompetenzen Erkenntnisgewinnung (EG), Kommunikation (KK), Bewertung (BW), den Aufgaben ( 1, 2 ) zugeordnet
 Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Einführung 1. Allgemeines (Begriffsbestimmung, Mappenführung) Anschauungsmaterial, Buch 2.Arbeitsmethoden in der Biologie 1 Kennzeichen des Lebens Kennzeichen des Lebens (S. 14/15) Die Kennzeichen von
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum S 2. Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe
 Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Graureiher und Stockente Anpassungen von Wassertieren an ihren Lebensraum Reihe 6 M1 Verlauf Material S 2 LEK Glossar Die Lebensweise der Stockente unter der Lupe Die Stockente ist ein Vogel, den du sicher
Die Stabheuschrecke. Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, Sprache: Deutsch. Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2
 Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Format: HDTV, DVD Video, PAL 16:9 Widescreen, 10 Minuten, 2007 Sprache: Deutsch Adressaten: Sekundarstufe 1 und 2 Schlagwörter: Phasmiden, Stabheuschrecke, Insekt, Phytomimese, Parthenogenese, Holometabolie,
Agrarwissenschaften. Moderne Landwirtschaft. Hohe Erträge bei niedrigem Personalaufwand. Hoher Mechanisierungsgrad
 Moderne Landwirtschaft Hohe Erträge bei niedrigem Personalaufwand Hoher Mechanisierungsgrad Hohe Spezialisierung (Monokulturen!) Leistungsfähige Rassen /Sorten Biologische Forschung in den Agrarwissenschaften:
Moderne Landwirtschaft Hohe Erträge bei niedrigem Personalaufwand Hoher Mechanisierungsgrad Hohe Spezialisierung (Monokulturen!) Leistungsfähige Rassen /Sorten Biologische Forschung in den Agrarwissenschaften:
Beobachtung und Experiment II
 Beobachtung und Experiment II Methodologie der Psychologie Thomas Schmidt & Lena Frank Wintersemester 2003/2004 Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Uni Göttingen Was ist ein Experiment? kontrollierte
Beobachtung und Experiment II Methodologie der Psychologie Thomas Schmidt & Lena Frank Wintersemester 2003/2004 Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie Uni Göttingen Was ist ein Experiment? kontrollierte
Kapitel 01.05: Spinnen
 1 2 Inhalt... 1 Inhalt... 2 Die Verwandten der Insekten: Spinnen...3 a) Merkmale des Spinnenkörpers:...3 Merkmale des Spinnenkörpers...4 b) Beutefang bei Spinnen... 5 Spinnenfotos... 6 Genauere Unterteilung
1 2 Inhalt... 1 Inhalt... 2 Die Verwandten der Insekten: Spinnen...3 a) Merkmale des Spinnenkörpers:...3 Merkmale des Spinnenkörpers...4 b) Beutefang bei Spinnen... 5 Spinnenfotos... 6 Genauere Unterteilung
K23 Biologische Vielfalt
 K23 Biologische Vielfalt Von Nik Probst Erschienen im Fischerblatt 2013, Jahrgang 61(6): 36-39 Seit dem 19. Jahrhundert hat die weltweite Artenvielfalt deutlich abgenommen. Es gibt Schätzungen, dass jährlich
K23 Biologische Vielfalt Von Nik Probst Erschienen im Fischerblatt 2013, Jahrgang 61(6): 36-39 Seit dem 19. Jahrhundert hat die weltweite Artenvielfalt deutlich abgenommen. Es gibt Schätzungen, dass jährlich
Vom Ei zum Fluginsekt
 PdN Biologie in der Schule / libellenforschung Heft 5 / 64. Jahrgang / 2015 Vom Ei zum Fluginsekt Der Lebenszyklus von Libellen K. Koch und L. Hesse In praktischen Arbeiten gewinnen Schülerinnen und Schüler
PdN Biologie in der Schule / libellenforschung Heft 5 / 64. Jahrgang / 2015 Vom Ei zum Fluginsekt Der Lebenszyklus von Libellen K. Koch und L. Hesse In praktischen Arbeiten gewinnen Schülerinnen und Schüler
