Kausalität. Alexander Reutlinger
|
|
|
- Eleonora Bachmeier
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Kausalität Alexander Reutlinger Viele wissenschaftliche Erklärungen beziehen sich auf Kausalbeziehungen bzw. Ursachen (z.b. auf ein Virus als Krankheitsursache). Auch im Alltag und in juristischen Kontexten identifizieren wir Kausalbeziehungen oder Ursachen (z.b. bei der Zuschreibung von rechtlicher und moralischer Verantwortung). Aber auf was nehmen wir in diesen Situationen eigentlich Bezug? Was genau sind Kausalbeziehungen bzw. Ursachen? Was ist Kausalität? Metaphysische Theorien der Kausalität geben Antworten auf diese Fragen. Genauer gesagt: Metaphysische Theorien der Kausalität liefern eine Vielzahl von Antworten. Um sich eine Übersicht zu verschaffen, ist es hilfreich, diese metaphysischen Theorien in drei Gruppen zu unterteilen: Eliminativistische Metaphysik: Es gibt keine Kausalität bzw. keine kausalen Fakten. Realistische Metaphysik: Es gibt Kausalität und sie existiert geistunabhängig in der Welt (d.h. unabhängig von unserer Kognition und unserer sprachlichen Bezugnahme auf sie). Je nach realistischer Theorie ist Kausalität (oder: sind kausale Fakten) entweder (i) metaphysisch fundamental oder (ii) metaphysisch nicht-fundamental. Anti-realistische Metaphysik: Kausalität existiert nicht geistunabhängig in der Welt. Kausalität existiert vielmehr geist-abhängig (d.h. abhängig von unserer Kognition und unserer sprachlichen Bezugnahme auf sie). Ich werde zuerst die eliminativistische Position darstellen und dann realistische Standardpositionen einführen, die alle eine Alternative zum Eliminativismus darstellen. Abschließend werde ich (aus Platzgründen) 1
2 lediglich auf die Literatur zur anti-realistischen Metaphysik verweisen und zusätzliche weiterführende Überblicks- und Forschungsliteratur empfehlen. Eliminativistische Metaphysik Russell (1912/13) hat in seinem berühmt-berüchtigten Aufsatz On the Notion of Cause für die These argumentiert, dass Kausalität aus dem ontologischen Repertoire unserer Welt gestrichen werden sollte. Nennen wir diese These die Eliminationsthese. Wie begründet Russell die Eliminationsthese? Russell geht zunächst von der methodologischen Annahme aus, dass wir nur dann davon ausgehen sollten, dass es kausale Fakten gibt, wenn kausale Fakten von anerkannten Theorien und Modellen der Wissenschaften beschrieben werden (s. Kap. VII.3&5). Betrachtet man aber die Physik (laut Russell die fortschrittlichste Wissenschaft), so sagen uns die Theorien der Physik nichts über Ursachen und diese Theorien sind zudem nicht damit vereinbar, dass es Ursachen in der physikalischen Welt gibt. Was bedeutet dies für metaphysische Theorien der Kausalität? Russell identifiziert ein philosophischen Dogma: all philosophers, of every school, imagine that causation is one of the fundamental axioms or postulates of science (Russell 1912/13, 1). Dieses Dogma und allgemeiner die Metaphysik der Kausalität sei ein relic of a bygone age (Russell 1912/13, 1). Russell will damit Folgendes zum Ausdruck bringen: die philosophische These, dass es Kausalität gibt, erscheint vielen Philosoph/innen nur deswegen als plausibel, weil diese (zumindest zu der Zeit als Russell schrieb) sich gar nicht mit den Wissenschaften oder nur mit veralteten Wissenschaften beschäftigen und die etablierten wissenschaftlichen Theorien ihrer Zeit nicht kennen bzw. nicht beachten. Wären Philosoph/innen wissenschaftlich besser informiert, würden sie sich nicht mehr mit metaphysischen Fragen zu Kausalität beschäftigen so Russell. Russells allgemeine Argumentationsstrategie für die Eliminationsthese besteht aus zwei Schritten: In einem ersten Schritt protokolliert Russell nüchtern, dass gängige philosophische Theorien Kausalität bestimmte Merkmale (d.h. notwendige Eigenschaften) zuschreiben. Russell bezieht sich hier vor allem auf 2
3 Regularitätstheorien (siehe unten Abschnitt zu realistischer Metaphysik). Zu diesen Merkmalen gehören unter anderem: (a) die Asymmetrie von Kausalbeziehungen (d.h. wenn A die Ursache von B ist, dann ist B nicht die Ursache von A), (b) die Zeit-Asymmetrie von Kausalbeziehungen (d.h. Ursachen treten früher als ihre Wirkungen auf; s. Kap. V.A.1-3) und (c) die Annahme, dass Ursachen hinreichend für das Auftreten ihrer Wirkungen sind (d.h. immer wenn ein bestimmter Typ von Ursache auftritt, tritt auch ein bestimmter Typ von Wirkung auf). In einem zweiten Schritt argumentiert Russell, dass die naturgesetzlichen Relationen, die von anerkannten physikalischen Theorien postuliert werden, nicht kausal zu verstehen sind, weil diese naturgesetzlichen Relationen (a) nicht asymmetrisch und (b) nicht zeit-asymmetrisch sind sowie (c) keineswegs immer hinreichende Bedingungen für das Auftreten eines Ereignisses spezifizieren (z.b. weil Störfaktoren auftreten können oder weil die Gesetze probabilistisch sind). Russell bringt eine Reihe von unabhängigen Argumenten für den zweiten Schritt seiner Argumentation in Anschlag. Jedes seiner Argumente befasst sich mit einem der Merkmale von Kausalität (Asymmetrie, Zeit-Asymmetrie, die Annahme von hinreichenden Ursachen, usw.). Aus diesen beiden Schritten schließt Russell, dass die Physik die Eliminationsthese stützt: nach allem was uns die Physik lehrt, sollten wir Kausalität aus dem ontologischen Repertoire unserer Welt streichen (s. Kap. V.B.4, V.C.4). (Zu einer detaillierten Darstellung von Russells und auch Machs Argumenten für die Eliminationsthese siehe Hüttemann 2013, Kap. 2.5; siehe Price und Corry 2007 zu neo-russellianischen Ansätzen in der Forschungsliteratur.) Russells Eliminationsthese bildet einen guten Ausgangspunkt, weil sie vielen Philosoph/innen als zu radikal erscheint. Fast niemand ist gewillt zu sagen, dass (a) die Wissenschaften im Allgemeinen nicht von Ursachen sprechen (selbst wenn das auf Teile der Physik zutreffen mag) und, dass (b) es 3
4 Ursachen überhaupt nicht gibt. Alle nachstehenden Theorien der Kausalität können als Bestrebungen verstanden werden, der Eliminationsthese (wissenschaftlich informiert) etwas entgegenzuhalten. Realistische Metaphysik Verschiedene realistische Positionen in der Metaphysik der Kausalität sind ein Versuch, der Eliminationsthese etwas entgegenzuhalten. Laut der realistischen Position gibt es kausale Fakten, die geist-unabhängig in der Welt existieren. Realistische Positionen unterscheiden sich aber u.a. darin, ob kausale Fakten als metaphysisch fundamental oder als metaphysisch nicht-fundamental aufgefasst werden (s. Kap. V.B.2-5). Fundamentalistische Realist/innen vertreten die These, dass kausale Fakten metaphysisch (und begrifflich) fundamental sind (z.b. Anscombe 1971; Cartwright 1989; Beebee/Hitchcock/Menzies 2010, Kap. 13). Fundamentalistische Realist/innen gehen radikal auf Konfrontationskurs mit Russell zumindest dann, wenn man annimmt, die Physik beschreibe die fundamentalen Fakten der Welt vollständig. Nicht-fundamentalistische RealistInnen behaupten hingegen, dass Kausalität metaphysisch nicht-fundamental ist und sich auf nicht-kausale fundamentale Fakten reduzieren lässt oder metaphysisch von diesen abhängt. Viele einschlägige Theorien der Kausalität gehören dem nichtfundamentalistischen Realismus an. Ich werde mich auf die Rekonstruktion von vier einflussreichen Theorien des nicht-fundamentalistischen Realismus beschränken: (a) Regularitätstheorien, (b) probabilistische Theorien, (c) Prozesstheorien und (d) kontrafaktische Theorien. (Zu dispositionalistischen Theorien siehe Hüttemann 2013, Kap. 9; s. auch Kap. III.A.5) (a) Regularitätstheorien Die Grundidee der Regularitätstheorie lässt sich auf Hume zurückführen. Diese Grundidee kann man an einem Beispiel veranschaulichen. Heute Vormittag gab es zwei wichtige Ereignisse: um 11:00 habe ich eine Aspirin genommen und um 11:08 haben meine Kopfschmerzen nachgelassen. Mein 4
5 Einnehmen von Aspirin ist eine Ursache des Nachlassens meiner Kopfschmerzen laut der Grundidee der Regularitätstheorie genau dann, wenn die folgenden vier Bedingungen erfüllt sind: 1. Es war tatsächlich der Fall, dass ich um 11:00 eine Aspirin genommen habe und um 11:08 meine Kopfschmerzen nachgelassen haben. 2. Einnahme und Nachlassen lagen räumlich und zeitlich nahe beieinander (das war der Fall: der Ort, an dem beide Ereignisse stattfanden, war meine Küche; es lagen nur 8 Minuten zwischen den Ereignissen), 3. Die Einnahme von Aspirin fand früher statt als das Nachlassen der Kopfschmerzen. 4. Es ist immer so (bei mir und bei anderen Personen), dass das Einnehmen von Aspirin dem Nachlassen von Kopfschmerzen vorangeht. Allgemein kann man die Grundidee so ausdrücken: Ein Ereignis a verursacht ein anderes Ereignis b genau dann, wenn 1. die Ereignisse a und b tatsächlich aufgetreten sind, 2. die Ereignisse a und b in räumlicher und zeitlicher Nähe zueinander aufgetreten sind, 3. a früher als b eintrat (s. Kap. V.A.3), 4. es immer ist so, dass das Auftreten von Ereignissen des Typs A (d.h. Ereignisse, die Ereignis a in einer bestimmten Hinsicht ähneln) dem Auftreten von Ereignissen des Typs B (d.h. Ereignisse, die Ereignis b in einer bestimmten Hinsicht ähneln) vorangeht. Regularitätstheorien verdanken ihren Namen Bedingung (4), die ausnahmslose Regelmäßigkeiten in der Welt postuliert. Ausnahmslos heißt hier: es ist tatsächlich immer und ohne Ausnahme so, dass Ereignisse eines bestimmten Typs zeitlich vor Ereignissen eines anderen Typs auftreten. Bedingung (4) impliziert auch Folgendes: ob eine Kausalbeziehung zwischen zwei 5
6 Ereignissen a und b vorliegt, hängt nicht nur von den Ereignissen a und b ab, sondern auch von dem Auftreten weiterer Ereignisse vom Typ A und vom Typ B an anderen Orten und zu anderen Zeitpunkten, die Teil der entsprechenden Regularität sind. Mill (1891) und Mackie (1980) haben zwei wichtige Modifikationen an der regularitätstheoretischen Grundidee vorgenommen. Erstens fordern sie, dass die Bedingung (4) auf Regularitäten eingeschränkt wird, die Naturgesetze sind oder aus Naturgesetzen folgen (s. Kap. V.C.1). Zweitens kritisieren Mill und Mackie, dass es oft nicht angemessen ist, ein einzelnes lokales Ereignis als Ursache zu identifizieren. Der Normalfall ist eher, dass die Ursache aus mehreren lokalen Ereignissen besteht. Z.B. ist es genauer betrachtet so, dass nicht die Einnahme von Aspirin allein, sondern die Einnahme von Aspirin zusammen mit einem Glas Wasser immer zu einem zeitnahen Nachlassen von Kopfschmerzen führt. Bedingung (4) sollte deswegen laut Mill und Mackie wie folgt revidiert werden: es ist immer so, dass das Auftreten von Ereignissen des Typs A und Ereignissen des Typs X und Ereignissen des Typs Y und... dem Auftreten von Ereignissen des Typs B vorangehen. Mackie (1980, Kap. 3) präzisiert diese Idee mit dem Begriff der INUS-Bedingung (INUS = Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition). Er entlehnt die Rede von notwendigen und hinreichenden Bedingungen aus der formalen Logik. Der Begriff der INUS-Bedingung lässt sich gut am Aspirin-Beispiel veranschaulichen. Die Einnahme von Aspirin ist für sich genommen nicht hinreichend (Insufficient) für ein schnelles Nachlassen von Kopfscherzen, sondern so nehmen wir an nur in Kombination mit einem Glas Wasser ist Aspirin eine hinreichende Bedingung (Sufficient) für das zügige Nachlassen von Kopfscherzen. Sowohl das Einnehmen von Aspirin als auch das Einnehmen von Wasser sind je für sich nicht-redundante (bzw. notwendige (Necessary), wie Mackie sagt) Bestandteile einer hinreichenden Bedingung für das schnelle Nachlassen von Kopfschmerzen. D.h. nimmt man nur Wasser oder nur Aspirin zu sich, verschwinden die Kopfschmerzen nicht schnell. Außerdem gilt: die Kombination von Aspirin und Wasser ist nicht die einzige hinreichende Bedingung für das Nachlassen Kopfschmerzen. Nehmen wir an, dass eine 6
7 Kombination aus Kaffee trinken und Spaziergängen tatsächlich ebenfalls eine hinreichende Bedingung für das Nachlassen Kopfschmerzen ist. D.h. sowohl die Kombination Wasser-Aspirin als auch die Kombination Spaziergänge- Kaffee ist nicht notwendig (Unnecessary) aber wohl hinreichend (Sufficient) für die Linderung der Kopfschmerzen. Mackie formuliert daher Bedingung (4) in einer disjunktiven Form: es ist immer so, dass das Auftreten von Ereignissen des Typs A und Ereignissen des Typs X und... (z.b. Aspirin und Wasser und...) oder das Auftreten von Ereignissen des Typs Y und Ereignissen des Typs Z und... (z.b. Kaffee trinken und Spaziergänge und...) dem Auftreten von Ereignissen des Typs B (z.b. dem schnellen Nachlassen von Kopfschmerzen) vorangehen. Gemäß der regularitätstheoretischen Grundidee und den Modifikationen von Mill und Mackie sind kausale Fakten metaphysisch nichtfundamental, weil Kausalität sich auf geist-unabhängig existierende Fakten über das Auftreten und die zeitliche Ordnung von Ereignissen und die Existenz von Regularitäten reduzieren lässt. Daher fallen Regularitätstheorien unter den nicht-fundamentalistischen Realismus. (b) Probabilistische Theorien Viele Beispiele für Kausalität aus den Wissenschaften und aus Alltagskontexten legen nahe, dass es die ausnahmslosen Regularitäten, die von Regularitätstheorien postuliert werden, häufig nicht gibt. Stattdessen ist es oft so, dass die Ursache das Auftreten der Wirkung bloß wahrscheinlicher macht, aber keine hinreichende Bedingung für die Wirkung ist. Ein berühmtes und politisch brisantes Beispiel veranschaulicht dies: regelmäßiges Rauchen verursacht Lungenkrebs. Aber nicht jede Person, die regelmäßig raucht, erkrankt an Lungenkrebs. Rauchen erhöht bloß die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs (Conway and Oreskes 2010). Probabilistische Theorien der Kausalität versuchen, diese Intuition mit Hilfe der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie zu präzisieren (Reichenbach 1965; Suppes 1970; Cartwright 1983; Salmon 1998). In diesem Zusammenhang werden Wahrscheinlichkeiten als objektiv und nicht als epistemisch interpretiert (s. Kap. V.C.3). Eine probabilistische Theorie 7
8 charakterisiert Kausalität z.b. mit einer notwendigen Bedingung so: A verursacht B, wenn die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von B gegeben A größer ist als das Auftreten von B gegeben A tritt nicht auf (Suppes 1970, 12). Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie schreiben wir diese bedingten Wahrscheinlichkeiten: P(B A) > P(B nicht-a). Zur Veranschaulichung: Rauchen verursacht Lungenkrebs, wenn P(Lungenkrebs Rauchen) > P(Lungenkrebs nicht-rauchen). Nennen wir diese Bedingung Erhöhungsbedingung. Verschiedene probabilistische Theorien führen weitere notwendige Bedingungen ein. Zum Beispiel fordern manche dieser Theorien, dass Ursachen früher als ihre Wirkungen auftreten (Suppes 1970, 12; s. Kap. V.A.3). Die berühmteste Ergänzung zur Erhöhungsbedingung ist jedoch eine Bedingung, die Abschirmung ( screening off ) verbietet (Reichenbach 1956; Suppes 1970). Die Kernidee: ein Faktor C schirmt die Ursache A von Wirkung B ab genau dann, wenn P(B A und C) = P(B nicht-a und C). Ein Beispiel: täglicher Sport schirmt Rauchen (die Ursache) von Herzerkrankungen (der Wirkung) ab, d.h. P(Herzerkrankung Rauchen und täglicher Sport) = P(Herzerkrankung nicht-rauchen und täglicher Sport). Hier erhöht Rauchen (die Ursache) nicht die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen (der Wirkung), wie von der Erhöhungsbedingung gefordert wird, weil täglicher Sport bestimmten Herzerkrankungen (zumindest für einige Zeit) entgegenwirken kann. Aus diesem Grund enthalten manche probabilistische Theorien eine Bedingung, die ausschließt, dass es weitere Faktoren (wie C) gibt, die die Ursache abschirmen (Suppes 1970, 23). Der Begriff der Abschirmung ist auch zentral für weitere Prinzipien im Rahmen von probabilistischen Theorien z.b. Reichenbachs (1956) Prinzip der gemeinsamen Ursache und die kausale Markov-Bedingung (Pearl 2000; Spirtes, Glymour und Scheines 2000). Viele klassische probabilistische Theorien sind als Ansätze im Rahmen des nicht-fundamentalistischen Realismus anzusehen. Sie reduzieren kausale Fakten auf geist-unabhängige, nicht-kausale Fakten (wie Wahrscheinlichkeitserhöhung, zeitliche Ordnung, Ausschluss von Abschirmung). 8
9 Es gibt jedoch eine interessante, gegenläufige Entwicklung bei aktuellen probabilistischen Theorien. Die Definitionen von Kausalbegriffen sind in diesen aktuellen Theorien keine Explizitdefinitionen mehr, sondern axiomatische Definitionen. Letzte definieren kausale Begriffe mit kausalem Vokabular (Cartwright 1983, 1989; Pearl 2000; Spirtes, Glymour und Scheines 2000). Es ist eine offene Frage, ob solche axiomatischen Definitionen mit einem nicht-fundamentalistischen Realismus vereinbar sind (Reutlinger 2013, Kap. 6). (c) Prozesstheorien Die Kernidee von Prozesstheorien lautet: Kausalität ist eine bestimmte Art von Prozess oder alternativ: was wir Ursache und Wirkungen nennen, ist durch eine bestimmte Art von Prozess verbunden. Unter einem Prozess wird (grob gesagt) die Bewegung eines Objekts durch Raum und Zeit verstanden (s. Kap. III.C.3). Ein Beispiel: wenn ich mit dem Fahrrad vom Münchner Hauptbahnhof zur Universität fahre, ist das laut der Prozesstheorie ein kausaler Prozess. (Anmerkung: Aus Platzgründen kann ich auf einen weiteren zentralen Begriff der Prozesstheorie den Begriff der kausalen Interaktion nicht eingehen.) Eine Prozesstheorie muss zwischen kausalen und nichtkausalen Prozessen (und Interaktionen) unterscheiden können. In der Literatur finden sich zwei prominente Strategien, kausale Prozesse zu definieren. Salmons mark transmission theory charakterisiert Kausalprozesse als Prozesse, die durch einen Eingriff verändert ( marked ) werden können und diese Veränderung (für ein bestimmtes Zeitintervall) nach dem Eingriff weiterbesteht (Salmon 1984, 148). Ein Beispiel zur Illustration: meine Fahrradtour durch München ist laut Salmon ein kausaler Prozess, weil wir diesen Prozess durch einen Eingriff verändern können (wir können z.b. am Odeonsplatz zwischen Hauptbahnhof und Universität mit einem Hammer eine Delle ins Schutzblech schlagen) und die Veränderung (die Delle) nach dem Eingriff bleibt (d.h. die Delle ist beim Eintreffen an der Universität immer noch da). Salmon bezeichnet Letzteres als mark transmission. Salmon behauptet, dass die mark transmission -Strategie es uns ermöglicht, korrekt zwischen kausalen und nicht-kausalen Prozessen zu unterscheiden. 9
10 Nehmen wir Salmons Beispiel für einen nicht-kausalen Prozess: mein Fahrrad wirft bei der Fahrt einen Schatten. Dieser sich vom Hauptbahnhof zur Universität bewegende Schatten ist kein kausaler Prozess. Die mark transmission theory erklärt uns, warum das so ist: wenn wir den Schatten durch einen Eingriff verändern (z.b. indem wir eine Taschenlampe auf den Schatten halten und dadurch ein Stück von ihm abschneiden ), dann ist es nicht der Fall, dass diese Veränderung nach dem Eingriff (d.h. nachdem wir die Taschenlampe ausschalten) weiterbesteht. Aufgrund einiger Probleme der mark transmission -Strategie (Hüttemann 2013, Kap. 7.4) hat Salmon (1998) die Erhaltungsgrößen-Theorie als alternative Variante der Prozesstheorie vorgeschlagen, die in leicht abweichenden Versionen auch von Dowe (2000) und Kistler (2006) vertreten wird. Die Kernidee der Erhaltungsgrößen-Theorie ist folgende: kausale Prozesse sind dadurch ausgezeichnet, dass sich ein Objekt durch Raum und Zeit bewegt und dabei einen von Null verschiedenen Betrag einer Erhaltungsgröße instantiiert (Salmon 1998, 257; Dowe 2000, 90). Erhaltungsgrößen sind physikalische Größen wie z.b. Energie, Impuls, Masse und elektrische Ladung, für die sog. Erhaltungssätze gelten. Ein Beispiel: Mein fahrendes Fahrrad ist ein Kausalprozess, weil das Rad (das Objekt) einen von Null verschiedenen Betrag einer Erhaltungsgröße (z.b. Masse und Impuls) instantiiert, während ich vom Hauptbahnhof zur Universität fahre. Der Schatten des fahrenden Fahrrads wird korrekt als nicht-kausaler Prozess klassifiziert, weil der Schatten auf dem Weg zwischen Hauptbahnhof und Universität keinen von Null verschiedenen Betrag einer Erhaltungsgröße instantiiert. (Anmerkung: Kausale Interaktionen, auf die ich nicht eingehen kann, werden als Übertragung von Erhaltungsgrößen definiert.) Prozesstheorien fallen unter den nicht-fundamentalistischen Realismus. Kausalprozesse existieren geist-unabhängig und sowohl mark transmission als auch die Instantiierung von Erhaltungsgrößen gelten als nicht-kausale Fakten. 10
11 (d) Kontrafaktische Theorien Kontrafaktische Theorien gehen von der Grundintuition aus, dass Ereignis a eine Ursache von Ereignis b ist, wenn folgendes wahr ist: wenn Ereignis a nicht aufgetreten wäre, dann wäre auch Ereignis b nicht eingetreten. Ein Konditionalsatz dieser Art wird als kontrafaktisches Konditional bezeichnet (s. Kap. VI.C.4). Ein Beispiel: Nehmen wir an, mein Einnehmen von Aspirin (um 11:00) war eine Ursache des Nachlassens meiner Kopfschmerzen (um 11:08). Gemäß der kontrafaktischen Grundintuition ist dies der Fall, wenn das folgende kontrafaktische Konditional wahr ist: wenn ich um 11:00 keine Aspirin genommen hätte, dann hätten meine Kopfschmerzen nicht um 11:08 nachgelassen. Kontrafaktische Theorien gehen durch solche Konditionale über das hinaus, was tatsächlich geschieht (oder geschehen ist), und nehmen auf bloß mögliche Situationen Bezug (z.b. die bloß mögliche Situation, dass ich keine Aspirin um 11:00 eingenommen habe). Eine der einflussreichsten Ausarbeitungen der kontrafaktischen Grundintuition stammt von Lewis (siehe Lewis 1973 zur ursprünglichen Theorie; zur Revision siehe Lewis 2004). Lewis (1973, 164) führt zunächst den Begriff der kontrafaktischen Abhängigkeit ein. Eine Ereignis b hängt von einem Ereignis a kontrafaktisch ab genau dann, wenn die folgenden kontrafaktischen Konditionale wahr sind (zu Lewis Semantik für kontrafaktische Konditionale: s. Kap. VI.C.4): Wenn Ereignis a aufgetreten wäre, dann wäre das Ereignis b eingetreten. Wenn Ereignis a nicht aufgetreten wäre, dann wäre Ereignis b nicht eingetreten. Nach Lewis (1973, ) ist ein Ereignis a eine Ursache von Ereignis b genau dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 1. a und b sind tatsächlich aufgetreten. 11
12 2. a und b sind distinkt, d.h. a und b stehen nicht in einer Identitäts-, Teil-Ganzes- oder Supervenienzbeziehung zueinander (s. Kap. IV.2, V.B.1 oder V.B.2). 3. Ereignis b hängt kontrafaktisch von a ab oder es gibt eine Folge von tatsächlich aufgetretenen und distinkten Ereignissen a, c 1,..., c n, b, so dass c 1 kontrafaktisch von a abhängt und... und b kontrafaktisch von c n abhängt. Lewis kontrafaktische Theorie liefert eine realistische und nichtfundamentalistische Metaphysik der Kausalität. Kausale Tatsachen existieren geist-unabhängig und es sind letztlich nicht-kausale Tatsachen (bezüglich Naturgesetzen und dem Humeschen Mosaik ), welche die relevanten Aussagen über das Auftreten von Ereignissen und die kontrafaktischen Konditionale wahrmachen (zu Lewis Begriff des Humeschen Mosaiks und seiner Theorie der Naturgesetze s. Kap. V.C.1, V.C.3; ergänzend: III.A.4, III.A.5). Interventionistische Theorien bilden eine weitere, sehr einflussreiche Ausarbeitung der kontrafaktischen Grundintuition (Woodward 2003; ein Vorläufer ist von Wright 1971). Interventionist/innen interpretieren das kontrafaktische Konditional Wenn die Ursache nicht aufgetreten wäre, dann wäre die Wirkung nicht aufgetreten unter Rückgriff auf den Begriff der Intervention: Wenn es eine gezielte Intervention auf die Ursache gäbe, so dass die Ursache (als Resultat dieser Intervention) nicht aufgetreten wäre, dann wäre die Wirkung nicht aufgetreten. Wichtig ist hier: der Begriff der Intervention ist selbst ein kausaler Begriff (Woodward 2003, 98). Im Kern definieren Interventionist/innen Kausalität gemäß der folgenden Leitidee: A verursacht B genau dann, wenn gilt: Wäre A aufgrund einer möglichen Intervention nicht aufgetreten, dann wäre auch B nicht aufgetreten (Woodward 2003, 59). Die interventionistische Theorie ist als Theorie im Rahmen des nichtfundamentalistischen Realismus intendiert ( modest realism, siehe Woodward 2003, 121; siehe Hitchcocks und Woodwards Beiträge in Price und Corry 2007). Aber es ist eine ungeklärte Frage (genauso wie bei neueren 12
13 probabilistischen Theorien), ob der nicht-fundamentalistische Realismus damit vereinbar ist, dass Kausalität durch kausale Begriffe (hier: durch den Begriff der Intervention) definiert wird (siehe Reutlinger 2013 für eine kritische Diskussion). Weiterführende Literatur In diesem kurzen Artikel konnte ich nicht auf die Stärken und Schwächen der dargestellten Positionen eingehen. Dazu empfehle ich Andreas Hüttemanns (2013) exzellente Diskussion aller zentralen Positionen in der Metaphysik der Kausalität. Das Oxford Handbook of Causation (Beebee, Hitchcock und Menzies 2010) bietet ebenfalls empfehlenswerte Überblicksliteratur. Psillos (2002) und Schrenk (2016) sind Einführungen, die die Metaphysik der Kausalität in einen größeren Rahmen der Metaphysik der Wissenschaften einordnen. In der aktuellen Forschungsliteratur möchte ich besonders hervorheben: Price und Corry (2007) zur Eliminationsthese (insbesondere die Aufsätze von Beebee, Elga, Loewer und Norton), Mackie (1980), Lewis (1986, Kap. 17 u. 21) und Woodward (2003) zu Varianten des nicht-fundamentalistischen Realismus, Pearl (2000) und Spirtes, Glymour und Scheines (2000) vereinen probabilistische und kontrafaktische Elemente. Beide Ansätze sind willkommene Provokationen für die metaphysische Debatte. Abschließend möchte ich auf die neuere, erfrischende Literatur zu antirealistischen Positionen in der Metaphysik der Kausalität hinweisen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Den vielfältigen anti-realistischen Theorien ist ein Leitmotiv gemein: kausale Fakten existieren zwar (entgegen der eliminativistischen Metaphysik), aber sie existieren nicht geist-unabhängig in der Welt (entgegen der realistischen Metaphysik). Stattdessen behaupten Anti- Realist/innen, dass Kausalität (in einem genauer zu spezifizierenden Sinn) geist-abhängig existiert. Wie geist-abhängige Kausalität im Detail zu 13
14 verstehen ist, erläutern Anti-Realist/innen auf unterschiedlicher Weise z.b. mit einem humeschen Projektivismus (Beebee 2006, Kap. 6), einem pragmatistischen Inferentialismus (Reiss 2012) und mit formalen Methoden wie Bayesianismus (Williamson 2005, Kap. 9) und Rangtheorie (Spohn 2012, Kap. 13). Literaturverzeichnis Anscombe, G.E.M.: Causality and Determination, London Beebee, Helen: Hume on Causation. Abingdon Beebee, Helen / Hitchcock, Chris / Menzies, Peter (Hg.): Oxford Handbook of Causation. Oxford Cartwright, Nancy: How the Laws of Physics Lie. Oxford Cartwright, Nancy: Nature s Capacities and their Measurement. Oxford 1989 Conway, Eric / Oreskes, Naomi: Merchants of Doubt. New York Dowe, Phil: Physical Causation. Cambridge Hüttemann, Andreas: Ursachen. Berlin Kistler, Max: Causation and Laws of Nature. London Lewis, David: Causation. In: ders.: Philosophical Papers II. Oxford 1986, Lewis, David: Causation as Influence. In: John Collins / Ned Hall / L.A. Paul (Hg.): Causation and Counterfactuals. Cambridge, MA 2004, Mackie, John L.: The Cement of the Universe. Oxford Mill, John S.: A System of Logic. New York Pearl, Judea: Causality. Cambridge Price, Huw / Corry, Richard (Hg.): Causation, Physics and the Constitution of Reality. Oxford Psillos, Stathis: Causation and Explanation. Chesham Reichenbach, Hans: The Direction of Time. Berkeley Reiss, Julian: Causation in the Sciences: An Inferentialist Account. In: Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 43/4 (2012), Reutlinger, Alexander: A Theory of Causation in the Biological and Social Sciences. New York
15 Russell, Bertrand: On the Notion of Cause, In: Proceedings of the Aristotelian Society 13 (1912/13), Salmon, Wesley: Scientific Explanation and the Causal Structure oft he World. Princeton Salmon, Wesley: Causality and Explanation, Oxford Schrenk, Markus: Metaphysics of Science. A Systematic and Historical Introduction. London Spirtes, Peter / Glymour, Clark / Scheines, Richard: Causation, Prediction and Search. New York Spohn, Wolfgang: The Laws of Belief. Oxford Suppes, Patrick: A Probabilistic Theory of Causality. Amsterdam Von Wright, Georg H.: Explanation and Understanding. Ithaca Williamson, Jon: Bayes Nets and Causality. Oxford Woodward, James: Making Things Happen. New York
Erklärung und Kausalität. Antworten auf die Leitfragen zum
 TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 16.6.2009 Textgrundlage: J. L. Mackie, Causes and
TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 16.6.2009 Textgrundlage: J. L. Mackie, Causes and
Kausalität und kontrafaktische
 Kausalität und kontrafaktische Konditionalsätze Illustrationen zu D. Lewis, Causation Erklärung und Kausalität 7.7.2009 Claus Beisbart TU Dortmund Sommersemester 2009 Hume in der Enquiry Zwei Definitionen
Kausalität und kontrafaktische Konditionalsätze Illustrationen zu D. Lewis, Causation Erklärung und Kausalität 7.7.2009 Claus Beisbart TU Dortmund Sommersemester 2009 Hume in der Enquiry Zwei Definitionen
Erklärung und Kausalität. Antworten auf die Leitfragen zum
 TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 23.6.2009 Textgrundlage: C. Hitchcock, Probabilistic
TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 23.6.2009 Textgrundlage: C. Hitchcock, Probabilistic
Wissenschaftstheorie Wie die Monarchie so auch die Kausalität in der Physik Wolfgang Pietsch,
 Wissenschaftstheorie Wie die Monarchie so auch die Kausalität in der Physik Wolfgang Pietsch, pietsch@cvl-a.tum.de Abstract: Der Essay fragt nach der Rolle von Kausalität in der Physik. Zuerst schlage
Wissenschaftstheorie Wie die Monarchie so auch die Kausalität in der Physik Wolfgang Pietsch, pietsch@cvl-a.tum.de Abstract: Der Essay fragt nach der Rolle von Kausalität in der Physik. Zuerst schlage
Kausales Denken. York Hagmayer und Michael R. Waldmann
 Kausales Denken York Hagmayer und Michael R. Waldmann Kausalität Kausalität eine grundlegende kognitive Kompetenz Nicht nur für eigene Handlungen, auch im Alltag bereichsübergreifend! Psychologische Forschung
Kausales Denken York Hagmayer und Michael R. Waldmann Kausalität Kausalität eine grundlegende kognitive Kompetenz Nicht nur für eigene Handlungen, auch im Alltag bereichsübergreifend! Psychologische Forschung
Physikalismus. Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di / Markus Wild & Rebekka Hufendiek. Sitzung 7 ( )
 Physikalismus Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di 10-12 / Markus Wild & Rebekka Hufendiek Sitzung 7 (26.3.13) Physikalismus? Allgemeine metaphysische These (Metaphysica generalis): Alles, was existiert,
Physikalismus Vorlesung: Was ist Naturalismus? FS 13 / Di 10-12 / Markus Wild & Rebekka Hufendiek Sitzung 7 (26.3.13) Physikalismus? Allgemeine metaphysische These (Metaphysica generalis): Alles, was existiert,
(1978) und Russells (1912) Attacken unternommen wurden, um dem Begriff der Kausalität als
 Max Kistler Zur Transfer-Theorie der Kausalität in: Georg Meggle (ed.), Analyomen 2: Perspectives in Analytical Philosophy, Vol. 1: Logic, Epistemology and Philosophy of Science, pp. 421-429. Berlin/New
Max Kistler Zur Transfer-Theorie der Kausalität in: Georg Meggle (ed.), Analyomen 2: Perspectives in Analytical Philosophy, Vol. 1: Logic, Epistemology and Philosophy of Science, pp. 421-429. Berlin/New
Kausalität. Michael Esfeld. Universität Lausanne, Sektion Philosophie CH-1015 Lausanne, Schweiz
 Kausalität Michael Esfeld Universität Lausanne, Sektion Philosophie CH-1015 Lausanne, Schweiz Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (erschienen in Andreas Bartels & Manfred Stöckler (Hgg.): Wissenschaftstheorie.
Kausalität Michael Esfeld Universität Lausanne, Sektion Philosophie CH-1015 Lausanne, Schweiz Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (erschienen in Andreas Bartels & Manfred Stöckler (Hgg.): Wissenschaftstheorie.
Die Debatte um den wissenschaftlichen Realismus ( )
 Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie (Überblick 20. Jahrhundert) Die Debatte um den wissenschaftlichen Realismus (3.7.2007)
Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie (Überblick 20. Jahrhundert) Die Debatte um den wissenschaftlichen Realismus (3.7.2007)
Kausalität: Begriffsdefinitionen und Metaphysik
 Grundlagen: Verschiedene Texte von Andreas Bartels Stanford Encyclopedia of Philosophy Beckermann, A. "Biologie und Freiheit". Erscheint in: H. Schmidinger und C. Sedmak (Hg.) Der Mensch ein freies Wesen?
Grundlagen: Verschiedene Texte von Andreas Bartels Stanford Encyclopedia of Philosophy Beckermann, A. "Biologie und Freiheit". Erscheint in: H. Schmidinger und C. Sedmak (Hg.) Der Mensch ein freies Wesen?
Logische Grundlagen der Mathematik, WS 2014/15
 Logische Grundlagen der Mathematik, WS 2014/15 Thomas Timmermann 16. Oktober 2014 1 Einleitung Literatur Paul.R. Halmos, Naive Set Theory Ralf Schindler, Logische Grundlagen der Mathematik Peter J. Cameron,
Logische Grundlagen der Mathematik, WS 2014/15 Thomas Timmermann 16. Oktober 2014 1 Einleitung Literatur Paul.R. Halmos, Naive Set Theory Ralf Schindler, Logische Grundlagen der Mathematik Peter J. Cameron,
Wenn Jesse James abgedrückt hätte, wäre Bill Bullock gestorben.
 KK5: Metaphysik 5. Fragenzettel (K) 1. Angenommen, Jesse James bedroht bei einem Banküberfall, der unblutig abläuft, den Kassierer Bill Bullock mit seinem Revolver. Betrachten Sie das kontrafaktische Konditio-
KK5: Metaphysik 5. Fragenzettel (K) 1. Angenommen, Jesse James bedroht bei einem Banküberfall, der unblutig abläuft, den Kassierer Bill Bullock mit seinem Revolver. Betrachten Sie das kontrafaktische Konditio-
1. Einleitung. 2. Zur Person
 Moritz Schlick: Naturgesetze und Kausalität Seminar über philosophische Aspekte in der Physik WS 2007/08 Seminarleitung: Prof. Dr. G. Münster Dr. C. Suhm Vortragender: Johannes Greber 13. 11. 2007 1. Einleitung
Moritz Schlick: Naturgesetze und Kausalität Seminar über philosophische Aspekte in der Physik WS 2007/08 Seminarleitung: Prof. Dr. G. Münster Dr. C. Suhm Vortragender: Johannes Greber 13. 11. 2007 1. Einleitung
Die Anfänge der Logik
 Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Textsorten. Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World
 Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
Textsorten Folien zum Tutorium Internationalisierung Go West: Preparing for First Contacts with the Anglo- American Academic World Alexander Borrmann Historisches Institut Lehrstuhl für Spätmittelalter
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Physik und Metaphysik
 WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie. Prof. Dr. Jörg Rössel
 Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Jörg Rössel Ablaufplan 1. Einleitung: Was ist Wissenschaft(stheorie) überhaupt? 2. Vorbereitung I: Logik und Argumentation
Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Jörg Rössel Ablaufplan 1. Einleitung: Was ist Wissenschaft(stheorie) überhaupt? 2. Vorbereitung I: Logik und Argumentation
Wozu Dispositionen? Einleitung zum Kolloquium Die Renaissance von Dispositionen in der gegenwärtigen Naturphilosophie
 Wozu Dispositionen? Einleitung zum Kolloquium Die Renaissance von Dispositionen in der gegenwärtigen Naturphilosophie Michael Esfeld Universität Lausanne Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (in Carl Friedrich
Wozu Dispositionen? Einleitung zum Kolloquium Die Renaissance von Dispositionen in der gegenwärtigen Naturphilosophie Michael Esfeld Universität Lausanne Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (in Carl Friedrich
Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein
 2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
2 Materialistische (physikalistische, naturalistische) Theorieansätze zum ontologischen Status von Bewusstsein 1. Der logische Behaviourismus Hauptvertreter: Gilbert Ryle, Carl Gustav Hempel Blütezeit:
Einführung in die moderne Logik
 Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Übersicht. Prädikatenlogik höherer Stufe. Syntax der Prädikatenlogik 1. Stufe (mit Gleichheit)
 Übersicht I Künstliche Intelligenz II Problemlösen III Wissen und Schlussfolgern 7. Logische Agenten 8. Prädikatenlogik 1. Stufe 9. Schließen in der Prädikatenlogik 1. Stufe 10. Wissensrepräsentation IV
Übersicht I Künstliche Intelligenz II Problemlösen III Wissen und Schlussfolgern 7. Logische Agenten 8. Prädikatenlogik 1. Stufe 9. Schließen in der Prädikatenlogik 1. Stufe 10. Wissensrepräsentation IV
Ethik. Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1
 Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 13. Kausale Erklärung Erklärung und Prognose: zwei fundamentale Leistungen
Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Vorlesung zur Wissenschaftstheorie und Ethik 1 13. Kausale Erklärung Erklärung und Prognose: zwei fundamentale Leistungen
Erläuterung zum Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch
 TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
TU Dortmund, Wintersemester 2010/11 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Aristoteles, Metaphysik Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch (Buch 4/Γ; Woche 4: 8. 9.11.2010) I. Der
Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes
 Ansgar Beckermann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes
Ansgar Beckermann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes
John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins. Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam
 John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins Jonathan F. Donges Harald R. Haakh Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam Übersicht Themen 1 Physik, Syntax,
John R. Searle: Das syntaktische Argument und die Irreduzibilität des Bewusstseins Jonathan F. Donges Harald R. Haakh Institut für Physik und Astronomie Universität Potsdam Übersicht Themen 1 Physik, Syntax,
Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes
 Ansgar Beckermann Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes 3., aktualisierte und erweiterte Auflage wde G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis Vorwort Vorwort zur zweiten Auflage
Ansgar Beckermann Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes 3., aktualisierte und erweiterte Auflage wde G Walter de Gruyter Berlin New York Inhaltsverzeichnis Vorwort Vorwort zur zweiten Auflage
Statistische Methoden der Datenanalyse Wintersemester 2011/2012 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Statistische Methoden der Datenanalyse Wintersemester 2011/2012 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Prof. Markus Schumacher Physikalisches Institut Westbau 2 OG Raum 008 Telefonnummer 07621 203 7612 E-Mail:
Statistische Methoden der Datenanalyse Wintersemester 2011/2012 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Prof. Markus Schumacher Physikalisches Institut Westbau 2 OG Raum 008 Telefonnummer 07621 203 7612 E-Mail:
Die naturalistische Verteidigung des wissenschaftlichen Realismus
 Christian Suhm Westfälische Wilhelms-Universität Münster Philosophisches Seminar Domplatz 23 48143 Münster Email: suhm@uni-muenster.de Anhörungsvortrag am Institut für Philosophie in Oldenburg (04.02.2004)
Christian Suhm Westfälische Wilhelms-Universität Münster Philosophisches Seminar Domplatz 23 48143 Münster Email: suhm@uni-muenster.de Anhörungsvortrag am Institut für Philosophie in Oldenburg (04.02.2004)
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Wie verstehen wir etwas? sprachliche Äußerungen. Sprachphilosophie, Bedeutungstheorie. Personen mit ihren geistigen Eigenschaften in der Welt
 Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Donald Davidson *1917 in Springfield, Massachusetts, USA Studium in Harvard, 1941 abgeschlossen mit einem Master in Klassischer Philosophie 1949 Promotion in Harvard über Platons Philebus Unter Quines
Revolutionen in der Mathematik I. Einführung in das Thema
 Revolutionen in der Mathematik I Einführung in das Thema Thomas S. Kuhn (1922-1996) Physiker und Wissenschaftstheoretiker Wichtigstes Werk: The Structure of Scientific Revolutions (1962) Soziale Theorie
Revolutionen in der Mathematik I Einführung in das Thema Thomas S. Kuhn (1922-1996) Physiker und Wissenschaftstheoretiker Wichtigstes Werk: The Structure of Scientific Revolutions (1962) Soziale Theorie
Was können wir wissen?
 Was können wir wissen? Einführung in die Erkenntnistheorie mit Essaytraining Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2001 2 Teile Vorlesung Di 16-18 T2-149 Tutorien Texte Fragen Essays Organisatorisches
Was können wir wissen? Einführung in die Erkenntnistheorie mit Essaytraining Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2001 2 Teile Vorlesung Di 16-18 T2-149 Tutorien Texte Fragen Essays Organisatorisches
Konstruktion der Vergangenheit
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Chris Lorenz Konstruktion der Vergangenheit Eine Einführung in die
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Legen die Naturgesetze alles Geschehen fest?
 Legen die Naturgesetze alles Geschehen fest? Wie alles anfing 22.1.2017 Fachbereich Physik Theorie komplexer Systeme Barbara Drossel 2 Newtons Gesetze (1686) Kraftgesetz: F = ma Gravitationsgesetz http://drychcik.wikispaces.com/
Legen die Naturgesetze alles Geschehen fest? Wie alles anfing 22.1.2017 Fachbereich Physik Theorie komplexer Systeme Barbara Drossel 2 Newtons Gesetze (1686) Kraftgesetz: F = ma Gravitationsgesetz http://drychcik.wikispaces.com/
1. Wissenschaftstheoretische Grundlagen Soziologische Theorie als erfahrungswissenschaftliche
 1. Wissenschaftstheoretische Grundlagen 1.1. Soziologische Theorie als erfahrungswissenschaftliche Theorie 1.1.1. Was sind keine erfahrungswissenschaftlichen Theorien? Aussagen der Logik und der Mathematik
1. Wissenschaftstheoretische Grundlagen 1.1. Soziologische Theorie als erfahrungswissenschaftliche Theorie 1.1.1. Was sind keine erfahrungswissenschaftlichen Theorien? Aussagen der Logik und der Mathematik
Einführung in die Ethik. Neil Roughley (WS 2006/07)
 Einführung in die Ethik Neil Roughley (WS 2006/07) Einführung in die Ethik 4: Metaethik 3 Realismus, Kognitivismus, Deskriptivismus (G.E. Moore) (3) Expressiv oder deskriptiv? Desk? (1) Wirklich? Exp?
Einführung in die Ethik Neil Roughley (WS 2006/07) Einführung in die Ethik 4: Metaethik 3 Realismus, Kognitivismus, Deskriptivismus (G.E. Moore) (3) Expressiv oder deskriptiv? Desk? (1) Wirklich? Exp?
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Verursachung und kausale Relevanz
 Monika Dullstein Verursachung und kausale Relevanz Eine Analyse singulärer Kausalaussagen mentis Paderborn Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in
Monika Dullstein Verursachung und kausale Relevanz Eine Analyse singulärer Kausalaussagen mentis Paderborn Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in
Frege löst diese Probleme, indem er zusätzlich zum Bezug (Bedeutung) sprachlicher Ausdrücke den Sinn einführt.
 1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
Spezielle Relativität
 Spezielle Relativität Gleichzeitigkeit und Bezugssysteme Thomas Schwarz 31. Mai 2007 Inhalt 1 Einführung 2 Raum und Zeit Bezugssysteme 3 Relativitätstheorie Beginn der Entwicklung Relativitätsprinzip Lichtausbreitung
Spezielle Relativität Gleichzeitigkeit und Bezugssysteme Thomas Schwarz 31. Mai 2007 Inhalt 1 Einführung 2 Raum und Zeit Bezugssysteme 3 Relativitätstheorie Beginn der Entwicklung Relativitätsprinzip Lichtausbreitung
Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk. Christian Damböck Institut Wiener Kreis
 Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk Christian Damböck Institut Wiener Kreis 6.5.2011 1 1. Das starre Rahmenwerk 2 Das strukturalistische Rahmenwerk Im Strukturalismus liegen Strukturen
Theorienstrukturalismus in einem starren Rahmenwerk Christian Damböck Institut Wiener Kreis 6.5.2011 1 1. Das starre Rahmenwerk 2 Das strukturalistische Rahmenwerk Im Strukturalismus liegen Strukturen
Kapitel ML:IV. IV. Statistische Lernverfahren. Wahrscheinlichkeitsrechnung Bayes-Klassifikation Maximum-a-Posteriori-Hypothesen
 Kapitel ML:IV IV. Statistische Lernverfahren Wahrscheinlichkeitsrechnung Bayes-Klassifikation Maximum-a-Posteriori-Hypothesen ML:IV-1 Statistical Learning c STEIN 2005-2011 Definition 1 (Zufallsexperiment,
Kapitel ML:IV IV. Statistische Lernverfahren Wahrscheinlichkeitsrechnung Bayes-Klassifikation Maximum-a-Posteriori-Hypothesen ML:IV-1 Statistical Learning c STEIN 2005-2011 Definition 1 (Zufallsexperiment,
Précis zu The Normativity of Rationality
 Précis zu The Normativity of Rationality Benjamin Kiesewetter Erscheint in: Zeitschrift für philosophische Forschung 71(4): 560-4 (2017). Manchmal sind wir irrational. Der eine ist willensschwach: Er glaubt,
Précis zu The Normativity of Rationality Benjamin Kiesewetter Erscheint in: Zeitschrift für philosophische Forschung 71(4): 560-4 (2017). Manchmal sind wir irrational. Der eine ist willensschwach: Er glaubt,
Boole sches Retrieval als frühes, aber immer noch verbreitetes IR-Modell mit zahlreichen Erweiterungen
 Rückblick Boole sches Retrieval als frühes, aber immer noch verbreitetes IR-Modell mit zahlreichen Erweiterungen Vektorraummodell stellt Anfrage und Dokumente als Vektoren in gemeinsamen Vektorraum dar
Rückblick Boole sches Retrieval als frühes, aber immer noch verbreitetes IR-Modell mit zahlreichen Erweiterungen Vektorraummodell stellt Anfrage und Dokumente als Vektoren in gemeinsamen Vektorraum dar
Realismus oder Antirealismus? Ein modales Kriterium. Lydia Mechtenberg
 Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22. 26.09.2003 Realismus oder Antirealismus? Ein modales Kriterium Lydia Mechtenberg Die nach wie vor heftige philosophische Debatte zwischen
Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22. 26.09.2003 Realismus oder Antirealismus? Ein modales Kriterium Lydia Mechtenberg Die nach wie vor heftige philosophische Debatte zwischen
HS Britischer Empirismus: Locke, Berkeley, Hume (51040)
 HS Britischer Empirismus: Locke, Berkeley, Hume (51040) Mi. 14-16 Uhr, UL 6 Raum 1070 Kontaktinformationen Dozierender: Büro: UL 6 Raum 3106 E-Mail: benderse@philosophie.hu-berlin.de Sprechzeit: Mi. 10-11
HS Britischer Empirismus: Locke, Berkeley, Hume (51040) Mi. 14-16 Uhr, UL 6 Raum 1070 Kontaktinformationen Dozierender: Büro: UL 6 Raum 3106 E-Mail: benderse@philosophie.hu-berlin.de Sprechzeit: Mi. 10-11
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik
 Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
2.2.4 Logische Äquivalenz
 2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
2.2.4 Logische Äquivalenz (I) Penélope raucht nicht und sie trinkt nicht. (II) Es ist nicht der Fall, dass Penélope raucht oder trinkt. Offenbar behaupten beide Aussagen denselben Sachverhalt, sie unterscheiden
Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart. Warum sind Bananen krumm?, dann muß ich mit einer Erklärung antworten.
 Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie (Überblick 20. Jahrhundert) Erklärungen (Zusammenfassung vom 5.6.2007) 1 Die Bedeutung
Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie (Überblick 20. Jahrhundert) Erklärungen (Zusammenfassung vom 5.6.2007) 1 Die Bedeutung
Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise
 Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
Donald Davidson ( )
 Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Foliensatz Davidson zur Einführung.doc Jasper Liptow 1/9 Donald Davidson (1917-2003) Geb. am 6. März 1917 in Springfield, Mass. Studium der Literaturwissenschaft und Philosophiegeschichte (u.a. bei A.
Über die Natur der Dinge Materialismus und Wissenschaft
 Mario Bunge/Martin Mahner Über die Natur der Dinge Materialismus und Wissenschaft S. Hirzel Verlag Stuttgart Leipzig Inhaltsverzeichnis Vorwort IX Danksagung XII 1 Einleitung 1 1.1 Zwei radikal verschiedene
Mario Bunge/Martin Mahner Über die Natur der Dinge Materialismus und Wissenschaft S. Hirzel Verlag Stuttgart Leipzig Inhaltsverzeichnis Vorwort IX Danksagung XII 1 Einleitung 1 1.1 Zwei radikal verschiedene
Analyse ethischer Texte
 WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG ANGEWANDTE ETHIK SOMMERSEMESTER 2005 Prof. Dr. Kurt Bayertz Analyse ethischer Texte 23. Juli 2005 I. Was sind Argumente? Zunächst eine allgemeine Charakterisierung von Argumenten
WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG ANGEWANDTE ETHIK SOMMERSEMESTER 2005 Prof. Dr. Kurt Bayertz Analyse ethischer Texte 23. Juli 2005 I. Was sind Argumente? Zunächst eine allgemeine Charakterisierung von Argumenten
Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften. Julian Reiss, Durham University
 Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Julian Reiss, Durham University Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Julian Reiss, Durham University Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Substitute
Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Julian Reiss, Durham University Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Julian Reiss, Durham University Kontrafaktuale in den Sozialwissenschaften Substitute
Inhalt. II. Was ist Existenz? 68 Der Supergegenstand 72 Monismus, Dualismus, Pluralismus 75 Absolute und relative Unterschiede 82 Sinnfelder 87
 Inhalt Philosophie neu denken 9 Schein und Sein 10 Der Neue Realismus 14 Die Vielzahl der Welten 17 Weniger als nichts 21 I. Was ist das eigentlich, die Welt? 27 Du und das Universum 33 Der Materialismus
Inhalt Philosophie neu denken 9 Schein und Sein 10 Der Neue Realismus 14 Die Vielzahl der Welten 17 Weniger als nichts 21 I. Was ist das eigentlich, die Welt? 27 Du und das Universum 33 Der Materialismus
Dr. Wolfgang Langer - IV Methoden der empirischen Sozialforschung I - SoSe
 Dr. Wolfgang Langer - IV Methoden der empirischen Sozialforschung I - SoSe 2000 1 Wissenschaftstheorie: Begriffe und Definitionen: Quelle: Giesen,B. & Schmid, M.: Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie.
Dr. Wolfgang Langer - IV Methoden der empirischen Sozialforschung I - SoSe 2000 1 Wissenschaftstheorie: Begriffe und Definitionen: Quelle: Giesen,B. & Schmid, M.: Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie.
Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Die Richtung der Zeit *
 Die Richtung der Zeit * Christian Loew Stichworte: Zeit; Zeitpfeil; Richtung der Zeit; Asymmetrien in der Zeit; Thermodynamik. Wir verlieren manchmal unsere räumliche Orientierung und wissen nicht mehr,
Die Richtung der Zeit * Christian Loew Stichworte: Zeit; Zeitpfeil; Richtung der Zeit; Asymmetrien in der Zeit; Thermodynamik. Wir verlieren manchmal unsere räumliche Orientierung und wissen nicht mehr,
Elementare Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Sprachverarbeitung
 Elementare Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Sprachverarbeitung Kursfolien Karin Haenelt 1 Übersicht Wahrscheinlichkeitsfunktion P Wahrscheinlichkeit und bedingte Wahrscheinlichkeit Bayes-Formeln
Elementare Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Sprachverarbeitung Kursfolien Karin Haenelt 1 Übersicht Wahrscheinlichkeitsfunktion P Wahrscheinlichkeit und bedingte Wahrscheinlichkeit Bayes-Formeln
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik. Quantenlogik. Martin Kohn Münster,
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik Quantenlogik Martin Kohn martin-kohn@gmx.de Münster, 14.09.2009 1 Einleitung Die Quantenlogik beschreibt die Anwendung der klassischen, alltäglichen
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Fachbereich Physik Quantenlogik Martin Kohn martin-kohn@gmx.de Münster, 14.09.2009 1 Einleitung Die Quantenlogik beschreibt die Anwendung der klassischen, alltäglichen
Erklärung und Kausalität. Antworten auf die Leitfragen zum
 TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 5.5.2009 Textgrundlage: C. G. Hempel, Aspekte wissenschaftlicher
TU Dortmund, Sommersemester 2009 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Erklärung und Kausalität Antworten auf die Leitfragen zum 5.5.2009 Textgrundlage: C. G. Hempel, Aspekte wissenschaftlicher
Hilary Putnam. Für die Erkenntnistheorie wichtige Schriften (Auswahl) The Meaning of Meaning (1975) Putnam I ( metaphysischer.
 Hilary Putnam *1926 in Chicago lebt ab 1927 mit seiner Familie in Paris 1934 Rückkehr in die USA 1944-48 Studium der Mathematik und Philosophie an der University of Pennsylvania 1948-49 Graduiertenstudium
Hilary Putnam *1926 in Chicago lebt ab 1927 mit seiner Familie in Paris 1934 Rückkehr in die USA 1944-48 Studium der Mathematik und Philosophie an der University of Pennsylvania 1948-49 Graduiertenstudium
Wir suchen Antworten auf die folgenden Fragen: Was ist Berechenbarkeit? Wie kann man das intuitiv Berechenbare formal fassen?
 Einige Fragen Ziel: Wir suchen Antworten auf die folgenden Fragen: Wie kann man das intuitiv Berechenbare formal fassen? Was ist ein Algorithmus? Welche Indizien hat man dafür, dass ein formaler Algorithmenbegriff
Einige Fragen Ziel: Wir suchen Antworten auf die folgenden Fragen: Wie kann man das intuitiv Berechenbare formal fassen? Was ist ein Algorithmus? Welche Indizien hat man dafür, dass ein formaler Algorithmenbegriff
These der Erklärungslücke: In einem zu klärenden Sinne von Erklärung ist eine solche Erklärung im Fall von Bewusstseinsphänomenen
 1 Worum es geht: Erklärung der Eigenschaften eines Gegenstandes (Makrogegenstand) aufgrund seiner internen Struktur (Mirkostruktur). Voraussetzung: Es ist in gewöhnlichen Fällen im Prinzip möglich, die
1 Worum es geht: Erklärung der Eigenschaften eines Gegenstandes (Makrogegenstand) aufgrund seiner internen Struktur (Mirkostruktur). Voraussetzung: Es ist in gewöhnlichen Fällen im Prinzip möglich, die
Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Enquiry concerning Human Understanding, Übersicht zur Sitzung am )
 TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Hume über die notwendige Verknüpfung ( Enquiry concerning Human
TU Dortmund, Wintersemester 2011/12 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Interpretationskurs: Das menschliche Wissen Hume über die notwendige Verknüpfung ( Enquiry concerning Human
Mentale Verursachung und die neue Reduktionismus-Debatte in der Philosophie des Geistes
 Mentale Verursachung und die neue Reduktionismus-Debatte in der Philosophie des Geistes Michael Esfeld Universität Lausanne, Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (in Patrick Spät (Hg.): Zur Zukunft der Philosophie
Mentale Verursachung und die neue Reduktionismus-Debatte in der Philosophie des Geistes Michael Esfeld Universität Lausanne, Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch (in Patrick Spät (Hg.): Zur Zukunft der Philosophie
Rhetorik und Argumentationstheorie.
 Rhetorik und Argumentationstheorie 2 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Teil 2 Was ist ein Beweis? 2 Wichtige Grundlagen Tautologie nennt man eine zusammengesetzte Aussage, die wahr ist, unabhängig vom
Rhetorik und Argumentationstheorie 2 [frederik.gierlinger@univie.ac.at] Teil 2 Was ist ein Beweis? 2 Wichtige Grundlagen Tautologie nennt man eine zusammengesetzte Aussage, die wahr ist, unabhängig vom
4. Veranstaltung. 16. November 2012
 4. Veranstaltung 16. November 2012 Heute Wiederholung Beschreibung von Bewegung Ursache von Bewegung Prinzip von Elektromotor und Generator Motor Generator Elektrischer Strom Elektrischer Strom Magnetkraft
4. Veranstaltung 16. November 2012 Heute Wiederholung Beschreibung von Bewegung Ursache von Bewegung Prinzip von Elektromotor und Generator Motor Generator Elektrischer Strom Elektrischer Strom Magnetkraft
Bayes-Netze (1) Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Institut für Informatik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Bayes-Netze (1) Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Institut für Informatik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl KI) Bayes-Netze (1) 1 / 22 Gliederung 1 Unsicheres Wissen 2 Schließen
Bayes-Netze (1) Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Institut für Informatik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl KI) Bayes-Netze (1) 1 / 22 Gliederung 1 Unsicheres Wissen 2 Schließen
DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION
 DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
DAVID HUME DIALOGE ÜBER NATÜRLICHE RELIGION NEUNTER TEIL, SEITEN 73-78 DER A PRIORI BEWEIS DER EXISTENZ GOTTES UND SEINER UNENDLICHEN ATTRIBUTE S. 73-74 Demea : Die Schwächen des a posteriori Beweises
Was es gibt und wie es ist
 Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Logik auf Abwegen: Gödels Gottesbeweis
 Logik auf Abwegen: Gödels Gottesbeweis Fabian Graf 06.August 2004 Überblick Einführung Geschichte der Gottesbeweise Verschiedene Gottesbeweise Gödels Gottesbeweis Zusammenfassung Fabian Graf Logik auf
Logik auf Abwegen: Gödels Gottesbeweis Fabian Graf 06.August 2004 Überblick Einführung Geschichte der Gottesbeweise Verschiedene Gottesbeweise Gödels Gottesbeweis Zusammenfassung Fabian Graf Logik auf
Kapitel 1. Aussagenlogik
 Kapitel 1 Aussagenlogik Einführung Mathematische Logik (WS 2012/13) Kapitel 1: Aussagenlogik 1/17 Übersicht Teil I: Syntax und Semantik der Aussagenlogik (1.0) Junktoren und Wahrheitsfunktionen (1.1) Syntax
Kapitel 1 Aussagenlogik Einführung Mathematische Logik (WS 2012/13) Kapitel 1: Aussagenlogik 1/17 Übersicht Teil I: Syntax und Semantik der Aussagenlogik (1.0) Junktoren und Wahrheitsfunktionen (1.1) Syntax
Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus?
 Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus? Raphael E. Bexten Gespräch mit Jugendlichen herausgeber@xyz.de (ersetze XYZ durch aemaet ) urn:nbn:de:0288-20130928923 19.03.2015 Raphael E. Bexten (http://aemaet.de)
Schließt die Wissenschaft die Existenz Gottes aus? Raphael E. Bexten Gespräch mit Jugendlichen herausgeber@xyz.de (ersetze XYZ durch aemaet ) urn:nbn:de:0288-20130928923 19.03.2015 Raphael E. Bexten (http://aemaet.de)
Das Phänomen der Cross-Polaren Anomalie bei Dimensionsadjektiven aus der Sicht von Bierwisch und Kennedy
 Sprachen Sebastian Arndt Das Phänomen der Cross-Polaren Anomalie bei Dimensionsadjektiven aus der Sicht von Bierwisch und Kennedy Einleitung Die vorliegende Arbeitbefasst sich mit dem Thema der graduierbaren
Sprachen Sebastian Arndt Das Phänomen der Cross-Polaren Anomalie bei Dimensionsadjektiven aus der Sicht von Bierwisch und Kennedy Einleitung Die vorliegende Arbeitbefasst sich mit dem Thema der graduierbaren
HM I Tutorium 1. Lucas Kunz. 27. Oktober 2016
 HM I Tutorium 1 Lucas Kunz 27. Oktober 2016 Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 2 1.1 Logische Verknüpfungen............................ 2 1.2 Quantoren.................................... 3 1.3 Mengen und ihre
HM I Tutorium 1 Lucas Kunz 27. Oktober 2016 Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 2 1.1 Logische Verknüpfungen............................ 2 1.2 Quantoren.................................... 3 1.3 Mengen und ihre
3 Wahrscheinlichkeitstheorie
 Einige mathematische Konzepte 3 Wahrscheinlichkeitstheorie 3.1 Wahrscheinlichkeit Die Wahrscheinlichkeitstheorie modelliert Situationen, in denen Unsicherheit über bestimmte Aspekte der Umwelt vorherrscht.
Einige mathematische Konzepte 3 Wahrscheinlichkeitstheorie 3.1 Wahrscheinlichkeit Die Wahrscheinlichkeitstheorie modelliert Situationen, in denen Unsicherheit über bestimmte Aspekte der Umwelt vorherrscht.
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Einführung in die Ethik. Neil Roughley (WS 2006/07)
 Einführung in die Ethik Neil Roughley (WS 2006/07) J.L. Mackie: Ethics Inventing Right and Wrong (1977) metaphysisch epistemisch semantisch Irrealismus Kognitivismus Deskriptivismus Werte existieren nicht
Einführung in die Ethik Neil Roughley (WS 2006/07) J.L. Mackie: Ethics Inventing Right and Wrong (1977) metaphysisch epistemisch semantisch Irrealismus Kognitivismus Deskriptivismus Werte existieren nicht
Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie. Prof. Dr. Jörg Rössel
 Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Jörg Rössel 0. Organisatorisches Leistungsnachweis: Klausur in der letzten Vorlesungswoche (6 10 Fragen) Gegenstand
Wissen und Gesellschaft I Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Jörg Rössel 0. Organisatorisches Leistungsnachweis: Klausur in der letzten Vorlesungswoche (6 10 Fragen) Gegenstand
Vorlesung 1: Einleitung
 Vorlesung 1: Einleitung Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Entscheidung VL 1, FS 12 Einleitung 1/17 1.1 Motivation In der Vorlesung Intermediate Microecoomics haben
Vorlesung 1: Einleitung Georg Nöldeke Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Basel Entscheidung VL 1, FS 12 Einleitung 1/17 1.1 Motivation In der Vorlesung Intermediate Microecoomics haben
Fuzzy Logic und Wahrscheinlichkeit
 Philosophische Fakultät Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Holm Bräuer M.A. Fuzzy Logic und Wahrscheinlichkeit Ein Kurzüberblick Was ist Fuzzy Logic? Fuzzy-Logik (englisch:
Philosophische Fakultät Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Holm Bräuer M.A. Fuzzy Logic und Wahrscheinlichkeit Ein Kurzüberblick Was ist Fuzzy Logic? Fuzzy-Logik (englisch:
Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie
 1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
Evidenz trumpft! Eine Kritik am Begriff der alternativen Fakten. Alexander Reutlinger 1. Beitrag für Cogito
 Evidenz trumpft! Eine Kritik am Begriff der alternativen Fakten Alexander Reutlinger 1 Beitrag für Cogito Rechtspopulistische Politiker wie der amtierende US-Präsident und seine Pendants in Polen, Ungarn,
Evidenz trumpft! Eine Kritik am Begriff der alternativen Fakten Alexander Reutlinger 1 Beitrag für Cogito Rechtspopulistische Politiker wie der amtierende US-Präsident und seine Pendants in Polen, Ungarn,
Erwin Rogler. Zum Leib-Seele Problem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts
 1 Erwin Rogler Zum Leib-Seele Problem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts Montag, den 21.1. und 28.1.2008, 14 15 Uhr Raum 2501, Campus Westend Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltung von Prof.
1 Erwin Rogler Zum Leib-Seele Problem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts Montag, den 21.1. und 28.1.2008, 14 15 Uhr Raum 2501, Campus Westend Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltung von Prof.
Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft
 Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit Pr[X > y + x X > x]? Da bei den ersten x Versuchen kein Erfolg eintrat, stellen wir uns vor, dass das
![Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit Pr[X > y + x X > x]? Da bei den ersten x Versuchen kein Erfolg eintrat, stellen wir uns vor, dass das Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit Pr[X > y + x X > x]? Da bei den ersten x Versuchen kein Erfolg eintrat, stellen wir uns vor, dass das](/thumbs/73/68375109.jpg) Sei X geometrisch verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. Dann ist Pr[X = k] die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem binären Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p genau in der k-ten unabhängigen
Sei X geometrisch verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. Dann ist Pr[X = k] die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem binären Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p genau in der k-ten unabhängigen
Statische Spiele mit vollständiger Information
 Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Statische Spiele mit vollständiger Information Wir beginnen nun mit dem Aufbau unseres spieltheoretischen Methodenbaukastens, indem wir uns zunächst die einfachsten Spiele ansehen. In diesen Spielen handeln
Wir bauen eine Zeitmaschine
 Zeitmaschinen Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten die Physiker, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was Zeit ist: Sie verläuft kontinuierlich, in eine Richtung und ist absolut, also unabhängig
Zeitmaschinen Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts glaubten die Physiker, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was Zeit ist: Sie verläuft kontinuierlich, in eine Richtung und ist absolut, also unabhängig
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation
 Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Wissenschaftliches Arbeiten
 Wissenschaftliches Arbeiten Andreas Schoknecht Jan Recker, Scientific Research in Information Systems A Beginner's Guide, Springer, 2013 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE INFORMATIK UND FORMALE BESCHREIBUNGSVERFAHREN
Wissenschaftliches Arbeiten Andreas Schoknecht Jan Recker, Scientific Research in Information Systems A Beginner's Guide, Springer, 2013 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE INFORMATIK UND FORMALE BESCHREIBUNGSVERFAHREN
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie Lösungsvorschläge zu Übungsblatt 1
 TUM, Zentrum Mathematik Lehrstuhl für Mathematische Physik WS 2013/ Prof. Dr. Silke Rolles Thomas Höfelsauer Felizitas Weidner Tutoraufgaben: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie svorschläge zu
TUM, Zentrum Mathematik Lehrstuhl für Mathematische Physik WS 2013/ Prof. Dr. Silke Rolles Thomas Höfelsauer Felizitas Weidner Tutoraufgaben: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie svorschläge zu
Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache
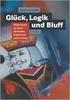 Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache Wie gewinnt man in Diskussionen? Carmen Kölbl SS 2004 Seminar: " Logik auf Abwegen: Irrglaube, Lüge, Täuschung" Übersicht logische Grundlagen Inferenzregeln
Logik und Missbrauch der Logik in der Alltagssprache Wie gewinnt man in Diskussionen? Carmen Kölbl SS 2004 Seminar: " Logik auf Abwegen: Irrglaube, Lüge, Täuschung" Übersicht logische Grundlagen Inferenzregeln
1. Gruppen. 1. Gruppen 7
 1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
1. Gruppen 7 1. Gruppen Wie schon in der Einleitung erläutert wollen wir uns in dieser Vorlesung mit Mengen beschäftigen, auf denen algebraische Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften definiert sind.
Philosophische Semantik
 Wir behaupten, daß es möglich ist, daß zwei Sprecher genau im selben Zustand (im engen Sinne) sind, obwohl die Extension von A im Ideolekt des einen sich von der Extension von A im Ideolekt des anderen
Wir behaupten, daß es möglich ist, daß zwei Sprecher genau im selben Zustand (im engen Sinne) sind, obwohl die Extension von A im Ideolekt des einen sich von der Extension von A im Ideolekt des anderen
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically
 Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
