ANALYSE DIE REFORM DES FINANZAUSGLEICHS IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN ÖKONOMISCHER RATIONALITÄT UND BESITZSTANDSDENKEN
|
|
|
- Angela Weiner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ANALYSE DIE REFORM DES FINANZAUSGLEICHS IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN ÖKONOMISCHER RATIONALITÄT UND BESITZSTANDSDENKEN iw-trends Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts Bis Ende 2004 muss ein neues Finanzausgleichsgesetz verabschiedet sein. Die Bundesregierung hat inzwischen ein Reformkonzept vorgelegt, das von den meisten Bundesländern abgelehnt wird. Die drei Gegenvorschläge, die verschiedene Ländergruppen vorgelegt haben, lassen einen grundlegenden Interessenkonflikt erkennen: Die Empfängerländer wollen den Status quo so weit wie möglich bewahren, die Geberländer ihre Zahlungslasten und die konfiskatorisch hohe Grenzbelastung mildern. Denn von zusätzlichen Lohnsteuermehreinnahmen belässt der bestehende Finanzausgleich den meisten Bundesländern gerade einmal 10 Prozent. Ein neuer Reformvorschlag des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln erhöht diesen Eigenanteil auf 35 bis 40 Prozent. Dies schafft bei den Bundesländern Anreize, mehr als bisher für die Stärkung der eigenen Finanzkraft zu sorgen. Außerdem erfüllt dieser Vorschlag die Auflage der Ministerpräsidentenkonferenz, nach der ein neuer Finanzausgleich verglichen mit dem alten keinem Bundesland größere Einbußen als 12 DM je Einwohner zumuten darf. In einem höchstrichterlichen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 11. November 1999 eine Reform des derzeit praktizierten Finanzausgleichs angemahnt und dieses Urteil mit einem konkreten Zeitplan für das Umsetzen der notwendigen Reformen verbunden. Demnach muss bis Ende 2002 ein Maßstäbegesetz verabschiedet sein, in dem die grundsätzlichen Vorgaben des Grundgesetzes konkretisiert werden. Bis Ende 2004 ist schließlich das neue Finanzausgleichsgesetz über die parlamentarischen Hürden zu bringen. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Entwurf zum Maßstäbegesetz vorgelegt. Er wird derzeit zwischen Bund und Ländern heftig diskutiert, wobei die Positionen der Bundesländer in einzelnen Punkten äußerst kontrovers sind. Dies zeigt sich auch darin, dass einige Ländergruppen völlig 38
2 unterschiedliche Gegenvorschläge zum Entwurf der Bundesregierung vorgelegt haben. In dieser Analyse sollen zunächst die Inhalte des Gesetzentwurfs der Bundesregierung und die Gegenvorschläge der Bundesländer vor dem Hintergrund des bestehenden Systems dokumentiert werden. Anschließend wird ein neuer Reformvorschlag des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln vorgestellt. Grundsätzlich steht jeder Finanzausgleich in einer föderal organisierten Volkswirtschaft im Spannungsfeld distributions- und allokationspolitischer Ziele: Das Ziel der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verlangt ein weitgehendes Angleichen der Finanzkraft der einzelnen Bundesländer. Aus allokativer Sicht muss es für die einzelnen Länder genügend Anreize geben, ihre Finanzkraft aus eigener Anstrengung zu verbessern. Zu diesen grundsätzlichen Konflikten kommen politische Interessenlagen, die sich auf das Bewahren finanzieller Besitzstände konzentrieren. So favorisiert die Ministerpräsidentenkonferenz einen Finanzausgleich, der verglichen mit dem bestehenden System keinem Bundesland Einbußen von mehr als 12 DM je Einwohner zumutet. Der derzeit praktizierte Finanzausgleich (Huber/Lichtblau, 1997) ist dreistufig aufgebaut (Übersicht 1). Auf der ersten Stufe findet der Umsatzsteuervorwegausgleich statt. Bis zu einem Viertel des Umsatzsteueraufkommens der Bundesländer wird umverteilt. Im Jahr 2000 waren dies etwa 17 Milliarden DM. Dabei erhalten die Länder, deren Steuerkraft (Steuereinnahmen je Einwohner) unter dem Länderdurchschnitt liegen, erhöhte Umsatzsteueranteile. Die zweite Stufe bildet der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne. Hierfür wird zunächst die Finanzkraft der einzelnen Länder ermittelt. In diese Messgröße gehen die gesamten Ländersteuereinnahmen und die Hälfte der Gemeindesteuereinkünfte ein. Der Finanzkraft wird der Finanzbedarf gegenübergestellt. Dabei wird von dem Grundsatz ausgegangen, dass der Finanzbedarf in allen Bundesländern je Einwohner gleich hoch ist. Der Das alte System 39
3 strukturelle Mehrbedarf großer, hoch verdichteter Gemeinden und Stadtstaaten wird über eine Einwohnerwertung berücksichtigt. Übersicht 1: Konstruktionselemente des Finanzausgleichs Bestehendes System und Vorschläge des Maßstäbegesetzes Bestehendes System Vorschläge des Maßstäbegesetzes 1. Stufe: Umsatzsteuervorwegausgleich Ergänzungsanteile Maximal 25% des Umsatzsteuer-Länder- Anteils. Berechtigte Länder mit unterdurchschnittlichen Pro- Kopf-Steuereinnahmen (Länder- und Einkommensteuern). Auffüllungsgrad Auffüllung bis zu 92% der Steuerkraft des Länderdurchschnitts; restliche Umsatzsteuer wird nach Einwohnern verteilt. Finanzkraft 2. Stufe: Länderfinanzausgleich Wie im bestehenden System. Steuerschwache Länder, aber nur besonders große Einnahmelücken werden ausgeglichen. Offen, doch Einnahmenreihenfolge bleibt gewahrt, keine Mindestgarantie und Sicherung eines Eigenanteils, keine Vollauffüllung bis zu einer bestimmten Grenze. Definition Ländersteuern und 50% der Gemeindesteuern. Sämtliche Länder- und Gemeindesteuern. Sonderlasten Abzug für Hafenlasten. Keine. Finanzbedarf Grundsatz Einwohnermaßstab. Wie im bestehenden System. Mehrbedarfe Für große/dicht besiedelte Gemeinden und Stadtstaaten. Maßstäbe Nicht ausgeführt; Mehrbedarfe für Stadtstaaten aus Großstadtvergleich abgeleitet. Höhe und Methode Einwohnerwertung: Stadtstaaten 135%; Gemeinden bis 136%. Ausgleichstarif Komplizierter progressiver Stufentarif, der jedem Land eine Finanzkraft von mindestens 95% des Bedarfs garantiert. 3. Stufe: Bundesergänzungszuweisungen Für Gemeinden, Stadtstaaten und dünn besiedelte Länder. Offen; Bewahrung des Status quo möglich. Offen; Bewahrung des Status quo möglich. Einfacher Tarif, der Grenzbelastung senkt und keine Mindestfinanzkraft garantiert. Grundsatz Ja. Ja; mit reduziertem Gesamtvolumen. Definition Leistungsschwäche Länder, deren Finanzkraft nach Länderfinanzausgleich ihren Finanzbedarf unterschreitet. Fehlbetrags-BEZ 90% der nach Finanzausgleich verbleibenden Lücke. Sonder-BEZ Vor allem für die neuen Länder, für kleine Länder zum Ausgleich höherer Kosten politischer Führung, Übergangshilfen für westdeutsche Länder und Hilfen zur Überwindung von Haushaltsnotlagen (Hamburg und Saarland). Finanzschwache Länder mit deutlich unterdurchschnittlicher Finanzkraft. Ja, für leistungsschwache Länder, aber Wahrung des Abstandsgebots. Befristet in Ausnahmefällen. Quelle: Deutscher Bundestag, 2001; Bundesrat 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Übersteigt die Finanzkraft eines Landes seinen Finanzbedarf, ist es finanzstark und damit ausgleichspflichtig; andernfalls gelten sie als finanzschwach 40
4 und damit ausgleichsberechtigt. Nach einem komplizierten progressiven Tarif transferieren finanzstarke an finanzschwache Bundesländer Finanzmittel, bis jedes Land mindestens 95 Prozent seines Finanzbedarfs erreicht. Diese horizontalen Transfers summierten sich im Jahr 2000 auf 16,3 Milliarden DM. Anschließend füllt der Bund auf der dritten Stufe des Finanzausgleichs die bei den finanzschwachen Ländern verbleibenden Lücken zu 90 Prozent (Ausgleichstarif) auf, so dass jedes Land mindestens 99,5 Prozent seines Finanzbedarfs erreicht. Diese Transfers erreichten im Jahr 2000 einen Umfang von 7,2 Milliarden DM. Anschließend gewährt der Bund Sonder-Bundesergänzungszuweisungen, die im vergangenen Jahr 18,9 Milliarden DM ausmachten. Hiermit werden besondere Lasten ausgeglichen, die überwiegend in den neuen Bundesländern anfallen. Der bestehende Finanzausgleich erfüllt zwar weitgehend die distributiven Aufgaben. Doch dies geht zu Lasten des allokativen Ziels. Tabelle 1 dokumentiert die ausgeprägten Nivellierungseffekte des bestehenden Finanzausgleichs: Vor dem Ausgleich liegt die Spannweite der Steuereinnahmen je Einwohner zwischen 52,4 Prozent (Thüringen) und 165,8 Prozent (Hamburg) des Durchschnitts. Nach Finanzausgleich schrumpft die Spannweite zwischen steuerstärkstem und steuerschwächstem Bundesland auf 88,3 bis 146,6 Prozent. Dieses System schafft massive Fehlanreize. Ablesen lässt sich dies an der Grenzbelastung der einzelnen Länder: Bei den meisten Bundesländern werden von zusätzlichen Lohnsteuereinnahmen rund 90 Prozent im Zuge des Finanzausgleichs abgeschöpft (Huber/Lichtblau, 2000). Anders gewendet: Von jeder zusätzlichen Lohnsteuereinnahme in Höhe von 1 DM bleibt den meisten Ländern gerade mal ein Eigenanteil von 10 Pfennigen übrig. Schwächen Vor diesem Hintergrund wird erklärbar, dass es für die Bundesländer wenig Anreize gibt, das heimische Wirtschaftswachstum zu fördern und die eigenen Steuerquellen zu pflegen. Empirische Studien und zahlreiche Berichte der Landes-Rechnungshöfe belegen denn auch, dass die geradezu konfiskatorisch hohe Grenzsteuerlast die Steuerdurchsetzung in den betroffenen Bundesländern negativ beeinflusst. 41
5 Der Abbau der hohen Grenzbelastungen ist folgerichtig ein zentrales Reformanliegen. Der Entwurf der Bundesregierung zum Maßstäbegesetz hat dies ansatzweise durchaus im Blick, beispielsweise beim Verzicht auf eine garantierte Mindestfinanzkraftausstattung, die zu einer besonders hohen Grenzbelastung führt. Doch selbst diese vorsichtigen Ansätze der Bundesregierung sind auf den massiven Widerspruch der Mehrheit der Bundesländer gestoßen. Tabelle 1: Umverteilungen und Grenzbelastungen im bestehenden Finanzausgleich, Bezugsjahr 2000 Steuereinnahmen je Einwohner Belastung 3) zusätzlicher Steuereinnahmen Vor Ausgleich 1) Nach Ausgleich 2) in Prozent der Länderdurchschnitt = 100 Einnahmen nach Ausgleich Saarland 83,9 93,8 91,9 Bremen 108,4 130,1 91,6 Mecklenburg-Vorpommern 55,1 89,2 91,4 Thüringen 52,4 88,3 91,1 Brandenburg 57,4 89,2 91,0 Sachsen-Anhalt 52,8 89,1 90,9 Rheinland-Pfalz 93,9 94,8 90,1 Sachsen 56,4 90,5 89,9 Berlin 97,4 125,6 89,8 Schleswig-Holstein 93,9 93,2 89,0 Niedersachsen 91,4 93,8 87,2 Hamburg 165,8 146,6 83,0 Hessen 129,7 106,7 80,4 Baden-Württemberg 114,0 100,6 78,7 Bayern 112,3 100,0 77,7 Nordrhein-Westfalen 109,4 100,6 71,0 1) Realsteuern der Gemeinden: 1999 mit Wachstumsrate laut Steuerschätzung fortgeschrieben. 2) Steuereinnahmen nach Umsatzsteuervorwegausgleich, Länderfinanzausgleich und Fehlbetrags-BEZ. 3) Abfluss zusätzlicher Lohnsteuereinnahmen eines Landes. Quelle: BMF, 2001; Statistisches Bundesamt, 2000; Arbeitskreis Steuerschätzung, 2000; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Kritische Punkte des Maßstäbegesetz Bei dem Entwurf des Maßstäbegesetzes und der Kritik der Bundesländer stehen neben der hier nicht behandelten vertikalen Umsatzsteuerverteilung - fünf Punkte im Vordergrund: 42
6 Die Rolle des Umsatzsteuervorwegausgleichs, die Bestimmung der Finanzkraft der einzelnen Bundesländer, die Definition des Finanzbedarfs, die Festlegung des Ausgleichstarifs und die Ausgestaltung der Bundesergänzungszuweisungen. Im Folgenden sollen die Vorschläge der Bundesregierung und die Kritik der Bundesländer zu diesen fünf Punkten kurz skizziert werden. Auf Länderebene haben sich zwei Koalitionen gebildet: nämlich eine Länderminderheit der vier Geberländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein- Westfalen auf der einen Seite und eine Ländermehrheit (alle anderen Länder ohne Thüringen) auf der anderen Seite. Umsatzsteuervorwegausgleich: Dieses Ausgleichsinstrument wollen Bund und Länder beibehalten und weiterhin bis zu 25 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen der Länder an steuerschwache Bundesländer umverteilen. Der Bund verlangt dabei, dass auf dieser Umverteilungsstufe die Einnahmenreihenfolge nicht verändert werden darf. Dies allerdings lehnen die vier Geberländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen ab, um sich die Möglichkeit offen zu halten, pauschalierte Zahlungen im Umsatzsteuervorwegausgleich zu leisten (Huber/Lichtblau, 2000). Eine Mindestauffüllung, wie sie das jetzige System garantiert, lehnt die Bundesregierung wegen verminderter Anreizeffekte ab. Dies stößt auf den Widerstand der Ländermehrheit, die auf eine Beibehaltung der Mindestgarantie drängt. Messung der Finanzkraft: Hier plädieren die vier Geberländer für eine Beibehaltung des Status quo, bei dem die Finanzkraft durch die gesamten Ländersteuern und nur die Hälfte der Gemeindesteuern definiert wird. Der Bund will dagegen die Gemeindesteuern in voller Höhe berücksichtigt wissen. Die übrigen Bundesländer beziehen eine mittlere Position, in dem sie die Realsteuern wie bisher hälftig, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dagegen zu 90 Prozent einbeziehen wollen. Diese unter- 43
7 schiedlichen Abgrenzungen beinhalten Konfliktstoff, weil sie mit massiven Umverteilungseffekten verbunden sind (Tabelle 2). Tabelle 2: Modellrechnung: Fiskalische Effekte und Grenzbelastung des Finanzausgleichs bei voller Einrechnung der Gemeindesteuern - Bezugsjahr Mehr- und Mindereinnahmen gegenüber Status quo (in DM je Einwohner) Grenzbelastung (Belastung zusätzlicher Lohnsteuereinnahmen in Prozent der Einnahmen nach Ausgleich) Ohne Mit 1) Ohne Mit 1) Kompensation Nachrichtl: Status quo Nordrhein-Westfalen ,1 68,1 71,0 Bayern ,9 73,7 77,7 Baden-Württemberg ,8 75,3 78,7 Niedersachsen ,6 88,1 87,2 Hessen ,9 75,9 80,4 Sachsen ,0 94,7 89,9 Rheinland-Pfalz ,3 89,2 90,1 Sachsen-Anhalt ,2 95,9 90,9 Schleswig-Holstein ,7 84,0 89,0 Thüringen ,3 96,1 91,1 Brandenburg ,2 96,0 91,0 Mecklenburg ,8 96,5 91,4 Vorpommern Saarland ,3 97,0 91,9 Berlin ,0 89,3 89,8 Hamburg ,5 79,1 83,0 Bremen ,7 91,4 91,6 Nachrichtlich: Transfers in Millionen DM ) Kompensation: Lineare Reduzierung der Ausgleichstarife, bis die Transfers im Länderfinanzausgleich einschließlich der Fehlbetrags-BEZ exakt dem Status-quo-Ausgleichsvolumen entsprechen. Quelle: BMF, 2000; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Nachteile für finanzstarke Länder Vor allem jene Länder, deren originäre Steuerkraft relativ hoch ist (Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern) würden verglichen mit dem Status quo erhebliche Verluste erleiden, die in der Spitze bis zu 421 DM je Einwohner erreichen können. Außerdem würde die volle Einbeziehung der 44
8 Gemeindesteuern die Anreizprobleme noch verschärfen. In einigen Ländern, so das Saarland oder die Stadtstaaten Bremen und Hamburg, würde die marginale Steuerbelastung fast 100 Prozent erreichen. Die Befürworter dieser Neuregelung argumentieren nun allerdings, dass die volle Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen eine Absenkung des Ausgleichstarifs, also der Grenzbelastungen, gestatten würde. Damit steigt die Finanzausgleichsmasse an und das gleiche Transfervolumen wird mit niedrigeren Abschöpfungen erreicht. Diese Behauptung ist empirisch aber keineswegs zutreffend, wie das folgende Experiment zeigt: Bei voller Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen wird der gegenwärtige Ausgleichstarif linear so weit abgesenkt, dass insgesamt das gleiche Ausgleichsvolumen wie bisher (2000) erreicht wird. Im Vergleich zum Status quo gehen dadurch zwar die Grenzbelastungen für die finanzstarken Länder leicht zurück, aber vor allem in den neuen Bundesländern steigen sie an. Damit weist dieser Vorschlag in die falsche Richtung. In den Ländern, in denen die Grenzbelastung ohnehin schon sehr hoch ist, würden die Anreizprobleme noch weiter verschärft. In den reichen Ländern, in denen die Grenzbelastung relativ niedrig ist, würden sich die Anreizstrukturen verbessern, allerdings nur geringfügig. Unter Effizienzgesichtspunkten ist daher die volle Einbeziehung der Gemeindeeinnahmen abzulehnen. Finanzbedarf: Bei der Definition des Finanzbedarfs gehen alle Vorschläge grundsätzlich von einem in allen Bundesländern gleich hohen Bedarf je Einwohner aus. Allerdings kann ein "abstrakter Mehrbedarf" einen höheren Finanzbedarf begründen, der dann nach der Konzeption des Maßstäbegesetzes des Bundes und nach Auffassung der Ländermehrheit durch eine Einwohnerwertung, also eine rechnerische Erhöhung der Einwohnerzahl, berücksichtigt werden soll. Strittig sind hier vor allem die Einwohnerwertung bei den Stadtstaaten, die gegenwärtig bei 135 Prozent liegt, sowie die Frage, ob bei dünn besiedelten Flächenländern eine Einwohnerwertung einzuführen ist. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist ein eventueller Mehrbedarf, der eine Einwohnerwertung rechtfertigt, anhand verlässlicher und objektivierbarer Indikatoren zu bestimmen. Allerdings lässt das Maßstäbegesetz die Frage, wie Mehrbedarfe zu bestimmen sind, offen. Insoweit ist hier das Gesetz ergänzungsbedürftig. Ausgabenansatz ist falsch 45
9 Regionale Mehrbedarfe mit Hilfe von Ausgabenvergleichen zu ermitteln, ist ökonomisch wenig sinnvoll. Denn höhere Ausgaben müssen keinesfalls Sonderbelastungen widerspiegeln, sondern können auch auf eine bessere Finanzausstattung oder auf ein höherwertiges Leistungsangebot zurückzuführen sein. Deshalb sollte der Mehrbedarf nicht an Ausgabenunterschieden, sondern an Kostenunterschieden ansetzen. Mehrbedarf ist dann der Aufwand, den ein Land mit ungünstigeren Kostenbedingungen aufwenden muss, um seinen Bürgern mit öffentlichen Leistungen den gleichen Nutzen zu schaffen, den andere Länder schon bei niedrigerem Aufwand erreichen. Dies entspricht dem mikroökonomischen Konzept der kompensierenden Variationen (Baretti, u. a., 2001). Empirische Studien, die mit Kostenvergleichen arbeiten, weisen zwar für Stadtstaaten einen Mehrbedarf nach, doch er ist niedriger als im gegenwärtig praktizierten System (bis zu 135 Prozent bei Stadtstaaten). Für Bremen wird ein Mehrbedarf von 111 bis 113 Prozent ermittelt, in Hamburg lag er zwischen 113 und 119 Prozent und in Berlin zwischen 110 und 120 Prozent (Baretti u.a., 2001). Ausgleichstarif: Im Hinblick auf den Ausgleichstarif verlangen der Bund und die Länderminderheit vor allem, dass den Ländern aus Verbesserungen ihrer Finanzkraft ein Eigenanteil verbleibt. Wie in der Gesetzesänderung ausgeführt wird, wäre eine Mindestfinanzkraftgarantie, wie sie der gegenwärtige Finanzausgleich vorsieht, mit dieser Vorgabe nicht zu vereinbaren. Dies ist ökonomisch insoweit zutreffend, als Länder, die an der Mindestgrenze liegen, sich in einer Armutsfalle befinden und unter besonders hohen Grenzbelastungen leiden. Im Vorschlag der Ländermehrheit spielt dieses unter Anreizgesichtspunkten zentrale Problem dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Sie fordern wie bisher Mindestgarantien von mindestens 90 Prozent sowie einen progressiven Tarif für die Zahlerländer. Bundesergänzungszuweisungen (BEZ): Nach dem Urteil des BVerfG darf der Bund nur noch leistungsschwachen Ländern Ergänzungszuweisungen zahlen. Nach dem Entwurf der Bundesregierung zum Maßstäbegesetz ist ein Bundesland dann als leistungsschwach einzustufen, wenn seine Finanzausstattung nach Finanzausgleich noch deutlich unter dem Länderdurchschnitt liegt. Demnach wären die leistungsschwachen Länder eine Teil- 46
10 menge der finanzschwachen Länder. Daraus folgt aber auch, dass die bislang praktizierte Förderung aller finanzschwachen Länder nicht mehr aufrecht zu erhalten wäre. Die Länderminderheit teilt diese Position der Bundesregierung. Die Ländermehrheit will dagegen die Leistungsschwäche nicht nur über die Finanzkraft, sondern auch anhand der allgemeinen Ausgabenbelastung definieren. Dies ist insofern problematisch, weil der Terminus Ausgabenbelastung ähnlich vage ist wie der des Mehrbedarfs. Darüber hinaus gäbe es bei Berücksichtigung einer allgemeinen Ausgabenbelastung einen Konflikt mit der Auflage, nach der die BEZ die Finanzkraftreihenfolge nicht verschieben dürfen. Ein Beispiel zeigt dies: Wenn von zwei Ländern mit gleich hoher Finanzkraft eines eine hohe Ausgabenlast zu tragen hat, darf dieses Land gleichwohl keine höheren BEZ erhalten, da sich andernfalls das Finanzkraft-Ranking verschieben würde. Hinsichtlich der Sonderbedarfs-BEZ betont der Gesetzentwurf der Bundesregierung deren zeitlich limitierte Beschränkung auf Ausnahmefälle (Haushaltsnotlage oder Hilfen für die neuen Bundesländer) und deren degressive Ausgestaltung. Im Klartext bedeutet dies wohl, dass der Bund diese Zahlungen abbauen will. Dies lehnen die Bundesländer ab. Die Interessenlage bei der anstehenden Reform des Finanzausgleichs ist somit sehr unterschiedlich. Während die Empfängerländer im Rahmen des BVerfG-Urteils den Status quo so weit wie möglich bewahren wollen, sind die Geberländer an einem Abbau ihrer Zahlungsverpflichtung und der hohen Grenzbelastung interessiert. Zur Konkretisierung ihrer Interessen haben die verschiedenen Ländergruppen inzwischen eigene Reformvorschläge ausgearbeitet. Ein Vorschlag stammt von den drei süddeutschen Geberländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, das Geberland Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen Vorschlag präsentiert. Der dritte Vorschlag stammt von der Ländermehrheit, zu der alle übrigen Bundesländer (außer Thüringen) zählen. Reformvorschläge der Länder Die Übersicht 2 stellt die wesentlichen Konstruktionselemente dieser drei Vorschläge dar. Hinsichtlich des Umsatzsteuervorwegausgleichs ist der Vorschlag der Südländer bemerkenswert. Sie wollen die Leistungen nicht an der Steuerkraft des jeweiligen Jahres, sondern an der in den drei zurücklie- 47
11 Übersicht 2: genden Jahren (Lag-Modell) abhängig machen. Dies hat zur Folge, dass marginale Steuereinnahmen im laufenden Jahr den Ländern grenzbelastungsfrei zufließen, in den folgenden Jahren aber nachversteuert werden müssen. Außerdem wollen die Südländer anders als die anderen Bundesländer die Hälfte der Gemeindesteuereinnahmen bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigen. Die gleiche Position beziehen sie bei der Ermittlung der Finanzkraft im Rahmen des Finanzausgleichs. Den Mehrbedarf der Stadtstaaten will diese Ländergruppe durch den Abzug von Festbeträgen regeln, während die anderen beiden Reformvorschläge diesbezüglich an der Methode der Einwohnerwertungen festhalten wollen. Reform des Finanzausgleichs: Die Vorschläge der Bundesländer Ländermehrheit 1) Länderminderheit Südländer 2) NRW 1. Umsatzsteuervorwegausgleich Ergänzungsanteile ja ja ja Bemessungsgrundlage Ländersteuerkraft Ländersteuer- und hälftige Ländersteuerkraft Gemeindesteuerkraft Auffüllungsgrad 90% 92% 99% Rate 90% 100% als Festbetrag (3-Jahres-Lag) 95% 2. Länderfinanzausgleich Finanzkraft 100% Landessteuern; 90% Gemeinde-USt und Est; 50% Realsteuern. Finanzbedarf Einwohnerwertungen: Stadtstaaten (135%); Gemeindesteuern (Dichteklauseln und Sozialhilfekomponente). Tarif Vollauffüllung bis 77%; danach linear degressiver Satz (100 bis 45%); Abschöpfung mit linear progressivem Satz (50 bis 75%) und ggf. Zu- oder Abschläge. Fehlbetrags-BEZ Vollauffüllung verbleibender Lücken zu 66,67%. Sonder-BEZ 12,32 Mrd. DM (NBL); 0,99 Mrd. DM kleine und strukturschwache Länder. 3. Bundesleistungen 100% Landessteuern; 50% Gemeindesteuern minus Festbeträge für Stadtstaaten. Einwohnerwertung für Gemeinden plus Zuschlag für Städte mit mehr als 1 Mio. Einwohner. Auffüllung mit linear degressivem Satz (80 bis 47,5%); Abschöpfung mit linear progressivem Satz (47,5 bis 80%) und ggf. Zu- oder Abschläge. Auffüllung bis 99% der verbleibenden Lücken mit einem Tarif von 25%. 14 Mrd. DM (NBL); 3,2 Mrd. DM (Struktur-hilfe); 3 Mrd. DM (Schuldenabbau); 0,5 Mrd. DM (Berlin); 0,3 Mrd. DM (politische Führung). 100% Landessteuern 50% Gemeindesteuern. Einwohnerwertungen: Stadtstaaten (135%), Wegfall der Dichteklauseln bei Gemeinden. Auffüllung mit linear degressivem Satz (77,5 bis 35%); Abschöpfung mit linear progressivem Satz (35 bis 77%) und ggf. Zu- oder Abschläge. Vollauffüllung verbleibender Lücken zu 85%. 14,15 Mrd. DM (NBL);0,93 Mrd. DM (politische Führung); 0,23 Mrd. DM (Berlin); 0,3 Mrd. DM (Hafenlasten); 0,654 Mrd. DM (Übergang). Umsatzsteuer 3,34 Mrd. Umsatzsteuer zusätzlich für Ländern 1) Neue Länder (ohne Thüringen), Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. 2) Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Quelle: Finanzbehörde Hamburg, 2001; Finanzministerium Bayern, 2001; Finanzministerium NRW, 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 48
12 Alle drei Reformvorschläge beinhalten eine Vereinfachung der Tarife und linear progressive Abschöpfungen. Lediglich die Ländermehrheit plädiert für eine Mindestgarantie. Bei den BEZ unterscheiden sich die drei Vorschläge im Detail zwar erheblich. Doch im grundsätzlichen Erhalt der Bundeszuschüsse sind sie sich einig. Das gilt auch für die absolute Höhe der Transfers. Hier soll der Status quo mit 22 bis 23 Milliarden DM erhalten bleiben. Tabelle 3 zeigt in einer Modellrechnung für das Jahr 2000 die fiskalischen und allokativen Effekte der drei Reformvorschläge: Probleme bleiben ungelöst Hinsichtlich der fiskalischen Effekte erfüllt keiner der Vorschläge das Kriterium, das durch die Reform des Finanzausgleichs kein Bundesland Einbußen von mehr als 12 DM je Einwohner zugemutet werden soll. Keiner der drei Vorschläge löst das Problem der hohen Grenzbelastung. Gemessen am Eigenanteil, also dem Betrag, der den Ländern von zusätzlichen Steuereinnahmen verbleibt, verschärft es sich sogar. Das gilt auf jeden Fall für den Vorschlag der Ländermehrheit. Hier sinkt bei acht Ländern der Eigenanteil unter die 5-Prozent-Marke, die im bestehenden System von keinem Bundesland unterschritten wird. Insofern bleibt die Suche nach einem Reformkonzept, das die fiskalischen und allokativen Ziele zu einem ökonomisch überzeugenden Einklang bringt, eine Herausforderung. Deshalb legt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln aufbauend auf frühere Vorschläge ein aktualisiertes Reformkonzept vor (Huber/Lichtblau, 1997; Huber/Lichtblau, 2000). Komponenten, die aus früheren Reformvorschlägen übernommen worden sind: Neues IW- Reformmodell Einfacher linearer Tarif, der die Grenzbelastung senkt. Pauschalierte Transfers, die Gewinner und Verlierer des Finanzausgleichs kompensieren. 49
13 Abwicklung dieser Pauschaltransfers über den Umsatzsteuervorwegausgleich und über die Sonder-BEZ. Tabelle 3: Modellrechnung: Fiskalische und allokative Effekte der Vorschläge der Bundesländer zur Reform des Finanzausgleichs 1) - Bezugsjahr Fiskalische Effekte (Mehr- und Mindereinnahmen gegenüber Status quo in DM je Einwohner) Allokative Effekte (Eigenanteil: Verbleib zusätzlicher Lohnsteuereinnahmen in Prozent der Einnahmen nach Ausgleich) Ländermehrheit 2) Länderminderheit Ländermehrheit 2) Status quo Länderminderheit Nachrichtl: Südländer 3) länder NRW Süd- NRW 3) Nordrhein-Westfalen ,4 32,6 34,3 29,0 Bayern ,0 24,3 24,3 22,3 Baden-Württemberg ,2 22,3 22,6 21,3 Niedersachsen ,9 13,2 12,9 12,8 Hessen ,0 20,7 21,2 19,6 Sachsen ,7 11,0 10,5 10,1 Rheinland-Pfalz ,5 10,8 10,4 9,9 Sachsen-Anhalt ,3 9,9 9,4 9,1 Schleswig-Holstein ,6 17,9 9,8 11,0 Thüringen ,2 9,8 9,3 8,9 Brandenburg ,5 9,9 9,4 9,0 Mecklenburg-Vorp ,7 9,3 8,9 8,6 Saarland ,7 8,9 8,5 8,1 Berlin ,5 16,7 10,5 10,2 Hamburg ,9 17,8 17,9 17,0 Bremen ,1 15,3 9,7 8,4 1) Berücksichtigt sind der Umsatzsteuervorwegausgleich, der Länderfinanzausgleich, die Fehlbetrags-BEZ und die Sonder- BEZ (ohne die Übergangs- und Haushaltsnothilfen). 2) Alle Bundesländer außer NRW, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. 3) Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Quelle: BMF, 2001; Finanzbehörde Hamburg, 2001; Finanzministerium Bayern, 2001; Finanzministerium NRW, 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Die Umverteilungseffekte des Umsatzsteuervorwegausgleichs fallen in dem nun vorgelegten Reformkonzept nochmals größer aus als in früheren Vorschlägen. Außerdem wird ein kleiner Teil des Transfervolumens dafür ein- 50
14 gesetzt, um die fiskalischen Effekte der Reform nicht wesentlich vom Status quo abweichen zu lassen und in der 12-DM-Marge zu bleiben, die die Ministerpräsidentenkonferenz vorgegeben hat. Bei der Ermittlung von Finanzkraft und Finanzbedarf blieb bei der Berücksichtigung des strukturellen Mehrbedarfs der Stadtstaaten die Einwohnerwertung unverändert. Der Vergleich des Reformkonzepts mit dem bestehenden Finanzausgleich wird dadurch erleichtert. Freilich bietet der IW-Reformvorschlag Raum für eine alternative Erfassung des strukturellen Mehrbedarfs. Im Umsatzsteuervorwegausgleich werden 16 Prozent des Länderanteils an der Umsatzsteuer - im Jahr 2000 waren das 20,2 Milliarden DM - als Ergänzungsanteile von steuerstarken an steuerschwache Länder gezahlt. Für jedes Land wird der Anteil ermittelt, den es als Ergänzungsanteil erhält oder den es zur Finanzierung dieser Transfers leisten muss. Diese Anteile werden langfristig festgeschrieben. Sie können verändert werden, wenn sich die Finanzierungsverhältnisse zwischen den Ländern grundlegend verschieben. Das Reformkonzept In der Basisvariante des Umsatzsteuervorwegausgleichs wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer vollständig nach der Einwohnerzahl verteilt. Danach wird ein hypothetischer Finanzausgleich im engeren Sinne gerechnet, um so Fehlbeträge und Überschüsse zu definieren. Der Anteil eines reichen Landes an den Überschüssen legt dessen Beitrag an der Finanzierung der Transfers fest, der Anteil eines armen Landes an den Fehlbeträgen definiert seinen Anteil am Bezug von Transfers (Tabelle 4, Spalte 3). Damit stellt bereits der Umsatzsteuervorwegausgleich auf die Finanzkraft-Finanzbedarf- Relationen ab, die auch dem Länderfinanzausgleich zugrunde liegen. Strukturelle Mehrbedarfe einzelner Länder würden somit bereits auf dieser Ebene des Finanzausgleichs berücksichtigt. Beim Länderfinanzausgleich im engeren Sinne werden dann die ermittelten Überschüsse und Fehlbeträge mit einem linearen Satz von 52,5 Prozent ausgeglichen. Auf der dritten Stufe des Finanzausgleichs gewährt der Bund leistungsschwachen Ländern drei Arten von Sonder-BEZ in Höhe von insgesamt 22 Milliarden DM. Allgemeine BEZ entfallen in dem Modell, weil sie mit hohen Grenzbelastungen verbunden wären. Als leistungsschwach werden alle Länder eingestuft, deren Finanzkraft immer noch höchstens 98 Prozent ihres Finanzbedarfs erreichen. Berlin erhält vorab 1,2 Milliarden DM als Haupt- 51
15 stadt-bez. 60 Prozent der verbleibenden Bundeshilfen werden an strukturschwache Länder vergeben. Dabei wird die Strukturschwäche nach bewährten Indikatoren der Regionalförderung (Huber/Lichtblau, 2000) definiert. Der Rest wird als Übergangs-BEZ gemäß der nach Finanzausgleich verbleibenden Lücken vergeben. Diese Zahlungen werden für eine bestimmte Frist festgeschrieben, beispielsweise für fünf bis zehn Jahre. Tabelle 4: IW-Reformvorschlag: Umsatzsteuervorwegausgleich - Modellrechnung Empfangene (+) und geleistete (-) Ergänzungsanteile Relative Steuerkraft 1) Basismodell 2) Anpassung 3) Nach Anpassung Prozentpunkte in Millionen DM 4) Sachsen-Anhalt 29,6 16,5 16, Thüringen 30,4 15,1 15, Sachsen 33,9 26,1 26, Mecklenburg-Vorpommern 35,0 10,3 10, Brandenburg 37,2 14,5 14, Saarland 77,4 2,1 2,1 434 Niedersachsen 86,8 9,2-1,8 7, Rheinland-Pfalz 92,8 2,6 1,4 3,9 797 Schleswig-Holstein 93,3 1,6 0,4 2,0 412 Berlin 93,9 1,8 1,8 369 Bremen 103, Nordrhein-Westfalen 113,7-23,1-2,2-25, Bayern 120,9-24,3 1,1-23, Baden-Württemberg 121,2-23,1 0,8-22, Hessen 142,9-23,4-1,3-24, Hamburg 184,3-6,1 1,6-4,5-914 Gesamt 0 +5, , ) Einnahmen aus den Einkommen- und Landessteuern je Einwohner in Prozent des Länderdurchschnitts. Länder mit Werten unter 100 gelten als steuerschwach und haben Anspruch auf Ergänzungsanteile. 2) Anteile an Fehlbeträgen oder Überschüssen im Länderfinanzausgleich, wenn Umsatzsteuer nach Einwohnern verteilt wird; Anteil des steuerstarken Landes Bremen wegen Finanzschwäche gleich null gesetzt. 3) Anpassungen bei leistungsstarken Ländern, die keinen Anspruch auf BEZ haben, um vorgegebenen Verteilungskorridor einzuhalten. 4) Anteile multipliziert mit der gesamten Ausgleichssumme von 20,2 Milliarden DM (16 Prozent der Umsatzsteuer der Länder); Rundungseffekte. Quelle: BMF, 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Ergebnisse der Modellrechnung Mit dieser Basislösung ist noch nicht garantiert, dass die Gewinne und Verluste der einzelnen Bundesländer in dem von der Ministerpräsidentenkonfe- 52
16 renz vorgegebenen Korridor von +/- 12 DM je Einwohner bleiben. Hierfür sind kleinere Anpassungen erforderlich. Für leistungsstarke Länder, deren Finanzkraft nach Finanzausgleich mindestens 98 Prozent ihres Finanzbedarfs erreicht, werden hierfür deren Finanzbeiträge beziehungsweise deren Anteile an den Ergänzungszuweisungen umverteilt. Bei den leistungsschwachen Ländern wird dies durch entsprechend angepasste Übergangs-BEZ erreicht. Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse des Umsatzsteuervorwegausgleichs gemäß einer Modellrechnung für das Jahr Die erste Spalte zeigt die relative Steuerkraft der Länder. Sie ist wie bisher der Quotient der Pro-Kopf-Einnahmen eines Landes aus den Einkommen- und Landessteuern zum Länderdurchschnitt. Länder mit Werten unter der 100-Prozent-Marke gelten als steuerschwach und erhalten Ergänzungsanteile. Länder mit Werten über der 100-Prozent-Marke sind steuerstark und müssen die Ergänzungstransfers finanzieren. Spalte 2 zeigt die Anteile der einzelnen Länder, wie sie sich nach dem oben beschriebenen Ansatz ergeben. Wenn ein steuerstarkes Land, wie in der Modellrechnung die Hansestadt Bremen, dennoch Fehlbeträge aufweist, wird sein Finanzierungsanteil auf null gesetzt. Spalte 4 zeigt, wie sich die Finanzierungsanteile verändern müssen, um mindestens im ersten Reformjahr den anvisierten Umverteilungskorridor von +/- 12 DM je Einwohner einzuhalten. Spalte 5 liefert die endgültigen, langfristig festzuschreibenden Anteile. Die letzte Spalte quantifiziert schließlich die Zahlungen im Umsatzsteuervorwegausgleich im Jahr Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Zahlungen im anschließenden Länderfinanzausgleich. Die ersten beiden Spalten liefern die Fehlbeträge und Überschüsse sowie die bei einem linearen Tarif von 52,5 Prozent resultierenden Zahlungen. Spalte 3 zeigt die Finanzkraft-Finanzbedarfs-Relationen nach Finanzausgleich. Länder, deren Finanzkraft nach Länderfinanzausgleich bei weniger als 98 Prozent des Länderdurchschnitts liegt, werden wie oben beschrieben als leistungsschwach eingestuft und erhalten abschließend BEZ. Deren Verteilung ist aus Tabelle 6 abzulesen. Die Hauptstadt-BEZ sind so festgelegt, dass Berlin ohne größere finanzielle Einbußen in den Finanzausgleich einbezogen werden kann. Die Sicherung der fiskalischen Positionen Berlins ist schwierig, weil dieses Land relativ wenig vom Um- 53
17 satzsteuervorwegausgleich profitiert und als relativ strukturstarkes Land auch nur einen kleinen Teil der Struktur-BEZ erhält. Tabelle 5: IW-Reformvorschlag: Länderfinanzausgleich - Modellrechnung Überschüsse (+)/Fehlbeträge (-) vor Finanzausgleich Millionen DM Zahlungen im Länderfinanzausgleich 1) Relation Finanzkraft/Finanzbedarf nach Finanzausgleich 2) in Prozent Hessen ,3 Hamburg ,5 Baden-Württemberg ,0 Bayern ,7 Nordrhein-Westfalen ,0 Schleswig-Holstein ,8 Rheinland-Pfalz ,4 Niedersachsen ,6 Saarland ,6 Brandenburg ,8 Sachsen ,2 Mecklenburg-Vorpommern ,0 Sachsen-Anhalt ,8 Thüringen ,8 Bremen ,7 Berlin ,0 Gesamt +/ / ) Linearer Tarif 52,5 Prozent. 2) Finanzkraft vor Ausgleich plus Umverteilungen im Umsatzsteuervorwegausgleich und Länderfinanzausgleich zu Finanzbedarf. Quelle: BMF, 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Die Vergabe der Struktur-BEZ orientiert sich an dem von Huber/Lichtblau (2000) entwickelten Verfahren. Die Übergangs-BEZ sollen den Systemwechsel fiskalisch abfedern und nehmen die nach Finanzausgleich verbleibenden Lücken der leistungsschwachen Länder zum Verteilungsmaßstab. Insgesamt werden Korrekturzahlungen in Höhe von 525 Millionen DM notwendig, um mit einer Feinsteuerung das anvisierte Verteilungsziel erreichen zu können. Fiskalische und allokative Effekte 54
18 Der entscheidende Vorteil des IW-Reformvorschlags ist, dass mit ihm sowohl die allokativen als auch die fiskalischen Ziele erreicht werden: Tabelle 6: IW-Reformvorschlag: Bundesergänzungszuweisungen - Modellrechnung 2000; in Millionen DM - Hauptstadt -BEZ Struktur- BEZ 1) Übergangs- BEZ 2) IW- Korrektur 3) Gesamt Saarland Brandenburg Sachsen Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt Thüringen Bremen Berlin Gesamt / ) 60 Prozent der nach Abzug der Hauptstadt-BEZ verbleibenden Bundeshilfen werden nach dem Grad der Strukturschwäche verteilt; als Indikatoren werden die Kriterien der Regionalförderung verwendet. 2) Der Rest wird als Übergangs-BEZ nach Maßgabe der nach FA verbleibenden Finanzkraftlücken verteilt. 3) Beträge sind so bemessen, dass die Umverteilungen gegenüber dem Status quo kleiner als 12 DM je Einwohner werden. Quelle: BMF, 2001; Huber/Lichtblau, 2000; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Der Eigenanteil der Länder liegt zwischen 35 und 40 Prozent, verglichen mit 8 bis 30 Prozent im bestehenden System Prozent (Tabelle 7). Die Umverteilungseffekte liegen in dem von der Ministerpräsidentenkonferenz gewünschten Korridor: Kein Bundesland verliert gegenüber dem Status quo mehr als 12 DM je Einwohner. Bei entsprechenden Anpassungen ist sogar eine Lösung möglich, die fiskalisch genau dem Status quo entspricht. Allerdings werden hierzu höhere Anpassungszahlungen erforderlich. Kritiker könnten einwenden, dass diesem Vorschlag nicht durchgängig objektive Maßstäbe zugrunde liegen. Vor allem in der Basislösung wurde die Anpassung zugegebenermaßen so gesteuert, dass es im Startjahr der Reform kaum Gewinner oder Verlierer gibt. Aber etwa 97 Prozent aller Transfers 55
19 sind nach einem objektiven und nachvollziehbaren Schlüssel verteilt worden. Der verbleibende Rest kann als Preis für die politische Kompromissfähigkeit des Reformvorschlags interpretiert werden. Tabelle 7: IW-Reformvorschlag im Überblick Ergebnisse der Modellrechnung für 2000 Fiskalische Effekte (Mehr- und Mindereinnahmen gegenüber Status quo 1) in DM je Einwohner) Allokative Effekte (Eigenanteil: Verbleib zusätzlicher Lohnsteuereinnahmen in Prozent der Einnahmen nach Ausgleich) Nordrhein-Westfalen +3 40,0 Bayern 0 38,4 Baden-Württemberg 0 38,0 Niedersachsen +3 37,3 Hessen +2 36,8 Sachsen 0 36,4 Berlin +2 36,4 Rheinland-Pfalz ,3 Sachsen-Anhalt ,9 Schleswig-Holstein +1 35,9 Brandenburg 0 35,9 Thüringen ,8 Hamburg 0 35,8 Mecklenburg ,7 Vorpommern Saarland -3 35,5 Bremen 0 35,4 1) Ohne Haushaltsnothilfen und Übergangs-BEZ. Quelle: BMF, 2001; Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Makroökonomische Vorteile Das Reformmodell fährt die Grenzbelastungen deutlich zurück, weil ein beträchtlicher Teil der Umverteilung über anreizverträgliche Pauschalzahlungen im Umsatzsteuervorwegausgleich abgewickelt wird. Die Höhe des Transfervolumens in diesem Umverteilungsschritt ist dabei keineswegs festgeschrieben, sondern wächst dynamisch mit dem Umsatzsteueraufkommen. Die niedrigeren Grenzbelastungen schaffen den Bundesländern erheblich mehr Anreize, durch eigene Anstrengungen ihre Steuerkraft zu verbessern. Dies dürfte sich positiv auf Wirtschaftswachstum und Steueraufkommen auswirken. Verschiedene Studien lassen für Deutschland bei einem Rückgang der Grenzbelastung um 20 Prozentpunkte einen Anstieg des Steueraufkommens um 22 Milliarden DM erwarten (Baretti/Huber/Lichtblau, 2000, 2001). Das Wirtschaftswachstum würde demnach um etwa 0,3 Prozentpunkte stimuliert, was seinerseits zu weiteren Steuermehreinnahmen führen 56
20 würde (Baretti u. a. 2000). Gerade in den neuen Ländern wäre dieser Wachstumseffekt einer Finanzausgleichsreform willkommen. Juni 2001 Christian Baretti* Bernd Huber** Karl Lichtblau * Mitarbeiter im ifo-institut München. ** Professor für Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Literatur: Arbeitskreis Steuerschätzung, Mai 2000, Ergebnisse der Steuerschätzung, Berlin. Baretti, Christian, Bernd Huber und Karl Lichtblau, 2000, A Tax on Tax Revenue the Incentive Effects of Equalizing Transfers: Evidence from Germany, CESifo Working Paper, Nr Baretti, Christian, Robert Fenge, Bernd Huber, Willi Leibfritz und Matthias Steinherr, 2000, Chancen und Grenzen föderalen Wettbewerbs, ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, Nr. 1, München. Baretti, Christian, Bernd Huber, Karl Lichtblau und Rüdiger Parsche, 2001, Die Einwohnergewichtung auf Länderebene im Länderfinanzausgleich, Gutachten im Auftrag der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen, erscheint als: ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung, Nr. 4. Baretti; Christian, Bernd Huber und Karl Lichtblau, 2001, Weniger Wachstum und Steueraufkommen durch den Finanzausgleich, HWWA Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Hamburg. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 2001, Konsensmodell der Länder Baden- Württemberg, Bayern und Hessen für eine Neugestaltung des Finanzausgleichs, München. Bundesministerium der Finanzen (BMF), 2001, Vorläufige Abrechnung über den Finanzausgleich unter den Ländern für das Jahr 2000, Berlin. Bundesrat, 2001, Empfehlungen zum Maßstäbegesetz, Drucksache 161/2/01, Berlin. Deutscher Bundestag, 2001, Entwurf eines Gesetzes über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen, BT-Drucksache. Finanzbehörde Hamburg, 2001, Beschreibung des Modells der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein zu Möglichkeiten einer Reform des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs, Hamburg. Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 2001, Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, Modell des Finanzministeriums NRW, Düsseldorf. Huber, Bernd und Karl Lichtblau, 1997, Systemschwächen des Finanzausgleichs Eine Reformskizze, in: iw-trends, 24. Jg., Heft 4, S
21 Huber, Bernd und Karl Lichtblau, 2000, Ein neuer Finanzausgleich, Reformoptionen nach dem Verfassungsgerichtsurteil, in: Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Nr. 257, Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Statistisches Bundesamt, 2000, Finanzen und Steuern, Kassenmäßige Steuereinnahmen 1988 bis 1999, Fachserie 14, Wiesbaden. *** Reform of the Fiscal Equalisation System - Economic Wisdom versus Hereditary Rights iw-focus Under the German fiscal equalisation system financially weak states receive transfers from wealthier states. The system is characterised by a high degree of redistribution and strong disincentives to maximise tax revenue. The effect of the latter is that most states keep less than 10 pennies of each DM of additional additional tax revenue. In November 1999, the Federal Supreme Court instructed the government to reform the system. Since a reform has to be approved by the upper house of parliament the poorer states which hold the majority in the chamber can block any cuts of their transfers. The reform proposed in the article would lower the marginal tax rate without reducing the overall amount of the transfers. In addition, it would replace the highly progressive and complex tax schedule by a linear redistribution rate of 52.5 per cent and supplement it with lump-sum transfers to keep the overall level of redistribution unchanged. In the future, the poorer states' shares of the lump transfers and the richer states' contributions should be adjusted on the basis of a set of socio-economic indicators. 58
Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen (Teil 1)
 und (Teil 1) In absoluten Zahlen*, und Geberländer Empfängerländer -3.797-1.295 Bayern -2.765-1.433 Baden- Württemberg * Ausgleichszuweisungen des s: negativer Wert = Geberland, positiver Wert = Empfängerland;
und (Teil 1) In absoluten Zahlen*, und Geberländer Empfängerländer -3.797-1.295 Bayern -2.765-1.433 Baden- Württemberg * Ausgleichszuweisungen des s: negativer Wert = Geberland, positiver Wert = Empfängerland;
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015
 Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015 Stand der Verhandlungen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Bisheriger Zeitplan Beschluss der Bundeskanzlerin
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Regierungsmedienkonferenz am 23. Juni 2015 Stand der Verhandlungen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen Bisheriger Zeitplan Beschluss der Bundeskanzlerin
Länderfinanzausgleich: eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems
 : eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems Simulation der Verteilungswirkungen höherer Steuermittel für die Bundesländer Kurzexpertise FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Platz des Landtags
: eine fiktive Fortschreibung des aktuellen Systems Simulation der Verteilungswirkungen höherer Steuermittel für die Bundesländer Kurzexpertise FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Platz des Landtags
Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016
 Bundesrat Drucksache 50/16 29.01.16 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016 A. Problem und Ziel Mit
Bundesrat Drucksache 50/16 29.01.16 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2016 A. Problem und Ziel Mit
Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen
 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit:
Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Diskussionsstand zur Neuordnung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit:
Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern
 Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern Gewerbliche Unternehmensgründungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Unternehmensgründungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 52.169
Gewerbliche Unternehmensgründungen nach Bundesländern Gewerbliche Unternehmensgründungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Unternehmensgründungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 52.169
Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen
 Finanzpolitik Forschungsstelle Finanzpolitik www.fofi.uni bremen.de Nr. 37 April 2013 Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen Das bundesstaatliche Finanzverteilungs und Finanzumverteilungssystem
Finanzpolitik Forschungsstelle Finanzpolitik www.fofi.uni bremen.de Nr. 37 April 2013 Nehmerland Hamburg: Zu reich für die Abgeltung von Sonderbedarfen Das bundesstaatliche Finanzverteilungs und Finanzumverteilungssystem
Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern
 Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern Gewerbeanmeldungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Gewerbeanmeldungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 111.044 109.218 106.566 105.476 109.124
Gewerbeanmeldungen nach Bundesländern Gewerbeanmeldungen 2005 bis 2015 in Deutschland nach Bundesländern - Anzahl Gewerbeanmeldungen 1) Anzahl Baden-Württemberg 111.044 109.218 106.566 105.476 109.124
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Steuerhaushalt. Fachserie 14 Reihe 4
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 8. Mai 2014 Artikelnummer: 2140400137004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 8. Mai 2014 Artikelnummer: 2140400137004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Thüringer Landesamt für Statistik
 Thüringer Landesamt für Statistik Pressemitteilung 035/2011 Erfurt, 31. Januar 2011 Arbeitnehmerentgelt 2009: Steigerung der Lohnkosten kompensiert Beschäftigungsabbau Das in Thüringen geleistete Arbeitnehmerentgelt
Thüringer Landesamt für Statistik Pressemitteilung 035/2011 Erfurt, 31. Januar 2011 Arbeitnehmerentgelt 2009: Steigerung der Lohnkosten kompensiert Beschäftigungsabbau Das in Thüringen geleistete Arbeitnehmerentgelt
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Steuerhaushalt. Fachserie 14 Reihe 4
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2012 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 24. April 2013 Artikelnummer: 2140400127004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 4 Finanzen und Steuern Steuerhaushalt 2012 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 24. April 2013 Artikelnummer: 2140400127004 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt
Finanzministerin Heinold zur Neuordnung des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs: Jetzt ist der Bund am Zug!
 Medien-Information 4. Dezember 2015 Finanzministerin Heinold zur Neuordnung des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs: Jetzt ist der Bund am Zug! Jetzt ist der Bund am Zug, so Finanzministerin Monika Heinold
Medien-Information 4. Dezember 2015 Finanzministerin Heinold zur Neuordnung des Bundesstaatlichen Finanzausgleichs: Jetzt ist der Bund am Zug! Jetzt ist der Bund am Zug, so Finanzministerin Monika Heinold
econstor Make Your Publication Visible
 econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Brügelmann, Ralph Working Paper Föderalismusreform: Die Unzulänglichkeiten des Finanzausgleichs
econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Brügelmann, Ralph Working Paper Föderalismusreform: Die Unzulänglichkeiten des Finanzausgleichs
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) ,5
 BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 26.01.2017 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr 2016
BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 26.01.2017 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr 2016
Die Finanzielle Situation der Bundesländer vor dem Hintergrund der Schuldenbremse
 Pressekonferenz, 10. März 2011, Berlin Die Finanzielle Situation der Bundesländer vor dem Hintergrund der Schuldenbremse Statement Dr. Rolf Kroker Leiter des Wissenschaftsbereichs II Wirtschafts- und Sozialpolitik
Pressekonferenz, 10. März 2011, Berlin Die Finanzielle Situation der Bundesländer vor dem Hintergrund der Schuldenbremse Statement Dr. Rolf Kroker Leiter des Wissenschaftsbereichs II Wirtschafts- und Sozialpolitik
Spielhallenkonzessionen Spielhallenstandorte Geldspielgeräte in Spielhallen
 Alte Bundesländer 1.377 von 1.385 Kommunen Stand: 01.01.2012 13.442 Spielhallenkonzessionen 8.205 Spielhallenstandorte 139.351 Geldspielgeräte in Spielhallen Einwohner pro Spielhallenstandort 2012 Schleswig-
Alte Bundesländer 1.377 von 1.385 Kommunen Stand: 01.01.2012 13.442 Spielhallenkonzessionen 8.205 Spielhallenstandorte 139.351 Geldspielgeräte in Spielhallen Einwohner pro Spielhallenstandort 2012 Schleswig-
Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben?
 Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben? Vortrag auf der Grünen Woche im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung am 22. Januar 2014 in Berlin Dr. Markus Eltges 2020 Dr. Markus Eltges
Ende des Solidarpakts regionale Disparitäten bleiben? Vortrag auf der Grünen Woche im Rahmen des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung am 22. Januar 2014 in Berlin Dr. Markus Eltges 2020 Dr. Markus Eltges
PORTAL ZUR HAUSHALTSSTEUERUNG.DE. KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT. Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth
 PORTAL ZUR KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth HAUSHALTSSTEUERUNG.DE 18. August 2013, Trebur Einordnung kommunaler Steuern (netto)
PORTAL ZUR KOMMUNALSTEUEREINNAHMEN 2012 Eine Analyse HAUSHALTS- UND FINANZWIRTSCHAFT Dr. Marc Gnädinger, Andreas Burth HAUSHALTSSTEUERUNG.DE 18. August 2013, Trebur Einordnung kommunaler Steuern (netto)
UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN
 UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN BETRIEBSINFORMATIK UND OPERATIONS RESEARCH Prof. Dr. Heiner Müller-Merbach HMM/Sch; 15.1.2001 Manuskript für Forschung & Lehre Hochschulfinanzen im Ländervergleich Laufende Grundmittel
UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN BETRIEBSINFORMATIK UND OPERATIONS RESEARCH Prof. Dr. Heiner Müller-Merbach HMM/Sch; 15.1.2001 Manuskript für Forschung & Lehre Hochschulfinanzen im Ländervergleich Laufende Grundmittel
Schriftliche Kleine Anfrage
 BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/4448 19. Wahlperiode 03.11.09 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Badde (SPD) vom 26.10.09 und Antwort des Senats Betr.: Mehr
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/4448 19. Wahlperiode 03.11.09 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Badde (SPD) vom 26.10.09 und Antwort des Senats Betr.: Mehr
Über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen!
 Über 5.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen! Im Jahr 2013 sind 5.548 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland durch die Jugendämter in Obhut genommen worden.
Über 5.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2013 in Deutschland angekommen! Im Jahr 2013 sind 5.548 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland durch die Jugendämter in Obhut genommen worden.
Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs
 Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs Wissenschaftliche Tagung IW Köln und MPI Fairer Föderalismus? Zum Reformbedarf bei Bildung und Finanzen 12. November 2014 Dr. Rolf Kroker Unzufriedenheit
Anforderungen an eine Reform des Länderfinanzausgleichs Wissenschaftliche Tagung IW Köln und MPI Fairer Föderalismus? Zum Reformbedarf bei Bildung und Finanzen 12. November 2014 Dr. Rolf Kroker Unzufriedenheit
Auswertung. Fachabteilung Entwicklung 1991 bis 2003 Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00%
 Bundesrepublik gesamt Anzahl der Kinderabteilungen Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00% Anzahl der Kinderbetten Kinderheilkunde -32,43% - davon
Bundesrepublik gesamt Anzahl der Kinderabteilungen Kinderheilkunde -14,09% Kinderchirurgie -29,29% Kinder- und Jugendpsychiatrie 5,35% Gesamt -13,00% Anzahl der Kinderbetten Kinderheilkunde -32,43% - davon
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) ,6
 BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 27.01.2016 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
BMF - I A 6 Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) - in Tsd. Euro - - Bundesgebiet insgesamt - - nach Steuerarten - Übersicht 1 27.01.2016 S t e u e r a r t Kalenderjahr Änderung ggü Vorjahr Gemeinschaftliche
2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999
 Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn 2. Kurzbericht: Pflegestatistik 1999 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung - Ländervergleich: Pflegebedürftige Bonn, im Oktober 2001 2. Kurzbericht: Pflegestatistik
Gesetz über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer
 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 15. Wahlperiode Drucksache 15/1924 10.05.2011 Neudruck Gesetzentwurf der Fraktion der SPD der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE Gesetz über die Festsetzung
Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025
 Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025 Bevölkerung insgesamt in Tausend 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 Bevölkerungsfortschreibung - Ist-Zahlen Variante
Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2025 Bevölkerung insgesamt in Tausend 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 Bevölkerungsfortschreibung - Ist-Zahlen Variante
Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage
 Bundesrat Drucksache 638/15 18.12.15 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes
Bundesrat Drucksache 638/15 18.12.15 Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen Fz - In Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN BADEN- WÜRTTEMBERG HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜ RINGEN
Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN BADEN- WÜRTTEMBERG HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜ RINGEN
Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Immobiliennachfrage und Bautätigkeit Dr. Michael Voigtländer, Forschungsstelle Immobilienökonomik
 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Immobiliennachfrage und Bautätigkeit Dr. Michael Voigtländer, Forschungsstelle Immobilienökonomik Berlin, 28. Mai 2009 Forschungsstelle Immobilienökonomik Das
Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Immobiliennachfrage und Bautätigkeit Dr. Michael Voigtländer, Forschungsstelle Immobilienökonomik Berlin, 28. Mai 2009 Forschungsstelle Immobilienökonomik Das
In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013
 In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013 Martin R. Textor Wie viel Geld wird in der Bundesrepublik Deutschland
In Berlin ist ein Kind doppelt so viel wert wie in anderen Bundesländern: Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung von 2006 bis 2013 Martin R. Textor Wie viel Geld wird in der Bundesrepublik Deutschland
Steuereinnahmen nach Steuerarten
 Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2007 gemeinschaftliche Steuern: 374,3 Mrd. (69,6%) Zölle (100 v.h.): 4,0 (0,7%) Lohnsteuer: 131,8 Mrd. (24,5%) Gewerbesteuer (100 v.h.): 40,1
Kassenmäßige Steuereinnahmen in absoluten Zahlen und Anteile, 2007 gemeinschaftliche Steuern: 374,3 Mrd. (69,6%) Zölle (100 v.h.): 4,0 (0,7%) Lohnsteuer: 131,8 Mrd. (24,5%) Gewerbesteuer (100 v.h.): 40,1
Senatsverwaltung für Finanzen
 Länderfinanzausgleich - Behauptungen und Tatsachen Der bayerische Steuerzahler kann nicht für die Misswirtschaft anderer Länder wie Bremen oder Berlin aufkommen. Tut er auch nicht. Der Länderfinanzausgleich
Länderfinanzausgleich - Behauptungen und Tatsachen Der bayerische Steuerzahler kann nicht für die Misswirtschaft anderer Länder wie Bremen oder Berlin aufkommen. Tut er auch nicht. Der Länderfinanzausgleich
1.4.1 Sterblichkeit in Ost- und Westdeutschland
 1.4.1 in Ost- und Westdeutschland Die ist im Osten noch stärker gesunken als im Westen. Die Gesamtsterblichkeit ist in Deutschland zwischen 1990 und 2004 bei Frauen und Männern deutlich zurückgegangen
1.4.1 in Ost- und Westdeutschland Die ist im Osten noch stärker gesunken als im Westen. Die Gesamtsterblichkeit ist in Deutschland zwischen 1990 und 2004 bei Frauen und Männern deutlich zurückgegangen
Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte
 Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Dienstag, 17. November 2015, 15:30 Uhr, NRW.Bank, Friedrichstraße 1, 48145 Münster Bernhard Daldrup,
Bund-Länder Finanzbeziehungen: Zum aktuellen Stand der Debatte Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Dienstag, 17. November 2015, 15:30 Uhr, NRW.Bank, Friedrichstraße 1, 48145 Münster Bernhard Daldrup,
Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen -
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2014 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2014 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN THÜ RINGEN SACHSEN- ANHALT MECKLENBURG-
Die Evangelische in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN SCHLESWIG- HOLSTEIN HESSEN HAMBURG NIEDERSACHSEN THÜ RINGEN SACHSEN- ANHALT MECKLENBURG-
Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen -
 Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Statistisches Bundesamt Fachserie 14 Reihe 10.1 Finanzen und Steuern Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen - 2013 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen
Bundesrat. Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
 Bundesrat Drucksache 268/16 (neu) 25.05.16 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales AIS - Fz - In Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten
Bundesrat Drucksache 268/16 (neu) 25.05.16 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales AIS - Fz - In Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung an den Kosten
Im Zusammenwirken von Länderfinanzausgleich und
 Rolf Peffekoven Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Länderfinanzausgleich Mit dem Urteil des Zweiten Senats vom 11. 11. 1999 hat das Bundesverfassungsgericht über die Normenkontroiianträge der
Rolf Peffekoven Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Länderfinanzausgleich Mit dem Urteil des Zweiten Senats vom 11. 11. 1999 hat das Bundesverfassungsgericht über die Normenkontroiianträge der
Erläuterung des neuen Verfahrens der Umrechnung von Wählerstimmen in Bundestagssitze
 Aktuelle Mitteilung des Bundeswahlleiters vom 09.10.2013 Erläuterung des neuen Verfahrens der Umrechnung von Wählerstimmen in Bundestagssitze Durch das 22. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom
Aktuelle Mitteilung des Bundeswahlleiters vom 09.10.2013 Erläuterung des neuen Verfahrens der Umrechnung von Wählerstimmen in Bundestagssitze Durch das 22. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom
Zügig nach Deutschland?
 22.05.2012 Zügig nach Deutschland? Ein Jahr uneingeschränkte Freizügigkeit für Migranten aus den EU-8 Ländern Seit dem 1. Mai 2011 gilt für die 2004 beigetretenen Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen,
22.05.2012 Zügig nach Deutschland? Ein Jahr uneingeschränkte Freizügigkeit für Migranten aus den EU-8 Ländern Seit dem 1. Mai 2011 gilt für die 2004 beigetretenen Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Programmierte Steuererhöhung
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Steuerpolitik 30.01.2017 Lesezeit 3 Min Programmierte Steuererhöhung Die Grunderwerbssteuer kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben.
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Steuerpolitik 30.01.2017 Lesezeit 3 Min Programmierte Steuererhöhung Die Grunderwerbssteuer kennt seit Jahren nur eine Richtung: nach oben.
Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht
![Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht](/thumbs/59/43372984.jpg) 1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Periode bzw. Jahr=2002-2012 ; Land Einheit Hauptbestand (auch Plenterwald) Unterstand Oberstand alle Bestandesschichten Baden-Württemberg
1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.r.] nach Land und Bestandesschicht Periode bzw. Jahr=2002-2012 ; Land Einheit Hauptbestand (auch Plenterwald) Unterstand Oberstand alle Bestandesschichten Baden-Württemberg
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung
 192 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 28. Teurer Kurswechsel beim Landesblindengeld Die zum 01.01.2013 in Kraft getretene Erhöhung des Landesblindengeldes ist willkürlich.
192 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung 28. Teurer Kurswechsel beim Landesblindengeld Die zum 01.01.2013 in Kraft getretene Erhöhung des Landesblindengeldes ist willkürlich.
Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland
 Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland A. Steuerverteilung und Finanzausgleich Steuern sind die wichtigste Einnahmeart des Staates. Rund 80 % der
Regionale Steuerautonomie und Implikationen für die intragovernmentalen Transfers in Deutschland A. Steuerverteilung und Finanzausgleich Steuern sind die wichtigste Einnahmeart des Staates. Rund 80 % der
Historischer Erfolg für Bremen und Bremerhaven Einigung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab 2020
 Der Präsident des Senats, Bürgermeister Dr. Carsten Sieling Die Senatorin für Finanzen, Bürgermeisterin Karoline Linnert Historischer Erfolg für Bremen und Bremerhaven Einigung der Finanzbeziehungen zwischen
Der Präsident des Senats, Bürgermeister Dr. Carsten Sieling Die Senatorin für Finanzen, Bürgermeisterin Karoline Linnert Historischer Erfolg für Bremen und Bremerhaven Einigung der Finanzbeziehungen zwischen
Bericht über die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
 Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung Arbeitsunterlage 0079 Zur internen Verwendung Bundesministerium der Finanzen Bericht über die Umsatzsteuerverteilung
Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung Arbeitsunterlage 0079 Zur internen Verwendung Bundesministerium der Finanzen Bericht über die Umsatzsteuerverteilung
Finanzen. Gesamtausgaben steigen in Niedersachsen unterdurchschnittlich. Kräftiger Anstieg der Sachinvestitionen in Niedersachsen
 Finanzen Gesamtausgaben steigen in unterdurchschnittlich Die bereinigten Gesamtausgaben haben in mit + 2,7 % langsamer zugenommen als in Deutschland insgesamt (+ 3,6 %). Die höchsten Zuwächse gab es in
Finanzen Gesamtausgaben steigen in unterdurchschnittlich Die bereinigten Gesamtausgaben haben in mit + 2,7 % langsamer zugenommen als in Deutschland insgesamt (+ 3,6 %). Die höchsten Zuwächse gab es in
EINWOHNERWERTUNG: AUSGLEICH FÜR STADTSTAATEN ALS LANDESHAUPTSTÄDTE OHNE UMLAND
 Fachbereich Wirtschaftswissenschaft (Fb 7) - Prof. Dr. Rudolf Hickel - Abs. Prof. Dr. R. Hickel, Universität Bremen,PF33 04 40. 28334 Bremen SCHNELLINFO: Kritik des Vorschlags durch drei finanzstärksten
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft (Fb 7) - Prof. Dr. Rudolf Hickel - Abs. Prof. Dr. R. Hickel, Universität Bremen,PF33 04 40. 28334 Bremen SCHNELLINFO: Kritik des Vorschlags durch drei finanzstärksten
Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern
 Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern BMNr Kennziffer Einheit Jahr Min/Max Städtevergleiche D-A-01 Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) Euro/EW 1995/2005 D-B-01 Entwicklung
Tabelle D Wirtschaftskraft: Übersicht über die Kennziffern BMNr Kennziffer Einheit Jahr Min/Max Städtevergleiche D-A-01 Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) Euro/EW 1995/2005 D-B-01 Entwicklung
Wie kann das Thema Konsequenzen der Staatsverschuldung kommuniziert werden? Ein Erfahrungsbericht aus Sachsen
 Wie kann das Thema Konsequenzen der Staatsverschuldung kommuniziert werden? Ein Erfahrungsbericht aus Sachsen Herr Staatssekretär Dr. Voß Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Nettokreditaufnahme
Wie kann das Thema Konsequenzen der Staatsverschuldung kommuniziert werden? Ein Erfahrungsbericht aus Sachsen Herr Staatssekretär Dr. Voß Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Nettokreditaufnahme
Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2015
 16.08.2016 Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2015 Das Statistische Bundesamt, Wiesbaden, hat die Fachserie 3, Reihe 2.4, Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke 2015 am 15.08.2016
16.08.2016 Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2015 Das Statistische Bundesamt, Wiesbaden, hat die Fachserie 3, Reihe 2.4, Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke 2015 am 15.08.2016
Bundesland. Bayern 112,3 190,5. Berlin 69,5 89,5. Brandenburg 29,3 40,3. Bremen 14,1 19,6. Hamburg 38,0 57,5. Hessen 79,8 125,3
 Tab. 1: Entlastung nach Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Jahr 2016 1 Einwohneranteil in % Baden-Württemberg 13,21 480 Bayern 15,63 569 Berlin 4,28 156 Brandenburg 3,03 110 Bremen 0,82 29 Hamburg
Tab. 1: Entlastung nach Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Jahr 2016 1 Einwohneranteil in % Baden-Württemberg 13,21 480 Bayern 15,63 569 Berlin 4,28 156 Brandenburg 3,03 110 Bremen 0,82 29 Hamburg
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin
 Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 A.) Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 A.) Bund-Länder-Finanzbeziehungen
DGSMP-Jahrestagung Augsburg, 19. September
 DGSMP-Jahrestagung 2007 - Augsburg, 19. September 2007 - Regionale Verteilungseffekte der Gesundheitsreform 2007 Florian Buchner Professur für Gesundheitsökonomie Fachhochschule Kärnten Jürgen Wasem Lehrstuhl
DGSMP-Jahrestagung 2007 - Augsburg, 19. September 2007 - Regionale Verteilungseffekte der Gesundheitsreform 2007 Florian Buchner Professur für Gesundheitsökonomie Fachhochschule Kärnten Jürgen Wasem Lehrstuhl
Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen
 Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Vortrag im Rahmen der Herbstfachtagung des Kompetenzzentrums für Nachhaltige Kommunale Finanzpolitik am 17. November 2015 Inhalt 1. Finanzpolitische Herausforderungen
Die Zukunft der föderalen Finanzstrukturen Vortrag im Rahmen der Herbstfachtagung des Kompetenzzentrums für Nachhaltige Kommunale Finanzpolitik am 17. November 2015 Inhalt 1. Finanzpolitische Herausforderungen
Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016
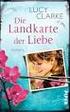 Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78. Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer. Die Schuldenbremse in den Bundesländern
 Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78 Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer Die Schuldenbremse in den Bundesländern Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 78 Ralph Brügelmann / Thilo Schaefer Die Schuldenbremse in den Bundesländern Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020
 Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin
 Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 A.) Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 14. Oktober 2016 in Berlin Beschluss Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 A.) Bund-Länder-Finanzbeziehungen
10 Schulzeit und Hausaufgaben
 10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
10 Schulzeit und Hausaufgaben Das Thema Schule wurde im diesjährigen Kinderbarometer unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Die im folgenden Kapitel umschriebenen Aussagen der Kinder beziehen sich auf
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter Stellen und Maßnahmen im stationären Bereich - Stand:
 Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter und im stationären Bereich - Stand: 31.03.2002 - Jahr 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Bundesland Baden-Württemberg 203
Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 1999/2000: Anzahl registrierter und im stationären Bereich - Stand: 31.03.2002 - Jahr 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Bundesland Baden-Württemberg 203
Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015
 Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015 nach Wohnort, Wohnungsgröße und Versicherungsbeitrag Mai 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Methodik 3 Hausratversicherung und Einbruchshäufigkeit
Hausratversicherungen und Einbruchshäufigkeit 2014 & 2015 nach Wohnort, Wohnungsgröße und Versicherungsbeitrag Mai 2016 CHECK24 2016 Agenda 1 Zusammenfassung 2 Methodik 3 Hausratversicherung und Einbruchshäufigkeit
Steuerstatistiken zur Politikberatung - Die Gemeindefinanzreform. Prof. Dr. habil. Michael Broer (Wolfsburg)
 Steuerstatistiken zur Politikberatung - Die Gemeindefinanzreform Prof. Dr. habil. Michael Broer (Wolfsburg) Die Gemeindefinanzreform 1. Das Gemeindefinanzsystem 2. Die Gemeindefinanzkommission 2010 2011
Steuerstatistiken zur Politikberatung - Die Gemeindefinanzreform Prof. Dr. habil. Michael Broer (Wolfsburg) Die Gemeindefinanzreform 1. Das Gemeindefinanzsystem 2. Die Gemeindefinanzkommission 2010 2011
a) 8,56 b) 13,12 c) 25,84 d) 37,06 e) 67,01 f) 111,50 g) 99,04 h) 87,49
 Runden von Zahlen 1. Runde auf Zehner. a) 44 91 32 23 22 354 1 212 413 551 b) 49 57 68 77 125 559 3 666 215 8 418 c) 64 55 97 391 599 455 2 316 8 112 9 999 d) 59 58 98 207 505 624 808 2 114 442 2. Runde
Runden von Zahlen 1. Runde auf Zehner. a) 44 91 32 23 22 354 1 212 413 551 b) 49 57 68 77 125 559 3 666 215 8 418 c) 64 55 97 391 599 455 2 316 8 112 9 999 d) 59 58 98 207 505 624 808 2 114 442 2. Runde
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 18. Mai
 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 18. Mai 2005 1335 Verordnung zur Bestimmung vorläufiger Landes-Basisfallwerte im Fallpauschalensystem für Krankenhäuser für das Jahr
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 Teil I Nr. 28, ausgegeben zu Bonn am 18. Mai 2005 1335 Verordnung zur Bestimmung vorläufiger Landes-Basisfallwerte im Fallpauschalensystem für Krankenhäuser für das Jahr
Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme?
 Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme? Prof. Dr. Günter Dannemann Finanzstaatsrat a.d. Forschungsstelle Finanzpolitik an der Universität Bremen Vortrag beim Rotary Club Verden / Aller 15. Mai 2006
Löst ein Nord(west)staat die Finanzprobleme? Prof. Dr. Günter Dannemann Finanzstaatsrat a.d. Forschungsstelle Finanzpolitik an der Universität Bremen Vortrag beim Rotary Club Verden / Aller 15. Mai 2006
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
 Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) GemFinRefG Ausfertigungsdatum: 08.09.1969 Vollzitat: "Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) GemFinRefG Ausfertigungsdatum: 08.09.1969 Vollzitat: "Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009
DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT?
 Prof. Dr. Gisela Färber DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT? Vortrag bei der Veranstaltung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Gisela Färber DETERMINANTEN DER FINANZKRAFT DER LÄNDER IM LÄNDERFINANZAUSGLEICH WELCHE ROLLE SPIELT DIE WIRTSCHAFTSKRAFT? Vortrag bei der Veranstaltung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz
Herausforderung Finanzföderalismus: Optionen für die Neuordnung der Bund-Länder Finanzbeziehungen
 Herausforderung Finanzföderalismus: Optionen für die Neuordnung der Bund-Länder Finanzbeziehungen Prof. Dr. Clemens Fuest Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim und Universität Mannheim
Herausforderung Finanzföderalismus: Optionen für die Neuordnung der Bund-Länder Finanzbeziehungen Prof. Dr. Clemens Fuest Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim und Universität Mannheim
Evangelische Kirche. in Deutschland. Kirchenmitgliederzahlen Stand
 Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2013 April 2015 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet:
Evangelische Kirche in Deutschland Kirchenmitgliederzahlen Stand 31.12.2013 April 2015 Allgemeine Bemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet:
Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2014
 07.09.2015 Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2014 Das Statistische Bundesamt, Wiesbaden, hat die Fachserie 3, Reihe 2.4, Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke 2014 vom 05.08.2015
07.09.2015 Landwirtschaftliche Grundstückspreise und Bodenmarkt 2014 Das Statistische Bundesamt, Wiesbaden, hat die Fachserie 3, Reihe 2.4, Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke 2014 vom 05.08.2015
Bevölkerung nach demografischen Strukturmerkmalen
 BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr
 KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr 2010 - Datengrundlage Die folgenden Darstellungen basieren auf den Ergebnissen einer Umfrage, die das niedersächsische Gesundheitsministerium
KHG-Investitionsförderung - Auswertung der AOLG-Zahlen für das Jahr 2010 - Datengrundlage Die folgenden Darstellungen basieren auf den Ergebnissen einer Umfrage, die das niedersächsische Gesundheitsministerium
Die Stärke des Föderalismus
 Die Stärke des Föderalismus Das föderale System in Deutschland aus Sicht eines (Bundes-)Landes Rede von Staatssekretärin Dr. Bernadette Weyland gehalten am 5. Februar 2015 im Consiglio Regionale del Veneto,
Die Stärke des Föderalismus Das föderale System in Deutschland aus Sicht eines (Bundes-)Landes Rede von Staatssekretärin Dr. Bernadette Weyland gehalten am 5. Februar 2015 im Consiglio Regionale del Veneto,
EU-Strukturfonds in Sachsen-Anhalt
 EU-Strukturfonds 2007-13 in Sachsen-Anhalt Ausgangssituation und gesamtwirtschaftliche Wirkungen Magdeburg 3. August 2006 Dr. Gerhard Untiedt GEFRA -Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Ludgeristr.
EU-Strukturfonds 2007-13 in Sachsen-Anhalt Ausgangssituation und gesamtwirtschaftliche Wirkungen Magdeburg 3. August 2006 Dr. Gerhard Untiedt GEFRA -Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Ludgeristr.
Bildung und Kultur. Wintersemester 2016/2017. Statistisches Bundesamt
 Statistisches Bundesamt Bildung und Kultur Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen - vorläufige Ergebnisse - Wintersemester 2016/2017 Erscheinungsfolge:
Statistisches Bundesamt Bildung und Kultur Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen - vorläufige Ergebnisse - Wintersemester 2016/2017 Erscheinungsfolge:
Partnerkarten Bundesländer
 Partnerkarten Bundesländer Karten drucken und auf Pappe kleben oder laminieren dann in der Mitte knicken, so dass man die Karte wie ein Dach hinstellen kann zwei Kinder spielen zusammen (s. Spielanleitung
Partnerkarten Bundesländer Karten drucken und auf Pappe kleben oder laminieren dann in der Mitte knicken, so dass man die Karte wie ein Dach hinstellen kann zwei Kinder spielen zusammen (s. Spielanleitung
Basiswissen Hochschulen/
 Basiswissen Hochschulen Daten zur Hochschulstruktur in Deutschland Autoren: Titel/ Untertitel: Auflage: 5 Stand: 22. September 2009 Institution: Ort: Website: Signatur: n Basiswissen Hochschulen/ Daten
Basiswissen Hochschulen Daten zur Hochschulstruktur in Deutschland Autoren: Titel/ Untertitel: Auflage: 5 Stand: 22. September 2009 Institution: Ort: Website: Signatur: n Basiswissen Hochschulen/ Daten
Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich
 1 Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin Die Ergebnisse des Zensus 2011 haben zu der Erkenntnis geführt, dass in Deutschland rund
1 Auswirkungen der Zensusergebnisse auf den kommunalen Finanzausgleich Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin Die Ergebnisse des Zensus 2011 haben zu der Erkenntnis geführt, dass in Deutschland rund
Verschuldung der deutschen Großstädte 2012 bis 2015
 Verschuldung der deutschen Großstädte 2012 bis 2015 Update zur EY-Kommunenstudie 2016 November 2016 Design der Studie Ihr Ansprechpartner Prof. Dr. Bernhard Lorentz Partner Government & Public Sector Leader
Verschuldung der deutschen Großstädte 2012 bis 2015 Update zur EY-Kommunenstudie 2016 November 2016 Design der Studie Ihr Ansprechpartner Prof. Dr. Bernhard Lorentz Partner Government & Public Sector Leader
Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern
 Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN BADEN- WÜRTTEMBERG Ku rhesse n- HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜRINGEN
Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- VORPOMMERN NORDRHEIN- WESTFALEN BREMEN BADEN- WÜRTTEMBERG Ku rhesse n- HAMBURG NIEDERSACHSEN SACHSEN- ANHALT THÜRINGEN
Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014
 Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014 Martin R. Textor Das Statistische Bundesamt stellt eine Unmenge an Daten zur Kindertagesbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung.
Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung: 2006 2014 Martin R. Textor Das Statistische Bundesamt stellt eine Unmenge an Daten zur Kindertagesbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung.
Der bundesstaatliche Finanzausgleich
 Der bundesstaatliche Finanzausgleich - 1 - Der bundesstaatliche Finanzausgleich Im Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland stellen die Länder eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete
Der bundesstaatliche Finanzausgleich - 1 - Der bundesstaatliche Finanzausgleich Im Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland stellen die Länder eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete
1. Allgemeine Hinweise
 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie Auswirkungen
Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie Auswirkungen
Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland
 Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland 5,0% 5,3% 2,5% 1,9% 3,2% 0,8% 3,4% 1,0% 3,6% 2,6% 1,8% 1,6% 1,6% 0,0% -0,8% -0,2% -2,5% -5,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland 5,0% 5,3% 2,5% 1,9% 3,2% 0,8% 3,4% 1,0% 3,6% 2,6% 1,8% 1,6% 1,6% 0,0% -0,8% -0,2% -2,5% -5,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Arbeitsmarkt, Februar 2017
 Gut beraten. Gut vertreten. Gut vernetzt. Arbeitsmarkt, Februar 2017 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Zahlen für den Arbeitsmarkt für Februar 2017 veröffentlicht. Dem Vorstandsvorsitzenden der BA,
Gut beraten. Gut vertreten. Gut vernetzt. Arbeitsmarkt, Februar 2017 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Zahlen für den Arbeitsmarkt für Februar 2017 veröffentlicht. Dem Vorstandsvorsitzenden der BA,
Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten
 Arbeitskammer des Saarlandes Abteilung Wirtschaftspolitik - Stand: 22.5.2013 AK-Fakten Öffentliche Finanzen im Saarland Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten fakten Das Saarland hat
Arbeitskammer des Saarlandes Abteilung Wirtschaftspolitik - Stand: 22.5.2013 AK-Fakten Öffentliche Finanzen im Saarland Das Saarland leidet unter Einnahmeschwäche und Altlasten fakten Das Saarland hat
Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28.
 Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28. März 2015 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 28. März 2015 Zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, vertreten
Forschungsgruppe Soziale Sicherung im Umbruch (SOSIUM)
 Forschungsgruppe Soziale Sicherung im Umbruch () Das Bildungs- und Teilhabepaket Ein progressiver Ansatz in der Grundsicherung für Arbeitssuchende? SAMF-Jahrestagung, 21./22. Februar 2013, Berlin Zehn
Forschungsgruppe Soziale Sicherung im Umbruch () Das Bildungs- und Teilhabepaket Ein progressiver Ansatz in der Grundsicherung für Arbeitssuchende? SAMF-Jahrestagung, 21./22. Februar 2013, Berlin Zehn
Basisdaten der Bundesländer im Vergleich (zusammengestellt von Ulrich van Suntum)
 Basisdaten der Bundesländer im Vergleich (zusammengestellt von Ulrich van Suntum) Es werden jeweils die letzten verfügbaren Daten dargestellt Deutschland = Durchschnitt der Bundesländer, nicht Bund Detaillierte
Basisdaten der Bundesländer im Vergleich (zusammengestellt von Ulrich van Suntum) Es werden jeweils die letzten verfügbaren Daten dargestellt Deutschland = Durchschnitt der Bundesländer, nicht Bund Detaillierte
Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.
 Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.2015 PV-Meldedaten Jan. Dez. 2014 Bundesverband Solarwirtschaft
Entwicklung des deutschen PV-Marktes Auswertung und grafische Darstellung der Meldedaten der Bundesnetzagentur nach 16 (2) EEG 2009 Stand 31.1.2015 PV-Meldedaten Jan. Dez. 2014 Bundesverband Solarwirtschaft
Kirchenmitgliederzahlen am
 zahlen am 31.12.2011 Oktober 2012 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
zahlen am 31.12.2011 Oktober 2012 Allgemeine Vorbemerkungen zu allen Tabellen Wenn in den einzelnen Tabellenfeldern keine Zahlen eingetragen sind, so bedeutet: - = nichts vorhanden 0 = mehr als nichts,
Ergebnis. der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau
 Ergebnis der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau Tabelle 1 - Gesamtübersicht Steuern insgesamt (Mio. ) 673.261,5 705.791,4 732.434 757.368 789.463
Ergebnis der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 9. bis 11. Mai 2017 in Bad Muskau Tabelle 1 - Gesamtübersicht Steuern insgesamt (Mio. ) 673.261,5 705.791,4 732.434 757.368 789.463
1. Einleitung...Seite Hauptteil Der Länderfinanzausgleich, Interessen, Modelle...Seite 3
 Inhalt: 1. Einleitung...Seite 2 2. Hauptteil Der Länderfinanzausgleich, Interessen, Modelle...Seite 3 2.1. Der Länderfinanzausgleich...Seite 3 2.2. Die Interessen der Beteiligten am Länderfinanzausgleich...Seite
Inhalt: 1. Einleitung...Seite 2 2. Hauptteil Der Länderfinanzausgleich, Interessen, Modelle...Seite 3 2.1. Der Länderfinanzausgleich...Seite 3 2.2. Die Interessen der Beteiligten am Länderfinanzausgleich...Seite
Steuerautonomie Internationaler Überblick und Lehren für Österreich. WIFO Jour Fixe Ludwig Strohner - EcoAustria
 Steuerautonomie Internationaler Überblick und Lehren für Österreich WIFO Jour Fixe Ludwig Strohner - EcoAustria 29.06.2015 Theoretische Vor- und Nachteile von Abgabenautonomie Vorteile Stärkung der dezentralen
Steuerautonomie Internationaler Überblick und Lehren für Österreich WIFO Jour Fixe Ludwig Strohner - EcoAustria 29.06.2015 Theoretische Vor- und Nachteile von Abgabenautonomie Vorteile Stärkung der dezentralen
Kinderarmut in Deutschland
 Geisteswissenschaft Axel Gaumer Kinderarmut in Deutschland Essay Kinderarmut in Deutschland Definition Armut: Armut ist ein Zustand, in dem Menschen unzureichende Einkommen beziehen (Paul A. Samuelson,
Geisteswissenschaft Axel Gaumer Kinderarmut in Deutschland Essay Kinderarmut in Deutschland Definition Armut: Armut ist ein Zustand, in dem Menschen unzureichende Einkommen beziehen (Paul A. Samuelson,
Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen-Thüringen. Verteilung und Landeshaushalt
 Verteilung und Landeshaushalt Arten der Verteilung Einkommensverteilung: Funktionale Einkommensverteilung: Verteilung des Einkommens auf Kapital und Arbeit (Lohn und Profit) Personelle Verteilung: Personen
Verteilung und Landeshaushalt Arten der Verteilung Einkommensverteilung: Funktionale Einkommensverteilung: Verteilung des Einkommens auf Kapital und Arbeit (Lohn und Profit) Personelle Verteilung: Personen
Die Schulden der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung?
 Die der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung? Bremen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management Kompetenzzentrum Öffentliche
Die der Kommunen: Welche Rolle spielen sie bei einer Altschuldenregelung? Bremen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management Kompetenzzentrum Öffentliche
