Assessment II: Rechtstheorie I Prüfung vom Lösungsskizze
|
|
|
- Ingrid Kruse
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Assessment II: Rechtstheorie I Prüfung vom Lösungsskizze Die folgende Lösungsskizze basiert auf der Vorlesung Rechtstheorie I und dem diese begleitenden Skript. Der Lösungsvorschlag ist, wenn auch notwendigerweise exemplarisch, aus didaktischen Gründen recht ausführlich gehalten; ein derartiger Umfang wurde auch für die Erreichung der maximalen Punktzahl nicht erwartet! 1. Frage (40 %): Als klassische Vertragstheorien können insbesondere die theoretisch einflussreichen Konzeptionen von Thomas Hobbes ( ), John Locke ( ) und Jean- Jacques Rousseau ( ) angeführt werden. Diese beruhen sämtlich auf der Idee, die Legitimation von Staat und Recht auf einen Gesellschaftsvertrag zu stützen, unterscheiden sich darüber hinaus aber in wesentlichen Punkten erheblich voneinander: Hobbes` vor dem historischen Hintergrund einer in ganz Europa von Bürgerkriegen und allgemeiner politischer Instabilität geprägten Epoche verfasste Theorie ist generell durch einen anti-idealistischen Grundton gekennzeichnet: Hobbes war Nominalist und Empirist und versuchte, sich beim Entwurf seiner Theorie mittels einer analytischen Methode an den Naturwissenschaften zu orientieren. Gemäss dem von ihm vertretenen mechanistischen Materialismus wird der Geist als Teil der physischen Existenz des Menschen aufgefasst, Bewusstseinserscheinungen als durch mechanische Vorgänge determiniert betrachtet, menschliche Willensfreiheit folglich abgelehnt. Angesichts dieser grundlegenden Weichenstellungen sind in Hobbes` Konzeption ethische oder politische Ideen eines allgemeingültigen Guten oder Gerechten, wie sie im platonischen Idealismus oder der aristotelischen Teleologie und den durch diese beeinflussten Theorien vertreten wurden, bereits ausgeschlossen. Folgerichtig sind Werte nach Hobbes Auffassung subjektiv und kontingent, eine natürliche Moral oder Gerechtigkeit ausgeschlossen. (Derartiges Hintergrundwissen wird zur Erreichung der vollen Punktzahl nicht erwartet, kann aber die Vergabe von zusätzlichen Punkten rechtfertigen) Ausgangspunkt von Hobbes` Staats- und Rechtsphilosophie bildet, wie dies für Theorien vom Gesellschaftsvertrag grundsätzlich charakteristisch ist, die Annahme eines Naturzustands, der bei Hobbes allerdings keine historische Hypothese, sondern eine analytisch-theoretische Kategorie darstellt. Der Naturzustand als Fiktion oder Gedankenexperiment soll demnach lediglich illustrieren, welche politische Anthropologie der Theoriebildung zugrunde liegt. Der Entwurf dieses Naturzustandes ist geprägt von Hobbes` pessimistischer Anthropologie: Einziger allgemeinmenschlicher Wert sei die Selbsterhaltung; statt allgemeingültiger moralischer Werte, die menschliches Verhalten unabhängig von autoritativer Setzung normativ beeinflussen würden, werde dieses lediglich von Kalkülen zur individuellen Nutzenmaximierung bestimmt. Die Menschen seien egoistisch und mit einem von Altruismus oder Moral unbeschränkten Machtstreben ausgestattet, das einzige natürliche Recht in diesem Zustand ist, alles zu tun, was der Selbsterhaltung nütze. Die Klugheitsregeln, nach denen sich Individuen laut Hobbes darüber hinaus richten, etwa die Bindung an Verträge, die goldene Regel oder Entgegenkommen, verpflichteten dagegen nur innerlich, durch Folgenabwägung und Nutzenkalkül; äussere Verbindlichkeit, also Rechtssicherheit, kann es im Naturzustand daher nicht geben. Hobbes` Naturzustand ist somit beherrscht von Ruhmsucht, Misstrauen und Furcht, dem Krieg aller gegen alle. Zu überwinden sei dieser durch die Gründung des Staats mittels der Übertragung der Macht auf einen Souverän, den Leviathan. Dies erfolge durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen den zuvor ungebundenen Individuen, durch den diese
2 ihr natürliches Recht auf Selbstverteidigung und Selbstbestimmung unwiderruflich auf den Souverän übertrügen, der seine so begründete Macht zum Schutz der Bürger nutzt. Dadurch, dass dieser Vertrag nach Hobbes` Auffassung zwischen den Bürgern zugunsten des Souveräns geschlossen wird, ergeben sich einige Besonderheiten: Da der Souverän nicht Vertragspartei, sondern lediglich Begünstigter des Vertrages sei, könne der Gesellschaftsvertrag ihm gegenüber nicht gekündigt werden, ein Widerstandsrecht der Bürger sei somit folgerichtig ausgeschlossen. Die Macht des Souveräns sei auch ansonsten unbeschränkt, umfasse etwa auch die Herrschaft über Glaubensfragen (wenn auch die innere Glaubensfreiheit nicht beschnitten werden dürfe), das Recht zur Kriegsführung, zur Zensur, zur Gestaltung der Eigentumsordnung und zur Verhängung der Todesstrafe. Der Souverän bestimme seine Nachfolge zudem selbst. Wie die Herrschaft faktisch begründet werde, ob durch Gewalt oder die Einsetzung durch die Gemeinschaft, habe auf diese durch die Fiktion des Gesellschaftsvertrages legitimierte Machtfülle des Souveräns dagegen keinen Einfluss. John Lockes`, etwas später entstandene, liberale Vertragstheorie hatte neben einigem theoretischen Einfluss auf spätere Denker im Gegensatz zu Hobbes Konzeption auch eine sehr konkrete Wirkung auf die Entwicklung politisch einflussreicher Ideen der folgenden Jahrzehnte, die sich etwa im Kontext der amerikanischen und französischen Revolutionen niederschlugen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des demokratischen, grundrechtsgebundenen Verfassungsstaates leisteten. Eine grundsätzliche Parallele zu Hobbes` Theorie liegt in einigen der erkenntnistheoretischen Grundannahmen Lockes: Auch dieser war Empirist und Nominalist, betonte also, dass menschliche Erkenntnis nicht auf eingeborenen Ideen, sondern auf Sinneserfahrungen und deren geistiger Verarbeitung etwa durch Verallgemeinerung und Abstraktion sinnlicher Erkenntnis der faktisch nur partikulär existierenden Einzeldinge beruhe. Dementsprechend existiert aus Lockes` Perspektive keine angeborene Moral, etwa in Form von angeborenen Ideen, diese werde wie jegliche menschliche Erkenntnis erst durch individuelle Erfahrung und Erziehung gewonnen. Zuvor seien Menschen ein white paper void of all characters. Allerdings bejaht Locke im Gegensatz zu Hobbes die Existenz eines Naturrechts, das allerdings nicht durch eingeborene, sondern durch die mittels der allgemeinen Vernunft erkennbaren Maximen gebildet werde. Auch in Lockes` Variante einer Gesellschaftsvertragstheorie bildet ein Naturzustand den Ausgangspunkt der Überlegungen. Dieser ist aber keine, wie bei Hobbes, reine Fiktion, sondern sei vielmehr, etwa im Verhältnis von Herrschern untereinander, durchaus noch real anzutreffen. Einen weiteren wichtigen Unterschied zu Hobbes` Konzept des Naturzustandes besteht in Lockes` Annahme eines vorstaatlichen natürlichen (Vernunft-)Gesetzes: Im Naturzustand herrsche nicht nur grundsätzliche Freiheit und Gleichheit, sondern auch das Verbot, Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum eines anderen zu verletzen. Da sich jedoch Einzelne über dieses Verbot hinweg zu setzen drohten, tendiert auch Lockes` Naturzustand dazu, sich in einen Kriegszustand zu entwickeln. Der Abschluss des Gesellschaftsvertrags diene daher letztlich der Rechtssicherheit, da die bereits vorstaatlich bestehenden Rechte nur durch einen solchen Übertritt in die politische Gesellschaft und ihre Institutionen geschützt werden könnten. Auch nach Lockes` Vorstellung delegieren die Einzelnen mit dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags ihre natürlichen Rechte auf Selbsterhaltung und die Strafgewalt an den Staat, der im Gegensatz zu Hobbes` Leviathan aber nicht über absolute Verfügungsgewalt über seine Untertanen verfügt: Vielmehr herrsche in der so begründeten Gesellschaft das Mehrheitsprinzip, die Konstituierung der Regierung erfolge erst nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages und nur das (zumindest konkludente) Einverständnis des Bürgers mache diesen zum Mitglied des Staates. Der Vertragsschluss stellt auch keinen einseitigen Unterwerfungsvertrag dar, vielmehr wird durch ihn auch die Regierung gebunden. Folgerichtig bejaht Locke ein Widerstandsrecht der Bürger, sobald der Staat seine Aufgabe, den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum, nicht mehr erfülle. In der
3 Ausübung seiner Staatsgewalt ist der legitime Staat an das Naturgesetz gebunden. Rousseau entwickelt seine Theorie vom Gesellschaftsvertrag eingebettet in eine Geschichtsphilosophie ohne Teleologie mit negativem Grundton. Ausgangspunkt ist eine Auseinandersetzung mit der Kultur und Gesellschaft seiner Zeit und eine frühe Aufklärungsund Wissenschaftskritik. Während Hobbes und Locke den Naturzustand als zumindest potentiellen Krieg aller gegen aller konzipieren und zumindest Hobbes` negative Anthropologie den Menschen im Naturzustand als nach Macht strebendes, misstrauisches und furchtsames Wesen charakterisiert, zeichnet Rousseau ein grundsätzlich positives Bild vom urwüchsigen Individuum. Im (auch hier hypothetischen) Naturzustand sei der Mensch das am besten ausgestattete Tier, autark, ohne Sprache, Vernunft, Moral oder Liebe, bedürfnislos und selbstbezogen, aber von Natur aus gut. Das Naturrecht im Naturzustand ergebe sich, den natürlichen Neigungen der ursprünglichen Menschen gemäss, aus Selbstliebe und Mitleid. Der Zivilisationsprozess ist für Rousseau eine negative Entwicklung: Um sich gegen widrige Umstände zu wappnen vereinigten sich die Menschen zu Horden oder Familien, die Sprache und das Eigentum entstünden und durch die Interaktion und den Vergleich mit anderen schliesslich Konkurrenz und Neid. Aus der urwüchsigen, selbstgenügsamen Selbstliebe (amour de soi) des Naturmenschen werde die naturwidrige Eigenliebe oder Selbstsucht (amour propre) des zivilisierten, nunmehr depravierten Individuums; Herrschaft und gesellschaftliche Ungleichheit entstünden. Vor diesem Hintergrund entwickelt Rousseau seine Theorie vom Gesellschaftsvertrag, durch den, wie er hofft, die amour propre in Staatsbürgertugend gewandelt werden könne. Im Naturzustand bestehe, wie bei Hobbes, die natürliche Freiheit und ein Recht eines jeden auf alles. Die natürliche Freiheit fordere, dass alles Recht nur Folge von Vereinbarungen sein könne, das oberste (Natur-)Gesetz der Menschen, die Selbsterhaltung, bedeute das Recht, über die für diese erforderlichen Mittel selbst zu bestimmen. Das Recht des Stärkeren habe dagegen, da es nur auf faktischem Zwang beruhe, keine normative Qualität. Den Austritt aus dem Naturzustand betrachtet Rousseau als sinnvoll, weil der Aufwand, sich im Naturzustand zu halten, ab einem bestimmten Punkt grösser werde, als eine Gesellschaft zu begründen. Aus solchen Nützlichkeitserwägungen beschlössen die Individuen den Gesellschaftsvertrag, dem einstimmig zuzustimmen sei. Folge des Vertrags sei die moralische rechtliche Ordnung, die bürgerliche Freiheit. Anders als bei Locke und ähnlich wie bei Hobbes entäussert sich Rousseaus` Individuum durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags vollständig an die Gemeinschaft. Im Unterschied zu Hobbes geschieht dies aber nicht allein aufgrund der notwendig absoluten Macht des Souveräns, sondern weil eine Begrenzung der souveränen Macht im Sinne des Schutzes der Untertanen nicht notwendig sei, da der Wille des Souveräns notwendig gut sei. Rousseaus` Gemeinwille (volonté générale), der das Gemeininteresse der Gesellschaft repräsentiert und sich in demokratischen Abstimmungen äussere, steht für diesen notwendig richtigen Willen des Souveräns. Das durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags begründete Gemeinwesen entwirft Rousseau als radikal-demokratische Republik: Die Republik sei eine durch allgemeine Gesetze regierte Ordnung, die Bürger der Souverän erliessen die Gesetze und wählten die Regierung, welche die Gesetze dann umsetze. Ziel des Gemeinwesens sei die Freiheit und Gleichheit der Bürger. Als Vertreter einer Vertragstheorie konnte alternativ Kant genannt werden. Vergleich der Theorien: Anhand der näher dargestellten Entwürfe von Hobbes, Locke und Rousseau können die Gemeinsamkeiten ebenso wie die erheblichen Differenzen zwischen den einzelnen Vertragstheorien erläutert werden. Eine wichtige Gemeinsamkeit aller Vertragstheorien ist ihr theoretisches Ziel: Ausgehend von der Autonomie des Individuums
4 soll die Legitimität von Staat und Recht begründet werden die Menschen schliessen sich aus freien Stücken zusammen, um die legitime staatliche Ordnung zu begründen. Alle Vertragstheoretiker gehen in ihrer Argumentationsstrategie grundsätzlich gleich vor: Es wird von einem vorstaatlichen, hypothetischen oder faktischen Naturzustand ausgegangen, der durch die Selbstverpflichtung der Individuen mittels des Gesellschaftsvertrages in den gesellschaftlichen Zustand übergeht. Im Einzelnen unterscheiden sich die geschilderten Theorien aber erheblich voneinander: Hobbes geht von einem negativen Menschenbild aus und verneint vorstaatliche Rechte, die über das natürliche Selbsterhaltungsrecht des Menschen hinausgehen würden. Sein Naturzustand ist folgerichtig chaotisch und anarchisch, gekennzeichnet vom Krieg aller gegen alle. Das durch den Gesellschaftsvertrag zur Herstellung von Sicherheit und Ordnung begründete Gemeinwesen ist gekennzeichnet von der absoluten Macht des Souveräns. All diese Eigenschaften der Theorie Hobbes` sind Gegenstand reger Kritik: Die Darstellung des Naturzustands sei keine Darstellung einer allgemeinmenschlichen Natur, sondern ein historischer Verfallszustand, die Konzeption eines allein auf eigene Interessen bedachten Menschen einseitig und vereinfacht, da sie etwa menschliche Eigenschaften wie Fürsorge und Solidarität nicht berücksichtige. Zudem vernachlässigt Hobbes, indem er normative Orientierung nur auf staatlichen Zwang gründet, andere wichtige Aspekte der Geltung von Normen, etwa die Normbefolgung aufgrund der Vorstellung von der Richtigkeit z.b. moralischer Normen. Eine naheliegende Kritik wendet sich zudem gegen den absolutistischen Charakter der Hobbesschen Herrschaftsordnung der Staat hat über den Schutz der Bürger voreinander hinausgehende Aufgaben, staatliche Gewalt bedarf, wie es insbesondere auch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts zeigen, der materiellen Begrenzung durch Verfassungen und Menschenrechte. Die Annahme vorstaatlicher Rechte betrifft einen wesentlichen Unterschied der Konzeption Lockes` gegenüber Hobbes: Die Individuen in Lockes Naturzustand besitzen (Menschen- )rechte, auch dort gilt das Verbot, die physische Integrität, die Freiheit oder das Eigentum anderer zu verletzen. Der Staat wird letztlich zur optimierten Gewährleistung eben dieser Rechte begründet, seine Macht ist durch diese Funktion legitimiert wie begrenzt. Rousseaus Vertragstheorie unterscheidet sich grundsätzlich von Hobbes und Locke: Sein hypothetischer Naturzustand etwa wird im Gegensatz zu Hobbes Krieg aller gegen alle zumindest in einem Teil seiner diesbezüglich ambivalenten und teilweise widersprüchlichen Äusserungen als ein eher idyllischer Ort dargestellt, in dem die Individuen ihrer eigentlichen Natur und dem Naturrecht gemäss leben, der Mensch nicht des Menschen Wolf sondern von Natur aus gut ist. Der Gesellschaftsvertrag soll die Freiheit, die durch die Korrumpierung des Menschen im Laufe der Entwicklung der Zivilisation verloren gegangen ist, als bürgerliche Freiheit in einer moralischen und rechtlichen Ordnung wieder herstellen. Rousseaus Staatswesen ist, im radikalen Gegensatz zu Hobbes, direktdemokratisch organisiert. Im Gegensatz zu Locke veräussert sich der Einzelne vollständig an das Gemeinwesen. Rousseau behauptet die Identität der Interessen von Individuum und Gemeinschaft und sieht daher kein Bedürfnis für den Schutz grundlegender Menschenrechte, die ja eine Freiheitssphäre des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft sichern sollen. Mögliche Kritik/Stellungnahme: Die Unterschiedlichkeit der Konzeptionen Hobbes, Lockes und Rousseaus weisen auf ein grundsätzliches Problem der vertragstheoretischen Begründungsversuche einer legitimen gesellschaftlichen Ordnung hin: Je nachdem welche anthropologischen Grundannahmen, erkenntnistheoretischen und normativen Prämissen solchen Versuchen der Letztbegründung zugrunde gelegt werden, können ganz unterschiedliche und gar einander widersprechende Staats- und Gesellschaftsentwürfe legitimiert werden. Die Idee eines Naturzustandes wirft so die Frage auf, ob dessen Eigenschaften nicht strategisch in Bezug auf die Legitimation einer bestimmten, aus ganz anderen Gründen präferierten Staatsform gewählt werden.
5 Die insbesondere in der Annahme eines hypothetischen Naturzustands zum Ausdruck kommenden normativen und anthropologischen Prämissen dieser Entwürfe können zudem, dies ist einer der wichtigsten Einwände gegen die Vertragstheorien, selbst nicht vertragstheoretisch begründet werden: Vertragstheorien können nicht begründen, warum Menschen diejenige Freiheit und Gleichheit zukommen soll, die dem freiwilligen, von individuellen Nutzenkalkülen bestimmten Abschluss des Vertrages erst seine normative, legitime Autorität begründende Wirkung vermittelt. 2. Frage (30%) Die Frage nach den Grundlagen legitimer Herrschaft beantwortet Habermas im Kontext seiner Diskurstheorie. Ausgehend von der Beobachtung, dass sich ein intersubjektiv gültiger Massstab für die vernünftige und gerechte Ordnung in der Geistesgeschichte weder aus der subjektiven Vernunft, noch aus der Tradition, der Beobachtung einer Teleologie der Geschichte oder einer wie auch immer gearteten Natur des Menschen habe begründen lassen, geht diese einen anderen Weg: Habermas konzipiert einen Begriff der Vernunft, der sich in der zwischenmenschlichen Kommunikation entfaltet. Erkenntnistheoretisch, also im Bezug auf Wahrheitsfragen, wendet sich die Diskurstheorie (zumindest in ihren frühen Entwürfen, später relativiert Habermas seine epistemologische Position) von der sog. Korrespondenztheorie der Wahrheit ab, für die das Wahrheitskriterium die Übereinstimmung von Erkenntnis und objektivem Sachverhalt war, und begründet ein prozeduralisiertes Wahrheitskriterium: Wahr sei, was sich in einem bestimmten Verfahren, dem Diskurs, als wahr ergebe. Der Diskurs sei diejenige Verständigungsform, in welche die Akteure einer Verständigungssituation einträten, sobald die Verständigung problematisch werde, also gegebenenfalls differierende Geltungsansprüche auf die Wahrheit oder normative Richtigkeit des Gesagten oder die Wahrhaftigkeit des Sprechenden erhoben würden. Ob diese Geltungsansprüche gerechtfertigt sind, werde im Diskurs entweder durch den begründeten Konsens der Sprechenden eingelöst, oder aber, falls ein solcher nicht erreicht wird, fallen gelassen. Mit dem Eintritt in den Diskurs durch das Erheben von Geltungsansprüchen müssen die Sprechenden nun laut Habermas die Möglichkeit eines solchen begründeten Konsenses voraussetzen und damit bestimmte, kontrafaktische Bedingungen der Chancengleichheit im Diskurs akzeptieren, die er unter den Begriff der idealen Sprechsituation fasst: Diese sei gekennzeichnet durch die Öffentlichkeit und vollständige Inklusion aller Betroffenen, die Gleichverteilung der Kommunikationsrechte, die Gewaltlosigkeit der Situation, die nur den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zur Geltung kommen lasse und die Aufrichtigkeit der Äusserungen aller Beteiligten. Auch in der Moralphilosophie wird auf das Konstrukt des herrschaftsfreien Diskurses zurückgegriffen. Sobald man sich auf einen Verständigungsprozess einlasse, habe man die Argumentationsregel (oder den Universalisierungsgrundsatz) U bereits akzeptiert: Jede gültige Norm muss der Bedingung genügen, dass die voraussichtlichen Folgen und Nebenwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden voraussichtlich ergeben, von allen Betroffenen zwanglos akzeptiert werden können. Aus dieser Argumentationsregel folge das zentrale Prinzip der Diskursethik, dass für alle Handlungsnormen, also für Moral und Recht, gelte: Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Recht und Moral stehen für Habermas autonom neben einander, sie ergänzen sich gegenseitig und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Das Recht lege normative Inhalte im Gegensatz zur Moral autoritativ fest und sanktioniere den Normverstoss. Habermas betont aber, dass auch das Recht legitim sein muss: Das Recht müsse sowohl Legalität durch Sanktionen herstellen, als auch Legitimität verkörpern. Die Legitimität erweise sich durch die Übereinstimmung mit dem Diskursprinzip. Durch diese Rückbindung des Legitimitätsbegriffs an den Diskurs
6 zeigt sich nach Habermas` Auffassung, dass im modernen Begriff des Rechts die Idee der Demokratie bereits angelegt sei, da sich in dieser die diskursive Rationalität gerade entfalte. Die Diskursethik zeige die innere Verbindung von Demokratie und Vernunft. Parallelen und Unterschiede gegenüber vertragstheoretischen Konzepten: Habermas Rechtstheorie steht in der Tradition der theoretischen Vordenker eines liberalen und demokratischen Rechtsstaats, zu denen auch Vertreter einer Vertragstheorie wie Locke, Rousseau oder Kant gehören. Wie diese meint er, dass das Recht seine Legitimität durch die sozialintegrative Kraft des übereinstimmenden und vereinigten Willens aller freien und gleichen Staatsbürger gewinnt. Die Legitimation von Recht und Staat wird wie schon bei den Vertragstheoretikern nicht metaphysisch oder religiös begründet, sondern durch den zumindest hypothetischen Rückgriff auf die autonome Entscheidung des letztlich eigenen Nutzenkalkülen folgenden Individuums. Wie die Vertragstheoretiker geht Habermas zudem von bestimmten kontrafaktischen Annahmen aus: während diese ihrer rationalen Rekonstruktion legitimer Ordnung das Gedankenexperiment eines Naturzustandes zugrundelegen, unterstellt jener bestimmte kontrafaktische Bedingungen der Chancengleichheit, die notwendig mit dem Eintritt in den Diskurs akzeptiert würden und verbindet seine Rechtsphilosophie mit einer Diskursethik mit universellem Anspruch. Eine grundsätzliche Abgrenzung gegenüber klassischen Philosophien sieht Habermas in seiner Fokussierung einer Vernunft die sich in der Kommunikation entfaltet: Die monologische, von einem Einzelnen in seiner eigenen Reflexion entwickelte Ethik der Vergangenheit werde abgelöst durch den realen Einbezug der Angehörigen einer Gesellschaft in die moralische Entscheidungsfindung. Ein wichtiger Unterschied zu den Vertragstheoretikern liegt zudem in der Tatsache, dass Habermas` seine Theorie weitgehend prozeduralistisch anlegt: Anstelle einer, etwa auf einem Gedankenexperiment beruhenden, Auszeichnung konkreter (rechtlicher oder moralischer) normativer Gehalte, die nach seiner Auffassung zu einem philosophischen Paternalismus führen könnte, soll sich die Philosophie auf die Analyse der Bedingungen für rationale Diskurse und Verhandlungen beschränken. Habermas meint, formale aber universelle Bedingungen für die diskursive Erzeugung von vernünftigen Handlungsnormen im Prozess einer vernünftigen Meinungs- und Willensbildung definiert zu haben. 3. Frage (30 %) Hans Kelsen und H.L.A Hart zählen zu den bedeutendsten Vertretern des Rechtspositivismus. Wissenschaftstheoretischer Hintergrund des Rechtspositivismus ist der Positivismus, ein erkenntnistheoretisches Ideal der Naturwissenschaften, das besagt, dass Gegenstand der Wissenschaft nur empirische Fakten sein könnten, welche wiederum nur empirischer Erkenntnis zugänglich seien. Da Erkenntnis nach der Auffassung des Positivismus nur auf empirischer Erfahrung und laut dem sog. Logischen Positivismus gegebenenfalls logischen Urteilen beruhen kann, wird Phänomenen wie Werten, Normen oder der Moral, da diesen das empirische Substrat fehle und es sich auch nicht um logische Kategorien handle, jeder wissenschaftlich fassbare Gehalt abgesprochen. Auch der Rechtspositivismus fordert, wissenschaftliche Erkenntnis auf die Interpretation positiver Befunde, in seinem Falle: auf das positive, tatsächlich gegebene, gesetzte Recht, zu beschränken und positive Rechtsordnungen deskriptiv zu erfassen und zu analysieren. Eine grundlegende Charakteristik der meisten rechtspositivistischen Theorien sind die auf David Hume zurückgehende Trennung von Sein und Sollen und die strikte Trennung von Recht und Moral. Kelsen unterscheidet zwischen Geltung und Wirksamkeit von Rechtsnormen. Wirksamkeit sei die, empirischer Forschung zugängliche, tatsächliche Effizienz von Rechtsnormen. Die Geltung sei dagegen der spezifisch normative Charakter, das Sollen einer Norm. Die
7 Geltung einer Rechtsnorm könne, da aus einem Sein kein Sollen abgeleitet werden könne, nur durch ein anderes Sollen, eine höherrangige Norm begründet werden. Da die Geltung der übergeordneten Norm wiederrum nur durch normhierarchisch über ihr angesiedelte Normen gewährleistet werden kann, entsteht ein Regress, der erst bei der Grundnorm endet. Die Rechtsnormen eines Rechtssystems gründen ihre Geltung somit auf ihr verfahrensgemässes zustande kommen als Teil einer einheitlichen, auf eine Grundnorm als letztes Geltungsprinzip zurückführbaren Rechtsordnung. In der Grundnorm liegt nach Kelsens Konzeption die Quelle der Sollensqualität des gesamten Rechtssystems. Darüber hinaus ist ein gewisser Grad an sozialer Wirksamkeit nach Kelsens Analyse Voraussetzer der Geltung einer Rechtsordnung. Kelsens bekanntere Formulierung der Grundnorm lautet: Zwangsakte sollen gesetzt werden unter den Bedingungen und auf die Weise, die die historisch erste Staatsverfassung und die ihr gemäss gesetzten Normen statuieren. Auch Hart geht davon aus, dass es keine notwendige oder logische Verbindung zwischen dem Recht und der Moral gibt (auch wenn Hart ganz im Gegensatz zu Kelsen einen moralischen Mindestgehalt rechtlicher Normen an nimmt). Zur Beantwortung der Frage nach dem Charakteristikum des Rechts gegenüber anderen, etwa moralischen Regeln, unterscheidet Hart zwischen Regeln erster und zweiter Ordnung. Regeln erster Ordnung seien Regeln, die Handlungsanweisungen geben. Regeln zweiter Ordnung seien Regeln, die zum aufstellen von Regeln ermächtigten oder Handlungsmöglichkeiten schafften. Während die Moral nur aus Regeln erster Ordnung bestehe, beruhten Rechtsregeln auf einer Sekundärregel besonderer Art, der rule of recognition, Harts berühmter Erkenntnisregel. Diese bestimme, welche Regeln Rechtsregeln seien (z.b. Recht ist, was der König in Kraft gesetzt hat ) und sei einerseits eine soziologische Beschreibung und andererseits eine Quelle der Verbindlichkeit für die Rechtsanwender. Hart betrachtet die rule of recognition als eine Art empirischer Grundnorm, als eine Weiterentwicklung der Kelsenschen Theorie. Mögliche Stellungnahme: Eine mögliche Kritik an Kelsens Konzeption einer Grundnorm beinhaltet den Vorwurf eines Zirkelschlusses: Die Grundnorm sei laut Kelsen die Voraussetzung der Normativität der Rechtsordnung. Die Grundnorm sei eine zwingende Annahme, da ansonsten die Normativität der Rechtsordnung keinen Grund habe. Gerade die Normativität der Rechtsordnung, die so vorausgesetzt wird, ist es aber, die in Frage steht. Kelsen leite die Normativität der Rechtsordnung aus der Grundnorm ab, die vorausgesetzt werde, weil die Rechtsordnung normativ sei. Dies stelle aber einen Zirkelschluss dar. Ein möglicher Einwand gegen Harts Grundnorm besagt, dass diese bestimmte rechtliche Phänomene nicht zuverlässig identifizieren könne. An dieser Stelle können auch allgemeine Einwände gegen Kelsens und Harts Versionen eines Rechtpositivismus vorgebracht werden (vgl. hierzu das Skript zur Vorlesung).
Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1: Natürliche" und bürgerliche Gleichheit" im älteren deutschen Naturrecht der Aufklärung 15.
 Inhaltsverzeichnis Vorwort VII Einleitung 1 I. Fragestellung und Gang der Untersuchung 1 II. Quellen und Methode, 8 III. Forschungsstand und Literatur 11 Kapitel 1: Natürliche" und bürgerliche Gleichheit"
Inhaltsverzeichnis Vorwort VII Einleitung 1 I. Fragestellung und Gang der Untersuchung 1 II. Quellen und Methode, 8 III. Forschungsstand und Literatur 11 Kapitel 1: Natürliche" und bürgerliche Gleichheit"
Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende. Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten?
 Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten? 1 Was ist «Moral»? «ETHIK» und «MORAL» Moralische Grundsätze
Werte und Grundsätze des Berufskodexes für interkulturell Dolmetschende Ethische Überlegungen: Was ist richtig? Wie soll ich mich verhalten? 1 Was ist «Moral»? «ETHIK» und «MORAL» Moralische Grundsätze
BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit Klausur 2 4 (Grundbegriffe des Rechts und der juristischen Methodik)
 Prof. Dr. J. Sieckmann Professur für Öffentliches Recht Lehrangebot für Bachelor-/Masterstudiengänge Übersicht BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit 2 4 (Grundbegriffe
Prof. Dr. J. Sieckmann Professur für Öffentliches Recht Lehrangebot für Bachelor-/Masterstudiengänge Übersicht BA-Studium SWS Credits 1) Einführung in die Rechtswissenschaft Vorlesung mit 2 4 (Grundbegriffe
Einführung in die Erziehungswissenschaft. Bildungstheorien. Vorlesungsplan. Einführende Bemerkungen, riskante Definitionen
 SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
SoSe 06 Prof. Dr. Gerhard de Haan Vorlesungsplan Einführung in die Erziehungswissenschaft Bildungstheorien 1. (20.04.06) Organisatorisches / Einführung: Wissensgesellschaft 2. (27.04.06) Anthropologie
Tutorium für LehramtskandidatInnen Sommersemester 2012
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Lehrstuhl für Internationale Beziehungen Lehrstuhl für Politische Theorie Tutorium für LehramtskandidatInnen Sommersemester
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft Lehrstuhl für Internationale Beziehungen Lehrstuhl für Politische Theorie Tutorium für LehramtskandidatInnen Sommersemester
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein?
 I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
I. Einleitung: Kann der Gottesglaube vernünftig sein? In seiner Hausmitteilung vom 20. 12. 1997 schreibt Der Spiegel: «Unbestreitbar bleibt, daß die großen Kirchen in einer Zeit, in der alle Welt den Verlust
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität
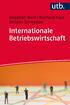 20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
20 Internationale Unternehmenskulturen und Interkulturalität Artefakte Auf der obersten Ebene befinden sich die Artefakte. Darunter fasst man jene Phänomene, die unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar sind.
Ludwig Feuerbach. *28.7.1804 (Landshut) +13.9.1872 (Rechenberg bei Nürnberg)
 Ludwig Feuerbach *28.7.1804 (Landshut) +13.9.1872 (Rechenberg bei Nürnberg) 1823 Studium der Theologie in Heidelberg bei Karl Daub (Hegelianer) 1824 Studium bei Hegel in Berlin, 1825 Wechsel zur Philosophie
Ludwig Feuerbach *28.7.1804 (Landshut) +13.9.1872 (Rechenberg bei Nürnberg) 1823 Studium der Theologie in Heidelberg bei Karl Daub (Hegelianer) 1824 Studium bei Hegel in Berlin, 1825 Wechsel zur Philosophie
Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19
 Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19 Online Texte: Homepage: http://www.unierfurt.de/internationalebeziehungen/ Passwort: EinführungPO Politische Ordnungen Staaten und Soveränität Dr. Andrea Ribeiro Hoffmann
Reader : Copyshop Rotplombe Nr. 19 Online Texte: Homepage: http://www.unierfurt.de/internationalebeziehungen/ Passwort: EinführungPO Politische Ordnungen Staaten und Soveränität Dr. Andrea Ribeiro Hoffmann
 Die Magna Charta der Universitäten Präambel Die unterzeichneten Universitätspräsidenten und -rektoren, die sich in Bologna anlässlich der neunten Jahrhundertfeier der ältesten europäischen Universität
Die Magna Charta der Universitäten Präambel Die unterzeichneten Universitätspräsidenten und -rektoren, die sich in Bologna anlässlich der neunten Jahrhundertfeier der ältesten europäischen Universität
Geld regiert die Welt
 Geld regiert die Welt Gegenstand und Problemstellung: Ethik als Kulturprinzip verstanden erklärt Ökonomie Fragen zur ersten Ringvorlesung im Wintersemester 08/09 Prof. Klaus Bastian {bastian@imn.htwk-leipzig.de},
Geld regiert die Welt Gegenstand und Problemstellung: Ethik als Kulturprinzip verstanden erklärt Ökonomie Fragen zur ersten Ringvorlesung im Wintersemester 08/09 Prof. Klaus Bastian {bastian@imn.htwk-leipzig.de},
Buddhismus und westliche Philosophie im Dialog
 Buddhismus und westliche Philosophie im Dialog Privat Prof. Dr. Jay Garfield im Tibetischen Zentrum 22. bis 29. Juni 2010 Tibetisches Zentrum Unter der Schirmherrschaft Seiner Heiligkeit 14. Dalai Lama
Buddhismus und westliche Philosophie im Dialog Privat Prof. Dr. Jay Garfield im Tibetischen Zentrum 22. bis 29. Juni 2010 Tibetisches Zentrum Unter der Schirmherrschaft Seiner Heiligkeit 14. Dalai Lama
Informatik und Ethik
 Informatik und Ethik Ethik Ethik beschäftigt sich mit der Aufstellung von Kriterien für gutes und schlechtes Handeln und der Bewertung von Motiven und Folgen. Leitlinie dabei ist die menschliche Vernunft.
Informatik und Ethik Ethik Ethik beschäftigt sich mit der Aufstellung von Kriterien für gutes und schlechtes Handeln und der Bewertung von Motiven und Folgen. Leitlinie dabei ist die menschliche Vernunft.
Seminar: Ethiktypen 10.10.2011
 Seminar: Ethiktypen 10.10.2011 Programm heute 1. Organisatorisches - Modulübersicht - Stundenplan SS 2011 - Termine 2. Einführung zum Seminar 3. Lektüreplan der ersten Stunden 2 1. Organisatorisches Modulübersicht
Seminar: Ethiktypen 10.10.2011 Programm heute 1. Organisatorisches - Modulübersicht - Stundenplan SS 2011 - Termine 2. Einführung zum Seminar 3. Lektüreplan der ersten Stunden 2 1. Organisatorisches Modulübersicht
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen IX, MACHT UND HERRSCHAFT Die, die die menschlichen Angelegenheiten mit philosophischem Blick betrachten,
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen IX, MACHT UND HERRSCHAFT Die, die die menschlichen Angelegenheiten mit philosophischem Blick betrachten,
Ethik im Wirtschaftsalltag
 Kann ein Unternehmen überhaupt ethisch handeln? Ja. Aber nicht, indem das Unternehmen sich an einer allgemeingültigen Definition von Ethik versucht, sondern indem es die Rahmenbedingungen schafft, damit
Kann ein Unternehmen überhaupt ethisch handeln? Ja. Aber nicht, indem das Unternehmen sich an einer allgemeingültigen Definition von Ethik versucht, sondern indem es die Rahmenbedingungen schafft, damit
Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann)
 Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Befähigungsgerechtigkeit als ethisches Benchmark für Public Health Genomics
 Befähigungsgerechtigkeit als ethisches Benchmark für Public Health Genomics Eröffnungsfeier des DZPHG Bielefeld 24.11.2006 Peter Dabrock Juniorprofessor für Sozialethik (Bioethik) Fachbereich Evangelische
Befähigungsgerechtigkeit als ethisches Benchmark für Public Health Genomics Eröffnungsfeier des DZPHG Bielefeld 24.11.2006 Peter Dabrock Juniorprofessor für Sozialethik (Bioethik) Fachbereich Evangelische
20 2 Begriffsabgrenzung (Werte, Tugend, Moral und Ethik)
 20 2 Begriffsabgrenzung (Werte, Tugend, Moral und Ethik) werden. Im Rahmen der sozialen Integration stellen sich dem Individuum unter anderem folgende Fragen: 23 Unter welchen Menschen fühle ich mich zu
20 2 Begriffsabgrenzung (Werte, Tugend, Moral und Ethik) werden. Im Rahmen der sozialen Integration stellen sich dem Individuum unter anderem folgende Fragen: 23 Unter welchen Menschen fühle ich mich zu
Attraktion Unternehmenskultur. Ihre Bedeutung für die Bindung von Mitarbeitern
 Attraktion Unternehmenskultur Ihre Bedeutung für die Bindung von Mitarbeitern Übersicht 1. Wodurch lassen wir uns begeistern? 2. Was bedeutet Unternehmenskultur? 3. Wie sind Unternehmenskulturen aufgebaut?
Attraktion Unternehmenskultur Ihre Bedeutung für die Bindung von Mitarbeitern Übersicht 1. Wodurch lassen wir uns begeistern? 2. Was bedeutet Unternehmenskultur? 3. Wie sind Unternehmenskulturen aufgebaut?
Gutes Leben was ist das?
 Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das
Einführung in die Pädagogik 1
 11 Einführung in die Pädagogik 1 Überblick Im ersten einführenden Kapitel beschäftigen wir uns zunächst mit dem Begriff der Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaft und seiner definitorischen Abgrenzung.
11 Einführung in die Pädagogik 1 Überblick Im ersten einführenden Kapitel beschäftigen wir uns zunächst mit dem Begriff der Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaft und seiner definitorischen Abgrenzung.
Deliberation and Democratic Legitimacy Joshua Cohen
 Deliberation and Democratic Legitimacy Joshua Cohen 1. Zur Person von Joshua Cohen Joshua Cohen ist Professor am Institute of Technology in Massachusetts und Lehrstuhlinhaber des Departements für Politikwissenschaften.
Deliberation and Democratic Legitimacy Joshua Cohen 1. Zur Person von Joshua Cohen Joshua Cohen ist Professor am Institute of Technology in Massachusetts und Lehrstuhlinhaber des Departements für Politikwissenschaften.
Kant, Kritik der Urteilskraft
 Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Kant, Kritik der Urteilskraft Kant über das Schöne. Kommentierende Hinweise (I) Textgrundlage: KU, 1 5. 1 Der Zusammenhang
Universität Dortmund, Sommersemester 2007 Institut für Philosophie C. Beisbart Kant, Kritik der Urteilskraft Kant über das Schöne. Kommentierende Hinweise (I) Textgrundlage: KU, 1 5. 1 Der Zusammenhang
6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT
 26 6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 6.1. GESCHICHTE DER ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Die Übersetzungswissenschaft ist eine sehr junge akademische Disziplin und wurde erst Anfang der 60er Jahre
26 6. ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 6.1. GESCHICHTE DER ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Die Übersetzungswissenschaft ist eine sehr junge akademische Disziplin und wurde erst Anfang der 60er Jahre
Dimensionen sozialer Ungleichheit. [ Sozialer Wandel ] Ansätze zur Erklärung und Überwindung sozialer Ungleichheit Klassische Theorien
![Dimensionen sozialer Ungleichheit. [ Sozialer Wandel ] Ansätze zur Erklärung und Überwindung sozialer Ungleichheit Klassische Theorien Dimensionen sozialer Ungleichheit. [ Sozialer Wandel ] Ansätze zur Erklärung und Überwindung sozialer Ungleichheit Klassische Theorien](/thumbs/32/15401520.jpg) Gymnasium Gemeinschaftskunde Klasse 11-538 - Lehrplaneinheit 1: Gesellschaft und Sozialstaat in der Bundesrepublik Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit verschiedenen Kategorien zur Beschreibung
Gymnasium Gemeinschaftskunde Klasse 11-538 - Lehrplaneinheit 1: Gesellschaft und Sozialstaat in der Bundesrepublik Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit verschiedenen Kategorien zur Beschreibung
Merkpunkte für die Zukunft
 PAX 2005 Öffentliche Anhörung Merkpunkte für die Zukunft 1 Mit dem Ziel einer rationalen Bewertung hat das Kuratorium am 14. und 15. Oktober 2005 im Kurhaus Göggingen eine öffentliche Anhörung zum Programm
PAX 2005 Öffentliche Anhörung Merkpunkte für die Zukunft 1 Mit dem Ziel einer rationalen Bewertung hat das Kuratorium am 14. und 15. Oktober 2005 im Kurhaus Göggingen eine öffentliche Anhörung zum Programm
Wissenschaftstheorie
 Wissenschaftstheorie 2. Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven Andreas Georg Scherer Prof. Dr. Andreas Georg Scherer, Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung,
Wissenschaftstheorie 2. Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Perspektiven Andreas Georg Scherer Prof. Dr. Andreas Georg Scherer, Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung,
Axiome im NLP von Heiko Schön
 Axiome im NLP von Heiko Schön Wenn man im Fremdwörterlexikon nachschaut so findet man 3 Definitionen des Axioms. 1. (willkürlich) festgelegter Grundsatz einer Theorie 2. als gültig anerkannter Grundsatz,
Axiome im NLP von Heiko Schön Wenn man im Fremdwörterlexikon nachschaut so findet man 3 Definitionen des Axioms. 1. (willkürlich) festgelegter Grundsatz einer Theorie 2. als gültig anerkannter Grundsatz,
In: Widerspruch Nr. 27 Philosophie und Alltag (1995), S. 26-30 Autoren: Andreas Edmüller/Thomas Wilhelm Artikel
 In: Widerspruch Nr. 27 Philosophie und Alltag (1995), S. 26-30 Autoren: Andreas Edmüller/Thomas Wilhelm Artikel Andreas Edmüller Thomas Wilhelm Projekt Philosophie Überzeugen durch Argumente Projekt Philosophie
In: Widerspruch Nr. 27 Philosophie und Alltag (1995), S. 26-30 Autoren: Andreas Edmüller/Thomas Wilhelm Artikel Andreas Edmüller Thomas Wilhelm Projekt Philosophie Überzeugen durch Argumente Projekt Philosophie
2.1 Ewiges Leben und die wahre Liebe
 2.1 Ewiges Leben und die wahre Liebe Die Sehnsucht, ewig zu leben Wir wurden geschaffen, um ewig zu leben und das Ideal der wahren Liebe zu verwirklichen. Während unseres Erdenlebens beschäftigen wir uns
2.1 Ewiges Leben und die wahre Liebe Die Sehnsucht, ewig zu leben Wir wurden geschaffen, um ewig zu leben und das Ideal der wahren Liebe zu verwirklichen. Während unseres Erdenlebens beschäftigen wir uns
in diesem Fragebogen finden Sie eine Reihe von allgemeinen Aussagen. Ein Beispiel: Gutmütige Menschen lassen sich leicht schikanieren.
 Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer unserer Untersuchung, in diesem Fragebogen finden Sie eine Reihe von allgemeinen Aussagen. Ein Beispiel: Gutmütige Menschen lassen sich leicht schikanieren.
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer unserer Untersuchung, in diesem Fragebogen finden Sie eine Reihe von allgemeinen Aussagen. Ein Beispiel: Gutmütige Menschen lassen sich leicht schikanieren.
Von der Antike bis zur Gegenwart Grundpositionen der philosophischen Ethik 27 23
 ethikos zur Konzeption des Arbeitsbuchs 10 Theorie und Praxis des Handelns Moral, Handlung, Werte und Normen Einführung in die Grundlagen der Ethik 11 12 1. Calvin, Hobbes und das Recht des Stärkeren oder
ethikos zur Konzeption des Arbeitsbuchs 10 Theorie und Praxis des Handelns Moral, Handlung, Werte und Normen Einführung in die Grundlagen der Ethik 11 12 1. Calvin, Hobbes und das Recht des Stärkeren oder
Theorie und Praxis des Handelns Moral, Handlung, Werte und Normen: Grundlagen der Ethik 9
 Theorie und Praxis des Handelns Moral, Handlung, Werte und Normen: Grundlagen der Ethik 9 1. Calvin, Hobbes und das Recht des Stärkeren oder: Was versteht man unter Ethik und Moral? 10 2. Denken, handeln
Theorie und Praxis des Handelns Moral, Handlung, Werte und Normen: Grundlagen der Ethik 9 1. Calvin, Hobbes und das Recht des Stärkeren oder: Was versteht man unter Ethik und Moral? 10 2. Denken, handeln
Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
 TU Dortmund, Wintersemester 2009/10 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
TU Dortmund, Wintersemester 2009/10 Institut für Philosophie und Politikwissenschaft C. Beisbart Von der Metaethik zur Moralphilosophie: R. M. Hare Der praktische Schluss/Prinzipien Überblick zum 26.10.2009
(G-N-U) G-N-U GmbH EDV-Dienstleistungen. An die Große Beschwerdekammer (zu G 3/08) beim Europäischen Patentamt Erhardtstraße 27 80469 München
 Gerlachfeld 13 45279 Essen Gerlachfeld 13 45279 Essen An die Große Beschwerdekammer (zu G 3/08) beim Europäischen Patentamt Erhardtstraße 27 80469 München Tel.: 0201-860 428 0 Fax: 0201-860 428 1 http://www.g-n-u.de
Gerlachfeld 13 45279 Essen Gerlachfeld 13 45279 Essen An die Große Beschwerdekammer (zu G 3/08) beim Europäischen Patentamt Erhardtstraße 27 80469 München Tel.: 0201-860 428 0 Fax: 0201-860 428 1 http://www.g-n-u.de
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS
 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS BVerwG 3 B 31.11 VGH 21 B 10.188 In der Verwaltungsstreitsache hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 24. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS BVerwG 3 B 31.11 VGH 21 B 10.188 In der Verwaltungsstreitsache hat der 3. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 24. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS
 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS BVerwG 7 B 68.02 VG 31 A 311.00 In der Verwaltungsstreitsache hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 20. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESCHLUSS BVerwG 7 B 68.02 VG 31 A 311.00 In der Verwaltungsstreitsache hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts am 20. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht
(Ihre Anspruchsprüfung beginnt stets mit dem Obersatz: Wer will was von wem woraus? )
 A. Gutachtenstil Der Gutachtenstil ist eine besondere Argumentationsstruktur, die in juristischen Gutachten angewendet wird. Er soll ermöglichen, Gedankengänge des Verfassers zu verdeutlichen und logisch
A. Gutachtenstil Der Gutachtenstil ist eine besondere Argumentationsstruktur, die in juristischen Gutachten angewendet wird. Er soll ermöglichen, Gedankengänge des Verfassers zu verdeutlichen und logisch
Völkerrecht I: Begriff, Regelungsbereich
 : Begriff, Regelungsbereich 20. September 2011 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2011 Administratives Zuständige Assistierende des Lehrstuhls Kaufmann Caroline Ehlert (044/ 634 48 62) Bei Fragen
: Begriff, Regelungsbereich 20. September 2011 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2011 Administratives Zuständige Assistierende des Lehrstuhls Kaufmann Caroline Ehlert (044/ 634 48 62) Bei Fragen
Grundlagen der Sozialen Demokratie
 LESEBUCH DER SOZIALEN DEMOKRATIE 1 Tobias Gombert u. a. Grundlagen der Sozialen Demokratie INHALT 01. Vorwort 03:37 02. Was ist Soziale Demokratie? 06:57 03. Grundwerte 02:52 04. Freiheit 15:58 05. Gleichheit
LESEBUCH DER SOZIALEN DEMOKRATIE 1 Tobias Gombert u. a. Grundlagen der Sozialen Demokratie INHALT 01. Vorwort 03:37 02. Was ist Soziale Demokratie? 06:57 03. Grundwerte 02:52 04. Freiheit 15:58 05. Gleichheit
 Der Erbvertrag Was kennzeichnet den Erbvertrag? Der Erbvertrag ist in den 2274 ff BGB geregelt. Der maßgebliche Unterschied zum Testament, das jederzeit geändert werden kann, besteht darin, dass der Erblasser
Der Erbvertrag Was kennzeichnet den Erbvertrag? Der Erbvertrag ist in den 2274 ff BGB geregelt. Der maßgebliche Unterschied zum Testament, das jederzeit geändert werden kann, besteht darin, dass der Erblasser
BERUFSGRUNDSÄTZE UND STANDESREGELN
 BERUFSGRUNDSÄTZE UND STANDESREGELN Unternehmensberater Ausgabe 2002 Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie Wiedner Hauptstraße 63 A-1045 Wien Tel. + 43-5-90900-3539, Fax: +43-5-90900-285
BERUFSGRUNDSÄTZE UND STANDESREGELN Unternehmensberater Ausgabe 2002 Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie Wiedner Hauptstraße 63 A-1045 Wien Tel. + 43-5-90900-3539, Fax: +43-5-90900-285
Welche Werte sind heute wichtig?
 1 Vieles, was den eigenen Eltern und Großeltern am Herzen lag, hat heute ausgedient. Dennoch brauchen Kinder Orientierungspunkte, um in der Gemeinschaft mit anderen zurechtzukommen. Alle Eltern wollen
1 Vieles, was den eigenen Eltern und Großeltern am Herzen lag, hat heute ausgedient. Dennoch brauchen Kinder Orientierungspunkte, um in der Gemeinschaft mit anderen zurechtzukommen. Alle Eltern wollen
Konzeption einer Optimierung der Reputationsmessung
 nachweisen; für das Wissen konnte kein signifikanter Effekt nachgewiesen werden (2009, 219). Dazu ist jedoch zu bemerken, dass die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Messmodelle attribut-bezogen operationalisiert
nachweisen; für das Wissen konnte kein signifikanter Effekt nachgewiesen werden (2009, 219). Dazu ist jedoch zu bemerken, dass die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Messmodelle attribut-bezogen operationalisiert
BERGISCHES STUDIENINSTITUT FÜR KOMMUNALE VERWALTUNG Staats- und Europarecht
 Klausur 1; Schwierigkeitsgrad Lösungsskizze Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit I. Zuständigkeit Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art.
Klausur 1; Schwierigkeitsgrad Lösungsskizze Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit I. Zuständigkeit Die Zuständigkeit des BVerfG ergibt sich aus Art.
Vermerk zur Reichweite der Einsichtnahme in Bebauungspläne nach HmbTG
 Vermerk zur Reichweite der Einsichtnahme in Bebauungspläne nach HmbTG Fallbeispiel: Ein Bezirksamt bereitet einen Bebauungsplan vor. Die Öffentlichkeit ist noch nicht beteiligt worden. Darf der Entwurf
Vermerk zur Reichweite der Einsichtnahme in Bebauungspläne nach HmbTG Fallbeispiel: Ein Bezirksamt bereitet einen Bebauungsplan vor. Die Öffentlichkeit ist noch nicht beteiligt worden. Darf der Entwurf
Übersicht der Module des Studienfaches: Sozialwissenschaften (A-Fach: 80 AP/50 SWS) Anlage 2
 Übersicht der Module des tudienfaches: ozialwissenschaften (A-Fach: 80 AP/50 W) Anlage 2 W-1: (19010) Einführung in die ozialwissenschaften W-1.1 (19011): Einführung I W-1.2 (19012) Einführung II (kann
Übersicht der Module des tudienfaches: ozialwissenschaften (A-Fach: 80 AP/50 W) Anlage 2 W-1: (19010) Einführung in die ozialwissenschaften W-1.1 (19011): Einführung I W-1.2 (19012) Einführung II (kann
Der fließende Übergang vom Autoritären Denken zur Politischen Theologie: Das Beispiel Eric Voegelins
 Der fließende Übergang vom Autoritären Denken zur Politischen Theologie: Das Beispiel Eric Voegelins Übersicht 1. Einleitung 2. Voegelins prägende Jahre in Wien 3. Voegelins politischer Standpunkt 4. Der
Der fließende Übergang vom Autoritären Denken zur Politischen Theologie: Das Beispiel Eric Voegelins Übersicht 1. Einleitung 2. Voegelins prägende Jahre in Wien 3. Voegelins politischer Standpunkt 4. Der
Numerus clausus. Einleitung: Zugangsbeschränkungen. Frage 1: Artikel 12 EGV (1/16) Übungen im Europarecht Fall 10 vom 8. Mai 2008.
 Numerus clausus Fall 10 vom 8. Mai 2008 Frühlingssemester 2008 Prof. Christine Kaufmann (Vertretung: Florian Utz) Einleitung: Zugangsbeschränkungen 2 Frage 1: Artikel 12 EGV (1/16) Frage Verstösst Österreich
Numerus clausus Fall 10 vom 8. Mai 2008 Frühlingssemester 2008 Prof. Christine Kaufmann (Vertretung: Florian Utz) Einleitung: Zugangsbeschränkungen 2 Frage 1: Artikel 12 EGV (1/16) Frage Verstösst Österreich
Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages
 Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 Wilhelmstraße 60, Zi. 434 11011 Berlin Tel: (030) 227-73524 Fax: (030) 227-76186 Email: norbert.geis@bundestag.de 1 Rede zur 1. Lesung
Norbert Geis Mitglied des Deutschen Bundestages Platz der Republik 1 Wilhelmstraße 60, Zi. 434 11011 Berlin Tel: (030) 227-73524 Fax: (030) 227-76186 Email: norbert.geis@bundestag.de 1 Rede zur 1. Lesung
Grundannahmen von Systemtheorien
 Grundannahmen von Systemtheorien Die Wechselbeziehungen zwischen den Elementen sind nicht zufällig, sondern sind in einer bestimmten Weise geordnet. Die Ordnung der Beziehungen = Struktur Systeme tendieren
Grundannahmen von Systemtheorien Die Wechselbeziehungen zwischen den Elementen sind nicht zufällig, sondern sind in einer bestimmten Weise geordnet. Die Ordnung der Beziehungen = Struktur Systeme tendieren
Pierre-Joseph Proudhon. Theorie der Steuer. Herausgegeben und übersetzt von. Lutz Roemheld. mit einer Einführung von. Dirk Löhr A 263224
 Pierre-Joseph Proudhon Theorie der Steuer Herausgegeben und übersetzt von Lutz Roemheld mit einer Einführung von Dirk Löhr A 263224 Metropolis-Verlag Marburg 2012 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 13 Editorische
Pierre-Joseph Proudhon Theorie der Steuer Herausgegeben und übersetzt von Lutz Roemheld mit einer Einführung von Dirk Löhr A 263224 Metropolis-Verlag Marburg 2012 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 13 Editorische
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters
 Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 3. Herrschaft (Bevc, S. 53ff.) Definition und gesellschaftliche Bedeutung: Herrschaft ist grundlegend für jede
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 3. Herrschaft (Bevc, S. 53ff.) Definition und gesellschaftliche Bedeutung: Herrschaft ist grundlegend für jede
Was ist wissenschaftlich?
 1 Niklas Lenhard-Schramm (Westfälische Wilhelms Universität Münster) Was ist wissenschaftlich? Was ist wissenschaftlich? Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist lohnenswert für jeden, der wissenschaftliches
1 Niklas Lenhard-Schramm (Westfälische Wilhelms Universität Münster) Was ist wissenschaftlich? Was ist wissenschaftlich? Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist lohnenswert für jeden, der wissenschaftliches
Systemisch Denken Systemische Supervision
 Jürg Hartmann 8500 Frauenfeld, im Jahr 2010 Beratung, Coaching & Supervision Wellenbergstr. 39 Tel. 052 720 10 42 praxis.hartmann@bluewin.ch www.hartmann-coaching.ch Systemisch Denken Systemische Supervision
Jürg Hartmann 8500 Frauenfeld, im Jahr 2010 Beratung, Coaching & Supervision Wellenbergstr. 39 Tel. 052 720 10 42 praxis.hartmann@bluewin.ch www.hartmann-coaching.ch Systemisch Denken Systemische Supervision
Einführung in die. 1. Vorlesung
 Einführung in die Rechtswissenschaft 1. Vorlesung I. Das Studium im allgemeinen der Rechtswissenschaft 1. Wenigstens zwei mögliche Ziele Berufsqualifikation ErwerbgeistigerReife, Bildung, Humboldtsches
Einführung in die Rechtswissenschaft 1. Vorlesung I. Das Studium im allgemeinen der Rechtswissenschaft 1. Wenigstens zwei mögliche Ziele Berufsqualifikation ErwerbgeistigerReife, Bildung, Humboldtsches
Einführung in die praktische Philosophie
 Einführung in die praktische Philosophie Vorlesung 1. Was ist praktische Philosophie? Claus Beisbart TU Dortmund Sommersemester 2011 Ziel der heutigen Vorlesung In der ersten Vorlesung möchte ich Sie an
Einführung in die praktische Philosophie Vorlesung 1. Was ist praktische Philosophie? Claus Beisbart TU Dortmund Sommersemester 2011 Ziel der heutigen Vorlesung In der ersten Vorlesung möchte ich Sie an
Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati. René Descartes Meditationen Erste Untersuchung
 Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati René Descartes Meditationen Erste Untersuchung INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 3 1.1 PROBLEMSTELLUNG 3 1.2 ZIELSETZUNG
Seminar Klassische Texte der Neuzeit und der Gegenwart Prof. Dr. Gianfranco Soldati René Descartes Meditationen Erste Untersuchung INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG 3 1.1 PROBLEMSTELLUNG 3 1.2 ZIELSETZUNG
Die Definition von New Life Performance
 Die Definition von New Life Performance Die Definition von New Life Performance DIE DEFINITION VON NEW LIFE PERFORMANCE Für New Life Performance gibt es keine umfassende Darstellung in einem eindeutigen
Die Definition von New Life Performance Die Definition von New Life Performance DIE DEFINITION VON NEW LIFE PERFORMANCE Für New Life Performance gibt es keine umfassende Darstellung in einem eindeutigen
Prof. Dr. Maria-Anna Bäuml-Roßnagl Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Psychologie und Pädagogik
 Prof. Dr. Maria-Anna Bäuml-Roßnagl Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Psychologie und Pädagogik UNIVERSITÄT REGENSBURG - Prof. Dr. Barbara Weber Lehrstuhl für Werteentwicklung und Zivilgesellschaftliches
Prof. Dr. Maria-Anna Bäuml-Roßnagl Ludwig-Maximilians-Universität München Fakultät für Psychologie und Pädagogik UNIVERSITÄT REGENSBURG - Prof. Dr. Barbara Weber Lehrstuhl für Werteentwicklung und Zivilgesellschaftliches
Theorie qualitativen Denkens
 Theorie qualitativen Denkens Vorbetrachtungen - vor den 70er Jahren standen vor allem quantitative Forschungen im Mittelpunkt - qualitative Wende in den 70er Jahren in der BRD - seit dem setzt sich qualitatives
Theorie qualitativen Denkens Vorbetrachtungen - vor den 70er Jahren standen vor allem quantitative Forschungen im Mittelpunkt - qualitative Wende in den 70er Jahren in der BRD - seit dem setzt sich qualitatives
> Menschenrechte Elternrechte
 Gutmann Menschenrechte Elternrechte Kinderrechte : DAKJ Symposium Kinderrechte stärken! Berlin 8. Oktober 2014 > Menschenrechte Elternrechte Kinderrechte: Prof. Dr. Thomas Gutmann Lehrstuhl für Bürgerliches
Gutmann Menschenrechte Elternrechte Kinderrechte : DAKJ Symposium Kinderrechte stärken! Berlin 8. Oktober 2014 > Menschenrechte Elternrechte Kinderrechte: Prof. Dr. Thomas Gutmann Lehrstuhl für Bürgerliches
Grenzen der Medizin? Referat von Dr. theol. Luzius Müller. Ein heikles Unterfangen... ref. pfarramt beider basel an der universität
 Grenzen der Medizin? Referat von Dr. theol. Luzius Müller Ein heikles Unterfangen... Ethik als Wahrnehmungswissenschaft und Vermittlungswissenschaft Angewandte Ethik fasst die bestehende gute Praxis in
Grenzen der Medizin? Referat von Dr. theol. Luzius Müller Ein heikles Unterfangen... Ethik als Wahrnehmungswissenschaft und Vermittlungswissenschaft Angewandte Ethik fasst die bestehende gute Praxis in
6. Sitzung. Methoden der Politikwissenschaft: Metatheorien, Werturteilsproblematik und politikwissenschaftliche Methoden
 6. Sitzung Methoden der Politikwissenschaft: Metatheorien, Werturteilsproblematik und politikwissenschaftliche Methoden Inhalt der heutigen Veranstaltung 1. Metatheorien/Paradigmen 2. Die so genannte Drei-Schulen
6. Sitzung Methoden der Politikwissenschaft: Metatheorien, Werturteilsproblematik und politikwissenschaftliche Methoden Inhalt der heutigen Veranstaltung 1. Metatheorien/Paradigmen 2. Die so genannte Drei-Schulen
I. Gemäß 50 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.
 29.01.2015 Gericht Landesverwaltungsgericht Wien Entscheidungsdatum 29.01.2015 Geschäftszahl VGW-001/048/772/2015 Text IM NAMEN DER REPUBLIK Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seinen Richter Dr. Frank
29.01.2015 Gericht Landesverwaltungsgericht Wien Entscheidungsdatum 29.01.2015 Geschäftszahl VGW-001/048/772/2015 Text IM NAMEN DER REPUBLIK Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seinen Richter Dr. Frank
Moralische Urteilsfähigkeit fördern
 Studienseminar Koblenz Wahlmodul 173 Moralische Urteilsfähigkeit fördern Das Konzept von Lawrence Kohlberg Moralerziehung Dort, wo das Wohlergehen der Menschen vom Verhalten anderer Menschen abhängig ist,
Studienseminar Koblenz Wahlmodul 173 Moralische Urteilsfähigkeit fördern Das Konzept von Lawrence Kohlberg Moralerziehung Dort, wo das Wohlergehen der Menschen vom Verhalten anderer Menschen abhängig ist,
Was darf die gute Psychiatrie?
 Was darf die gute Psychiatrie? Paul Hoff Fortbildungszyklus 2016 «Die optimierte Gesellschaft und die gute Psychiatrie» Psychiatrische Klinik Zugersee 21. Januar 2016 Agenda Fakten Interpersonalität Werte
Was darf die gute Psychiatrie? Paul Hoff Fortbildungszyklus 2016 «Die optimierte Gesellschaft und die gute Psychiatrie» Psychiatrische Klinik Zugersee 21. Januar 2016 Agenda Fakten Interpersonalität Werte
U R T E I L S A U S Z U G
 ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 3781 Urteil Nr. 125/2006 vom 28. Juli 2006 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 42 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 26. März 1999
ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 3781 Urteil Nr. 125/2006 vom 28. Juli 2006 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 42 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 26. März 1999
GRUNDSÄTZE UND RICHTLINIEN DER BERUFSAUSÜBUNG
 Standesregeln ASP-Unternehmensberatung 2007 - 2 - Berufsgrundsätze und Standesregeln Unternehmensberatung AUER, SPRINGER & PARTNER ( A S P ) PRÄAMBEL Das Team der Unternehmensberatung AUER, SPRINGER &
Standesregeln ASP-Unternehmensberatung 2007 - 2 - Berufsgrundsätze und Standesregeln Unternehmensberatung AUER, SPRINGER & PARTNER ( A S P ) PRÄAMBEL Das Team der Unternehmensberatung AUER, SPRINGER &
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten
 Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters
 Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 17. Außenpolitik/Internationale Politik (Nohlen/Grotz, S. 26ff.; 235ff.; Brechtken 2003) Die Trennung von Außen-
Einführung in die Politikgeschichte des industriellen Zeitalters A. Politische Grundbegriffe 17. Außenpolitik/Internationale Politik (Nohlen/Grotz, S. 26ff.; 235ff.; Brechtken 2003) Die Trennung von Außen-
Ethik, Ökonomik und Gesellschaft mit neuen Begriffen erklärt
 Querdenker Ethik, Ökonomik und Gesellschaft mit neuen Begriffen erklärt Zehnte Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung im Sommersemester 2011 Prof. Klaus Bastian {bastian@imn.htwk-leipzig.de} 8. 6. 2011
Querdenker Ethik, Ökonomik und Gesellschaft mit neuen Begriffen erklärt Zehnte Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung im Sommersemester 2011 Prof. Klaus Bastian {bastian@imn.htwk-leipzig.de} 8. 6. 2011
Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis
 Detlef Staude Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis R hetorik hat sich in der Antike als Gegenpol zur Philosophie entwickelt oder wurde als
Detlef Staude Rhetorik als philosophisch-humanistische Tradition und ihre Bedeutung in der Philosophischen Praxis R hetorik hat sich in der Antike als Gegenpol zur Philosophie entwickelt oder wurde als
dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen stehen:
 Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Predigt zu Joh 2, 13-25 und zur Predigtreihe Gott und Gold wieviel ist genug? Liebe Gemeinde, dieses Buch hier ist für mich das wertvollste aller theologischen Bücher, die bei mir zuhause in meinen Bücherregalen
Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben
 Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben 1. Einleitendes Kapitel 1.1.1 Einen Text einleiten und zum Thema hinführen In der vorliegenden Arbeit geht es um... Schwerpunkt dieser Arbeit ist...
Formulierungshilfen für das wissenschaftliche Schreiben 1. Einleitendes Kapitel 1.1.1 Einen Text einleiten und zum Thema hinführen In der vorliegenden Arbeit geht es um... Schwerpunkt dieser Arbeit ist...
Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen. Präambel
 Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen Präambel Evangelische Schulen verstehen sich als öffentliche Schulen, indem sie sich an der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung für Kinder und Jugendliche
Qualitätsanalyse NRW an Evangelischen Schulen Präambel Evangelische Schulen verstehen sich als öffentliche Schulen, indem sie sich an der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung für Kinder und Jugendliche
Um zu einer sinnerfüllten Existenz zu gelangen bedarf es der Erfüllung von drei vorangehenden Bedingungen (Grundmotivationen 1 )
 In der Existenzanalyse und Logotherapie geht es um ein Ganzwerden des Menschen um zu einer erfüllten Existenz zu gelangen. Die Existenzanalyse hat das Ziel, den Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung
In der Existenzanalyse und Logotherapie geht es um ein Ganzwerden des Menschen um zu einer erfüllten Existenz zu gelangen. Die Existenzanalyse hat das Ziel, den Menschen zu befähigen, mit innerer Zustimmung
Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien -
 Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien - Verfasser Markus Eidam Markus Eidam & Partner Interkulturelle Trainings, Organisationsentwicklung, Weiterbildung Reichenhainer Straße 2 09111 Chemnitz
Interkulturelle Kompetenz - Beruflich in Tschechien - Verfasser Markus Eidam Markus Eidam & Partner Interkulturelle Trainings, Organisationsentwicklung, Weiterbildung Reichenhainer Straße 2 09111 Chemnitz
Frieder Nake: Information und Daten
 Frieder Nake: Information und Daten Mit Grundlagen der Zeichentheorie nach Morris Seminar 31120: Information Philosophische und informationswissenschaftliche Perspektiven, SS 2004 Frieder Nake: Information
Frieder Nake: Information und Daten Mit Grundlagen der Zeichentheorie nach Morris Seminar 31120: Information Philosophische und informationswissenschaftliche Perspektiven, SS 2004 Frieder Nake: Information
U R T E I L S A U S Z U G
 ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 4051 Urteil Nr. 116/2007 vom 19. September 2007 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 462 des Strafgesetzbuches, gestellt von
ÜBERSETZUNG Geschäftsverzeichnisnr. 4051 Urteil Nr. 116/2007 vom 19. September 2007 U R T E I L S A U S Z U G In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 462 des Strafgesetzbuches, gestellt von
Führungsstile. Verfasser: Bernd Fischl (Frau Dr. Schroll Decker, TU München)
 Führungsstile Verfasser: Bernd Fischl (Frau Dr. Schroll Decker, TU München) Datum. 28.05.2000 Gliederung: 1.) Definition Führungsstil 2.) Unterschiedliche Führungstypologien a) Die klassische Dreiteilung
Führungsstile Verfasser: Bernd Fischl (Frau Dr. Schroll Decker, TU München) Datum. 28.05.2000 Gliederung: 1.) Definition Führungsstil 2.) Unterschiedliche Führungstypologien a) Die klassische Dreiteilung
Werte in den Wissenschaften John Dupré
 12. Juni 2014 Werte in den Wissenschaften John Dupré Alexander Christian M.A. Mag. Christian Feldbacher John Dupré: Tatsachen und Werte Übersetzung von Fact and Value, in: Kincaid et al. (2007), S. 28-41.
12. Juni 2014 Werte in den Wissenschaften John Dupré Alexander Christian M.A. Mag. Christian Feldbacher John Dupré: Tatsachen und Werte Übersetzung von Fact and Value, in: Kincaid et al. (2007), S. 28-41.
Datenschutz und Medienfreiheit
 Datenschutz und Medienfreiheit Vortrag auf der Tagung Von Jägern, Sammlern und Piraten Datenschutz, Neue Medien und Technologien in der Europäischen Union Haus der Europäischen Union, 27./28.9.2012 ao.
Datenschutz und Medienfreiheit Vortrag auf der Tagung Von Jägern, Sammlern und Piraten Datenschutz, Neue Medien und Technologien in der Europäischen Union Haus der Europäischen Union, 27./28.9.2012 ao.
Humanistischer Generalismus
 Humanistischer Generalismus Grundlegende philosophische Forderungen Beginn: Sommer 2005 Letzte Bearbeitung: Sommer 2008 Autor: Franz Plochberger Freier Wissenschaftler Email: plbg@bluewin.ch Home: http://www.plbg.ch
Humanistischer Generalismus Grundlegende philosophische Forderungen Beginn: Sommer 2005 Letzte Bearbeitung: Sommer 2008 Autor: Franz Plochberger Freier Wissenschaftler Email: plbg@bluewin.ch Home: http://www.plbg.ch
Einführung in die praktische Philosophie I
 Einführung in die praktische Philosophie I Vorlesung 1. Was tun? Die Grundfrage der Praktischen Philosophie Claus Beisbart Wintersemester 2011/12 Ziel der heutigen Vorlesung In der ersten Vorlesung möchte
Einführung in die praktische Philosophie I Vorlesung 1. Was tun? Die Grundfrage der Praktischen Philosophie Claus Beisbart Wintersemester 2011/12 Ziel der heutigen Vorlesung In der ersten Vorlesung möchte
Die klassische Beschäftigungstheorie und -politik Deutsche Sparkassenzeitung, Nr. 65, 09.09.1977, Seite 2
 Deutsche Sparkassenzeitung, Nr. 65, 09.09.1977, Seite 2 1 Die Beseitigung der nach allgemeiner Ansicht zu hohen Arbeitslosigkeit ist heute das wirtschaftspolitische Problem Nummer eins. Um dieses Problem
Deutsche Sparkassenzeitung, Nr. 65, 09.09.1977, Seite 2 1 Die Beseitigung der nach allgemeiner Ansicht zu hohen Arbeitslosigkeit ist heute das wirtschaftspolitische Problem Nummer eins. Um dieses Problem
AG Weiterentwicklung des International Office, Professionalisierung von Vorgängen. Unter-AG II Prozesse und Abläufe. DAAD Leitertagung 2015, Bonn
 AG Weiterentwicklung des International Office, Professionalisierung von Vorgängen Unter-AG II Prozesse und Abläufe DAAD Leitertagung 2015, Bonn 1 Georg-August-Universität Göttingen 20.11.2015 2 Georg-August-Universität
AG Weiterentwicklung des International Office, Professionalisierung von Vorgängen Unter-AG II Prozesse und Abläufe DAAD Leitertagung 2015, Bonn 1 Georg-August-Universität Göttingen 20.11.2015 2 Georg-August-Universität
Sozialisation und Identität
 Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Übung: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic, M.A. Sebastian Schmidt, Marion Röder, Hanna Heß Sozialisation und Identität Inhaltsverzeichnis Biographie
Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Übung: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic, M.A. Sebastian Schmidt, Marion Röder, Hanna Heß Sozialisation und Identität Inhaltsverzeichnis Biographie
Ein bloß mündlich vereinbarter Beitritt zu einer fremden Schuld ist so rechtlich nicht (mehr) durchsetzbar.
 Der Oberste Gerichtshof ist von seiner bisherigen Rechtsansicht abgegangen. Mit Urteil vom 20. April 2010, hat er nunmehr entschieden, dass nicht nur eine Bürgschaft, sondern auch ein Schuldbeitritt nur
Der Oberste Gerichtshof ist von seiner bisherigen Rechtsansicht abgegangen. Mit Urteil vom 20. April 2010, hat er nunmehr entschieden, dass nicht nur eine Bürgschaft, sondern auch ein Schuldbeitritt nur
Die Grenzen des Konflikts im Neopluralismus
 die Gesellschaft IPW Selected Student Papers Essay testfight / photocase.de IPW Selected Student Papers 56, Oktober 2015 Hauke Brunkhorst, Heinz Bude und Helmut König im Gespräch Matthias Dorgeist Die
die Gesellschaft IPW Selected Student Papers Essay testfight / photocase.de IPW Selected Student Papers 56, Oktober 2015 Hauke Brunkhorst, Heinz Bude und Helmut König im Gespräch Matthias Dorgeist Die
Gefördert durch: dynaklim-kompakt
 Gefördert durch: dynaklim-kompakt Risiko & Co. - Begriffe und Abgrenzungen 1 Problemstellung Ein Basisproblem, das immer auftritt, wenn es um Risiko geht, ist die Existenz unterschiedlicher Risikodefinitionen
Gefördert durch: dynaklim-kompakt Risiko & Co. - Begriffe und Abgrenzungen 1 Problemstellung Ein Basisproblem, das immer auftritt, wenn es um Risiko geht, ist die Existenz unterschiedlicher Risikodefinitionen
Philo IK VO Methoden und Ideen. Zeckenimpfung. Erfahrungswissenschaft. Unwirkliches aus Wirklichem. 2009-10-15 19:00h, Gotz I
 Philo IK VO Methoden und Ideen 2009-10-15 19:00h, Gotz I Anfang: Warnung - Einführung nicht wie eine Führung durch ein Haus vorstellen (z.b. Überblick zu Anordnung und Fkt. der Zimmer) Philosophie vorstellen
Philo IK VO Methoden und Ideen 2009-10-15 19:00h, Gotz I Anfang: Warnung - Einführung nicht wie eine Führung durch ein Haus vorstellen (z.b. Überblick zu Anordnung und Fkt. der Zimmer) Philosophie vorstellen
EUROPARAT MINISTERKOMITEE
 EUROPARAT MINISTERKOMITEE Nichtamtliche Übersetzung Empfehlung Rec (2000) 21 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die freie Berufsausübung der Anwältinnen und Anwälte (angenommen vom Ministerkomitee
EUROPARAT MINISTERKOMITEE Nichtamtliche Übersetzung Empfehlung Rec (2000) 21 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die freie Berufsausübung der Anwältinnen und Anwälte (angenommen vom Ministerkomitee
Leseprobe Ohne Gott geht's besser
 Leseprobe Ohne Gott geht's besser Atheismus und Humanismus sind die bessere Alternative Wissen und Glauben 2 1. Wissen und Glauben... 1.2 An was die Leute glauben Viele Leute glauben an einen oder mehrere
Leseprobe Ohne Gott geht's besser Atheismus und Humanismus sind die bessere Alternative Wissen und Glauben 2 1. Wissen und Glauben... 1.2 An was die Leute glauben Viele Leute glauben an einen oder mehrere
Einleitung 9. Einleitung
 Einleitung 9 Einleitung Lesen und schreiben zu lernen ist für manche Schülerinnen und Schüler ein Kinderspiel, für anderewiederum eine jahrelange»quälerei«, insbesonderewas die Rechtschreibung angeht.
Einleitung 9 Einleitung Lesen und schreiben zu lernen ist für manche Schülerinnen und Schüler ein Kinderspiel, für anderewiederum eine jahrelange»quälerei«, insbesonderewas die Rechtschreibung angeht.
Inhalt. Vorwort... 9. 1 Einführung: Begriffe, Geschichte und Methoden... 11. 2 Kognitive Determinanten des Lernerfolgs im Unterricht...
 5 Inhalt Vorwort..................................................... 9 1 Einführung: Begriffe, Geschichte und Methoden... 11 1.1 Gegenstand und Geschichte... 12 1.1.1 Psychologie... 12 1.1.2 Pädagogik
5 Inhalt Vorwort..................................................... 9 1 Einführung: Begriffe, Geschichte und Methoden... 11 1.1 Gegenstand und Geschichte... 12 1.1.1 Psychologie... 12 1.1.2 Pädagogik
Leitfaden für Masterarbeiten im Master Management & Business Development für den Bereich Kommunikation und PR
 Leitfaden für Masterarbeiten im Master Management & Business Development für den Bereich Kommunikation und PR 1. Wesen und Ziel der Masterarbeit Im Master Management & Business Development erlangen die
Leitfaden für Masterarbeiten im Master Management & Business Development für den Bereich Kommunikation und PR 1. Wesen und Ziel der Masterarbeit Im Master Management & Business Development erlangen die
Themenbereich 1: Das Individuum im Erziehungsprozess I
 Inhaltsfeld: IF 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse Das pädagogische Verhältnis Anthropologische Grundannahmen Erziehung und Bildung im Verhältnis zu Enkulturation Erziehungsstile Erziehungsziele Bildung
Inhaltsfeld: IF 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse Das pädagogische Verhältnis Anthropologische Grundannahmen Erziehung und Bildung im Verhältnis zu Enkulturation Erziehungsstile Erziehungsziele Bildung
Typologie politischer Systeme
 Typologie politischer Systeme (nach W. Merkel) Wege zur Demokratie 1sk0 Klassifikationskriterien Herrschaftslegitimation Herrschaftszugang Herrschaftsmonopol Herrschaftsstruktur Herrschaftsanspruch Herrschaftsweise
Typologie politischer Systeme (nach W. Merkel) Wege zur Demokratie 1sk0 Klassifikationskriterien Herrschaftslegitimation Herrschaftszugang Herrschaftsmonopol Herrschaftsstruktur Herrschaftsanspruch Herrschaftsweise
