Konzept der Verhaltenssüchte und Grenzen des Suchtbegriffs
|
|
|
- Dominik Seidel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Nervenarzt 2013 DOI /s z Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 K. Mann 1 M. Fauth-Bühler 1 N. Seiferth 2 A. Heinz 2 Expertengruppe Verhaltenssüchte der DGPPN 1 Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, Mannheim 2 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte, Berlin 3 Expertengruppe Verhaltenssüchte der DGPPN, - Konzept der Verhaltenssüchte und Grenzen des Suchtbegriffs Traditionell wird der Begriff Sucht mit der Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen wie Alkohol und anderen Drogen in Verbindung gebracht. Erst seit kurzem wird er auf eine Reihe problematischer Verhaltensweisen wie z. B. Glücksspielen, Internetgebrauch, exzessives Kaufen und sexuelle Aktivitäten angewendet. In diesem Artikel untersuchen wir, ob es sich hier um Süchte handelt und wo die Grenzen des Suchtbegriffes liegen. Das Suchtkonzept Das englische/französische Wort addiction kommt vom lateinischen Verb addicere, was ursprünglich Versklavung bedeutete. Die Unfreiheit des Willens als zentrales Merkmal der Sucht spiegelt sich auch in den diagnostischen Kriterien der ICD-10 wider: Als Kernelement wird der Kontrollverlust angesehen. Der Betroffene hat Schwierigkeiten, die Einnahme zu kontrollieren bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Außerdem kommt es zu fortschreitender Vernachlässigung anderer Verpflichtungen, Aktivitäten, Vergnügen oder Interessen, d. h. das Verlangen nach der Substanz wird zum Lebensmittelpunkt. Der Gebrauch der Substanz(en) wird wider besseres Wissen und trotz eintretender schädlicher Folgen fortgesetzt. Des Weiteren berichten die Betroffenen über ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, die Substanz zu konsumieren (sog. craving ). Entzug und Toleranzentwicklung sind Teile des körperlichen Abhängigkeitssyndroms. Als Toleranz bezeichnet man das Phänomen, dass der Betroffene immer größerer Mengen der Substanz benötigt, damit die gewünschte Wirkung eintritt bzw. dass bei konstanter Menge die gewünschten Effekte ausbleiben [40], da der Körper neuroadaptiven Veränderungen unterliegt, die der Substanzwirkung entgegengesetzt sind. Wird die Substanz abgesetzt, kommt es zu Entzugssymptomen, die als Ausdruck der neuroadaptiven Prozesse des zentralen Nervensystems in Folge des Substanzkonsums verstanden werden können. Konzept und Definition der Verhaltenssüchte Erst in jüngster Vergangenheit wurde eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, die exzessiv betrieben zum Problem werden können, wie Glücksspielen, Essen, Sex, das Schauen von pornographischem Filmmaterial, PC- und Internetgebrauch, das Spielen von Videospielen und Einkaufen [33] als Verhaltenssüchte, diskutiert. Verhaltenssucht, auch als nichtsubstanzassoziierte Sucht [10] bezeichnet, bezieht sich auf die Tatsache, dass sich zunächst normale, angenehme Tätigkeiten in unangepasste, immer wiederkehrende Verhaltensweisen verwandeln. Diese werden aufgrund eines quasi unwiderstehlichen Verlangens, Anreizes oder Impulses, den das Individuum kaum kontrollieren kann, häufig ausgeführt, obwohl das Verhalten in dieser Intensität der Person und/oder anderen Schaden zufügt [9]. Die Verhaltenssucht stellt eine chronische Erkrankung dar, bei der ein Risiko besteht, auch nach langen Abstinenzzeiträumen rückfällig zu werden. Bei Verhaltenssüchten werden analog zur Substanzabhängigkeit auch Phänomene wie Entzugssymptome und Toleranzeffekte beobachtet [9]. Betroffene Individuen zeigen eine dysphorische Stimmung, wenn sie an der Ausübung des exzessiven Verhaltens gehindert werden, was als Entzugssymptom verstanden wird. Bei konstanter Zahl der Wiederholungen der entsprechenden Handlungen nehmen die begleitenden positiven Gefühlszustände ab oder aber die Intensität der Verhaltensweisen muss zunehmen, um ähnlich positive Effekte zu erzielen (d. h. Toleranzentwicklung,. Tab. 1). Klassifikation der Verhaltenssüchte In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten 10. Revision [39] und dem Diagnostischen und Statistischen Manual für Psychische Störungen 4. Revision [1] ist derzeit nur das pathologische Glücksspiel enthalten, welches aber nicht im Suchtkapitel, sondern als Störung der K. Mann und M. Fauth-Bühler haben zu gleichen Teilen zu der Arbeit beigetragen. 1
2 Tab. 1 Gegenüberstellung diagnostischer Merkmale für pathologisches Spielen und Substanzabhängigkeit. (Mod. nach [37]) Pathologisches Spielen Drang zu Spielen/Eingenommensein Toleranzentwicklung (z. B. höhere Einsätze) Wiederholte, erfolglose Versuche, das Spiel zu kontrollieren, einzuschränken oder aufzugeben Entzugssymptome (z. B. Unruhe, Gereiztheit) Spielen als Flucht vor Problemen oder negativen Stimmungen, Jagd nach Verlusten vom Vortag Gefährdung sozialer Beziehungen/des Arbeitsplatzes, Lügen, illegale Handlungen, Finanzierung des Spielens durch Andere, Fortführung des Spielens nach Geldverlusten Substanzabhängigkeit Verlangen, die Substanz zu konsumieren Toleranzentwicklung (vgl. Dosissteigerung) Kontrollverlust über Beginn, Ende und Menge des Konsums/ Abstinenzversuche Körperliche Entzugssymptome Vernachlässigung anderer Aktivitäten oder Interessen (vgl. zunehmend konsumassoziierte Zeiten) Fortgesetzter Konsum wider besseren Wissens und trotz psychischer oder körperlicher Folgeschäden Impulskontrolle eingeordnet wird. In der 5. Auflage des DSM werden die derzeitigen Kategorien Substanzmissbrauch und Abhängigkeit durch eine neue Kategorie Sucht und verwandte Störungen ( addiction and related disorders ) ersetzt, welcher dann auch Verhaltenssüchte mit pathologischem Glücksspiel als einziger Verhaltenssucht zugeordnet werden. Internetabhängigkeit wird im Anhang aufgenommen, da die wenigen Studien noch keine klaren Zuordnungen erlauben. Dagegen wird die WHO in der ICD-11 nach Vorschlag der zuständigen Arbeitsgruppe wahrscheinlich neben pathologischem Glücksspiel eine Sammelkategorie Weitere Verhaltenssüchte einführen. Unter dieser Kategorie werden exzessiv betriebene Verhaltensweisen subsummiert, die die zentralen Suchtkriterien erfüllen (starkes Verlangen, Kontrollverlust, Fortführung des Verhaltens trotz negativer Konsequenzen etc.) und klinischer Aufmerksamkeit bedürfen. Hier soll nach dem derzeitigen Stand der Diskussion Internetsucht eingeordnet werden können. Nichtsubstanzassoziierte Sucht, Impulskontrollstörung oder Zwangsstörung? Prinzipiell stellt sich die Frage, ob Verhaltenssüchte mehr Ähnlichkeiten mit Substanzabhängigkeit aufweisen oder ob sie den Impulskontrollstörungen oder auch den Zwangserkrankungen zuzuordnen sind [9, 12, 13, 36]. Diese sog. Sucht-Neurose-Debatte ist sowohl für die ätiologische als auch die therapeutische Perspektive auf Verhaltenssüchte von Interesse [13, 22].» Die Polarisierung zwischen den verschiedenen Sichtweisen ist in den Hintergrund getreten Die Betrachtung der Verhaltenssüchte als Zwangsstörung stützt sich dabei auf die Analyse und therapeutische Bearbeitung der intrapsychischen wie interpersonellen Funktionalität des Symptomverhaltens [13], wobei der Vermeidung negativer Zustände durch das Verhalten eine tragende Bedeutung zukommt. Klassische Suchtmodelle sahen hingegen vor dem Hintergrund biologischer Aspekte die Erreichung und Erhaltung der Abstinenz als ein wesentliches Therapieprinzip an, was das unerwünschte Verhalten im Sinne eines Konsums beenden, nicht aber die Erkrankung heilen kann. Diese damalige Polarisierung zwischen den verschiedenen Sichtweisen ist aus aktueller wissenschaftlicher Perspektive in den Hintergrund getreten. Die epidemiologische wie neurowissenschaftliche Forschung konnte hier einen wichtigen Beitrag leisten: Überzeugende Übereinstimmungen zwischen substanzgebundenen und nichtsubstanzassoziierten Süchten wurden sowohl hinsichtlich des Krankheitsverlaufs (chronisch rezidivierender Verlauf mit höherer Verbreitung und Prävalenz unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen), der Phänomenologie (positive Verstärkerwirkung der Substanz oder des Verhaltens zumindest in den ersten Stadien der Störung, subjektives Craving, Toleranzentwicklung und Entzug), möglicher Komorbiditäten, des Behandlungsverlaufs als auch im Hinblick auf genetische Veranlagung und neurobiologischen Mechanismen berichtet [9, 11]. Hinsichtlich der gemeinsamen neurobiologischen Grundlagen aller Suchterkrankungen beschäftigt sich die aktuelle Forschung mit der Funktionsweise des dopaminergen, mesokortikolimbischen Belohnungssystems und auch der Rolle der Neurotransmitter Glutamat und Serotonin sowie der endogenen Opioide [28]. Details hierzu finden sich im Artikel von Kiefer et al. in diesem Heft. Bisher verfügbare Daten wurden primär an Glücksspielern und exzessiv das Internet nutzenden Individuen erhoben. Die Evidenz bezüglich anderer Verhaltensweisen, die exzessiv betrieben und problematisch entgleiten können, ist nicht ausreichend, um Schlussfolgerungen hinsichtlich einer möglichen Eingruppierung als Verhaltenssüchte zuzulassen. Aufgrund der Erweiterung moderner Suchtmodelle um den Aspekt der Entstehung und Aufrechterhaltung des Problemverhaltens vor einem lerntheoretischen Hintergrund [32] sowie um die neurobiologischen Mechanismen von gelerntem Konsumverhalten [28] finden sich auch hinsichtlich der Therapieimplikationen immer weniger Diskrepanzen der Suchtperspektive zum Neurosenmodell. So resultiert aus dem beiden Modellen gemeinsamen Verständnis von Verhaltenssüchten als erlerntes Problemverhalten die Notwendigkeit, im therapeutischen Prozess den Aufbau alternativer psychischer und sozialer Ressourcen zu gewährleisten, um den Verzicht auf das Problemverhalten im Sinne eines Umlernprozesses effektiv zu unterstützen [15]. Charakteristisch für die Suchtperspektive auf Verhaltenssüchte ist jedoch der Übergang von Reiz-Reaktions- und Verstärkungsbedingungen (operante und klassische Konditionierung), die das Problemverhalten fördern, hin zu automatisierten und neuro- 2 Der Nervenarzt 2013
3 Zusammenfassung Summary biologisch untermauerten Reaktionsmustern, sodass den tatsächlich erlebten Belohnungen im Verlauf der Krankheitsentwicklung deutlich geringere Bedeutung zukommt. Auch zeigt sich hier, dass eine zunehmende motivationale Fokussierung des zerebralen Belohnungssystems auf die Suchtsubstanz bzw. das exzessive Verhalten, wie es Nesse und Berridge [30] vorschlugen und wie es in neurobiologischen Studien unterstützt werden konnte, im späteren Krankheitsverlauf nicht gleichzusetzen ist mit dem subjektiven Erleben von Belohnung oder positiven Affekten (inklusive der Beendigung negativer Zustände). Andere Perspektiven, die sich um eine Integration der verschiedenen Modelle bemühen, schlagen beispielsweise eine Einteilung von Personen mit Verhaltenssüchten in Untergruppen vor, die je nach individueller Charakteristik eine Zuordnung zu den Süchten, Zwangsstörungen oder einer Mischung beider Aspekte vornimmt [3]. Auch existieren Überlegungen, Verhaltenssüchte auf einem Kontinuum zu verorten, das sich zwischen den Polen Impulsivität und Zwanghaftigkeit aufspannt. Hierzu ist zu berücksichtigen, dass obwohl zwanghafte und impulsive Aspekte auch bei Verhaltenssüchten zu beobachten sind, diese jedoch erheblich zwischen verschiedenen Verhaltenssüchten [9] variieren. Zudem ist auch bei stoffgebundenen Abhängigkeiten eine erhöhte Impulsivität feststellbar [2], was eine geringere Trennschärfe der Konzepte nach sich ziehen kann. Entsprechend sind zunächst weitere Studien notwendig, welche die diskreten Anteile von impulshaftem und zwanghaftem Verhalten bei den verschiedenen substanzgebundenen und nichtsubstanzassoziierten Süchten in umfangreichen und gut charakterisierten Stichproben untersuchen. Pro und Kontra Sucht am Beispiel exzessiver Verhaltensweisen Glücksspielsucht und pathologischer Computer- und Internetgebrauch werden angesichts ihrer Häufigkeit und klinischen Bedeutung in eigenen Artikeln in diesem Heft behandelt (s. Böning et al. und Rehbein et al.). Pathologisches Kaufen ( Kaufsucht ) 1 Exzessives Kaufen ( Kaufsucht ), früher auch unter dem Namen Oniomanie bekannt, wurde bereits vor über 100 Jahren beschrieben [21]. Die Betroffenen klagen über großes Leid, und auch in der Öffentlichkeit gibt es ein immer größeres Bewusstsein, dass Kaufsüchtigen geholfen werden muss. Derzeit ist die Kaufsucht in keinem der offiziellen Diagnosesysteme gelistet und soll auch nicht in die geplante 5. Auflage des DSM und die 11. Auflage des ICD aufgenommen werden. Bei der Diagnosestellung ist das Fehlen einer Zweckgebundenheit beim Kaufen eines der zentralen Kriterien [24]. Die Betroffenen verlieren nach dem Kauf sehr schnell ihr Interesse an den Waren. Nicht selten, etwa in zwei Drittel aller Fälle, horten die Betroffenen die gekauften Güter zwanghaft [27]. Ein weiteres zentrales Merkmal der Kaufsucht ist, dass es weniger um den Besitz und die Nutzung der Ware geht, als vielmehr um das positive Erleben während des Bestellens, Auswählens oder Einkaufens. Somit erfolgt das Kaufen nicht bedarfsgerecht und dient auch nicht der Bereicherung, sondern in erster Linie der Emotionsregulation. O Guinn und Faber [31] beschrieben den sog. zwanghaften Kaufzyklus, der aus folgenden Komponenten besteht: 1. Eine allgemeine Prädisposition zu Angstgefühlen und niedrigem Selbstbewusstsein, die sich kurz vor dem Verlangen einzukaufen verschlimmern; 2. impulsive Einkaufsepisoden, die mit Hochgefühl und Berauschtheit einhergehen; 3. Schuld- und Reuegefühle im Anschluss an die Einkaufsepisode und 4. einen erneuten Impuls einzukaufen, um den Gefühlen von niedrigem Selbstbewusstsein, Angst und Schuld, die sich während der Einkaufsepisoden gesteigert haben, zu entkommen. Die Autoren schlugen folgende Definition für Kaufsucht vor: 1 Dieser Abschnitt lehnt sich an ein Kapitel (Müller et al. [29]) in einem Buch zu Verhaltenssüchten an. Nervenarzt 2013 [jvn]:[afp] [alp] DOI /s z Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 K. Mann M. Fauth-Bühler N. Seiferth A. Heinz Expertengruppe Verhaltenssüchte der DGPPN Konzept der Verhaltenssüchte und Grenzen des Suchtbegriffs Zusammenfassung Die Zahl von Betroffenen mit Verhaltenssüchten nimmt vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich zu. Psychiater und Psychotherapeuten erwarten Hinweise zur diagnostischen Einordnung und zum therapeutischen Vorgehen. Wir diskutieren nosologische Aspekte und empfehlen Glücksspiel und exzessiven Computer- und Internetgebrauch als Verhaltenssüchte zu behandeln. In Einzelfällen kann das Suchtmodell auch bei pathologischem Kaufen, exzessivem Sexualverhalten und Adipositas therapeutisch genutzt werden. Schlüsselwörter Verhaltenssucht Klassifikation Suchtbegriff Sexsucht Kaufsucht The concept of behavioral addiction and limits of the term addiction Summary The numbers of persons with a prevalence for behavioral addiction are rising especially among the young. Psychiatrists and psychotherapists are still awaiting indications for diagnostic classification and treatment approaches. We discuss the nosological aspects and suggest categorizing gambling and excessive computer and internet use as behavioral addictions. In specific cases the addiction model can also be applied for excessive sexual behavior, compulsive buying and obesity. Keywords Behavioral addiction Classification Addiction Excessive sexual behavior Compulsive buying Die Kaufsucht ist gekennzeichnet durch chronisch wiederkehrendes Einkaufen, welches die Hauptreaktion auf negative Ereignisse oder Gefühle darstellt und sehr schwer zu stoppen ist und letztendlich schädliche Konsequenzen für das Individuum hat. Basierend auf einer Repräsentativerhebung scheinen 6% der erwachsenen US- 3
4 Bevölkerung die Kriterien für zwanghaftes Kaufverhalten zu erfüllen, wobei Frauen in dieser Untersuchung nicht häufiger betroffen waren als Männer. Deutsche Bevölkerungsbefragungen haben ergeben, dass die Kaufsuchtgefährdung hier ähnlich hoch eingeschätzt wird [26]. Untersuchungen zu Komorbiditäten von Kaufsucht deuten darauf hin, dass 25 50% der Individuen mit der Diagnose Kaufsucht auch die Kriterien für Depression [9, 24] und 44% die Kriterien für eine Angststörung [25] erfüllen. Des Weiteren weisen 4 35% die Begleitdiagnose Zwangsstörung und 10 45% Substanzabhängigkeit auf [24]. Bislang existiert nur eine Bildgebungsstudie zur Kaufsucht [35]. Hier wurden 23 kaufsüchtige Patientinnen und 26 gesunde Frauen während einer simulierten Kaufentscheidung mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fm- RI) untersucht. Während der Produktpräsentation zeigten kaufsüchtige Frauen eine höhere Aktivierung im Nucleus accumbens als die nichtkaufsüchtigen Kontrollpersonen, wenn sie Waren sahen, die sie gern erwerben wollten, was von den Autoren als stärkeres wanting (Verlangen/Craving) bei den kaufsüchtigen Frauen interpretiert wurde. Kaufsüchtige Probandinnen zeigten zudem eine geringere Aktivierung in der Insularegion, wenn die Preise für die Waren gezeigt wurden, die sie später konsumieren wollten, verglichen mit den Waren, die sie nicht kaufen wollten. Dieses Resultat beurteilten die Autoren als einen Hinweis auf ein geringeres Verlustempfinden für Geld bei den kaufsüchtigen Teilnehmerinnen. Obwohl zwanghaftes Kaufverhalten historisch gesehen als Impulskontrollstörung eingeordnet wurde, argumentieren einige Forscher, dass die Erkrankung zu den Zwangsspektrumsstörungen zu rechnen sei, während andere die Ähnlichkeit zu Substanzabhängigkeit betonen. Croissant und Kollegen [5] konnten zeigen, dass exzessives Einkaufen ähnlich wie Substanzabhängigkeit einen Belohnungskreislauf aktiviert. Ein Argument gegen das Konzept der Kaufsucht ist, dass es sich beim exzessiven Warenkonsum lediglich um schlechte Geldmanagementfertigkeiten handelt, die durch einen Mangel an finanziellem Bewusstsein gepaart mit leichter Beeinflussbarkeit durch Werbung hervorgerufen werden. Schuldenberatung wird häufig als Ausweg angeboten, um das Überziehen des Bankkontos in den Griff zu bekommen. Eine Zuordnung zu den Verhaltenssüchten könne zur Folge haben, dass der Beratungsbedarf über den Umgang mit Geld vernachlässigt wird [8]. Exzessives Sexualverhalten ( Sexsucht ) 2 In den aktuellen Versionen von ICD und DSM sind die Klassifikationsmöglichkeiten für exzessives Sexualverhalten unzureichend. In der ICD-10 kann lediglich die Diagnose gesteigertes sexuelles Verlangen (F52.8) vergeben werden, die allerdings nicht weiter spezifiziert werden kann. Im DSM-IV-TR besteht die Möglichkeit, entsprechende Verhaltensweisen entweder als nicht näher bezeichnete sexuelle Störung (302.90) einzuordnen oder in Anlehnung an das pathologische Glücksspiel als nicht näher bezeichnete Impulskontrollstörung (312.30) zu klassifizieren. Für die kommende 5. Revision des DSM hat die Arbeitsgruppe für die Sexual- und Geschlechtsidentitätsstörungen [16] die Einführung einer Kategorie hypersexuelle Störung vorgeschlagen. Sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in den USA gehen die Schätzungen von Prävalenzraten zwischen 3 und 6% aus [11]. Die Kinsey-Untersuchungen [20] berichteten, dass bei 7,6% der bis 30-jährigen Männer die Anzahl beliebig herbeigeführter Orgasmen pro Woche für mindestens 5 Jahre 7 betrug. Auch eine schwedische Untersuchung [23] gelangte zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich der Raten von exzessivem Sexualverhalten. Von insgesamt 1279 befragten Männern und 1171 Frauen wurden 12,1% der Männer und 7,0% der Frauen als hochgradig hypersexuell eingestuft. Einschränkend bei all diesen Studien ist allerdings anzumerken, dass die Häufigkeit sexueller Aktivität allein nicht ausreicht, um ein Verhalten als pathologisch einzustufen. 2 Dieser Abschnitt lehnt sich an ein Kapitel (Hartmann et al. [14]) in einem Buch zu Verhaltenssüchten an. Bezüglich bestehender Komorbiditäten bei Personen mit exzessiven Sexualverhalten zeichnet sich in der begrenzten Anzahl an Studien ein recht heterogenes Bild ab. In Punktprävalenzstudien wies jeweils ein signifikanter Anteil der Betroffenen gar keine bzw. nur marginale Anzeichen für psychische Auffälligkeiten auf, während ca % deutlichere Symptome psychischer Erkrankungen erkennen ließen, insbesondere affektive und interpersonelle Störungen. Bei Betrachtung der Lebenszeitprävalenz zeigen sich als Hauptkomorbiditäten vor allem affektive Störungen (v. a. Dysthymie), die bei bis zu 60% auftraten, gefolgt von Substanzabhängigkeiten, Angststörungen und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Die Angaben zum Geschlechterverhältnis variieren zwischen den Studien stark. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bisher überwiegend nur Schätzwerte sowie Daten aus Online-Umfragen und unsystematischen Studien vorliegen. Schätzungen gehen von einem Verhältnis von Männern zu Frauen von 3:1 bis 5:1 aus [4]. Der Prozentsatz der Frauen unter den hochgradig Hypersexuellen in der Studie von Långström und Hanson [23] lag bei 37%. In anderen Umfragen und Online-Studien lag der Anteil von Frauen, die von einer Hypersexualität berichteten, zwischen 8 und 20% [18]. Die kritischen Verhaltensmuster von Frauen und Männern scheinen sich deutlich zu unterscheiden. Bei Frauen steht promiskuitives Verhalten und Online-Chats und Kontakte im Vordergrund. Problembereiche bei Männern sind hingegen Pornographie und Masturbation. Tierexperimentelle Studien und Bildgebungsstudien zu sexuellem Verhalten bei gesunden Menschen legen nahe, dass bei exzessivem Sexualverhalten ähnliche strukturelle und funktionelle Veränderungen des mesokortikolimbischen Belohnungssystems zu beobachten sind wie bei der Substanzabhängigkeit und anderen Verhaltenssüchten [2, 38]. Allerdings liegen bislang keine hinreichenden Erkenntnisse zu neurobiologischen Mechanismen bei Menschen mit exzessivem sexuellem Verhalten vor. Eine einzelne Pilotstudie deutet auf strukturelle Veränderungen in frontalen Hirnregionen hin, 4 Der Nervenarzt 2013
5 die gemäß der Autoren auch bei anderen Verhaltenssüchten zu beobachten sind, jedoch sind die Befunde aufgrund der methodischen Einschränkungen hinsichtlich ihrer Spezifität für exzessives Sexualverhalten nicht hinreichend interpretierbar.» Eine Zuordnung zum Erklärungsmodell der Sucht ist weiter umstritten Zusammenfassend sprechen sowohl bei Betrachtung von Symptomatik und Verhaltensebene als auch bei Berücksichtigung der Belege für ein gemeinsames neurobiologisch-pathophysiologisches Substrat etliche Aspekte für eine Zuordnung exzessiven Sexualverhaltens zum Erklärungsmodell der Sucht. Gegen diese Zuordnung wird oft eingewendet, dass Entzugssymptome und Toleranzentwicklung bei exzessivem Sexualverhalten in wirklich vergleichbarer Form nicht hinreichend belegt sind. Darüber hinaus wird die Heterogenität von Erscheinungsformen, Persönlichkeitstypen, ätiopathogenetischen Faktoren und Verlaufsformen exzessiven Sexualverhaltens gegen eine alleinige Einordnung als Sucht ins Feld geführt. Pathologisches Essverhalten ( Esssucht ) 3 Esssucht ist derzeit weder im ICD-10 noch im DSM-IV als Störung anerkannt und es besteht keine Übereinstimmung zwischen Experten, ob sie in zukünftigen Auflagen Eingang in die Diagnosesysteme finden soll. Jedoch soll binge eating disorder in der Kategorie feeding and eating disorders als eigenständige Diagnose in der 5. Auflage des DSM aufgenommen werden. Bei der binge eating disorder handelt es sich um eine Störung des Essverhaltens, bei der im Rahmen von Essanfällen, die vom Gefühl des Kontrollverlusts begleitet sind, große Mengen an Nahrungsmitteln konsumiert werden. Im Unterschied zur Bulimie verbleibt die Nahrung, die wäh- 3 Dieser Abschnitt lehnt sich an ein Kapitel (Kiefer [19]) in einem Buch zu Verhaltenssüchten an. rend einer Essattacke aufgenommen wird, im Körper. Die Betroffenen ergreifen keine gewichtsregulierenden Gegenmaßnahmen wie Erbrechen, Abführmittelkonsum, Hungern oder intensives Sporttreiben [6]. Entsprechend ist die Binge-Eating-Störung häufig mit Übergewichtigkeit oder Adipositas assoziiert. Gesundheitsprobleme, die durch Adipositas verursacht werden, sind volkswirtschaftlich von enormer Bedeutung. Aktuelle Anstrengungen, die Bevölkerung zu motivieren, auf eine gesunde Ernährung zu achten, scheinen jedoch nur von begrenzter Wirksamkeit. In den vergangenen Jahren kumulieren Hinweise aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass neuronale Netzwerke und neuropsychologische Mechanismen des Belohnungslernens, die charakteristisch für Suchterkrankungen sind, auch in die Entstehung und Aufrechterhaltung der Adipositas involviert sind. Hier besteht aktuell jedoch noch weiterer Forschungsbedarf. Grenzen des Suchtbegriffs Was folgt daraus, dass pathologisches Spielen, exzessives Nutzen des Internets oder ruinöses Kaufen als Sucht klassifiziert werden? Einerseits kann ein für die Betroffenen leidvoller Zustand dann als Störungsbild verstanden werden, wenn dessen Therapie durch die Solidargemeinschaft aller Krankenversicherten erstattet wird. Andererseits besteht die Gefahr der Pathologisierung von Verhaltensweisen, die eigentlich im Belieben der einzelnen Individuen stehen sollten. Denn anhand welcher Kriterien werden einzelne, leidenschaftlich verfolgte Verhaltensweisen als Süchte bezeichnet und andere nicht? Macht es Sinn, bei jedem hingebungsvollen Forscher, der Nächte lang arbeitet, von Arbeitssucht zu sprechen? Oder werden als Süchte nur all jene Verhaltensweisen bezeichnet, die für die Betroffenen negativ sind? Aber wer legt fest, was für eine Person zuträglich und was ihr abträglich ist. Die Gesellschaft? Die herrschende Moral? Oder gibt es Kriterien, die einigermaßen objektivierbar sind? Denn Letztere erscheinen nötig, wenn man es nicht in das Belieben des jeweiligen Zeitgeistes stellen will, ob eine Gesellschaft die freiheitlichen Errungenschaften der Moderne im Sinne der Gestaltung des eigenen Privatlebens, der sexuellen Vorlieben, der Verwendung eigener Einkünfte oder der Gestaltung der eigenen Freizeit reglementieren und pathologisieren darf. Bezüglich der stoffgebundenen Suchterkrankungen ist die Frage leichter zu beantworten, was denn als Abhängigkeitserkrankung gelten soll und was nicht. Denn die zentralen Kriterien der Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik erklären sich daraus, dass sich das zentrale Nervensystem des betroffenen Individuums so sehr an die Droge gewöhnt hat, dass ein Leben ohne sie nur um den Preis teilweise lebensbedrohlicher Entzugserscheinungen zu haben ist. Die Schädlichkeit der Drogen wird so unmittelbar für alle Beteiligten deutlich. Neurobiologisch ist mit schweren Entzugserscheinungen meistens eine Toleranzentwicklung gegenüber den sedierenden und damit zentralnervös inhibierenden Wirkungen der Drogen verbunden, sodass es beim plötzlichen Absetzen der Drogen zu einem zentralnervösen Ungleichgewicht und einer erhöhten Erregbarkeit des Gehirns führt, die im Delir akut lebensbedrohlich werden kann. Nichtstoffgebundene Suchterkrankungen wirken aber vor allem auf motivationale Systeme ein, sodass hier die neuroadaptiven Veränderungen und die Entzugssymptome in aller Regel milder verlaufen. Als zentrale Kriterien der Suchterkrankung verbleiben also das starke Verlangen nach der Tätigkeit, die verminderte Kontrolle über das Verhalten und die schädlichen Wirkungen für den Einzelnen, die wiederum kaum unabhängig von der gesellschaftlich vorherrschenden Moral bewertet werden können. In dieser Situation können zwei Überlegungen helfen: Einerseits eine Reflexion des Krankheitsbegriffes und andererseits ein gezielter Rückblick auf frühere Versuche, Suchterkrankungen von Leidenschaften abzugrenzen.» Die Vielfältigkeit des Verhaltens ist ein wesentliches Kennzeichen des Menschen 5
6 Expertengruppe Verhaltenssucht der DGPPN F Adams, Michael, Prof. Dr., Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Department Wirtschaftswissenschaften Institut für Recht der Wirtschaft F Arnaud, Nicolas, Dr., Dipl.-Psych., DZSKJ Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Universität Hamburg F Batra, Anil, Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Universität Tübingen F Berner, Michael, Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg F Bleich, Stefan, Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie & Psychotherapie, Med. Hochschule Hannover F Böning, Jobst, Prof. Dr. med., em., Höchberg F De Zwaan, Martina, Prof. Dr. med., Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universität Hannover F Fauth-Bühler, Mira, Dr. rer. nat., Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, AG Spielsucht F Fiedler, Ingo, Dr., Universität Hamburg, Institute of Law & Economics, Abt. für Pathologisches Glücksspiel F Hartmann, Uwe, Prof. Dr med., Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover F Hayer, Tobias, Dr. med., Institut für Psychologie und Kognitionsforschung, Universität Bremen F Heinz, Andreas, Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité, Berlin F Kiefer, Falk, Prof. Dr. med., Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, Universität Heidelberg F Leménager, Tagrid, Dr. phil., Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, AG Spielsucht F Mann, Karl, Prof. Dr. med., Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, Universität Heidelberg F Meyer, Gerhard, Prof. Dr. med., Institut für Psychologie und Kognitionsforschung, Universität Bremen F Mörsen, Chantal, Dipl.-Psych., AG Spielsucht, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte F Mößle, Thomas, PD Dr., Dipl.-Psych., Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V., Hannover F Müller, Astrid, PD Dr. med, Dr. phil., Klinik für Psychosomatik & Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover F Rehbein, Florian, Dr., Dipl.-Psych., Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V., Hannover F Rumpf, Hans-Jürgen, Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck F Seiferth, Nina, Dr., Dipl.-Psych., AG Emotional Neuroscience, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité - Universitätsmedizin, Campus Mitte F Te Wildt, Bert Theodor, PD Dr. med., Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, LWL-Universitätsklinikum Bochum der Ruhr-Universität Bochum F Thomasius, Rainer, Prof. Dr. med., Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf F Wölfling, Klaus, Dr. phil., Spielsuchtambulanz, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Bezüglich des Krankheitsbegriffes ist es sinnvoll, Leitsymptome wie das Verlangen nach einer Substanz oder eines bestimmten Verhaltensmusters oder die verminderte Kontrolle über dieses Verhalten nur dann als objektivierbare Symptome einer Erkrankung zu verstehen, wenn sie wesentliche Funktionen des betroffenen Organs, in diesem Fall des Gehirns, einschränken. Da menschliches Leben und Verhalten so vielfältig ist und sich in den unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Mustern zeigt, muss jede Definition wesentlicher zentralnervöser Funktionen soweit wie möglich kulturell übergreifend formuliert werden können. Ein entsprechender Ansatz geht davon aus, dass die Vielfältigkeit menschlichen Verhaltens selbst ein wesentliches Kennzeichen des Menschen ist, sodass deren Einschränkung durch das überstarke Verlangen nach einer Tätigkeit und die verminderte Kontrolle über diese Tätigkeit auf Kosten vielfältiger anderer Handlungsweisen als wesentliche Einschränkung und damit als objektives Krankheitszeichen gelten kann [15]. Als Kennzeichen einer Erkrankung sollten solche objektivierbaren Funktionsstörungen aber darüber hinaus nur dann gewertet werden, wenn sie entweder subjektiv mit einem ausgeprägten Leidenszustand auf Seiten des Betroffenen verbunden sind oder ganz basale Tätigkeiten beeinträchtigen, die für das alltägliche Leben notwendig sind (sowie die Körperpflege oder die Nahrungsaufnahme). Wer also, wie in Einzelfällen berichtet, dass Internet so exzessiv nutzt, dass er oder sie sich durch mangelnde Nahrungsaufnahme und Körperhygiene schädigt, kann Anspruch darauf erheben, als krank wahrgenommen zu werden und therapeutische Leistungen einfordern, die vom Krankenversicherungssystem erstattet werden können. Bezüglich des Suchtbegriffes wird hier, wie bereits zu Beginn des Artikels anhand der Herkunft des Begriffes dargelegt, auf die für das Individuum schädliche Einschränkung wesentlicher Verhaltensweisen abgehoben. In ganz ähnlicher Form wurden auch früher schon Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen thematisiert. So postulierte beispielsweise Kant, dass die eigentlichen Suchterkrankungen dann gegeben seien, wenn ein Mensch den andren bloß zum Mittel seiner Zwecke macht [17]. Typische Beispiele dafür waren für Kant die Herrschund Habsucht. Auch hier wird ein Verlust an vielfältigen Verhaltensweisen beschrieben, der in diesem Fall den Kontakt zu den Mitmenschen einengt und seiner eigentlichen Qualität beraubt. Dass hier ein Verlust vorliegt, wird dann besonders deutlich, wenn der starke Drang nach der suchtartigen Verhaltensweise den Betroffenen selbst unangenehm ist und sie sich eigentlich wünschen würden, ganz anders zu handeln. Diesen Widerspruch hat beispielsweise Harry Frankfurt [7] thematisiert. Allerdings sind beim Menschen unbewusste und bewusste, unreflektierte und reflektierte Wünsche oft so eng miteinander verknüpft, dass eine klare Trennung in eine suchtrelevante, dranghafte Begierde einerseits und die reflektierte Stellungnahme der betroffenen Personen andererseits den komplexen Gegebenheiten kaum gerecht wird. Es ist aber plausibel anzu- 6 Der Nervenarzt 2013
7 nehmen, dass es zu den wesentlichen Fähigkeiten aller Menschen gehört, sich vom aktuellen Geschehen zumindest zeitweise zu distanzieren und sich zumindest kurzfristig dem Strudel der Ereignisse und eigenen Befindlichkeiten soweit zu entziehen, dass eine reflektierte Stellungnahme möglich wird [34]. Entscheidend für die Frage, ob suchtartiges Verhalten vorliegt, ist also nicht die vermeintliche Wertigkeit der Handlungen, ob ein Mensch leidenschaftlich liebt, Briefmarken sammelt oder am Computer spielt, steht ihm frei. Entscheidend ist aber, ob sich solche Verhaltensweisen auf Kosten aller anderen Verhaltensmöglichkeiten durchsetzen und ob insbesondere der flexible Kontakt zu den Mitmenschen verloren geht. Fazit für die Praxis F Vor dem geschilderten Hintergrund und in Anbetracht der skizzierten Befunde schlagen wir in Einklang mit der geplanten ICD-11 vor, sowohl das exzessive Glücksspiel als auch die exzessive Computer- und Internetnutzung den Verhaltenssüchten zuzurechnen. Bei den anderen geschilderten Verhalten erscheint uns die Datenlage nicht ausreichend für eine schlüssige Einordnung. F Aufgrund von Studienergebnissen und insbesondere auch Einzelfallschilderungen kann angenommen werden, dass z. B. das exzessive Kaufen bei bestimmten Individuen Suchtcharakter annimmt und das Suchtmodell damit auch einen aussichtsreichen therapeutischen Zugang erlaubt. F Dies gilt zumindest in Einzelfällen auch bei exzessivem Sexualverhalten und bei Adipositas. Korrespondenzadresse Prof. Dr. K. Mann Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin J 5, Mannheim Karl.Mann@zi-mannheim.de Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt für sich und seine Koautoren an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Literatur 1. American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4. Aufl. American Psychiatric Association, Washington, DC 2. Bechara A (2005) Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive perspective. Nat Neurosci 8(11): Blanco C, Moreyra P, Nune E et al. (2001) Pathological gambling: addiction or compulsion? Semin Clin NeuroPsychiatry 6(3): Carnes P (1998) The case for sexual anorexia: an interim report on 144 patients with sexual disorders. Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention 5(4): Croissant B, Klein O, Löber S, Mann K (2009) A case of compulsive buying impulse control disorder or dependence disorder? Psychiatr Prax 36(04): Eating Disorders Work Group on DSM-V (2011) 7. Frankfurt H (1988) Freedom of the will and the concept of a person. the importance of what we care about: philosophical essays. University Press, Cambridge, S Goldman R (2000) Compulsive Buying as an Addiction. In: Benson AL (Hrsg) I shop, therefore I am: compulsive buying and the search for self. Rowman & Littlefield, New York, S Grant JE, Potenza MN, Weinstein A, Gorelick DA (2010) Introduction to behavioral addictions. Am J Drug Alcohol Abuse 36(5): Grüsser SM, Poppelreuter S, Heinz A et al (2007) Behavioural addiction: an independent diagnostic category? Nervenarzt 78: Grüsser S, Thalemann C (2006) Verhaltenssucht Diagnostik, Therapie, Forschung. Huber, Bern 12. Hand I (1997) Zwangs-Spektrum-Störungen oder Nichtstoffgebundene Abhängigkeiten? In: Mundt C, Linden M, W B (Hrsg) Psychotherapie in der Psychiatrie. Springer, Wien, S Hand I (2003) Störungen der Impulskontrolle: Nichtstoffgebundene Abhängigkeiten (Süchte), Zwangsspektrum-Störungen oder? Suchttherapie 4: Hartmann U, Mörsen C, Böning J, Berner M (im Druck) Exzessives Sexualverhalten. In: Mann K (Hrsg) Verhaltenssüchte. Springer, Heidelberg 15. Heinz A (2005) Gesunder Geist-krankes Hirn? Überlegungen zum Krankheitsbegriff in der Psychiatrie. In: Hermann C, Pauen M, Rieger J, Schicktanz S (Hrsg) Bewusstsein. Philosophie, Neurowissenschaften, Ethik. Wilhelm Fink, München, S Kafka MP (2010) Hypersexual disorder: a proposed diagnosis for DSM-V. Archives of sexual behavior 39(2): Kant I (1983) Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Reclam, Stuttgart, S Kaplan MS, Krueger RB (2010) Diagnosis, assessment, and treatment of hypersexuality. J Sex Res 47(2): Kiefer F (im Druck) Suchtaspekte bei Adipositas. In: Mann K (Hrsg) Verhaltenssüchte. Springer, Heidelberg 20. Kinsey A, Pomeroy W, Martin C (1948) Sexual Behavior in the Human Male. Br Med J 21. Kraepelin E (1909) Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. S Lindenmeyer J (2004) Vom allgemeinen Defizitmodell zum situationsspezifischen Rückfallrisiko Anmerkungen zur Sucht-Neurose-Debatte. Verhaltenstherapie 14: Långström N, Hanson RK (2006) High rates of sexual behavior in the general population: correlates and predictors. Arch Sex Behav 35(1): McElroy S, Keck P, Pope H et al (1994) Compulsive buying: a report of 20 cases. J Clin Psychiatry 55(6): Mueller A, Mitchell JE, Black DW et al (2010) Latent profile analysis and comorbidity in a sample of individuals with compulsive buying disorder. Psychiatry Res178(2): Mueller A, Mitchell JE, Crosby RD et al (2010) Estimated prevalence of compulsive buying in Germany and its association with sociodemographic characteristics and depressive symptoms. Psychiatry Res 180(2 3): Mueller A, Mueller U, Albert P et al (2007) Hoarding in a compulsive buying sample. Behav Res Ther 45(11): Mörsen C, Heinz A, Fauth-Bühler M, Mann K (2012) Glücksspiel im Gehirn: neurobiologische Gundlagen pathologischen Glückspielens. In: Wurst F, Thon N, Mann K (Hrsg) Glücksspielsucht. Ursachen Prävention Therapie. Verlag Hans Huber, Bern, S Müller A, Böning J, De Zwaan M (im Druck) Pathologisches Kaufen. In: Mann K (Hrsg) Verhaltenssüchte. Springer, Heidelberg 30. Nesse R, Berridge K (1997) Psychoactive drug use in evolutionary perspective. Science 278(5335): O Guinn T, Faber RJ (1989) Compulsive buying: a phenomenological exploration. J Cons Res 16(2): O Brien CP, Childress A, McLellan AT, Ehrman R (1992) A learning model of addiction. In: O Brien CP, Jaffe JH (Hrsg) Addictive states. Research publications: association for research in nervous and mental disease. Raven Press, New York, S Petry NM (2006) Should the scope of addictive behaviors be broadened to include pathological gambling? Addiction 101: Plessner H (1975) Die Stufen des Organischen under der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Walter de Gruyter, Berlin 35. Raab G, Elger CE, Neuner M, Weber B (2011) A neurological study of compulsive buying behaviour. J Consum Policy34(4): Schoofs N, Heinz A (2012) Pathological gambling: Impulse control disorder, addiction or compulsion? Nervenarzt. doi: /s y 37. Seiferth N, Beck A (2011) Neurobiologie der Sucht und Brain Imaging. Spektrum Psychiatr 2: Volkow ND, Fowler JS (2000) Addiction, a disease of compulsion and drive: involvement of the orbitofrontal cortex. Cereb Cortex10(3): WHO (1992) International Classification of Diseases (ICD-10): clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization, Geneva 40. WHO (1994) Lexicon of alcohol and drug terms. World Health Organization, Geneva 7
Verloren im Netz? Verhaltenssüchte und ihre Folgen
 PROF. DR. WOLFGANG MAIER PRÄSIDENT DGPPN Verloren im Netz? Verhaltenssüchte und ihre Folgen Hauptstadtsymposium der DGPPN am 27. Februar 2013 in Berlin Vorsitz: DIE MITGLIEDER DER TASK FORCE VERHALTENSSÜCHTE
PROF. DR. WOLFGANG MAIER PRÄSIDENT DGPPN Verloren im Netz? Verhaltenssüchte und ihre Folgen Hauptstadtsymposium der DGPPN am 27. Februar 2013 in Berlin Vorsitz: DIE MITGLIEDER DER TASK FORCE VERHALTENSSÜCHTE
Verhaltenssüchte: Wenn Tätigkeiten zur Droge werden
 Verhaltenssüchte: Wenn Tätigkeiten zur Droge werden Symposium Glücksspiel 2009 Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Historischer Kontext
Verhaltenssüchte: Wenn Tätigkeiten zur Droge werden Symposium Glücksspiel 2009 Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Historischer Kontext
Bipolare Störung und Verhaltenssüchte
 SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR BIPOLARE STÖRUNGEN 11. INTERDISZIPLINÄRE JAHRESTAGUNG, 24.10.2015 «Bipolar und Sucht» Bipolare Störung und Verhaltenssüchte Prof. Dr. med. Michael Rufer Klinik für Psychiatrie
SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR BIPOLARE STÖRUNGEN 11. INTERDISZIPLINÄRE JAHRESTAGUNG, 24.10.2015 «Bipolar und Sucht» Bipolare Störung und Verhaltenssüchte Prof. Dr. med. Michael Rufer Klinik für Psychiatrie
Amerikanische Verhältnisse Abhängigkeitsdiagnostik nach DSM 5 bei PatientInnen in der stationären Entwöhnungsbehandlung: Ergebnisse einer Pilotstudie
 Amerikanische Verhältnisse Abhängigkeitsdiagnostik nach DSM 5 bei PatientInnen in der stationären Entwöhnungsbehandlung: Ergebnisse einer Pilotstudie Wilma Funke und Johannes Lindenmeyer Kliniken Wied
Amerikanische Verhältnisse Abhängigkeitsdiagnostik nach DSM 5 bei PatientInnen in der stationären Entwöhnungsbehandlung: Ergebnisse einer Pilotstudie Wilma Funke und Johannes Lindenmeyer Kliniken Wied
Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
 Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SCHULD vs. KRANKHEIT SUCHT vs. ABHÄNGIGKEIT ABHÄNGIGKEIT vs. MISSBRAUCH PSYCHISCHE vs. PHYSISCHE ABHÄNGIGKEIT
Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SCHULD vs. KRANKHEIT SUCHT vs. ABHÄNGIGKEIT ABHÄNGIGKEIT vs. MISSBRAUCH PSYCHISCHE vs. PHYSISCHE ABHÄNGIGKEIT
Fluch oder Segen? Online Medien aus Sicht der Psychiatrie. Dr. Kurosch Yazdi Zentrum für Suchtmedizin Landesnervenklinik Wagner- Jauregg Linz
 Fluch oder Segen? Online Medien aus Sicht der Psychiatrie Zentrum für Suchtmedizin Landesnervenklinik Wagner- Jauregg Linz Verhaltenssüchte: 1. Onlinesüchte: Online- Rollenspiele (z.b. WoW) Socialnetworks
Fluch oder Segen? Online Medien aus Sicht der Psychiatrie Zentrum für Suchtmedizin Landesnervenklinik Wagner- Jauregg Linz Verhaltenssüchte: 1. Onlinesüchte: Online- Rollenspiele (z.b. WoW) Socialnetworks
Übersicht. Mögliche Therapieimplikationen
 KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE Das Konzept der Verhaltenssüchte im DSM-5: klinische und neurobiologische Perspektiven sowie Therapieimplikationen Dr. Nina Romanczuk-Seiferth PPT, Dipl.-Psych.
KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE Das Konzept der Verhaltenssüchte im DSM-5: klinische und neurobiologische Perspektiven sowie Therapieimplikationen Dr. Nina Romanczuk-Seiferth PPT, Dipl.-Psych.
Was sind Verhaltenssüchte?
 Was sind Verhaltenssüchte? Grundlagen zur Krankheitsentstehung, Symptomatik und Behandlungsmöglichkeiten Wenn Alltag süchtig macht Fachtagung 16. September 2011 Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Leitung AG
Was sind Verhaltenssüchte? Grundlagen zur Krankheitsentstehung, Symptomatik und Behandlungsmöglichkeiten Wenn Alltag süchtig macht Fachtagung 16. September 2011 Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Leitung AG
Gehirn und Verhaltenssucht
 Forum für Suchtfragen; Basel, 15. November 2012 Gehirn und Verhaltenssucht Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Ärztlicher Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen Gliederung meines Vortrags Das «klassische»
Forum für Suchtfragen; Basel, 15. November 2012 Gehirn und Verhaltenssucht Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Ärztlicher Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen Gliederung meines Vortrags Das «klassische»
PATHOLOGISCHES KAUFEN eine psychische Erkrankung?
 PATHOLOGISCHES KAUFEN eine psychische Erkrankung? PD Dr. med. Dr. phil. Astrid Müller Klinik für Psychosomatik & Psychotherapie, MHH 19. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e. V.
PATHOLOGISCHES KAUFEN eine psychische Erkrankung? PD Dr. med. Dr. phil. Astrid Müller Klinik für Psychosomatik & Psychotherapie, MHH 19. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e. V.
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
 F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Triadisches System: Suchterkrankungen werden den psychogenen Erkrankungen zugeordnet. Sucht als psychische Abhängigkeit wurde von Gewöhnung
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Triadisches System: Suchterkrankungen werden den psychogenen Erkrankungen zugeordnet. Sucht als psychische Abhängigkeit wurde von Gewöhnung
Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer vom
 Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer vom 24.11.2011 BPtK Klosterstraße 64 10179 Berlin Tel.: 030 27 87 85-0 Fax: 030 27 87 85-44 info@bptk.de
Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer vom 24.11.2011 BPtK Klosterstraße 64 10179 Berlin Tel.: 030 27 87 85-0 Fax: 030 27 87 85-44 info@bptk.de
Gehirn und Verhaltenssucht
 Forum für Suchtfragen; Basel, 15. November 2012 Gehirn und Verhaltenssucht Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Ärztlicher Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen Gliederung meines Vortrags Das «klassische»
Forum für Suchtfragen; Basel, 15. November 2012 Gehirn und Verhaltenssucht Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Ärztlicher Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen Gliederung meines Vortrags Das «klassische»
Epidemiologie der spezifischen Phobien
 Geisteswissenschaft Marcel Maier Epidemiologie der spezifischen Phobien Studienarbeit - Review Artikel - (benotete Seminararbeit) Epidemiologie der Spezifischen Phobien erstellt von Marcel Maier (SS 2005)
Geisteswissenschaft Marcel Maier Epidemiologie der spezifischen Phobien Studienarbeit - Review Artikel - (benotete Seminararbeit) Epidemiologie der Spezifischen Phobien erstellt von Marcel Maier (SS 2005)
Glücksspielsucht und Komorbidität. Besondere Aspekte in Beratung und Behandlung
 Glücksspielsucht und Komorbidität Besondere Aspekte in Beratung und Behandlung Mittwoch, 9. November 2016 9:00-16:00 Uhr Ort: JUFA Hotel Graz City Idlhofgasse 74, 8020 Graz Pathologisches Glücksspiel tritt
Glücksspielsucht und Komorbidität Besondere Aspekte in Beratung und Behandlung Mittwoch, 9. November 2016 9:00-16:00 Uhr Ort: JUFA Hotel Graz City Idlhofgasse 74, 8020 Graz Pathologisches Glücksspiel tritt
Vom Mögen zum Wollen. Motivationale und neurobiologische Aspekte der Abhängigkeit
 Vom Mögen zum Wollen Motivationale und neurobiologische Aspekte der Abhängigkeit Überblick Gesellschaftliche Aspekte Differenzierung Wollen und Mögen Neurobiologische Substrate Incentive Theorie Neurokognitive
Vom Mögen zum Wollen Motivationale und neurobiologische Aspekte der Abhängigkeit Überblick Gesellschaftliche Aspekte Differenzierung Wollen und Mögen Neurobiologische Substrate Incentive Theorie Neurokognitive
Was ist Sucht/Abhängigkeit?
 Was ist Sucht/Abhängigkeit? 1 Suchtkranke sind in der Regel nicht - unter der Brücke zu finden - ständig betrunken - offensichtlich suchtkrank - leistungsunfähig - aggressiv - labil und willensschwach
Was ist Sucht/Abhängigkeit? 1 Suchtkranke sind in der Regel nicht - unter der Brücke zu finden - ständig betrunken - offensichtlich suchtkrank - leistungsunfähig - aggressiv - labil und willensschwach
Pathologisches Kaufen off- und online
 Pathologisches Kaufen off- und online PD Dr. med. Dr. phil. Astrid Müller Klinik für Psychosomatik & Psychotherapie, MHH 5. Symposium Fachverband Medienabhängigkeit e.v. 30. Oktober 2014 mueller.astrid@mh-hannover.de
Pathologisches Kaufen off- und online PD Dr. med. Dr. phil. Astrid Müller Klinik für Psychosomatik & Psychotherapie, MHH 5. Symposium Fachverband Medienabhängigkeit e.v. 30. Oktober 2014 mueller.astrid@mh-hannover.de
Grundlagen zu Verhaltenssüchten
 Grundlagen zu Verhaltenssüchten Symposium Computerspiele und Onlinesucht Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Historischer Kontext Definition
Grundlagen zu Verhaltenssüchten Symposium Computerspiele und Onlinesucht Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Historischer Kontext Definition
Neue Süchte und Geschlecht
 Neue Süchte und Geschlecht Glückspiel, Kaufsucht, Online-Sucht Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Kompetenzzentrum Verhaltenssucht Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz XVIII. Niedersächsische
Neue Süchte und Geschlecht Glückspiel, Kaufsucht, Online-Sucht Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Kompetenzzentrum Verhaltenssucht Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz XVIII. Niedersächsische
22. Zürcher Präventionstag
 Verhaltenssüchte aktueller Wissensstand 22. Zürcher Präventionstag Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Leitung AG Spielsucht Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Sucht und Abhängigkeit
Verhaltenssüchte aktueller Wissensstand 22. Zürcher Präventionstag Dipl.-Psych. Chantal P. Mörsen Leitung AG Spielsucht Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Campus Mitte Themen Sucht und Abhängigkeit
Ziele und Methoden in der Therapie von Pathologischem PC/- Internetgebrauch
 Ziele und Methoden in der Therapie von Pathologischem PC/- Internetgebrauch 6. Fachtagung der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland Kristina Latz M.Sc., Suchthilfe Aachen ShAc 0001.023 01.06.2010 Rev.1
Ziele und Methoden in der Therapie von Pathologischem PC/- Internetgebrauch 6. Fachtagung der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland Kristina Latz M.Sc., Suchthilfe Aachen ShAc 0001.023 01.06.2010 Rev.1
Inhaltsverzeichnis. Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung
 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Unkontrolliertes und süchtiges Kaufverhalten:
 Unkontrolliertes und süchtiges Kaufverhalten: Die Schattenseiten der Konsumgesellschaft Prof. Dr. Gerhard Raab 7. September 2011 Einige Fakten zum Kaufverhalten a Kaufen bzw. Shopping Shopping ist heute
Unkontrolliertes und süchtiges Kaufverhalten: Die Schattenseiten der Konsumgesellschaft Prof. Dr. Gerhard Raab 7. September 2011 Einige Fakten zum Kaufverhalten a Kaufen bzw. Shopping Shopping ist heute
Inhaltsverzeichnis. 1 Grundlagen... 20. 2 Pathologisches Glücksspielen... 63. 1.1 Familiäre Rahmenbedingungen. 20 Gottfried Maria Barth
 1 Grundlagen... 20 1.1 Familiäre Rahmenbedingungen. 20 Gottfried Maria Barth 1.1.1 Heutige Situation der Familien... 20 1.1.2 Bedeutung der Familie für Jugendliche und Erwachsene... 20 1.1.3 Verhaltenssucht
1 Grundlagen... 20 1.1 Familiäre Rahmenbedingungen. 20 Gottfried Maria Barth 1.1.1 Heutige Situation der Familien... 20 1.1.2 Bedeutung der Familie für Jugendliche und Erwachsene... 20 1.1.3 Verhaltenssucht
Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung. Prof. Dr. med. Elmar Gräßel
 Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung, Psychiatrische Universitätsklinik
Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung, Psychiatrische Universitätsklinik
Depressive Kinder und Jugendliche
 Depressive Kinder und Jugendliche von Gunter Groen und Franz Petermann Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Vorwort 9 Kapitel 1 1 Zum Phänomen im Wandel der Zeit 11 Kapitel 2 2
Depressive Kinder und Jugendliche von Gunter Groen und Franz Petermann Hogrefe Verlag für Psychologie Göttingen Bern Toronto Seattle Vorwort 9 Kapitel 1 1 Zum Phänomen im Wandel der Zeit 11 Kapitel 2 2
Automatisch verloren!
 Kontakt Automatisch verloren! Glücksspiel geht an die Substanz Fachinformationen zum Thema Glücksspiel für Beratungskräfte Kontakt Wenn das Spiel kein Spiel mehr ist Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen
Kontakt Automatisch verloren! Glücksspiel geht an die Substanz Fachinformationen zum Thema Glücksspiel für Beratungskräfte Kontakt Wenn das Spiel kein Spiel mehr ist Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen
Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos
 Alice Sendera Martina Sendera Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen und Erkrankungen I. Teil Entwicklungspsychologie im Kindes- und
Alice Sendera Martina Sendera Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen und Erkrankungen I. Teil Entwicklungspsychologie im Kindes- und
Psychische Störungen Einführung. PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig
 Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Psychische Störungen Einführung PD Dr. Peter Schönknecht Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Leipzig Psychopathologische Symptome Psychopathologische Symptome
Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen
 Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen Gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus multidisziplinärer Perspektive Inhaltsverzeichnis
Studienmaterial für das Modul: Spezifische Bedarfe 2: psychische Erkrankungen Gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus multidisziplinärer Perspektive Inhaltsverzeichnis
LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung in allen Bereichen der Sucht Wissensc
 Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Folgen des Missbrauchs Sucht: Ein Trend von Suchtmitteln zu Suchtverhalten
 Folgen des Missbrauchs Sucht: Ein Trend von Suchtmitteln zu Suchtverhalten Symposium: Mein Handy, mein PC, mein Tablet Ärztekammer Nordrhein 27. März 2013 Autor: Praxis für Kommunikation und PolitikBeratung
Folgen des Missbrauchs Sucht: Ein Trend von Suchtmitteln zu Suchtverhalten Symposium: Mein Handy, mein PC, mein Tablet Ärztekammer Nordrhein 27. März 2013 Autor: Praxis für Kommunikation und PolitikBeratung
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von
 Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Sucht und Trauma. Die schwarzen Brüder
 Update Sucht interdisziplinär KSSG 3. Februar 2011 Sucht und Trauma. Die schwarzen Brüder Dr. med. Thomas Maier Chefarzt Akutpsychiatrie, Sucht- und Psychotherapie St. Gallische Psychiatrische Dienste
Update Sucht interdisziplinär KSSG 3. Februar 2011 Sucht und Trauma. Die schwarzen Brüder Dr. med. Thomas Maier Chefarzt Akutpsychiatrie, Sucht- und Psychotherapie St. Gallische Psychiatrische Dienste
Depressive Kinder und Jugendliche
 Depressive Kinder und Jugendliche von Groen und Franz Petermann 2., überarbeitete Auflage HOGREFE GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM KOPENHAGEN STOCKHOLM Vorwort 5 1
Depressive Kinder und Jugendliche von Groen und Franz Petermann 2., überarbeitete Auflage HOGREFE GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM KOPENHAGEN STOCKHOLM Vorwort 5 1
Resilienz. Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer
 Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Psychogene Essstörung und Adipositas - wenn Körper und Nahrung die Mutter ersetzen
 Ihre Gesundheit wir sorgen dafür. Psychogene Essstörung und Adipositas - wenn Körper und Nahrung die Mutter ersetzen Globale Prävalenz von Übergewicht und Adipositas - 1 Mrd. Menschen sind übergewichtig
Ihre Gesundheit wir sorgen dafür. Psychogene Essstörung und Adipositas - wenn Körper und Nahrung die Mutter ersetzen Globale Prävalenz von Übergewicht und Adipositas - 1 Mrd. Menschen sind übergewichtig
Abgerufen am von anonymous. Management Handbuch für die Psychotherapeutische Praxis
 Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Exzessives Kaufen und Kaufsucht Hintergründe, Mechanismen und mögliche Interventionen
 Exzessives Kaufen und Kaufsucht Hintergründe, Mechanismen und mögliche Interventionen Dr. Oliver Büttner Angewandte Sozialpsychologie & Konsumentenverhaltensforschung Universität Wien Überblick 1. Problematisches
Exzessives Kaufen und Kaufsucht Hintergründe, Mechanismen und mögliche Interventionen Dr. Oliver Büttner Angewandte Sozialpsychologie & Konsumentenverhaltensforschung Universität Wien Überblick 1. Problematisches
Glücksspielsucht: Klassifikation, Phänomenologie und klinisches Erscheinungsbild: Aktueller Stand der Forschung
 Glücksspielsucht: Klassifikation, Phänomenologie und klinisches Erscheinungsbild: Aktueller Stand der Forschung Dipl. Psych. Chantal P. Mörsen Prof. Dr. Sabine M. Grüsser Sinopoli Begriffsbestimmung Anglo
Glücksspielsucht: Klassifikation, Phänomenologie und klinisches Erscheinungsbild: Aktueller Stand der Forschung Dipl. Psych. Chantal P. Mörsen Prof. Dr. Sabine M. Grüsser Sinopoli Begriffsbestimmung Anglo
Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten
 1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
1 Um sinnvoll über Depressionen sprechen zu können, ist es wichtig, zwischen Beschwerden, Symptomen, Syndromen und nosologische Krankheitseinheiten unterscheiden zu können. Beschwerden werden zu depressiven
Memorandum Internetabhängigkeit
 Memorandum Internetabhängigkeit Autoren: Hans Jürgen Rumpf, Nicolas Arnaud, Anil Batra, Anja Bischof, Gallus Bischof, Matthias Brand, Andreas Gohlke, Michael Kaess, Falk Kiefer, Tagrid Leménager, Karl
Memorandum Internetabhängigkeit Autoren: Hans Jürgen Rumpf, Nicolas Arnaud, Anil Batra, Anja Bischof, Gallus Bischof, Matthias Brand, Andreas Gohlke, Michael Kaess, Falk Kiefer, Tagrid Leménager, Karl
Pädagogik. Anja Winterstein. Essstörungen. Studienarbeit
 Pädagogik Anja Winterstein Essstörungen Studienarbeit Essstörungen! Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Grundlegendes zum Essen und Essstörungen 2-6 2.1. Gestörtes Essverhalten. 2-3 2.2. Einteilung
Pädagogik Anja Winterstein Essstörungen Studienarbeit Essstörungen! Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Grundlegendes zum Essen und Essstörungen 2-6 2.1. Gestörtes Essverhalten. 2-3 2.2. Einteilung
Sucht und Abhängigkeit
 www.herzwurm.ch Sucht und Abhängigkeit Was ist Sucht? Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten. Der Betroffene hat keine Selbstkontrolle
www.herzwurm.ch Sucht und Abhängigkeit Was ist Sucht? Sucht ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten. Der Betroffene hat keine Selbstkontrolle
VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK KULTURHISTORISCHE BETRACHTUNG ERKLÄRUNGSMODELLE DER ANOREXIA NERVOSA 28
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
Selbstverletzendes Verhalten
 Selbstverletzendes Verhalten Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten von Franz Petermann und Sandra Winkel mit einem Beitrag von Gerhard Libal, Paul L Plener und Jörg M. Fegert GÖTTINGEN
Selbstverletzendes Verhalten Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten von Franz Petermann und Sandra Winkel mit einem Beitrag von Gerhard Libal, Paul L Plener und Jörg M. Fegert GÖTTINGEN
Vorläufiges Programm
 in Kooperation mit Forschungsnetzwerke Psychische Erkrankungen Stand und Perspektiven, 21./22. April 2016, im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin Vorläufiges Programm Donnerstag, 21. April
in Kooperation mit Forschungsnetzwerke Psychische Erkrankungen Stand und Perspektiven, 21./22. April 2016, im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin Vorläufiges Programm Donnerstag, 21. April
Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle!
 Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle! Die Autoren Dr. med. Cornelia Dehner-Rau arbeitet als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische
Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle! Die Autoren Dr. med. Cornelia Dehner-Rau arbeitet als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische
Cannabisentzugssymtome und Hinweise auf Persönlichkeitsstörungen. bei stationär behandelten Patienten während des Cannabisentzuges
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Andreas Marneros) Cannabisentzugssymtome
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Andreas Marneros) Cannabisentzugssymtome
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen
 Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment) und Differentialdiagnosen Thomas Duning Andreas Johnen Klinik für Allgemeine Neurologie Department für Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Alkoholabhängigkeit und Depression im Licht der Hirnforschung
 Alkoholabhängigkeit und Depression im Licht der Hirnforschung Christian Kaiser, M. Sc. in Psychologie christian.kaiser@ovgu.de 21. Magdeburger Fachtagung zur Suchttherapie Alte Ölmühle 28. 10. 2015 Gliederung
Alkoholabhängigkeit und Depression im Licht der Hirnforschung Christian Kaiser, M. Sc. in Psychologie christian.kaiser@ovgu.de 21. Magdeburger Fachtagung zur Suchttherapie Alte Ölmühle 28. 10. 2015 Gliederung
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe
 S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
Abhängigkeiten und Suchterkrankungen
 Ausbildung zum/r Psycholog. Berater/in und Psychotherapeutische/r Heilpraktiker/in Abhängigkeiten und Suchterkrankungen Begleitskript zum Seminar Inhalt Allgemeine Vorbemerkungen zu den Skripten Inhalt
Ausbildung zum/r Psycholog. Berater/in und Psychotherapeutische/r Heilpraktiker/in Abhängigkeiten und Suchterkrankungen Begleitskript zum Seminar Inhalt Allgemeine Vorbemerkungen zu den Skripten Inhalt
Pharmakologisches Neuroenhancement: Zwischen planbarem Wissenstransfer und nicht intendierten Rückwirkungen
 Pharmakologisches Neuroenhancement: Zwischen planbarem Wissenstransfer und nicht intendierten Rückwirkungen Univ.-Prof. Dr. Klaus Lieb Kick-Off-Meeting ELSA Wissenstransfer 12./13. Mai 2014, Berlin Pharmakologisches
Pharmakologisches Neuroenhancement: Zwischen planbarem Wissenstransfer und nicht intendierten Rückwirkungen Univ.-Prof. Dr. Klaus Lieb Kick-Off-Meeting ELSA Wissenstransfer 12./13. Mai 2014, Berlin Pharmakologisches
SYMPOSIUM demenzerkrankungen - NEUE ansätze IN
 SYMPOSIUM demenzerkrankungen - NEUE ansätze IN GRUNDLAGENFORSCHUNG, DIAGNOSTIK, THERAPIE UND VERSORGUNG Wilhelm Klein-Strasse 27 CH-4012 Basel Tel. +41 61 325 51 11 Fax +41 61 325 55 12 info@upkbs.ch www.upkbs.ch
SYMPOSIUM demenzerkrankungen - NEUE ansätze IN GRUNDLAGENFORSCHUNG, DIAGNOSTIK, THERAPIE UND VERSORGUNG Wilhelm Klein-Strasse 27 CH-4012 Basel Tel. +41 61 325 51 11 Fax +41 61 325 55 12 info@upkbs.ch www.upkbs.ch
salus klinik Hürth Als Mario das Spielen lernte Zur Funktion des Computerspiels Aus der Praxis für die Praxis:
 27. Fachtagung des Fachverbandes Glücksspielsucht e.v. in Berlin Aus der Praxis für die Praxis: Als Mario das Spielen lernte Zur Funktion des Computerspiels salus klinik Hürth // Dipl. Psych. Michael Krämer
27. Fachtagung des Fachverbandes Glücksspielsucht e.v. in Berlin Aus der Praxis für die Praxis: Als Mario das Spielen lernte Zur Funktion des Computerspiels salus klinik Hürth // Dipl. Psych. Michael Krämer
Michael Rufer, Susanne Fricke: Der Zwang in meiner Nähe - Rat und Hilfe für Angehörige zwangskranker Menschen, Verlag Hans Huber, Bern by
 Rufer/Fricke Der Zwang in meiner Nähe Aus dem Programm Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Dieter Frey, München Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg Prof. Dr. Meinrad
Rufer/Fricke Der Zwang in meiner Nähe Aus dem Programm Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Dieter Frey, München Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg Prof. Dr. Meinrad
Gesundheitsbezogene Lebensqualität, körperliche Beschwerden, psychische Komorbidität und Interventionen bei Dyspepsie
 Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Kognitive Profile bei kinder- und jugendpsychiatrischen Störungsbildern
 Aus dem Zentrum für Psychische Erkrankungen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Ärztlicher Direktor:
Aus dem Zentrum für Psychische Erkrankungen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Ärztlicher Direktor:
Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese. Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann
 Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann Inhaltsverzeichnis 1. Entstehungshintergrund 2. Konzept der Salutogenese
Ein Modell zur Gesundheits- und Krankheitsentwicklung Das Konzept der Salutogenese Florian Schmidt, Marius Runkel, Alexander Hülsmann Inhaltsverzeichnis 1. Entstehungshintergrund 2. Konzept der Salutogenese
1. Da muss ich allein durch - wer braucht die Psychiatrie und Psychotherapie und was versteht man darunter? 21
 Die Herausgeber. 15 Vorwort zur dritten Auflage 36 Vorwort zur zweiten Auflage 17 Vorwort zur ersten Auflage 20 Wolfgang Fischer & Harald J. Freyberger Ich bin doch nicht verrückt 1 Was verbirgt sich eigentlich
Die Herausgeber. 15 Vorwort zur dritten Auflage 36 Vorwort zur zweiten Auflage 17 Vorwort zur ersten Auflage 20 Wolfgang Fischer & Harald J. Freyberger Ich bin doch nicht verrückt 1 Was verbirgt sich eigentlich
Pathologischer PC- und Internetgebrauch
 salus klinik Friedrichsdorf Pathologischer PC- und Internetgebrauch Dipl. Psych. Nadja Tahmassebi salus klinik Friedrichsdorf Pathologischer PC und Internetkonsum Gaming (Mehrpersonen Online Rollenspiele,
salus klinik Friedrichsdorf Pathologischer PC- und Internetgebrauch Dipl. Psych. Nadja Tahmassebi salus klinik Friedrichsdorf Pathologischer PC und Internetkonsum Gaming (Mehrpersonen Online Rollenspiele,
Suchtentwicklung. Ablauf
 Suchtentwicklung Oberthema Eine Suchtentstehung aufzeigen Idee / Ziele Die Gratwanderung zwischen Genuss und Sucht kennenlernen Sich Gedanken über den eigenen Konsum machen Zeit Methode 15 20min Gruppenarbeit,
Suchtentwicklung Oberthema Eine Suchtentstehung aufzeigen Idee / Ziele Die Gratwanderung zwischen Genuss und Sucht kennenlernen Sich Gedanken über den eigenen Konsum machen Zeit Methode 15 20min Gruppenarbeit,
Entwicklung eines Erhebungsinstruments. Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel
 Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Die Rehabilitation Suchtkranker mit depressiven Störungen
 Die Rehabilitation Suchtkranker mit depressiven Störungen Prof. Dr. med. Reinhart Schüppel 13.09.16 Worum es geht Sucht und Depression Zusammenhänge Diagnostik Therapie Sucht-Reha 2 Epidemiologie Störung
Die Rehabilitation Suchtkranker mit depressiven Störungen Prof. Dr. med. Reinhart Schüppel 13.09.16 Worum es geht Sucht und Depression Zusammenhänge Diagnostik Therapie Sucht-Reha 2 Epidemiologie Störung
Memorandum Internetbezogene Störungen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht)
 Memorandum Internetbezogene Störungen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht) Autoren: Hans-Jürgen Rumpf 1, Nicolas Arnaud 2, Anil Batra 3, Anja Bischof 1, Gallus Bischof
Memorandum Internetbezogene Störungen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht) Autoren: Hans-Jürgen Rumpf 1, Nicolas Arnaud 2, Anil Batra 3, Anja Bischof 1, Gallus Bischof
In der Vergangenheit gab es keine klaren Kriterien für die
 Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Der Psychiater und Depressionsforscher Prof. Dr. Hubertus Himmerich erlebt das Leid, das die Krankheit Depression auslöst, tagtäglich als Oberarzt der Depressionsstation unserer Klinik, der Leipziger Universitätsklinik
Syndromspezifische Hilfe oder Empfundene Gängelung?
 Syndromspezifische Hilfe oder Empfundene Gängelung? Die Position der niedergelassenen Psychotherapeuten Dr. rer. nat. Dietrich Munz Sonnenberg Klinik Stuttgart dietrichmunz@t-online.de Kongress Essstörungen
Syndromspezifische Hilfe oder Empfundene Gängelung? Die Position der niedergelassenen Psychotherapeuten Dr. rer. nat. Dietrich Munz Sonnenberg Klinik Stuttgart dietrichmunz@t-online.de Kongress Essstörungen
Forum Suchtmedizin Ostschweiz Regionalkonferenz Ost 14. August Sucht und Trauma. Dr. med. Thomas Maier
 Forum Suchtmedizin Ostschweiz Regionalkonferenz Ost 14. August 2014 Sucht und Trauma Dr. med. Thomas Maier Chefarzt Akutpsychiatrie, Sucht- und Psychotherapie St. Gallische Psychiatrische Dienste Sektor
Forum Suchtmedizin Ostschweiz Regionalkonferenz Ost 14. August 2014 Sucht und Trauma Dr. med. Thomas Maier Chefarzt Akutpsychiatrie, Sucht- und Psychotherapie St. Gallische Psychiatrische Dienste Sektor
Inhaltsverzeichnis. 1 1 Organische psychische Störungen (ICD-10 F0) 1.1 Diagnostik der Demenz. 1.2 Therapie demenzieller Syndrome. 1.
 Inhaltsverzeichnis 1 1 Organische psychische Störungen (ICD-10 F0) 1.1 Diagnostik der Demenz 1.2 Therapie demenzieller Syndrome 1.3 Delir 2 Alkoholabhängigkeit (ICD-10 F1) 2.1 Epidemiologie 2.2 Diagnostische
Inhaltsverzeichnis 1 1 Organische psychische Störungen (ICD-10 F0) 1.1 Diagnostik der Demenz 1.2 Therapie demenzieller Syndrome 1.3 Delir 2 Alkoholabhängigkeit (ICD-10 F1) 2.1 Epidemiologie 2.2 Diagnostische
Dysmorphophobie Körperdysmorphe Störung
 Dysmorphophobie Körperdysmorphe Störung Definition Charakteristik und Therapie Merkmale der Störung Exzessive Beschäftigung mit einem Körperteil, das als häßlich oder entstellt erlebt wird, obwohl keine
Dysmorphophobie Körperdysmorphe Störung Definition Charakteristik und Therapie Merkmale der Störung Exzessive Beschäftigung mit einem Körperteil, das als häßlich oder entstellt erlebt wird, obwohl keine
Sucht und Persönlichkeitsstörungen
 19. Fachtagung für Beratungsstellen und Sozialdienste am 14. September 2016 Sucht und Persönlichkeitsstörungen Komorbidität als Herausforderung im ambulanten Alltag Dipl. Psych. Stefan Hellert Psychologischer
19. Fachtagung für Beratungsstellen und Sozialdienste am 14. September 2016 Sucht und Persönlichkeitsstörungen Komorbidität als Herausforderung im ambulanten Alltag Dipl. Psych. Stefan Hellert Psychologischer
Internet- und Computerspielabhängigkeit
 Vortrag Netzwerk Betriebe 27. Juni 2012 Internet- und Computerspielabhängigkeit Referentin: Dayena Wittlinger Fachstelle für Glücksspiel und Medienkonsum Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen
Vortrag Netzwerk Betriebe 27. Juni 2012 Internet- und Computerspielabhängigkeit Referentin: Dayena Wittlinger Fachstelle für Glücksspiel und Medienkonsum Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen
Woran leiden Glücksspieler? Erste Ergebnisse der Baden- Württemberg-Studie
 Woran leiden Glücksspieler? Erste Ergebnisse der Baden- Württemberg-Studie K. Mann 1, M. Bühler 1, T. Leménager 1 mit M. Rietschel 2, C. Mörsen 4, K. Wölfling 3, M. Beutel 5, A. Lindner 5, M. Vogelgesang
Woran leiden Glücksspieler? Erste Ergebnisse der Baden- Württemberg-Studie K. Mann 1, M. Bühler 1, T. Leménager 1 mit M. Rietschel 2, C. Mörsen 4, K. Wölfling 3, M. Beutel 5, A. Lindner 5, M. Vogelgesang
WAS BEDEUTET ABSTINENZ FÜR SUBSTITUIERTE? Ulrich Claussen Diplompsychologe Jugendberatung und Jugendhilfe e.v., Frankfurt am Main
 WAS BEDEUTET ABSTINENZ FÜR SUBSTITUIERTE? Ulrich Claussen Diplompsychologe Jugendberatung und Jugendhilfe e.v., Frankfurt am Main EINLEITUNG Substitution gilt als Behandlung der Wahl Substitution beinhaltet
WAS BEDEUTET ABSTINENZ FÜR SUBSTITUIERTE? Ulrich Claussen Diplompsychologe Jugendberatung und Jugendhilfe e.v., Frankfurt am Main EINLEITUNG Substitution gilt als Behandlung der Wahl Substitution beinhaltet
Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen
 Ist dies die richtige Therapie für Sie? Merkmale der generalisierten Angst 19 Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen Generalisierte Angst ist ein häufiges Nebenmerkmal von vielen unterschiedlichen
Ist dies die richtige Therapie für Sie? Merkmale der generalisierten Angst 19 Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen Generalisierte Angst ist ein häufiges Nebenmerkmal von vielen unterschiedlichen
Depression und Angst. Komorbidität
 Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
Depression. Was ist das eigentlich?
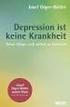 Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Hellweg-Klinik Bielefeld Ganztägig ambulante Rehabilitation suchtkranker Menschen
 Hellweg-Klinik Bielefeld Ganztägig ambulante Rehabilitation suchtkranker Menschen 1 Übersicht 1. Personenkreis 2. Behandlung 3. Team 4. Therapie-Inhalte 5. Zugang zur Klinik 6. Definition 7. Definition
Hellweg-Klinik Bielefeld Ganztägig ambulante Rehabilitation suchtkranker Menschen 1 Übersicht 1. Personenkreis 2. Behandlung 3. Team 4. Therapie-Inhalte 5. Zugang zur Klinik 6. Definition 7. Definition
Depression als Risikofaktor für Adipositas und Kachexie
 EDI 2011 Berlin Depression als Risikofaktor für Adipositas und Kachexie Christine Smoliner Diplom-Ernährungswissenschaftlerin St. Marien-Hospital Borken Epidemiologie Depressionen - 4 Mio. Menschen in
EDI 2011 Berlin Depression als Risikofaktor für Adipositas und Kachexie Christine Smoliner Diplom-Ernährungswissenschaftlerin St. Marien-Hospital Borken Epidemiologie Depressionen - 4 Mio. Menschen in
Tabellenband: Prävalenz der Medikamenteneinnahme und medikamentenbezogener Störungen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2012
 IFT Institut für Therapieforschung Parzivalstraße 25 80804 München www.ift.de Prof. Dr. Ludwig Kraus Wissenschaftlicher Leiter Januar 2014 Ludwig Kraus, Alexander Pabst, Elena Gomes de Matos & Daniela
IFT Institut für Therapieforschung Parzivalstraße 25 80804 München www.ift.de Prof. Dr. Ludwig Kraus Wissenschaftlicher Leiter Januar 2014 Ludwig Kraus, Alexander Pabst, Elena Gomes de Matos & Daniela
Onlinesucht-Projekt der GESOP
 Onlinesucht-Projekt der GESOP Bausteine des Onlinesuchtprojekts Einzelgespräche Onlinesucht-Gruppe Freizeit-Gruppe Selbsthilfe- Gruppe ESCapade Arbeitskooperation Präventions- veranstaltung Informations-
Onlinesucht-Projekt der GESOP Bausteine des Onlinesuchtprojekts Einzelgespräche Onlinesucht-Gruppe Freizeit-Gruppe Selbsthilfe- Gruppe ESCapade Arbeitskooperation Präventions- veranstaltung Informations-
Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
 Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen Begriffsbestimmung Der Begriff
Übergewicht, Anorexia nervosa und Veränderung der motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland Anorexia nervosa bei Kindern und Jugendlichen Begriffsbestimmung Der Begriff
INHALT. I. DEPRESSIVE REAKTIONEN AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT Martin Hautzinger
 INHALT I. DEPRESSIVE REAKTIONEN AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT 1. Beschreibung der Depression 15 1.1. Das klinische Bild der Depression 16 1.2. Emotionale Symptome 18 1.3. Kognitive Symptome 19 1.4. Motivationale
INHALT I. DEPRESSIVE REAKTIONEN AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT 1. Beschreibung der Depression 15 1.1. Das klinische Bild der Depression 16 1.2. Emotionale Symptome 18 1.3. Kognitive Symptome 19 1.4. Motivationale
Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen
 Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen In unserem Qualitätsbericht 2010 haben wir die Ergebnisse von Erhebungen
Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen In unserem Qualitätsbericht 2010 haben wir die Ergebnisse von Erhebungen
Das Adoleszente Gehirn: Implikationen für die Entwicklung von psychiatrischen Störungen und Forensik im Jugendalter
 Das Adoleszente Gehirn: Implikationen für die Entwicklung von psychiatrischen Störungen und Forensik im Jugendalter ¹, ² Peter J. Uhlhaas ¹Department of Neurophysiology Max-Planck Institute for Brain Research,
Das Adoleszente Gehirn: Implikationen für die Entwicklung von psychiatrischen Störungen und Forensik im Jugendalter ¹, ² Peter J. Uhlhaas ¹Department of Neurophysiology Max-Planck Institute for Brain Research,
Herzlich Willkommen. zum Vortrag Psychische Störungen und ihre (Aus)Wirkungen
 Herzlich Willkommen zum Vortrag Psychische Störungen und ihre (Aus)Wirkungen Eine Übersicht über verschiedene Störungsbilder und ihre möglichen Wirkungen auf die Betroffenen und das Umfeld, insbesondere
Herzlich Willkommen zum Vortrag Psychische Störungen und ihre (Aus)Wirkungen Eine Übersicht über verschiedene Störungsbilder und ihre möglichen Wirkungen auf die Betroffenen und das Umfeld, insbesondere
Internet, Videogames und Handy: Grenzen zwischen engagierter Nutzung und Verhaltenssucht. Aktuelle Befunde aus der Forschung
 Internet, Videogames und Handy: Grenzen zwischen engagierter Nutzung und Verhaltenssucht. Aktuelle Befunde aus der Forschung Gregor Waller, MSc Bern, 7. März 2013 Fachforum Jugendmedienschutz Inhalt 1.
Internet, Videogames und Handy: Grenzen zwischen engagierter Nutzung und Verhaltenssucht. Aktuelle Befunde aus der Forschung Gregor Waller, MSc Bern, 7. März 2013 Fachforum Jugendmedienschutz Inhalt 1.
