Deutscher Verband für Landschaftspflege e.v. (DVL) Feuchtwanger Straße Ansbach
|
|
|
- Falko Berg
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutscher Verband für Landschaftspflege e.v. (DVL) Feuchtwanger Straße Ansbach
2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 3 2. Entwicklung des DVL Mitgliederentwicklung des DVL Leitbild fast abgeschlossen 4 3. Bearbeitung wichtiger Themen durch den DVL auf Bundes- und EU-Ebene Extensive Beweidung: Abschluss-Tagung in Köln DVL-Position zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 des BMUB Beteiligung am LULUCF-Bericht von BMUB und BMEL Zusammenarbeit mit der EU-Kommission Der DVL in der Agrarpolitik Ökologisches Management von Leitungstrassen Rotmilan Land zum Leben DVL entwickelt Standards für Biodiversitätsberatung Mehr Landschaftspflegematerial in bestehende Biogasanlagen Schutz der genetischen Biodiversität gebietseigener Pflanzen Internationale Aktivitäten Landschaftspflegeverbände als weltweites Vorbild Beratungshilfe für kooperativen Naturschutz in Rumänien Ausgewählte Aktivitäten des DVL in den Bundesländern Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Schleswig-Holstein Thüringen 29 Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
3 1. Einleitung Dieser Geschäftsbericht gibt einen komprimierten Überblick über die Schwerpunkte der Arbeit des DVL im Zeitraum Juni 2014 bis Juni Dabei sind bewusst Schwerpunkte gesetzt worden. Viele weitere interessante Details und Informationen zu den Projekten und Aktivitäten finden Sie auf unserer Website Vorstand, Fachbeirat und Mitarbeiter des DVL bei der Frühjahrssitzung 2015 in Nümbrecht 2. Entwicklung des DVL 2.1 Mitgliederentwicklung des DVL Im Juni 2015 gibt es in Deutschland insgesamt 155 Landschaftspflegeverbände und vergleichbare Organisationen die im DVL Mitglied oder Fördermitglied sind (siehe Verbreitungskarte). Diese Verbände sind inzwischen in allen deutschen Flächenstaaten vertreten. Insgesamt verzeichnet der DVL zum Juni Mitglieder. Neugründungen von Landschaftspflegeorganisationen, die noch nicht alle offiziell dem DVL beigetreten sind, erfolgen weiterhin insbesondere in Baden-Württemberg (siehe auch Kapitel 5.1) Weitere Gründungsinitiativen gibt es aktuell darüber hinaus in Hessen und Bayern. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
4 2.2 Leitbild fast abgeschlossen Der DVL will auf dem diesjährigen Deutschen Landschaftspflegetag in Wiesbaden sein künftiges Leitbild vorstellen und beschließen. Kernpunkte sind das Bekenntnis zum gleichberechtigten Zusammenschluss aus Landwirtschaft, Naturschutz und Politik sowie zur Praxisnähe. Der DVL fühlt sich bei seiner Arbeit vor allem den Menschen verpflichtet, die in der Landschaft Nutzung und Wertschöpfung mit dem Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen verbinden. Das Leitbild wurde von den Mitgliedern des DVL entwickelt und im Rahmen eines 1 Jahr andauernden Beteiligungsprozess diskutiert. Mitglieder des DVL sind augenblicklich 155 Landschaftspflegeorganisationen in allen deutschen Flächenbundesländern. Leitbild des DVL Wir sind der Dachverband der Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland. Markenzeichen des DVL sowie seiner Mitglieder ist der gleichberechtigte und freiwillige Zusammenschluss von Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Politik. Wir wollen in unserer Kulturlandschaft auf zeitgemäße und nachhaltige Weise Naturvielfalt und Lebensqualität schaffen. In unserem Tun fühlen wir uns den Menschen verpflichtet, die in der Landschaft Nutzung und Wertschöpfung mit dem Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen verbinden. Wir bieten... kompetenten Service und Beratung rund um den Erhalt von Landschaften und natürlichen Lebensgrundlagen in Deutschland. Wir führen Meinungen aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Naturschutz und der Politik zusammen, vernetzen die Akteure und werben engagiert für Themen der Landschaftspflege. Wir bündeln und vertreten die Interessen und Erfahrungen unserer Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene. Wir arbeiten mit praxisgerechten und zukunftsfähigen Lösungen und Empfehlungen. Unser Denken und Handeln basiert auf Erfahrungen aus der regionalen Landschaftspflegepraxis. Unsere Themen vertreten wir fachorientiert und sachlich. Wir arbeiten dazu mit unseren Mitgliedern, Interessensverbänden, Wissenschaft, staatlicher Verwaltung und politischen Gremien zusammen. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
5 3. Bearbeitung wichtiger Themen durch den DVL auf Bundes- und EU-Ebene Wie in der Vergangenheit zählte auch im vergangenen Jahr die Diskussion zur Umsetzung der Agrarreform zu einem der Kernthemen, das der DVL im Sinne seiner Mitglieder intensiv bearbeitet. 3.1 Extensive Beweidung: Abschluss-Tagung in Köln Auch in der neuen reformierten Agrarpolitik gibt es bei der Förderung von Weideflächen zahlreiche Hürden. Die Beweidung von Feuchtwiesen, Trockenrasen oder Almweiden ist weiterhin mit aufwändiger Bürokratie und hohen Sanktionsrisiken verbunden. Betroffen sind Landwirte und Naturschutz gleichermaßen. Auf einer Tagung des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege in Köln-Deutz am 24. Februar 2015 haben 160 Fachleute aus Praxis und Verwaltung die neuen Richtlinien bewertet. Ein Hauptproblem ist die Anerkennung der Weideflächen in der 1. Säule der Agrarförderung. Aus Sicht des DVL brauchen wir eine Vereinfachung der Regeln im Sinne der Landwirte um die schönsten Perlen unserer Kulturlandschaften zu bewahren. Aus Sicht der EU handelt es sich oft um Grenzertragsstandorte, die nur in Teilen die Kriterien einer landwirtschaftlichen Produktionsfläche erfüllen und deshalb nicht generell ins landwirtschaftliche Fördersystem passen. Wegen zu vieler Bäume, Büsche, aber auch Schilf, Seggen und Binsen ist oft unklar, ob Landwirte auf den Flächen Direktzahlungen erhalten dürfen; ob es sich also um landwirtschaftliches Grünland im Sinne der EU-Vorordnungen handelt. Die Vegetation muss in vielen Fällen aufwendig vermessen und bewertet werden. Das Fehlerrisiko für die Landwirte und letztlich für die Mitgliedsstaaten ist dabei immens. Dieselbe EU verpflichtet jedoch Deutschland diese Flächen, oft Natura 2000-Gebiete, wegen ihres Artenreichtums zu erhalten. Dies ist aber nur durch landwirtschaftliche Nutzung von Schäfern oder Mutterkuhhaltern möglich ein krasser Widerspruch. Obwohl diese Landwirte für ihre Leistungen Förderprogramme der 2. Säule (z.b. Agrarumweltprogramme) nutzen, sind sie wie alle Landwirte auch auf Direktzahlungen aus der 1. Säule angewiesen. Die Tagung wurde gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) veranstaltet, der selbst Träger von modellhaften Beweidungsprojekten in Nordrhein-Westfalen ist. Gefördert wurde die Veranstaltung im Rahmen des DVL-Projekts Entwicklung der extensiven Beweidung als zukunftsfähiges Naturschutzinstrument durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein, die Heinz Sielmann Stiftung, die Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds, die Heidehofstiftung, die Naturstiftung David und den WWF Deutschland. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
6 3.2 DVL-Position zum Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 des BMUB Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen (THG) in Deutschland bis 2020 um mindestens 40 % gegenüber 1990 zu mindern. Das entspricht einer Minderung von rund Mt. (Megatonnen) CO 2 -Äquivalenten im Jahr 1990 auf einen Zielwert von höchstens 750 Mt. CO 2 -Äquivalenten in Gemäß Nationalem Inventarbericht 2014 wurden in Deutschland in 2012 rund 940 Mt. THG emittiert. Das entspricht einer Minderung von 24,7 % im Vergleich zu wurde noch eine Minderung von 25,6 % erreicht. Auch in 2013 sind laut Umweltbundesamt die Treibhausgasemissionen erneut gestiegen. Demnach wurden 2013 rund 951 Mt THG ausgestoßen, was gegenüber 1990 einer Minderung von 23,8 % entspricht. Der DVL möchte daher zusammen mit seinen Mitgliedern Maßnahmen durchführen, die zu einer Reduktion der THG-Emissionen maßgeblich beitragen könnten. Als einen ambitionierten, aber nicht unrealistischen, Vorschlag konzentriert sich unsere Empfehlung auf die extensive Nutzung organischer Böden. Obgleich ihre Bedeutung für die gesamten deutschen THG-Emissionen herausragend ist, wurden sie bei der sektoralen Aufteilung in der Sektion Landwirtschaft bisher nicht berücksichtigt. Wir halten jedoch das THG-Minderungspotential in diesem Bereich für überragend, ist doch Deutschland der zweitgrößte europäische Emittent von Treibhausgasen aus Mooren, obwohl die deutsche Moorfläche nur 2,3% der europäischen Moorfläche umfasst. So emittieren durch landwirtschaftliche Nutzung allein auf organischen Böden jährlich insgesamt 20,26 Mio. t CO 2 -Äquivalente 1.. Eine gezielte Wiedervernässung ausgewählter Flächen (durch Anhebung des Grundwasserspiegels) mit einer angepassten extensiven Grünlandnutzung kann jedoch dazu führen, die THG-Emissionen zu stoppen und Flächen als CO 2 -Senken wiederherzustellen. Wenngleich sicherlich nicht die gesamte Landwirtschaft auf organischen Böden umgestellt werden kann oder soll, so besteht auch bei der Umwandlung weniger Flächen von intensiver in extensiver Bewirtschaftung in kurzer Zeit größtes THG-Einsparpotential! Bislang ist eine umfassende extensive Bewirtschaftung organischer Böden mangels Rahmengesetzgebungen, Kostenübersicht und Einkommensausgleich für die durchführenden Landwirte nicht möglich. Zudem sind die gesellschaftlichen Kosten aktueller landwirtschaftlicher Nutzung auf organischen Böden nicht bekannt. Mit sehr intensiven praxisnahen Kontakten zu Landwirten und Landschaftspflegeverbänden bietet der DVL seine Mithilfe an. 3.3 Beteiligung am LULUCF-Bericht von BMUB und BMEL LULUCF bedeutet Land Use, Land-Use Change and Forestry (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft). Nach einem EU-Beschluss aus dem Jahr 2013 ist Deutschland verpflichtet, bis Januar 2015 einen Bericht über die erwarteten Emissionen im Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (Treibhausgas-Quellgruppe LULUCF ), die damit verbundenen 1 NABU-Studie Klimaschutz natürlich!, S rlich.pdf Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
7 Minderungspotentiale sowie derzeitige und künftige Minderungsmaßnahmen und deren Umsetzbarkeit an die Kommission zu liefern. Dieser EU-Beschluss sieht zudem vor, dass der Bericht mit breiter Beteiligung von Interessenvertretern erstellt werden soll. Der DVL hat im Sommer 2014 eine Stellungnahme erstellt, die eingesehen werden kann auf der DVL- Website unter: Zusammenarbeit mit der EU-Kommission Phil Hogan hat während seines ersten Auslandbesuches als neuer EU-Agrarkommissar die Landschaftspflegeverbände kennengelernt. In Kelheim (Bayern) informierte er sich u.a. über Erfolge bei LEADER. Der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF ist seit 10 Jahren Sitz der LEADER- Geschäftsstelle. Kelheim zählt zu den erfolgreichsten LEADER-Regionen in Bayern. Klaus Blümlhuber, langjähriger Landessprecher der bayerischen Landschaftspflegeverbände und Geschäftsführer des LPV konnte in einem Gespräch mit Hogan im kleinen Kreis auch das Modell der Landschaftspflegeverbände vorstellen. Er bat Hogan, bei der Initiative des DVL zum Aufbau des europäischen Landschaftspflegenetzwerkes Landcare Europe zu helfen. Der DVL will die EU-Kommission dafür gewinnen, das kooperative Modell der Landschaftspflegeverbände auch in anderen Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Agrarkommissar Hogan (re.) trifft auf Leidenschaft Landschaft Carl-Christian Buhr (links) ist im Kabinett des neuen Agrarkommissars Hogan Ansprechpartner für das EU-Mitgliedsland Deutschland. Bei einem Treffen in Brüssel Ende Februar stellte sich der DVL mit seinen Landschaftspflegeverbänden dem neuen Kabinettsmitglied vor. Buhr will die DVL-Initiative zum Aufbau von Landcare Europe unterstützen. Er bat außerdem darum, dass sich der DVL intensiv für eine erfolgreiche Umsetzung des Greenings einsetzt. Josef Göppel sagt hier eine künftige enge Zusammenarbeit zu. Anwesend bei der Besprechung war auch Michael Pielke (rechts), ein wichtiger Ansprechpartner für den DVL in der Generaldirektion Agri. Josef Göppel MdB, 1. Vorsitzender des DVL mit EU-Kabinettsmitglied Dr. Carl-Christian Buhr (li.) und Michael Pielke (re.) Darüber hinaus pflegt der DVL auch auf der Arbeitsebene intensive Kontakte sowohl in die Generaldirektion Landwirtschaft, als auch in Generaldirektion Umwelt. So wurde der DVL zum Beispiel eingeladen, im Rahmen einer Besprechung von BMEL und Bayerischem Landwirtschaftsministerium mit der EU-Kommission die anstehenden Herausforderungen bei der Berücksichtigung von extensivem Wei- Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
8 degrünland in der 1.Säule aus Sicht der Landschaftspflegeverbände darzustellen. Während der einstündigen Diskussion wurde deutlich, dass die Kommission für extensive Weideflächen keine Sonderregelungen akzeptieren wird. Sie stellt den Mitgliedsstaaten jedoch frei, Möglichkeiten der sogenannten delegierten Rechtsakte zu nutzen. 3.5 Der DVL in der Agrarpolitik Die wichtigsten Inhalte der neuen Agrarreform stehen für Deutschland fest. Der DVL und die Deutsche Vernetzungsstelle (DVS) zogen deshalb eine erste Bilanz, wie sich die neuen Vorgaben auf den Natur- und Biodiversitätsschutz in Deutschland auswirken werden. Fast 100 Teilnehmer diskutierten in Gotha darüber, wie positiv oder negativ sich die neuen Vorgaben auf Förderprogramme und auf die Praxis auswirken. Wichtigstes Ergebnis: Wir sind dem Ziel einer besseren Biodiversitätsförderung nicht wirklich näher gekommen. Es muss sich, trotz Neuerungen wie dem Greening, Wegweisendes ändern entweder schon zum Midterm-Review 2017 oder in der nächsten Programmplanung ab Besonders der eingeschlagene Weg des integrativen Naturschutzes muss hinterfragt werden, um die Biodiversitätsziele zu erreichen. Gemeint ist hier nicht der Naturschutz zusammen mit den Landwirten, sondern die Integration der Naturschutzförderung in die Landwirtschaftsförderung. So ist es zum Beispiel immer noch schwer, extensives Weidegrünland als förderberechtigt in der 1. Säule zu beantragen. Nach dem Spiel ist also vor dem Spiel. Das berühmte Herberger-Zitat lässt sich auch auf die Agrarreform anwenden. Bereits jetzt, nach Beginn der Umsetzung, wird über Schritte zur Weiterentwicklung diskutiert. Wichtiges Forum ist die sogenannte Verbändeplattform aus ca. 30 Verbänden, die sich allesamt für eine grünere und gerechtere Agrarpolitik einsetzen. Unter Moderation der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und von EuroNatur erarbeitet die Plattform zu den wichtigsten Themen gemeinsame Positionen und vertritt diese auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Agrarpolitik wird auch beim DVL ein wichtiges Kernthema sein und in die Verbändeplattform die Kompetenz und Erfahrungen aus der praktischen Landschaftspflege einbringen. 3.6 Ökologisches Management von Leitungstrassen Ende August 2014 erschien als Abschluss eines vom BfN finanzierten Projekts der DVL-Leitfaden Lebensraum unter Strom Trassen ökologisch managen. Darin sind Praxiswissen und Erfahrungen aus vielen Regionen Deutschlands gebündelt, so dass nun eine praxisnahe Grundlage für das naturschutzfachliche Management von Leitungstrassen vorliegt. Zudem hat der DVL hier erstmals ökologisches Trassenmanagement definiert. Die möglichen Maßnahmen, von der Ablagerung von Totholz über die Ansiedlung gebietsheimischer Magerrasen bis zur Beweidung mit Rindern und Schafen werden beschrieben und mit Beispielen untersetzt. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
9 Der DVL will mit diesem Leitfaden eine wichtige Grundlage für das naturschutzfachliche Management von Leitungstrassen legen. Mit einem ökologisch optimierten Management von Leitungstrassen können Netzbetreiber, Landschaftspflegeverbände, Grundstückseigentümer und Behörden dazu beitragen, Lebensräume zu vernetzen und für Tiere und Pflanzen Rückzugsräume zu schaffen. Es werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wie die technischen Anforderungen zur Übertragungssicherheit und die Chancen für eine naturschutzfachliche Verbesserung der Stromtrassen unter einen Hut zu bringen sind. 3.7 Rotmilan Land zum Leben Das Verbundprojekt Rotmilan Land zum Leben startete im Oktober Im Verbund zusammengeschlossen haben sich der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), die Deutsche Wildtier Stiftung (DeWiSt), der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) und 10 Praxispartner, die in 11 Praxisregionen in 8 Bundesländern aktiv sind. Das Projekt wurde zunächst bis zum mit Aussicht auf Verlängerung genehmigt. In den beiden Wintern 2013/14 sowie 2014/15 erfolgte in den Praxisregionen die Kartierung der Rotmilanbruten. Diese wird jährlich nach einheitlicher Methode wiederholt. So können über die voraussichtlich 6-jährige Projektlaufzeit wertvolle Daten über die Entwicklung der Rotmilane aufgenommen werden. Zusätzlich nahmen die Projektmitarbeiter Kontakt zu Behörden und Landnutzern vor Ort auf, um über den Rotmilan, seine Gefährdung und Maßnahmen zu seiner Bestandsstabilisierung zu informieren. Ein starker Fokus lag hierbei auf der Beratung von Land und Forstbewirtschaftern, da eine rotmilanfreundliche Landwirtschaft mit genügend Nahrungsgrundlage v.a. während der Jungenaufzucht und eine störungsfreie Brutsaison für den Rotmilan sehr wichtig sind. Hier haben die Mitarbeiter vor Ort versucht zusammen mit den Landnutzern Lösungen zu finden, die zum Teil über spezielle Förderprogramme unterstützt werden (siehe Kapitel 5.3). Des Weiteren wurden in 3 Regionen Rotmilane besendert, um die Nutzung der verschiedenen Flächen mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen auswerten zu können. Als zusätzliche Unterstützung wurden auch Kameras an Horsten angebracht. So kann nicht nur ausgewertet werden, in wie weit der Rotmilan die Flächen mit einer rotmilanfreundlichen Landwirtschaft anfliegt, sondern auch, welche Beutetiere er ins Nest bringt. Für diese Auswertungen wurden auf ausgewählten Flächen das Auftreten von Kleinsäugern und Brutvögeln untersucht. Zusätzlich hat der DDA weitere Analysen durchgeführt, die langfristig bei der Analyse des Rotmilanbestands, dessen Entwicklung und potentiellen Maßnahmen zur Bestandsstabilisierung und verbesserung helfen. Bereits zum Jahreswechsel 2015 haben die Verbundpartner einen Aufstockungsantrag mit einer weiteren Laufzeit von 4,5 Jahren für das Rotmilanprojekt beim BfN/DLR eingereicht. Bis Ende Juni werden voraussichtlich alle Verbundpartner einen Bewilligungsbescheid bekommen, so dass das Projekt fortgesetzt werden kann. Weitere aktuelle Informationen über das Projekt Rotmilan Land zum Leben finden Sie unter Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
10 3.8 DVL entwickelt Standards für Biodiversitätsberatung Der flächendeckende Aufbau einer praxisgerechten Biodiversitätsberatung von Landnutzern wird in den nächsten Jahren ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, um die Ziele des Biodiversitätsschutzes bei steigender Flächenkonkurrenz umzusetzen und den Kunden Landwirt für diese Aufgaben zu gewinnen. Der DVL will in den kommenden drei Jahren deshalb im Rahmen eines Projektes wichtige Grundlagen dafür schaffen. Aus Sicht des DVL können durch gezielte Biodiversitätsberatung die öffentlichen Gelder effektiver für den Naturschutz ausgerichtet werden. Neben fachlichen Zielvorgaben erfordert aber auch der Umgang mit komplizierten Verwaltungsvorgaben ein hohes Maß an Professionalität. Die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen über staatliche Förderprogramme ist mittlerweile von hoher Komplexität. Sanktions- und Anlastungsrisiken lassen bei der Planung und Abwicklung weder beim Manager Landschaftspflegeverband noch beim Landwirt Fehler zu. Die beratenden Akteure vor Ort müssen deshalb gezielt an diese Beratungsaufgaben herangeführt und geschult werden. Grundlage ist die Festlegung von Qualitätsstandards, die drei Anforderungen gerecht werden sollten: Sicherung eines hohen naturschutzfachlichen Niveaus der Beratung (1), Erfüllung der Erwartungen der Landnutzer hinsichtlich einer praxisorientierten Biodiversitätsberatung (2) und Anerkennung der Biodiversitätsberatung durch Behörden aller Ebenen (sowohl Landwirtschaft als auch Naturschutz (3). Das Projekt will mit den Landschaftspflegeverbänden Vorschläge erarbeiten, welche Qualitätsstandards für eine Biodiversitätsberatung von Landnutzern notwendig sind. Projektergebnis sollen einheitliche Beratungsstandards sein, die sowohl von allen Landschaftspflegeverbänden als auch von anderen Akteuren in allen Bundesländern genutzt werden können. Das Vorhaben soll mit einer Qualifizierungsreihe für diese Akteure kombiniert werden. Aus dem Projekt heraus sollen außerdem die Beratungsstandards in einem Leitfaden beschrieben werden und als Werkzeugkoffer für die Berater zur Verfügung gestellt werden. Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gefördert. 3.9 Mehr Landschaftspflegematerial in bestehende Biogasanlagen Ende 2014 wurde das Projekt Mehr Landschaftspflegematerial in bestehende Biogasanlagen erfolgreich mit der Veröffentlichung des Beratungsordners Vom Landschaftspflegematerial zum Biogas abgeschlossen. Die Fachtagung und Abschlussveranstaltung Biogas aber natürlich! Biogas aus Landschaftspflegematerial, Reststoffen und Biodiversitätsmaterial wurde vom Juli 2014 mit rund 75 Teilnehmern in Schwäbisch Hall durchgeführt. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
11 3.10 DiverGen Schutz der genetischen Biodiversität gebietseigener Pflanzen im Freistaat Sachsen Seit Anfang August 2014 betreut der DVL in Sachsen das Projekt DiverGen mit dem Ziel die Verfügbarkeit von autochthonem Saat- und Pflanzgut sicherzustellen. Gebietseigenes Pflanzund Saatgut ist ab 2020 Pflicht bei der Anlage von Gehölzpflanzungen oder Ansaaten außerhalb des Siedlungsraumes und der geregelten Landund Forstwirtschaft (s. 40(4) BNatSchG). In den kommenden Jahren werden Saatgutmischungen z.b. für Deiche, Böschungen und Tagebaufolgelandschaften konzipiert und mit den Praxispartnern erzeugt. Für die Bereitstellung von gebietseigenem Gehölz-Saatgut werden Vermehrungshecken und -plantagen etabliert (siehe Kapitel 5.6). Seit Ende Mai informiert die Homepage über Bezugsquellen, rechtlichen Hintergrund, Zertifizierung und Herkunftsgebiete von gebietseigenen Gehölzen, Gräsern und Kräutern. Ebenfalls Ende Mai erschien das Faltblatt zur Verwendung gebietseigener Pflanzen, das im Rahmen des Projektes DiverGen erstellt wurde. 4. Internationale Aktivitäten 4.1 Landschaftspflegeverbände als weltweites Vorbild Begeistert von der erfolgreichen Regionalvermarktung der Juradistl-Produkte und den dadurch erhaltenen Weideflächen zeigten sich sowohl Clinton Muller, Koordinator von Landcare International aus Nairobi, als auch eine Gruppe von 15 Experten zu Grünlandmanagement aus dem Baltikum. Beide waren unterwegs, um sich in Europa Best-Practice-Beispiele anzuschauen. Zusammen mit dem DVL bot der Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.opf. an, den internationalen Gästen seine Arbeit und Erfolge zu zeigen. Besonders interessant waren für die Besucher die kleinteiligen Kulturlandschaften, sowie die Methoden, mit denen der lokale Landschaftspflegeverband diese erhält und weiterentwickelt. So starteten im März und Mai die Besucher zusammen mit Werner Thumann und Marie Kaerlein ihre Exkursion am Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrum am Habsberg, um dann auf dem Kuppenalbwanderweg die markanten Trockenrasenhänge des Oberpfälzer Jura zu erleben und die Zusammenhänge zwischen Naturschutz und Landschaftspflege-Produkten, wie dem Juradistl- Lamm, zu verstehen. Zum Abschluss konnten sich die Teilnehmer von der guten Zusammenarbeit mit den Gastronomen in der Region bei regionalen Gastwirten und der Qualität des Lammfleischs selbst überzeugen. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
12 Werner Thumann, Marie Kaerlein, Clinton Muller und Agnes Hofmann (v.li) ließen sich das Juradistl-Lamm aus der Küche von Michael Meier (re.) zeigen (Foto: LPV Neumarkt i.d.opf.) 4.2 Beratungshilfe für kooperativen Naturschutz in Rumänien Im Mai 2015 hat das Beratungshilfeprojekt Erhalt der Kulturlandschaft in den Karpaten durch Kooperation zwischen Landwirtschaft, Landschaftspflege und Tourismus gestartet. Gefördert wird durch das Umweltbundesamt der Austausch von Wissen und die Übertragung von Erfahrungen, um in der Region Szeklerburg in Rumänien kooperative Strukturen ähnlich eines Landschaftspflegeverbandes anzustoßen. Vor Ort arbeitet der DVL mit der Partnerorganisation Pogany-havas Association zusammen, um die lokalen Bedingungen und Interessensgruppen in das Projekt integrieren zu können. Zudem wird im Projekt auch ein Geschäftsführer eines LPV eingebunden, um ganz praktisches Wissen weitergeben zu können. Die erste Projektphase läuft bis Ende November Eine Verlängerung wurde in Aussicht gestellt. Typische Kulturlandschaft in den Karpaten (Foto: Kőrössy Ruki) Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
13 5. Ausgewählte Aktivitäten des DVL in den Bundesländern In den Bundesländern Bayern, Brandenburg, Thüringen und Schleswig-Holstein ist es dem DVL möglich, durch die Unterstützung der jeweiligen Länder über eigene Koordinierungsstellen hauptamtlich aktiv zu sein. In Sachsen wird diese Koordinationsarbeit durch den dortigen DVL-Landesverband übernommen. Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils eine direkt in die Landesverwaltung integrierte Koordinierungsstelle. In den anderen Bundesländern wird die Präsenz auf Landesebene über engagierte ehrenamtliche Kräfte getragen, die dies neben ihrer Tätigkeit in einem örtlichen Verband absolvieren. Die Aktivitäten in einigen Bundesländern werden im Folgenden beispielhaft beschrieben: 5.1 Baden-Württemberg LEV Neugründungswelle in Baden-Württemberg hält weiter an Seit dem letzten Geschäftsbericht wurden 4 weitere Landschaftserhaltungsverbände (LEV) gegründet. Somit haben sich inzwischen 30 von 35 Landkreisen in Baden-Württemberg für das Erfolgsmodell LEV entschieden und das Förderangebot des Landes angenommen. Das Land stellt den Landkreisen für die Einrichtung von LEVen Mittel für 1,5 Stellenäquivalente zur Verfügung. Nur eine halbe Stelle muss der Trägerverein selbst erbringen. Die Kernaufgaben der LEV in Baden-Württemberg sind die Erhaltung, Pflege, Weiterentwicklung und Offenhaltung der Kulturlandschaft. Zudem werden sie einen wesentlichen Beitrag in der Umsetzung der Natura Managementplänen leisten. Baden-Württemberg hat 257 FFH-Gebiete ( ha, terr.) und 90 Vogelschutzgebiete ( ha). Die LEVs stellen ihre Arbeit regelmäßig einer breiten Öffentlichkeit vor z.b. bei den Landesgartenschauen, wie dieses Jahr in Mühlacker sowie bei den Landschaftspflegetagen in Baden-Württemberg, der in diesem Jahr zusammen mit dem LEV-Ortenaukreis am durchgeführt wird (mehr unter Zudem wurde für die Landschaftserhaltungsverbände Baden-Württemberg ein neuer Internetauftritt mit Intranet für die LEV-Geschäftsstellen konzipiert Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
14 Aktivitäten des Landessprecherteams Das im letzten Jahr gewählte Landessprecherteam (s. Geschäftsbericht 2014) hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen und ist in verschiedenen Gremien aktiv. Für den MEPL III Begleitausschuss, der zum ersten Mal am 17. Juni 2015 tagte, wurden Antonia Klein, LEV Ostalbkreis e.v. und Beate Leidig, LEV Schwäbisch Hall e.v. (Stellvertreterin) als stimmberechtigte Mitglieder benannt. Hans Page, LEV Emmendingen wurde bereits 2014 in den Fachbeirat des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL) bestellt. Kontakt Koordinierungsstelle der Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg bei der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL) Marion Ebert Oberbettringer Straße 162 D Schwäbisch Gmünd Tel.: Bayern Beratung zu Greeningmaßnahmen auf ökologischen Vorrangflächen Im Rahmen eines vom Umweltministerium geförderten Beratungsprojektes führten im Frühjahr neun Landschaftspflegeverbände die Greeningberatung von 17 landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern durch. Um möglichst viele verschiedene Aspekte in Bezug auf die Umweltrelevanz berücksichtigen zu können, wurden Betriebe zwischen 40 und 200 Hektar sowie reine Ackerbaubetriebe und tierhaltende Betriebe ausgewählt. Die Beratung und Umsetzung der Greeningmaßnahmen wird vom DVL begleitet und dokumentiert. Dabei sollen auch die möglichen Kombinationen und Synergien mit staatlichen Förderprogrammen im Bereich Umwelt erprobt und die Akzeptanz der einzelnen Maßnahmen untersucht werden. PIK-Maßnahmen in Straubing-Bogen und Deggendorf Seit Ende 2014 ist die Arbeitsgemeinschaft von DVL, LPV Straubing-Bogen und dem Büro Bosch&Partner von der RMD Wasserstraßen GmbH in den Landkreisen Straubing-Bogen und Deggendorf mit der Umsetzung von PIK-Maßnahmen für den Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Donau beauftragt. Landwirte sollen gewonnen werden, freiwillig auf ihren Nutzflächen artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen wie z.b. Lerchenfenster, Kiebitzfenster oder Blühund Brachstreifen für das Rebhuhn anzulegen. Die Informationsveranstaltungen zu dem Projekt stießen bei den betroffenen Landwirten auf großes Interesse. Insgesamt bestehen 28 Maßnahmenkombinationen, die die Landwirte gegen eine Prämienzahlung abschließen können. In diesem Sommer will der LPV Straubing-Bogen nun möglichst viele Landwirte für eine Teilnahme an dem Projekt werben. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
15 Starkes Bündnis für die Schäferei in Bayern Acht bayerische Verbände und das Bayerische Umweltministerium präsentierten die gemeinsame Erklärung Kulturlandschaft braucht Schafe! Strategie zur Förderung der Hüteschäferei in Bayern in Augsburg. Ziel aller Partner ist der Erhalt der Hüteschäferei in Bayern und die Entwicklung tragfähiger Zukunftsperspektiven. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) initiierte dafür ein Bündnis mit Bayerischem Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), Landesverband Bayerischer Schafhalter, Bayerischem Gemeindetag, BUND Naturschutz in Bayern (BN), Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), Bayerischem Jagdverband (BJV) mit Wildland-Stiftung Bayern, Bayerischem Bauernverband (BBV) und den Bayerischen Naturparken. Die Strategie identifiziert vier Handlungsfelder: Produktion und Vermarktung, Bereitstellung und Verfügbarkeit von Flächen, angemessenes Entgelt für öffentliche Leistungen und speziell auf sie angepasste Förderbedingungen, sowie die Akzeptanz der Hüteschäferei bei anderen Nutzergruppen. Die gemeinsame Erklärung bildet den Abschluss des Projektes Erhalt wertvoller Naturschutzflächen durch extensive Schafbeweidung Entwicklung einer landesweiten Strategie zur Unterstützung der Hüteschäferei in Bayern, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV). Partner des Strategiepapiers v. l.: Eric Imm - Bayerischer Jagdverband, Alfred Enderle - Bayerischer Bauernverband, Nicolas Liebig - Bayerische Landschaftspflegeverbände, Reiner Erben - Umweltreferent der Stadt Augsburg, Dr. Christian Barth - Bayerisches Umweltministerium, Dr. Kai Frobel - Bund Naturschutz, Friedrich Belzner - Landesverband Bayerischer Schafhalter, Heinrich Schmidt - Bayerische Naturparke, Rene Gomringer - Landesverband Bayerischer Schafhalter Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
16 Schäferrevierkonzepte Die größten Erschwernisse für die extensive Schafhaltung liegen in der Verfügbarkeit notwendiger Revierausstattungen. Dazu gehören zum Beispiel Flächen für Pferch und Weide oder frei zugängliche Triebwege und Tränkmöglichkeiten. Deshalb beantragte der DVL ein Projekt zur modellhaften Erstellung von Schäferrevierkonzepten beim Bayerischen Naturschutzfonds. Fünf Landschaftspflegeverbände erarbeiten praxisnahe Konzepte, die Lösungsmöglichkeiten für die Entwicklung ausgewählter Schäferbetriebe und die Beweidung naturschutzfachlichen wichtiger Flächen aufzeigen sollen. Damit kann sowohl die betriebliche Situation des Schäfers als auch die Beweidung hochwertiger Flächen optimiert und gegebenenfalls weiter ausgedehnt werden. Hüteschäferei, Neustadt an der Saale Kompensation gemeinsam mit Landschaftspflegeverbänden Landschaftspflegeverbände setzen Kompensationsmaßnahmen naturschutzfachlich beispielhaft um. In einer Broschüre hat der Deutsche Verband für Landschaftspflege mit ausgewählten Landschaftspflegeverbänden acht Beispiele dafür ausgearbeitet. Anhand eines Steckbriefes, Bildern und einer kurzen Beschreibung spiegeln die Beispiele die große Bandbreite von möglichen Kompensationsmaßnahmen wieder. Darunter fallen z.b. Ausgleichsmaßnahmen im Moor, am Gewässer oder auf Magerstandorten. Aber auch die unterschiedlichen Modelle bei der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen werden dargestellt. Diese reichen von Ökokontomaßnahmen bis hin zur Einrichtung einer Flächenagentur. Die Broschüre gibt Gemeinden und Eingriffsverursachern Ideen für eine fachgerechte Umsetzung künftiger Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Landschaftspflegeverbänden. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
17 Bayerns UrEinwohner Die Artenschutzkampagne wurde erneut als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Wiederauszeichnung war die Weiterentwicklung Kommunikationsmedien, wie Facebook und die nutzerfreundliche Überarbeitung der Internetseite Zu den modernen Kommunikationsmedien gehörte die Produktion einer Smartphone-App: Mit der neuen App Wertach.Natur im Fluss informieren die Landschaftspflegeverbände vom Ursprung bis zur Mündung der Wertach an 20 Infopunkte mit kurzen Videos über Natur- und Kulturlandschaft. Die Beiträge umfassen Themen wie Alpwirtschaft, Auwald, Fischtreppen oder Renaturierung auf. Das Infosystem Wertach.Natur im Fluss besteht aus einer Smartphone-App (Android und ios), Hinweisschildern vor Ort sowie einer Internetseite. Die App ist kostenlos und kann unter oder im appstore heruntergeladen werden. Sie begleitet auch den Fernradweg Wertach erleben. Wertach.Natur wurde vom DVL in Kooperation mit den Landschaftspflegeverbänden Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Landkreis Augsburg und Stadt Augsburg erarbeitet. Die Kampagne wurde wieder durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz bis 2016 verlängert und startet im Juli mit 10 neuen Projekten der Landschaftspflegeverbände zum Thema Natur in der Stadt. Kontakt DVL-Koordinierungsstelle Bayer) Beate Krettinger, Christiane Feucht Feuchtwanger Str Ansbach Tel.: 0981/ Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
18 5.3 Brandenburg Rotmilan-Projekt Die Population des Rotmilans soll bis 2020 deutlich ansteigen. Darauf zielt das Rotmilan- Schutzprojekt innerhalb des Bundesprogramms Biologische Vielfalt ab, dessen Koordiation der DVL bundesweit in acht Bundesländern übernommen hat. Der Landschaftspflegeverband Uckermark- Schorfheide ist mit der Region Uckermark im Projekt vertreten. Zwei Mitarbeiter_innen betreuen jeweils mit einer halben Stelle das Projekt und verfolgen dabei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte. Einerseits werden die Rotmilanbestände in einem festgelegten Untersuchungsgebiet der Uckermark kartiert sowie die Beobachtung von Gefährdungen und Störungen am Nest, bzw. in der Umgebung festgehalten. Andererseits sollen Landwirte zur Verbesserung der Nahrungsgrundlage und Umsetzung von Maßnahmen auf dem Acker (z. B. Anbau kleinkörniger Leguminosen) für diesen Greifvogel beraten werden. Zur Förderung über das, seit Januar 2015 eingeführte Greening stehen den Landwirten viele Maßnahmen zur Verfügung. Größtenteils dienen diese aber nicht der Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit. Daher standen die ersten Kontaktaufnahmen mit den Landwirten unter dem Zeichen der Information über die Ansprüche und die Möglichkeiten der Förderung des Rotmilans. Die Kartierungen in 2014 ergaben, dass in 9 Nestern 15 Jungvögel erfolgreich aufgezogen wurden. Die Projektlaufzeit wurde bis 30. September 2019 verlängert. ILE-Trockrasenprojekte Das Projekt des Landschaftspflegeverbandes Uckermark-Schorfheide zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen auf Trockenrasen im Landkreis Uckermark ist vom NaturSchutzFonds Brandenburg zum Projekt des Monats April 2015 gewählt worden. Seit April 2013 wurden in fünf ausgewählten FFH- Gebieten Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der prioritären Lebensraumtypen der Trockenrasen (6120, 6210, 6240) umgesetzt, in denen Maßnahmen aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes notwendig waren. Weitere Voraussetzungen waren die Zustimmung der Eigentümer und die Aussicht auf Flächennutzung. Finanziert wurde das Projekt mit durch die Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE). Der NaturSchutzFonds Brandenburg förderte zusätzlich mit die Personalkosten. Fachliche Grundlage der Maßnahmen für die Projektgebiete waren die seit Frühjahr 2012 vorliegenden ersten Ergebnisse der Natura 2000-Managementpläne für die FFH-Gebiete. Begleitet wurde das Projekt durch eine sich regelmäßig treffende Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fachbehörden und Gebietsbetreuern. In den einzelnen Gebieten wurden auf einem Bearbeitungsgebiet von 62 ha modellhaft Erhaltungsmaßnahmen wie Mahd, Beweidung und Entbuschung durchgeführt. Insgesamt konnten fast 39 ha Trockenrasen entbuscht und 14 ha gemäht werden. Zusätzlich sollten über das Projekt hinaus die Voraussetzungen für eine anschließende dauerhafte Pflege durch eine reguläre Beweidung im Rahmen nutzbarer Förderprogramme geschaffen werden. Die Wiederherstellung der Weideflächen ermöglichte die nachfolgende Beweidung aller Gebiete über Vertragsnaturschutz bzw. im Rahmen einer regulären landwirtschaftlichen Nutzung. So konnte im FFH-Gebiet Trockenrasen Schildberge auch ohne das Förderinstrument Vertragsnaturschutz langfristig eine Beweidung mit Dexter-Rindern etabliert werden. Diese kleinen und genügsamen Rinder eignen sich hervorragend für die Beweidung von sensiblen Trocken- Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
19 rasen. In diesem Gebiet wurde als weiteres langfristiges Projekt mit dem stufenweisen Ringeln eines Robinienbestands begonnen, um Stockausschläge zu vermeiden. Parallel fand in gleicher Förderkonstruktion auch im Landkreis Märkisch Oderland ein Pilot-Projekt in Trägerschaft des Landschaftspflegeverbandes Mittlere Oder statt. In insgesamt sieben FFH - Schutzgebieten wurden auf 30,5 ha Entbuschungen, Mahd und Beweidung beauftragt. Im FFH- Schutzgebiet Trockenrasen am Oderbruch wurden auf großer Fläche Robinien zurückgedrängt um das Biotop Trockenrasen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Die Pflegemaßnahmen, in mehrere Arbeitsschritte über den Jahresverlauf gegliedert, sind auf diesen Flächen mit Abschluss des Projektes nicht beendet und werden ehrenamtlich weiter betreut. Beweidung mit Dexter-Rindern im FFH-Gebiet Trockenrasen Schildberge (Foto: LPV) Stockhochschnitt zur Zurückdrängung der Robinie (Foto: Johannes Giebermann) 20 Jahre Waldschule Am Vorabend des Internationalen Tags der Umwelt feierte das Waldhaus Blankenfelde und damit das Umweltbildungsprojekt des Landschaftspflegevereins Mittelbrandenburg sein 20jähriges Bestehen. LPV Mittelbrandenburg e.v (Foto: Markus Mohn) Vielfüßlergang beim Waldspaziergang zur Fachveranstaltung zum 20 jährigen Bestehen (Foto: Markus Mohn) Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
20 Bereits 1996 betreute der DVL ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördertes Projekt zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen aus dem Großstadtbereich für Natur- und Umweltschutz, das der LPV vor Ort am Rande Berlins durchführte. Mit solchen und weiteren Förderungen und Unterstützungen, aber vor allem auch mit vielen Ehrenamtlichen, wuchs das Waldhaus- Projekt heran und stellte sich immer wieder neuen Herausforderungen. Heute nehmen jährlich rund kleine und große Besucher die nahezu täglichen Angebote wahr. Zu Beginn dieses Jahres erhielt das Projekt dafür den Teltow-Fläming-Preis Umfrage unter den LPV Brandenburg zur Natura 2000-Managementplanung Von März bis Juni 2014 wurden durch die Koordinierungsstelle Brandenburg die elf LPV in Brandenburg und Berlin hinsichtlich ihres Potentials und ihrer Bereitschaft zum Mitwirken an Umsetzungsprojekten innerhalb der FFH-Managementpläne befragt. Managementpläne (MP) ersetzen gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie die Bewirtschaftungspläne von FFH-Gebieten. Vier der befragten Verbände setzen derzeit FFH-Managementpläne um, bzw. sind an der Erstellung von Managementplänen beteiligt. Dem gegenüber können sich acht der neun LPV, die an der Befragung teilnahmen, grundsätzlich vorstellen, FFH-Managementpläne umzusetzen. Ist ein LPV erst einmal an der Umsetzung von Managementplänen beteiligt, ergeben sich daraus gleich mehrere Projekte. Fazit der Umfrage: Der Wille zur Umsetzung von Natura 2000-Managementplänen ist bei den Brandenburger Landschaftspflegeverbänden vorhanden, allerdings mangelt es ihnen aktuell zumeist an der nötigen Personalkapazität und den Finanzmitteln. Landschaftspflegeverbände, die schon an mehreren Umsetzungsprojekten beteiligt sind, kalkulieren für die Koordinierung von MP- Umsetzungsprojekten mindestens eine halbe Stelle (20 Stunden/ Woche) ein. Um also die LPV zur Koordinierung von MP-Umsetzungsprojekten innerhalb Brandenburgs zu etablieren, bedarf es folgender Voraussetzungen: Abschaffung des Vorfinanzierungsprinzips Förderung von Personalkosten in relevanten Richtlinien verankern Zugang zu Weiterbildungen für haupt- und ehrenamtlich Beschäftigte erleichtern, bzw. fördern Auf die Umsetzung von Natura 2000-Managementplänen sind die LPV durch ihre Präsenz, fachliche Kompetenz und Vernetzung in der Region gut vorbereitet. Allerdings müssen die LPV im Umweltund Landwirtschaftsministerium Brandenburg stärker als Partner bei der Umsetzung von Managementplänen verankert werden. Dieser wichtigen Aufgabe will sich die DVL-Koordinierungsstelle auch in Zukunft annehmen. Kontakt DVL Koordinierungsstelle Brandenburg Holger Pfeffer, Linda Rehmer Friedensallee 21, Rangsdorf Tel.: pfeffer@lpv.de, rehmer@lpv.de Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
21 5.4 Hessen LPV Rheingau-Taunus übernimmt Regionalmanagement der LEADER-Region Taunus Seit Februar 2015 ist die Region Taunus LEADER-Förderregion. In einem breit angelegten Beteiligungsprozess hat die Lokale Aktionsgruppe aus der Region Untertaunus und drei Gemeinden ein Regionales Entwicklungskonzept erarbeitet. Nach einer europaweiten Ausschreibung für das Regionalmanagement übernimmt der LPV Rheingau die Steuerung des LEADER-Prozesses und die Projektberatung. Das vorläufige Planungskontingent für LEADER-Projekte in der Region Taunus beträgt 2,18 Mio. an EU-, Bundes- und Landesmitteln. Kontakt Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.v. Jürgen Windgasse, Sonja Kraft Heimbacher Str Bad Schwalbach lpv.rtk@t-online.de LPV Main-Taunus: Familienerntetage Bei den Familienerntetagen des Landschaftspflegeverbands Main-Taunus Streuobst e.v. füllen sich nicht nur die Kisten der Gäste, sondern auch die Säckel der Gemeinden. Die Einnahmen von kommunalen Streuobstwiesen gehen zur Hälfte an die Kommune und zur Hälfte an den Verband, der auch die Geräte für die Ernte zur Verfügung stellt. Der LPV berät und unterstützt Kommunen bei der Reaktivierung und Pflege ihrer Streuobstwiesen. Kontakt Main-Taunus Streuobst e. V. Barbara Helling Am Kreishaus Hofheim helling@streuobst-mtk.de Die saftige Vielfalt der Streuobstwiesen (Foto: LPV) Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
22 5.5 Mecklenburg-Vorpommern Tümpel im Grünen - Lebensraum für Molch und Unke Die von Natur aus nährstoffreichen Sölle und Moore der Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg sind die Lebensräume verschiedener Amphibien. Besonders nennenswert sind die Vorkommen von Kammmolch (Triturus cristatus) und Rotbauchunke (Bombina bombina). Viele der 85 Sölle und Moore des FFH-Gebietes wurden in der jüngeren Vergangenheit drainiert und sind stark verlandet. Die Lebensraumfunktion für Amphibien ist dadurch erheblich eingeschränkt. Vor vier Jahren waren der Kammmolch und Rotbauchunke hier nahezu ausgestorben. Deshalb wurde ein FFH-Gebiet ausgewiesen. Durch die Renaturierung von 28 Kleingewässern, 2009 bis 2014 hat der Landschaftspflegeverband Renaturierter Soll im FFH-Gebiet Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg (Foto: M. Bauer) Nordwestmecklenburg und Wismar in Kooperation mit Landwirten, Eigentümern und Kommunen, Lebensraum für die gefährdeten Amphibien geschaffen. Heute sind ihre Populationen wieder stabil. Einer der Grundsätze des Projektes war, dass sowohl die Amphibien als auch der wirtschaftende Mensch im Gebiet künftig ihr Auskommen haben. Daher wurden auch die Bedürfnisse der Landnutzer bei diesem kooperativen Projekt berücksichtigt. Vereinzelt wurden Gräben wieder ausgeformt, um den kontrollierten Abfluss des Wassers über die Zielwasserstände zu gewährleisten. Die Flächen um die Tümpel im Grünen werden, ohne Pflanzenschutz- und Düngemittel, weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Grünes Klassenzimmer am Rande des Müritz-Nationalparkes Ökologische Inwertsetzung versiegelter Flächen zur Anlage eines Wissenspfades Der Landschaftspflegeverband Mecklenburger Endmoräne hat mit der Etablierung des Grünen Klassenzimmers eine Umweltbildungseinrichtung geschaffen, die sowohl der Darstellung des Aufgabenspektrums der Landschaftspflegeverbände als auch als Anlaufstelle und Bildungsstätte für einheimische Naturfreunde und Gäste unserer Region dient. Einen besonderen Schwerpunkt wird dabei die Arbeit mit Kindern einnehmen, die durch den LPV über Schulgärten schon jetzt an eine naturgemäße, nachhaltige Wirtschaftsweise herangeführt werden. Im Laufe des Jahres 2014 wurden umfangreiche Bau- und Pflanzmaßnahmen auf dem Gelände des Landschaftspflegehofes in Neu Schloen ausgeführt. Im Frühjahr 2015 wurden versiegelte Flächen zurückgebaut und versickerungsfähige Natursteinflächen eingebracht. Ein Lehrpfad beschreibt die entstandenen vielfältigen Formen von Hecken, Beeten, Wiesen und weiteren Elementen naturnaher Gärten. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
23 Die Kräuterspirale birgt auf kleinem Raum eine Fülle unterschiedlicher Küchenpflanzen mit spezifischen Standortansprüchen. Auf Lehrtafeln werden verschiedene Elemente naturnaher Gärten erklärt (Foto: M. Hedemann). Kontakt Koordinierungsstelle der Landschaftspflegeverbände in Mecklenburg-Vorpommern bei der Landesforst M-V -AöR- Harald Menning und Marie Hedemann Fritz-Reuter-Platz Malchin 5.6 Sachsen Wasserwissen für Jedermann Bildungsprojekt des Landschaftspflegeverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kann erfolgreiche Bilanz ziehen! In den Jahren hat der LPV Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit zahlreichen Veranstaltungen Wissen über den einzigartigen Lebensraums Bach vermittelt. Unter anderem fanden 10 Aktions- und Infotage, mehr als 40 Projekttage an Schulen, Ausstellungen, Bachpatenschaften, Schülerwettbewerbe, Fachveranstaltungen und exkursionen statt. Das Ziel des Projektes wurde erreicht: Verständnis und Akzeptanz für den Schutz der kleinen Fließgewässer konnten vergrößert werden und Kinder wie auch Erwachsene, Kommunen, Landeigentümer und -bewirtschafter, Vereine und weitere Interessierte im ländlichen Raum wurden zum aktiven Handeln für Ihren Bach vor der Haustür aktiviert. Am renaturierten Abschnitt des Pfaffengrundwassers in Stolpen/OT Helmsdorf informierte der Landschaftspflegeverband am 11. August 2014 zu den Ergebnissen der umfangreichen Bildungsarbeit. Mit der öffentlichen Vorstellung des Projekthandbuches WIR FÜR LEBENDIGE BÄCHE Entdecken, Informieren, Vernetzen, Handeln wurde das Projekt offiziell beendet. Zu Gast waren neben Vertretern des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft und der Stadtverwaltung Stolpen auch die Abgeordneten des Sächsischen Landtages Andrea Dombois und Jens Michel. Sie brachten ihre Anerkennung für die umfangreiche und praxisbezogene Öf- Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
24 fentlichkeitsarbeit zum Ausdruck und betonten die Wichtigkeit des kooperativen Ansatzes der Landschaftspflegeverbände im Zusammenspiel von Naturschutz, Kommunalpolitik und Landwirtschaft. Ines Thume vom LPV erläutert die Maßnahmen am Pfaffengrundwasser (v.l. Ines Thume, LPV; Karsten Bär, Bauernzeitung; Sandra Nicolai, Flächeneigentümerin; Jens Michel, MdL; Cordula Jost, LPV; Andrea Dombois, MdL; Jörg Rutscher, Stadtverwaltung Stolpen ) Foto: DVL-Landesverband Das Projekthandbuch gibt Empfehlungen zu praktischen Maßnahmen für einen nachhaltigen Schutz und die Entwicklung der kleinen Bäche, sechs beispielhafte Renaturierungsvorhaben im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und eine Übersicht der vielschichtigen Aktivitäten in der Projektlaufzeit werden dargestellt. Kontakt LPV Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.v. Ines Thume Tel thume@lpv-osterzgebirge.de Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
25 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung: Streuobst-Aktivitäten tragen Früchte! Einen wesentlichen Schwerpunkt beim Erhalt von Streuostbeständen bilden der richtige Schnitt der Obstbäume und eine angepasste Bewirtschaftung der Wiesen. Der LPV Nordwestsachsen legte deshalb in den vergangenen 4 Jahren einen Schwerpunkt seiner Arbeit im Bereich Streuobst auf die Etablierung von Schnitt-und Veredlungsseminare sowie die Gewinnung und Vernetzung von Kooperationspartnern. Begonnen wurde 2011 mit einem einzigen Seminar zum Obstbaumschnitt werden in der Region mittlerweile 20 Veranstaltungen zu Schnitt- und Veredlungstechniken angeboten, u.a. auch zum wenig bekannten Sommerschnitt! Das Informationsangebot wurde im Herbst 2014 erstmals um ein Obstbaum-Pflanzseminar erweitert, und 2015 kommt ein Anfängerkurs zur Sortenbestimmung dazu, der in Kooperation mit dem Pomologenverband Sachsen und der Prüfstelle des Bundesortenamtes in Wurzen durchgeführt wird. Weitere Kooperationspartner fand der LPV z.b. in den Volkshochschulen im Landkreis Leipzig sowie in mehreren regionalen Baumschulen. Obstbaumschnittseminar mit dem Bundessortenamt Auf diese Weise ist dem LPV gelungen, in der Region Nordsachsen ein Netzwerk an Akteuren aufzubauen - eine Arbeit, die nun im doppelten Sinn des Wortes reichlich Früchte trägt! Das Projekt des LPV zur Öffentlichkeitsarbeit Streuobst wurde aus Mittel der EU und des Freistaates Sachsen gefördert (Richtlinie NE/ 2007). Kontakt LPV Nordwestsachsen e.v. Veronika Leißner Tel / info@lpv-nordwestsachsen.de Artenschutzmaßnahmen für den Heldbock werden umgesetzt! Der LPV Torgau- Oschatz widmet sich seit 2013 in einem Projekt (gefördert über die Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2007) dem Erhalt von Lebensräumen für den Heldbock (Cerambyx cerdo) Im Elbtal befindet sich das größte und fast auch einzige Vorkommen dieses Käfers in Sachsen, der zu den größten und streng geschützten Käferarten des Freistaats zählt. Darüber hinaus genießt der Heldbock auch europarechtlichen Schutz in der FFH-Richtlinie. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
26 Auf der Grundlage von Fachdaten zu den aktuellen Vorkommen des Käfers übernahm der LPV die Planung und Organisation der praktischen Artenschutzmaßnahmen. So wurden zur Verbesserung des Mikroklimas Auslichtungsmaßnahmen an vorhandenen Eichenbeständen oder Einzelbäumen vorgenommen. Außerdem erfolgten, aufgrund der Standorttreue der Käfer, Neupflanzungen von Stiel- Eichen, um Lücken in vorhandenen Beständen zu schließen und mithilfe der künftigen Brutbäume den Fortbestand des Artvorkommens für die nächsten Generationen zu sichern. Kontakt LPV Torgau- Oschatz e.v. Cordula Volkmer Tel.: 03421/ Regionale Kreisläufe für gebietseigene Gehölze kommen in Schwung! Lebensräume und Biotopverbünde wie Hecken und Feldgehölze völlig neu zu schaffen, z.b. auf Ackerland, zählt zu den freudvollen Aufgaben der Landschaftspfleger. Hat man dabei doch das Gefühl, der Landschaft etwas zurückzugeben. Wenn es dann noch gelingt, etwas verloren Gegangenes wieder anzusiedeln, ist das schon eine kleine Sensation! Im April 2015 pflanzten die Mitarbeiter des LPV Mittleres Erzgebirge e.v. die ersten 120 Individuen des, im Mittleren Erzgebirge in den 1990er Jahren verschollenen Purgier-Kreuzdornes (Rhamnus cathartica). Weitere Pflanzungen sind ab Herbst geplant.. Die früher als Färbemittel ( Saftgrün ) für Textilien und Malerei verwendete Pflanze mit den abführend (purgierend) wirkenden Steinfrüchten ist in ganz Sachsen im Rückgang. Rhamnus cathartica-pflanzen mit Etikett in der Baumschule Meile Bei den jungen Sträuchern handelt es sich um nach dem Qualitätsprogramm VWW-Regiogehölze zertifiziertes gebietseigenes Pflanzgut, das aus Saatgut herangezogen wurde, welches der LPV in anerkannten autochthonen Natur-Vorkommen des Vogtlandes 2012 gewann. Die Verschulung erfolgte in einer regionalen Baumschule im Osterzgebirge unter vergleichbaren klimatischen und edaphischen Bedingungen wie am Pflanzstandort. Herkunft, Produktion und Verwendung bleiben somit prüf- und nachvollziehbar. Pflanzung des Kreuzdornes im Mittleren Erzgebirge April 2015 Dieser Erfolg ist ein schönes Beispiel für den Produktions-Grundsatz aus der Region in der Region für die Region und für die Verknüpfung von Landschaftspflege und Artenschutz! Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
27 Kontakt LPV Mittleres Erzgebirge Thomas Prantl Tel / DVL-Projektbüro DiverGen René Schubert Tel / DVL- Landesverband Sachsen Christina Kretzschmar Lange Str. 43, Pirna Tel / Schleswig-Holstein Lokale Aktionen - Alles auf Neustart Der Eintritt in die neue ELER-Förderperiode hatte auch für die Lokalen Aktionen, die Landschaftspflegeverbände in Schleswig-Holstein, erhebliche Konsequenzen. Die Lokalen Aktionen bekamen zwar bereits in der letzten Förderperiode eine ELER-Förderung, aufgrund der Verzögerungen beim Übergang in die aktuelle Förderperiode trat aber eine Finanzierungslücke auf, die dankenswerter Weise aus Landesmitteln überbrückt werden konnte. Auf Grundlage des im Frühling 2015 genehmigten Landesprogramms für den ländlichen Raum (LPLR) erweitert sich in der neuen Förderperiode nun das Aufgabenfeld der Lokalen Aktionen. Neben der Fortführung der Managementplanung und Maßnahmenumsetzung in Natura-2000-Gebieten haben die Landschaftspflegeverbände als neue Aufgabe die Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betriebe hinzubekommen. Die Lokalen Aktionen sind für diese Aufgabe prädestiniert, da die Vereine mit ihren Netzwerken im ländlichen Raum in der Regel bereits an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Naturschutz gearbeitet haben. Die Artenagentur und Koordinierungsstelle des DVL in Schleswig-Holstein haben für den Einstieg in dieses Themenfeld bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet, so dass sie die Lokalen Aktionen mit Rat und Tat bei dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützen können. Auf der Basis eines Förderbescheids für die nächsten 3 Jahre haben inzwischen alle Lokalen Aktionen ihre Geschäftsstellen ab dem meist mit den alten Mitarbeitern wieder besetzt und können sich nun mit voller Kraft ihren alten und neuen Aufgaben widmen. Artenreiches Grünland im Fokus Anfang 2014 wurde, angegliedert an die Koordinierungsstelle, ein zweijähriges Pilotprojekt zur Entwicklung von Strategien zum Erhalt von artenreichem Grünland ( Wertgrünland ) gestartet. In der bisherigen Projektlaufzeit haben die Mitarbeiter Leif Sönnichsen (bis ), Christoph Gasse und Jan-Marcus Carstens wichtige Erkenntnisse zur Situation des Wertgrünlandes gesammelt. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Flächenumfang dieser Grünlandtypen in Schleswig-Holstein drastisch zurückgegangen. Während im artenreichen, nassen Grünland (Nassgrünland, meist auf Moorböden) die Zeit der großen Flächenverluste bereits in den vergangenen Jahrzehnten lag, finden Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
28 im sogenannten arten- und strukturreichen Dauergrünland, dem artenreichen Grünland auf eher mineralischen Böden, die Abnahmen aktuell statt. Allein 16 % der 2012 kartierten Probeflächen waren 2014 verschwunden. Bei einer solchen Abnahme des Wertgrünlandes ist es offensichtlich, dass neben den klassischen Instrumenten wie dem Vertragsnaturschutz offenbar neue Strategien notwendig sind, um die Verluste zu stoppen oder sogar eine Trendumkehr zu erreichen. Artenagentur stellt sich noch breiter auf Eine Kernaufgabe der Artenagentur ist die Erarbeitung von Schutzkonzepten für Arten, die nach dem Artenhilfsprogramm Schleswig-Holstein einer besonderen Beachtung bedürfen. Die Methoden, hier zu Erfolgen zu kommen, sind sehr unterschiedlich. Ein Weg sind direkte Artenschutzmaßnahmen, zu denen beispielsweise die Wiederansiedlungen gefährdeter Pflanzenarten gehören. Das neuste Projekt in diesem Bereich widmet sich dem Baltischen Enzian, von dem es aktuell nur noch einen Standort im Lande gibt, und für dessen Erhalt Schleswig-Holstein eine bundesweite Verantwortung besitzt. Andere, noch weiter verbreitete Arten, wie z.b. die Feldvögel, lassen sich nur indirekt durch Lebensraumverbesserungen in ihren Beständen sichern. Die Artenagentur hat sich deshalb auch im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern und Projektträgern intensiv mit der Konzeption neuer Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Ackerbereich befasst. Aus der Projektarbeit sind mehrere Programmvarianten entstanden, die in das LPLR für die Förderperiode aufgenommen wurden (Vertragsmuster Kleinteiligkeit im Ackerbau, Milan-Variante und Bienenweide als Module im Vertragsmuster Ackerlebensräume ). Besichtigung von Vertragsflächen des Programms Kleinteiligkeit im Ackerbau das neue Vertragsmuster richtet sich speziell an Ökobetriebe und beinhaltet die kleinteilige Bewirtschaftung mit unterschiedlichen Kulturarten sowie Vorgaben zum Umfang an Leguminosen und Brach-/Blühflächen. Die Artenagentur hat im Berichtszeitraum an 35 Projekten zum Artenschutz gearbeitet. Als zukünftiger neuer Arbeitsschwerpunkt ist in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle und den Lokalen Aktionen die Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betriebe vorgesehen (siehe oben). Auf Grundlage des LPLR kann die Artenagentur zum Herbst 2015 voraussichtlich über eine ELER-Förderung kofinanziert werden. Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
29 Kontakt Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) Uwe Dierking, Detlev Finke, Dr. Helge Neumann, Dr. Wiebke Sach, Christoph Gasse, Jan-Markus Carstens Hamburger Chaussee Flintbek Thüringen Umsetzung FFH-Managementpläne - kooperativ Durch zunehmende Verbuschung wurden in den letzten Jahren immer mehr naturschutzfachlich wertvolle Flächen aus der landwirtschaftlichen Förderung herausgenommen. Diese Flächen werden damit unattraktiv für die Weidehaltung. Um diesem Trend entgegenzuwirken und die tiergebundenen Landschaftspflege in der Region zu erhalten startete der DVL das Projekt Umsetzung FFH- Managementpläne - kooperativ". Im FFH-Gebiet 8 NSG Alter Stolberg im Norden Thüringens soll die Umsetzung von FFH-Managementplänen modellhaft entwickelt und erprobt werden. Gemeinsam mit den Landnutzern werden Maßnahmen entwickelt, die in den jährlichen Betriebsablauf integriert werden. So kann eine langfristige Umsetzung gewährleistet werden. Bevor die Flächen allerdings wieder bewirtschaftet und gefördert werden können, müssen sie zunächst entbuscht werden. Dies übernimmt der Landschaftspflegeverband Südharz/ Kyffhäuser. Beweidung im FFH-Gebiet 8 NSG Alter Stolberg. (Foto: Gerhard Gramm-Wallner) Erste Projektergebnisse zeigen, dass die im FFH-Gebiet tätigen Landwirte bei der Erstellung des FFH- Managementplans nur sehr eingeschränkt einbezogen worden waren. Deshalb soll für die Landwirtschaftsbetriebe ein Handbuch entwickelt werden. Es soll über den Managementplan informieren und Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
30 die FFH-Lebensraumtypen und Bewirtschaftungsmöglichkeiten beschreiben. Das Projekt wird über die FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen (FILET) aus ELER- Mitteln der Europäischen Union und Landesmitteln des Freistaates Thüringen kofinanziert und wird durch das DVL Projektbüro Thüringen umgesetzt. Vorortabstimmung mit der Agrargenossenschaft Buchholz (Foto: Rolf Schiffler) Neue Perspektiven für die Landschaftspflegeverbände Thüringens Im Ergebnis der letzten Landtagswahlen im September 2014 hat die neue rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen damit begonnen ihre Ziele umzusetzen. Im Koalitionsvertrag der drei Parteien wurde formuliert, dass sich die Thüringer Naturschutzpolitik künftig stärker der Umsetzung von Natura 2000, also der Erhaltung und Verbesserung der Situation in den Natura 2000-Gebieten und der Anhang-Arten der FFH-Richtlinie, zuwenden soll. Dafür soll ein System von Biologischen Stationen nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen geschaffen werden. Die Landschaftspflegeverbände in Thüringen mit ihrer seit über 20 Jahren praktizierten Drittelparität in der Vorstandschaft streben in ihren Wirkungsgebieten die Trägerschaft der Biologischen Stationen an. Dazu wurden in enger Abstimmung mit den sieben Landschaftspflegeverbänden mit allen Fraktionen im Thüringer Landtag Gespräche geführt. Zudem stimmt sich die DVL-Koordinierungsstelle mit den Thüringer Naturschutzverbänden dahingehend ab, dem Umweltministerium ein abgestimmtes Konzept zur Installation eines Systems der Biologischen Stationen vorzulegen. Kontakt DVL Projektbüro Thüringen Gerhard Gramm-Wallner Alfred-Hess-Straße Erfurt Tel.: 0361/ gramm-wallner@lpv.de Geschäftsbericht Juni 2014 bis Juni von 32
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern
 Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ländliche Entwicklung (ELER) in Bayern 1. Juni 2015, Brüssel Anton Dippold Umsetzung der ELER-VO in Bayern Die Umsetzung der ELER-Förderung erfolgt
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg Aufgaben, Organisation, Finanzierung
 Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg Aufgaben, Organisation, Finanzierung Vortrag bei der Informationsveranstaltung des Landratsamts Biberach am 06.11.2012 1 Gliederung Landschaftserhaltungsverbände
Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg Aufgaben, Organisation, Finanzierung Vortrag bei der Informationsveranstaltung des Landratsamts Biberach am 06.11.2012 1 Gliederung Landschaftserhaltungsverbände
Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern
 Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern Wolfram Güthler Referat 64 Landschaftspflege und Naturschutzförderung Schneverdingen, den 28.09.2010 Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche Landwirtschaftliche
Lebensraum Feldflur Beispiele aus Bayern Wolfram Güthler Referat 64 Landschaftspflege und Naturschutzförderung Schneverdingen, den 28.09.2010 Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche Landwirtschaftliche
Lust auf ein Open-Air-Semester?
 Lust auf ein Open-Air-Semester? Das Commerzbank-Umweltpraktikum in einem Nationalpark, Naturpark oder Biosphärenreservat bringt frischen Wind ins Studium. Mensch und Natur im Einklang Das Commerzbank-Umweltpraktikum
Lust auf ein Open-Air-Semester? Das Commerzbank-Umweltpraktikum in einem Nationalpark, Naturpark oder Biosphärenreservat bringt frischen Wind ins Studium. Mensch und Natur im Einklang Das Commerzbank-Umweltpraktikum
Wie ist so ein Programm entstanden?
 Wie ist so ein Programm entstanden? Politische Stimmung erzeugen Mögliche Maßnahmen: Durch eine Anhörung im Fachausschuss zum Thema Biodiversität Naturverbänden z.b. BUND, Nabu Fachverwaltung Stadt UNB
Wie ist so ein Programm entstanden? Politische Stimmung erzeugen Mögliche Maßnahmen: Durch eine Anhörung im Fachausschuss zum Thema Biodiversität Naturverbänden z.b. BUND, Nabu Fachverwaltung Stadt UNB
Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen. Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne. Strategische Überlegungen zum Politikfeld
 Adenauer-Gespräch im Lindenhof am 27.02.2012 Die Thüringer Landesentwicklung aktiv gestalten! Strategische Überlegungen zum Politikfeld Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen Prof. Dr.
Adenauer-Gespräch im Lindenhof am 27.02.2012 Die Thüringer Landesentwicklung aktiv gestalten! Strategische Überlegungen zum Politikfeld Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen Prof. Dr.
Umweltverbände gemeinsam aktiv. Adrian Johst Geschäftsführer Naturstiftung David / Koordinator DNR-Strategiegruppe Naturschutzflächen
 Umweltverbände gemeinsam aktiv für das Nationale Naturerbe Adrian Johst Geschäftsführer Naturstiftung David / Koordinator DNR-Strategiegruppe Naturschutzflächen Was ist das Nationale Naturerbe? Einerseits:
Umweltverbände gemeinsam aktiv für das Nationale Naturerbe Adrian Johst Geschäftsführer Naturstiftung David / Koordinator DNR-Strategiegruppe Naturschutzflächen Was ist das Nationale Naturerbe? Einerseits:
Demografischer Wandel im ländlichen Raum
 Demografischer Wandel im ländlichen Raum Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Lebenswelt Dorf und die dörflichen Lebensstile 1 Der Wettbewerb - seit 2005 unter dem Motto Unser Dorf hat Zukunft
Demografischer Wandel im ländlichen Raum Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Lebenswelt Dorf und die dörflichen Lebensstile 1 Der Wettbewerb - seit 2005 unter dem Motto Unser Dorf hat Zukunft
ESF-Förderprogramm Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand. Bundesministerium für Arbeit und Soziales -CarloManuelDrauth-
 ESF-Förderprogramm Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand Bundesministerium für Arbeit und Soziales -CarloManuelDrauth- Warum eine Nationale CSR-Strategie? CSR trägt zur Bewältigung gesellschaftlicher
ESF-Förderprogramm Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand Bundesministerium für Arbeit und Soziales -CarloManuelDrauth- Warum eine Nationale CSR-Strategie? CSR trägt zur Bewältigung gesellschaftlicher
FAQs zum Wertebündnis Bayern
 FAQs zum Wertebündnis Bayern 1. Was ist das Wertebündnis Bayern? 2. Welche Zielsetzung hat das Wertebündnis Bayern? 3. Welche Werte sollen den Kindern und Jugendlichen schwerpunktmäßig vermittelt werden?
FAQs zum Wertebündnis Bayern 1. Was ist das Wertebündnis Bayern? 2. Welche Zielsetzung hat das Wertebündnis Bayern? 3. Welche Werte sollen den Kindern und Jugendlichen schwerpunktmäßig vermittelt werden?
Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie
 Regierungspräsidium Darmstadt Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie unter Verwendung einer Präsentation des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Kreiskonferenz Groß-Gerau, 27. Mai
Regierungspräsidium Darmstadt Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie unter Verwendung einer Präsentation des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Kreiskonferenz Groß-Gerau, 27. Mai
Pläne des BMELV zur Förderung der. On-farm-Erhaltung
 Pläne des BMELV zur Förderung der Mustertext Mustertext On-farm-Erhaltung Dr. Thomas Meier Referat 522: Biologische Vielfalt und Biopatente Mustertext 2 Internationale Zusammenarbeit 3 Internationaler
Pläne des BMELV zur Förderung der Mustertext Mustertext On-farm-Erhaltung Dr. Thomas Meier Referat 522: Biologische Vielfalt und Biopatente Mustertext 2 Internationale Zusammenarbeit 3 Internationaler
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
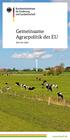 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gefördert durch: Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Österreich
 ECOCAMPING Rheinland-Pfalz und Saarland (Mai 2009 - Dezember 2010) Erweiterung und Konsolidierung des ECOCAMPING Netzwerks in Rheinland-Pfalz und Saarland. Ein Projekt von: Verband der Campingunternehmer
ECOCAMPING Rheinland-Pfalz und Saarland (Mai 2009 - Dezember 2010) Erweiterung und Konsolidierung des ECOCAMPING Netzwerks in Rheinland-Pfalz und Saarland. Ein Projekt von: Verband der Campingunternehmer
Implementierung von Pflegestützpunkten in den Bundesländern Sachstand vom
 Baden-Württemberg Die wurde am 22. Januar 2010 unterzeichnet und ist am 31. März 2010 in Kraft Ein ist wegen der guten Beziehungen derzeit nicht geplant. Stattdessen wurde am 15. Dezember 2008 auf Landesebene
Baden-Württemberg Die wurde am 22. Januar 2010 unterzeichnet und ist am 31. März 2010 in Kraft Ein ist wegen der guten Beziehungen derzeit nicht geplant. Stattdessen wurde am 15. Dezember 2008 auf Landesebene
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Schleswig-Holstein
 Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Flächenbelegung durch Energiepflanzenanbau in Dipl. Ing. agr. Sönke Beckmann Sönke Beckmann 1 Ziele des europäischen Naturschutzes Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Erhaltung der natürlichen
Postfach Stuttgart FAX: 0711/ oder 2379 (Presse)
 MINISTERIUM FÜR L ÄND LICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ B ADEN-WÜRTTEMBERG Postfach 10 34 44 70029 Stuttgart E-Mail: poststelle@mlr.bwl.de FAX: 0711/126-2255 oder 2379 (Presse) An den Präsidenten des Landtags
MINISTERIUM FÜR L ÄND LICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ B ADEN-WÜRTTEMBERG Postfach 10 34 44 70029 Stuttgart E-Mail: poststelle@mlr.bwl.de FAX: 0711/126-2255 oder 2379 (Presse) An den Präsidenten des Landtags
Stefan Bischoff (ISAB GmbH)
 Eine für alle alle für eine? Engagementfördernde Infrastruktureinrichtungen zwischen Konkurrenz und Kooperation Fachtagung des Landesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement Bayern und der BAGFA am 05.05.2015
Eine für alle alle für eine? Engagementfördernde Infrastruktureinrichtungen zwischen Konkurrenz und Kooperation Fachtagung des Landesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement Bayern und der BAGFA am 05.05.2015
Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs
 Tagung der Heinrich Böll Stiftung Kommunen gehen voran: Rio 20+ 2. März 2012 in Stuttgart Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs Gregor Stephani Leiter des Referats Grundsatzfragen
Tagung der Heinrich Böll Stiftung Kommunen gehen voran: Rio 20+ 2. März 2012 in Stuttgart Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs Gregor Stephani Leiter des Referats Grundsatzfragen
Gemeinsam die Zukunft des Naturparks Südeifel gestalten!
 Gemeinsam die Zukunft des Naturparks Südeifel gestalten! Naturpark Südeifel 1958 gegründet Erster Naturpark in Rheinland-Pfalz Zweiter Naturpark in Deutschland deutscher Teil des Deutsch-Luxemburgischen
Gemeinsam die Zukunft des Naturparks Südeifel gestalten! Naturpark Südeifel 1958 gegründet Erster Naturpark in Rheinland-Pfalz Zweiter Naturpark in Deutschland deutscher Teil des Deutsch-Luxemburgischen
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt. Katrin Anders Nachhaltigkeits- und Projektmanagement im Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode
 Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt Katrin Anders Nachhaltigkeits- und Projektmanagement im Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode Wernigerode Die bunte Stadt am Harz 34.000 Einwohner
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt Katrin Anders Nachhaltigkeits- und Projektmanagement im Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode Wernigerode Die bunte Stadt am Harz 34.000 Einwohner
Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen
 Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen Dipl. Ing. agr Gerd Ostermann Agrarreferent NABU Rheinland- Pfalz Ausgangssituation Etwa
Praxisbeispiele und Visionen zur nachhaltigen Entwicklung unserer Kulturlandschaft durch Bodenordnungsmaßnahmen Dipl. Ing. agr Gerd Ostermann Agrarreferent NABU Rheinland- Pfalz Ausgangssituation Etwa
Ländliche Regionalentwicklung In Schleswig-Holstein. Initiative AktivRegion :
 Ländliche Regionalentwicklung In Schleswig-Holstein Initiative AktivRegion : flächendeckende Umsetzung des LEADER-Konzeptes im Rahmen der neuen EU-Förderperiode ELER von 2007 bis 2013 Stand: Oktober 2006
Ländliche Regionalentwicklung In Schleswig-Holstein Initiative AktivRegion : flächendeckende Umsetzung des LEADER-Konzeptes im Rahmen der neuen EU-Förderperiode ELER von 2007 bis 2013 Stand: Oktober 2006
Leitbild der Verbraucherzentrale Bayern
 Leitbild der Verbraucherzentrale Bayern Die Verbraucherzentrale Bayern ist ein unabhängiger, überwiegend öffentlich finanzierter und gemeinnütziger Verein. Mitglieder sind verbraucherorientierte Verbände.
Leitbild der Verbraucherzentrale Bayern Die Verbraucherzentrale Bayern ist ein unabhängiger, überwiegend öffentlich finanzierter und gemeinnütziger Verein. Mitglieder sind verbraucherorientierte Verbände.
Ausstellung "Auf dem Weg zur kinderfreundlichen Stadt"
 Ausstellung "Auf dem Weg zur kinderfreundlichen Stadt" In deiner Stadt leben zur Zeit 5479 Kinder und Jugendliche, das sind über 18 %. Also fast 2 von 10 Menschen in Weil am Rhein sind unter 18 Jahren
Ausstellung "Auf dem Weg zur kinderfreundlichen Stadt" In deiner Stadt leben zur Zeit 5479 Kinder und Jugendliche, das sind über 18 %. Also fast 2 von 10 Menschen in Weil am Rhein sind unter 18 Jahren
Projekt Lernort Bauernhof
 Projekt Lernort Bauernhof Projektabschlussbericht MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM, Name des Projekts: Lernort Bauernhof Themenfeld: Bildung und Wissen als Motoren für eine nachhaltige Entwicklung Vorsitzende(r):
Projekt Lernort Bauernhof Projektabschlussbericht MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM, Name des Projekts: Lernort Bauernhof Themenfeld: Bildung und Wissen als Motoren für eine nachhaltige Entwicklung Vorsitzende(r):
Sachsen Digital Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen. 28. Oktober 2016 Dresden
 Sachsen Digital Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen 28. Oktober 2016 Dresden Sachsen Digital Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen Kabinettsbeschluss: Januar 2016 Handlungsleitfaden
Sachsen Digital Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen 28. Oktober 2016 Dresden Sachsen Digital Die Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen Kabinettsbeschluss: Januar 2016 Handlungsleitfaden
Kommunikationsstrategie EFRE in Thüringen. Vorstellung und Diskussion des Entwurfs Sitzung des Begleitausschusses am
 EFRE 2014-2020 in Thüringen Vorstellung und Diskussion des Entwurfs Sitzung des Begleitausschusses am 26.02.15 1 1. Vorgaben aus den EU-Verordnungen für Mitgliedsstaaten bzw. Verwaltungsbehörden EU VO
EFRE 2014-2020 in Thüringen Vorstellung und Diskussion des Entwurfs Sitzung des Begleitausschusses am 26.02.15 1 1. Vorgaben aus den EU-Verordnungen für Mitgliedsstaaten bzw. Verwaltungsbehörden EU VO
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN
 BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
Naturschutz in Gemeinden
 Eine Pusch-Tagung Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden Montag, 19. September 2016, 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr, Volkshaus, Zürich PUSCH PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ Ökologische Infrastruktur:
Eine Pusch-Tagung Ökologische Infrastruktur: erfolgreicher Naturschutz in Gemeinden Montag, 19. September 2016, 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr, Volkshaus, Zürich PUSCH PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ Ökologische Infrastruktur:
Initiative energetische Gebäudesanierung. Eine Kooperation des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 Initiative energetische Gebäudesanierung Eine Kooperation des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.v. und der
Initiative energetische Gebäudesanierung Eine Kooperation des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.v. und der
Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler
 28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de
 Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Tourismus & biologische Vielfalt
 Tourismus & biologische Vielfalt Qualifizierung - Ausbildung - Qualitätssicherung Martina Porzelt, Verband Deutscher Naturparke (VDN) Qualitätsoffensive Naturparke mit Qualität zum Ziel, www.naturparke.de
Tourismus & biologische Vielfalt Qualifizierung - Ausbildung - Qualitätssicherung Martina Porzelt, Verband Deutscher Naturparke (VDN) Qualitätsoffensive Naturparke mit Qualität zum Ziel, www.naturparke.de
Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden -
 Strategien kommunaler Alkoholprävention in Niedersachsen Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden - Hans-Jürgen Hallmann g!nko - Landeskoordinierungsstelle
Strategien kommunaler Alkoholprävention in Niedersachsen Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden - Hans-Jürgen Hallmann g!nko - Landeskoordinierungsstelle
ETZ SK-AT DI Martina Liehl (Weinviertel Management)
 Ramsar Eco NaTour Projekt zur Förderung des Naturtourismus und zur Erhaltung und Verbesserung wertvoller Lebensräume in den March-Thaya-Auen und der Trockenlebensräume der Marchregion ETZ SK-AT 2007-2013
Ramsar Eco NaTour Projekt zur Förderung des Naturtourismus und zur Erhaltung und Verbesserung wertvoller Lebensräume in den March-Thaya-Auen und der Trockenlebensräume der Marchregion ETZ SK-AT 2007-2013
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
 Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung Das Programm in einem Satz: Mit dem Programm Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung fördert das BMBF außerschulische kulturelle Bildungsmaßnahmen für (bildungs)benachteiligte
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung Das Programm in einem Satz: Mit dem Programm Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung fördert das BMBF außerschulische kulturelle Bildungsmaßnahmen für (bildungs)benachteiligte
Die Umschichtung von Mitteln innerhalb der Direktzahlungen in die Förderprogramme Ländliche Entwicklung. Prof. Dr. Hubert Weiger
 1 Die Umschichtung von Mitteln innerhalb der Direktzahlungen in die Förderprogramme Ländliche Entwicklung Prof. Dr. Hubert Weiger 09.11.2006 2 Agrarhaushalt der EU für 2006 (EU25) Gesamtbetrag 54.771,9
1 Die Umschichtung von Mitteln innerhalb der Direktzahlungen in die Förderprogramme Ländliche Entwicklung Prof. Dr. Hubert Weiger 09.11.2006 2 Agrarhaushalt der EU für 2006 (EU25) Gesamtbetrag 54.771,9
Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung
 Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung in Bezug auf das Standortregister Der gesetzliche Rahmen 1 für Nutzer von gentechnisch veränderten
Informationsblatt für Bewirtschafter von GVO-Anbauflächen zur Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung in Bezug auf das Standortregister Der gesetzliche Rahmen 1 für Nutzer von gentechnisch veränderten
Nachhaltigkeit durch Förderung? Strategien der Agrarumweltförderung in Sachsen
 Nachhaltigkeit durch Förderung? Strategien der Agrarumweltförderung in Sachsen Jahrestagung der Landesarchäologen am 24. Mai 2011 in Meißen Ziele der EU aus Lissabon- und Göteborgstrategie Wettbewerb+Beschäftigung
Nachhaltigkeit durch Förderung? Strategien der Agrarumweltförderung in Sachsen Jahrestagung der Landesarchäologen am 24. Mai 2011 in Meißen Ziele der EU aus Lissabon- und Göteborgstrategie Wettbewerb+Beschäftigung
AUFBAU EINER STRATEGIE FÜR MEHR GESUNDHEITLICHE CHANCENGLEICHHEIT IN DEUTSCHLAND
 AUFBAU EINER STRATEGIE FÜR MEHR GESUNDHEITLICHE CHANCENGLEICHHEIT IN DEUTSCHLAND Erster Schritt: Kommunale Präventionsketten "Gesund aufwachsen für alle" Dr. Frank Lehmann, Bundeszentrale für gesundheitliche
AUFBAU EINER STRATEGIE FÜR MEHR GESUNDHEITLICHE CHANCENGLEICHHEIT IN DEUTSCHLAND Erster Schritt: Kommunale Präventionsketten "Gesund aufwachsen für alle" Dr. Frank Lehmann, Bundeszentrale für gesundheitliche
AGORANATURA NaturMarkt
 1/14 AGORANATURA NaturMarkt Projektpartner gefördert durch Projektträger 2/14 Initialisierung eines virtuellen Marktplatzes für den Verkauf von Ökosystemleistungen (ÖSL) und Biodiversität Quantifizierung
1/14 AGORANATURA NaturMarkt Projektpartner gefördert durch Projektträger 2/14 Initialisierung eines virtuellen Marktplatzes für den Verkauf von Ökosystemleistungen (ÖSL) und Biodiversität Quantifizierung
GEMEINDE- UND STÄDTEBUND THÜRINGEN
 GEMEINDE- UND STÄDTEBUND THÜRINGEN Vorstellung des Gemeinde-und Städtebundes Thüringen im Thüringer Gewässerbeirat am 3. Dezember 2014 Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen Der Gemeinde- und Städtebund
GEMEINDE- UND STÄDTEBUND THÜRINGEN Vorstellung des Gemeinde-und Städtebundes Thüringen im Thüringer Gewässerbeirat am 3. Dezember 2014 Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen Der Gemeinde- und Städtebund
Innovative Hochschule Eine Förderinitiative von Bund und Ländern
 Innovative Hochschule Eine Förderinitiative von Bund und Ländern BMBF, Referat Neue Instrumente und Programme der Innovationsförderung www.bmbf.de Informationsveranstaltung zur neuen Förderinitiative Innovative
Innovative Hochschule Eine Förderinitiative von Bund und Ländern BMBF, Referat Neue Instrumente und Programme der Innovationsförderung www.bmbf.de Informationsveranstaltung zur neuen Förderinitiative Innovative
Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik
 Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik Timo Kaphengst Ecologic Institut Berlin 1 Inhalt Kurzer Überblick über die Gemeinsame Agrarpolitik
Möglichkeiten und bestehende Instrumente für eine Integration von Ökosystemleistungen in die Agrarpolitik Timo Kaphengst Ecologic Institut Berlin 1 Inhalt Kurzer Überblick über die Gemeinsame Agrarpolitik
Praxisnahe Zusammenarbeit mit Landwirten
 Praxisnahe Zusammenarbeit mit Landwirten Was ist für Landwirte wichtig und wie wirken Agrarumweltprogramme, Greening-Verpflichtungen und Beratung in der Praxis? Referentin: Natalie Meyer Michael-Otto-Institut
Praxisnahe Zusammenarbeit mit Landwirten Was ist für Landwirte wichtig und wie wirken Agrarumweltprogramme, Greening-Verpflichtungen und Beratung in der Praxis? Referentin: Natalie Meyer Michael-Otto-Institut
Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.v.
 LEV Erfahrungsbericht aus der Anfangsphase des LEV Landratsamt Biberach/Riß 06.11.2012 Übersicht 1. Der Ortenaukreis 2. Anlass / Gründungsphase 3. Mitglieder 4. Verbandsaufbau 5. Finanzen 6. Aufgaben LEV
LEV Erfahrungsbericht aus der Anfangsphase des LEV Landratsamt Biberach/Riß 06.11.2012 Übersicht 1. Der Ortenaukreis 2. Anlass / Gründungsphase 3. Mitglieder 4. Verbandsaufbau 5. Finanzen 6. Aufgaben LEV
Welchen Nutzen hat die Gesellschaft von mehr Natur und Wildnis am Gewässer?
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Welchen Nutzen hat die Gesellschaft von mehr Natur und Wildnis am Gewässer? Dr. Thomas Ehlert Bundesamt für Naturschutz, Fachgebiet II 3.2 Binnengewässer, Auenökosysteme
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Welchen Nutzen hat die Gesellschaft von mehr Natur und Wildnis am Gewässer? Dr. Thomas Ehlert Bundesamt für Naturschutz, Fachgebiet II 3.2 Binnengewässer, Auenökosysteme
Die Gemeinsame Agrarpolitik in Österreich im Zusammenhang mit der Initiative Unternehmen Landwirtschaft 2020
 Die Gemeinsame Agrarpolitik in Österreich im Zusammenhang mit der Initiative Unternehmen Landwirtschaft 2020 DDr. Reinhard Mang Generalsekretär des Lebensministeriums Jahrestagung Netzwerk Land 17. Oktober
Die Gemeinsame Agrarpolitik in Österreich im Zusammenhang mit der Initiative Unternehmen Landwirtschaft 2020 DDr. Reinhard Mang Generalsekretär des Lebensministeriums Jahrestagung Netzwerk Land 17. Oktober
Bundesprogramm Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit
 Das Bundesprogramm Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Das Bundesprogramm Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Die deutschen Berichte zu Natura 2000: Ergebnisse und Schlußfolgerungen
 Die deutschen Berichte zu Natura 2000: Ergebnisse und Schlußfolgerungen Frank Klingenstein Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit EIN Schutzinstrument der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie
Die deutschen Berichte zu Natura 2000: Ergebnisse und Schlußfolgerungen Frank Klingenstein Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit EIN Schutzinstrument der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt
 Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt Katrin Anders Nachhaltigkeits- und Projektmanagement im Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode Naturschutzkonferenz Sachsen-Anhalt 11.10.2014 Wernigerode
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt Katrin Anders Nachhaltigkeits- und Projektmanagement im Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode Naturschutzkonferenz Sachsen-Anhalt 11.10.2014 Wernigerode
URBACT III Nationaler Infotag Deutschland. Essen, 15. September 2014
 URBACT III Nationaler Infotag Deutschland Essen, 15. September 2014 URBACT III Nach URBACT I (2002-2006) und URBACT II (2007-2013) Europäisches Programm der territorialen Zusammenarbeit 2014-2020 Finanziert
URBACT III Nationaler Infotag Deutschland Essen, 15. September 2014 URBACT III Nach URBACT I (2002-2006) und URBACT II (2007-2013) Europäisches Programm der territorialen Zusammenarbeit 2014-2020 Finanziert
Europas Naturerbe sichern - Bayern als Heimat bewahren NATURA 2000
 Europas Naturerbe sichern - Bayern als Heimat bewahren NATURA 2000 KURZINFORMATION zur Umsetzung der FFH- und der Vogelschutz- Richtlinie der Europäischen Union Bayerisches Staatsministerium für Landesentwickung
Europas Naturerbe sichern - Bayern als Heimat bewahren NATURA 2000 KURZINFORMATION zur Umsetzung der FFH- und der Vogelschutz- Richtlinie der Europäischen Union Bayerisches Staatsministerium für Landesentwickung
Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag)
 Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag) Projekttitel: Entwicklungsstudie Bretterschachten Antragsteller: Markt Bodenmais, Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais Gesamtkosten: ca. 20.000,- LAG: ARBERLAND
Projektbeschreibung (als Anlage zum Förderantrag) Projekttitel: Entwicklungsstudie Bretterschachten Antragsteller: Markt Bodenmais, Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais Gesamtkosten: ca. 20.000,- LAG: ARBERLAND
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm
 Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätsförderung auf dem Acker Perspektiven für die Umsetzung im künftigen ELER-Programm Tagung Bienenweiden, Blühflächen und Agrarlandschaft 26. / 27. November 2013, Berlin
LEBEN UND ERLEBEN IM MITTLEREN SCHWARZWALD DAS PORTAL FÜR FÖRDERPROGRAMME UND INNOVATIVE PROJEKTE IN DER REGION
 LEBEN UND ERLEBEN IM MITTLEREN SCHWARZWALD DAS PORTAL FÜR FÖRDERPROGRAMME UND INNOVATIVE PROJEKTE IN DER REGION ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben
LEBEN UND ERLEBEN IM MITTLEREN SCHWARZWALD DAS PORTAL FÜR FÖRDERPROGRAMME UND INNOVATIVE PROJEKTE IN DER REGION ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben
Überblick zur Förderung des Inlandstourismus in Deutschland
 Überblick zur Förderung des Inlandstourismus in Deutschland 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Überblick zur Förderung des Inlandstourismus in Deutschland Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 21.07.2016 Fachbereich:
Überblick zur Förderung des Inlandstourismus in Deutschland 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Überblick zur Förderung des Inlandstourismus in Deutschland Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 21.07.2016 Fachbereich:
Beiträge des Bundesprogramms Biologische Vielfalt zur Erhaltung von Auen und Gewässern
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Beiträge des Bundesprogramms Biologische Vielfalt zur Erhaltung von Auen und Gewässern Prof. Dr. Beate Jessel Bundesamt für Naturschutz Dialogforum "Bundesprogramm
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Beiträge des Bundesprogramms Biologische Vielfalt zur Erhaltung von Auen und Gewässern Prof. Dr. Beate Jessel Bundesamt für Naturschutz Dialogforum "Bundesprogramm
NATURA 2000 Umsetzung in Bayern
 NATURA 2000 Umsetzung in Bayern Runder Tisch am 23. Oktober 2006 zum Entwurf des Managementplans Giesenbacher Quellmoor FFH-Gebiet 7635-302 Regierung von Oberbayern Sachgebiet 51 Naturschutz NATURA 2000
NATURA 2000 Umsetzung in Bayern Runder Tisch am 23. Oktober 2006 zum Entwurf des Managementplans Giesenbacher Quellmoor FFH-Gebiet 7635-302 Regierung von Oberbayern Sachgebiet 51 Naturschutz NATURA 2000
Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege
 Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege anlässlich der Veranstaltung Abschlussveranstaltung des Caritasprojektes
Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege anlässlich der Veranstaltung Abschlussveranstaltung des Caritasprojektes
Nachhaltiges Landmanagement: Fördermaßnahmen für maßgeschneiderte Lösungen. Martin Scheele
 Nachhaltiges Landmanagement: Fördermaßnahmen für maßgeschneiderte Lösungen Martin Scheele GD Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung Europäische Kommission Herausforderungen und Chancen Habitate Artenvielfalt
Nachhaltiges Landmanagement: Fördermaßnahmen für maßgeschneiderte Lösungen Martin Scheele GD Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung Europäische Kommission Herausforderungen und Chancen Habitate Artenvielfalt
Heike Zellmer Regionalmanagerin Prignitz
 Heike Zellmer Regionalmanagerin Prignitz Lage des Landkreises Prignitz im Land Brandenburg: LAG Storchenland Prignitz deckungsgleich mit dem Landkreis Abgrenzung der Region:Die Region bewarb sich in ihren
Heike Zellmer Regionalmanagerin Prignitz Lage des Landkreises Prignitz im Land Brandenburg: LAG Storchenland Prignitz deckungsgleich mit dem Landkreis Abgrenzung der Region:Die Region bewarb sich in ihren
Die Förderung integrierter Stadtentwicklung im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds
 Die Förderung integrierter Stadtentwicklung im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 2014-2020 Erich Unterwurzacher Direktor in der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung
Die Förderung integrierter Stadtentwicklung im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 2014-2020 Erich Unterwurzacher Direktor in der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung
Staatliche Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten
 Staatliche Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten München, 19. Juni 2013 und Nürnberg, 20. Juni 2013 Familienbildung als Aufgabe der Kinder-
Staatliche Förderung der strukturellen Weiterentwicklung kommunaler Familienbildung und von Familienstützpunkten München, 19. Juni 2013 und Nürnberg, 20. Juni 2013 Familienbildung als Aufgabe der Kinder-
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück. Leitbild
 Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
Leitbild der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück Leitbild 2 Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein Text, in dem beschrieben wird, wie gehandelt werden soll. In einem sozialen Dienstleistungs-Unternehmen
Schule der Zukunft Bildung für Nachhaltigkeit
 Schule der Zukunft Bildung für Nachhaltigkeit 2009-2011 Eine Kampagne zur Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in NRW www.schule-der-zukunft.nrw.de Was wollen wir mit der Kampagne erreichen?
Schule der Zukunft Bildung für Nachhaltigkeit 2009-2011 Eine Kampagne zur Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in NRW www.schule-der-zukunft.nrw.de Was wollen wir mit der Kampagne erreichen?
Kommunalreform in Dänemark
 Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Konrad-Adenauer-Stiftung Politik und Beratung Kommunalreform in Dänemark Bericht Mehr Informationen unter www.politik-fuer-kommunen.de Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Hauptabteilung Politik und Beratung
Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen. Neues von der BAG LAG
 Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen Neues von der Chronologie.6.6 Gründung des e.v. mit 8 Gründungsmitgliedern in Göttingen 4.7.6 Einrichtung der -Geschäftsstelle der bei der Agrarsozialen
Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen Neues von der Chronologie.6.6 Gründung des e.v. mit 8 Gründungsmitgliedern in Göttingen 4.7.6 Einrichtung der -Geschäftsstelle der bei der Agrarsozialen
Das Konzept der Stadt Worms zur lokalen Anpassung an den Klimawandel. Abt Umweltschutz und Landwirtschaft
 Das Konzept der Stadt Worms zur lokalen Anpassung an den Klimawandel Abt. 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft Projektablauf Klimaanpassungskonzept 1. Risiko- und Vulnerabilitätsanalyse (Klima-Bündnis
Das Konzept der Stadt Worms zur lokalen Anpassung an den Klimawandel Abt. 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft Projektablauf Klimaanpassungskonzept 1. Risiko- und Vulnerabilitätsanalyse (Klima-Bündnis
Leitbild. Brandenburgischer Kurorte- und Bäderverband e.v. natürlich gesund
 Leitbild Brandenburgischer Kurorte- und Bäderverband e.v. natürlich gesund Das sind wir Wir sind der freiwillige Zusammenschluss aus Kur- und Erholungsorten sowie Gesundheitseinrichtungen. Der Brandenburgische
Leitbild Brandenburgischer Kurorte- und Bäderverband e.v. natürlich gesund Das sind wir Wir sind der freiwillige Zusammenschluss aus Kur- und Erholungsorten sowie Gesundheitseinrichtungen. Der Brandenburgische
Bewirtschaftung von FFH-Wiesen in Baden-Württemberg. im Rahmen von Natura 2000
 Bewirtschaftung von FFH-Wiesen in Baden-Württemberg im Rahmen von Natura 2000 Natura 2000 - was ist das? Europaweites Netz von Schutzgebieten Schutz von bestimmten Lebensräumen und Arten und damit Schutz
Bewirtschaftung von FFH-Wiesen in Baden-Württemberg im Rahmen von Natura 2000 Natura 2000 - was ist das? Europaweites Netz von Schutzgebieten Schutz von bestimmten Lebensräumen und Arten und damit Schutz
SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN. Programm Kinder- und Jugendpolitik Kanton Schaffhausen. Kurzfassung
 SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018 Kanton Schaffhausen Kurzfassung VORWORT Am 1. Januar 2013 trat das Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit
SCHÜTZEN FÖRDERN BETEILIGEN Programm Kinder- und Jugendpolitik 2016-2018 Kanton Schaffhausen Kurzfassung VORWORT Am 1. Januar 2013 trat das Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit
Vorstellung des BMBF-Programms. Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte
 Vorstellung des BMBF-Programms Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Agenda 1. Übergeordnete
Vorstellung des BMBF-Programms Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Agenda 1. Übergeordnete
Hessens Landkreise wollen gestalten statt verwalten
 Pressemitteilung Frankfurter Straße 2 65189 Wiesbaden Telefon (0611) 17 06-0 Durchwahl (0611) 17 06-12 Telefax-Zentrale (0611) 17 06-27 PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 PC-Fax-direkt (0611) 900 297-72
Pressemitteilung Frankfurter Straße 2 65189 Wiesbaden Telefon (0611) 17 06-0 Durchwahl (0611) 17 06-12 Telefax-Zentrale (0611) 17 06-27 PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 PC-Fax-direkt (0611) 900 297-72
Partizipation - Chancen und Hindernisse der gesellschaftlichen Teilhabe des BDAJ - Bayern. Gefördert von:
 Partizipation - Chancen und Hindernisse der gesellschaftlichen Teilhabe des BDAJ - Bayern Gliederung BDAJ-Bayern und seine strukturellen Ziele Partizipation und Engagement des BDAJ Förderliches und Hindernisse
Partizipation - Chancen und Hindernisse der gesellschaftlichen Teilhabe des BDAJ - Bayern Gliederung BDAJ-Bayern und seine strukturellen Ziele Partizipation und Engagement des BDAJ Förderliches und Hindernisse
Optimierung der Förderung ländlicher Räume aus Sicht des Bundes
 Optimierung der Förderung ländlicher Räume aus Sicht des Bundes Ralf Wolkenhauer Leiter der Unterabteilung Ländliche Räume, BMEL www.bmel.de Ländliche Räume in Deutschland umfassen rund 90 % der Fläche
Optimierung der Förderung ländlicher Räume aus Sicht des Bundes Ralf Wolkenhauer Leiter der Unterabteilung Ländliche Räume, BMEL www.bmel.de Ländliche Räume in Deutschland umfassen rund 90 % der Fläche
Ich für uns Dorothee Perrine Caring Community Seniorennetzwerk Heidenheim
 Ich für uns Caring Community Seniorennetzwerk in Agenda Was ist eine Caring Community? Bevölkerungsentwicklung in Situation in Trägernetzwerk Caring Community Best-Practice-Analyse in anderen Kommunen
Ich für uns Caring Community Seniorennetzwerk in Agenda Was ist eine Caring Community? Bevölkerungsentwicklung in Situation in Trägernetzwerk Caring Community Best-Practice-Analyse in anderen Kommunen
Mehr biologische Vielfalt in Luxemburg durch landwirtschaftliche Förderinstrumente
 Mehr biologische Vielfalt in Luxemburg durch landwirtschaftliche Förderinstrumente Pressekonferenz im Nachhaltigkeitsministerium Luxemburg, den 16.04.2012 Dipl. Biologin Nadja Kasperczyk 1 Gliederung Biologische
Mehr biologische Vielfalt in Luxemburg durch landwirtschaftliche Förderinstrumente Pressekonferenz im Nachhaltigkeitsministerium Luxemburg, den 16.04.2012 Dipl. Biologin Nadja Kasperczyk 1 Gliederung Biologische
Landschaftspflegeverband. Passau e. V.
 Landschaftspflegeverband Passau e. V. - pflegen - - erhalten - - schützen - Landschaft pflegen - erhalten schützen! Der Landschaftspflegeverband Passau ist ein gemeinnütziger Verein im Einsatz für den
Landschaftspflegeverband Passau e. V. - pflegen - - erhalten - - schützen - Landschaft pflegen - erhalten schützen! Der Landschaftspflegeverband Passau ist ein gemeinnütziger Verein im Einsatz für den
Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung. der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der EKHN 332 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Vom 14. Dezember 2006 (ABl.
Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der EKHN 332 Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Vom 14. Dezember 2006 (ABl.
Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014
 Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014 Greening ein neues Instrument der EU-Agrarpolitik Uta Maier (TLL) Jena, 17.06.2013 TLL Kolloquium Wirtschaftliche Lage / Aktuelle Fragen der Agrarpolitik
Aktuelle Fragen der Agrarpolitik/GAP-Reform ab 2014 Greening ein neues Instrument der EU-Agrarpolitik Uta Maier (TLL) Jena, 17.06.2013 TLL Kolloquium Wirtschaftliche Lage / Aktuelle Fragen der Agrarpolitik
Ehrenamtsagentur Jossgrund. Das gute Leben das Gute leben. Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14.
 Ehrenamtsagentur Jossgrund Das gute Leben das Gute leben Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14. März 2016 Das gute Leben das Gute leben 6 Kernsätze beschreiben das Selbstverständnis
Ehrenamtsagentur Jossgrund Das gute Leben das Gute leben Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14. März 2016 Das gute Leben das Gute leben 6 Kernsätze beschreiben das Selbstverständnis
Aktuelle Informationen zur Agrarförderung Auswertung Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau und Greening 2015/2016
 Aktuelle Informationen zur Agrarförderung Auswertung Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau und Greening 2015/2016 Irene Kirchner Referatsleiterin 32 im MLUL Auswertung AUKM und Greening
Aktuelle Informationen zur Agrarförderung Auswertung Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökologischer Landbau und Greening 2015/2016 Irene Kirchner Referatsleiterin 32 im MLUL Auswertung AUKM und Greening
Eine Stiftung für die Natur
 Zeit für die Natur Eine Stiftung für die Natur Die Liebe zur Natur, wie sie uns von Loki Schmidt vorgelebt wurde, prägt die Arbeit der Loki Schmidt Stiftung. Wir engagieren uns in Hamburg sowie deutschlandweit
Zeit für die Natur Eine Stiftung für die Natur Die Liebe zur Natur, wie sie uns von Loki Schmidt vorgelebt wurde, prägt die Arbeit der Loki Schmidt Stiftung. Wir engagieren uns in Hamburg sowie deutschlandweit
Kommunale Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Überblick und Rahmenbedingungen
 Kommunale Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Überblick und Rahmenbedingungen Annegret Engelke Referatsleiterin Naturschutz bei Planungen und Vorhaben Dritter Gebietsschutz Inhaltlicher Überblick Kurze Einführung
Kommunale Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Überblick und Rahmenbedingungen Annegret Engelke Referatsleiterin Naturschutz bei Planungen und Vorhaben Dritter Gebietsschutz Inhaltlicher Überblick Kurze Einführung
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen
 Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
In vier Workshops wurden durch die Teilnehmer des Seminars Probleme der Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen und Verbänden diskutiert.
 - 91 - Workshops In vier Workshops wurden durch die Teilnehmer des Seminars Probleme der Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen und Verbänden diskutiert. Dabei standen insbesondere folgende Fragen im Zentrum:
- 91 - Workshops In vier Workshops wurden durch die Teilnehmer des Seminars Probleme der Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen und Verbänden diskutiert. Dabei standen insbesondere folgende Fragen im Zentrum:
Organisation, Aufgaben und Finanzierung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland
 Organisation, Aufgaben und Finanzierung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland Informationsveranstaltung, 14.12.2005, Willebadessen, MDgt. Hans-Joachim Schreiber, Sprecher der AG BR, Mitglied
Organisation, Aufgaben und Finanzierung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland Informationsveranstaltung, 14.12.2005, Willebadessen, MDgt. Hans-Joachim Schreiber, Sprecher der AG BR, Mitglied
Kurzumtriebsplantagen (KUP) Nachhaltig erzeugte Biomasse zur langfristigen Absicherung des Brennstoffbedarfs
 Kurzumtriebsplantagen (KUP) Nachhaltig erzeugte Biomasse zur langfristigen Absicherung des Brennstoffbedarfs Ein erfolgreiches Kooperationsmodell zwischen Erzeuger und Verwerter seit 2010 Tobias Ehm Energy
Kurzumtriebsplantagen (KUP) Nachhaltig erzeugte Biomasse zur langfristigen Absicherung des Brennstoffbedarfs Ein erfolgreiches Kooperationsmodell zwischen Erzeuger und Verwerter seit 2010 Tobias Ehm Energy
Rede. des Geschäftsführers des Bündnisses für. Demokratie und Toleranz, Dr. Gregor Rosenthal,
 Rede des Geschäftsführers des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, Dr. Gregor Rosenthal, anlässlich der Preisverleihung Aktiv für Demokratie und Toleranz am 20. Februar 2009 in Dachau Es gilt das gesprochene
Rede des Geschäftsführers des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, Dr. Gregor Rosenthal, anlässlich der Preisverleihung Aktiv für Demokratie und Toleranz am 20. Februar 2009 in Dachau Es gilt das gesprochene
EU-Agrarpolitik bis 2020 (GAP) Betriebsprämie und Co.: Welche Eckdaten liegen für Bauern schon vor!
 EU-Agrarpolitik bis 2020 (GAP) Betriebsprämie und Co.: Welche Eckdaten liegen für Bauern schon vor! Sonder-AMK 4.11.2013 - Beschluss zur 1. Säule (Betriebsprämie) Kürzung der Direktzahlungen (Betriebsprämien)
EU-Agrarpolitik bis 2020 (GAP) Betriebsprämie und Co.: Welche Eckdaten liegen für Bauern schon vor! Sonder-AMK 4.11.2013 - Beschluss zur 1. Säule (Betriebsprämie) Kürzung der Direktzahlungen (Betriebsprämien)
I N F O R M A T I O N
 I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger am 2. September 2013 zum Thema "Buchpräsentation 'Bauernland Oberösterreich' Oö. Landwirtschaft So schaut's aus" Weiterer
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger am 2. September 2013 zum Thema "Buchpräsentation 'Bauernland Oberösterreich' Oö. Landwirtschaft So schaut's aus" Weiterer
Ehrenamtliches Engagement in Ahnatal
 Ehrenamtliches Engagement in Ahnatal Viele Menschen möchten sich gerne freiwillig engagieren, wissen jedoch oft nicht, wo ihre Hilfe gebraucht wird und an wen sie sich wenden können. Andererseits suchen
Ehrenamtliches Engagement in Ahnatal Viele Menschen möchten sich gerne freiwillig engagieren, wissen jedoch oft nicht, wo ihre Hilfe gebraucht wird und an wen sie sich wenden können. Andererseits suchen
Lokale Agenda 21 im Dialog
 Lokale Agenda 21 im Dialog die Zivilgesellschaft im Nachhaltigkeitsprozess Überblick Entstehungsgeschichte: Warum so starke Orientierung an der unorganisierten Zivilgesellschaft Ziele & Grundsätze Dialogorte
Lokale Agenda 21 im Dialog die Zivilgesellschaft im Nachhaltigkeitsprozess Überblick Entstehungsgeschichte: Warum so starke Orientierung an der unorganisierten Zivilgesellschaft Ziele & Grundsätze Dialogorte
Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hessen
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie Landwirtschaft und Verbraucherschutz Hessisches Kultusministerium Vernetzungsstelle Hessen Vernetzungsstelle Hessen Baustein einer gesundheitsfördernden Schule
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie Landwirtschaft und Verbraucherschutz Hessisches Kultusministerium Vernetzungsstelle Hessen Vernetzungsstelle Hessen Baustein einer gesundheitsfördernden Schule
Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport
 Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport DKV-Verbandsausschuss, Mainz, 17.11.2007 Hermann Thiebes DKV-Vizepräsident Freizeit-
Marketingkonzeption zur Umsetzung von Projekten in den Landes Kanu- Verbänden und Vereinen im Freizeitund Kanuwandersport DKV-Verbandsausschuss, Mainz, 17.11.2007 Hermann Thiebes DKV-Vizepräsident Freizeit-
Menschen mit Behinderung als Teilhaber und Gestalter des Gemeinwesens
 Menschen mit Behinderung als Teilhaber und Gestalter des Gemeinwesens von Dr. Michael Spörke Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.v.-isl Menschen mit Behinderung bestimmen mit! Dr.
Menschen mit Behinderung als Teilhaber und Gestalter des Gemeinwesens von Dr. Michael Spörke Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.v.-isl Menschen mit Behinderung bestimmen mit! Dr.
Betreiben einer lokalen Aktionsgruppe (LAG), Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet
 5.3.4.3 Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet I Tabellarische Kurzbeschreibung Ziel - Zusammenwirken von Akteuren aus verschiedenen Bereichen - Verantwortliche Ausarbeitung
5.3.4.3 Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung in dem betreffenden Gebiet I Tabellarische Kurzbeschreibung Ziel - Zusammenwirken von Akteuren aus verschiedenen Bereichen - Verantwortliche Ausarbeitung
