Tetracyclin-Resistenz in Helicobacter pylori:
|
|
|
- Wilfried Kaufman
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Abteilung Mikrobiologie und Hygiene des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Tetracyclin-Resistenz in Helicobacter pylori: Herstellung und Charakterisierung von definierten 16S rrna- Mutanten und Etablierung eines Realtime-PCR Ansatzes zur schnellen Resistenzbestimmung I N A U G U R A L D I S S E R T A T I O N Zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Vorgelegt 2004 von Marco Berning geboren in Tettnang/Bodenseekreis
2 Dekan Prof. Dr. med. Christoph Peters 1. Gutachter Prof. Dr. med. Manfred Kist 2. Gutachter Dr. J.G. Kusters, PhD (Associate professor) Jahr der Promotion 2005
3 - 3 - INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Helicobacter pylori Epidemiologie Mikrobiologische Eigenschaften Pathogenitätsfaktoren und Virulenzfaktoren H. pylori-assoziierte Erkrankungen Diagnostische Methoden Therapie Resistenzentwicklung und mechanismen Tetracyclin Unerwünschte Wirkungen Dosierung und Pharmakokinetik Wirkungsmechanismus Resistenzmechanismen gegen Tetracycline Ziele der Arbeit Material und Methoden Allgemeine Methoden Allgemeine mikrobiologische Methoden MHK-Bestimmung DNA-Extraktion Polymerase-Kettenreaktion Sequenzierung und Analyse Transformation Erstellung der Transformanten Herstellung der kompetenten E. coli Klonierung in E. coli Natürliche Transformation mit H. pylori Stabilitäts-Experiment Bestimmung des Wachstumsverhaltens...34
4 - 4 - INHALTSVERZEICHNIS in Flüssigkultur Messung der Koloniegrösse Restriktionsenzymverdau mit HinfI Mutationsdetektion mit einer FRET-basierten Realtime-PCR Tabellen Ergebnisse Herstellung der verschiedenen 16S rrna-transformanten Stabilitätsexperiment Resistenzbestimmung Wachstumsexperiment Flüssigmedium Messung der Koloniegrösse Restriktionsanalyse der verschiedenen 16S rrna-muta-tionen mit HinfI Etablierung eines Realtime-PCR Ansatzes zur Detektion von 16S rrna- Mutationen Diskussion Tetracyclinresistenz bei H. pylori Schwierigkeiten der Resistenztestung Detektion von Tetracyclin-resistenten Stämmen Zusammenfassung Literaturverzeichnis...64 Abkürzungsverzeichnis Publikationen aus dieser Arbeit Lebenslauf Danksagung
5 EINLEITUNG 1 Einleitung 1.1 Helicobacter pylori Die Existenz spiralförmiger Mikroorganismen in der menschlichen Magenschleimhaut wurde schon vor hundert Jahren beschrieben. Da diese jedoch nicht angezüchtet werden konnten und der Magen als steriles Organ galt, wurde diese Entdeckung ignoriert und vergessen, bis 1979 der Pathologe John Warren in Magenbiopsien auffallend häufig gekrümmte Bakterien in der Mukusschicht fand (83). Zusammen mit Barry Marshall gelang es ihm 1982 zum ersten Mal, das damals noch zur Campylobacter-Spezies gerechnete gramnegative Bakterium anzuzüchten (84). Die beiden Wissenschaftler beobachteten einen Zusammenhang zwischen einer Helicobacter pylori-infektion (zu dieser Zeit noch Campylobacter pyloridis genannt) mit der chronisch superfiziellen Gastritis und dem Ulcus duodeni (Geschwür des Zwölffingerdarms) (84). Diese Beobachtung wurde schnell bestätigt und ebenfalls für das Ulcus ventriculi (Magengeschwür) gezeigt (14). Seit 1991 wurde mehrfach bewiesen, dass Entzündungen der Magenschleimhaut durch H. pylori in Zusammenhang mit der Entwicklung eines Adenokarzinoms des Magens stehen (105). Später konnte zusätzlich eine Assoziation der Infektion mit dem MALT-Lymphom gezeigt werden (12) Epidemiologie Weltweit sind ca. 50% der Menschheit mit H. pylori infiziert. Es bestehen jedoch Unterschiede in der Infektionsrate sowohl zwischen verschiedenen Ländern als auch innerhalb einzelner Populationen. Die Prävalenz unter Erwachsenen mittleren Alters in Entwicklungsländern beträgt 70 bis 90%, verglichen mit einer Infektionsrate von 25 bis 50% in Industrieländern (109). Erhöhte Prävalenzen innerhalb eines Landes kommen bei Gruppen mit niedrigem sozioökonomischen Standard, bzw. mit niedriger Bildung, sowie höheren Alters vor (36). Zusätzlich wurden für verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Infektionshäufigkeiten beschrieben, so ist z.b. die Seroprävalenz bei australischen Ureinwohnern besonders niedrig (30), bei Schwarzen in den USA dagegen besonders hoch (50). Eine Infektion mit H. pylori tritt zumeist in der frühen Kindheit auf und persistiert ohne spezifische antimikrobielle Therapie in der Regel ein Leben lang (8, 95). Vorwiegend findet die Infektion innerhalb des Familienverbandes statt, besonders bei beengten Verhältnissen und niedrigen Hygienestandards (92). Spätere Infektionen sind selten und werden bei
6 EINLEITUNG Erwachsenen auf ungefähr 0,3-1% Neuinfektionen pro Jahr geschätzt (68). Der Grund für die erhöhte Prävalenz bei älteren Menschen in entwickelten Ländern wird auf den Kohorteneffekt zurückgeführt, d.h. die heutige Prävalenz spiegelt die höhere Infektionsrate in deren Kindheit wider. Dementsprechend kann in Industrieländern in Zukunft von einem Rückgang der H. pylori-prävalenz ausgegangen werden, da der Anteil infizierter Kinder nur noch bei etwa 10% liegt (113). Der genaue Infektionsweg ist heute immer noch nicht klar. Es scheint kein Tierreservoir zu geben. Jedoch kommen andere Helicobacter-Spezies in vielen Tieren natürlich vor (120). Unwahrscheinlich erscheint auch Trinkwasser als Infektionsquelle. Das wichtigste Erregerreservoir scheint folglich der menschliche Magen zu sein (95). Als mögliche Übertragungswege werden beschrieben und diskutiert: fäkal-oral, oral-oral (über Speichel, Magensaft und Vomitus) und iatrogen. Abb. 1.1: Mit H. pylori besiedelte Antrumschleimhaut (127) a a Der weiße Balken rechts unten entspricht 2 µm.
7 EINLEITUNG Mikrobiologische Eigenschaften H. pylori ist ein spiralförmiges, gram-negatives Stäbchenbakterium mit leicht aufgetriebenen Enden. Nach längerer Kultur prädominieren jedoch kokkoide Formen, die zwar metabolisch aktiv sind, sich aber in vitro nicht anzüchten lassen (17). Das Bakterium ist 2,5 bis 5 µm lang und 0,5 bis 1 µm breit. Für die Motilität ist die unipolare Begeißelung mit 2 bis 6 Flagellen notwendig. Die Flagellen sind von einer Scheide umgeben, deren Aufbau der bakteriellen Zellwand entspricht (40). Biochemisch auffällig und somit zur Identifizierung geeignet sind eine hohe Urease-Aktivität sowie eine positive Oxidase- und Katalasereaktion. Das Bakterium lebt wirtsspezifisch im Magen des Menschen. Dementsprechend stellt H. pylori hohe Ansprüche an die Bedingungen der kulturellen Anzucht. Die Kultivierung muss auf komplexen Medien bei mikroaeroben Bedingungen und einer Temperatur von 37 C erfolgen (49). Seit 1989 wird Helicobacter als eine eigene Gattung angesehen, da es sich in seinen Eigenschaften von anderen Bakterien unterscheidet (47). Es weichen sowohl die konservierte 16S rrna als auch die Ultrastruktur, der Fettsäuregehalt, das Wachstumsverhalten und die Enzymaktivitäten von verwandten Gattungen, wie z.b. Campylobacter, der es zunächst zugerechnet wurde, ab (48). Andere Arten der Gattung Helicobacter kommen bei verschiedensten Säugetieren und Vögeln vor (120). Das gesamte Genom von H. pylori konnte mittlerweile bei 2 unterschiedlichen Stämmen, und J99, komplett sequenziert werden (2, 132). Das auffällig GC-arme Genom umfasst etwa 1,65 Megabasen und kodiert für nur etwa 1500 Proteine (132). Zusätzlich zum zirkulären Chromosom tragen noch ca. 40% der Stämme unterschiedliche Plasmide, auf denen bisher allerdings noch keine Virulenzfaktoren ausfindig gemacht werden konnten (66, 94). H. pylori ist natürlicherweise in der Lage DNA aufzunehmen. In Zusammenhang mit der Rekombination erklärt das die außerordentlich hohe genetische Variabilität (85). Einzelne Isolate unterscheiden sich nicht nur in der Anordnung verschiedener Gene, sondern auch in der Ausstattung mit einzelnen Genen und Gengruppen (62, 129).
8 EINLEITUNG Pathogenitätsfaktoren und Virulenzfaktoren H. pylori kolonisiert die Mukusschicht des Magens. Dort wird trotz nur oberflächlicher Kolonisation eine lokale und systemische Immunantwort ausgelöst. Einige bakterielle Faktoren, die es H. pylori ermöglichen, dem menschlichen Immunsystem zu entgehen und als einziges Bakterium im sauren Milieu des Magens zu überleben, wurden in den letzten Jahren entdeckt. Im folgenden sind Eigenschaften beschrieben, die essentiell für Kolonisation und Überleben sind. Hinzu kommen Virulenzfaktoren, deren Vorhandensein Einfluss auf die assoziierten Krankheiten haben oder deren genaue Auswirkungen noch nicht bekannt sind. Die spiralige Form erlaubt es H. pylori, sich korkenzieherartig in die Mukusschicht des Magens einzuschrauben. Mit Hilfe der lophotrichen Begeißelung gelingt es dem Bakterium, sich gegen die Magenperistaltik zu bewegen und der Magensäure zu entkommen, indem es in die weniger saure Schleimschicht eindringt (56). Die 2-6 Flagellen bestehen aus zwei Untereinheiten, FlaA und FlaB (124), die von einer säureresistenten Membran umhüllt sind. Angetrieben werden die Flagellen durch einen Protonengradienten über der bakteriellen Membran (99). Im Tiermodell wurde bestätigt, dass Motilität für die Kolonisation erforderlich und wahrscheinlich wegen des hohen turnover an Epithelzellen und Mukus wichtig für die Persistenz im Magen ist (32). In vitro bewegt sich H. pylori in Richtung höherer Konzentrationen von Harnstoff, Bikarbonat, Mucinen und verschiedenen Aminosäuren (96). Dieser Mechanismus erlaubt dem Bakterium vermutlich in vivo den relativ hohen ph-wert von etwa 5 in der Mukusschicht zu erreichen. H. pylori bildet große Mengen an Urease und ist damit imstande, einen Teil der aggressiven Magensäure in seiner Umgebung zu neutralisieren (8). Urease katalysiert die Hydrolyse von Harnstoff zu Ammoniak und Karbamat, das wiederum in ein zweites Ammoniakmolekül und Kohlendioxid zerfällt (97). Ammoniak ist in der Lage Protonen aufzunehmen und so die Magensäure zu neutralisieren. Das Enzym Urease ist ein 540 kda großes Hexamer, das aus je 2 Untereinheiten UreA und UreB und 2 Ni 2+ -Ionen besteht (29). Es kommt sowohl zytoplasmatisch als auch an der Zelloberfläche von H. pylori vor. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die zytoplasmatische Urease für die Säureresistenz benötigt wird, da das Enzym bei einem Optimum von ph 7,5-8 arbeitet und unterhalb eines ph von 3-4 irreversibel inaktiviert wird (57). Als Regulationsmechanismus wird ein Protonenregulierter Kanal für Harnstoff UreI diskutiert, welcher nur bei niedrigem ph Harnstoff in die Zelle lässt und somit eine überschießende Ammoniakproduktion verhindert (138). Eine zweite essentielle Funktion der Urease könnte die Bereitstellung von Ammoniak als
9 EINLEITUNG Stickstoffquelle für die Aminosäureproduktion sein (140). Darauf deuten Versuche mit gnotobiotischen Schweinen hin, in denen eine Kolonisation mit Urease-negativen H. pylori weder in normal sauren noch in neutralisierten Mägen gelang (31). Die Urease ist ein potenter Stimulus für die Phagozytenaktivierung und die inflammatorische Zytokin- Produktion (54). Außerdem ist die Urease-Aktivität in vitro für menschliche Zellen toxisch und führt zu Apoptose von Zellen der Magenmukosa (119). Wegen eines signifikanten Antikörpertiters gegen Urease bei H. pylori-infizierten wird das Enzym bzw. Untereinheiten als ein möglicher Kandidat für ein Vakzin in Erwägung gezogen (97). Nicht alle H. pylori leben in der Mukusschicht des Magens. Ein Teil adheriert an Epithelzellen. Ob einige auch in Epithelzellen eindringen, wird kontrovers diskutiert, aber sicher ist, dass es dann nur extrem selten vorkommt (8). Adhäsion scheint wichtig als Schutz gegen die Magensäure und davor, nicht aus dem Magen fortgetragen zu werden. Zusätzlich spielt Adhäsion eine wichtige Rolle in der Induktion von Entzündungsreaktionen, da sie in vitro Voraussetzung für die Produktion proinflammatorischer Zytokine von Magenepithelzellen ist (60). In den letzten Jahren konnten einige Adhäsine identifiziert werden, wie z.b. BabA, das an das Blutgruppenantigen Lewis b auf Magenepithelzellen binden kann (59). Die Polysaccharidkapsel von H. pylori zeigt im Gegensatz zu anderen Bakterien eine niedrige Immunogenität und eine geringe biologische Aktivität (98). Möglicherweise bietet Phasenvariation, definiert als häufige, reversible Veränderungen im Lipopolysaccharid- Phänotyp, einen gewissen Schutz vor dem Immunsystem (4). Außerdem tragen viele Stämme Polysaccharidseitenketten, die den Blutgruppenantigenen Lewis X und Lewis Y gleichen. Hier wird diskutiert, ob H. pylori durch molekulare Mimikry maskiert der Immunantwort entkommen könnte (5). Etwa 50% der H. pylori-stämme sezernieren das aktive vakuolisierende Zytotoxin VacA, wohingegen das vaca-gen in fast allen Stämmen zu finden ist (9). VacA-negative Stämme weisen jedoch eine geringere Transkriptmenge auf (38). Auch führt die große Variabilität des Gens zu unterschiedlichen Ausprägungen der Vakuolisierung bzw. Ausbildung des klinischen Erscheinungsbildes. Die variablen Regionen von VacA finden sich am N- terminalen Ende (s1 oder s2) und in der Mitte des Proteins (m1 oder m2) (9). Der vaca- Subtyp s1/m1 zeigt gegenüber den Subtypen s1/m2 und s2/m2 eine signifikant erhöhte Zytotoxizität (10). VacA inseriert in die Membranen von Epithelzellen und formt dort einen Anionenselektiven spannungsabhängigen Ionenkanal (126). Dadurch können Bikarbonat und organische Anionen die Zellen verlassen, was möglicherweise die Bakterien mit
10 EINLEITUNG Nährstoffen versorgt. Ebenfalls baut es sich in Mitochondrienmembranen ein, wodurch Cytochrom c freigegeben und die Apoptose eingeleitet wird (39). VacA konnte im Mausmodell Erosionen und Ulzerationen in der Magenmukosa verursachen (130). Auch kommen VacA-positive Bakterien signifikant häufiger bei Ulkuspatienten vor. Bei ca. 30% der Ulkuspatienten jedoch kommt das Toxin nicht vor und ist somit nicht essentiell für die Ulzerogenese (37). Das 128 kda große Protein CagA (engl. cytotoxin associated gene) verdankt seinen Namen der anfänglichen Annahme, es sei mit der Expression von VacA assoziiert. Später konnte jedoch gezeigt werden, dass die VacA Toxinbildung in Stämmen ohne das caga-gen unverändert ist (145). Das Gen gilt als ein Marker für eine Gruppe von etwa 30 Genen, der sog. cag Pathogenitätsinsel (cag-pai). Einige dieser Gene kodieren für ein Typ IV- Sekretionssystem, durch das das CagA-Protein in Epithelzellen eingebracht werden kann (102). Dort wird es durch Tyrosinkinasen phosphoryliert und führt damit über verschiedene Signalkaskaden zu Veränderungen im Zytoskelett und im Zellzyklus der Wirtszelle. Außerdem ist das Typ IV-Sekretionssystem bedeutsam für eine vermehrte Produktion und Ausschüttung von proinflammatorischer Zytokinen, z.b IL-8, das eine wichtige Rolle in der Gastritis- und Ulkuspathogenese spielt (24). Fast alle Stämme, die bei peptischen Ulzerationen und Magenkarzinom gefunden werden, sind cag-pai-positiv (16), wobei jedoch auch viele cag-pai-positive H. pylori nicht mit Krankheiten assoziiert sind H. pylori-assoziierte Erkrankungen Gastritis Eine akute H. pylori-infektion wird nur selten beobachtet. Sie führt zu einer massiven Infiltration von neutrophilen Granulozyten und mononukleären Zellen, was oft mit unspezifischen dyspeptischen Symptomen wie Völlegefühl, Nausea und Erbrechen vergesellschaftet ist (67). Praktisch jede infizierte Person entwickelt eine chronische-aktive Gastritis Typ B (bakteriell infektiös), wovon 80 bis 90 % niemals Symptome haben (125). Der Schweregrad der Entzündung und somit das Auftreten von Folgeerkrankungen hängt sowohl von bakteriellen als auch von Wirtsfaktoren ab. Neben der Infiltration der Schleimhaut kann es zur Atrophie der Mukosa, partiellem Auftreten von Regeneratepithel und Ausbildung intestinaler Metaplasien kommen (15). Bei Individuen mit intakter Säuresekretion ist die Gastritis meist im Antrum lokalisiert, da hier relativ wenige säureproduzierende Parietalzellen zu finden sind. Seltener findet man bei Personen mit einer Störung der Säureproduktion eine im Korpus prädominate Entzündung (125).
11 EINLEITUNG Gastroduodenale Ulkuskrankheit Bei 84% der Ulzera des Magens und 95% des Zwölffingerdarms liegt eine H. pylori- Besiedlung vor (69). Ein kausaler Zusammenhang zwischen H. pylori-infektion und der gastroduodenalen Ulkuskrankheit wird dadurch bestätigt, dass nach einer H. pylori- Eradikationstherapie praktisch immer eine dauerhafte Ulkusheilung erreicht werden kann (110). Das Entzündungsmuster der Magenschleimhaut und die Veränderungen in der Säuresekretion bestimmen das Krankheitsbild. So führt eine Antrum-betonte Gastritis eher zu einem Duodenalgeschwür (117). Dabei nimmt die Zahl der Somatostatinproduzierenden D-Zellen ab, weniger Somatostatin führt über eine negative Feedbackhemmung zu einer vermehrten Gastrinausschüttung der G-Zellen. Vermehrtes Gastrin wiederum stimuliert die gesunde Korpusschleimhaut zu einer erhöhten Säureproduktion. Die gesteigerte Säurelast wiederum führt zu gastrischen Metaplasien im Duodenum. Nun kann H. pylori diese Schleimhaut besiedeln und ein Duodenalgeschwür entstehen (8). Bei Personen mit einer Pangastritis, d.h. Antrum und Korpus sind gleichermaßen betroffen, kann H. pylori den sonst unwirtlichen Korpus besiedeln. Durch den gleichen Mechanismus kommt es hier ebenfalls zu einer Hypergastrinämie, wobei der entzündete Korpus dann aber nicht in der Lage ist, mehr Säure zu produzieren (34). Letztlich gibt es weiterhin Lücken im Verständnis der Magenulkusentstehung. Zum einen kommt es auf das ulzerogene Potential des einzelnen H. pylori-stammes an, zum anderen spielen genetische und immunologische Faktoren eine wichtige Rolle (35, 69). Dazu kommen andere Faktoren wie Rauchen und Medikamenteneinnahmen, wobei hier nichtsteroidale Antiphlogistika und besonders Aspirin eine übergeordnete Rolle zukommt (70) Magenkarzinom Zahlreiche epidemiologische Studien haben bereits vor Jahren den Zusammenhang zwischen einer H. pylori Infektion und dem kardiafernen Magenkarzinom gezeigt (101, 105). Daraufhin klassifizierte die WHO 1994 H. pylori als Klasse I Karzinogen (58). Bei etwa der Hälfte der von H. pylori-kolonisierten Individuen entwickelt sich auf Grund der chronischen Entzündung eine atrophische Gastritis und intestinale Metaplasien. Diese Läsionen kommen zumeist multifokal an der kleinen Kurvatur des Magens vor und erhöhen das Risiko für das Magenkarzinom um das 5 bis 90-fache, abhängig von Ausmaß und Art der Metaplasie (67). Der endgültige Beweis für diese Sequenz wurde 1998 erbracht, als mongolische Wüstenmäuse mit H. pylori infiziert wurden. Nach 62 Wochen
12 EINLEITUNG entwickelten 37% der Tiere ein Magenkarzinom, aus der nicht-infizierten Kontrollgruppe dagegen kein einziges (137). Verschiedene genotypische Varianten, z.b. caga-positive Stämme, haben ein höheres onkogenes Potential. Zusätzlich spielen Wirtsfaktoren, wie Alter bei der Infektion, genetische Charakteristika und Status des Immunsystems, sowie verschiedene Umweltfaktoren auch bei der Krebsentstehung eine entscheidende Rolle (7) MALT-Lymphom In der nicht-infizierten Magenmukosa findet sich kein lymphatisches Gewebe. Bei einer H. pylori-besiedlung kommt es als Reaktion auf die Infektion zum Auftreten von Lymphfollikeln und lymphatischen Aggregaten, woraus sich in seltenen Fällen ein B-Zell- Klon in Form eines niedrig malignen MALT-Lymphomes entwickelt (67). Bei fast allen Patienten mit MALT-Lymphom kann eine H. pylori-gastritis mit mukosa-assoziertem lymphatischen Gewebe (MALT, engl. mucosa-associated lymphoid tissue) nachgewiesen werden (12, 142) % der Patienten zeigen nach einer Eradikationstherapie eine komplette Remission (12, 131), weswegen dieser Ansatz als Therapie der ersten Wahl gilt Diagnostische Methoden Eine Infektion mit H. pylori lässt sich mit verschiedenen diagnostischen Tests nachweisen. Es stehen sowohl indirekte nicht-invasive als auch direkte invasive Methoden zur Verfügung. Der nicht-invasive serologische Test ist einfach und billig, eine Erfolgskontrolle der Therapie ist jedoch nur bedingt möglich (74). Außerdem ist aufgrund der unterschiedlichen Stämme von H. pylori eine lokale Validierung nötig. Beim Harnstoff- Atemtest trinkt der Patient eine Lösung mit 13 C-Harnstoff, aus dem mit Hilfe der bakteriellen Urease 13 CO 2 freigesetzt wird, welches ausgeatmet und massenspektrometrisch erfasst wird (81). Der Test ist geeignet zur Erstdiagnose und kann nach einem Zeitintervall von 4 Wochen auch zur Erfolgskontrolle der Therapie genutzt werden. Mit dem Stuhl- Antigen-Test kann ebenfalls eine Therapiekontrolle durchgeführt werden. Diese neue Methode ist in Spezifität und Sensitivität vergleichbar mit den anderen oben genannten nicht-invasiven Methoden und ist besonders interessant bei sehr jungen Patienten, da hier die Probengewinnung vergleichsweise einfach ist (18). Für direkte Tests ist eine Magenbiopsie nötig, was jedoch häufig keine Schwierigkeit darstellt, da eine endoskopische Untersuchung bei vielen Patienten, besonders bei gastrointestinalen Blutungen und Malignitätsverdacht, ohnehin indiziert ist. Das aus Antrum- und Korpusschleimhaut gewonnene Material kann mit Hilfe des Urease-Schnelltests schnell und einfach auf
13 EINLEITUNG Anwesenheit von H. pylori, bzw. dessen Enzym Urease getestet werden (88). Des weiteren können die Magenbiopsien histologisch aufgearbeitet und untersucht werden. Hier sind jedoch zur definitiven Identifikation von H. pylori aufwendige immunhistochemische Techniken erforderlich (86). Die Kultivierung des Erregers aus Magenbiopsien ist ebenfalls möglich. Dabei wird häufig zusätzlich eine Resistenztestung durchgeführt, was bei Vorliegen des Antibiogramms eine optimale Therapie erlaubt. Bei dieser Methode muss die Anzucht des Erregers allerdings innerhalb von wenigen Tage erfolgen. Der Nachweis von H. pylori mittels PCR ist selten, gewinnt aber an Bedeutung durch die Möglichkeit zum Nachweis bestimmter genetischer Mutationen, z.b. solcher, die für Antibiotika-Resistenzen verantwortlich sind (73) Therapie Nicht jede H. pylori-infektion bedarf einer Therapie. Zwar sind große Teile von Populationen infiziert, aber nur ein geringer Teil davon entwickelt die Folgekrankheiten. Deswegen werden immer wieder Empfehlungen für die verschiedenen Indikationen zur Therapie erarbeitet (siehe Tabelle 1.1). Tabelle 1.1: Richtlinien zur H. pylori-eradikationstherapie nach dem Maastricht Consensus Report (13) Indikationen, bei denen eine Therapie unbedingt empfohlen wird Magen- und Duodenalulkus MALT-Lymphom Atrophische Gastritis kürzlich erfolgte Resektion eines Magenkarzinoms Verwandter ersten Grades mit Magenkarzinom Patientenwunsch Indikationen, bei denen eine Therapie ratsam ist Dyspepsie Gastroösophageale Refluxerkrankung (bei Patienten, die langandauernde Säuresuppressionstherapie benötigen) permanente NSAID-Einnahme Die Therapie einer H. pylori-infektion muss die totale Eradikation der Bakterien zur Folge haben, da sonst aus einer einzelnen Kolonie nach Beendigung der Therapie der ganze
14 EINLEITUNG Magen wieder besiedelt werden kann. Dieses Ziel ist in der besonderen ökologischen Nische von H. pylori, der Mukusschicht der Magenschleimhaut, nicht einfach zu erreichen, da die Penetration der antimikrobiellen Therapeutika in die Mukusschicht schwierig sein kann, was große Konzentrationsunterschiede zur Folge hat. Zusätzlich beeinträchtigt das lokal sehr saure Milieu die Wirksamkeit der einzelnen Medikamente (27, 51). Deswegen werden in der H. pylori-eradikationstherapie üblicherweise Kombinationen aus 3 oder 4 verschiedenen Medikamenten, sogenannten Tripel- oder Quadrupeltherapien, verwendet. Um den sauren ph im Magen anzuheben und somit zum einen die Wirksamkeit der Antibiotika zu verbessern, zum anderen die Ulkusheilung zu fördern und schnell Schmerzen, z.b. bei einem Ulkus, zu lindern, werden regelmäßig ein Protonenpumpenhemmer (PPI, engl. proton pump inhibitor), z.b. Omeprazol oder Folgepräparate, oder ein H 2 -Rezeptor-Antagonist (Ranitidin) in die Kombination mit aufgenommen (6). Die übrigen 2-3 Komponenten sind verschiedene antimikrobiell wirksame Substanzen, üblicherweise Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazol, Tetracyclin und Wismutsalz. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass besonders mit Kombinationen aus PPI, Clarithromycin und Amoxicillin sowie aus PPI, Clarithromycin und Metronidazol hohe Eradikationsraten von 70-96% zu erreichen sind (78, 79, 82). Somit sind das Italian Triple (PMC, PPI in Standarddosis 2x/d, Metronidazol (2x 400 mg/d) und Clarithromycin (2x 250 mg/d) über 7 Tage) und das French Triple (PAC, PPI in Standarddosis 2x/d, Amoxicillin (2x 1000 mg/d) und Clarithromycin (2x 500 mg/d) über 7 Tage) die Therapien der ersten Wahl nach dem Maastricht Consensus Report 2 im Jahr 2000 (13). Gründe für die Bevorzugung des einen oder anderen Protokolls können sowohl die regionale Resistenzlage als auch die Kosten sein. Vorteil des PAC-Regimes ist die Möglichkeit, bei Therapieversagen ohne Resistenzprüfung auf die Ersatztherapie, die sog. Quadrupeltherapie (PPI in Standarddosis 2x/d, Wismutsalz (4x 120 mg/d), Metronidazol (3x 400 mg/d) und Tetracyclin (4x 500 mg/d) über 14 Tage), umzustellen (41, 106). Ein anderer Ansatz, der in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte, ist die prophylaktische und therapeutische Impfung gegen H. pylori. Unterschiedliche Verfahren, z.b. mit H. pylori-genen in verschiedenen Vektoren, sind bisher ohne zufriedenstellendes Ergebnis erprobt worden (3). Besonders in Entwicklungsländern wäre wegen der hohen Durchseuchung eine Impfung als Alternative zur aufwendigen Antibiotikatherapie wünschenswert. Auch in entwickelten Ländern könnte ihr bei zunehmenden Antibiotikaresistenzen eine große Bedeutung zukommen.
15 EINLEITUNG Resistenzentwicklung und mechanismen Durch den weitverbreiteten Einsatz von Antibiotika stieg die Zahl der resistenten H. pylori- Stämme in den letzten Jahren deutlich an. Besonders die Rate der Metronidazol-resistenten Stämme liegt in Europa und Nordamerika mittlerweile bei durchschnittlich 30-40%, die der Clarithromycin-resistenten bei etwa 10%. H. pylori-stämme, die gegen Amoxicillin und Tetracyclin resistent sind, werden zumindest in entwickelten Ländern noch selten gefunden (44). Abb. 1.2: Resistenzentwicklung für Metronidazol und Clarithromycin in Europa nach (44) Metronidazol Metronidazol, ein Nitroimidazol, ist ein Prodrug, das in bakteriellen Zellen erst aktiviert wird. Das geschieht durch die Reduktion der Nitrogruppe. Das aktivierte Produkt bildet freie Radikale, die wiederum subzelluläre Strukturen und die DNA angreifen können (33). In H. pylori wurden eine Nitroreduktase RdxA und weitere Enzyme gefunden, die in der Lage sind, Metronidazol zu aktivieren. Eine Inaktivierung von RdxA durch Punktmutation im rdxa-gen führt zu Metronidazolresistenz (46). Mutationen in den anderen Genen frxa und fdxb bedingen ebenfalls Resistenzen, jedoch von unterschiedlichem Ausmaß (71). Metronidazol-Resistenz ist weit verbreitet; in entwickelten Ländern liegt die Rate bei 10-60% (44), in Entwicklungsländern fast bei 100% (89). Dem zugrunde liegt wahrscheinlich der weitverbreitete Einsatz von Nitroimidazolen bei gynäkologischen, dentalen und parasitären Infektionen (90). Eine solche Resistenz senkt die Erfolgsrate einer auf Metronidazol-basierenden Therapie um etwa 20% (91).
16 EINLEITUNG Clarithromycin Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum. Es bindet an die bakteriellen Ribosomen, genauer an Domäne V der 23S rrna. Das führt zu einem Stop der Elongation und somit der Proteinsynthese (139). Bei H. pylori konnten Punktmutationen an den Positionen 2142 und 2143 des 23S rrna-gens gefunden werden, die zu einer verminderten Makrolid- Bindung an das Ribosom und somit zu Resistenz führen (134). Der Anteil der Makrolidresistenten H. pylori-stämme beträgt zwischen 0 und 29%, abhängig von der regionalen Verbreitung des Antibiotikums (44). Eine Makrolid-Resistenz vermindert die Erfolgschance einer Therapie, die Clarithromycin enthält, um mehr als 50% (108, 128) Amoxicillin Das β-laktam Amoxicillin bindet an sogenannte PBPs (Penicillin-bindende Proteine). PBPs sind Enzyme, die in die Biosynthese der Peptidoglykanschicht der Zellwand involviert sind. Bei H. pylori konnten verschiedene PBPs beschrieben werden, wobei Mutationen im pbp 1a-Gen mit einer β-laktam-resistenz einhergehen (43). Die Amoxicillin-Resistenz in Europa ist noch relativ wenig verbreitet, in vielen Ländern konnten noch keine resistente Stämme identifiziert werden (44). Manche Studien zeigen jedoch sehr hohe Raten, z.b. in China 72% (144) und in Brasilien 29% (93). Ob das die tatsächliche epidemiologische Situation widerspiegelt, ist unklar, da die hohen Werte möglicherweise den Methoden, bzw. deren Interpretation, anzulasten sind (90) Tetracyclin Eine Tetracyclin-Resistenz bei H. pylori ist zumindest in Europa, Australien und den USA sehr selten, in vielen Studien konnte kein einziger resistenter Stamm gefunden werden (20, 26, 52). Jedoch besonders aus asiatischen Ländern wird von zunehmenden Resistenzen gegen Tetracyclin berichtet. In Korea zeigen zwei Studien Resistenzraten von etwa 5%, in Japan liegen sie bei 6,7% (64, 72). In Shanghai/Volksrepublik China sind angeblich bis zu 59% der H. pylori-stämme resistent gegen Tetracyclin (143). Aber auch in Brasilien wurden unlängst 9% resistente Stämme beschrieben (45). Im Jahr 2002 ist unabhängig voneinander der gleiche Resistenzmechanismus bei zwei Tetracyclin-resistenten H. pylori-stämmen, einer aus Australien und einer aus den Niederlanden, gefunden worden (42, 133). Auf diesen Mechanismus wird in späteren Kapiteln eingegangen.
17 EINLEITUNG 1.2 Tetracyclin Tetracycline sind Breitspektrumantibiotika mit bakteriostatischer Wirkung gegen gramnegative sowie gram-positive Bakterien, atypische Erreger und Protozoen. R 4 R 1 N(CH 3 ) 2 R 3 R 2 OH OH O O OH O Abb. 1.3: Grundgerüst der Tetracycline CONH 2 Die Familie der Tetracycline wurde in den späten vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt. Die zuerst gefundenen Substanzen Chlortetracyclin und Oxytetracyclin sind Produkte von Streptomyces aureofaciens und S. rimosus. Andere Tetracycline sind ebenfalls natürliche, in verschiedenen Streptomyces-Arten vorkommende Moleküle, aber auch semisynthetische Analoga mit verbesserter Wasserlöslichkeit und oraler Absorption (23). Die Grundform des Moleküls besteht aus vier linear kondensierten Sechserringen (Abb. 1.3), an denen unterschiedliche funktionale Gruppen angehängt sind (Tabelle 1.2). Die Standardsubstanz ist heute Doxycyclin. Substanzen wie Tetracyclin und Oxytetracyclin werden wegen ihrer schlechteren oralen Resorption heute seltener verwendet. Die alte Substanz Tetracyclin hat jedoch Eingang in die Helicobacter pylori-therapie gefunden. Das Wirkspektrum und der Wirkmechanismus der verschiedenen Tetracycline sind identisch. Tabelle 1.2: Substituenten der wichtigsten Tetracycline an den Positionen 4, 5, 6 und 7 a und deren Herkunft R 1 R 2 R 3 R 4 Herkunft Tetracyclin H OH CH 3 H S. texas Chlortetracyclin H OH CH 3 Cl S. aureofasciens Oxytetracyclin H OH CH 3 H S. rimosus Doxycyclin OH H CH 3 H semisynthetisch Minocyclin H H H N(CH 3 ) 2 semisynthetisch a Position 4, 5, 6, 7 entsprechen R 1, R 2, R 3, R 4
18 EINLEITUNG Wegen ihres breiten Spektrums und ihrer relativ guten Veträglichkeit haben Tetracycline sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin eine große Bedeutung. Hinzu kommt, dass in Ländern, die auf preiswerte Medikamente angewiesen sind, die im Vergleich zu anderen Antibiotika billigen Tetracycline noch häufiger angewendet werden. Sie sind Mittel der ersten Wahl bei ambulant erworbenen Pneumonien mit Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae und Chlamydia psittaci (63). Zusätzlich werden Rickettsiosen, Borreliosen und Brucellosen mit Doxycyclin therapiert (1). Minocyclin wird bei Akne vulgaris gegen Propionibacterium acnes angewendet (28). Sogar bei Amöben-Infektionen und zur Malariaprophylaxe können Tetracycline verwendet werden (104). Bei Vorliegen eines Antibiogramms kann das Anwendungsgebiet noch ausgedehnt werden, z.b. wegen der bedeutenden biliären Exkretion bei Entzündungen der ableitenden Gallenwege. Tabelle 1.3: Anwendungen von Tetracyclinen in der Therapie und Prophylaxe von Infektionen (modifiziert nach (23)) Erste Wahl akzeptierte Alternative zu anderen Antibiotika Respirationstrakt atypische Pneumonie (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, C. psittaci) Gastrointestinaltrakt Cholera Prophylaxe gegen Reisediarrhoe Urogenitaltrakt Non-Gonokokken Urethritis Cervicitis Lymphogranuloma venereum Granuloma inguinale Lokale und systemische Infektionen Rocky mountain spotted fever endemischer und epidemischer Typhus Q-Fieber Brucellose (in Kombination) Lyme-Borreliose Rückfallfieber Periodontale Infektionen Akne vulgaris Prophylaxe gegen Mefloquine-resistente Plasmodium falciparum Malaria ambulant erworbene Pneumonien infektiöse Exazerbationen von chronischer Bronchitis Legionellose Helicobacter pylori-infektionen Syphilis Epididymitis Prostatitis MRSA-Infektionen Bartonellosen Leptospirose Morbus Whipple
19 EINLEITUNG Unerwünschte Wirkungen Prinzipiell sollten Tetracycline nur bei gesicherten Indikationen verwendet werden, nicht bei Schwangerschaften und nicht bei gewöhnlichen Infektionen bei Kindern unter 8 Jahren. Alle Tetracycline, besonders bei oraler Gabe, können zu gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Sodbrennen, abdominellen Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoen führen. Eine pseudomembranöse Enterokolitis tritt sehr selten auf, jedoch sollte beim Auftreten von Diarrhoen eine Infektion mit Clostridium difficile unbedingt ausgeschlossen werden. Leberschädigungen mit Gelbsucht, Azotämie, Azidose und Schock können auftreten, jedoch zumeist bei sehr hohen Dosierungen von etwa 2 g und bevorzugt bei Schwangeren im letzten Schwangerschaftsdrittel. Besonders Doxycyclin kann zu Photodermatosen mit Erythemen, Ödemen und z.t. irreversiblen Pigmetierungen führen. Kinder können durch die Therapie mit Tetracyclinen eine dauerhafte Braunfärbung der Zähne bekommen, die möglicherweise mit Schmelzdefekten und erhöhter Kariesanfälligkeit einhergeht. Allergien mit Exanthemen, bis hin zu einer Dermatitis exfoliativa und einem anaphylaktischen Schock, sind vereinzelt beschrieben worden. Dabei ist eine Kreuzsensibilität zwischen den verschiedenen Tetracyclinen üblich. Außerdem können intrakranielle Drucksteigerungen, Nierenschädigungen und lokale Reizerscheinungen auftreten. Interaktionen mit anderen Medikamenten müssen beachtet werden. So kann bei einer gleichzeitigen Antikoagulanzientherapie, einer Therapie mit Sulfonylharnstoffen oder bei digitalisierten Patienten eine Dosisreduktion der entsprechenden Substanzen nötig sein (53, 118) Dosierung und Pharmakokinetik Tetracycline werden in der Regel oral verabreicht. Die prozentuale Resorption beträgt bei Tetracyclin etwa 60-80%, bei Minocyclin und Doxycyclin %. Die Resorption findet hauptsächlich im Magen und proximalen Dünndarm statt. Sie wird durch verschiedene Substanzen verschlechtert: durch Kalzium, das z.b. in Milchprodukten und einigen Antazida besonders viel enthalten ist und durch Aluminium z.b. aus Sucralfat. Bei einer Chemotherapie mit Tetracyclinen sollten Plasmaspiegel von 2-5 µg/ml angestrebt werden, die bei Erwachsenen mit etwa 1-2 g Tetracyclin oder 0,2 g Doxycyclin pro Tag erreicht werden. Durch die kurze Halbwertszeit der meisten Tetracycline ist eine
20 EINLEITUNG Verabreichung 4x täglich nötig, um den wirksamen Spiegel aufrecht zu halten. Die längeren Halbwertszeiten von Doxycyclin und Minocyclin erlauben 1-2 Einzeldosen pro Tag (23). Tetracycline penetrieren gut in die verschiedenen Gewebe und Sekrete. Sie akkumulieren in Leber, Milz, Knochenmark sowie Zahnschmelz und -wurzel von noch nicht durchgebrochenen Zähnen. Die Blut-Liquor-Schranke kann nur bei entzündeten Meningen passiert werden. Tetracycline sind plazentagängig und können in hohen Konzentrationen in der Muttermilch gefunden werden (53). Die Elimination von Tetracyclin erfolgt in erster Linie renal, aber auch zum Teil biliär, Doxycyclin wird weitgehend als inaktives Konjugat oder Chelat fäkal ausgeschieden und kann deshalb auch bei niereninsuffizienten Patienten eingesetzt werden (53) Wirkungsmechanismus Tetracycline inhibieren die bakterielle Proteinsynthese, indem sie die Anlagerung der Aminoacyl-tRNA an das Ribosom verhindern. Um in die Zelle zu gelangen, muss Tetracyclin durch eine oder mehrere Membranen gelangen. Bei gram-negativen Bakterien überwinden die positiv geladenen Tetracyclin- Moleküle wahrscheinlich als Magnesium-Komplex durch die Porine OmpF und OmpC die äußere Membran (22, 116). Durch das Donnan-Potential angezogen, akkumulieren die Moleküle im periplasmatischen Raum. Dort dissoziiert der Komplex, das Ca 2+ -Ion verlässt das nun ungeladene Tetracyclin, das dann schwach lipophil durch die innere Membran diffundieren kann (23). Bei gram-positiven Erregern durchdringt ebenfalls ein ungeladenes Tetracyclin-Molekül die Zytoplasmamembran, hier jedoch mit Hilfe eines aktiven H + - abhängigen Transportmechanismus (100, 116). Im Zytoplasma bildet Tetracyclin wahrscheinlich wieder einen Chelatkomplex, da Metallionen dort in hoher Konzentration vorkommen (116). Vermutlich als Magnesiumkomplex bindet es reversibel an die 30S Untereinheit des Ribosoms (22). Das Ribosom dient der Translation des genetischen Codes in Form der mrna in Proteine, wobei die mrna selbst ein Transkriptionsprodukt der DNA darstellt. Das bakterielle Ribosom hat einen Sedimentationskoeffizient von 70S; es ist zusammengesetzt aus einer großen Untereinheit 50S und einer kleinen 30S. Die kleine Untereinheit wiederum besteht aus einer 16S rrna und 21 Proteinen, die große aus einer 5S rrna, einer 23S rrna und 31 verschiedenen Proteinen. Während der Elongation bindet an die A-Bindungstelle des Ribosoms die passende Aminoacyl-tRNA (aa-trna), welche die als nächstes anzuknüpfende Aminosäure enthält. Drei Nukleotide der mrna bilden das Kodon, an das
21 EINLEITUNG nur die aa-trna mit dem entsprechenden Antikodon passt. An der P-Bindungstelle befindet sich die Peptidyl-tRNA, also die an trna gebundene, schon translatierte Peptidkette. Diese Peptidkette wird nun an die aa-trna mit Hilfe einer Petidylbindung gebunden. Das ganze wandert als verlängerte Peptidyl-tRNA zur P-Bindungstelle, die zuvor von der freien trna verlassen wurde. Die A-Stelle ist wieder frei für eine neue aatrna. Um an die A-Stelle binden zu können, muss die aa-trna den sogenannten Initiationskomplex mit dem Elongationsfaktor EF-Tu und dem Energielieferanten GTP bilden. Nach der Bindung an die A-Bindungstelle werden EF-Tu und das zu GDP hydrolisierte GTP wieder freigesetzt (123, 135). In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass Tetracycline mindestens 2 Bindungsstellen in der 30S Untereinheit haben, wobei die primäre Bindungstasche in räumlicher Nähe zur A-Bindungstelle (Aminoacyl-Stelle) liegt (19, 107). Die Bindungstasche ist etwa 20 Å breit und 7 Å tief. Maßgeblich gebildet wird sie vom Phosphat-Rückgrat der Basen , aus Helix 34 und aus Helix 31 (Abb. 1.4, Basen nummeriert nach der E. coli 16S rrna) (19). G 966 H 3 C OH N(CH 3 ) 2 A 965 OH CONH 2 C 1195 OH O OH OH O G 1053 Mg 2+ U 1196 C 1054 G 1197 G 1198 Abb. 1.4: Mögliche Bindungsstellen zwischen Tetracyclin und der 16S rrna (19)
22 EINLEITUNG Die Kodon-Antikodon-Bindung des Initiationskomplexes, bestehend aus EF-Tu, der Aminoacyl-tRNA und GTP, wird nicht beeinträchtigt, da die an den Faktor EF-Tu gebundene aa-trna eine andere Orientierung hat als später, wenn sie an die A- Bindungstelle angelagert ist und EF-Tu freigesetzt wurde. Die Rotation, die bei der GTP- Hydrolyse geschieht, führt nun zu einer sterischen Behinderung mit dem gebundenen Tetracyclin. Die aa-trna wird ohne Knüpfung der Peptidbindung an die Peptidyl-tRNA wieder freigegeben (19). Der Stop der Elongation in der bakteriellen Proteinsynthese sowie der unproduktive Energieverbrauch durch die GTP-Hydrolyse bieten eine gute Erklärung für den bakteriostatischen Effekt von Tetracyclinen (19). Diskutiert wird außerdem eine zweite Bindungstelle mit geringerer Affinität für Tetracycline an Helix 27 der 16S rrna (19, 107). Dort ist für die Elongation eine Konformationsänderung innerhalb des Ribosomenkomplexes nötig (21, 80). Die Bindung von Tetracyclinen an dieser Stelle könnte den ram state (engl. ribosomal ambiguity state) stabilisieren, in dem häufiger falsche trnas gebunden werden. Ein erschwerter Übergang in den restrictive state würde zusätzlich das dort stattfindende Korrekturlesen beeinträchtigen. Dieser Mechanismus enspräche dem vermuteten Wirkungsmechanismus des Aminoglykosids Streptomycin (21) Resistenzmechanismen gegen Tetracycline Tetracycline sind mit die mit am meisten eingesetzten Antibiotika, nicht nur in der Humanund Veterinärmedizin, sondern auch in therapeutischen und subtherapeutischen Dosen in der Viehzucht und im Obstanbau (23). Ein dramatischer Anstieg der Rate der Tetracyclinresistenten Bakterien seit der Einführung der Tetracycline in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts verwundert deshalb nicht (23). Bei unterschiedlichen Bakterien sind im Laufe der letzten Jahre vier verschiedene Mechanismen, die den Organismen eine Resistenz gegenüber Tetracyclinen verleihen, beschrieben worden: Efflux-Proteine, ribosomale Schutzproteine, enzymatische Inaktivierung und Mutationen in der 16S rrna. Mittlerweile sind mindestens 33 Tetracyclin- (tet) und 3 Oxytetracyclin-Resistenz (otr) Gene beschrieben (112). Die einzelnen tet-gene wurden nach ihrer Entdeckung mit Buchstaben des römischen Alphabets versehen. Ab dem 27ten musste die Nomenklatur geändert werden, neue tet- Gene werden nun mit Zahlen ab 30 bezeichnet (76, 77).
23 EINLEITUNG Efflux-Proteine Alle tet Efflux-Gene kodieren für Membran-assoziierte Proteine, die Energie-abhängig Tetracyclin aus der bakteriellen Zelle befördern können und somit die intrazelluläre Konzentration des Antibiotikums senken (112). Die meisten dieser Gene werden nur in gram-negativen Bakterien gefunden; nur zwei, tet(k) und tet(l), kommen vornehmlich in gram-positiven Erregern vor (23). Alle diese Gene führen zu einer Resistenz gegen Tetracyclin und Doxycyclin, nur tet(b) zusätzlich gegen Minocyclin, so dass bei erfolgter Genotypisierung oftmals weiterhin mit Minocyclin therapiert werden könnte (23). Die Expression dieser Gene wird meistens durch einen Repressor geregelt, der unter Tetracyclin-freien Bedingungen an die DNA Operator Region bindet und eine Translation verhindert. Bindet jedoch ein Tetracyclin-Magnesium-Komplex an den Repressor, löst sich dieser, und die Gene werden relativ schnell abgelesen (65). Die Efflux-Gene kommen bei gram-negativen Bakterien häufig auf großen Plasmiden vor, die meist noch andere Antibiotika und Schwermetall-Resistenzen sowie Pathogenitätsfaktoren tragen. Das bedeutet, dass die Selektion für nur eines dieser Gene zu einer Selektion für das gesamte Plasmid führt, was die häufig vorkommenden Multidrug-Resistenzen erklärt (23) Ribosomale Schutzproteine Zehn verschiedene Gene kodieren für ribosomale Schutzproteine, die eine Resistenz gegen Tetracyclin, Doxycyclin und Minocyclin vermitteln (112). Diese 72,5 kda großen, zytoplasmatischen Proteine können GTP binden und haben eine GTPase-Aktivität. Für Tet(O) wurde ein Mechanismus beschrieben, wie es als Tet(O)-GTP Komplex an die Ribosomen bindet und das Tetracyclin verdrängt. Es verlässt das Ribosom als Tet(O)-GDP wieder und macht der normalen Translation Platz (121). Ribosomale Schutzproteine können bei gram-positiven Bakterien, Anaerobiern und non-enterischen gram-negativen Bakterien, wie Neisseria gonorrhoeae und Haemophilus ducreyi, gefunden werden (112). Die Gene für ribosomale Schutzproteine sind zumeist, assoziiert mit konjugativen und nichtkonjugativen Transposons, im Chromosom, seltener in einem Plasmid integriert. Die mobilen Genelemente kommen oft zusammen mit multiplen Antibiotikaresistenzen vor. Aus diesem Grund sind Tetracyclin-resistente Bakterien häufig gegen eine ganze Reihe von Antibiotika resistent (75, 112).
24 EINLEITUNG Andere Mechanismen Das tet(x)-gen ist soweit bisher bekannt, das einzige, das für ein Enzym kodiert, welches in der Lage ist, in Anwesenheit von Sauerstoff und NADPH Tetracycline chemisch so zu verändern, dass sie nicht mehr antibiotisch wirksam sind (122). Allerdings wurde dieses Gen bisher nur in dem Anaerobier Bacteroides gefunden und kann dort wegen der Abwesenheit von Sauerstoff nicht wirksam sein. Vermutlich stammt es aber ursprünglich aus einem Aerobier, bzw. einem fakultativ anaeroben Bakterium, das aber noch nicht identifiziert werden konnte (23, 122). Ein weiterer für Tetracyclin-Resistenz verantwortlicher Mechanismus, eine Mutation in der 16S rrna, wurde bisher nur bei zwei Spezies gefunden. Im gram-positiven Propionibacterium acnes konnte 1998 an der bei E. coli entsprechenden Position 1058 ein Basenaustausch von Guanin zu Cytosin gefunden werden (114). Im Jahr 2002 wurde von zwei verschiedenen Gruppen eine Dreifachmutation in beiden 16S rrna-genen im gramnegativen H. pylori an Position ausgemacht, welche bei E. coli entspricht (42, 133). 1.3 Ziele der Arbeit Bei den beiden Tetracyclin-resistenten H. pylori-stämmen, deren Resistenzmechanismus kürzlich beschrieben wurde, fand sich eine Mutation in den drei Basenpaaren der beiden 16S rrna-gene rrna und rrnb von AGA nach TTC (42, 133). Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, ob Mutationen von nur einem oder zwei Basenpaaren an dieser Stelle zu einer klinisch relevanten Resistenz gegenüber Tetracyclin führen. Dazu wurde versucht, Mutanten mit jeweils 1, 2 oder 3 Basenpaarsubstitutionen herzustellen. Diese sollten sowohl auf den Grad der Resistenz, als auch auf Stabilität der Mutation und das Wachstumsverhalten getestet werden. Zusätzlich sollte ein Ansatz zur schnellen molekulargenetischen Detektion der resistenten H. pylori-stämme mit Hilfe eines Realtime-PCR Ansatzes erarbeitet werden. Damit könnte bei zunehmender Tetracyclin-Resistenz in Zukunft eine Möglichkeit bestehen, diese Resistenz ohne Kultivierung schnell zu detektieren und eine adäquate Antibiotikatherapie zu gewährleisten.
25 MATERIAL UND METHODEN 2 Material und Methoden 2.1 Allgemeine Methoden Die in dieser Arbeit dargestellten Experimente wurden größtenteils im Labor der gastroenterologischen Abteilung des Erasmus Medisch Center in Rotterdam, Niederlande durchgeführt. Eine erneute Resistenztestung sowie die Etablierung der Realtime-PCR Methode erfolgten im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsklinik Freiburg Allgemeine mikrobiologische Methoden Für alle molekulargenetischen Versuche wurde der vollständig sequenzierte H. pylori Tet S - Stamm genutzt. Als Referenzstamm bei der Resistenzbestimmung diente zusätzlich der Tet R -Stamm 181 (42). Für die Validierung der Mutationsdetektion mit Hilfe der Realtime-PCR wurde DNA von 50 Tet S -Stämmen aus der Routinediagnostik in Freiburg des Jahres 2003 und von 5 Tet R -Stämmen (BZ002, BZ197, BZ261, BZ288, BZ291) aus Brasilien (45, 111) verwendet. Die Kultivierung von H. pylori erfolgte routinemäßig auf Columbia-Agar-Medium (Becton Dickinson, Cockeysville, Maryland, USA), dem 7% lysiertes Pferdeblut (BioTrading, Mijdrecht, Niederlande) und H. pylori Dent Selektives Supplement (Oxoid, Basingstoke, Großbritannien) zugesetzt wurde. Die sogenannten Tet-Platten enthielten zusätzlich 1 µg/ml Tetracyclin (Sigma Aldrich Chemie, Zwijndrecht, Niederlande). Im Folgenden werden die Medien ohne Tetracyclin in Abgrenzung dazu als Dent-Platten bezeichnet. H. pylori wurde auf den genannten Medien für h bei 37 C in einer mikroaeroben Atmosphäre (5% O 2, 10% CO 2, 85% N 2 ) kultiviert, die mit einem Anoxomatsystem (Mart Microbiology BV, Lichtenvoorde, Niederlande) erzeugt wurde. Die Klonierungen erfolgten im E. coli-stamm DH5α MCR. Die Bakterien wurden über Nacht in Flüssigmedium (L Broth, BioTrading, Mijdrecht, Niederlande) oder auf Luria- Bertani Platten (LB Medium, BioTrading, Mijdrecht, Niederlande) bei 37 C in aerober Atmosphäre angezüchtet. Zur dauerhaften Lagerung bei -80 C wurden die Bakterien mit einem sterilen Wattetupfer abgenommen und in Rotterdam in Hirn-Herz-Glucose Bouillon (BHI, Oxoid, Basingstoke, Großbritannien) und 15% Glycerol suspendiert. In Freiburg wurden sie in ein Cryobank TM - System (Mast Diagnostica, Rheinfeld, Deutschland) eingeimpft, dem anschließend die überschüssige Flüssigkeit abgezogen wurde.
26 MATERIAL UND METHODEN MHK-Bestimmung Modifiziertes Agardiffusionsverfahren (E-Test) Das Agardiffusionsverfahren dient der Bestimmung des sogenannten MHK-Werts (Minimale Hemmkonzentration), der entweder in mg/l oder µg/ml angegeben wird. Dieser Wert entspricht der geringsten Konzentration des Anitibiotikums, bei dem kein bakterielles Wachstum mehr erkennbar ist. Routinemäßig wurde die MHK mit Hilfe von E-Test- Streifen (AB Biodisk, Solna, Schweden) bestimmt. In diesen Streifen befindet sich das Antibiotikum in einem Konzentrationsgradienten. Es diffundiert in die Agarplatte und der Bakterienrasen lässt nach 2-3 Tagen Wachstum einen Hemmhof erkennen. Die MHK wird am Schnittpunkt des Hemmhofes mit dem E-Teststreifen auf der Messskala abgelesen. Nach der Standardmethode in Rotterdam wurden die Bakterien nach 1-2 Tagen in Kultur in 1 ml PBS (Tabelle 2.6) aufgenommen und die optische Dichte bei einer Wellenlänge von 600 nm (OD 600 ) gemessen. Die Suspensionen wurden dann mit PBS auf eine OD 600 =4 (ca. 2* 10 9 CFU/ml) verdünnt. Davon wurden 100 µl (etwa 2* 10 8 CFU) auf eine Columbia Agar Platte verteilt. Nachdem die Oberfläche nach 3-4 min getrocknet war, wurde der E- Test Streifen steril aufgebracht. Die Inkubation der Bakterien erfolgte für 2-3 Tage bei 37 C unter mikroaeroben Bedingungen. Danach wurde die Inhibitionszone den Anweisungen des Herstellers gemäß abgelesen. Stämme mit einer MHK 4 µg/ml in dieser E-Test-Methode galten als hoch-resistent gegen Tetracyclin (42, 72). Zusätzlich wurden Stämme mit einer MHK 1 µg/ml und < 4 µg/ml als niedrig-resistent klassifiziert. Alle Stämme wurden in Freiburg nochmals nach der dortigen Standardmethode für E- Tests gemessen. Die Bakterien wurden nach 1-2 Tagen in Kultur mit einer Einwegoese in 3 ml 0,9 % NaCl-Lösung bis zu einer McFarland-Dichte von ca. 2 suspendiert. Die 3 ml wurden komplett auf eine Iso-Sensitest-Agar-Platte (Oxoid, Basingstoke, Großbritannien) mit 10 % Pferdeblut gegeben, für etwa 10 s geschüttelt und wieder abgegossen. Die verbliebene Flüssigkeit wurde mit einer Pipette abgenommen, und die Platten wurden mit geöffneten Deckel bei 37 C getrocknet. Nach etwa min wurde der E-Test-Streifen steril aufgebracht, und die Platten unter mikroaeroben Bedingungen bei 37 C inkubiert. Nach 2 Tagen konnte die Inhibitionszone nach Anweisung des Herstellers abgelesen werden.
27 MATERIAL UND METHODEN Agardilutionsverfahren Das Agar-Dilutionsverfahren gilt als der Goldstandard für die Bestimmung der MHK. Hier werden Agarplatten, die bestimmte Antibiotikakonzentrationen enthalten mit dem Bakterium beimpft. Nach zwei Tagen kann der MHK-Wert abgelesen werden. Er enspricht der niedrigsten Antibiotikakonzentration der Agarplatte ohne erkennbares Wachstum. Für den Agar-Dilutions-Test wurden Iso-Sensitest-Agar-Platten (Oxoid, Basingstoke, Großbritannien) mit 10% Pferdeblut und Tetracyclin-Konzentrationen von 0,1 bis 128 µg/ml (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1; 2; 3; 4; 8; 16; 32; 64; 128 µg/ml) angefertigt. Nach 1-2 Tagen in Kultur auf Dent-Platten wurden die Bakterien in 1 ml PBS (Tabelle 2.6) suspendiert, auf eine OD 600 =0,5 verdünnt und mit einem AM 80 Automatic Inoculator (Denley Tech, Billinghurst, Großbritannien) als einzelne Tropfen auf den Platten aufgebracht. Nach 2 Tagen Inkubation unter mikroaeroben Bedingungen und 37 C wurde das Wachstum auf den Platten abgelesen. Vor den Messungen der optischen Dichte wurden die Bakterien mit Hilfe einer Gram-Färbung überprüft DNA-Extraktion Die DNA-Extraktion erfolgte nach zwei verschiedenen Protokollen. Das erste, welches nur zu einer geringen Aufreinigung führte, wurde benutzt, wenn nur wenige Zellen zur Verfügung standen und deren DNA als Template für eine PCR verwendet wurde. Dazu wurden die Bakterien in 1 ml PBS (Tabelle 2.6) aufgenommen, zentrifugiert ( g) und in 100 µl TE 0.1 (Tabelle 2.6) resuspendiert. Die Suspension wurde für 10 Minuten auf 100 C erhitzt und danach für 5 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit ( g) zentrifugiert. Vom Überstand wurden 10 µl abgenommen und 1:10 oder 1:20 in destilliertem H 2 O verdünnt. Das zweite Protokoll eignete sich, falls genügend Zellmaterial vorhanden war, sowohl für die Isolation von Template-DNA für die PCR als auch zur Aufreinigung von Kontroll- DNA für die natürliche Transformation. Hierzu wurden die Bakterien in 1 ml PBS gewaschen, in 800 µl TE 50 (Tabelle 2.6) resuspendiert und mit 2 mg Lysozym (Sigma, St. Louis, USA), 2 mg Protease (Sigma, St. Louis, USA) und 30 µl 10% SDS (Tabelle 2.6) behandelt. Nach einstündiger Inkubation erfolgte die DNA-Extraktion zunächst mit 400 µl PCI und danach mit 400 µl CI (Tabelle 2.6). Mit 100 µl Natriumacetat (3M, ph 5.2) und nachfolgend 600 µl Isopropanol wurde die DNA präzipitiert und mit 20 C kaltem 70%igem Ethanol gewaschen. Nach Lösung in TE 0.1 wurde die verbleibende RNA mit
28 MATERIAL UND METHODEN 0,5 mg RNAse (Promega, Madison, USA) entfernt. Die gewonnene DNA wurde sofort weiterverarbeitet oder bei 20 C gelagert Polymerase-Kettenreaktion Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR, engl. polymerase chain reaction) dient der Amplifikation bestimmter DNA-Abschnitte (115). Zwei selektive Oligonukleotide (Primer) hybridisieren an den Enden des gewünschten Abschnittes an die DNA, und mit Hilfe einer hitzestabilen Taq-DNA-Polymerase werden weitere Nukleotide angebaut. Durch regelmäßige Veränderung der Temperatur verläuft die Reaktion zyklisch. Zunächst wird die DNA bei 95 C denaturiert, d.h. in die Einzelstränge aufgetrennt, danach erfolgt das Annealing, also das Anlagern der Primer bei C. Bei 72 C, dem Temperaturoptimum der Taq-DNA-Polymerase, kommt es zur Elongation des DNA-Stranges, d.h ausgehend vom 3 -Ende des Primers wird die komplementäre DNA synthetisiert. In einem Zyklus werden so aus einem Ausgangs-Doppelstrang zwei neue, die je zur Hälfte de novo synthetisiert wurden. Durch 35-fache Wiederholung können theoretisch bis zu 2 35 identische DNA-Fragmente hergestellt werden. Die PCR wurde mit dem PCR Core System I (Promega, Madison, Wisconsin, USA) in einem Thermocycler (icycler, BioRad, Kalifornien, USA) durchgeführt. Die 50 µl Ansätze enthielten jeweils 25 pmol Primer und etwa 25 pg Template-DNA. Die PCR-Programme für die jeweiligen Primer sind in Tabelle 2.5 zu finden. Die Auftrennung des PCR Produktes erfolgte in 1 und 1,5%igen ethidiumbromidhaltigen TBE-Agarosegelen in TBE-Puffer (Tabelle 2.6). Sichtbar gemacht und fotografisch dokumentiert wurde das Ergebnis mit Hilfe eines Imago (B&L Systems, Maarssen, Niederlande) Primer Der Abschnitt der beiden 16S rrna-gene rrna und rrnb, welcher für die primäre Bindungstasche von Tetracyclinen codiert, wurde mit dem Oligonukleotidprimerpaar 696F und 1245R (Tabelle 2.4) amplifiziert. Die Produkte wurden zur Sequenzierung verwendet. Die Primerpaare rrna-f rrna/rrnb-r und rrnb-f rrna/rrnb-r (Abb. 2.1) wurden zur Differenzierung von rrna und rrnb eingesetzt. Die anderen Primer in Tabelle 2.3 wurden für die natürliche Transformation verwendet. Alle Oligonukleotidprimer stammen von der Firma Isogen, Maarsen, Niederlande.
29 MATERIAL UND METHODEN a rrna-f rrna/rrnb-r HP1144 rrna b rrnb-f rrna/rrnb-r HP1439 rrnb Abb. 2.1: PCR-Ansatz zu Differenzierung zwischen rrna und rrnb Da sich die Sequenz zwischen rrna und rrnb erst einige hundert Basenpaare upstream unterscheidet, befinden sich die Vorwärtsprimer nicht mehr im 16S rrna-gen a Schematische Anordnung der rrna und des dafür spezifischen Primerpaares rrna-f rrna/rrnb-r b Schematische Anordnung der rrnb und des dafür spezifischen Primerpaares rrnb-f rrna/rrnb-r Sequenzierung und Analyse Sequenziert wurde von BaseClear Inc., Leiden, Niederlande nach der Didesoxynukleotidterminationsmethode nach Sanger. Die Daten wurden mit Hilfe von Chromas (Technelysium Software, Helensvale, Australien) und in Sci Ed Central (Scientific & Educational Software, Durham, N.C.) analysiert. Die zum Vergleich verwendeten Sequenzen stammen aus der NCBI database (National Center of Biotechnology Information, Los Alamos, New Mexico, USA).
30 MATERIAL UND METHODEN 2.2 Transformation Erstellung der Transformanten Mit Hilfe der PCR wurde die Substitution von 1, 2 und 3 Basenpaaren (Tabelle 2.1) an Postition (Nummerierung bezieht sich auf 16S rrna Gen von H. pylori 26695) im rrna und rrnb Gen vorgenommen. Zunächst wurden alle Möglichkeiten zwischen der Tet S Sequenz AGA und der bekannten Tet R Sequenz TTC gewählt. In Anlehnung an die Publikation von Dailidiene et al. in der die Sequenzen GGA, GTA und GGC an Postition aus klinischen Isolaten aus Litauen, El Salvador und Indien beschrieben wurde (25), erfolgte später noch die Herstellung der vier möglichen Sequenzen mit Guanin an Position 926 (Tabelle 2.1). Tabelle 2.1: Basenpaarsubstitutionen in rrna und rrnb Anzahl der Substitutionen Substitutionen a Substitutionen b 1 Basenpaar TGA, ATA, AGC GGA 2 Basenpaare TTA, TGC, ATC GTA, GGC 3 Basenpaare TTC GTC Die unterstrichenen Buchstaben stehen für die veränderten Basenpaare gegenüber der Wildtypsequenz, bzw. der Sequenz von H. pylori an Position der rrna. a Möglichkeiten zwischen AGA und TTC b entsprechend Dailidiene et al. (25) Mit der chromosomalen DNA von Stamm als Vorlage wurde mit den Primern 711F und R1 bis R11 (Tabelle 2.3, Figur 2.2) ein erstes Genprodukt amplifiziert, mit den Primern F1 bis F11 und 1071R (Tabelle 2.3, Figur 2.2) ein zweites. Die Produkte wurden aufgereinigt (QIAquick PCR Purification Kit, Qiagen GmbH, Hilden, Deutschland), 1:100 verdünnt und in gleichen Anteilen gemischt. Dieses DNA-Gemisch war Vorlage für die dritte PCR mit den Primern 711F und 1071R (Tabelle 2.3, Abb. 2.2). Hier wirkten die beiden PCR-Produkte als eine Art Mega-Primer mit einem Hybridisierungsbereich von 20 Basenpaaren, von denen ausgehend dann der Komplementärstrang synthetisiert wurde. Die Primer 711F und 1071R wurden in dem Ansatz zusätzlich benötigt, um das Fragment ausreichend zu vervielfältigen. Das Produkt der dritten PCR wurde dann in einen pgem -T easy vector (Promega, Madison, Wisconsin, USA) geklont, um sicher zu stellen, später nur mit DNA-Fragmenten, die die gewünschten Basenpaarsubstitution enthalten, zu transformieren. Um die Anwesenheit der erwünschten Mutation zu kontrollieren wurde mit Hilfe der M13 Forward
31 MATERIAL UND METHODEN und Reverse Primer sequenziert. Mit dem gereinigten Vektor und einem PCR-Produkt des Vektors (711F 1071R) wurden diese Basenpaarsubstitutionen mit einer natürlichen Transformation in H. pylori übertragen. Wildtyp 16S rrna Gen PCR 1 711F * R1-11 PCR 2 F1-11 * 1071R PCR 3 711F * 1071R Substitution * Abb. 2.2: PCR-Ansatz zum Einfügen der verschiedenen Mutationen Als Vorlage für PCR 1 und PCR 2 diente chromosomale DNA von H.pylori-Stamm Das Sternchen steht für die Basenpaarsubstitution. Für PCR 1 wurde das Primerpaar 711F R1 bis R11 (Tabelle 2.3), für PCR 2 das Primerpaar F1 bis F R (Tabelle 2.3) verwendet. Im dritten Ansatz wurden ein äquimolarer Mix der beiden aufgereinigten Produkte als neues Template mit den Primern 711F 1071R verwendet.
32 MATERIAL UND METHODEN Herstellung der kompetenten E. coli E. coli Stamm DH5α MCR wurde über Nacht in Flüssigkultur (L Broth, BioTrading, Mijdrecht, Niederlande) angezüchtet, dann verdünnt (1:100) und für weitere 2 h bei 37 C inkubiert, um die Bakterien in die mittlere logarithmische Phase zu bringen. Nach Zentrifugation bei 4 C wurde das Pellet in Waschpuffer (Tabelle 2.6) gelöst, auf Eis gelegt, wieder zentrifugiert, in Freezing Puffer (Tabelle 2.6) gelöst und bei 80 C eingefroren. Alle Inkubationen von E. coli erfolgten als Schüttelkultur (120 rpm) unter aeroben Bedingungen bei 37 C Klonierung in E. coli Die PCR Produkte wurden den Herstellerangaben ensprechend aufgereinigt (QIAquick PCR Purification Kit, Qiagen GmbH, Hilden, Deutschland) und über Nacht bei 16 C in den pgem -T Easy Vector (Figur 2.3) ligiert (1 µl T4 DNA Ligase, 1 µl Vektor, 10 µl PCR Produkt, T4 DNA Ligase Kit, Promega). Dieser kommerzielle Vektor enthält eine Ampicillin-Resistenz-Kassette Amp R und ein β-galaktosidasegen lacz. Zehn µl des jeweiligen Ligationsprodukts wurde direkt zu den kompetenten E. coli Zellen gegeben, und mit einem Hitzeschock (45 min auf Eis, 90 s im Wasserbad bei 42 C, danach 90 s auf Eis) wurde die Aufnahme der DNA erleichtert. Nach 45 min Erholung in L-Broth (BioTrading, Mijdrecht, Niederlande) bei 37 C wurden die Zellen auf Selektivmedium (LB Medium, Ampicillin [100 µg/ml], X-Gal [5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid 50 µg/ml] auf der Plattenoberfläche) verteilt, auf dem nur noch Bakterien, die das Plasmid aufgenommen haben, Kolonien bilden können. Eine Insertion in das lacz-gen des Plasmids führt zu dem Verlust der β-galaktosidaseaktivität des Bakteriums. Somit ist es nicht mehr fähig, auf X-Gal-haltigem Medium blaue Kolonien zu bilden. Nach Übernachtinkubation bei 37 C wurden die weißen Kolonien, in denen eine Insertion in lacz stattgefunden hatte, isoliert und in selektivem Flüssigmedium (L-Broth, Ampicillin [100 µg/ml]) weiter propagiert. Dieses Medium enthielt weiterhin Ampicillin, damit nur E. coli mit Plasmid überleben konnten. Das vervielfältigte Plasmid aus diesen Kulturen wurde nun isoliert (WizardR Plus SV Minipreps DNA Purification Kit, Quiagen GmbH, Hilden, Deutschland).
33 MATERIAL UND METHODEN Abb. 2.3: Genschema des pgem -T Easy Vector Natürliche Transformation mit H. pylori H. pylori Stamm wurde jeweils mit ca. 1 µg aufgereinigtem Plasmid transformiert. Zusätzlich wurde mit Hilfe der Primer 711F 1071R vom Plasmid der gewünschte DNA- Abschnitt amplifiziert. Ca. 250 ng dieses PCR-Produkts wurden ebenfalls zur Transformation verwendet. Dazu wurden Bakterien aus der Stammkollektion von 80 C auf Columbia Agar Platten gebracht und für 2 Tage bei 37 C und mikroaeroben Bedingungen inkubiert. Die frisch gewachsenen Bakterien wurden als kleine, etwa 2 cm durchmessende Areale auf frische Dent-Platten aufgetragen. Nach 5 bis 6 h Inkubation wurde die DNA dazugegeben und auf dem gesamten Areal verteilt. Die Bakterien wurden über Nacht inkubiert und am folgenden Tag auf selektives Medium ausgebracht (Tet-Platten). Einzelne Kolonien wurden nach 5 bis 8 Tagen auf Dent- und auf Tet-Platten übertragen, kultiviert und der Stammkollektion hinzugeführt. Außerdem wurde DNA isoliert, mit den Primerpaaren 711F 1071R und 696F 1245R (Tabelle 2.3 und 2.4) amplifiziert und sequenziert. Als positive und negative Kontrollen wurde immer zusätzlich mit DNA von Tet R Stamm 181, DNA von Tet S Stamm und TE 0.1 (Tabelle 2.6) transformiert.
34 MATERIAL UND METHODEN 2.3 Stabilitäts-Experiment Die Bakterienstämme mit den 1-3 Basensubstitutionen wurden aus der gefrorenen Stammsammlung jeweils auf Dent-Platten und Tet-Platten 20 mal subkultiviert, d.h. ein Teil der Bakterien wurde nach 1-3 Tagen auf eine frische Platte übertragen. Nach den Kultivierungsschritten 1, 5, 10, 15, 20 wurde ein Teil der Bakterien für die Stammsammlung eingefroren und die MHK mittels E-Test bestimmt. Außerdem wurde nach Schritt 1 und 20 die primäre Bindungstasche für Tetracyclin in den 16S rrna-genen sequenziert, um die Stabilität der eingefügten Mutation zu überprüfen. 2.4 Bestimmung des Wachstumsverhaltens in Flüssigkultur Die verschiedenen Mutanten wurden 2 Tage lang mit einer Start OD 600 =0,05 in Flüssigmedium (Brucella Broth, Biotrading; 3% Newborn Calf Serum, Gibco BRL/Invitrogen, Breda, Niederlande; Dent Selektives Supplement) vorkultiviert. Danach wurden sie in Erlenmeyerkolben sowohl ohne als auch mit Tetracyclin (1 µg/ml) weiterkultiviert. Dazu wurde die Vorkulturen in 10 ml frischem Flüssigmedium auf eine OD 600 =0,05 verdünnt und nach 24, 48 und 72 h die OD 600 gemessen. Die Messung der optischen Dichte erfolgte mit einem NovaSpecII Visible Spectrophotometer (Pharmacia Diagnostics, Piscataway, New Jersey, USA). Die Kulturen wurden zusätzlich zu Beginn und nach jeder Messung der optischen Dichte nach GRAM gefärbt, um die Morphologie der Bakterien zu überprüfen. Die Inkubation erfolgte im Dunkeln als Schüttelkultur (60 rpm) bei 37 C unter mikroaeroben Bedingungen Messung der Koloniegrösse Die Bakterienstämme wurden zunächst 2-3 Tage auf Dent Platten vorkultiviert, dann in 1 ml PBS aufgenommen und auf eine OD 600 =1 verdünnt. Die Vitalität der Bakterien wurde mit Hilfe der Gram-Färbung bestätigt. Von der Bakteriensuspension wurden verschiedene Verdünnungen auf Dent-Platten (10-5, 10-6, 10-7 ) und Tet-Platten (10-4, 10-5, 10-6 ) ausplattiert. Nach 24, 48 und 72 h Inkubation wurden auf Platten mit etwa 100 Kolonien willkürlich 10 ausgewählt und deren Durchmesser bei 5-20 facher Vergrößerung (PAG-1, Zeiss, Oberkochen, Deutschland) gemessen.
35 MATERIAL UND METHODEN 2.5 Restriktionsenzymverdau mit HinfI Mit Hilfe von Restriktionsenzymen können DNA-Abschnitte an den für die verschiedenen Enzyme spezifischen Stellen geschnitten werden. Befinden sich die Erkennungssequenzen der Enzyme an Stellen, an denen Mutationen vorkommen, so unterscheidet sich das Muster der resultierenden DNA-Fragmente, was als Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP) bekannt ist. Zunächst erfolgte die Amplifikation des DNA-Abschnittes (Primerpaar 711F 1071R) der 16S rrna-gene mit aufgereinigter genomischer DNA. Danach wurden die Fragmentierung der PCR-Produkte mit dem Restriktionsenzym HinfI (Boehringer Mannheim GmbH, Deutschland) nach den Angaben des Herstellers durchgeführt. Eine 20 µl Reaktionsmischung enthielt 12 µl destilliertes Wasser, 5 µl PCR-Produkt, 2 µl 10-fach konzentrierten Reaktionspuffer (SuRE/Cut Buffer H, Boehringer Mannheim GmbH, Deutschland) und 1 µl des Restriktionsenzyms. Während der Inkubation des Ansatzes für 60 Minuten bei 37 C wurden die PCR-Produkte durch das Restriktionsenzym verdaut, danach auf einem 2%igen ethidiumbromidhaltigen TBE-Agarosegelen in TBE-Puffer (Tabelle 2.6) aufgetragen und gelelektrophoretisch aufgetrennt.
36 MATERIAL UND METHODEN 2.6 Mutationsdetektion mit einer FRET-basierten Realtime-PCR Mit dem LightCycler -System, das auf dem Prinzip einer Realtime-PCR beruht, können bei der Verwendung von sogenannten Hybridisation Probes spezifische PCR Produkte detektiert werden (141). Mit Hilfe einer Schmelzkurvenanalyse gelingt die Abgrenzung einzelner Mutationen voneinander. Fluorescein gtggagcatgtggtttaattc 5 -aagcggtggagcatgtggtttaattcgaagatacacgaagaaccttacct- 3 gaagatacacgaagaaccttacc LC Red 640 Abb. 2.4: Sequenzausschnitt der 16S rrna mit angelagerten Hybridisation Probes Schematische Anlagerung der Anchor Probe (über der Sequenz) und der Mutation Probe (unter der Sequenz) an die Wildtyp 16S rrna ( : AGA, rot hevorgehoben) von Position a a Zur Veranschaulichung wurde in diesem Schema das Gen in der Transkriptionsrichtung angegeben. Die Hybridisation Probes binden jedoch an den Komplemantärstrang. Zu einem normalen PCR-Ansatz werden zusätzlich zwei sequenzspezifische Oligonukleotide (Hybridisation Probes) gegeben. Diese müssen zwischen den Primern in räumlicher Nähe (1-5 Basenpaare) zueinander an den Abschnitt der DNA binden, in dem Mutationen gefunden werden sollen. Die beiden Hybridisation Probes sind jeweils an einen unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoff (Fluorescein und LC Red 640) gebunden. Wird nun das Fluorescein angeregt, ist es in der Lage die Energie auf LC Red 640 zu übertragen, wodurch dieses eine rote Fluoreszenz emittiert. Das sogenannte FRET-Prinzip (engl. fluorescence resonance energy transfer) funktioniert nur dann, wenn beide Fluoreszenzfarbstoffe sich in räumlicher Nähe zueinander befinden. Das trifft jedoch nur dann zu, wenn die beiden Hybridisation Probes an ihre jeweilige Ziel-DNA gebunden sind. Ansonsten diffundieren sie frei in der Lösung. Die Intensität der Fluoreszenz ist proportional zur Menge der Ziel-DNA und wird jeweils nach dem Annealing in jedem Zyklus gemessen. Eine der beiden Hybridisation Probes, die sog. Mutation Probe bindet genau im Bereich der gesuchten Mutation an den Wildtyp (Abb. 2.4). Befindet sich dort jedoch eine Mutation, ist die Bindung weniger stark, d.h. sie schmilzt bei einer niedrigeren Temperatur. Trägt man die Abnahme der Fluoreszenz gegenüber der Zeit auf, so erhält
37 MATERIAL UND METHODEN man als erste Ableitung dieser Kurve eine Schmelzkurve, deren Maximum der Schmelztemperatur entspricht. Für die Detektion der 16S rrna-mutation wurden zwei Hybridsation Probes (TIB Molbiol, Berlin, Deutschland) verwendet: eine Anchor Probe (hybridisiert an Nukleotide ), die am 3 -Ende mit Fluorescein (Tabelle 2.2) markiert ist, und ein Mutation Probe (hybridisiert an Nukleotide ), welche am 5 -Ende an LC Red 640 (Tabelle 2.2) gebunden ist. Die PCR wurde in 20 µl Ansätzen in Glasskapillaren (Roche Diagnostics, Deutschland) mit einem LightCycler (Roche Diagnostics, Deutschland) durchgeführt. Der PCR-Mix enthielt 10 µl QuantiTect Probe PCR Master Mix (Quiagen, Hilden, Deutschland), je 0,4 µl (enspricht 25 µm) der Primer 711F und 1071R (Tabelle 2), je 0,2 µl (enspricht 20 µm) der beiden Hybridisation Probes, 6,8 µl H 2 O und 2 µl Ziel- DNA. Tabelle 2.2: Hybridisation Probes für die Detektion der Mutation an Position der 16S rrna Hybridsation Probes Sequenz (5-3 ) Anchor Probe a Mutation Probe b a am 3 -Ende mit Fluorescein markiert b am 5 -Ende mit LC Red 640 markiert GTG GAG CAT GTG GTT TAA TTC GAA GAT ACA CGA AGA ACC TTA CC Das Temperaturprofil der Realtime-PCR begann mit einem initialen Denaturierungsschritt bei 95 C für 15 min, gefolgt von 50 Zyklen mit jeweils einer Denaturierung bei 95 C für 20 s (Aufheizrate 20 C/s), einem Annealing bei 53 C für 20 s (Abkühlrate 20 C/s) und einem Elongationsschritt bei 72 C für 30 s (Aufheizrate 2 C/s). Nach der Amplifikation wurden die Proben kurzzeitig auf 95 C erhitzt und dann für 30 s auf 30 C abgekühlt. Danach erfolgte eine langsame Erhitzung bis auf 85 C mit einer Aufheizrate von 0,1 C/s, währenddessen kontinuierlich die Fluoreszenz gemessen wurde. Die Schmelzkurven wurden aufgezeichnet und mit der LightCycler -Software (Roche Diagnostics, Deutschland) ausgewertet. Die beschriebenen Untersuchungen wurden mit H. pylori-dna der Tet S -Stämme 26695, der Tet R -Stämme 181, BZ002, BZ197, BZ261, BZ288, BZ291 sowie den Mutanten ATA, GGA, ATC, TTA, TGC, GGC, GTA, TTC und GTC durchgeführt. Zusätzlich wurde die Detektionsmethode noch mit DNA von 50 verschiedenen Tetracyclin-sensiblen Stämmen aus der Routinediagnostik des Jahres 2003 des Nationalen Referenzzentrums für Helicobacter pylori in Freiburg kontrolliert.
38 MATERIAL UND METHODEN 2.7 Tabellen Tabelle 2.3: Primer für 1-3 bp Substitution Primer Name Primer Sequenz (5'-3') a 16S rdna Mutation 711F CTGACGCTGATTGCGCGAAA 1071R TCGTTGCGGGACTTAACCCA F1 TAATTCGATGATACACGAAG A 926 T F2 TAATTCGAATATACACGAAG G 927 T F3 TAATTCGAAGCTACACGAAG A 928 C F4 TAATTCGATTATACACGAAG AG TT F5 TAATTCGATGCTACACGAAG A 926 T und A 928 C F6 TAATTCGAATCTACACGAAG GA TC F7 TAATTCGATTCTACACGAAG AGA TTC F8 TAATTCGAGGATACACGAAG A 926 G F9 TAATTCGAGTATACACGAAG A 926 G, G 927 T F10 TAATTCGAGGCTACACGAAG A 926 G, A 928 C F11 TAATTCGAGTCTACACGAAG AGA GTC R1 CTTCGTGTATCATCGAATTA A 926 T R2 CTTCGTGTATATTCGAATTA G 927 T R3 CTTCGTGTAGCTTCGAATTA A 928 C R4 CTTCGTGTATAATCGAATTA AG TT R5 CTTCGTGTAGCATCGAATTA A 926 T und A 928 C R6 CTTCGTGTAGATTCGAATTA GA TC R7 CTTCGTGTAGAATCGAATTA AGA TTC R8 CTTCGTGTATCCTCGAATTA A 926 G R9 CTTCGTGTATACTCGAATTA A 926 G, G 927 T R10 CTTCGTGTAGCCTCGAATTA A 926 G, A 928 C R11 CTTCGTGTAGACTCGAATTA AGA GTC a Die unterstrichenen Buchstaben stehen für die veränderten Basenpaare gegenüber der Wildtypsequenz an Position , die in das Genom eingefügt werden sollten.
39 MATERIAL UND METHODEN Tabelle 2.4: Primer für gesamte Tetracycline Bindungstasche und zur Differenzierung von rrna/rrnb Primer Name Primer Sequenz (5'-3') 696F CCTGCTGGAACATTACTGAC 1245R TGGCTCCACTTCGCAGTATT rrna-f CCCAAATCCTTGAGCGTTTA rrnb-f CGCATTCATAATCAGCTCAG rrna/rrnb-r TAGTTGTTGGAGGGCTTAGT Tabelle 2.5: PCR Programme Primerpaar Zyklen PCR Programme 711F 1071R 35x 95 C für 15 s, 50 C für 30 s, 72 C für 45 s 711F R x 95 C für 15 s, 45 C für 30 s, 72 C für 45 s F R 696F 1245R 35x 95 C für 15 s, 50 C für 30 s, 72 C für 1 min rrna-f rrna/rrnb-r rrnb-f rrna/rrnb-r 35x 95 C für 30 s, 50 C für 30 s, 72 C für 2 min Tabelle 2.6: Zusammensetzung verschiedener Puffer und Lösungen PBS 4 mmol/l Phosphat [ph 7.3] TE mm Tris-HCl: 0,1 mm EDTA [ph 8.0] TE mm Tris-HCl; 50 mm EDTA; [ph 8.0] TBE 1 M Tris; 0,9 M Borsäure; 0,01 M EDTA PCI Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1 CI Chloroform:Isoamylalkohol 24:1 Waschpuffer 10 mm Tris ph 8.0; 50 mm CaCl 2 ; 10 mm MgCl 2 Freezing Puffer 15% Glycerol; 10 mm Tris ph 8.0; 50 mm CaCl 2 ; 10 mm MgCl 2 SDS Natriumdodecylsulfat
40 ERGEBNISSE 3 Ergebnisse 3.1 Herstellung der verschiedenen 16S rrna-transformanten Der bekannte Mechanismus der Tetracyclin-Resistenz von Helicobacter pylori ist eine Dreifachmutation in der 16S rrna. Die resistenten Stämme weisen in beiden Kopien des Gens, rrna und rrnb, anstatt AGA im Tet S -Wildtyp das Triplett TTC an Position auf (42, 133). Um den Effekt auf die Tetracyclin-Resistenz von verschiedenen Mutationen in der 16S rrna in diesem Bereich festzustellen, wurden mit Hilfe der natürlichen Transformation Substitutionen im vollständig sequenzierten Tet S -H. pylori Stamm von 1, 2 und 3 Basenpaaren vorgenommen (TGA, ATA, AGC, TTA, TGC, ATC, TTC [unterstrichene Buchstaben stehen für Substitutionen gegenüber dem Tet S -Elternstamm]). Auf Tetracyclin-haltigen Platten (1 µg/ml) wurden die resistenten Kolonien selektiert. Bei den Transformationen konnten mit der DNA, die alle sieben verschiedenen Substitutionen enthielt, und der positiven Kontrolle (DNA von Tet R -Stamm 181) nach etwa 5 bis 7 Tagen Kolonien gewonnen werden. Bei den negativen Kontrollen mit TE 0,1 und DNA von Tet S waren keine Kolonien sichtbar. Generell war die Effizienz der natürlichen Transformation bzw. der Selektion gering, besonders bei Substitutionen von nur einem Basenpaar. Dort waren entweder keine oder nur wenige, sehr kleine Kolonien auf den selektiven Tetracyclin-Platten zu finden. Für jede Kombination von Basenpaarsubstitutionen wurden 8 Kolonien von mindestens zwei verschiedenen Transformationexperimenten gewonnen. Mit Hilfe des Primerpaares 711F 1071R wurde der entsprechende Teil der 16S rrna amplifiziert und sequenziert. Hierbei konnten die Erfolge der Substitutionen gezeigt werden. Sechs der sieben unterschiedlichen Mutanten waren immer homozygot in beiden 16S rrna-genen. Nur bei den Mutanten mit einer Basenpaarsubstitution AGC konnten in der Sequenzanalyse an Position 926 und 927 doppelte Spitzen gesehen werden (926: T und A; 927: T und G) (Abb. 3.1). Mit Hilfe des Primerpaares rrna-f rrna/rrnb-r und rrnb-f rrna/rrnb-r konnten die beiden Gene der 16S rrna getrennt amplifiziert werden. Hier war festzustellen, dass eine Heterozygotie vorlag, d.h. in rrna die Sequenz AGC und in rrnb TTC. Weitere Versuche, Mutanten mit AGC in beiden 16S rrna-kopien herzustellen, waren auch bei erniedrigter Tetracyclinkonzentration (0,8 µg/ml) im Selektionsmedium nicht erfolgreich. Eine weitere Reduktion der Tetracyclinkonzentration im Selektionsmedium erwies sich als ungeeignet, da nach etwa 5 bis 6 Tagen ein Durchbruchswachstum des nicht transformierten Wildtyps auftrat.
41 ERGEBNISSE Die gewonnenen Mutanten mussten zweimal subkultiviert werden, um genügend Bakterien sowohl für eine Lagerung bei 80ºC, als auch für die Resistenztestung und die weiteren Experimente zu erhalten. Je zwei verschiedene Kolonien wurden gewählt und für die weiteren Versuche genutzt. Hier zeigte sich jedoch, dass der mit TGA transformierte Stamm schon nach diesen 2 Subkultivierungsschritten nicht mehr dieselbe Mutation aufwies, sondern konstant über mehrere Versuche das Triplett TGC vorlag. Deshalb war es bei diesem Stamm weder möglich die MHK zu messen noch weitere Versuche durchzuführen Abb. 3.1: Ergebnis der Sequenzierung (Position ) des Transformanten AGC a An Position 926 der 16S rrna-gene befindet sich sowohl ein Thymin- als auch ein Adeninrest, an Position 927 ein Thymin- und ein Guaninrest. a Sequenzierungsdaten in Chromas (Technelysium Software, Helensvale, Australien) Nachträglich wurden noch vier weitere Mutanten mit Guanin an Position 926 der 16S rrna hergestellt: GGA, GTA, GGC, GTC. Dailidiene et al. hatten von niedrig-resistenten klinischen Isolaten mit Basenpaaraustauschen an derselben Position in beiden Genen der 16 S rrna aus El Salvador (GGA) und Litauen (AGC, GTA, GGC) berichtet (25). Alle vier Mutanten konnten nach der beschriebenen Methodik hergestellt werden, wobei die Selektion des Mutanten GGA mit einem Basenpaaraustausch äußerst schwierig war und nur auf Tetracyclin-Platten mit einer Konzentration von 0,8 µg/ml gelang. Mit diesen vier nachträglich hergestellten Mutanten wurden keine Stabilitäts- und Wachstumsexperimente durchgeführt.
42 ERGEBNISSE 3.2 Stabilitätsexperiment Um die Stabilität der jeweiligen Substitutionen der 16S rrna zu überprüfen, wurden jeweils 2 der verschiedenen Transformanten 20-mal subkultiviert. Dies geschah sowohl auf Medium mit einer Tetracyclin-Konzentration von 1 µl/mg als auch auf Tetracyclin-freiem Medium. Nach den Schritten 5, 10, 15 und 20 wurden die MHK-Werte bestimmt und die Stämme eingefroren. Nachdem zu Beginn die Bakterien alle 2 bis 3 Tage auf neuen Agarplatten subkultiviert werden konnten, gingen schon etwa ab Schritt 5 die ersten Stämme nach einer Zeitspanne von 3 Tagen auf einer Platte verloren. Zwischen Schritt 10 und 15 waren schon nach 2 Tagen alle Bakterien abgestorben, so dass sie täglich auf neuen Platten subkultiviert werden mussten. Stämme, die so verloren gingen, wurden ab dem letzten Schritt, in dem sie eingefroren wurden, erneut in Kultur gebracht. Tabelle 3.1: Sequenz an Position beider 16S rrna-gene a Schritt 1 b Schritt 20 rrna rrnb rrna rrnb TGA c TGC TGC ATA ATA ATA ATA ATA AGC d AGC TTC TTC TTC TTA TTA TTA TTA TTA TGC TGC TGC TGC TGC ATC ATC ATC ATC ATC TTC TTC TTC TTC TTC a unterstrichene Buchstaben stehen für Substitutionen gegenüber dem Elternstamm b zwei Subkultivierungsschritte nach erfolgreicher Transformation c nachdem die TGA-Mutante nach 2 Subkultivierungsschritten die Sequenz TGC verändert hatte, wurde sie nicht mehr weiter subkultiviert d diese Mutante konnte nur heterozygot hergestellt werden Nach Schritt 20 wurde die primäre Bindungstasche für Tetracycline der rrna mit Hilfe der Primer 696F und 1245R amplifiziert und sequenziert, um etwaige Mutationen in der primären Bindungstasche für Tetracyclin in der 16S rrna zu finden. Die Sequenzanalyse zeigte bei den Transformanten ATA, TTA, TGC, ATC und TTC keine Veränderung gegenüber Schritt 1 (Tabelle 3.1).
43 ERGEBNISSE Bei beiden Transformanten AGC, die zu Beginn des Experiments heterozygot AGC/TTC vorlagen, fand sich nach 20 Subkultivierungsschritten TTC in beiden Genen der 16S rrna. Es konnten hier keine Unterschiede zwischen der Kultivierung mit und der ohne Tetracyclin festgestellt werden (Tabelle 3.1). 3.3 Resistenzbestimmung Zunächst erfolgte die Resistenzbestimmung nur mit dem E-Test-Protokoll des Labors der gastroenterologischen Abteilung des Erasmus MC in Rotterdam. Die MHK-Werte der Transformanten mit einer oder zwei Basenpaarsubstitution lagen nach zwei Subkultivierungschritten im Bereich zwischen 1,0 und 2,0 µg/ml. Diese Werte sind signifikant höher als der bei Tet S -Stamm (MHK 0,19 µg/ml) gemessene. Unter diesen Transformanten lagen die MHK der beiden in 2 Basenpaaren veränderten TTA und ATC immer leicht höher als die von TGC und ATA (Tab. 3.2). Bei der heterozygoten Mutante AGC/TTC fand sich zunächst auch eine MHK im Bereich von 1,5 µg/ml. Tabelle 3.2: MHK der einzelnen Mutanten nach Subkultivierungschritt 1 und 20 Mutanten Schritt 1 b Schritt 20 b ohne Tetracyclin b mit Tetracyclin b Wildtyp ,19 0,19 0,19 TGA a Nicht bestimmt Nicht bestimmt Nicht bestimmt ATA 1,5 1,5 2,0 2,0 AGC/TTC 1,5 6,0 8,0 6,0 8,0 TTA 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 TGC 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 ATC 2,0 2,0-3,0 3,0 TTC 6,0 8,0 6,0 8,0 8,0 a die Sequenz der TGA-Mutante veränderte sich schon vor der ersten Resistenztestung zu TGC. b MHK in µg/ml Der Wert für die Mutante mit der dreifachen Basensubstitution TTC lag immer zwischen 6,0 und 8,0 µg/ml, und ist somit vergleichbar mit dem Tet R -Stamm 181, der an Position in der 16S rrna das gleiche Basentriplett hat (Tabelle 3.2). Somit war die Mutante mit der Dreifachmutation TTC deutlich resistenter als die übrigen Mutanten.
44 ERGEBNISSE In den ersten 10 Subkultivierungsschritten zeigte sich bei allen Transformanten außer bei AGC/TTC keine Veränderung der MHK. Hier stieg die MHK schon nach Schritt 5 sowohl auf Tetracyclin-haltigem, als auch auf Tetracyclin-freiem Medium auf 3 µg/ml an. Bei Schritt 15 stiegen die MHK der meisten Mutanten leicht an. Die Mutante AGC/TTC verzeichnete dagegen einen deutlicheren Anstieg auf 6,0-8,0 µg/ml. Die Werte nach 20 Subkultivierungsschritten unterschieden sich kaum von denen nach 15. Zwischen der Kultivierung auf Tetracyclin-haltigem und -freiem Medium konnten keine eindeutigen Unterschiede in der MHK gesehen werden (Tabelle 3.2). Die Messung der MHK ergab für die Mutante GGA einen Wert von 0,5-0,75 µg/ml, womit sie definitionsgemäß als sensibel gilt. Die beiden Mutanten GTA und GGC mit zwei ausgetauschten Basenpaaren zeigten eine niedrige Resistenz mit MHK-Werten von 1-2 µg/ml, bzw. 1 µg/ml. Sie liegen damit in etwa im gleichen Bereich wie die anderen Mutanten mit zwei Basenpaarsubstitutionen. Die MHK der Mutanten mit drei substituierten Basenpaaren rangierte bei 4-6 µg/ml. Damit war die GTC-Mutante, ebenso wie die TTC-Mutante, eindeutig resistent gegen Tetracyclin (Tabelle 3.3). Zusätzlich wurden alle Stämme nochmals im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsklinik Freiburg sowohl nach dem dortigen E-Test Protokoll als auch mit der Agardilutionsmethode gemessen. Hier wichen die Werte beider Methoden relativ stark voneinander ab. Die Werte im E-Test (Freiburg) waren ausnahmslos niedriger, wohingegen die mit der Agardilutionsmethode gemessenen weitaus höher als die ursprünglich mit dem E-Test in Rotterdam gemessenen waren. Vergleicht man aber die Unterschiede der einzelnen Mutanten innerhalb einer Versuchsmethode, so sind diese in allen drei unterschiedlichen Ansätzen vergleichbar (Tabelle 3.3). Bei gleichen Grenzwerten für die Resistenz galten nach der Freiburger E-Test-Methode zusätzlich TGC und GGC als sensibel und TTC und GTC lediglich als gering resistent. Nach den Werten der Agardilution waren die Mutanten TTA, ATC, TTC, GTA und GTC als hoch-resistent einzustufen. In allen drei Methoden der Resistenzbestimmung waren die MHK-Werte für den Tet S -Wiltyp unter 1 µg/ml, der damit immer sensibel war.
45 ERGEBNISSE Tabelle 3.3: Die MHK-Werte der unterschiedlichen Messmethoden im Vergleich a, b Rotterdam Freiburg E-Test E-Test Agardilution Tet S -Stamm ,19 0,096 0,4 Tet R -Stamm 181 6,0 8,0 2,0 32 Schritt 1 ATA 1,5 0,75 1,0 2 AGC/TTC 1,5 1,0 1,5 16 TTA 1,5 2,0 1,0 1,5 8 TGC 1,0 1,5 0,5 0,75 2 ATC 2 1,5 16 TTC 6 8 2,0 3,0 32 GGA 0,5 0,75 0,38 0,8 GTA GGC 1 0,75 2 GTC Schritt 20 ATA 1,5 2,0 0,5 0,75 2 ohne Tetracyclin AGC/TTC TTA 2 3 1,0 1,5 8 TGC 1,5 2,0 0,75 2 ATC 2 3 1,5 16 TTC Schritt 20 ATA 2 0,75 1,0 3 4 mit Tetracyclin AGC/TTC TTA 2 3 1,5 16 TGC ATC TTC a unterstrichene Buchstaben stehen für Substitutionen gegenüber dem Elternstamm b MHK in µg/ml
46 ERGEBNISSE 3.4 Wachstumsexperiment Um festzustellen, ob die einzelnen Mutationen Unterschiede im Wachstumsverhalten des Bakteriums bedingen, wurden die verschiedenen Mutanten und der Wildtyp in Gegenwart von Tetracyclin (1 µg/ml) und unter Tetracyclin-freien Bedingungen kultiviert. Die Wachstumsversuche wurden sowohl auf Platten mit festem Medium als auch in Flüssigmedium durchgeführt. Auf den Agarplatten wurde 7 Tage lang täglich der Durchmesser von 10 zufällig ausgewählten Kolonien gemessen. In den Flüssigmedien wurde nach 24, 48 und 72 Stunden die optische Dichte bei einer Wellenlänge von 600nm (OD 600 ) bestimmt Flüssigmedium Das Wachstumsverhalten der verschiedenen Mutanten und des Wildtyps unterschied sich unter Tetracyclin-freien Bedingungen nicht (Abb. 3.2 a). Im Flüssigmedium ohne Tetracyclinzusatz wuchsen die Bakterien bis zu einer OD 600 von etwa 0,8-1 nach 48 Stunden. Danach nahm die OD 600 meist wieder etwas ab, da das Nährstoffangebot aufgebraucht war. In Flüssigmedium mit Tetracyclinzusatz konnten alle Mutanten noch wachsen, jedoch nahm ihr Wachstum unterschiedlich stark ab. Der Tet S -Wildtyp zeigte nahezu kein Wachstum. Die Mutanten mit dem Austausch eines Basenpaares, AGC und ATA, und die Mutante mit zwei Basenpaarenaustauschen TGC vermehrten sich nur sehr langsam. Die Zunahmen in der OD 600 waren fast gleich. Das Wachstum der 2-Basenpaar Mutanten TTA und ATC war demgegenüber vermehrt und deutlich schneller, jedoch noch immer geringer als beim Mutanten mit TTC (Abb. 3.2 b) Messung der Koloniegrösse Analog zu den Ergebnissen in Flüssigmedium waren unter Tetracyclin-freien Bedingungen auch bei Messung der Koloniegrösse keine Unterschiede zwischen den einzelnen Mutanten und dem Wildtyp festzustellen. Bei einer Konzentration von 1 µg/ml Tetracyclin in den Platten konnten auch nach 7 Tagen keine Kolonien bei Tet S -Wildtyp ausgemacht werden. Bei den Mutanten war auf Tetracyclin-haltigen Platten lediglich ein Trend zu erkennen, der in die gleiche Richtung zeigte wie beim Experiment in flüssigem Medium. Die Methode war nicht geeignet um Unterschiede im Wachstumsverhalten zu zeigen (Daten nicht gezeigt).
47 ERGEBNISSE 1,2 1 0h 24h 48h 0,8 OD 600 0,6 0,4 0,2 0 AGC ATA TGC TTA ATC TTC Wildtyp Abb. 3.2 a: Wachstumsverhalten der verschiedenen Mutanten in Tetracyclin-freiem Flüssigmedium a, b 0,6 0,5 0,4 0h 24h 48h OD 600 0,3 0,2 0,1 0 AGC ATA TGC TTA ATC TTC Wildtyp Abb. 3.2 b: Wachstumsverhalten der verschiedenen Mutanten in Tetracyclin-haltigem Flüssigmedium a, b a Abszisse: Bezeichnung der untersuchten Mutanten und des Elternstammes; Ordinate: optische Dichte der Bakteriensuspension, gemessen bei 600 nm. Es sind Durchschnittswerte dreier Wachstumsexperimente zusammengefasst, was zu den relativ großen Standardabweichungen führt. b Ergebnisse von einem aus insgesamt drei Doppelexperimenten
48 ERGEBNISSE 3.5 Restriktionsanalyse der verschiedenen 16S rrna-mutationen mit HinfI Die für einen Verdau mit HinfI spezifische Sequenz lautet 5 -G ANTC-3. N steht hier für ein beliebiges Nukleotid. Der Pfeil symbolisiert die Position, an der das Enzym schneidet, also zwischen den Nukleotiden 924 und 925 bei den Mutanten mit den Sequenzen ATC, GTC und TTC. Beim Enzymverdau des PCR-Produktes der Primer 711F 1071R, welches die Basen der 16S rrna-gene enthielt, konnten beim Wildtyp und den Mutanten GGA, ATA, TGC, TTA, GTA und GGC erwartungsgemäß zwei Fragmente mit 256 und 105 Basenpaaren unterschieden werden. Bei Tet R -Stamm 181 mit TTC und den Mutanten ATC, GTC und TTC war ein anderes Muster mit jeweils drei Fragmente mit 216, 105 und 40 Basenpaaren zu finden. Bei der heterozygoten Mutation AGC/TTC konnten beide Muster und damit vier verschiedene Fragmente mit 256, 216, 105 und 40 Basenpaaren auf dem Gel differenziert werden. M M Abb. 3.3: RFLP-Muster der verschiedenen Mutanten mit dem Enzym HinfI Reihe 1-7: Wildtyp und Mutanten, die nur in zwei Fragmente zerschnitten wurden (AGA-Wildtyp, GGA, ATA, TGC, TTA, GTA, GGC); Reihe 8: die heterozygote Mutante AGC/TTC; Reihe 9-12: die Mutanten ATC, GTC, TTC und Tet R -Stamm 181, die in 3 Fragmente zerschnitten wurden. Die Fragmente sind mit Pfeilen markiert, die deren Länge in Basenpaaren angeben. M steht für den Elektrophoresemarker (1 kb-leiter)
Helicobacter pylori Diagnostik, Resistenzsituation und Therapie Diagnostik Abb. 1
 Mikrobiologische Diagnostik von Helicobacter pylori in der täglichen Praxis Helicobacter pylori Diagnostik, Resistenzsituation und Therapie Dr. rer. nat. Roland Pfüller, MDI Laboratorien GmbH MVZ, Berlin
Mikrobiologische Diagnostik von Helicobacter pylori in der täglichen Praxis Helicobacter pylori Diagnostik, Resistenzsituation und Therapie Dr. rer. nat. Roland Pfüller, MDI Laboratorien GmbH MVZ, Berlin
Tetracycline. Tetracyclin
 Tetracycline Tetracyclin Geschichte Die Tetracycline sind Antibiotika, die aus Streptomyces- Arten gewonnen werden. Sie kommen in der Erde, im Staub, im Getreide vor. Isolierung Chlorotetracycline 1948
Tetracycline Tetracyclin Geschichte Die Tetracycline sind Antibiotika, die aus Streptomyces- Arten gewonnen werden. Sie kommen in der Erde, im Staub, im Getreide vor. Isolierung Chlorotetracycline 1948
Neues über Helicobacter pylori
 Neues über Helicobacter pylori 3. Braunschweiger Endoskopietag 20. Februar 2010 Dr. med. Antje Bierschwale Hannover Helicobacter pylori konnte in einer mexikanischen Mumie, die 2000 Jahre alt ist, mittels
Neues über Helicobacter pylori 3. Braunschweiger Endoskopietag 20. Februar 2010 Dr. med. Antje Bierschwale Hannover Helicobacter pylori konnte in einer mexikanischen Mumie, die 2000 Jahre alt ist, mittels
Helicobacter pylori - neue Methoden zum Nachweis und Resistenzbestimmung. Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz
 Helicobacter pylori - neue Methoden zum Nachweis und Resistenzbestimmung Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz Ein Schluck Helicobacter pylori revolutionierte die Gastroenterologie
Helicobacter pylori - neue Methoden zum Nachweis und Resistenzbestimmung Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz Ein Schluck Helicobacter pylori revolutionierte die Gastroenterologie
Helicobacter pylori. Arbeitsgruppenleiter: Assoc.Prof. Dr. Christoph Steininger
 Helicobacter pylori Erstellt durch Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Assoc.Prof. Dr. Christoph Steininger, Prof. Dr. Michael Gschwantler am 22.02.2014 Arbeitsgruppenleiter: Assoc.Prof. Dr. Christoph
Helicobacter pylori Erstellt durch Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Assoc.Prof. Dr. Christoph Steininger, Prof. Dr. Michael Gschwantler am 22.02.2014 Arbeitsgruppenleiter: Assoc.Prof. Dr. Christoph
Eukaryotische messenger-rna
 Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende u.u. nicht-codierende Bereiche (Introns) Spleißen von prä-mrna Viele Protein-codierende Gene in Eukaryoten sind durch nicht-codierende
Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende u.u. nicht-codierende Bereiche (Introns) Spleißen von prä-mrna Viele Protein-codierende Gene in Eukaryoten sind durch nicht-codierende
Posttranskriptionale RNA-Prozessierung
 Posttranskriptionale RNA-Prozessierung Spaltung + Modifikation G Q Spleissen + Editing U UUU Prozessierung einer prä-trna Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende
Posttranskriptionale RNA-Prozessierung Spaltung + Modifikation G Q Spleissen + Editing U UUU Prozessierung einer prä-trna Eukaryotische messenger-rna Cap-Nukleotid am 5 -Ende Polyadenylierung am 3 -Ende
Helicobacter pylori Infektion im Kindesalter
 Helicobacter pylori Infektion im Kindesalter J. Crone Univ. Klinik für Kinder- und Chronisch abdominelle Schmerzen häufigster Grund einen Kinderarzt aufzusuchen Apley, 1959 Dr. Julia Crone Helicobacter
Helicobacter pylori Infektion im Kindesalter J. Crone Univ. Klinik für Kinder- und Chronisch abdominelle Schmerzen häufigster Grund einen Kinderarzt aufzusuchen Apley, 1959 Dr. Julia Crone Helicobacter
AntibiotikaResistenzmechanismen
 AntibiotikaResistenzmechanismen 20. Oktober 2011 Patricia Kahl Charlotte Schäfer Definition: Antimikrobielle Medikamentenresistenz Erworbene Fähigkeit eines Mikroorganismus, der Wirkung einer chemotherapeutisch
AntibiotikaResistenzmechanismen 20. Oktober 2011 Patricia Kahl Charlotte Schäfer Definition: Antimikrobielle Medikamentenresistenz Erworbene Fähigkeit eines Mikroorganismus, der Wirkung einer chemotherapeutisch
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen
 Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Helicobacter pylori - Eigenschaften, Diagnostik und. Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz
 Helicobacter pylori - Eigenschaften, Diagnostik und Resistenzbestimmung Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz Gastroskopie? Atemtest? Kultur? Schnelltest? PCR? Ein Schluck
Helicobacter pylori - Eigenschaften, Diagnostik und Resistenzbestimmung Tamara Savic Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz Gastroskopie? Atemtest? Kultur? Schnelltest? PCR? Ein Schluck
Frage: Führt die antibiotische Behandlung der Helicobacter pylori Infektion bei Patienten mit funktioneller Dyspepsie zur Beschwerdefreiheit?
 Funktionelle Dyspepsie: Bei Patienten mit positivem Helicobacter pylori Nachweis hilft eine Eradikation, wenn überhaupt nur wenigen Patienten (Resultate von 2 Studien) Frage: Führt die antibiotische Behandlung
Funktionelle Dyspepsie: Bei Patienten mit positivem Helicobacter pylori Nachweis hilft eine Eradikation, wenn überhaupt nur wenigen Patienten (Resultate von 2 Studien) Frage: Führt die antibiotische Behandlung
Helicobacter-pylori-Infektion. Diagnostik, primäre und erneute Therapie
 AMB 1997, 31, 17 Helicobacter-pylori-Infektion. Diagnostik, primäre und erneute Therapie Zusammenfassung: Eine Eradikation" von Helicobacter pylori nach einem erprobten Dreifachschema gilt zur Zeit als
AMB 1997, 31, 17 Helicobacter-pylori-Infektion. Diagnostik, primäre und erneute Therapie Zusammenfassung: Eine Eradikation" von Helicobacter pylori nach einem erprobten Dreifachschema gilt zur Zeit als
Antibakterielle Naturstoffe in der medizinischen Chemie
 OC 07-Vortrag Antibakterielle Naturstoffe in der medizinischen Chemie Tobias Geid Schlagwort: Selektive Toxizität (Paul Ehrlich) 1 Unterschiede zwischen menschlicher (eukaryotischer) und bakterieller (prokaryotischer)
OC 07-Vortrag Antibakterielle Naturstoffe in der medizinischen Chemie Tobias Geid Schlagwort: Selektive Toxizität (Paul Ehrlich) 1 Unterschiede zwischen menschlicher (eukaryotischer) und bakterieller (prokaryotischer)
Pathogenese und Therapie der Gastritis
 Dr. med. Ronald Berndt Dr. med. Harald Schreiber und Partner Escherichstraße 6, 91522 Ansbach Tel: (09 81) 4 88 83-0 Fax: (09 81) 4 88 83-10 E-Mail: info@patho-ansbach.de Internet: http://www.patho-ansbach.de
Dr. med. Ronald Berndt Dr. med. Harald Schreiber und Partner Escherichstraße 6, 91522 Ansbach Tel: (09 81) 4 88 83-0 Fax: (09 81) 4 88 83-10 E-Mail: info@patho-ansbach.de Internet: http://www.patho-ansbach.de
KV: Translation Michael Altmann
 Institut für Biochemie und Molekulare Medizin KV: Translation Michael Altmann Herbstsemester 2008/2009 Übersicht VL Translation 1.) Genexpression 2.) Der genetische Code ist universell 3.) Punktmutationen
Institut für Biochemie und Molekulare Medizin KV: Translation Michael Altmann Herbstsemester 2008/2009 Übersicht VL Translation 1.) Genexpression 2.) Der genetische Code ist universell 3.) Punktmutationen
Wissenschaftler entwickeln Impfstoff gegen Bakterium Heliobacter pylori
 Neue Impfung gegen Magenkrebs Wissenschaftler entwickeln Impfstoff gegen Bakterium Heliobacter pylori München (8. Februar 2010) - Jedes Jahr erkranken fast 19.000 Menschen in Deutschland neu an Magenkrebs.
Neue Impfung gegen Magenkrebs Wissenschaftler entwickeln Impfstoff gegen Bakterium Heliobacter pylori München (8. Februar 2010) - Jedes Jahr erkranken fast 19.000 Menschen in Deutschland neu an Magenkrebs.
Kolonisation oder Infektion?
 Kolonisation oder Infektion? Die physiologische bakterielle Besiedlung des Menschen Nase: Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Mund/Rachen: Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Neisseria
Kolonisation oder Infektion? Die physiologische bakterielle Besiedlung des Menschen Nase: Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Mund/Rachen: Streptococcus mutans Streptococcus pneumoniae Neisseria
Kapitel 20: 1. Nach Abschluss der Arbeiten werden sterile Arbeitsbänke und Laminar-Flow-Bänke durch sterilisiert.
 Kapitel 20: 1 Nach Abschluss der Arbeiten werden sterile Arbeitsbänke und Laminar-Flow-Bänke durch sterilisiert. A. Röntgenstrahlen B. UV -Licht C. Gamma-Strahlung D. Ionisierende Strahlung Kapitel 20:
Kapitel 20: 1 Nach Abschluss der Arbeiten werden sterile Arbeitsbänke und Laminar-Flow-Bänke durch sterilisiert. A. Röntgenstrahlen B. UV -Licht C. Gamma-Strahlung D. Ionisierende Strahlung Kapitel 20:
mrna S/D UTR: untranslated region orf: open reading frame S/D: Shine-Dalgarno Sequenz
 1. Nennen Sie die verschiedenen RNA-Typen, die bei der Translation wichtig sind. Erklären Sie die Funktion der verschiedenen RNA-Typen. Skizzieren Sie die Struktur der verschiedenen RNA-Typen und bezeichnen
1. Nennen Sie die verschiedenen RNA-Typen, die bei der Translation wichtig sind. Erklären Sie die Funktion der verschiedenen RNA-Typen. Skizzieren Sie die Struktur der verschiedenen RNA-Typen und bezeichnen
Translation. Auflesung- Proteinsynthese
 Translation Auflesung- Proteinsynthese Proteinsynthese DNA mrna Transkription elágazási hely Translation Polypeptid Vor dem Anfang Beladen der trnas spezifische Aminosäure + spezifische trna + ATP Aminoacyl-tRNA
Translation Auflesung- Proteinsynthese Proteinsynthese DNA mrna Transkription elágazási hely Translation Polypeptid Vor dem Anfang Beladen der trnas spezifische Aminosäure + spezifische trna + ATP Aminoacyl-tRNA
$"%% "! "# &"' () * +%
 $"%% "! "# &"' () * +% Steckbrief Name: Früher: Campylobacter pyloridis aktuelle Nomenklatur: Helicobacter pylori Alter: 24 Jahre (seit Erstisolierung) Aussehen: spiralförmiges, begeißeltes Bakterium Besondere
$"%% "! "# &"' () * +% Steckbrief Name: Früher: Campylobacter pyloridis aktuelle Nomenklatur: Helicobacter pylori Alter: 24 Jahre (seit Erstisolierung) Aussehen: spiralförmiges, begeißeltes Bakterium Besondere
Die antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B: Identifikation neuer Resistenzmutationen und Optimierung der Verlaufskontrolle
 Angefertigt am Fachbereich 08 - Biologie und Chemie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Virologie am Fachbereich 11- Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen Die antivirale Therapie
Angefertigt am Fachbereich 08 - Biologie und Chemie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Virologie am Fachbereich 11- Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen Die antivirale Therapie
Clostridium difficile Infektion
 Clostridium difficile Infektion Erstellt durch ao Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer und Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger am 22.10.2013 Arbeitsgruppenleiter: Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger
Clostridium difficile Infektion Erstellt durch ao Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer und Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger am 22.10.2013 Arbeitsgruppenleiter: Assoc. Prof. PD Dr. Christoph Steininger
Immunbiologie. Teil 3
 Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Teil 3 Haupthistokompatibilitätskomplex (1): - es gibt einen grundlegenden Unterschied, wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten ihr relevantes Antigen erkennen - B-Lymphozyten binden direkt an das komplette
Aspekte der Eisenresorption. PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse Binningen
 Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Translation Teil 3 Proteinfaktoren und ihre Rolle in der Proteinsynthese
 Translation Teil 3 Proteinfaktoren und ihre Rolle in der Proteinsynthese Damit die Proteinsynthese beginnen kann, müssen m-rna und fmet-trna zum Ribosom gebracht werden. Wie geschieht das??? Von entscheidender
Translation Teil 3 Proteinfaktoren und ihre Rolle in der Proteinsynthese Damit die Proteinsynthese beginnen kann, müssen m-rna und fmet-trna zum Ribosom gebracht werden. Wie geschieht das??? Von entscheidender
Labortests für Ihre Gesundheit. Warum und wann Antibiotika? 07
 Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? 07 01IPF Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? Infektionskrankheiten und ihre Behandlung heute und morgen Heutzutage ist
Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? 07 01IPF Labortests für Ihre Gesundheit Warum und wann Antibiotika? Infektionskrankheiten und ihre Behandlung heute und morgen Heutzutage ist
Antibiotika sind oft Inhibitoren der Genexpression
 Antibiotika sind oft Inhibitoren der Genexpression Inhibitoren der Transkription: Rifampicin, Actinomycin α-amanitin Inhibitoren der Translation: Puromycin, Streptomycin, Tetracycline, Chloramphenicol
Antibiotika sind oft Inhibitoren der Genexpression Inhibitoren der Transkription: Rifampicin, Actinomycin α-amanitin Inhibitoren der Translation: Puromycin, Streptomycin, Tetracycline, Chloramphenicol
Säurebedingte Magen-Darm- Erkrankungen
 Säurebedingte Magen-Darm- Erkrankungen Informationen für Patienten Seite 1 Inhalt Allgemeiner Teil Helicobacter pylori Therapiemöglichkeiten Ausgewählte Krankheitsbilder Refluxkrankheit Gastritis Magen-
Säurebedingte Magen-Darm- Erkrankungen Informationen für Patienten Seite 1 Inhalt Allgemeiner Teil Helicobacter pylori Therapiemöglichkeiten Ausgewählte Krankheitsbilder Refluxkrankheit Gastritis Magen-
TRANSKRIPTION I. Die Herstellung von RNA bei E-Coli
 TRANSKRIPTION I Die Herstellung von RNA bei E-Coli Inhalt Aufbau der RNA-Polymerase Promotoren Sigma-Untereinheit Entwindung der DNA Elongation Termination der Transkription Modifizierung der RNA Antibiotika
TRANSKRIPTION I Die Herstellung von RNA bei E-Coli Inhalt Aufbau der RNA-Polymerase Promotoren Sigma-Untereinheit Entwindung der DNA Elongation Termination der Transkription Modifizierung der RNA Antibiotika
Inhalt. Entdeckung und allgemeine Informationen. Klassifizierung. Genom Viren untypische Gene Tyrosyl-tRNA Synthetase. Ursprung von grossen DNA Viren
 Mimivirus Inhalt Entdeckung und allgemeine Informationen Klassifizierung Genom Viren untypische Gene Tyrosyl-tRNA Synthetase Ursprung von grossen DNA Viren Entstehung von Eukaryoten Entdeckung 1992 in
Mimivirus Inhalt Entdeckung und allgemeine Informationen Klassifizierung Genom Viren untypische Gene Tyrosyl-tRNA Synthetase Ursprung von grossen DNA Viren Entstehung von Eukaryoten Entdeckung 1992 in
Helicopylori. Die. bacter- Infektion. 1. Präparat: 2. Präparat: 3. Präparat: Ärztlicher Ratgeber für Patienten
 Bitte nehmen Sie die Medikamente wie folgt ein: 1. Präparat: 2. Präparat: 3. Präparat: morgens mittags abends morgens mittags abends Die Helicopylori bacter- Infektion Therapiedauer morgens mittags abends
Bitte nehmen Sie die Medikamente wie folgt ein: 1. Präparat: 2. Präparat: 3. Präparat: morgens mittags abends morgens mittags abends Die Helicopylori bacter- Infektion Therapiedauer morgens mittags abends
Mit dieser Arbeit wurde anhand einer multizentrischen und offenen Pilot- Therapiestudie die Wirksamkeit der auf Omeprazol basierenden modifizierten
 42 4. DISKUSSION Mit dieser Arbeit wurde anhand einer multizentrischen und offenen Pilot- Therapiestudie die Wirksamkeit der auf Omeprazol basierenden modifizierten Dualtherapie kombiniert mit dem Antibiotikum
42 4. DISKUSSION Mit dieser Arbeit wurde anhand einer multizentrischen und offenen Pilot- Therapiestudie die Wirksamkeit der auf Omeprazol basierenden modifizierten Dualtherapie kombiniert mit dem Antibiotikum
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Institut für Medizinische Mikrobiologie Immunologie und Parasitologie
 Inhaltsverzeichnis Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Institut für Medizinische Mikrobiologie Immunologie und Parasitologie Direktor: Prof. Dr. A. HÖRAUF 1 Direkte Erregernachweise 1 1.1 Mikroskopie..............
Inhaltsverzeichnis Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Institut für Medizinische Mikrobiologie Immunologie und Parasitologie Direktor: Prof. Dr. A. HÖRAUF 1 Direkte Erregernachweise 1 1.1 Mikroskopie..............
Personalisierte Medizin
 Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
Personalisierte Medizin Möglichkeiten und Grenzen Prof. Dr. Friedemann Horn Universität Leipzig, Institut für Klinische Immunologie, Molekulare Immunologie Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie
NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85)
 EPIDEMIOLOGISCHE KREBSREGISTRIERUNG // EINZELNE KREBSARTEN NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85) SITUATION IN DEUTSCHLAND INZIDENZ UND MORTALITÄT MÄNNER FRAUEN Altersstandardisierte Rate (/1.) Europastandard
EPIDEMIOLOGISCHE KREBSREGISTRIERUNG // EINZELNE KREBSARTEN NON-HODGKIN-LYMPHOME (C82-C85) SITUATION IN DEUTSCHLAND INZIDENZ UND MORTALITÄT MÄNNER FRAUEN Altersstandardisierte Rate (/1.) Europastandard
8 Antibiotika, Antimykotika: Spektrum Dosierung Nebenwirkungen
 8 Antibiotika, Antimykotika: Spektrum Dosierung Nebenwirkungen Amoxicillin Amoxypen j Grampositive (nicht S. aureus) und gramnegative Keime (H. influenzae ca. 10 % Resistenz) * Erwachsene, Kinder 412 Jahre
8 Antibiotika, Antimykotika: Spektrum Dosierung Nebenwirkungen Amoxicillin Amoxypen j Grampositive (nicht S. aureus) und gramnegative Keime (H. influenzae ca. 10 % Resistenz) * Erwachsene, Kinder 412 Jahre
Klinisches Management bei Helicobacter pylori- Therapieversagern
 Klinisches Management bei Helicobacter pylori- Therapieversagern Prim. Univ. Doz. Dr. Herbert Wurzer Abteilung für Innere Medizin Department für Gastroenterologie mit Infektiologie H. pylori -Therapieergebnisse
Klinisches Management bei Helicobacter pylori- Therapieversagern Prim. Univ. Doz. Dr. Herbert Wurzer Abteilung für Innere Medizin Department für Gastroenterologie mit Infektiologie H. pylori -Therapieergebnisse
Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA
 Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA Von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu
Aufbau eines Assays zur Optimierung einer Polymerase für die Generierung hochgradig fluoreszenz-markierter DNA Von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu
Immunbiologie. Teil 6
 Teil 6 Lymphatische Organe - Übersicht (1) - zusätzlich zu der Einteilung primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - kann man zwei Gruppen unterscheiden: 1. Strukturen, die embryonal angelegt
Teil 6 Lymphatische Organe - Übersicht (1) - zusätzlich zu der Einteilung primäre, sekundäre und tertiäre lymphatische Organe - kann man zwei Gruppen unterscheiden: 1. Strukturen, die embryonal angelegt
Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli
 Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli 1. Einleitung Das Bakterium Escherichia coli ist in der Lage verschiedene Substrate für seinen Stoffwechsel zu nutzen. Neben Glucose und Acetat kann es
Induktion der β-galaktosidase von Escherichia coli 1. Einleitung Das Bakterium Escherichia coli ist in der Lage verschiedene Substrate für seinen Stoffwechsel zu nutzen. Neben Glucose und Acetat kann es
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Einführung in die Immunbiologie Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de S 2 M 2 Das Immunsystem eine Übersicht Das
Urogenitale Infektionserreger mittels PCR
 Urogenitale Infektionserreger mittels PCR Dr. Monika Börner Planegg 09. September 2009 Urogenitale Infektionserreger mittels PCR Grundlagen / Allgemeines Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Mykoplasmen
Urogenitale Infektionserreger mittels PCR Dr. Monika Börner Planegg 09. September 2009 Urogenitale Infektionserreger mittels PCR Grundlagen / Allgemeines Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Mykoplasmen
Antibiotika in der Praxis mit Hygieneratschlägen
 Antibiotika in der Praxis mit Hygieneratschlägen Bearbeitet von Uwe Frank, Franz Daschner 9., vollst. überarb. Aufl. 2010. Taschenbuch. XII, 201 S. Paperback ISBN 978 3 642 10459 6 Weitere Fachgebiete
Antibiotika in der Praxis mit Hygieneratschlägen Bearbeitet von Uwe Frank, Franz Daschner 9., vollst. überarb. Aufl. 2010. Taschenbuch. XII, 201 S. Paperback ISBN 978 3 642 10459 6 Weitere Fachgebiete
Vorlesungsthemen Mikrobiologie
 Vorlesungsthemen Mikrobiologie 1. Einführung in die Mikrobiologie B. Bukau 2. Zellaufbau von Prokaryoten B. Bukau 3. Bakterielles Wachstum und Differenzierung B. Bukau 4. Bakterielle Genetik und Evolution
Vorlesungsthemen Mikrobiologie 1. Einführung in die Mikrobiologie B. Bukau 2. Zellaufbau von Prokaryoten B. Bukau 3. Bakterielles Wachstum und Differenzierung B. Bukau 4. Bakterielle Genetik und Evolution
Carbapeneme im Vergleich Stellenwert von Doripenem Mikrobiologie
 Carbapeneme im Vergleich Stellenwert von Doripenem Mikrobiologie Dr. med. Béatrice Grabein Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am KUM Béatrice Grabein Einteilung der Carbapeneme* Allgemein:
Carbapeneme im Vergleich Stellenwert von Doripenem Mikrobiologie Dr. med. Béatrice Grabein Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am KUM Béatrice Grabein Einteilung der Carbapeneme* Allgemein:
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 2 (06.06. 10.06.) DNA-Schäden, Mutationen und Reparatur 1.
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 2 (06.06. 10.06.) DNA-Schäden, Mutationen und Reparatur 1.
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016
 Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
Biologie I/B: Klassische und molekulare Genetik, molekulare Grundlagen der Entwicklung Theoretische Übungen SS 2016 Fragen für die Übungsstunde 4 (20.06. 24.06.) Regulation der Transkription II, Translation
ENDOKARDITIS-PROPHYLAXE FÜR ERWACHSENE
 ENDOKARDITIS-PROPHYLAXE FÜR ERWACHSENE Sie benötigen gemäss den geltenden Empfehlungen eine vorbeugende Behandlung gegen eine bakterielle Endokarditis. Vorname Name Geburtsdatum Herzfehler Penicillin-Allergie
ENDOKARDITIS-PROPHYLAXE FÜR ERWACHSENE Sie benötigen gemäss den geltenden Empfehlungen eine vorbeugende Behandlung gegen eine bakterielle Endokarditis. Vorname Name Geburtsdatum Herzfehler Penicillin-Allergie
Nosokomiale Infektionen
 Definitionen Nosokomiale Infektion Infektion, die bei Aufnahme ins Krankenhaus weder vorhanden noch in Inkubation war Healthcare-associated Infektionen werden nicht nur im Krankenhaus, sondern auch außerhalb
Definitionen Nosokomiale Infektion Infektion, die bei Aufnahme ins Krankenhaus weder vorhanden noch in Inkubation war Healthcare-associated Infektionen werden nicht nur im Krankenhaus, sondern auch außerhalb
6. Induktion der Galactosidase von Escherichia coli
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Institut für Mikrobiologie und Weinforschung FI-Übung: Identifizierung, Wachstum und Regulation (WS 2004/05) Sebastian Lux Datum: 19.1.2005 6. Induktion der Galactosidase
Helicobacter pylori Eradikation ambulant in der Praxis
 Aus dem Medizinischen Zentrum für Innere Medizin der Philipps-Universität Marburg Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. R. Arnold Abteilung Gastroenterologie Leiter: Prof. Dr. R. Arnold Helicobacter pylori
Aus dem Medizinischen Zentrum für Innere Medizin der Philipps-Universität Marburg Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. R. Arnold Abteilung Gastroenterologie Leiter: Prof. Dr. R. Arnold Helicobacter pylori
Characterization o f glioblastoma stem cells upon. triggering o f CD95
 Aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg Direktor (kommissarisch): Prof. Dr. rer. nat. Michael Boutros Abteilung für Molekulare Neurobiologie Abteilungsleiterin Prof. Dr. med. Ana Martin-Villalba
Aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg Direktor (kommissarisch): Prof. Dr. rer. nat. Michael Boutros Abteilung für Molekulare Neurobiologie Abteilungsleiterin Prof. Dr. med. Ana Martin-Villalba
Spezielle Pathologie des Atmungstraktes. Teil 8
 Spezielle Pathologie des Atmungstraktes Teil 8 Interstitielle Pneumonie: - es können drei verschiedene Formen der interstitiellen Pneumonie unterschieden werden: - akute interstitielle Pneumonie - entzündliche
Spezielle Pathologie des Atmungstraktes Teil 8 Interstitielle Pneumonie: - es können drei verschiedene Formen der interstitiellen Pneumonie unterschieden werden: - akute interstitielle Pneumonie - entzündliche
MRSA Schluss mit Mythen
 Stefan Borgmann MRSA Schluss mit Mythen Klinikum Ingolstadt Neue MRSA Antibiotika Name Wirkort Indikation Keine Indikation Nebenwirkungen Kontraindikation Dosierung Kosten / Tag Ceftarolin (Zinforo) (Teflaro)
Stefan Borgmann MRSA Schluss mit Mythen Klinikum Ingolstadt Neue MRSA Antibiotika Name Wirkort Indikation Keine Indikation Nebenwirkungen Kontraindikation Dosierung Kosten / Tag Ceftarolin (Zinforo) (Teflaro)
Vom multisensiblen Keim zur Resistenz
 Vom multisensiblen Keim zur Resistenz Dr. med. Béatrice Grabein Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Klinikum der Universität München Die Erdgeschichte als ein Tag betrachtet 5:00Uhr Geburtsstunde
Vom multisensiblen Keim zur Resistenz Dr. med. Béatrice Grabein Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene Klinikum der Universität München Die Erdgeschichte als ein Tag betrachtet 5:00Uhr Geburtsstunde
Herstellung und Charakterisierung von zellpermeablem Interferon-α des Waldmurmeltieres (Marmota monax)
 Aus der Abteilung Innere Medizin II der Medizinischen Universitätsklinik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Herstellung und Charakterisierung von zellpermeablem Interferon-α des Waldmurmeltieres
Aus der Abteilung Innere Medizin II der Medizinischen Universitätsklinik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Herstellung und Charakterisierung von zellpermeablem Interferon-α des Waldmurmeltieres
3.1 Virologische Laboratoriumsdiagnostik Proben zur Untersuchung auf Influenza... 29
 Inhaltsverzeichnis Einleitung........................................... XVII 1 Virologie........................................ 1 1.1 Typen und Subtypen................................ 1 1.2 Nomenklatur
Inhaltsverzeichnis Einleitung........................................... XVII 1 Virologie........................................ 1 1.1 Typen und Subtypen................................ 1 1.2 Nomenklatur
Rekombinante Antikorperfragmente fur die. Zoonosediagnostik
 Rekombinante Antikorperfragmente fur die Zoonosediagnostik Von der Fakultat fur Lebenswissenschaften der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades eines Doktors
Rekombinante Antikorperfragmente fur die Zoonosediagnostik Von der Fakultat fur Lebenswissenschaften der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades eines Doktors
Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01
 Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01 am 15.02.2001 von 15.30 17.00 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 40 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach unbedingt angeben (3 1.
Klausur zur Vorlesung Biochemie III im WS 2000/01 am 15.02.2001 von 15.30 17.00 Uhr (insgesamt 100 Punkte, mindestens 40 erforderlich) Bitte Name, Matrikelnummer und Studienfach unbedingt angeben (3 1.
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung
 Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
Traditionelle und innovative Impfstoffentwicklung Reingard.grabherr@boku.ac.at Traditionelle Impfstoffentwicklung Traditionelle Impfstoffentwicklung Louis Pasteur in his laboratory, painting by A. Edelfeldt
Vererbung. Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend
 Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
Vererbung Die durch Fortpflanzung entstandene Nachkommenschaft gleicht den Elternorganismen weitgehend Klassische Genetik Äußeres Erscheinungsbild: Phänotypus setzt sich aus einer Reihe von Merkmalen (Phänen))
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
Hochdurchsatz Generierung und Analyse von Arabidopsis thaliana-proteinen
 MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MOLEKULARE GENETIK Hochdurchsatz Generierung und Analyse von Arabidopsis thaliana-proteinen Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR MOLEKULARE GENETIK Hochdurchsatz Generierung und Analyse von Arabidopsis thaliana-proteinen Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie
15a. Antibiotika-Resistenz bei Staphylokokken
 Experiment 15 / Student report Laboratory to Biology III Diversity of Microorganisms / Wintersemester 2002/03 / page 1 15a. Antibiotika-Resistenz bei Staphylokokken VerfasserInnen: Betreuerin: Andrea Glaser,
Experiment 15 / Student report Laboratory to Biology III Diversity of Microorganisms / Wintersemester 2002/03 / page 1 15a. Antibiotika-Resistenz bei Staphylokokken VerfasserInnen: Betreuerin: Andrea Glaser,
Es brennt im Magen-Darm-Trakt Die Dyspepsie
 KHM Fortbildungstag Luzern Hauptreferat C / Seminar C1 Vol. 0 N o 0/2000 1.9.2000 Primary Primary 2001;1:317 321 Es brennt im Magen-Darm-Trakt Die Dyspepsie H. Opty Beschwerden des oberen Gastrointestinaltraktes
KHM Fortbildungstag Luzern Hauptreferat C / Seminar C1 Vol. 0 N o 0/2000 1.9.2000 Primary Primary 2001;1:317 321 Es brennt im Magen-Darm-Trakt Die Dyspepsie H. Opty Beschwerden des oberen Gastrointestinaltraktes
Expression der Flagellingene von Helicobacter pylori in unterschiedlichen bakteriellen Wirtsspezies
 Aus dem Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Abteilung für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie der Ruhr-Universität Bochum Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. med. S. Gatermann Expression
Aus dem Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Abteilung für Medizinische Mikrobiologie und Immunologie der Ruhr-Universität Bochum Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. med. S. Gatermann Expression
Klausur Mikrobiologie, Hygiene und Virologie SS (Humanmedizin, Universität zu Köln) Gedächtnisprotokoll Revision: v1.0 /
 Klausur Mikrobiologie, Hygiene und Virologie SS 2007 (Humanmedizin, Universität zu Köln) Gedächtnisprotokoll Revision: v1.0 / 13.07.2007 IK Studiengang: Anzahl: Format: Zeit: RSG und MSG 54 short-answer-
Klausur Mikrobiologie, Hygiene und Virologie SS 2007 (Humanmedizin, Universität zu Köln) Gedächtnisprotokoll Revision: v1.0 / 13.07.2007 IK Studiengang: Anzahl: Format: Zeit: RSG und MSG 54 short-answer-
Labordiagnostik bei Infektion
 Stefan Borgmann Labordiagnostik bei Infektion Klinikum Ingolstadt Labordiagnostik bei Infektionen 2 Serologische Marker - CRP - Prokalzitonin (PCT) Mikrobiologische Diagnostik - Direktkultur - Abstriche
Stefan Borgmann Labordiagnostik bei Infektion Klinikum Ingolstadt Labordiagnostik bei Infektionen 2 Serologische Marker - CRP - Prokalzitonin (PCT) Mikrobiologische Diagnostik - Direktkultur - Abstriche
8. Translation. Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen. Genetischer Code. Initiation - Elongation - Termination
 8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation - Elongation - Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse human bacteria
8. Translation Konzepte: Translation benötigt trnas und Ribosomen Genetischer Code Initiation - Elongation - Termination 1. Welche Typen von RNAs gibt es und welches sind ihre Funktionen? mouse human bacteria
ANTIBIOTIKATHERAPIE BEI IMPLANTATERHALTUNGSVERSUCH
 CAMPUS GROSSHADERN CAMPUS INNENSTADT ANTIBIOTIKATHERAPIE BEI IMPLANTATERHALTUNGSVERSUCH Dr. Béatrice Grabein Stabsstelle Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene WANN KOMMT EIN IMPLANTATERHALTUNGSVERSUCH
CAMPUS GROSSHADERN CAMPUS INNENSTADT ANTIBIOTIKATHERAPIE BEI IMPLANTATERHALTUNGSVERSUCH Dr. Béatrice Grabein Stabsstelle Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene WANN KOMMT EIN IMPLANTATERHALTUNGSVERSUCH
MODULE für den SCHULKOFFER GENTECHNIK
 MODULE für den SCHULKOFFER GENTECHNIK Modul 1 - DNA-Bastel-Set Zusammenbau eines Papiermodells in Form einer Doppelhelix sehr einfach, Unterstufe, ohne Koffer möglich Modul 2 - DNA-Isolierung aus Gemüse
MODULE für den SCHULKOFFER GENTECHNIK Modul 1 - DNA-Bastel-Set Zusammenbau eines Papiermodells in Form einer Doppelhelix sehr einfach, Unterstufe, ohne Koffer möglich Modul 2 - DNA-Isolierung aus Gemüse
Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen.
 Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5
 Prof. A. Sartori Medizin 1. Studienjahr Bachelor Molekulare Zellbiologie FS 2013 12. März 2013 Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5 5.1 Struktur der RNA 5.2 RNA-Synthese (Transkription)
Prof. A. Sartori Medizin 1. Studienjahr Bachelor Molekulare Zellbiologie FS 2013 12. März 2013 Expression der genetischen Information Skript: Kapitel 5 5.1 Struktur der RNA 5.2 RNA-Synthese (Transkription)
1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen:
 Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Übung 10 1. Welche Auswirkungen auf die Expression des lac-operons haben die folgenden Mutationen: a. Eine Mutation, die zur Expression eines Repressors führt, der nicht mehr an den Operator binden kann.
Bei Einbeziehung von neun Allelen in den Vergleich ergibt sich eine Mutation in 38 Generationen (350:9); das entspricht ca. 770 Jahren.
 336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
336 DNA Genealogie Das Muster genetischer Variationen im Erbgut einer Person - zu gleichen Teilen von Mutter und Vater ererbt - definiert seine genetische Identität unveränderlich. Neben seiner Identität
3.19 Non-Hodgkin-Lymphome
 140 Ergebnisse zur Non-Hodgkin-Lymphome 3.19 Non-Hodgkin-Lymphome Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Die altersstandardisierten Inzidenzraten von n und in Deutschland sind von 1980 bis zur Mitte der
140 Ergebnisse zur Non-Hodgkin-Lymphome 3.19 Non-Hodgkin-Lymphome Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: Die altersstandardisierten Inzidenzraten von n und in Deutschland sind von 1980 bis zur Mitte der
Gastrointestinale Erreger ein Update Helicobacter pylori
 Gastrointestinale Erreger ein Update Helicobacter pylori A. M. Hirschl Klinische Abteilung für Klinische Mikrobiologie Klinisches Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Medizinische Universität
Gastrointestinale Erreger ein Update Helicobacter pylori A. M. Hirschl Klinische Abteilung für Klinische Mikrobiologie Klinisches Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Medizinische Universität
Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen
 Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/verbesserte-basenpaarungbei-dna-analysen/ Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen Ein Team aus der Organischen
Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/verbesserte-basenpaarungbei-dna-analysen/ Verbesserte Basenpaarung bei DNA-Analysen Ein Team aus der Organischen
Antibiotikaresistenz: Carbapenemase-bildende Keime in Nutztierbeständen
 Antibiotikaresistenz: Carbapenemase-bildende Keime in Nutztierbeständen Aktualisierte Mitteilung Nr. 036/2016 des BfR vom 23.12.2016* Carbapeneme sind Antibiotika, die für die Behandlung von Menschen zugelassen
Antibiotikaresistenz: Carbapenemase-bildende Keime in Nutztierbeständen Aktualisierte Mitteilung Nr. 036/2016 des BfR vom 23.12.2016* Carbapeneme sind Antibiotika, die für die Behandlung von Menschen zugelassen
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS Enzymregulation. Marinja Niggemann, Denise Schäfer
 Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Praktikum Biochemie B.Sc. Water Science WS 2011 Enzymregulation Marinja Niggemann, Denise Schäfer Regulatorische Strategien 1. Allosterische Wechselwirkung 2. Proteolytische Aktivierung 3. Kovalente Modifikation
Der Vergleich des Barrett-Spektrums im klinischen Bereich und den Arztpraxen
 Der Vergleich des Barrett-Spektrums im klinischen Bereich und den Arztpraxen ein Vortrag von Afag Aslanova > Präsentation > Bilder 54 Der Vergleich des Barrett-Spektrums im klinischen Bereich und den Arztpraxen
Der Vergleich des Barrett-Spektrums im klinischen Bereich und den Arztpraxen ein Vortrag von Afag Aslanova > Präsentation > Bilder 54 Der Vergleich des Barrett-Spektrums im klinischen Bereich und den Arztpraxen
Psoriasin is a major Escherichia coli-cidal factor of the female genital tract
 Psoriasin is a major Escherichia coli-cidal factor of the female genital tract Mildner M, Stichenwirth M, Abtin A, Eckhart L, Sam C, Gläser R, Schröder JM, Gmeiner R, Mlitz V, Pammer J, Geusau A, Tschachler
Psoriasin is a major Escherichia coli-cidal factor of the female genital tract Mildner M, Stichenwirth M, Abtin A, Eckhart L, Sam C, Gläser R, Schröder JM, Gmeiner R, Mlitz V, Pammer J, Geusau A, Tschachler
Inhaltsverzeichnis. 1 Anatomie/Physiologie. 2 Beratung zum Krankheitsbild. Vorwort... V. Abkürzungsverzeichnis...
 VII Vorwort... V Abkürzungsverzeichnis... IV 1 Anatomie/Physiologie 1.1 Bakterien... 1 1.1.1 Aufbau... 1 1.1.2 Vermehrung... 3 1.1.3 Bakterienformen... 5 1.1.4 Gram-Färbung... 6 1.1.5 Apathogene und pathogene
VII Vorwort... V Abkürzungsverzeichnis... IV 1 Anatomie/Physiologie 1.1 Bakterien... 1 1.1.1 Aufbau... 1 1.1.2 Vermehrung... 3 1.1.3 Bakterienformen... 5 1.1.4 Gram-Färbung... 6 1.1.5 Apathogene und pathogene
Diagnostik von Infektionen. Professor Christian Ruef Institut für Infektiologie und Spitalhygiene
 Diagnostik von Infektionen Professor Christian Ruef Institut für Infektiologie und Spitalhygiene 1 Schwerpunkte Einleitung, Uebersicht Klinische Beispiele Sepsis Pneumonie auf der Intensivstation Ausblick
Diagnostik von Infektionen Professor Christian Ruef Institut für Infektiologie und Spitalhygiene 1 Schwerpunkte Einleitung, Uebersicht Klinische Beispiele Sepsis Pneumonie auf der Intensivstation Ausblick
Musterlösung - Übung 5 Vorlesung Bio-Engineering Sommersemester 2008
 Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
Aufgabe 1: Prinzipieller Ablauf der Proteinbiosynthese a) Erklären Sie folgende Begriffe möglichst in Ihren eigenen Worten (1 kurzer Satz): Gen Nukleotid RNA-Polymerase Promotor Codon Anti-Codon Stop-Codon
Integron und Integrase
 Integron und Integrase Ein Versuch zum Nachweis von Antibiotikaresistenzen. Ein NUGI-Projekt am Albert-Einstein-Gymnasium, Wiblingen These Der Einsatz von Antibiotika führt zu einer erhöhten Resistenzbildung
Integron und Integrase Ein Versuch zum Nachweis von Antibiotikaresistenzen. Ein NUGI-Projekt am Albert-Einstein-Gymnasium, Wiblingen These Der Einsatz von Antibiotika führt zu einer erhöhten Resistenzbildung
Textverständnis. Bearbeitungszeit im Originaltest für 24 Aufgaben: 60 Minuten (Hier für 6 Aufgaben: 15 Minuten)
 Textverständnis Bearbeitungszeit im Originaltest für 24 Aufgaben: 60 Minuten (Hier für 6 Aufgaben: 15 Minuten) Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial
Textverständnis Bearbeitungszeit im Originaltest für 24 Aufgaben: 60 Minuten (Hier für 6 Aufgaben: 15 Minuten) Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial
ESBL ESBL. Dies bedeutet eine Resistenz gegenüber Antibiotika! Übersicht. Übersicht. Was genau? Besiedlung / Infektion. Ursachen. Infektion.
 Besiedlung / Extended Spectrum Beta Lactamasen Zu deutsch: Diese Darmbakterien bilden von sich aus ein: extended spectrum = ein erweitertes Spektrum, einen erweiterten Bereich von Beta Lactamasen aus.
Besiedlung / Extended Spectrum Beta Lactamasen Zu deutsch: Diese Darmbakterien bilden von sich aus ein: extended spectrum = ein erweitertes Spektrum, einen erweiterten Bereich von Beta Lactamasen aus.
Infekte der (oberen) Atemwege. Husten Halsschmerzen Ohrenschmerzen NNH - Entzündung
 Infekte der (oberen) Atemwege Husten Halsschmerzen Ohrenschmerzen NNH - Entzündung häufig in der Hausarztpraxis häufigste Symptome: Husten Schnupfen Halsschmerzen Ohrenschmerzen virusbedingte Infektionen
Infekte der (oberen) Atemwege Husten Halsschmerzen Ohrenschmerzen NNH - Entzündung häufig in der Hausarztpraxis häufigste Symptome: Husten Schnupfen Halsschmerzen Ohrenschmerzen virusbedingte Infektionen
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium):
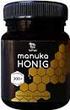 Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Zunehmende Gefahren durch resistente Bakterien in Deutschland: 7 Schritte zur Vermeidung unnötiger Antibiotikatherapie
 Zunehmende Gefahren durch resistente Bakterien in Deutschland: 7 Schritte zur Vermeidung unnötiger Antibiotikatherapie Prof. Mathias Herrmann Universitätskliniken des Saarlandes Homburg/Saar Mikrobielle
Zunehmende Gefahren durch resistente Bakterien in Deutschland: 7 Schritte zur Vermeidung unnötiger Antibiotikatherapie Prof. Mathias Herrmann Universitätskliniken des Saarlandes Homburg/Saar Mikrobielle
Taurin. Ursprung. Vorkommen
 Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Prävalenz bei ambulanten Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie nach Erreger
 Produktnummer: IF1250M Rev. I Leistungsmerkmale Nicht für den Vertrieb in den USA ERWARTETE WERTE Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie Zwei externe Prüfer untersuchten den Focus Chlamydia MIF IgM
Produktnummer: IF1250M Rev. I Leistungsmerkmale Nicht für den Vertrieb in den USA ERWARTETE WERTE Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie Zwei externe Prüfer untersuchten den Focus Chlamydia MIF IgM
Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll?
 Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll? Radiologisch-internistisches Forum 09.07.2008 C. Ott Enge Assoziation von Infektionen mit CED fragliche pathogenetische Bedeutung von M. paratuberculosis
Mikrobiologische Diagnostik- wann ist was sinnvoll? Radiologisch-internistisches Forum 09.07.2008 C. Ott Enge Assoziation von Infektionen mit CED fragliche pathogenetische Bedeutung von M. paratuberculosis
ESBL in Altenheimen: Ergebnisse einer LGL-Studie. Dr. Giuseppe Valenza
 ESBL in Altenheimen: Ergebnisse einer LGL-Studie Dr. Giuseppe Valenza MRE-Prävalenz Deutschland MRSA ESBL Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung 1,6-3,1% 1 6,3% (E. coli) 2 Prävalenz in Pflegeheim-Bewohnern
ESBL in Altenheimen: Ergebnisse einer LGL-Studie Dr. Giuseppe Valenza MRE-Prävalenz Deutschland MRSA ESBL Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung 1,6-3,1% 1 6,3% (E. coli) 2 Prävalenz in Pflegeheim-Bewohnern
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN
 RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
Molekularpathologische Untersuchungen aus Paraffinmaterial. OA Dr. Martina Hassmann Institut für Pathologie und Mikrobiologie LKH HORN
 Molekularpathologische Untersuchungen aus Paraffinmaterial OA Dr. Martina Hassmann Institut für Pathologie und Mikrobiologie LKH HORN PCR-Untersuchung aus Paraffinmaterial - Bei Tumoren: K-Ras-,EGFR-Mutation,
Molekularpathologische Untersuchungen aus Paraffinmaterial OA Dr. Martina Hassmann Institut für Pathologie und Mikrobiologie LKH HORN PCR-Untersuchung aus Paraffinmaterial - Bei Tumoren: K-Ras-,EGFR-Mutation,
